Untersuchungen zum Zelldifferentialbild in Milch und Blut unter. Berücksichtigung des Gesundheitsstatus der bovinen Milchdrüse
|
|
|
- Joseph Abel
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Aus dem Zentrum für Lebensmittelwissenschaften Zentrumsabteilung Hygiene und Technologie der Milch der Tierärztlichen Hochschule Hannover Untersuchungen zum Zelldifferentialbild in Milch und Blut unter Berücksichtigung des Gesundheitsstatus der bovinen Milchdrüse INAUGURAL-DISSERTATION zur Erlangung des Grades einer DOKTORIN DER VETERINÄRMEDIZIN (Dr. med. vet.) durch die Tierärztliche Hochschule Hannover Vorgelegt von Anke Schröder, geb. Heide aus Bonn Hannover 2003
2 Wissenschaftliche Betreuung: Univ.-Prof. Dr. Dr. Jörn Hamann 1. Gutachter: Univ.-Prof. Dr. Dr. Jörn Hamann 2. Gutachter: Univ.-Prof. Dr. Martina Hoedemaker, PhD. Tag der mündlichen Prüfung: 04. Juni 2003 Diese Arbeit wurde durch Mittel der Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH gefördert.
3 Meinen Eltern in Liebe und Dankbarkeit
4
5 Inhaltsverzeichnis INHALTSVERZEICHNIS 1. EINLEITUNG LITERATURÜBERSICHT Mastitisdiagnostik Zellgehalt in normaler und in Mastitismilch Physiologische Einflüsse auf den Zellgehalt der Milch Methoden zur Zellzählung Prescott und Breed Coulter Counter Fossomatic NAGase-Aktivität Elektrische Leitfähigkeit Mikroskopische Zelldifferenzierung Geschichte Methoden zur Herstellung von Milchausstrichen Kieler Sedimentausstrich Cytospin Zellmorphologie Allgemeines PMN Eosinophile Granulozyten Basophile Granulozyten Lymphozyten Monozyten Makrophagen Epithelzellen Zelldifferentialbild in Milch einer gesunden Milchdrüse Zelldifferentialbild in Milch einer erkrankten Milchdrüse Zelldifferentialbild des Blutes I
6 Inhaltsverzeichnis 2.3 Durchflußzytometrische Zelldifferenzierung Differenzierung aufgrund der Zellmorphologie Differenzierung mit Hilfe monoklonaler Antikörper Herstellung monoklonaler Antikörper Cluster of Differentiation Haupthistokompatibilitätskomplex II TCR WC CD CD CD14 (LPS-Rezeptor) Zelldifferentialbild einer gesunden Milchdrüse Phagozyten Lymphozyten Zelldifferentialbild einer erkrankten Milchdrüse Phagozyten Lymphoyzten Zelldifferentialbild des Blutes Phagozyten Lymphoyzten Zelluläre Abwehr der bovinen Milchdrüse Phagozytose Makrophagen PMN Lebenszyklus Migration Entzündung Lymphozyten T-Lymphozyten B-Lymphozyten Folgerung MATERIAL UND METHODEN Versuchstiere Betrieb II
7 Inhaltsverzeichnis Betrieb Versuchsreihen Versuch 1: Orientierende Untersuchung auf der Basis einer randomisierten Tierauswahl Versuch 2: Methodische Fragestellungen Versuch 3: Untersuchungen zum Zelldifferentialbild auf der Basis einer selektierten Tierauswahl Geräte Material Verbrauchsmaterialien Reagenzien Antikörper und Nachweisreagenzien Antikörper für den Einsatz in der Membranimmunfluoreszenz Monoklonale Primärantikörper Sekundärantikörper Kulturmedien, Puffer und Lösungen Lösungen für die Zellanalytik Phosphat-gepufferte Kochsalzlösung (PBS) Wasch- und Verdünnungspuffer für die Membranimmunfluoreszenz (MIF-Puffer) Lösungen für die Durchflußzytometrie Trägerflüssigkeit (Sheath fluid) Propidiumiodidlösung To-Pro-3-Lösung Acridinorange-Lösung Färbelösungen für die Mikroskopie Hemacolor Toluidinblaulösung Fixationslösung für Rohmilch Probenahme Blut Milch Vorgemelk Viertelanfangsgemelk (VAG) Viertelhandgemelk (VGH) Versuch 1: Orientierende Untersuchung auf der Basis einer randomisierten Tierauswahl Versuch 2: Methodische Fragestellungen III
8 Inhaltsverzeichnis Versuch 3: Untersuchungen zum Zelldifferentialbild auf der Basis einer selektierten Tierauswahl Probenanalyse Blut Klinische Labordiagnostik Leukozytenseparation Bestimmung und Einstellung der Zellkonzentration in der Zellsuspension Milch Mastitisdiagnostik Mikrobiologische Untersuchung Messung der NAGase - Aktivität Bestimmung des Zellgehaltes im VAG Bestimmung des Zellgehaltes im VGH Kieler Sedimentausstrich Separation der somatischen Milchzellen Versuch 1: Orientierende Untersuchung auf der Basis einer randomisierten Tierauswahl Versuch 2: Methodische Fragestellungen Versuch 3: Untersuchungen zum Zelldifferentialbild auf der Basis einer selektierten Tierauswahl Bestimmung und Einstellung der Zellkonzentration in der Zellsuspension Ausstriche der ZSM ( Kaffeemühle ) Durchflußzytometrische Analysen Durchflußzytometrie Durchflußzytometrische Beurteilung der Zellvitalität Prinzip Probenvorbereitung und Messung Auswertung Membranimmunfluoreszenz Prinzip Durchführung Auswertung Datengruppierung und Statistik Versuch 1: Orientierende Untersuchung auf der Basis einer randomisierten Tierauswahl Datengruppierung Statistik Versuch 2: Methodische Fragestellungen Einfluß von Probenahmegefäß und Untersucher auf das mikroskopische Zelldifferentialbild IV
9 Inhaltsverzeichnis Einfluss von Probenahmegefäß und Antikörper auf das durchflußzytometrische Zelldifferentialbild Vergleich von Kieler Sedimentausstrich und Ausstrich der Zellsuspension Überprüfung der Wiederholbarkeit verschiedener Parameter Versuch 3: Untersuchungen zum Zelldifferentialbild auf der Basis einer selektierten Tierauswahl ERGEBNISSE Versuch 1: Orientierende Untersuchung auf der Basis einer randomisierten Tierauswahl Selektierte Kriterien der Eutergesundheit Mikroskopisches Zelldifferentialbild Durchflußzytometrische Parameter Versuch 2: Methodische Fragestellungen Einfluß des Probenahmegefäßes und des Untersuchers auf das mikroskopische Zelldifferentialbild Einfluß des Probenahmegefäßes Einfluß des Untersuchers Einfluß des Probenahmegefäßes und des Antikörpers auf das durchflußzytometrische Zelldifferentialbild Einfluß des Probenahmegefäßes Einfluß des Antikörpers Vergleich von Kieler Sedimentausstrich und Ausstrich der Zellsuspension mit der Kaffeemühle Untersuchungen zur Wiederholbarkeit der mikroskopischen und durchflußzytometrischen Zelldifferenzierung Wiederholbarkeit der Milchzelldifferenzierung Wiederholbarkeit der Blutzelldifferenzierung Versuch 3: Untersuchungen zum Zelldifferentialbild auf der Basis einer selektierten Tierauswahl Selektierte Kriterien der Eutergesundheit Mikroskopisches Zelldifferentialbild in Milch Mikroskopisches Zelldifferentialbild des Blutes Durchflußzytometrische Parameter der Milchzellsuspension Durchflußzytometrische Parameter der Blutzellsuspension V
10 Inhaltsverzeichnis 5. DISKUSSION Versuch 1: Orientierende Untersuchungen auf der Basis einer randomisierten Tierauswahl Selektierte Kriterien der Eutergesundheit Mikroskopisches Zelldifferentialbild Durchflußzytometrische Parameter Zellvitalität CD4 und CD WC MHC II Folgerungen zu Versuch Versuch 2: Methodische Fragestellungen Einfluß des Probenahmegefäßes und des Untersuchers auf das mikroskopische Zelldifferentialbild Einfluß des Probenahmegefäßes Einfluß des Untersuchers Einfluß des Probenahmegefäßes und des Antikörpers auf das durchflußzytometrische Zelldifferentialbild Einfluß des Probenahmegefäßes Einfluß des Antikörpers Vergleich von Kieler Sedimentausstrich und Ausstrich der Zellsuspension mit der Kaffeemühle Untersuchungen zur Wiederholbarkeit der mikroskopischen und durchflußzytometrischen Zelldifferenzierung Folgerungen zu Versuch Versuch 3: Untersuchungen zum Zelldifferentialbild auf der Basis einer selektierten Tierauswahl Selektierte Kriterien der Eutergesundheit Mikroskopisches Zelldifferentialbild in Milch Mikroskopisches Zelldifferentialbild des Blutes Durchflußzytometrische Parameter der Milchzellsuspension Zellvitalität CD4 und CD TCR VI
11 Inhaltsverzeichnis Bo MHC II CD14 (LPS-Rezeptor) Durchflußzytometrische Parameter der Blutzellsuspension Zellvitalität CD4 und CD TCR Bo MHC II CD14 (LPS-Rezeptor) Folgerungen zu Versuch ZUSAMMENFASSUNG SUMMARY RESUME LITERATURVERZEICHNIS EPILOG VII
12 Tabellen TABELLEN Tab. 1: Zellmorphologie von Milchzellen Tab. 2: Zelldifferentialbild in Milch einer gesunden Milchdrüse Tab. 3: Größe der CD4 + und CD8 + Lymphozytensubpopulationen in Blut und Milch Tab. 4: Durchflußzytometrisches Zelldifferentialbild der Phagozyten in Blut und Milch vor und nach einer intrazisternalen LPS-Injektion (PAAPE et al. 1996) Tab. 5: Verwendete monoklonale Antikörper zur Charakterisierung von zellulären Oberflächenstrukturen in der Membranimmunfluoreszenz Tab. 6: Klinische Laborparameter zur Beurteilung der Allgemeingesundheit Tab. 7: Histogramm Statistik zu FL3-H Tab. 8: Quadranten Statistik für die Auswertung der MIF Tab. 9: Gruppierung der Daten in Versuch Tab. 10: Gruppierung der Daten für den Vergleich der Ausstricharten KSA und ZSM, für die Untersuchung zur Wiederholbarkeit und für Versuch Tab. 11: Stichprobengröße n Viertel, Mittelwert X und Standardabweichung sd der selektierten Kriterien der Eutergesundheit in Versuch Tab. 12: Signifikanzen (p-werte) der selektierten Kriterien der Eutergesundheit zwischen den Gruppen in Versuch Tab. 13: Korrelationskoeffizienten der selektierten Kriterien der Eutergesundheit mit SCC VAG Tab. 14: Signifikanzen für die einzelnen Zellarten zwischen den Gruppen Tab. 15: Korrelationskoeffizienten der einzelnen Zellarten mit SCC VAG Tab. 16: Stichprobengröße n Viertel, Mittelwert X und Standardabweichung sd der durchflußzytometrischen Parameter der ZSM in Versuch Tab. 17a: Signifikanzen für die durchflußzytometrischen Parameter zwischen den Gruppen Tab. 17b: Signifikanzen für die durchflußzytometrischen Parameter zwischen den Gruppen Tab. 18a: Korrelationskoeffizienten der durchflußzytometrischen Parameter mit SCC VAG Tab. 18b: Korrelationskoeffizienten der durchflußzytometrischen Parameter mit SCC VAG VIII
13 Tabellen Tab. 19: Ergebnisse der mikroskopischen Zelldifferenzierung in Versuch 2: Einfluß von Probenahmegefäß und Untersucher Tab. 20: Signifikanzen des Gefäßvergleichs getrennt nach Untersucher Tab. 21: Signifikanzen des Untersuchervergleiches Tab. 22: Ergebnisse der durchflußzytometrischen Zelldifferenzierung in Versuch 2: Einfluß von Probenahmegefäß und Antikörper Tab. 23: Zelldifferentialbild getrennt nach Gruppen, Methode KSA Tab. 24: Zelldifferentialbild getrennt nach Gruppen, Methode Kaffeemühle Tab. 25: Signifikanzen des Vergleichs der Ausstrichmethoden, getrennt nach Zellart und Eutergesundheitsstatus Tab. 26: Mittelwert X und Standardabweichung sd der Differenz KSA - ZSM Tab. 27: Signifikanzen für die einzelnen Zellarten und Methoden zwischen den Gruppen Tab. 28a: Ergebnisse zur Wiederholbarkeit der mikroskopischen und durchflußzytometrischen Milchzelldifferenzierung Tab. 28b: Ergebnisse zur Wiederholbarkeit der mikroskopischen und durchflußzytometrischen Milchzelldifferenzierung Tab. 28c: Ergebnisse zur Wiederholbarkeit der mikroskopischen und durchflußzytometrischen Milchzelldifferenzierung Tab. 29a: Ergebnisse zur Wiederholbarkeit der mikroskopischen und durchflußzytometrischen Blutzelldifferenzierung Tab. 29b: Ergebnisse zur Wiederholbarkeit der mikroskopischen und durchflußzytometrischen Blutzelldifferenzierung Tab. 30: Selektierte Kriterien der Eutergesundheit in Versuch 3, Gruppen A, B1 und C Tab. 31: Korrelationskoeffizienten der selektierten Kriterien der Eutergesundheit mit SCC VAG in Versuch Tab. 32: Signifikanzen (p-werte) der Zellarten zwischen den Gruppen in Versuch Tab. 33: Korrelationskoeffizienten der einzelnen Zellarten mit SCC VAG Tab. 34a: Durchflußzytometrisches Zelldifferentialbild in Versuch 3, Gruppen A, B1 und C Tab. 34b: Durchflußzytometrisches Zelldifferentialbild in Versuch 3, Gruppen B2, C2 und C Tab. 35a: Signifikanzen für die durchflußzytometrischen Parameter zwischen den Gruppen in Versuch IX
14 Tabellen Tab. 35b: Signifikanzen für die durchflußzytometrischen Parameter zwischen den Gruppen in Versuch Tab. 36a: Korrelationskoeffizienten für die durchflußzytometrischen Parameter in Versuch Tab. 36b: Korrelationskoeffizienten für die durchflußzytometrischen Parameter in Versuch Tab. 36c: Korrelationskoeffizienten für die durchflußzytometrischen Parameter in Versuch Tab. 37: Durchflußzytometrische Parameter der Blutzellsuspension in Versuch Tab. 38a: Signifikanzen für die durchflußzytometrischen Parameter des Blutes zwischen den Gruppen in Versuch Tab. 38b: Signifikanzen für die durchflußzytometrischen Parameter des Blutes zwischen den Gruppen in Versuch Tab. 39: Vorkommen von γδ-t-zellen in Milch Tab. 40: Prozentuale Verteilung der Zellen in verschiedenen durch Zentrifugation gewonnenen Milchfraktionen nach DILBAT Tab. 41: Vergleichende Gegenüberstellung von Milchparametern in gesunden (Referenz A, n = 50) und an Mastitis erkrankten Vierteln (n = 68) unter der Berücksichtigung der Analytik auf der Basis einer Signifikanz von mind. p < 0, X
15 Abbildungen ABBILDUNGEN Abb. 1: Untersuchungsschritte für VAG und VGH Abb. 2: Auswertung der Vitalitätsmessung Abb. 3: Auswertung der MIF am Beispiel der Lymphozyten Abb. 4: Zelldifferentialbild unter Berücksichtigung der Eutergesundheit in Versuch Abb. 5: Milchzellausstriche A - H, mikroskopiert bei 1000 facher Vergrößerung in Ölimmersion... 81/82 Abb. 6: KSA Zelldifferentialbild unter Berücksichtigung der Eutergesundheit Abb. 7: ZSM ( Kaffeemühle ) Zelldifferentialbild unter Berücksichtigung der Eutergesundheit Abb. 8: Zelldifferentialbild der Milch unter Berücksichtigung der Eutergesundheit in Versuch Abb. 9: Zelldifferentialbild im Blut unter Berücksichtigung der Eutergesundheit in Versuch Abb. 10: Veränderungen der prozentualen Bindungsrate von CD4 und Bo116 an Milchzellen unter Berücksichtigung der Eutergesundheit XI
16 Abkürzungen und Termini technici ABKÜRZUNGEN UND TERMINI TECHNICI AO Akridinorange Aqua (mono)dest. Aqua (mono)destillata (einfach destilliertes Wasser) Aqua tridest. Aqua tridestillata (dreifach destilliertes Wasser) BASO B Basophile Granulozyten Blut Bo116, Bo139 Bezeichnung für subklonierte Hybridome und die von ihnen produzierten monoklonalen Antikörper C Complement (Komplement) CD Cluster of Differentiation DNS Desoxyribonukleinsäure DVG Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft EOS B Eosinophile Granulozyten Blut EPI Epithelzellen ER Eppendorf Reaktionsgefäß EV Events (Messereignisse) FITC Fluoresceinisothiocyanat FL 1-4 Detektoren des Durchflußzytometers FR FACS Röhrchen FSC Forward Scatter (Vorwärtsstreulicht) G-CSF Granulocyte-Colonystimulating factor (Granulozytenkolonie-stimulierender Faktor) hgr. hochgradig IDF International Dairy Federation Ig Immunglobulin IL Interleukin k Korrelationskoeffizient KSA Kieler Sedimentausstrich LF elektrische Leitfähigkeit LOG Logarithmus zur Basis 10 LPS Lipopolysaccharid LYM (B) Lymphozyten (Blut) XII
17 Abkürzungen und Termini technici MAK Makrophagen mak monoklonaler Antikörper mgr. mittelgradig MHC Major Histocompatibility Complex (Haupthistokompatibilitätskomplex) MIF Membranimmunfluoreszenz min Minute MNC Mononuclear Cells (mononukleäre Zellen) MONO B Monozyten Blut ms Milli-Siemens MT Mikrotiterplatte n Stichprobengröße NAG(ase) N-Acetyl-ß-D-Glucosaminidase NK Natural Killer Zellen ns nicht signifikant OL Oben links OR Oben rechts PBS Phosphate Buffered Saline (Phosphatgepufferte Kochsalzlösung) PE Phycoerythrin PE Cy5 Phycoerythrin Cytochrom 5 PI Propidiumiodit PMN (B) Polymorphkernige Neutrophile Granzulozyten (Blut) s signifikant SCC Somatic Cell Count (Somatische Zellzahl = Zellgehalt) sd Standardabweichung SSC Side Scatter (Seitwärtsstreulicht) Tab. Tabelle TCR T-Zellrezeptor (T-Cell-Receptor) TMR Total Mixed Ration TNF Tumor Nekrose Faktor TSB Tryptic Soy Broth (Tryptische Soja Boullion) UL Unten links UR Unten rechts XIII
18 Abkürzungen und Termini technici US Untersucher UV Ultraviolett VAG Viertelanfangsgemelk VGH Viertelhandgemelk VIT Vitalität WC Workshop Cluster X Mittelwert, arithmetisch xg Vielfaches der Erdbeschleunigung Xm Mittlere Fluoreszenzintensität ZSB Zellsuspension Blut ZSM Zellsuspension Milch % prozentuale Bindungsrate (Durchflußzytometrie) + - positiv = Antigen auf der Zelloberfläche nachgewiesen negativ = Antigen auf der Zelloberfläche nicht nachgewiesen XIV
19 Einleitung 1. EINLEITUNG Der Zellgehalt der Milch ist ein wichtiges, wenn nicht das wichtigste Kriterium der Mastitisdiagnostik. Auch ist seit langem bekannt, daß sich durch eine Mastitis nicht nur die Zahl der Zellen in der Milch erhöht, sondern auch das Verhältnis der einzelnen Zellarten zueinander verändert wird. Vielfach wird der Zelldifferenzierung sogar eine größere Aussagefähigkeit als der Zellzählung zugebilligt. Für den Routineeinsatz ist das bisherige mikroskopische Differenzierungsverfahren jedoch zu zeitaufwendig und fehlerbehaftet, wie aus den bisher hierzu veröffentlichten Daten hervorgeht. Automatisierte Verfahren der Zelldifferenzierung auf der Basis der Impedanzmessung, die vor allem auf die Bestimmung des Anteils der PMN ausgerichtet waren, haben sich nicht durchsetzen können. Eine weitere Möglichkeit für die Zelldifferenzierung stellt die Durchflußzytometrie dar. Das bisher veröffentlichte Datenmaterial erlaubt keine Bewertung ihrer Eignung zur Differenzierung von Milch- oder Blutzellen und der Aussagekraft der so ermittelten Zelldifferentialbilder bezüglich der Eutergesundheit. Die Durchflußzytometrie in Kombination mit der Membranimmunfluoreszenz hat sich in der Humanmedizin in den letzten Jahren als Verfahren in der Routinediagnostik etabliert. Sie ist in der Diagnostik von Immunschwächeerkrankungen sowie von Tumoren der Immunhistologie, die mikroskopisch ausgewertet wird, überlegen, da sie eine weitgehend untersucherunabhängige, schnellere und genauere Beurteilung des Untersuchungsmaterials ermöglicht. Ihr Einsatz beschränkt sich nicht nur auf aus Blut gewonnene Zellsuspensionen, sondern es können auch andere Proben, wie z.b. Bronchoalveolarlavagen untersucht werden. In der Veterinärmedizin findet diese Technik hauptsächlich im Rahmen der Forschung auf dem Arbeitsgebiet der Kleintiermedizin seit einiger Zeit auch in der Diagnostik Anwendung. Im Bereich der Milchkunde wird die Durchflußzytometrie zur Zählung der Zellen in der Milch eingesetzt. 1
20 Einleitung Vor diesem Hintergrund wurde mir im Rahmen der Mitarbeit in der Arbeitsgruppe Mastitisfrüherkennung der Zentrumsabteilung Hygiene und Technologie der Milch die Aufgabe übertragen, das Zelldifferentialbild in Milch und Blut unter Berücksichtigung der Eutergesundheit zu ermitteln, wobei neben mikroskopischen Verfahren die Durchflußzytometrie unter Einschluß der Membranimmunfluoreszenz Verwendung finden sollte. Diese Fragestellung beinhaltet nicht nur einen hohen wissenschaftlichen Anspruch, sondern könnte zu einer Verbesserung der Mastitisdiagnostik unter Feldbedingungen beitragen. Diese praxisorientierte Feststellung ist insbesondere vor dem Hindergrund der häufig nicht befriedigenden Heilungsquoten nach Einsatz medikamentöser Behandlung hervorzuheben. Für die analytische Auseinandersetzung mit der gewählten Thematik sollten mikroskopische und durchflußzytometrische Techniken für die Substrate Milch und Blut miteinander verglichen werden. 2
21 Literaturübersicht 2. LITERATURÜBERSICHT 2.1 Mastitisdiagnostik Zur sicheren Diagnose erkrankter Milchdrüsen sollten immer mindestens zwei Kriterien (Erreger- und Entzündungsnachweis) herangezogen werden. Die DVG (1994) empfiehlt, den Gehalt somatischer Zellen im Viertelanfangsgemelk mit dem Nachweis mikrobiologischer Erreger zu kombinieren. Nach GRABOWSKI (2000) sind u.a. die Parameter elektrische Leitfähigkeit, somatische Zellen und N-Acetyl-ß-D-Glucosaminidase für die Erkennung von Eutererkrankungen geeignet. Die zytomikrobiologische Untersuchung wurde kürzlich von der DVG (2000) ausführlich beschrieben Zellgehalt in normaler und in Mastitismilch Die Zählung der somatischen Zellen in der Milch wird als verläßliche und spezifische Methode zur Mastitisdiagnostik angesehen (KITCHEN 1981, TOLLE 1970) bis Zellen pro ml Milch werden als der normale physiologische Zellgehalt von Milch aus gesunden Drüsenkomplexen mit einem oberen Grenzwert von Zellen pro ml Milch bezeichnet (DOGGWEILER u. HESS 1983, HAMANN u. REICHMUTH 1990, HAMANN 1992, SMITH 1996, DVG 2002). Oberhalb eines Zellgehaltes von mehr als Zellen pro ml ändert sich die chemische Milchzusammensetzung und die Milchleistung der Kuh nimmt ab (TOLLE 1970, WOOLFORD 1985, SHOSHANI u. MERMAN 1977, KNIGHT u. PEAKER 1991). Bakteriologisch positive Milchproben aus entzündeten Milchdrüsen enthalten einen signifikant erhöhten Zellgehalt von bis zu mehreren Millionen Zellen/ml Milch (BLACKBURN 1968, PAAPE et al. 1979, KEHRLI u. SHUSTER 1994, SMITH 1996, LABOHM et al. 1998). 3
22 Literaturübersicht Physiologische Einflüsse auf den Zellgehalt der Milch Zu Laktationsbeginn und ende sowie mit zunehmender Laktationsnummer kann ein erhöhter Zellgehalt beobachtet werden (BLACKBURN 1968, LABOHM et al. 1998). Nach der Kolostralphase gibt es jedoch keine physiologische Erhöhung der Zellzahl, vielmehr treten mit fortschreitender Laktation und steigender Laktationsanzahl vermehrt Mastitiden auf, die zu einer Zellzahlerhöhung führen (REICHMUTH 1975, DOGGWEILER u. HESS 1983, SMITH 1996). Auch die Rasse hat einen signifikanten Einfluß auf den Zellgehalt der Milch. Die Schwankungsbreite gesunder Drüsenkomplexe ist aber mit < Zellen/ml Milch so gering, daß sie bei der Diagnostik für praktische Belange außer acht gelassen werden kann (DOGGWEILER u. HESS 1983). Streß in Form von Weideaustrieb, Impfung oder Brunst führt nur dann zu einer Erhöhung des Gehalts somatischer Zellen in der Milch, wenn die Milchdrüse bereits vorgeschädigt ist (HAMANN u. REICHMUTH 1990, HAMANN 1992). Zur Beurteilung der Zellgehaltes spielt auch die Gemelksfraktion eine gewisse Rolle. Innerhalb eines Melkvorganges sind das Anfangs- und das Endgemelk zellreicher als das Hauptgemelk (PAAPE u. TUCKER 1966, ÖSTENSSON et al. 1988, HAMANN u. GYODI 1999) Methoden zur Zellzählung Prescott und Breed Die Methode von Prescott und Breed aus dem Jahr 1910 wird als Referenzmethode angesehen. Es werden 0,01 ml Milch auf 1 cm 2 ausgestrichen, fixiert, entfettet und mit Methylenblau gefärbt. Anschließend werden mindestens 400 Zellen mikroskopisch gezählt. Mit Hilfe der Anzahl der ausgezählten Felder wird der Zellgehalt pro ml errechnet. Diese Methode ist sehr arbeitsaufwendig und mit vielen 4
23 Literaturübersicht Fehlerquellen behaftet. Die Verteilung der Zellen auf dem Objektträger ist meistens nicht homogen, und zur Ermittlung des Zellgehaltes pro ml muß mit einem relativ großen Faktor multipliziert werden. Zudem ist die Entscheidung, ob ein gefärbtes Objekt eine Zelle ist, subjektiv (TOLLE et al. 1971, HEESCHEN 1975, IDF 1984, KITCHEN 1981) Coulter Counter Die erste Automatisierung der Milchzellzählung erfolgte mit dem Coulter Counter, der mit dem Prinzip der Impedanzmessung arbeitet. Nach Fixierung der Zellen mit Formalin wird die Milch mit einem Detergenz verdünnt, so daß unter Hitzeeinwirkung die Fettmicellen zerstört werden. Die Zellen werden anschließend einzeln zwischen zwei Elektroden hindurchgeleitet. Die Zellen verdrängen dort eine hochleitende Flüssigkeit und vergrößern dadurch den elektrischen Widerstand. Es entstehen Spannungsimpulse in Abhängigkeit von der Partikelgröße. Die Anzahl der Impulse gibt die Anzahl der Partikel wieder, die die Elektroden passiert haben (TOLLE et al. 1968, HEESCHEN 1975, IDF 1984). Auch einige Blutanalysengeräte messen nach diesem Prinzip die Anzahl von Leukozyten, Erythrozyten und Thrombozyten im Blut Fossomatic Dieses Verfahren beruht auf der Zählung fluoreszierender Partikel. Die Milchprobe wird dazu mit einem Puffer und einer Färbelösung vermischt. Als Farbstoff wird Ethidiumbromid eingesetzt, das die DNS der Zellen anfärbt und unter UV- oder Laseranregung fluoresziert. Ursprünglich wurde die Probe auf eine rotierende Scheibe aufgesprüht und vollautomatisch mikroskopisch ausgewertet. Die neueren Geräte arbeiten heute nach dem Prinzip der Durchflußzytometrie. Beiden Verfahren ist gemeinsam, daß jedes fluoreszierende Partikel in einen elektrischen Impuls umgewandelt wird, der nach Verstärkung registriert werden kann. Der Zellgehalt wird 5
24 Literaturübersicht vom Gerät in Tausend pro ml angegeben (HEESCHEN 1975, IDF 1984, HEESCHEN et al. 1993, UBBEN et al. 1997) NAGase-Aktivität N-Acetyl-ß-D-Glucosaminidase (NAGase) ist ein intra- und extrazellulär wirksames lysosomales Enzym, für das eine gesteigerte Aktivität im Rahmen der Infektionsabwehr, u.a. im Zusammenhang mit Mastitiden, nachgewiesen wurde (SANDHOLM u. MATTILA 1985, SCHÜTTEL 1999, GRABOWSKI 2000). Als Hauptquelle in der Milch gelten vor allem Makrophagen, aber auch PMN. Die Aktivität des Enzyms im Substrat Milch kann im Falle einer Mastitis um das Zehnfache ansteigen und korreliert relativ eng mit der Zellzahl. Sie ist daher auch als Kriterium für das frühzeitige Erkennen einer subklinischen Mastitis geeignet und hier der Zellzahl evtl. sogar überlegen. Zumindest kann ihre Aussagefähigkeit in der Mastitisdiagnostik mit derjenigen der Zellzahl gleichgestellt werden (SCHULTZE 1985, HAMANN et al. 1999). Ein weiterer Vorteil dieses empfindlichen Indikators der Eutergesundheit ist, daß er nicht von Allgemeinerkrankungen beeinflußt wird (KRÖMKER et al. 1999). Die Aktivitätsmessung erfolgt nach dem fluoreszenzoptischen Prinzip im Mikrotiterplattenverfahren. Die Aktivität wird zunächst in nmol x min 1 x ml 1 angegeben. Da die Werte ähnlich wie die Zellzahl nicht normalverteilt sind, werden sie für statistische Berechnungen logarithmiert (NOGAI et al. 1996, SCHÜTTEL 1999) Elektrische Leitfähigkeit Die elektrische Leitfähigkeit der Milch wird bestimmt durch die Konzentration und Beweglichkeit der dissoziierten Ionen (vor allem Chlorid-, Kalium- und Natrium-Ionen) in der Milch. Im physiologischen Gleichgewicht ist die Kaliumionenkonzentration in 6
25 Literaturübersicht der Milch höher als im Blut, während es sich für Natrium- und Chloridionen umgekehrt verhält. Dieses Konzentrationsgefälle wird von der Blut/Euterschranke aufrechterhalten. Wird diese durch eine Euterentzündung geschädigt, so erhöht sich ihre Permeabilität, wodurch es zum Einstrom von Natrium- und Chloridionen in die Milch kommt (SCHULTZE 1985, HAMANN 1999). Schon unter physiologischen Bedingungen wird die elektrische Leitfähigkeit maßgeblich von vielen Faktoren beeinflußt, darunter Laktationsstadium, Rasse und Melkintervall. Auch der Fettgehalt der Milch spielt eine Rolle, da die Fettmicellen die Ionenbeweglichkeit herabsetzen. Eine umfassende Literaturstudie zur Eignung der elektrischen Leitfähigkeit für die Mastitisdiagnostik wurde 1998 von HAMANN und ZECCONI veröffentlicht (IDF-Bulletin Nr. 334). Die elektrische Leitfähigkeit ist zwar prinzipiell als Parameter für die Erkennung von Eutererkrankungen geeignet, und oberhalb eines Grenzwertes von 6,5 ms/cm besteht nur noch ein geringes Risiko für falsch positive Befunde. Aufgrund ihrer hohen physiologischen Variabilität ist ihre diagnostische Aussagefähigkeit jedoch als gering einzuschätzen. Die elektrische Leitfähigkeit sollte daher nur in Kombination mit weiteren Parametern zur Mastitisdiagnostik eingesetzt werden (HAMANN 1999, GRABOWSKI 2000, HAMANN u. ZECCONI 1998). Eine weitere Möglichkeit der Bewertung dieses Parameters ist der Vergleich innerhalb der Euterviertel, da der Wahrscheinlichkeit nach eine intramammäre Infektion die einzige Einflußgröße ist, die nur ein einzelnes Viertel befällt (SCHULTZE 1985). Die elektrische Leitfähigkeit kann einerseits mit Handgeräten als sogenannter Cow side test, andererseits auch automatisch durch fest in die Melkeinheit integrierte Sensoren gemessen werden (SCHULTZE 1985). In automatischen Melksystemen wird diese Möglichkeit zur automatischen Überwachung der Eutergesundheit eingesetzt. 7
26 Literaturübersicht 2.2 Mikroskopische Zelldifferenzierung Geschichte Die Differenzierung von somatischen Milchzellen wird seit fast 100 Jahren durchgeführt. Bis 1926 wurden keine prozentualen Verteilungen angegeben. Die Unterscheidung erfolgte zwischen Leukozyten (heute PMN), Lymphozyten, Makrophagen und Epithelzellen. Dabei ist zu beachten, daß sich die Bedeutung des Begriffs Leukozyten gewandelt hat: Heute bezeichnet er nicht mehr die Zellart der neutrophilen Granulozyten oder PMN, sondern ist eine Sammelbezeichnung für alle Abwehrzellen. Bis 1947 wurden fast alle großen Zellen den Makrophagen bzw. Histiozyten zugerechnet, anschließend wurden sie fast ausschließlich als Epithelzellen eingeordnet. Seit 1977 werden aufgrund elektronenmikroskopischer Untersuchungen die mononukleären Zellen der Milch mit einer Größe von 8 30 µm als Makrophagen identifiziert (MIELKE u. KOBLENZ 1980, LEE et al. 1980, PAAPE et al. 1981). Auch der Anteil der PMN in normaler Milch schwankt in den Untersuchungen zwischen 1 % und 58 %, wobei normale Milch nicht genau definiert ist. Seit 1932 wurde bei der differenzierten Betrachtung der Milchzellen ein Unterschied in der Zusammensetzung zwischen normaler und Mastitismilch festgestellt, der sich in einem höheren Anteil PMN in Mastitismilch ausdrückt (MIELKE u. KOBLENZ 1980). Bei der Betrachtung derartiger Zahlen sollten aber die Schwankungen in der Definition normaler Milch bedacht werden. Der Grenzwert für die Anzahl somatischer Zellen in Milch aus gesunden Milchdrüsen, der seit 1970 mit Zellen pro ml definiert ist (TOLLE et al. 1971, DOGGWEILER u. HESS 1983, DVG 1994), wird bis heute in vielen Untersuchungen nicht berücksichtigt. Häufig wird auch Milch mit einer Zellzahl größer Zellen pro ml als normal definiert (BLACKBURN 1968, LEE et al. 1980, MIELKE u. KOBLENZ 1980, KITCHEN 1981, KURZHALS et al. 1985, CONCHA 1986, PARK et al. 1992, LEITNER et al. 1995, LEUTENEGGER et al. 2000, SURIYASATHAPORN et al. 2000), oder es wird keine Definition der verwendeten Milch angegeben (LEE et al. 1980, HAGELTORN u. SAAD 1986, PAAPE et al. 1996) 8
27 Literaturübersicht Methoden zur Herstellung von Milchausstrichen Das Ziel der unter beschriebenen Methode von PRESCOTT und BREED aus dem Jahr 1910, die auf dem direkten Ausstrich der Milch beruht, ist die reine Zellzählung. Für die Zelldifferenzierung wird zunächst durch Zentrifugation das zellreiche Sediment der Milch gewonnen und dann mit unterschiedlichen Techniken auf den Objektträger aufgebracht Kieler Sedimentausstrich Dieses Ausstrichverfahren geht auf SELEMANN et al. (1936) zurück. Nach der ursprünglichen Methode wird die Milch zunächst auf 85 C erhitzt, dann für zehn Minuten zentrifugiert und der Überstand verworfen. Das Sediment wird mit einer Öse auf einer Fläche von 3 cm 2 ausgestrichen und nach Lufttrocknung für ca. 5 Sekunden mit Toluidinblau oder für ca. 10 Minuten mit Methylenblau gefärbt. In späteren Methodenbeschreibungen wurde die Erhitzung der Probe weggelassen. Hauptziel dieses Ausstrichverfahrens war die semiquantitative Zellzahlbestimmung. Durch die Automatisierung der Zellzählung in Milch hat es hier jedoch seine Bedeutung verloren (DILBAT 1963, KRAFT 1994, HAMANN et al. 2001) Cytospin DULIN et al. (1982) haben eine heute weit verbreitete Methode zum Ausstreichen des Milchsediments beschrieben. Cytospin ist eine Zentrifuge für Objektträger, auf denen eine Probenkammer fixiert ist. Durch saugfähiges Papier ist direkt unter der Kammer eine runde Fläche mit einem Durchmesser von ca. 5 mm begrenzt. Nur diese Fläche wird später mikroskopiert. Zur Gewinnung des Sediments werden 1 ml Milch mit 8 ml eiskaltem PBS für 10 Minuten bei 180 xg zentrifugiert. Je nach Pelletgröße wurde das Pellet in nur 0,2 ml 9
28 Literaturübersicht TSB oder zusätzlich 2 ml PBS resuspendiert. 0,2 ml der Zellsuspension wurden in die Cytospinkammer überführt und bei 225 xg für 10 Minuten zentrifugiert. Vor dem Färben nach Wright werden die Ausstriche luftgetrocknet Zellmorphologie Allgemeines Die Anfertigung von Milchausstrichen zur Zelldifferenzierung ist schwierig, und es ist unmöglich, die Qualität von Blutausstrichen zu erreichen (MIELKE u. KOBLENZ 1980, DULIN et al. 1982, MILLER et al. 1993). Entsprechend fehleranfällig ist die Zelldifferenzierung, was sicherlich ein Grund für die z.t. sehr unterschiedlichen Ergebnisse der einzelnen Forscher ist. Gerade Makrophagen und Epithelzellen sind so nur schwer zu unterscheiden, weil sie gleich groß sind und beide Fetteinschlüsse enthalten können. Des weiteren führt die Tatsache, daß nicht eindeutig differenzierbare Zellen aus dem Zelldifferentialbild ausgeschlossen werden, ebenfalls zu Verzerrungen (MIELKE u. KOBLENZ 1980, LEE et al. 1980). Diese Aspekte sind stark vom Untersucher abhängig, da er, selbst nach gründlicher Einweisung, letztendlich selber seine Kriterien für die Unterscheidung der Zellen festlegen muß. Die folgende Beschreibung der unterschiedlichen Zellmorphologien basiert hauptsächlich auf licht- und elektronenmikroskopischen Analysen von Milch-, aber auch von Blutleukozyten (SCHÖNBERG 1956, PAAPE et al. 1979, MIELKE u. KOBLENZ 1980, LEE et al. 1980, LUDEWIG 1996, LIEBICH 1993). In Tab. 1 sind die Zellmorphologien schematisiert zusammengefaßt PMN Neutrophile Granulozyten oder auch PMN (Polymorphonuclear Neutrophils) sind an einem intensiv gefärbten, stabförmigen oder gelappten Kern und an kleinen dichten 10
29 Literaturübersicht Granula im Zytoplasma zu erkennen. Ihre Größe beträgt µm. Enthalten sie jedoch Fettvakuolen, können sie einen ähnlichen Umfang wie Makrophagen erreichen Eosinophile Granulozyten Eosinophile Granulozyten haben die gleiche Zellgröße und Kernform wie PMN; sie enthalten jedoch eosinophile Granula, die mit 0,5 1,5 µm etwas größer als die neutrophilen Granula sind Basophile Granulozyten Auch basophile Granulozyten haben einen gelappten Kern, sind mit 9 12 µm durchschnittlich aber etwas kleiner als PMN. Ihr Zytoplasma enthält 1,5 µm große basophile Granula, die den Kern überlagern können Lymphozyten Die 5-10 µm großen Lymphozyten zeichnen sich durch einen runden bis ovalen Kern mit wenig oder keinem umgebenden Zytoplasma aus. Kern und Zytoplasma sind dichter, d.h. intensiver gefärbt als bei kleinen Monozyten bzw. Makrophagen. Aktivierte Lymphozyten können bis zu 25 µm groß werden. Obwohl Lymphozyten funktionell eine sehr heterogene Zellpopulation sind, können sie im Ausstrich nicht weitergehend unterteilt werden Monozyten Monozyten sind µm groß und haben einen runden bis nierenförmigen Kern. Im schwach basophilen Zytoplasma liegen azurophile Granula. 11
30 Literaturübersicht Makrophagen Makrophagen kommen in einer Größe von 8-30 µm vor und ihr Zellkörper ist 0,5-10 mal größer als der Kern. Das Zytoplasma enthält häufig nicht angefärbte Vakuolen. Der Kern, der in sehr vielfältigen Formen vorkommt, besteht aus diffusem Chromatin und wird daher schwächer angefärbt als der Kern von PMN oder Lymphozyten. Ihre Größe nimmt mit der Menge phagozytierter (Fett-) Partikel zu und kann auch deutlich über 18 µm liegen Epithelzellen Epithelzellen kommen meist als Klumpen von 4-16 Zellen vor. Ihre Zellkerne sind groß und rund; das Verhältnis zwischen Kern und Zytoplasma beträgt 1:2-3. Tab. 1: Zellmorphologie von Milchzellen Zellart Größe Kern Zytoplasma PMN µm intensiv gefärbt, stabförmig oder gelappt dichte neutrophile Granula; 0,5 1 µm Eosinophile Granulozyten Basophile Granulozyten µm intensiv gefärbt, stabförmig oder gelappt 9 12 µm intensiv gefärbt, stabförmig oder gelappt eosinophile Granula; 0,5 1,5 µm basophile Granula; 1,5 µm Lymphozyten/ Blasten 5 10 µm bis 25 µm intensiv gefärbt, rund bis oval sehr wenig, intensiv gefärbt Makrophagen 8 30 µm schwach gefärbt, vielfältige Formen schwach gefärbt, oft nicht angefärbte Vakuolen Epithelzellen µm intensiv gefärbt, groß und rund schwach gefärbt, nicht angefärbte Vakuolen möglich 12
31 Literaturübersicht Zelldifferentialbild in Milch einer gesunden Milchdrüse Seit den 1980er Jahren ist bekannt, daß die Makrophagen die größte Zellfraktion in der Milch bilden, gefolgt von Lymphozyten, PMN und Epithelzellen. Wie aus Tab. 2 hervorgeht, herrscht noch keine Einigkeit darüber, wie groß der Anteil der einzelnen Zellpopulationen in normaler Milch genau ist. Das von PAAPE et al. (1981) veröffentlichte Zelldifferentialbild von 60 % Makrophagen, 28 % Lymphozyten, 10 % neutrophile Granulozyten (PMN) und 2 % Epithelzellen wird von anderen Autoren am häufigsten zitiert (CONCHA 1986, BURVENICH et al. 1995, KELLY et al. 2000). Tab. 2: Zelldifferentialbild in Milch einer gesunden Milchdrüse Quelle Zellart MAK LYM PMN EPI Paape et al % 1) 5 % 1) 95 % 1) 3 % 2) 22 % 2) 75 % 2) Lee et al % 16 % 3 % 1 % Paape et al % 28 % 10 % 2 % Kurzhals et al % 1,5 % 34 % 2,4 % Wever u. Emanuelson % 15 % 37 % Miller et al % 24 % 26 % 19 % Östensson % 14 % 12 % 1) Kühe MAK = Makrophagen, LYM = Lymphozyten 2) Färsen PMN = neutrophile Granulozyten, EPI = Epithelzellen Des weiteren wird eine Abhängigkeit der Zellzusammensetzung von Laktationsstadium und nummer sowie der Gemelksfraktion beschrieben (BLACKBURN 1966, PAAPE u. Tucker 1966, ÖSTENSSON et al. 1988, MILLER et al. 1991, ÖSTENSSON 1993). 13
32 Literaturübersicht So nimmt mit steigender Laktationsnummer der Gehalt somatischer Zellen in der Milch zu, wobei die PMN die Hauptträger dieses Anstiegs sind und sich ihr Anteil an der Gesamtzellzahl erhöht. (BLACKBURN 1966 u. 1968, BURVENICH et al. 1995, LABOHM et al. 1998). Diese Beobachtungen entsprechen dem Zelldifferentialbild der Milch während einer Euterentzündung (siehe 2.2.5), so daß der Einfluß der Laktationsnummer eigentlich auf eine erhöhte Infektionsrate älterer Tiere zurückzuführen ist (WEVER u. EMANUELSON 1989). Ähnlich zu interpretieren ist die Darstellung, daß zu Laktationsbeginn der Anteil der Makrophagen am größten ist und gegen Laktationsende sowohl der absolute Milchzellgehalt als auch der PMN-Anteil ansteigen (BLACKBURN 1966, CONCHA 1986, BURVENICH et al. 1995). Die Dominanz der Makrophagen zu Laktationsbeginn ist unbestritten, gegen Laktationsende findet in gesunden Milchdrüsen jedoch ein gleich starker Anstieg von Lymphozyten und Epithelzellen statt (ÖSTENSSON et al. 1988). Der Anteil der Epithelzellen von im Mittel unter 2 % kann bei Färsen in den ersten 4 Laktationswochen auf bis zu 15 % steigen (MILLER et al. 1991, BURVENICH et al. 1995) Zelldifferentialbild in Milch einer erkrankten Milchdrüse Die Hauptreaktion der Milchdrüse auf eine Infektion ist das schnelle Einströmen von PMN, in weit geringerem Maß auch von Lymphozyten und Makrophagen, in die Milch, wodurch der Zellgehalt der Milch auf einige Millionen Zellen pro ml steigen kann. In der akuten Phase der Entzündung stellen die PMN bis zu 95 % der somatischen Milchzellen (BLACKBURN 1968, PAAPE et al. 1979, KURZHALS et al. 1985, ÖSTENSSON 1993, BURVENICH et al. 1995, LABOHM et al. 1998). Die Höhe des Zellinflux in ein infiziertes Viertel ist u.a. von der Erregerart abhängig. Ab dem siebten Tag post infectionem nimmt der Anteil der PMN ab und derjenige der Lymphozyten zu. Bei subklinischen und chronischen Mastitiden stellen auch die 14
33 Literaturübersicht Makrophagen wieder einen größeren Anteil an den somatischen Zellen in der Milch (CONCHA 1986, ÖSTENSSON 1993, LEITNER et al. 1995, LABOHM et al. 1998) Zelldifferentialbild des Blutes Im Blut des Rindes kommen physiologischer Weise % PMN (Neutrophile Granulozyten), 5 6 % Eosinophile Granulozyten, < 1 % Basophile Granulozyten, % Lymphozyten und 5 10 % Monozyten vor. Die Morphologie der Zellen entspricht der Beschreibung unter (LIEBICH 1993). In der akuten Phase einer bakteriellen Infektion sinkt zunächst der Anteil der PMN auf ca. 18 %, um nach sieben Tagen über das physiologische Maß hinaus auf ca. 80 % anzusteigen. Nach ca. zehn Tagen nimmt dann der Anteil der Lymphozyten zu, oft begleitet von einer Eosinophilie (BICKHARDT 1992, BURVENICH et al. 1994). 2.3 Durchflußzytometrische Zelldifferenzierung Differenzierung aufgrund der Zellmorphologie Wie unter beschrieben, mißt ein Durchflußzytometer prinzipiell leuchtende Partikel. Ein auf die Zellanalytik ausgelegtes Gerät erfaßt zusätzlich zu verschiedenen Farben noch Größe und Struktur der Zellen. Die Anfärbung der DNS und RNS mit einer 0,0004 %igen Acridinorangelösung kann genutzt werden, PMN, Lymphozyten, Makrophagen und Monozyten in Blut und Milch zu unterscheiden (HAGELTORN u. SAAD 1986). Für die Messung wird die Milch lediglich 1:200 mit der Färbelösung verdünnt. Im Gegensatz zu PMN und Lymphozyten konnte in einem Koordinatensystem, in dem Partikelgröße gegen Partikelstruktur dargestellt wurden, für Monozyten und Makrophagen keine Region festgelegt werden. Mit Hilfe einer Sortiereinrichtung am Durchflußzytometer wird die Zelldifferenzierung mikroskopisch bestätigt. Nach längerer Lagerung der Milchproben 15
34 Literaturübersicht veränderte sich die Wolke der PMN derart, daß eine Abgrenzung gegen die Lymphozyten erschwert wurde. Wird für die Zelldifferenzierung auf die mikroskopische Kontrolle verzichtet, so kann der Anteil der Makrophagen rechnerisch ermittelt werden, indem die Summe der PMN und Lymphozyten von allen gemessenen Zellen abzogen wird (ÖSTENSSON et al. 1988, ÖSTENSSON 1993). Auch der DNS-Farbstoff Carboxydimethylfluoreszeindiazetat ist dafür geeignet, intakte lebende Zellen von Zellfragmenten zu unterscheiden. Vor der durchflußzytometrischen Analyse werden durch Zentrifugation die Zellen aus der Milch separiert. Bisher wurde mit dieser Methode lediglich der Anteil der PMN bestimmt (MILLER et al. 1993). Durch die Kombination der DNS-Farbstoffe SYBR green 1 und Propidiumiodid können durchflußzytometrisch durch Zentrifugation gewonnene Milchzellen in PMN und mononukleäre Zellen differenziert werden. Diese Farbstoffkombination ermöglicht es, nur lebende Zellen in der Auswertung zu berücksichtigen, wodurch die Abgrenzung der Zellpopulationen verbessert wird (PILAI et al. 2000) Differenzierung mit Hilfe monoklonaler Antikörper Herstellung monoklonaler Antikörper Monoklonale Antikörper werden mit Hilfe von tumorös entarteten Plasmazellen der Maus, den Myelomzellen, hergestellt. Nach Immunisierung einer Maus gegen ein bestimmtes Antigen werden Milzzellen dieser Maus mit Myelomzellen fusioniert. Durch mehrere Schritte werden die so gewonnenen Hybridomzellen vereinzelt, so daß Zellklone entstehen, die sich aus einer einzigen Zelle gebildet haben und nur monoklonale Antikörper eines Isotyps und einer Spezifität produzieren. In weiteren Schritten wird dann die genaue Spezifität des Antikörpers ermittelt, so daß er analytisch eingesetzt werden kann. Solche Antikörper können durch chemische 16
35 Literaturübersicht Reaktionen an ihrem unspezifischen Teil mit Fluorochromen, Enzymen oder anderen Molekülen gekoppelt werden, um sie sichtbar zu machen (JANEWAY u. TRAVERS 1997). Zur Differenzierung einzelner Zellpopulationen und zellulärer Subpopulationen werden diese Antikörper in der Membranimmunfluoreszenz eingesetzt (siehe ) Cluster of Differentiation Die Oberflächenstrukturen von Zellen können in Haupthistokompatibilitätskomplex, Antigenrezeptoren und Differenzierungsantigene unterteilt werden. Letztere werden allgemein Cluster of Differentiation (CD) genannt und durchnummeriert. Diese aus der Humanmedizin stammende Bezeichnung wurde auch in der Tiermedizin übernommen. Eine CD-Bezeichnung wird aber erst vergeben, wenn festgestellt wurde, daß die gefundene Struktur mit der menschlichen übereinstimmt. Das geschieht in internationalen Workshops. Konnte keine korrespondierende humane Struktur gefunden werden, so erhält die Struktur beim Rind die Bezeichnung Workshop Cluster (WC1). Beide Bezeichnungen sagen nichts über die Funktion der Oberflächenstruktur aus (MORRISON et al. 1991, JANEWAY u. TRAVERS 1997). Die CD-Moleküle können auch polymorph vorkommen, wie dies z.b. für das bovine CD4 beschrieben wurde. Durch den Vergleich von zwölf gegen CD4 gerichtete Antikörper wurden unterschiedliche Bindungsverhalten festgestellt (BENSAID u. HADAM 1991, MORRISON et al. 1991). Im folgenden wird auf diejenigen Oberflächenstrukturen näher eingegangen, deren Expression unter Berücksichtigung der Eutergesundheit mit Hilfe der Membranimmunfluoreszenz im Rahmen der vorgelegten Arbeit untersucht wurde. 17
36 Literaturübersicht Haupthistokompatibilitätskomplex Klasse II Das bovine MHC (Major Histocompatibility Complex) Klasse II Molekül kann auf der Oberfläche von professionellen antigenpräsentierenden Zellen nachgewiesen werden. Dazu gehören u.a. B-Zellen, Makrophagen und dendritische Zellen. Überdies werden diese Moleküle auf aktivierten Zellen exprimiert, z.b. aktivierten T- Zellen. Die Expression wird durch Zytokine, v.a. Interferon-γ, reguliert (PASTORET et al. 1998). Diese Präsentation von antigenen Peptiden ist ein wichtiger Bestandteil der Immunregulation TCR1 Die im Mikroskop nicht weiter unterteilbare Population lymphoider Zellen der Milch läßt sich anhand von Oberflächenstrukturen in drei große Subpopulationen einteilen: B-Zellen, αβ-t-zellen mit dem T-Zellrezeptor (TCR) 2 und γδ-t-zellen mit dem TCR1 (WYATT et al. 1996). Bovine γδ-t-zellen sind eine heterogene Gruppe, deren Bedeutung noch nicht abschließend geklärt ist. Es wird vermutet, daß sie ein Teil des angeborenen Überwachungssystems sind, das insbesondere im Darmtrakt und in der Milchdrüse eine wichtige Verteidigungslinie gegen Infektionen darstellt. Bei Jungtieren ist ihre Population größer als bei adulten. γδ-t-zellen werden vor allem in Schleimhäuten nachgewiesen und sind in der Milz, der Milchdrüse und dem Darmepithel besonders häufig zu finden. Dort sollen sie immunregulatorische Funktionen haben. In Wiederkäuern rezirkuliert ein Großteil dieser Lymphozytenpopulation zwischen Blut, Gewebe und Lymphe und ist in den peripheren Körperkompartimenten weit verteilt (PARK et al. 1992, WYATT et al. 1994, DAVIS et al. 1996, MACHUGH et al. 1997, FERENS et al. 1998, DAUBENBERGER et al. 1999, SOLTYS u. QUINN 1999) 18
37 Literaturübersicht WC1 WC1 ist ein vom T-Zell-Rezeptor unabhängiger Marker für γδ-t-zellen, dessen Funktion noch ungeklärt ist. Es wird jedoch spekuliert, daß sie derjenigen von CD4 und CD8 ähnelt, d.h. daß dieses Molekül ein Korezeptor des T-Zellrezeptors ist (DAUBENBERGER et al. 1999, VAN KAMPEN et al. 1999) CD4 CD4 wird von einer großen Subpopulation der αβ-t-zellen sowie einem kleinen Teil der γδ-lymphozyten als Korezeptor exprimiert. Die CD4-positiven (CD4 + ) T- Helferzellen erkennen die von MHC Klasse II präsentierten Peptide und aktivieren u.a. durch die Sekretion von Zytokinen die Makrophagen dazu, phagozytierte Bakterien abzutöten (JANEWAY u. TRAVERS 1997, FERENS et al. 1998, DAUBENBERGER et al. 1999, RIOLLET et al. 2000) CD8 Analog zu CD4 wird auch CD8 von einer großen Subpopulation der αβ-t-zellen sowie einem kleinen Teil der γδ-lymphozyten als Korezeptor exprimiert. CD8 + αβ-t- Zellen können entweder zytotoxische oder suppressive Lymphozyten sein. Sie reagieren auf von MHC Klasse I präsentierte Antigene. Zytotoxische Lymphozyten töten viral oder tumorös entartete Zellen ab, während suppressive Lymphozyten durch die Sekretion spezifischer Zytokine die Immunantwort herunterregulieren (JANEWAY u. TRAVERS 1997, FERENS et al. 1998, DAUBENBERGER et al. 1999, RIOLLET et al. 2000). 19
38 Literaturübersicht CD14 (LPS-Rezeptor) CD14 kommt auf der Oberfläche boviner Monozyten, Makrophagen und einer Subpopulation der PMN vor. Er ist ein Rezeptor für den Komplex aus Lipopolysaccharid (LPS) und LPS-Bindungsprotein. Die Bindung an diesen Rezeptor löst in Monozyten und Makrophagen u.a. die Synthese von Interleukin (IL) -1, IL-6, IL-8, dem Tumornekrosefaktor (TNF) α und dem Granulozytenkoloniestimulierenden Faktor (G-CSF) aus. Die Bindung an CD14 steht somit am Anfang einer Entzündungsreaktion. CD14 wird auch als Marker für Makrophagen eingesetzt (ADLER et al. 1994, SOPP et al. 1996, BERTHON u. HOPKINS 1996) Zelldifferentialbild einer gesunden Milchdrüse Bei der durchflußzytometrischen Zelldifferenzierung mit Hilfe von Antikörpern wird nur selten der prozentuale Anteil von PMN, Lymphozyten und Makrophagen an allen Zellen angegeben, sondern meistens werden Aussagen über die Expression von Oberflächenstrukturen, das Reaktionsmuster von Subpopulationen bzw. ihr Verhältnis zueinander gemacht Phagozyten In der Milch normal laktierender Kühe konnte auf ca. 68 % der PMN CD14 und auf ca. 80 % CD11b nachgewiesen werden. Für CD18 schwanken die Angaben zwischen 65 und 88 % (PAAPE et al. 1996, RIOLLET et al. 2001). 35% der großen mononukleären Zellen (große MNC) tragen CD14 und 55 % CD18 auf ihrer Oberfläche. Für den Anteil der Makrophagen an den MNC besteht eine Abhängigkeit vom Laktationsstadium: er ist mit 69 % peripartal am größten und sinkt 20
39 Literaturübersicht im Laktationsverlauf auf 21 % (PARK et al. 1992, PAAPE et al. 1996, RIOLLET et al. 2001) Lymphozyten Durchschnittlich sind in der Milch 20 % der Lymphozyten B-Lymphozyten und 45 % T-Lymphozyten, ihre Anteile sind jedoch erheblichen Schwankungen unterlegen (CONCHA et al. 1978, PAAPE et al. 2000). Der Anteil der B-Lymphozyten zeigt einen ähnlichen Verlauf wie derjenige der Makrophagen: er schwankt zwischen 25 % peripartal und 7 % in der Laktation. Die T-Lymphozyten verhalten sich entgegengesetzt: im Geburtszeitraum stellen sie 16 % der Lymphozyten, später 62 % (PARK et al. 1992, VAN KAMPEN u. MALLARD 1997). Mit Hilfe eines Antikörpers gegen den B-Zellmarker CD21 können in der Lymphozytenpopulation der Milch nur ca. 1 % B-Lymphozyten nachgewiesen werden, mit dem T-Zellmarker CD2 aber ca. 60 % T-Lymphozyten (RIOLLET et al. 2001). Tab. 3 stellt den Anteil der CD4 + und CD8 + Zellen an den T-Lymphozyten dar. Das Verhältnis dieser beiden Zellarten (CD4/CD8) ist < 1 (YAMAGUCHI et al. 1999, PAAPE et al. 2000). Beide Subpopulationen unterliegen einem Laktationseinfluß. In der Frühlaktation ist der Anteil der CD8 + Zellen am größten und nimmt im Laktationsverlauf ab. Bei den CD4 + Zellen verhält es sich genau umgekehrt (ASAI et al. 1998). 21
40 Literaturübersicht Tab. 3: Größe der CD4 + und CD8 + Lymphozytensubpopulationen in Blut und Milch Quelle Antigen CD4 CD8 Substrat Bezug Park et al Schmaltz et al % 8 34 % Milch Lymphozytenmorphologie % % Blut Lymphozytenmorphologie % % Milch CD3 + Lymphozyten Taylor et al % % Milch T-Lymphozygen Van Kampen et al Asai et al % % Milch CD3 + Lymphozyten % % Blut CD3 + Lymphozyten 24 ± 14 % 59 ± 13 % Milch CD2 + Lymphozyten 67 ± 6,2 % 20 ± 3,6 % Blut CD2 + Lymphozyten Riollet et al % 21 % Milch Lymphozytenmorphologie Die Population der γδ-t-zellen bildet mit ca. 29 % die dritte große Lymphozytenfraktion in der Milch, ca. 13 % davon sind CD8 + γδ-t-zellen. Zur Geburt sind ca. 20 % Lymphozyten in der Milch WC1 +, in der Laktation geht ihr Anteil auf ca. 15 % (VAN KAMPEN et al. 1999) bzw. 5 % (RIOLLET et al. 2001) zurück. MHC II wird von ca. 6 % der Lymphozyten exprimiert (RIOLLET et al. 2001). 22
41 Literaturübersicht Zelldifferentialbild einer erkrankten Milchdrüse Viele der im Folgenden aufgeführten Daten beruhen auf durch LPS- bzw. Toxininstillation in die Milchdrüse künstlich hervorgerufenen Mastitiden oder aber auf experimentellen Infektionen v.a. mit Staphylococcus (S.). aureus, nicht jedoch auf Felduntersuchungen Phagozyten PMN aus abnormaler Milch tragen kein CD14 auf ihrer Zelloberfläche, aber CD18 wird auf allen PMN nachgewiesen. Der Anteil CD11b exprimierender PMN liegt wie in normaler Milch bei 80 %, die Expressionsdichte ist aber signifikant niedriger (SOLTYS u. QUINN 1999, RIOLLET et al. 2001). CD14 wird von 25 %, CD18 von 95 % der großen MNC exprimiert mit einer im Vergleich zur gesunden Milchdrüse um das dreifache gestiegenen Expressionsdichte (PAAPE et al. 1996). In Tab. 4 werden die Ergebnisse einer Studie mit intrazisternaler LPS-Instillation zusammenfassend für Blut und Milch dargestellt. Tab. 4: Durchflußzytometrisches Zelldifferentialbild der Phagozyten in Blut und Milch vor und nach einer intrazisternalen LPS- Injektion (PAAPE et al. 1996) CD14 vor CD14 nach CD 18 vor CD 18 nach PMN Milch 68 % 0 % 65 88% 100 % PMN Blut 3 % 0 % 93 % 90 % große MNC Milch 35 % 25 % 55 % 95 % große MNC Blut 63 % 61 % 95 % 99 % 23
42 Literaturübersicht Lymphozyten Durch eine Mastitis nimmt die Dichte der CD4-Moleküle auf der Zelloberfläche zu und es erhöht sich der Anteil der T-Helferzellen (CD4 + ) innerhalb der Lymphozytenpopulation und wird größer als derjenige der CD8 + Zellen. Dieser Anstieg scheint jedoch je nach Infektionserreger unterschiedlich stark auszufallen. So wurde beispielsweise beschrieben, daß im Vergleich zu Escherichia (E.) coli und S. aureus bei durch Streptokokken verursachten Mastitiden ein geringer Anstieg des Anteils der CD4 + Zellen stattfindet. Für CD8 + Zellen wurde sowohl eine Vergrößerung als auch eine Verkleinerung dieser Lymphozytensubpopulation beschrieben, während für die Expressionsdichte keine Veränderung gefunden wurde (LEITNER et al. 1995, TAYLOR et al. 1997, SOLTYS u. QUINN 1999, RIVAS et al. 2000, RIOLLET et al. 2001) Der Anteil der γδ-t-zellen an den Lymphozyten steigt auf ca. 14 % und scheint unbeeinflußt von der Erregerspezies zu sein (SOLTYS u. QUINN 1999, RIOLLET et al. 2000) Zelldifferentialbild des Blutes Phagozyten Von den PMN im Blut exprimieren ca. 93 % CD18 und nur ca. 3 % CD14. Durch LPS-Injektion in die Milchdrüse geht die Expression beider Strukturen um jeweils ca. 3 % zurück (PAAPE et al. 1996). Im Blut schwankt der Anteil der Monozyten an den mononukleären Zellen im Laktationsverlauf zwischen 15 % und 31 %, wobei der niedrigste Wert in der frühen Trockenstehphase erreicht wird. Auf ca. 62 % der großen MNC konnte CD14 nachgewiesen werden. Der Anteil der CD18 + großen MNC stiegt durch LPS-Injektion in die Milchdrüse von 95 % auf 99 % an (PARK et al. 1992, PAAPE et al. 1996). 24
43 Literaturübersicht Lymphozyten Im Blut laktierender Kühe besteht die Lymphozytenpopulation aus 23 % B-Zellen und 45 % T-Zellen (CONCHA et al. 1978). Zur Geburt findet innerhalb der Lymphozytenpopulation ein signifikanter Anstieg der IgM tragenden B-Lymphozyten und der MHC II + Zellpopulationen statt (VAN KAMPEN u. MALLARD 1997), im anschließenden Laktationsverlauf ändern sich die Anteile von B- und T-Lymphozyten sowie NK Zellen dagegen kaum (PARK et al. 1992). Im Blut laktierender Kühe sind 20 % der T-Lymphozyten CD8 +. Für die Lymphozytensubpopulation der T-Helferzellen (CD4 + ) gibt es unterschiedliche Angaben: ca. 35 % (VAN KAMPEN et al. 1999) und ca. 67 % (ASAI et al. 2000). Peripartal nehmen die Anteile der CD4 + und CD8 + an den Lymphozyten sowie die mittlere Expressionsdichte dieser Oberflächenstrukturen ab und steigen in der Frühlaktation nur langsam wieder an. Das Verhältnis von CD4/CD8 Lymphozyten, das immer > 1 beträgt, zeigt ebenfalls eine Abhängigkeit von Laktationsstadium. Es nimmt vom Laktationsbeginn zum Laktationsende hin ab (PARK et al. 1992, ASAI et al. 2000). Nur die Größenschwankungen der CD8 + Lymphozytenpopulation scheinen von Infektionen der Milchdrüse beeinflußt zu sein (VAN KAMPEN u. MALLARD 1997, VAN KAMPEN et al. 1999, RIVAS et al. 2000), wobei nicht in jeder Studie zu diesem Themenkomplex eine Reaktion der Blutleukozyten auf eine Infektion der Milchdrüse beobachtet werden konnte (RIOLLET et al. 2001). Der Anteil der γδ-t-zellen an der Lymphozytenpopulation im Blut beträgt ca. 3 %, derjenige der CD8 + γδ-t-zellen ca. 2 %. Die in ihrer Größe laktationsabhänige Subpopulation der WC1 + γδ-t-zellen zeigt ein den αβ-t-zellen (CD4 + und CD8 + ) genau entgegengesetztes Verhalten: ihr Anteil an den Blutlymphozyten ist zur Geburt am niedrigsten und steigt während der Laktation an (VAN KAMPEN u. MALLARD 1997, VAN KAMPEN et al. 1999, ASAI et al. 2000). 25
44 Literaturübersicht 2.4 Zelluläre Abwehr der bovinen Milchdrüse Phagozytose Als Phagozytose wird das Erkennen und Aufnehmen fremder Partikel durch Zellen bezeichnet. Phagozytose und anschließendes Abtöten der Bakterien stellen einen wichtigen Schutzmechanismus des Euters gegen eindringende Mikroorganismen dar. Ihre Ausprägung zeigt neben tierindividuellen Einflüssen eine Abhängigkeit von Laktationsstadium und nummer (VECHT 1985, GUIDRY et al. 1985). Die Phagozytose wird durch die sogenannte Opsonisierung der Bakterien mit Antikörpern, v.a. IgG und IgM, oder Komplementfaktoren, v.a. C3b, verbessert. Die Phagozyten wiederum tragen auf ihrer Zelloberfläche Komplement- sowie Fc- Rezeptoren für die Antikörper. Es wird jedoch vermutet, daß diese Rezeptoren durch Milchbestandteile blockiert und dadurch inaktiviert werden. Komplement kommt in der Milch nur in sehr niedrigen Konzentrationen vor. Die Menge von IgG1, IgG2, IgM und IgA, die in normaler Milch gering ist, steigt im Rahmen einer Mastitis an. Die Fähigkeit der Phagozyten in der Milch zu Phagozytose und intrazellulärem Abtöten von Bakterien ist auch durch die Aufnahme von Fett, Eiweiß und anderen Milchbestandteilen sowie die in der Milch geringen Konzentrationen von Sauerstoff und Glucose im Vergleich zum Blut reduziert (JAIN 1976, PAAPE u. WERGIN 1977, PAAPE et al. 1981, TARGOWSKI 1983, HOLMBERG u. CONCHA 1985, VECHT 1985, CONCHA 1986, BURVENICH et al. 1994, SORDILLO et al. 1997) Makrophagen Die Phagozyten in der Milch sind Makrophagen und PMN. Die Makrophagen, die in normaler Milch die größte Zellfraktion bilden, begegnen als erste Phagozyten den ins Euter eingedrungenen Bakterien (THOMAS et al. 1994). Sie bauen phagozytierte Mikroorganismen ab und präsentieren sie auf ihrer Zelloberfläche in MHC II- Molekülen. Aktivierte Makrophagen setzten zusätzlich verschiedenen Mediatoren frei, durch die PMN angelockt und stimuliert werden. Durch Antigenpräsentation 26
45 Literaturübersicht stimulieren sie auch Lymphozyten, die ebenfalls PMN-anlockende Lymphokine freisetzen (TARGOWSKI 1983, HOLMBERG u. CONCHA 1985, VECHT 1985, BURVENICH et al. 1994, SORDILLO et al. 1997) PMN Lebenszyklus PMN werden als der wichtigste Schutz vor Mastitiden eingestuft. Neben den im Blut zirkulierenden PMN gibt es noch Reserven, die marginal der Wand der Blutgefäße angelagert sind, sowie einen weiteren Pool im Knochenmark. Aus diesen Reserven wandern sie, angelockt durch Signale, die u.a. von Makrophagen ausgesandt werden, als Barriere gegen das Eindringen von Mikroorganismen in Körperhöhlen und Gewebe (JAIN 1976). Die Lebensspanne der PMN, nachdem sie nach einer Reifungszeit von zehn bis zwölf Tagen das Knochenmark verlassen haben, beträgt nur wenige Tage. Nach Ablauf dieser Frist werden sie apoptotisch und von Makrophagen phagozytiert, so daß keine toxischen Substanzen ins Gewebe gelangen können. Die PMN in der Milch werden gemeinsam mit den anderen Zellen regelmäßig beim Melken aus dem Euter gespült und in der Blutbahn neu rekrutiert. Die kontinuierliche Migration der PMN in die Milchdrüse stellt nach Ansicht vieler Autoren die erste immunologische Barriere gegen eindringende Bakterien dar (BURVENICH et al. 1994, 1995, PAAPE et al. 2000) Migration Verschiedene Mediatoren führen zu einer direkten und gerichteten Migration der PMN zum Entzündungsort. Dies geschieht, indem die PMN dem Konzentrationsgradienten der Chemoattraktinen wie z.b. C5a, Interleukin (IL) 8 oder LPS zur höchsten Konzentration folgen, was Chemotaxis genannt wird (TARGOWSKI 1983, BURVENICH et al. 1995, PAAPE et al. 2000). Andere 27
46 Literaturübersicht Mediatoren wie CD11/CD18 lagern sich an die Zellmembran an und führen zu einer Adhäsion der PMN an die Gefäßwand, bevor sie das Gefäß verlassen und durch die Tight Junctions ins Gewebe gelangen Entzündung Im Fall einer Mastitis gelangen innerhalb von acht bis zehn Stunden mehrere Millionen Zellen in die Milch, ein erster signifikanter Anstieg des Zellgehaltes ist sogar schon nach vier Stunden meßbar (JAIN 1976, PAAPE et al. 1976, BURVENICH et al. 1994, PRIN-MATHIEU et al. 2002). Das Ausmaß der PMN- Infiltration hängt u.a. von der Erregerspezies ab (CONCHA 1986, LEITNER et al. 1995). Der Erfolg dieser PMN-Rekrutierung steht in direktem Zusammenhang mit der erfolgreichen Bekämpfung einer Euterinfektion. Die kann dadurch erklärt werden, daß, wie unter beschrieben, die Phagozytosefähigkeit der PMN in der Milch stark eingeschränkt ist und für eine erfolgreiche Abwehr sehr viel PMN notwendig sind. Dennoch konnten Eigenschaften von vor einer Infektion aus Blut isolierten PMN mit der Schwere der anschließenden experimentellen Mastitis in Verbindung gebracht werden (BURVENICH et al. 1994). In der Milch phagozytieren die PMN die eingedrungenen Erreger und töten sie intrazellulär ab. Dies kann sauerstoffabhängig durch die Bildung radikaler Sauerstoffspezies geschehen oder sauerstoffunabhängig durch Säuren, Lactoferrin, Lysozym oder kationische Proteine. Beide recht unspezifischen Mechanismen stellen auch eine Gefahr für das umgebende körpereigene Gewebe dar, indem sie zu dessen Fibrosierung und damit zum Verlust der Funktionalität führen (TARGOWSKI 1983, THOMAS et al. 1994, BURVENICH et al. 1995, SHUSTER et al. 1996, SORDILLO et al. 1997, PAAPE et al. 2000). 28
47 Literaturübersicht Lymphozyten Die Lymphozyten spielen eine wichtige Rolle bei der Modulation der Immunantwort und halten das Immunsystem im Gleichgewicht. Ihre Reaktionsfähigkeit scheint in der Milch jedoch herabgesetzt zu sein. Wie bei den PMN besteht auch die gerichtete Migration der Lymphozyten, die durch Oberflächenstrukturen, den Homing- Rezeptoren, gesteuert wird, aus Adhäsion an und Diapedese durch das Gefäßendothel (PAAPE et al. 2000) T-Lymphozyten T-Helferzellen (CD4 + ) werden MHC II-restringiert durch spezifische Antigene angeregt und sezernieren daraufhin stimulierende sowie hemmende Mediatoren, die die Chemotaxis, die Migration und die Phagozytose beeinflussen (HOLMBERG u. CONCHA 1985, CONCHA 1986, SORDILLO et al. 1997, PAAPE et al. 2000). Die T-Suppressorzellen (CD8 + ) haben vermutlich immunmodulierende Aufgaben, indem sie hemmend auf die Immunantwort wirken. Für die CD8 + Zellen aus Milch konnte eine hemmende Wirkung auf die Proliferation von CD4 + Lymphozyten nachgewiesen werden (PARK et al. 1993, PAAPE et al. 2000). Den zytotoxischen T-Zellen wird eine das Epithel schützende Funktion zugeschrieben, indem sie über MHC I-Vermittlung alte oder beschädigte sekretorische Zellen beseitigen (TARGOWSKI 1983). Bisher wurde im Euter jedoch noch keine Aktivität von zytotoxischen T-Zellen beobachtet (BURVENICH et al. 1995). Die Funktion der γδ-t-zellen ist noch nicht abschließend geklärt. Es wird vermutet, daß sie MHC-abhängig und -unabhängig Zytotoxizität und die zytotoxischen T-Zellen modulieren können. Es ist denkbar, daß sie durch Entfernung geschädigter Zellen eine Schutzfunktion für das Epithel ausüben (SORDILLO et al. 1997, PAAPE et al. 2000). 29
48 Literaturübersicht Die Natural Killer (NK) Zellen sind in ihrer Antigenerkennung nicht an MHC gebunden, sie tragen jedoch Fc-Rezeptoren auf ihrer Oberfläche. Mit diesen Rezeptoren binden sie an mit Antikörpern opsonisierte Zellen/Bakterien und töten sie ab. Es wird daher vermutet, daß sie an der Beseitigung von Bakterien aus dem Euter beteiligt sein könnten, was bisher aber noch nicht nachgewiesen werden konnte (SORDILLO et al. 1997, PAAPE et al. 2000) B-Lymphozyten B-Lymphozyten können Antigen aufnehmen und in MHC II-Molekülen den T- Helferzellen präsentieren, die dadurch zur Zytokinausschüttung angeregt werden. Diese Zytokine führen entweder dazu, daß die B-Lymphozyten sich zu Plasmazellen entwickeln und Antikörper produzieren oder aber zu Gedächtniszellen werden. Die Antikörperproduktion konnte auch für Plasmazellen aus der Milch nachgewiesen werden (CONCHA 1986). Die Antikörper fungieren nicht nur als Opsonine, sondern sie können auch Toxine neutralisieren (TARGOWSKI 1983, CONCHA 1986, SORDILLO et al. 1997). 2.5 Folgerung Die breite Streuung der Zelldifferentialbilder spiegelt wider, daß die mikroskopische Zelldifferenzierung bei Milchzellen methodisch und in der Aussagekraft an ihre Grenzen stößt. Der Einsatz spezifischer monoklonaler Antikörper und die Durchflußzytometrie bieten hier neue und weiterreichende Möglichkeiten. Wie aus der Literaturübersicht deutlich wird, ist jedoch mit dem bisher veröffentlichten Datenmaterial ein direkter Vergleich zwischen der mikroskopischen und der durchflußzytometrischen Zelldifferenzierung, insbesondere ihrer Aussagekraft hinsichtlich der bovinen Mastitis, nicht möglich. Genau dieser Vergleich ist das Ziel der vorliegenden Arbeit. 30
49 Material und Methoden 3. MATERIAL UND METHODEN 3.1 Versuchstiere Die Versuche wurden mit Kühen des Lehr und Forschungsguts Ruthe der Tierärztlichen Hochschule Hannover (Betrieb 1) und des Landwirtes Thomas Meldau in Adelheidsdorf (Betrieb 2) durchgeführt. Vereinzelt wurden auch Patienten der Kliniken für Geburtshilfe und Gynäkologie des Rindes und für Rinderkrankheiten beprobt Betrieb 1 Auf dem Lehr- und Forschungsgut Ruthe der Tierärztlichen Hochschule Hannover wurden ca. 80 Kühe der Rasse Deutsche Holstein Farbrichtung Schwarzbunt mit einer durchschnittlichen Jahresleistung von kg gemolken. Es wurden nur Proben von dem Teil der Herde gewonnen, der in einem Tiefstreustall mit Freßgitter aufgestallt ist und in einem Doppel-Vierer Autotandem Melkstand der Firma DeLaval zweimal täglich von Uhr und Uhr gemolken wurde. Die Fütterung der Herde setzte sich zusammen aus der Grundversorgung durch eine aufgewertete Mischration sowie der leistungsorientierten Kraftfuttergabe am Automaten; Wasser stand ad libitum zur Verfügung Betrieb 2 Auf dem Betrieb des Landwirtes Thomas Meldau wurden ca. 80 Kühe der Rasse Deutsche Holstein Farbrichtung Schwarzbunt zweimal täglich um 5.30 Uhr und um Uhr in einem Doppel-Sechser Fischgrätenmelkstand der Firma Westfalia gemolken. Die Herde, die in einem Boxenlaufstall mit Spaltenboden, im Sommer mit 31
50 Material und Methoden Weidegang, gehalten wurde, hatte eine durchschnittliche jährliche Milchleistung von ca kg. Das Grundfutter bestand aus Grassilage und wurde mit Kalk und Mineralfutter ergänzt. Ein Kraftfutterautomat stand für die Leistungsfütterung zur Verfügung, Wasser war ad libitum für die Tiere zugänglich Versuchsreihen Versuch 1: Orientierende Untersuchung auf der Basis einer randomisierten Tierauswahl Für den Versuch 1 wurden Milchproben von 21 Kühen gewonnen, darunter 1 Tier mit nur drei funktionellen Drüsenkomplexen (Dreistrich). Die Auswahl der Versuchstiere wurde spontan vom Probenehmer vorgenommen ohne Berücksichtigung von Laktationsnummer oder stadium und ohne Vorkenntnis über die Eutergesundheit Versuch 2: Methodische Fragestellungen Die Selektion der Kühe für diesen Versuch basierte auf den Daten zur Zellzahl aus den monatlich durchgeführten Milchleistungsprüfungen des Landeskontrollverbandes Niedersachsen Bremen e.v. für die Betriebe Ruthe und Meldau. Es wurde darauf geachtet, daß sowohl Färsen als auch Kühe mit höherer Laktationszahl vertreten waren. Auf Ebene der Eutergesundheit war es das Ziel, Proben von auf allen Vierteln eutergesunden Tieren (SCC < Zellen / ml), von mittelgradig (mgr.) erkrankten (SCC Zellen / ml Milch) bis hin zu hochgradig (hgr.) erkrankten (SCC > Zellen / ml Milch) Drüsenkomplexen zu erhalten. Um Aussagen über die Wiederholbarkeit der untersuchten Parameter zu erhalten, wurden insgesamt 10 Tiere an drei aufeinanderfolgenden Tagen sowie ein viertes Mal mit einer Woche Abstand beprobt. 32
51 Material und Methoden Versuch 3: Untersuchungen zum Zelldifferentialbild auf der Basis einer selektierten Tierauswahl Im Rahmen von Versuch 3 wurden Blut- und Milchproben von 37 Kühen gewonnen, darunter 4 Dreistriche. Die Versuchstiere in Ruthe wurden anhand von Viertelgemelksuntersuchungen, die im dreiwöchigen Abstand durchgeführt wurden, gezielt nach ihrer Eutergesundheit ausgewählt. Im Betrieb Meldau wurde über 3 Wochen in einer Anamnesephase die Eutergesundheit potentieller Versuchstiere erhoben, um anhand dieser Daten die Kühe für den Versuch zu selektieren. Die Kriterien entsprachen den in aufgeführten. Die eutergesunden Tieren waren von der Abkalbung bis zur Beprobung nicht an einer klinischen oder subklinischen Mastitis erkrankt und zum Beprobungszeitpunkt tragend. Auch die mgr. euterkranken Tiere waren tragend, im Fall der hgr. Erkrankungen rückte dieses Kriterium dagegen in den Hintergrund. Allgemeinerkrankungen wurden durch eine adspektorische Allgemeinuntersuchung sowie die Erhebung des unter aufgeführten Blutbildes ausgeschlossen. 3.2 Geräte Aqua dest. Aufbereitungsanlage Aqua tridest. Aufbereitungsanlage Autoklav GFL-Wasserdestillierapparat (Metall), Gesellschaft für Labortechnik, Hannover Quarzdestillierapparat Destamet, Heraeus, Hanau Varioklav Dampfsterilisator, H + P Labortechnik GmbH, Oberschleißheim Blutanalysegerät Hematology Analyzer, Modell MEK 6108G für Veterinärmedizin NIHON KOHDEN, Bad Homburg 33
52 Material und Methoden Eismaschine Typ UBE Elektrische Pipettierhilfe Ziegra, Isernhagen pipetus - akku, Hirschmann Laborgeräte, Eberstadt Elektrische Zählhilfe Assistent Counter AC 8 Karl Hecht Assistent GmbH, Altnau TG, Schweiz Fluoreszenz-Durchflußzytometer, Modell FACSCalibur, mit angeschlossener Computereinheit Heißluftsterilisator Kühlzentrifuge Omnifuge 2.ORS Kühlzentrifuge Sigma 4K-1 Laborwaage L310 Leitfähigkeitsmeßgerät Lichtmikroskop Multipette plus Pipetten, einstellbar von µl, µl, 0,5-10 µl Pipetten, Fixvolumen 50µl, 10 µl Schüttler Becton Dickinson, Heidelberg Rubarth Apparate GmbH, Hannover Heraeus, Hanau Sigma, Osterode Sartorius GmbH, Göttingen Mastitron, Milku, Uelzen Zeiss Axiolab, Zeiss, Oberkochen Eppendorf, Hamburg Eppendorf Research, Eppendorf, Hamburg Eppendorf Research, Eppendorf, Hamburg MS Minishaker IKA, Landgraf Laborgeräte OHG, Langenhagen; Heidolph Reax top, Landgraf Laborgeräte OHG, Langenhagen 34
53 Material und Methoden Staukette nach Hauptner Zentrifuge für Deckgläschen ( Kaffeemühle ) Eikemeyer, Tuttlingen Eigenbau der ZA Hygiene und Technologie der Milch auf Basis einer Krups Kaffeemühle, Hannover 3.3 Material Verbrauchsmaterialien Auslaufpipetten 10 ml Babyflaschen 250 ml aus Glas Combitips plus 2,5 ml Deckgläschen 18 x 18 mm Sarstedt ( ), Nümbrecht Fa. Eggers, Ronnenberg Eppendorf ( ), Hamburg IDL ( ), Nidderau Einmalösen 10 µl Landgraf Laborgeräte OHG ( ), Langenhagen Glasflaschen 1 L, Duran mit Schraubverschluß Kanülen 38 mm, 20 G 1 ½, steril Nylonsiebgewebe, w 50 µm Objektträger 76 x 26 mm Reagenzglas Duran 10 ml Omnilab ( ), Bremen Becton Dickinson (360215), Heidelberg HLL (610050), Landgraf Laborsysteme GmbH, Langenhagen IDL ( ), Nidderau Landgraf Laborgeräte OHG, Langenhagen Röhrchen, 15 ml und 50 ml Sarstedt ( und ), Nümbrecht 35
54 Material und Methoden Röhrchen, 13 ml Röhrchen für die Durchflußzytometrie, 5 ml (FACS-Röhrchen) Rundboden-Mikrotiterplatten, 96 Vertiefungen, steril Safe Lock-Tubes 1,5 ml (Eppendorf Reaktionsgefäße) Standardtips, gelb und blau Sterilfilter, 0,22 µm Porenweite Transferpipetten 3,5ml Vacutainer Adapters Vacutainerröhrchen, 7 ml, mit 0,084 ml 0,34 M EDTA Vacutainerröhrchen, 10 ml, ohne Zusatz Vacutainerröhrchen, 7 ml, mit Na - Fluoridzusatz Weithalsflaschen 250 ml aus Polyethylen mit Schraubverschluß Sarstedt (55.468), Nümbrecht Becton Dickinson ( ), Heidelberg Nunc (163320), Wiesbaden Eppendorf ( ), Hamburg Eppendorf ( und ), Hamburg Renner (06001), Darmstadt Sarstedt ( ), Nümbrecht Becton Dickinson (364887), Heidelberg Becton Dickinson (367655), Heidelberg Becton Dickinson (368430), Heidelberg Becton Dickinson (367729), Heidelberg Omnilab ( ), Hannover 36
55 Material und Methoden Reagenzien Acridinorange (C.I ) Merck Eurolab GmbH ( ), Darmstadt Albumin, bovin, Fraktion V, 98% pulverisiert (BSA, bovines Serumalbumin) Roth (80762), Karlsruhe Bronopol Merck Eurolab GmbH ( ), Darmstadt Einbettmittel Ethanol 94 % Vol, denaturiert (Brennspiritus) Corbit, I. Hecht, Kiel - Hassesee CG Chemikalien, Laatzen Färbesystem Hemacolor Merck Eurolab GmbH, Darmstadt Fixierlösung Nr Farbreagenz rot Nr Farbreagenz blau Nr NaCl Trockenpulver Oxoid GmbH (L 5), Wesel Phosphatgepufferte Kochsalzlösung Sigma Aldrich Chemie GmbH (1000 3), (PBS), ph 7,4 ohne Ca ++/Mg ++ Steimheim und Biochrom (L18210), Berlin Propidiumiodid (PI) Sigma Aldrich Chemie GmbH ( ), Steimheim Toluidinblau (C.I ) Merck Eurolab GmbH ( ), Darmstadt TO PRO 3 Iodide Molekular Probes (T 3605), Leyden, Niederlande 37
56 Material und Methoden Antikörper und Nachweisreagenzien Antikörper für den Einsatz in der Membranimmunfluoreszenz Monoklonale Primärantikörper Tab. 5 gibt eine Übersicht über die in der Membranimmunfluoreszenz eingesetzten primären monoklonalen Antikörper (mak), sowie deren Isotypen und Spezifitäten. Verdünnungen der verwendeten primären Antikörper wurden mit MIF-Puffer (siehe ) hergestellt. Der mak Bo116 ist spezifisch für polymorphkernige neutrophile Granulozyten (PMN), das von ihm erkannte Antigen ist bisher jedoch noch nicht charakterisiert (RÖNSCH 1992). Der mak Bo139 ist spezifisch für BoLA-DR-Produkte (LANGE 1995), d.h. für bovine MHC Klasse II Moleküle. Die Hybridome, welche die murinen mak Bo116 (IgM) und Bo139 (IgG3) produzieren, wurden in der Arbeitsgruppe Immunologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover nach der Immunisierung von Mäusen mit bovinen lymphoblastoiden Zellen des Rindes (nach Transformation mit Theileria annulata) hergestellt (REBESKI 1990, VON DER OSTEN 1990, RÖNSCH 1992). 38
57 Material und Methoden Tab. 5: Verwendete monoklonale Antikörper zur Charakterisierung von zellulären Oberflächenstrukturen in der Membranimmunfluoreszenz mak Donor/Isotyp Verdünnung Eingesetztes Volumen Spezifität Versuch Bo 139 1) Maus IgG3 unverdünnt 20 µl Bo 116 1) Maus IgM unverdünnt 20 µl Bovine MHC II (BoLA DR) Neutrophile Granulozyten* 3 3 CC8 (FITC) 2) [CD4-S] 3w 086 CACT83A 1) [CD4-I] Maus IgG 2a 1:20 10 µl Bovines CD4 1,2,3 Maus IgM 1:5 20 µl Bovines CD4 2 CC58 (RPE) 2) Maus IgG1 1:2 10 µl TuK4 (RPE-Cy5) 2) Maus IgG 2a 1:14 10 µl Bovines CD8b Humanes CD14, Kreuzrkt. u.a. mit Rind 1,3 3 CC101 2) Maus IgG 2a 1:2 10 µl Bovine WC 1 1,2 GB21A 3) Maus IgG 2b 1:20 10 µl Boviner TcR1-N24 2,3 * Das erkannte Molekül auf der Zelloberfläche ist noch nicht charakterisiert 1) Arbeitsgruppe Immunologie, Tierärztliche Hochschule Hannover 2) Firma Serotec, Co., Großbritannien 3) Firma vmrd, Inc., Pullman, WA, USA 39
58 Material und Methoden Sekundärantikörper F(ab )2 Kaninchen gegen Maus IgG, Kreuzreaktion mit IgM: Fluoresceinisothiocyanat (FITC)-konjugiert Firma Serotec, Co. (STAR9B), Großbritannien Kulturmedien, Puffer und Lösungen Alle Puffer und Lösungen wurden, wenn nicht anders angegeben, in Aqua tridest. angesetzt Lösungen für die Zellanalytik Phosphat-gepufferte Kochsalzlösung (PBS) Hierzu wurde die PBS-Trockensubstanz (s ) in Aqua tridest. gelöst. Der Puffer hatte einen ph-wert von 7,4. Die Konzentrationen der Bestandteile waren: NaCl 137,0 µmol/ml KCl 2,7 µmol/ml Na 2 HPO 4 8,1 µmol/ml KH 2 PO 4 1,12 µmol/ml Für die doppelt konzentrierte Phosphat-gepufferte Kochsalzlösung (2 x PBS) wurde doppelt soviel Trockensubstanz pro Volumen Aqua tridest. eingesetzt Wasch- und Verdünnungspuffer für die Membranimmunfluoreszenz (MIF-Puffer) BSA 2,5 g und NaN 3 0,05 g gelöst in 500 ml PBS, aufbewahrt bei 4 C 40
59 Material und Methoden Lösungen für die Durchflußzytometrie Trägerflüssigkeit (Sheath fluid) Als Trägerflüssigkeit für das Durchflußzytometer wurde sterilfiltriertes (0,2 µm) PBS mit 0,1 mg/ml NaN 3 (Natriumazid) verwendet Propidiumiodidlösung 1 mg/ml Propidiumiodid gelöst in PBS wurde als Stammlösung in aliquoten Teilen bei 28 C gelagert. Zum Anfärben toter Zellen wurde die Stammlösung 1:5 verdünnt (Gebrauchslösung). Der Probe wurden 30 µl Propidiumiodidgebrauchslösung pro ml zugesetzt (Endkonzentration 6 µg/ml) To-Pro-3-Lösung To-Pro-3 wurde in der Konzentration 1 mmol/ml gelöst in DMSO tiefgefroren geliefert. Diese Stammlösung wurde 1:1000 mit MIF-Puffer verdünnt und die Gebrauchslösung in aliquoten Teilen bei 28 C gelagert. Der Probe wurden 20 µl Gebrauchslösung, die erst kurz zuvor aufgetaut worden war, zugesetzt (Endkonzentration 0,1 µmol/ml) Acridinorange-Lösung Acridinorange 200 mg NaCl 425 mg gelöst in 500 ml Aqua monodest. (Stammlösung: 0,4 %) 41
60 Material und Methoden Durch Verdünnung mit PBS um den Faktor 1000 wurde die Gebrauchslösung (0,0004 %) hergestellt. Beide Lösungen wurden lichtgeschützt bei 4 C gelagert Färbelösungen für die Mikroskopie Hemacolor Das System Hemacolor besteht aus gebrauchsfertigen Lösungen, die unverändert eingesetzt wurden Toluidinblaulösung Toluidinblau 2 mg/ml gelöst in Aqua monodest Fixationslösung für Rohmilch Bronopol 10 mg/ml gelöst in Aqua tridest, aufbewahrt bei 4 C Zur Fixation von 10 ml Milch wurden 60 µl der Bronopollösung benötigt (Endkonzentration 1% Bronopol). 3.4 Probenahme Blut Die Entnahme und Untersuchung von Blutproben wurden nur in Versuch 3 durchgeführt. Aus der mit einer Staukette angestauten Vena jugularis wurden nach Desinfektion der Punktionsstelle mit 70 %-igem Ethylalkohol ca. 30 ml gerinnungsgehemmtes 42
61 Material und Methoden (EDTA) Vollblut und 10 ml Blut zur Gewinnung des Blutserums entnommen. Aufgrund von unterschiedlichen Betriebsabläufen wurde im Betrieb 1 das Blut nach dem Melken, im Betrieb 2 vor dem Melken gewonnen. Die Blutproben wurden während des Transports und bis zur weiteren Verarbeitung im Labor bei 4 C gekühlt Milch Es wurde jedes funktionelle Euterviertel der Versuchstiere während der Morgenmelkzeit beprobt. Die Milchproben wurden durch Handmelken gewonnen und umgehend ins Labor gebracht, wo sie bis zum Beginn der Zellisolation bei 4 C gelagert wurden. Im Sommer erfolgte der Transport der Proben mit Kühlelementen in einer Kühlbox. Die Entnahme von Vorgemelk und Viertelanfangsgemelk wurde in jedem Versuch auf die gleiche Weise durchgeführt, die Entnahme der Viertelhandgemelke dagegen wurde in den einzelnen Versuchen modifiziert Vorgemelk Die ersten ca. 5 ml wurden aus dem nicht gereinigten und unstimulierten Euterviertel in die Messkammer des Gerätes Mastitron gemolken und nach der Messung der elektrischen Leitfähigkeit (LF) unschädlich entsorgt Viertelanfangsgemelk (VAG) Nach trockener Reinigung des Euters und der Zitzen mit Haushaltspapier folgte eine gründliche Desinfektion besonders der Zitzenkuppe mit Haushaltspapier, das mit 70%-igem Ethylalkohol getränkt war. Anschließend wurden 10 ml Milch (VAG) in ein steriles Glasröhrchen gemolken. 43
62 Material und Methoden Viertelhandgemelk (VGH) Nach Gewinnung des VAG wurden je nach Versuch 250 oder 500 ml Milch (VGH) je Euterviertel in ein Probenahmegefäß mit Schraubverschluß gemolken Versuch 1: Orientierende Untersuchung auf der Basis einer randomisierten Tierauswahl Ermelken von 250 ml aus jeder funktionellen Zitze in eine Weithalsflasche aus Polyethylen mit Schraubverschluß Versuch 2: Methodische Fragestellungen Ermelken von 500 ml aus jeder funktionellen Zitze in eine Duran Glasflasche mit Schraubverschluß. Nach Durchmischung Umfüllen der Probe in eine Weithalsflasche aus Polyethylen mit Schraubverschluß und eine sterile Babyflasche aus Glas sofort nach der Probenahme Versuch 3: Untersuchungen zum Zelldifferentialbild auf der Basis einer selektierten Tierauswahl Ermelken von 500 ml aus jeder funktionellen Zitze in je zwei sterile Babyflaschen aus Glas. 44
63 Material und Methoden 3.5 Probenanalyse Blut Klinische Labordiagnostik Um den allgemeinen Gesundheitszustand der Versuchstiere beurteilen zu können, wurden im klinischen Labor der Klinik für Rinderkrankheiten der Tierärztlichen Hochschule Hannover die in Tab. 6 dargestellten Parameter untersucht. Tab. 6: Klinische Laborparameter zur Beurteilung der Allgemeingesundheit Parameter Einheit Parameter Einheit Leukozyten / µl Eosinophile % Erythrozyten x10 6 / µl Segmentkernige % Hämoglobin g / dl Lymphozyten % Hämatokrit % Monozyten % MCV 1) µg 3 Glucose mmol / l MCH 2) pg Freie Fettsäuren µmol / l MCHC 3) g / dl ß - Hydroxybutyrat mmol / l Plättchen / µl Harnstoff mmol / l 1) MCV = Mean corpuscular volume (mittleres korpuskuläres Volumen) 2) MCH = Mean corpuscular hemoglobin (mittlerer korpuskulärer Hämoglobingehalt) 3) MCHC = Mean corpuscular hemoglobin concentration (mittlere korpuskuläre Hämoglobinkonzentration) 45
64 Material und Methoden Leukozytenseparation 10 ml Vollblut (EDTA) wurden in ein 50 ml Röhrchen gegeben und für 15 min bei 1000 xg und 4 C ohne Bremse zentrifugiert. Das Plasma (obere Phase) wurde bis knapp über dem Buffy Coat abgesaugt und bis auf 1 ml verworfen. Dieser 1 ml wurde für die spätere Anfertigung der Milchzellausstriche (siehe ) in einem Eppendorf Reaktionsgefäß (ER) kühl gelagert. Anschließend wurden die pelletierten Zellen durch Rütteln vom Röhrchenboden gelöst und die Erythrozyten durch hypotone Lyse entfernt. Dazu wurden 20 ml Aqua tridest. zu den Zellen gegeben und das Röhrchen für 20 sec sanft geschwenkt. Durch Zugabe von 20 ml doppelt konzentriertem PBS wurde die Isotonie wieder hergestellt. Es folgte eine Zentrifugation für 10 min bei 1000 xg und 4 C mit Bremse. Nach Dekantieren des Überstandes und Aufrütteln des Zellpellets wurde die Lyse mit je 10 ml Aqua tridest. und doppelt konzentriertem PBS wiederholt. Abschließend wurden 10 ml PBS zu den Zellen pipettiert und diese für 5 min bei 1000 xg und 4 C zentrifugiert. Das nach Abgießen des Überstandes gewonnene Zellpellet wurde aufgerüttelt, in 500 µl PBS resuspendiert und in ein ER überführt. Das Röhrchen wurde mit weiteren 500 µl PBS nachgespült. Die so gewonnene Zellsuspension Blut (ZSB) wurde bis zur weiteren Untersuchung auf Eis gelagert Bestimmung und Einstellung der Zellkonzentration in der Zellsuspension 50 µl Zellsuspension wurden in einem ER 1 : 2 mit PBS verdünnt. Nach gründlichem Schwenken des ER saugte das Gerät Hematology Analyzer 50 µl an, verdünnte sie mit isotonischer Lösung und zählte die Zellen nach dem Prinzip einer Impedanzmessung mit Hilfe von Kapillaren. Das Gerät gab die Zellkonzentration unter der Bezeichnung WBC in 10 3 Zellen pro µl an, was 10 6 Zellen pro ml entspricht. Da die Zellsuspension zuvor 1 : 2 verdünnt wurde, mußte das vom Gerät ausgegebene Ergebnis verdoppelt werden, um die wahre Zellkonzentration zu erhalten. Sie war Ausgangswert für die Verdünnung der Zellsuspension mit PBS auf die Arbeitskonzentration von ca. 4 x 10 6 Zellen pro ml. 46
65 Material und Methoden Milch Abb. 1 gibt eine Übersicht über die mit Milch durchgeführten Untersuchungen. VAG VGH Mikrobiologie NAGase SCC SCC NAGase KSA Zellseparation ZSM Kaffeemühle Zellvitalität MIF Abb. 1: Untersuchungsschritte für VAG und VGH Mastitisdiagnostik Mikrobiologische Untersuchung Die mikrobiologische Untersuchung wurde aus dem VAG durchgeführt. Nach Durchmischung der Probe wurden mit einer Einmalöse 10 µl Milch auf einer halben Blutagarplatte mit Äskulinzusatz ausgestrichen. Die Platten wurden nach 24 und 48 Stunden beurteilt. Wenn es für die Differenzierung nötig war, wurden Subkulturen einzelner Bakterienkolonien angelegt. Die erste Einordnung der Erreger erfolgte aufgrund von Koloniemorphologie, Wachstumsgeschwindigkeit, Hämolyseeigenschaften und Äskulinspaltung. Zur weiteren Ausdifferenzierung wurden dann Nativpräparate, Gramfärbung, der 47
66 Material und Methoden Nachweis von Gruppenantigenen sowie biochemische und enzymatische Reaktionen herangezogen Messung der NAGase - Aktivität Für die fluoreszenzspektroskopische Messung der Aktivität des Enzyms N-Acetyl-ß- D-glucosaminidase (NAGase) nach dem von KITCHEN et al. (1978), LINKO- LÖPPÖNEN u. MÄKINEN (1985) und NOGAI et al. (1996) etablierten Mikrotiterplatten-Verfahren wurde je 1 ml des VAG und des VGH in einem ER bei -20 C eingefroren. Das Enzym NAGase hydrolysiert das nichtfluoreszierende Substrat 4-Methyl-umbelliferyl-N-acetyl-ß-D-glucosaminidin (4-MeUNAG) in N- Acetylglucosamin (GlcNAc) und in die fluoreszierende Substanz 4-Methylumbelliferon (4-MeU), die dann als Meßgröße in einem Fluorometer detektiert wird. Die Enzymaktivität wurde in nmol min -1 ml -1 angegeben und für die statistischen Berechnungen logarithmisch transformiert Bestimmung des Zellgehaltes im VAG Nachdem die Proben für die mikrobiologische Untersuchung und die Messung der NAGase Aktivität entnommen wurden, wurde das VAG mit 60 µl Bronopollösung (10 %) fixiert und bei 4 C gekühlt. Die Anzahl somatischer Zellen (Somatic Cell Count = SCC) im VAG wurde nach fluoreszenzoptischem Prinzip mit dem Gerät Fossomatic, Firma Foss Elektrik, Dänemark, im Zentrum für Tiergesundheit, Milch und Lebensmittelanalytik des Ahlemer Instituts der Landwirtschaftskammer Hannover bestimmt. 48
67 Material und Methoden Bestimmung des Zellgehaltes im VGH Der Zellgehalt des VGH wurde indirekt mit dem institutseigenen Durchflußzytometer bestimmt. Dazu wurden 10 µl Milch mit 990 µl Akridinorange (AO) -lösung (0,0004 %) 1:100 verdünnt. AO interkaliert sowohl mit RNS als auch mit DNS, so daß mit diesem Farbstoff somatische Zellen gefärbt werden können. Nach Anregung mit Laserlicht mit einer Wellenlänge von λ = 488 nm emittiert AO Fluoreszenzlicht, das sowohl im ersten als auch im zweiten Detektor des Durchflußzytometers gemessen werden kann (siehe ). Anhand dieser Fluoreszenz konnte mit dem Durchflußzytometer zwischen somatischen Zellen und Fettmizellen, die ebenfalls korpuskulär sind, unterschieden werden. Im Durchflußzytometer wurden dann über genau 10 Minuten die Zahl der korpuskulären Teilchen gemessen, die innerhalb eines definierten Intensitätsbereiches Licht im Bereich des ersten Detektors emittierten Kieler Sedimentausstrich 10 ml VGH wurden in ein Röhrchen (13 ml) pipettiert und für 10 min bei 1400 xg und 10 C mit Bremse zentrifugiert. Im Anschluß wurde der Fettpfropf in der Bunsenbrennerflamme erwärmt und zusammen mit dem Überstand verworfen. Die Röhrchen wurden einige Minuten mit der Öffnung nach unten in einen Ständer gestellt, damit der Überstand möglichst vollständig auslaufen konnte. Als nächstes wurde ein Tropfen sterile physiologische Kochsalzlösung zum Sediment gegeben, das mit einer ausgeglühten Öse resuspendiert wurde. Dann wurden 2 4 Ösen einer Probe auf einer Fläche von ca. 2 cm 2 auf einem Objektträger ausgestrichen. Nach Lufttrocknung wurden die Ausstriche in Toluidinblaulösung für wenige Sekunden gefärbt und die überschüssige Farbe vorsichtig unter einem weichen Wasserstrahl abgespült, wonach der Ausstrich wieder an der Luft trocknete. Die mikroskopische Zelldifferenzierung erfolgte unter Ölimmersion bei 1000facher Vergrößerung und mit einer Zählhilfe. Wurden nach 20 min nicht mindestens 20 differenzierbare Zellen gefunden, so wurde die Auswertung abgebrochen und der Ausstrich von der späteren Datenanalyse ausgeschlossen. 49
68 Material und Methoden Separation der somatischen Milchzellen Versuch 1: Orientierende Untersuchung auf der Basis einer randomisierten Tierauswahl Die Milchzellen wurden aus dem VGH (200 ml) separiert. Dazu wurde jede Probe 1 : 2 mit PBS (4 C) verdünnt, auf 8 Röhrchen (Volumen 50 ml) aufgeteilt und für 15 Minuten bei 1000 xg und 4 C zentrifugiert. Die Zentrifuge wurde für diese erste Zentrifugation so eingestellt, daß sie am Ende frei auslaufen konnte. Das sich oben absetzende Fett wurde mit einem Metallspatel vom Rand gelöst und verworfen. Der Überstand wurde abgegossen, die Röhrchen für einige Minuten auf den Kopf gestellt und anschließend das restliche Fett am Rand mit einem saugfähigen Papier entfernt. Nach Zugabe von 1 ml kaltem PBS wurde das Sediment mit einer Pipette durch mehrmaliges Aufziehen und Ablassen resuspendiert und in eines der Röhrchen, die zu einer Probe gehören, überführt. Die Röhrchen wurden nachgespült, indem nochmals 1 ml kaltes PBS mehrmals aufgezogen und wieder abgelassen und am Ende in das Sammelröhrchen pipettiert wurde. Nachdem das Röhrchen mit kaltem PBS auf 50 ml aufgefüllt worden war, wurde es für 15 min bei 400 xg und 4 C mit Bremse zentrifugiert. Wie zuvor wurde der Überstand abgegossen und das Sediment in PBS resuspendiert. Anschließend wurde es in ein kleineres Röhrchen (15 ml) überführt, wobei erneut das große Röhrchen nachgespült wurde. Das kleine Röhrchen wurde mit PBS auf 10 ml aufgefüllt und für 15 min bei 300 xg und 4 C mit Bremse zentrifugiert. Es folgte nochmals das Abgießen des Überstandes und das Resuspendieren des Sedimentes, die abschließende Zentrifugation fand bei 200 xg statt. Nach Dekantieren des Überstandes wurde das Sediment nun in 250 µl PBS resuspendiert und in ein Eppendorfreaktionsgefäß (ER) überführt, wobei das kleine Röhrchen mit weiteren 250 µl PBS nachgespült wurde. Die so erhaltene Zellsuspension Milch (ZSM) wurde bis zur weiteren Analyse auf Eis gelagert. 50
69 Material und Methoden Versuch 2: Methodische Fragestellungen Die Zellseparation wurde grundsätzlich so wie unter beschrieben durchgeführt. Das 1 : 2 mit PBS (4 C) verdünnte VGH (250 ml) wurde nun jedoch in einem Zentrifugenbecher zentrifugiert. Die einzelnen Zentrifugationen erfolgten unter den gleichen Bedingungen wie zuvor. Nach der ersten Zentrifugation wurden das Sediment einer Probe in ein Röhrchen (50 ml) überführt, wobei der Zentrifugenbecher wie beschrieben nachgespült wurde. Das Resuspendieren und Überführen wurde hier mit einer Transferpipette durchgeführt. Nach der zweiten Zentrifugation wurde die Probe in ein kleines Röhrchen (15 ml) pipettiert (siehe ). Die dritte und vierte Zentrifugation sowie die Überführung der Probe in ein ER erfolgten wie in Versuch Versuch 3: Untersuchungen zum Zelldifferentialbild auf der Basis einer selektierten Tierauswahl Es wurde genauso verfahren wie in Versuch 2 (siehe ). Da das Probenvolumen in Versuch ml betrug, wurden je Probe zwei Zentrifugenbecher angesetzt und die Probe nach der ersten Zentrifugation in einem Röhrchen (50 ml) zusammengeführt Bestimmung und Einstellung der Zellkonzentration in der Zellsuspension Die Zellkonzentration in der ZSM wurde genauso bestimmt wie in der ZSB (siehe ). Wurde die erwünschte Arbeitskonzentration von ca. 4x10 6 Zellen / ml überschritten, so wurde die ZSM ebenfalls mit PBS entsprechend verdünnt. 51
70 Material und Methoden Ausstriche der ZSM ( Kaffeemühle ) 40 µl der unverdünnten ZSM wurden mittig auf ein Deckgläschen pipettiert, auf dem kurz zuvor Blutplasma (siehe ) aufgetragen wurde. Dieses Deckgläschen wurde für ca. 5 sec und mit bis zu ca. 200 xg in der Zentrifuge für Deckgläschen Kaffeemühle zentrifugiert und anschließend mit Corbit so auf einen Objektträger aufgeklebt, daß die Zellen oben lagen. Nach der Lufttrocknung wurden die Ausstriche mit dem Schnellfärbesystem Hemacolor gefärbt. Dazu wurden die Objektträger für jeweils 10 sec ins Methanol Fixierbad, in die rote und in die blaue Färbelösung getaucht. Abschließend wurde die überschüssige Farbe vorsichtig unter einem weichen Wasserstrahl abgespült. Nach erneuter Lufttrocknung wurden die Ausstriche im Mikroskop mit Ölimmersion bei 1000facher Vergrößerung und mit einer Zählhilfe differenziert. Wie beim Kieler Sedimentausstrich (siehe ) wurde die Differenzierung abgebrochen, wenn nach 20 min nicht mindestens 20 Zellen registriert wurden. In diesem Fall wurde der Ausstrich von der weiteren Analyse der Daten ausgeschlossen. Dieses Ausstrichverfahren wird im weiteren Text als Kaffeemühle bezeichnet Durchflußzytometrische Analysen Durchflußzytometrie Die Durchflußzytometrie basiert darauf, daß in Suspension befindliche Partikel (Zellen) durch besondere Führung in einer Trägerflüssigkeit vereinzelt werden, so daß sie nacheinander einen bzw. zwei Laserstrahlen passieren. Dabei streuen die Zellen das einfallende Laserlicht ohne Veränderung von dessen Wellenlänge zum einen in Verlängerung des Strahls (Vorwärtsstreulicht, Forward Scatter, FSC) und zum anderen im rechten Winkel dazu (Seitwärtsstreulicht, Side Scatter, SSC). Dieses Streulicht wird von zwei Detektoren aufgefangen, in ein elektronisches Signal umgewandelt und an die angeschlossene Computereinheit weiter geleitet. Das Ausmaß des FSC spiegelt die Größe des Partikels wieder und ist von seinem 52
71 Material und Methoden Refraktionsindex abhängig, während das SSC von der Komplexität, die sich aus Oberflächenbeschaffenheit und Granularität der Zelle zusammensetzt, beeinflußt wird. Das für die Untersuchungen eingesetzte Durchflußzytometer FACSCalibur (Becton Dickinson, Heidelberg) verfügt über zwei Laser. Der Argonlaser erzeugt Licht der Wellenlänge 488 nm, der ihm zeitlich nachgeschaltete Diodenlaser Licht der Wellenlänge 635 nm. Dem Argonlaser sind zusätzlich zu den Streulichtdetektoren drei Fluoreszenzdetektoren zugeordnet. Der Detektor FL1 nimmt Licht im Wellenlängenbereich von nm (Grünfluoreszenz) auf, der Detektor FL2 arbeitet bei nm (Orangefluoreszenz) und FL3 registriert Licht im Bereich von 650 nm (Rotfluoreszenz). Dem Diodenlaser ist der Detektor FL4 zugeordnet, der Ereignisse erfaßt, die Licht im Bereich von nm emittieren und die in definiertem zeitlichen Abstand nach der Passage des Argonlasers auftreten. So können pro Partikel, das die beiden Laser passiert, bis zu 6 Parameter (FSC, SSC, FL1 FL4) erfaßt werden. Sie bilden mit einer bestimmten Geräteeinstellung in Abhängigkeit von den optischen Eigenschaften dieses Partikels ein Datenmuster, das ihn als Meßereignis definiert. Die Einstellung des Gerätes, die Kontrolle der Messung, das Abspeichern der Meßdaten und ihre Auswertung erfolgen über die angeschlossene Computereinheit mit dem Programm CellQuestPro der Firma Becton Dickinson, Heidelberg (ORMEROD 2000). Das Programm CellQuestPro ermöglicht u.a. die Darstellung eines einzelnen Parameters gegen die Zahl der gemessenen Ereignisse (Histogramm) oder die Darstellung zweier Parameter gegeneinander in einem Koordinatensystem (Punktdiagramm, Dot Plot). Die Lage der Ereignisse in den Darstellungen ist abhängig von den Geräteeinstellungen während der Meßung. Um Daten verschiedener Meßungen miteinander vergleichen zu können, wurde daher immer mit den gleichen Einstellungen gemessen. Für die Auswertung der Meßdaten ist es weiterhin nötig, Untergruppen gezielt selektieren zu können. Dies ist sowohl im Histogramm als auch im Punktdiagramm durch das Setzen von elektronischen Fenstern (gates) möglich. Durch das Einrichten mehrerer Gates und ihrer logischen 53
72 Material und Methoden Verknüpfung lassen sich verschiedene statistische Aussagen über die Meßparameter treffen. Es können u.a. die Anzahl bestimmter Meßereignisse, ihr prozentualer Anteil an einer selektierten Ereignisgruppe sowie der mittlere Wert eines Parameter für diese Untergruppe angegeben werden. Werden FSC und SSC in einem Punktdiagramm gegeneinander aufgetragen, so stellen sich morphologisch ähnliche Zellen als zusammenhängende Wolke dar. Werden aus Blut isolierte Zellen untersucht, so bilden ruhende lymphoide Zellen, Blasten und Monozyten sowie Granulozyten drei voneinander abgrenzbare Wolken. Da vor allem Phagozyten im Milieu der Milch ihre Morphologie verändern, bilden hier häufig nur lymphoide Zellen eine homogene Wolke. Selbst in aus Blut stammenden Zellsuspensionen lassen sich Eosinophile Granulozyten nicht rein morphologisch von Neutrophilen Granulozyten (PMN) unterscheiden. In der Korrelation von FL2 mit SCC stellen sich diese beiden Zellarten aber durch die höhere rotorange Autofluoreszenz der Eosinophilen als getrennte Wolken dar Durchflußzytometrische Beurteilung der Zellvitalität Prinzip Geschädigte und/oder abgestorbenen Zellen weisen Defekte in der Zellmembran auf und zeigen im Vergleich zu gesunden Zellen Veränderungen in Größe und Komplexität. Zur Färbung solcher Zellen sind Fluorochrome wie Propidiumiodid (PI) oder TO-PRO-3 geeignet. Diese Farbstoffe gelangen durch defekte Zellmembranen ins Zellinnere und interkalieren dort mit der DNS Doppelhelix. PI wird vom ersten Laser mit λ = 488 nm angeregt und die PI positiven Zellen werden im Detektor FL3 gemessen, während TO-PRO-3 Signale nach Anregung durch den zweiten Laser mit λ = 635 nm hauptsächlich in FL4 registriert werden. Zellen mit intakter Membran werden in diesen Detektoren nicht registriert. Ist der Zelluntergang so weit fortgeschritten, daß keine DNS Reste in den Zellen oder gar nur noch Zellbruchstücke vorhanden sind, können diese mit derartigen Fluorochromen nicht markiert werden. Es können mit dieser Methode also nur tote kernhaltige Zellen mit 54
73 Material und Methoden Membrandefekten erkannt und von der Analyse ausgeschlossen werden, nicht aber kernlose Zellen und Zellbruchstücke Probenvorbereitung und Messung Im Versuch 1 wurde keine getrennte Bestimmung der Zellvitalität durchgeführt. Sie war hier Teil der Auswertung der Messungen der MIF (siehe ). Die Messung der Zellvitalität erfolgte so erst nach Inkubation und mehrmaligem Waschen. Im Versuch 3 wurde die Messung mit einem eigenen Ansatz unabhängig von der MIF durchgeführt. Dazu wurden 50 µl der auf die Arbeitskonzentration eingestellten Zellsuspension zu 150 µl PBS mit PI in ein FACS Röhrchen (FR) pipettiert. Anschließend wurden zelluläre Ereignisse je Probe im FACS gemessen Auswertung Die Auswertung der Messungen erfolgte in allen Versuchen nach dem gleichen Schema. Zunächst wurden in der morphologischen Darstellung FSC/SSC die Meßereignisse, die nach ihrer Größe keine Zellen sein konnten, von der weiteren Auswertung ausgeschlossen. Für die gewählten Geräteeinstellungen waren das diejenigen Meßereignisse, die im Punktediagramm im FSC sowie im SSC kleiner als 50 relative Achseneinheiten waren (siehe Abb. 2 A + B). Dann wurde das Signal des Farbstoffes (FL4 im Versuch 1, FL3 im Versuch 2) in einem Histogramm dargestellt. Mit Hilfe von Gates, deren Lage für die Auswertung der Messungen nicht verändert wurde, und der Statistikfunktion von CellQuestPro wurde nun der Anteil der farbstoffnegativen Zellen bestimmt. Der Auswertungsgang ist in Abb. 2 dargestellt. 55
74 Material und Methoden A B M1 M2 C D Abb.2 Auswertung der Vitalitätsmessung A: Vorwärts (FSC)- gegen Seitwärts (SSC)- Streulicht Darstellung aller gemessenen Partikel B: FSC/SSC Darstellung nach Ausschluß des Debris in der linken unteren Ecke; nur diese Zellen wurden berücksichtigt. C: FL3/SSC Darstellung der roten Fluoreszenz, in der sich nicht angefärbte lebende Zellen (links) von angefärbten toten (rechts) unterscheiden. D: FL3 Histogramm mit der Histogramm Statistik in Tab. 7 wurde die Vitalität der Zellen in % bestimmt: M1 = vitale Zellen, M2 = tote Zellen, Xm = mittlere Fluoreszenzaktivität in FL3. 56
75 Material und Methoden Tab. 7: Histogramm Statistik zu FL3-H Marker Events % Xm All ,00 609,80 M ,54 15,45 M , , Membranimmunfluoreszenz Prinzip Die Membranimmunfluoreszenz (MIF) weist Oberflächenstrukturen von Zellen mit Hilfe von Antikörpern nach, die spezifisch an diese Strukturen binden. Im Fall der direkten MIF ist bereits an diesen spezifischen Antikörper (Primärantikörper) ein Fluorochrom gekoppelt, die indirekte MIF benötigt einen zweiten, fluorochrommarkierten Antikörper (Sekundärantikörper), der den Primärantikörper erkennt Durchführung Die Membranimmunfluoreszenz wurde sowohl mit Milch- als auch mit Blutproben durchgeführt. Es wurden aus jeder Probe 100 µl Zellsuspension (4 x 10 6 Zellen / ml) je Antikörper sowie 100 µl für den Kontrollansatz in eine Vertiefung der Mikrotiterplatte (MT) pipettiert. Anschließend wurde die MT, genau wie beim späteren Waschen, für 4 min bei 350 xg und 10 C mit Bremse zentrifugiert, der Überstand wurde dekantiert und die Zellen durch Rütteln der Platte auf dem Minishaker vom Plattenboden gelöst. Dann wurden 10 bzw. 20 µl eines spezifischen monoklonalen Antikörpers (siehe Tab. 5) und als Kontrollansatz gegen unspezifische Bindungen des Sekundärantikörpers auch einmal je Probe 10 µl PBS zu den Zellen pipettiert 57
76 Material und Methoden und durch kurzes Rütteln mit den Zellen vermischt. Für die 20minütige Inkubation im Kühlschrank wurde die MT mit einem Deckel abgedeckt. Im Anschluß daran wurden die Zellen zweimal gewaschen (jeweils Zugabe von 150 µl MIF Puffer, Abzentrifugieren 4 min, 350 xg, 10 C, Bremse, Überstand dekantieren, Zellen aufrütteln). Die Zellen, die mit direkt markierten Antikörpern inkubiert wurden, wurden nun in 100 µl PBS aufgenommen, für die anschließende Messung in FACS Röhrchen (FR) überführt und dunkel gelagert. In den FR waren 100 µl PBS mit 20 µl TO-PRO-3 vorgelegt. Zu den in der MT verbliebenen Zellen wurden 30 µl FITC konjugierter Sekundärantikörper pipettiert und es folgte eine weitere 20minütige Inkubation im Kühlschrank. Nach erneutem zweimaligen Waschen wurden auch diese Zellen in 100 µl PBS aufgenommen und in FR überführt. Die Probe wurde so lange im Durchflußzytometer gemessen, bis - wenn vorhanden in der Region der lymphoiden Zellen 5000 Events erfaßt waren Auswertung Obwohl die durchflußzytometrische Messung der MIF stets mit den gleichen Geräteeinstellungen erfolgte, mußten für die Auswertung die mitgeführten Negativkontrollen miteinbezogen werden, da der Sekundärantikörper in der ZSM zu geringgradiger, unspezifischer Bindung neigte. Durch Setzen eines Gates in FL4 (siehe ) wurden tote, membrandefekte Zellen, die durch TO-PRO-3 markiert waren (rechts im Punktdiagramm), von der weiteren Auswertung ausgeschlossen. Das Fluorochrom Fluoreszein-Isothiocyanat (FITC), mit dem die Antikörperbindung markiert wird, wird mit 488 nm, der Wellenlänge des ersten Lasers, angeregt und emittiert im Bereich des Fluoreszenzdetektors FL1, während Phycoerythrin (PE) bei gleicher Anregung von FL 2 detektiert wird. Das dritte eingesetzte Fluorochrom, Phycoerythrin Cytochrom 5 (PE Cy5) wird vom dritten Detektor FL 3 gemessen. Die Analyse der Antikörperbindung erfolgte in einem Punktediagramm, in dem ein Fluoreszenzkanal gegen SSC aufgetragen wurde. Im Fall einer Doppelfluoreszenzanalyse, d.h. in einem Ansatz wurden zwei verschieden markierte Antikörper eingesetzt, wurden zusätzlich zur oben beschriebenen Auswertung die 58
77 Material und Methoden zwei Fluoreszenzkanäle miteinander korreliert. Mit einer Quadrantenanalyse wurden der prozentuale Anteil fluoreszenzpositiver Zellen und die mittlere Fluoreszenzintensität ermittelt (siehe Abb. 3 E). Für die Auswertung der lymphozytenspezifischen mak wurden durch Setzen entsprechender Gates ausschließlich lymphoide Zellen selektiert, für die Auswertung der anderen mak dagegen wurden die Lymphozyten von der Auswertung ausgeschlossen. 59
78 Material und Methoden A B C D Abb. 3: Auswertung der MIF am Beispiel der Lymphozyten, Beschriftung siehe folgende Seite E 60
79 Material und Methoden A: FSC/SSC Darstellung; der Debris in der linken unteren Ecke wurde während der Messung ausgeschnitten. B: FL4/SSC Darstellung; nur die links liegenden, nicht angefärbten vitalen Zellen werden in der weiteren Auswertung berücksichtigt. C: FSC/SSC Darstellung nach Ausschluß der angefärbten toten Zellen; nun erfolgt die Selektion der Lymphozyten für die Beurteilung der Antikörperbindung. D: FL1/SSC Darstellung der Lymphozyten; die markierten (rechts) und nicht markierten (links) Lymphozyten grenzen sich deutlich voneinander ab. Mit der Quadrantenstatistik werden der prozentuale Anteil der Zellen, die den Antikörper gebunden haben (% UR) sowie ihre mittlere Fluoreszenzintensität (Xm UR) ermittelt (siehe Tab. 8). E: FL1/FL2 Darstellung von Lymphozyten, die gleichzeitig mit 2 Antikörpern markiert wurden. Mit Hilfe der Quadrantenstatistik wird der prozentuale Anteil der Zellen, die keine (% UL), nur einen (% UR und % OL) oder beide Antikörper (% OR) gebunden haben, erhoben (siehe Tab. 8). Tab. 8: Quadranten Statistik für die Auswertung der MIF Einfarbenfluoreszenz Doppelfluoreszenz Quadrant Events % Xm Events % OL ,34 OR ,91 UL ,91 3, ,26 UR ,09 92, ,50 OL = oben links, OR = oben rechts, UL = unten links, UR = unten rechts, Events = ausgewertete Zellen, % = Anteil der Zellen in einem Quadranten an allen ausgewerteten Zellen, Xm = mittlere Fluoreszenzintensität der Zellen in einem Quadranten 61
80 Material und Methoden Datengruppierung und Statistik Versuch 1: Orientierende Untersuchung auf der Basis einer randomisierten Tierauswahl Datengruppierung Die Kühe bzw. Euterviertel wurden nach dem in Tab. 9 dargestellten Schema in vier Gruppen eingeteilt. Ausschlaggebend war der Zellgehalt pro ml im Viertelanfangsgemelk (SCC VAG). Gruppe A umfaßt selektiv die Euterviertel der Kühe, die auf allen vier Drüsenkomplexen weniger als Zellen/ml Milch aufwiesen und somit als eutergesund eingestuft werden konnten. Tab. 9: Gruppierung der Daten in Versuch 1 Zellen x 1000 / ml Milch Alle Viertel < 100 Mindestens 1 Viertel > 100 Einteilung Kuh A B oder C Zellen x 1000 / ml Milch Einteilung Viertel < 100 < > 400 A BC1 BC2 C Statistik Die statistischen Berechnungen wurden mit dem Programm SAS Version 8e 2002, SAS Institute Inc., Cary, NY durchgeführt. Die Normalverteilung wurde optisch mit dem Verfahren PROC CHART geprüft. Nicht normalverteilte Daten wurden logarithmisch transformiert und nochmals geprüft. Mittelwert und Standardabweichung wurden mit dem Programm PROC MEANS, die einfaktorielle 62
81 Material und Methoden Varianzanalyse für unabhängige Stichproben mit PROC GLM und die Korrelation der Parameter mit der Zellzahl mit PROC CORR berechnet Versuch 2: Methodische Fragestellungen Einfluß von Probenahmegefäß und Untersucher auf das mikroskopische Zelldifferentialbild Alle Berechnungen wurden getrennt für die drei Zellarten PMN, Lymphozyten und Makrophagen durchgeführt. Der Einfluß des Probenahmegefäßes wurde zusätzlich für jeden der drei Untersucher separat berechnet, während umgekehrt zur Berechnung des Untersuchereinflusses die Probenahmegefäße einzeln betrachtet wurden. Zunächst wurden die Daten optisch auf Normalverteilung geprüft (siehe ) Für Mittelwert und Standardabweichung wurde das Verfahren PROC MEANS eingesetzt, die Berechnung der zweifaktoriellen Varianzanalyse für wiederholte Messungen erfolgte mit PROC GLM des Programms SAS Einfluß von Probenahmegefäß und Antikörper auf das durchflußzytometrische Zelldifferentialbild Der Einfluß des Probenahmegefäßes wurde für Bindungsrate (%) und mittlere Fluoreszenzintensität (Xm) der vier in diesem Versuch eingesetzten Antikörper berechnet. Umgekehrt wurde der Vergleich zwischen den Antikörpern getrennt nach Art des Probenahmegefäßes durchgeführt. Die Statistik wurde analog zu berechnet. 63
82 Material und Methoden Vergleich von Kieler Sedimentausstrich und Ausstrich der Zellsuspension Die Einteilung der Proben für die statistischen Berechnungen ist in Tab. 10 dargestellt. Sie erfolgte wie unter anhand des SCC VAG. Tab. 10: Gruppierung der Daten für den Vergleich der Ausstricharten KSA und ZSM, für die Untersuchung zur Wiederholbarkeit und für Versuch 3 Zellen x 1000 / ml Milch Alle Viertel <100 Mindestens 1 Viertel Mindestens 1 Viertel > 400 Einteilung Kuh A B C Zellen x 1000 / ml Milch Einteilung Viertel < 100 < < > 400 A B1 B2 C1 C2 C3 Alle Berechnungen erfolgten getrennt für die Zellarten PMN, Lymphozyten und Makrophagen. Die Ausstricharten wurden jeweils innerhalb einer Gruppe miteinander verglichen. Dazu wurde nach der optischen Prüfung auf Normalverteilung eine zweifaktorielle Varianzanalyse für wiederholte Messungen eingesetzt (vgl ). Für den Vergleich der Gruppen A bis C3 innerhalb einer Ausstrichart wurde der Ryan-Einot-Gabriel-Welsch Multiple Range Test mit PROC GLM des Programms SAS angewendet. Um beurteilen zu können, welche Zellarten mit der jeweiligen Methode angereichert wurden, erfolgte eine Berechnung von Mittelwert und Standardabweichung der Differenz KSA ZSM. 64
83 Material und Methoden Überprüfung der Wiederholbarkeit verschiedener Parameter Für diese Fragestellung wurde keine Datengruppierung vorgenommen. Ob zwischen den Werten der aufeinanderfolgenden drei Tage signifikante Unterschiede bestehen, wurde mit einer zweifaktoriellen Varianzanalyse berechnet. Diese Rechnung wurde unter Einbeziehung des vierten Untersuchungstages wiederholt Versuch 3: Untersuchungen zum Zelldifferentialbild auf der Basis einer selektierten Tierauswahl Die Datengruppierung ist in Tab. 10 dargestellt und unter kurz erläutert. Das statistische Vorgehen entspricht den zu Versuch 1 unter beschriebenen Berechnungen. 65
84 Ergebnisse 4. ERGEBNISSE Ziel dieser Arbeit war es, mikroskopisch und durchflußzytometrisch die Veränderungen des Zelldifferentialbildes in Abhängigkeit von der Eutergesundheit zu untersuchen. Zunächst wurde mit einer orientierenden Untersuchung festgestellt, ob und in welcher Form diese Veränderungen zu erfassen waren. Da weder für die Mikroskopie noch für die Durchflußzytometrie auf praktische Erfahrung zurückgegriffen werden konnte, wurden auch die Methoden selbst exemplarisch überprüft. Auf der Basis dieser Untersuchungen wurde die Abhängigkeit des Zelldifferentialbildes von der Eutergesundheit in Blut und Milch mikroskopisch und durchflußzytometrisch analysiert. 4.1 Versuch 1: Orientierende Untersuchung auf der Basis einer randomisierten Tierauswahl Selektierte Kriterien der Eutergesundheit Die Gruppeneinteilung erfolgte anhand des Zellgehaltes (SCC) des VAG (SCC VAG) als Leitparameter für die Eutergesundheit (siehe 3.5.4), aber es wurden in diesem Zusammenhang noch weitere Parameter erhoben. Tab. 11 gibt die Stichprobengrößen, Mittelwerte und Standardabweichungen für die elektrische Leitfähigkeit (LF) sowie den SCC und die NAGase-Aktivität (NAGase) in VAG und VGH in den einzelnen Gruppen wieder. Insgesamt war für alle Meßgrößen ein Anstieg der Werte von A über BC1 und BC2 zu C3 zu beobachten. Obwohl für die Gruppen A und BC1 der gleiche SCC-Grenzwert galt, war der Zellgehalt in BC1 signifikant höher als in A. Kein anderes selektiertes Kriterium der Eutergesundheit zeigte diese signifikante Differenz. SCC VAG war auch die einzige Meßgröße, in der sich BC1 und BC2 signifikant unterschieden. C3 hat im Vergleich mit den übrigen Gruppen (A, BC1 u. BC2) in den Parametern LF, SCC VAG, SCC VGH, NAGase 66
85 Ergebnisse VAG und NAGase VGH signifikant die höchsten Werte. In Tab. 12 sind die Signifikanzen im einzelnen aufgeführt. Tab. 11: Stichprobengröße n Viertel, Mittelwert X und Standardabweichung sd der selektierten Kriterien der Eutergesundheit in Versuch 1 Gruppe A BC1 BC2 C3 Parameter n X sd n X sd n X sd n X sd LF 35 6,27 0, ,28 0, ,57 0, ,13 1,98 LOG SCC VAG 35 4,04 0, ,40 0, ,33 0, ,07 0,43 LOG SCC VGH 34 2,53 0, ,78 0, ,07 0, ,81 0,75 LOG NAG VAG 35 0,39 0, ,43 0, ,65 0, ,13 0,47 LOG NAG VGH 35 0,40 0, ,41 0, ,57 0, ,02 0,47 Alle selektierten Kriterien der Eutergesundheit korrelierten hochsignifikant (p < 0,0001) mit SCC VAG. SCC VGH korrelierte am stärksten, gefolgt von NAGase VAG und VGH. Die elektrische Leitfähigkeit zeigte die schwächste Korrelation. In Tab. 13 sind die Korrelationskoeffizienten aufgeführt. 67
86 Ergebnisse Tab.12: Signifikanzen (p-werte) der selektierten Kriterien der Eutergesundheit zwischen den Gruppen in Versuch 1 Gruppe LF SCC VAG SCC VGH NAGase VAG NAGase VGH A/BC1 ns * ns ns ns A/BC2 ns *** *** ** ns A/C3 *** *** *** *** *** BC1/BC2 ns *** ns ns ns BC1/C3 *** *** *** *** *** BC2/C3 *** *** *** *** *** allgemein *** *** *** *** *** *: p < 0,05; **: p < 0,01; ***: p < 0,001, ns = nicht signifikant Tab. 13: Korrelationskoeffizienten der selektierten Kriterien der Eutergesundheit mit SCC VAG Kriterium LF SCC VGH NAGase VAG NAGase VGH k 0, , , ,59946 k = Korrelationskoeffizient 68
87 Ergebnisse Mikroskopisches Zelldifferentialbild In diesem Versuch wurde das Zelldifferentialbild der ZSM erhoben. Die Ausstriche hierfür wurden mit der Kaffeemühle hergestellt. Zur Differenzierung wurden PMN, Lymphozyten und Makrophagen herangezogen. Das Zelldifferentialbild zeigte einen ähnlichen Trend in Abhängigkeit der Eutergesundheit wie die selektierten Kriterien. BC2 hatte jedoch den höchsten Anteil PMN und den niedrigsten Anteil Lymphozyten, die Werte für C3 lagen etwas niedriger bzw. höher. Der Anteil der Makrophagen zeigte keinerlei Reaktion auf eine Veränderung der Eutergesundheit (siehe Abb. 4). Zusammenfassend wurde für eutergesunde Milchdrüsen (A) ein Zelldifferentialbild von ca. 37 % PMN, 46 % Lymphozyten und 17 % Makrophagen, für hochgradig erkrankte Drüsenkomplexe (C3) eines von ca. 57 % PMN, 24 % Lymphozyten und 19 % Makrophagen festgestellt. Tab. 14 zeigt die Signifikanzen des Gruppenvergleichs. 90 *** *** *** *** * % * * A BC1 BC2 30 C % PMN ZSM % LYM ZSM % MAK ZSM Abb. 4. Zelldifferentialbild unter Berücksichtigung der Eutergesundheit in Versuch 1 69
88 Ergebnisse Tab. 14: Signifikanzen für die einzelnen Zellarten zwischen den Gruppen Gruppe % PMN % Lymphozyten % Makrophagen A/BC1 ns ns ns A/BC2 *** *** ns A/C3 *** *** ns BC1/BC2 * * ns BC1/C3 ns * ns BC2/C3 ns ns ns allgemein *** *** ns *: p < 0,05; **: p < 0,01; ***: p < 0,001, ns = nicht signifikant Die PMN zeigten eine positive und Lymphozyten eine etwa gleichstarke negative hochsignifikante (p 0,0002) Korrelation mit SCC VAG. Die Korrelationskoeffizienten sind in Tab. 15 dargestellt. Tab. 15: Korrelationskoeffizienten der einzelnen Zellarten mit SCC VAG Zellart PMN Lymphozyten Makrophagen k 0, , ,17311 k = Korrelationskoeffizient 70
89 Ergebnisse Durchflußzytometrische Parameter Mit dem Durchflußzytometer wurden für jeden Antikörper zum einen die prozentuale Bindungsrate (%), zum anderen die Bindungshäufigkeit pro Zelle (mittlere Fluoreszenzintensität Xm) bestimmt. Die prozentuale Bindungsrate gibt den Anteil der Lymphozyten, an die der Antikörper gebunden hat, an allen lymphoiden Zellen wieder. Die Bindungshäufigkeit ermöglicht eine Aussage über die Expressionsdichte des erkannten Antigens auf der Zelloberfläche. Die prozentuale Angabe der vitalen Zellen (% Vitalität) bezieht sich auf alle Zellen. Nur wenige der durchflußzytometrischen Parameter zeigten eine Abhängigkeit von der Eutergesundheit. Die Vitalität zeigte ein ähnliches Verhalten wie die PMN, jedoch waren nur die Differenzen zwischen A und BC1 bzw. BC2 signifikant. Die Zellen, die CD4 bzw. CD8 exprimierten, schienen durch Änderungen in der Eutergesundheit unbeeinflußt zu bleiben. WC1 wurde insgesamt von nur sehr wenigen lymphoiden Zellen exprimiert, der Anteil dieser Zellen nahm aber bei hgr. Mastitis (C3) signifikant ab. Die Zellpopulationen, die CD8 und WC1 gleichzeitig exprimierten, sowie die MHC II tragenden Zellen, verhielten sich in Abhängigkeit von der Eutergesundheit ähnlich. Ihre Bindungsrate war in A am niedrigsten, gefolgt von BC2. In BC1 und C3 war ihr Anteil am größten. Die Expressionsdichte von MHC II war im unveränderten Sekret (A) am geringsten und stieg mit dem Schweregrad der Mastitis an. Im einzelnen sind die Ergebnisse in Tab. 16 und die Signifikanzen in Tab. 17a+b dargestellt. 71
90 Ergebnisse Tab. 16: Stichprobengröße n Viertel, Mittelwert X und Standardabweichung sd der durchflußzytometrischen Parameter der ZSM in Versuch 1 Gruppe A BC1 BC2 C3 Parameter n X sd n X sd n X sd n X sd % VIT 35 43,67 20, ,52 18, ,48 20, ,70 26,26 % CD ,60 14, ,92 12, ,42 13, ,60 16,04 Log Xm CD4 33 2,09 0, ,06 0, ,07 0, ,07 0,07 % CD ,22 10, ,99 8, ,77 9, ,82 11,75 Xm CD ,17 502, ,19 354, ,10 266, ,03 243,47 %CD4/% CD8 33 0,98 0, ,26 0, ,19 0, ,98 0,54 Log % γδ 35 0,26 0, ,35 0, ,23 0, ,01 0,33 Log Xm γδ 35 2,07 0, ,92 0, ,02 0, ,04 0,19 Log % CD8+γδ 34-0,68 0, ,87 0, ,66 0, ,00 0,44 % Bo ,43 1, ,57 3, ,43 1, ,45 3,34 Log Xm Bo ,21 0, ,13 0, ,31 0, ,33 0,12 72
91 Ergebnisse Tab.17a: Signifikanzen für die durchflußzytometrischen Parameter zwischen den Gruppen Gruppe % Vit % CD4 log Xm CD4 % CD8 Xm CD8 CD4%/ CD8% A/BC1 ns ns ns ns ns ns A/BC2 * ns ns ns ns ns A/C3 * ns ns ns ns ns BC1/BC2 ns ns ns ns ns ns BC1/C3 ns ns ns ns ns ns BC2/C3 ns ns ns ns ns ns allgemein * ns ns ns ns ns *: p < 0,05; **: p < 0,01; ***: p < 0,001, ns = nicht signifikant Die Korrelationsanalyse bestätigte die oben beschriebenen Beobachtungen, daß nur die Parameter % Vit, log % WC1, log % WC1+CD8 und log Xm Bo139 von der Eutergesundheit beeinflußt werden. Sie korrelierten signifikant mit SCC VAG, dem Leitparameter für die Eutergesundheit (siehe Tab. 18a+b). 73
92 Ergebnisse Tab.17b: Signifikanzen für die durchflußzytometrischen Parameter zwischen den Gruppen Gruppe log % WC1 log Xm WC1 log % CD8+WC1 % Bo139 log Xm Bo139 A/BC1 ns * ns ** * A/BC2 ns ns ns ns ** A/C3 ** ns ** ** ** BC1/BC2 ns ns ns ns *** BC1/C3 ** ns ns ns *** BC2/C3 * ns * ns ns allgemein * ns * * *** *: p < 0,05; **: p < 0,01; ***: p < 0,001, ns = nicht signifikant Tab. 18a: Korrelationskoeffizienten der durchflußzytometrischen Parameter mit SCC VAG Parameter % Vit % CD4 log Xm CD4 % CD8 Xm CD8 CD4%/ CD8% k 0, , , , , ,03181 k = Korrelationskoeffizient 74
93 Ergebnisse Tab. 18b: Korrelationskoeffizienten der durchflußzytometrischen Parameter mit SCC VAG Parameter log % WC1 log Xm WC1 log % CD8+ WC1 % Bo139 log Xm Bo139 k - 0, , , , ,31350 k = Korrelationskoeffizient Mit den Parametern % PMN, % LYM, % VIT, log % WC1, log % WC1+CD8 und log Xm Bo139 konnten sowohl im mikroskopischen als auch im durchflußzytometrischen Zelldifferentialbild signifikante Veränderungen der Zellpopulationen in Abhängigkeit von der Eutergesundheit beobachtet werden. 4.2 Versuch 2: Methodische Fragestellungen Einfluß des Probenahmegefäßes und des Untersuchers auf das mikroskopische Zelldifferentialbild In diesem Versuch wurden aus 40 Milchproben, die jeweils in zwei verschiedenen Probenahmegefäßen (Plastik und Glas) gewonnen wurden (siehe ) die Zellen separiert und mit der Kaffeemühle ausgestrichen. Alle 80 Ausstriche wurden von drei verschiedenen Untersuchern differenziert. Für jeden Untersucher wurde über die 40 Ausstriche, die zu einem Gefäß gehören, der arithmetische Mittelwert getrennt nach Zellart berechnet. Diese Mittelwerte wurden dann für die Vergleiche der Gefäße bzw. Untersucher herangezogen. Tab. 19 zeigt die Ergebnisse dieser Zelldifferenzierung in Form von Mittelwert X, Standardabweichung sd und Stichprobengröße n. 75
94 Ergebnisse Tab. 19: Ergebnisse der mikroskopischen Zelldifferenzierung im Versuch 2: Einfluß von Probenahmegefäß und Untersucher Gefäß Plastik Glas Untersucher US1 US2 US3 US1 US2 US3 PMN LYM MAK X 61,37 67,30 67,10 58,53 63,56 65,49 sd 24,87 18,43 19,20 24,70 21,29 20,51 X 13,47 14,83 5,10 12,00 14,44 5,67 sd 13,32 10,99 4,42 11,29 13,59 4,99 X 23,11 16,63 27,49 28,10 21,23 28,38 sd 16,42 11,52 17,39 16,42 11,70 17,77 Proben n PMN = Polymorphkernige Neutrophile Granulozyten LYM = Lymphozyten MAK = Makrophagen Einfluß des Probenahmegefäßes Das Material des Probenahmegefäßes beeinflußte den Anteil der Phagozyten, insbesondere der Makrophagen, signifikant. Es wurden mehr PMN und Makrophagen aus dem Glasgefäß als aus dem Kunststoffgefäß isoliert (siehe Tab. 19). Die Signifikanzen für die Untersucher sind in Tab. 20 aufgeführt. 76
95 Ergebnisse Tab. 20: Signifikanzen des Gefäßvergleichs getrennt nach Untersucher Zellart Untersucher US1 US2 US3 PMN ns * ns LYM ns ns ns MAK * * ns *: p < 0,05; **: p < 0,01; ***: p < 0,001, ns = nicht signifikant Einfluß des Untersuchers Tab. 21: Signifikanzen des Untersuchervergleiches Gefäß Plastik Glas Untersucher US1 / US2 US1 / US3 US2 / US3 US1 / US2 US1 / US3 US2 / US3 PMN ** ** ns *** *** ns LYM ns *** *** ns *** *** MAK ** ** *** ** ns *** *: p < 0,05; **: p < 0,01; ***: p < 0,001, ns = nicht signifikant Mit der Varianzanalyse konnte einerseits für jede Zellart allgemein der Einfluß des Untersuchers gesichert werden, es wurden aber auch alle Untersucher einzeln miteinander verglichen. Hierbei traten nicht für jede Zellart zwischen allen Untersuchern signifikante Differenzen auf, aber Übereinstimmungen zwischen zwei 77
96 Ergebnisse Untersuchern beschränkten sich nur auf eine Zellart. Die Signifikanzen im einzelnen sind Tab. 21 zu entnehmen Einfluß des Probenahmegefäßes und des Antikörpers auf das durchflußzytometrische Zelldifferentialbild Zu dieser Fragestellung wurden zwei Antikörperpaare hinsichtlich Bindungsrate (%) und mittlerer Fluoreszenzintensität (Xm) untersucht. Das eine Paar (CD4 I und CD4 S) war gegen die gleiche Oberflächenstruktur gerichtet, während zwei verschiedene Strukturen der γδ-t-lymphozyten die Antigene für das andere Paar (WC1 und GB21A) waren. Die Untersuchungen wurden mit den unter beschriebenen Proben bzw. Zellsuspensionen durchgeführt, so daß auch der Einfluß des Probenahmegefäßes mit berücksichtigt werden konnte. Die Berechnungen erfolgten ebenfalls wie unter beschrieben. Mittelwerte X, Standardabweichung sd und Stichprobengröße n sind in Tab. 22 dargestellt. Tab.22: Ergebnisse der durchflußzytometrischen Zelldifferenzierung in Versuch 2: Einfluß von Probenahmegefäß und Antikörper Gefäß Plastik Glas mak CD4S CD4I WC1 GB21A CD4S CD4I WC1 GB21A % Xm X 31,84 4,49 4,58 12,77 31,14 4,91 4,96 13,65 sd 9,99 3,28 3,03 6,51 10,68 3,04 2,71 6,87 X 127,98 287,30 305,33 337,67 127,01 346,59 235,99 343,43 sd 18,94 204,95 276,75 73,20 17,27 309,27 151,38 153,15 Proben n
97 Ergebnisse Einfluß des Probenahmegefäßes Schon ohne Statistik fiel auf, das sich für jeden Parameter die Mittelwerte der beiden Gefäße auf dem gleichen Niveau bewegten. Die Varianzanalyse bestätigte, daß die Probenahmegefäße das durchflußzytometrische Zelldifferentialbild nicht signifikant (p > 0,05) beeinflußten Einfluß des Antikörpers Der eingesetzte Antikörper übte einen starken und hochsignifikanten (p < 0,0001) Einfluß auf die prozentuale Bindungsrate und damit den Anteil einer Subpopulation an der Gesamtpopulation aus (siehe Tab. 18). Das gegen CD4 gerichtete Antikörperpaar zeigte auch signifikante (p < 0,0001) Unterschiede in der mittleren Fluoreszenzintensität Vergleich von Kieler Sedimentausstrich und Ausstrich der Zellsuspension mit der Kaffeemühle Anhand von 146 doppelt angefertigten Milchzellausstrichen wurde überprüft, ob die Anzahl der Zentrifugationsschritte und die Technik, die Zellen auf dem Objektträger aufzutragen, zu unterschiedlichen Zelldifferentialbildern führen. Die Auswertung erfolgte separat für die unterschiedlichen Eutergesundheitsklassen (siehe ). Dadurch konnte ermittelt werden, ob sich trotz eventueller Unterschiede ein ähnlicher Einfluß der Eutergesundheit auf das Zelldifferentialbild erkennen läßt. Durch Betrachtung der mittleren Differenz KSA Kaffeemühle konnte beurteilt werden, welche Zellarten durch eine Methode angereichert bzw. reduziert wurden. 79
98 Ergebnisse Den Tabb. 23 und 24 können die mittleren Zelldifferentialbilder und ihre Schwankungsbereiche entnommen werden. Es fiel auf, daß im KSA in allen Gruppen weniger PMN, aber mehr Lymphozyten gefunden wurden als in der ZSM, die Makrophagen sich aber auf dem gleichen Niveau befanden. Die Varianzanalyse (Tab. 25) bestätigte, daß mit der Ausnahme PMN C2 für PMN und Lymphozyten in allen Gruppen ein signifikanter Unterschied zwischen den Zelldifferentialbildern, d.h. zwischen den Ausstrichmethoden bestand. Die Makrophagen zeigten eine solche signifikante Differenz nur bei hgr. Mastitis (C3). Die Mittelwerte der Differenzen KSA Kaffeemühle (Tab. 26) unterstützten die Annahme, daß durch die vermehrte Zentrifugation Lymphozyten verloren bzw. PMN angereichert wurden. Für die Makrophagen ließ sich kein Trend ablesen. Auch wenn signifikante Unterschiede (siehe Tab. 25) zwischen den Differenzierungsergebnissen beider Ausstricharten bestanden, so spiegelten doch beide eine analoge Veränderung des Zelldifferentialbildes in Abhängigkeit von der Eutergesundheit wieder. In Abb. 6 und 7 zeichnete sich für beide Ausstricharten ein Anstieg der PMN und eine Abnahme der mononukleären Zellen (Lymphozyten und Makrophagen) ab. Die statistische Untersuchung dieser Veränderungen ergab, daß mit der Methode Kaffeemühle geringfügig mehr Signifikanzen gefunden wurden. Dieses Ergebnis unterstützt den subjektiven, nicht dokumentierten Befund des Untersuchers, daß mit der Kaffeemühle ein besser interpretierbarer Ausstrich erreicht wurde (siehe auch Abb. 5) 80
99 Ergebnisse PMN Kaffeemühle (A) PMN KSA (B) Lymphozyt Kaffeemühle (C) Lymphozyt KSA (D) Makrophage Kaffeemühle (E) Makrophage KSA (F) Abb. 5: Milchzellausstriche A - H, mikroskopiert bei 1000 facher Vergrößerung in Ölimmersion (Bilder E 1 u. E 2 siehe folgende Seite) 81
100 Ergebnisse Makrophage Kaffeemühle (E 1 oben + E 2 unten) 82
Diagnostik an Blutzellen
 Diagnostik an Blutzellen Was ist ein Blutbild? Was ist der Hämatokrit? Wie werden Zellen im Blut Untersucht? Marker zur Identifizierung von Zellen im Blut Diagnostik an Blutzellen Blut Plasma (ca. 55%)
Diagnostik an Blutzellen Was ist ein Blutbild? Was ist der Hämatokrit? Wie werden Zellen im Blut Untersucht? Marker zur Identifizierung von Zellen im Blut Diagnostik an Blutzellen Blut Plasma (ca. 55%)
Durchflusszytometrische BALF-Diagnostik
 Durchflusszytometrische BALF-Diagnostik Gliederung 1. Lymphozytenidentifizierung 2. Durchflusszytometrie als Methode 3. Bearbeitung der Proben 4. Typische Befunde und Probleme 5. Blick in die Zukunft Dagmar
Durchflusszytometrische BALF-Diagnostik Gliederung 1. Lymphozytenidentifizierung 2. Durchflusszytometrie als Methode 3. Bearbeitung der Proben 4. Typische Befunde und Probleme 5. Blick in die Zukunft Dagmar
Thüringer Landesanstalt. für Landwirtschaft, Beurteilung der Eutergesundheit von Milchkühen anhand der Leitfähig- keitsmessungen mit dem Mastitron
 Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Beurteilung der Eutergesundheit von Milchkühen anhand der Leitfähig- keitsmessungen mit dem Mastitron Gerät Clausberg, Juli 06 Thüringer Ministerium für Landwirtschaft,
Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Beurteilung der Eutergesundheit von Milchkühen anhand der Leitfähig- keitsmessungen mit dem Mastitron Gerät Clausberg, Juli 06 Thüringer Ministerium für Landwirtschaft,
UE Biochemie II: Flow Cytometry
 UE Biochemie II: Flow Cytometry Lerninhalt: Grundlagen der Durchflußzytometrie: Forward Scatter, Side Scatter, Fluoreszenzintensität; FACS; Lymphozytenpräparation über Ficoll; Hintergrund: Siehe Vorlesung
UE Biochemie II: Flow Cytometry Lerninhalt: Grundlagen der Durchflußzytometrie: Forward Scatter, Side Scatter, Fluoreszenzintensität; FACS; Lymphozytenpräparation über Ficoll; Hintergrund: Siehe Vorlesung
Angeborene und erworbene Immunantwort
 Molekulare Mechanismen der Pathogenese bei Infektionskrankheiten Angeborene und erworbene Immunantwort Hans-Georg Kräusslich Abteilung Virologie, Hygiene Institut INF 324, 4.OG http://www.virology-heidelberg.de
Molekulare Mechanismen der Pathogenese bei Infektionskrankheiten Angeborene und erworbene Immunantwort Hans-Georg Kräusslich Abteilung Virologie, Hygiene Institut INF 324, 4.OG http://www.virology-heidelberg.de
3 Ergebnisse 3.1 Charakterisierung der untersuchten Melanome
 3 Ergebnisse 3.1 Charakterisierung der untersuchten Melanome Untersucht wurden insgesamt 26 Melanome, die zwischen 1991 und 1997 in der Universitätsklinik und Poliklinik für Dermatologie und Venerologie
3 Ergebnisse 3.1 Charakterisierung der untersuchten Melanome Untersucht wurden insgesamt 26 Melanome, die zwischen 1991 und 1997 in der Universitätsklinik und Poliklinik für Dermatologie und Venerologie
Durchflusszytometrie (Flow
 Durchflusszytometrie (Flow cytometry) Institut für Immunologie und Biotechnologie ie, Medizin inischeische Fakult ultät Universität Pécs Das Prinzip und Bedeutung der Durchflusszytometrie Flowcytometrie
Durchflusszytometrie (Flow cytometry) Institut für Immunologie und Biotechnologie ie, Medizin inischeische Fakult ultät Universität Pécs Das Prinzip und Bedeutung der Durchflusszytometrie Flowcytometrie
Hart aber fair. Der Faktencheck in Sachen Mastitis. 5 Dinge, die Sie über Kennzahlen zur Eutergesundheit wissen sollten
 Hart aber fair Der Faktencheck in Sachen Mastitis 5 Dinge, die Sie über Kennzahlen zur Eutergesundheit wissen sollten 1 Klinische Untersuchung + Dokumentation Die klinische Untersuchung ist die Grundlage
Hart aber fair Der Faktencheck in Sachen Mastitis 5 Dinge, die Sie über Kennzahlen zur Eutergesundheit wissen sollten 1 Klinische Untersuchung + Dokumentation Die klinische Untersuchung ist die Grundlage
5. Untersuchungsmethode
 5. Untersuchungsmethode 5.1. Grundlagen der Durchflußzytometrie Das Durchflußzytometer besteht aus dem System zur Probeneingabe, dem optischen System mit Lichtquelle und Detektorsystem sowie einer Datenverarbeitungseinheit.
5. Untersuchungsmethode 5.1. Grundlagen der Durchflußzytometrie Das Durchflußzytometer besteht aus dem System zur Probeneingabe, dem optischen System mit Lichtquelle und Detektorsystem sowie einer Datenverarbeitungseinheit.
Anacker, Gerhard, (Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft, Aussenstelle Clausberg, Oberellen OT Clausberg);
 1 Nr.: V-094 Beeinflussung der qualität durch die Eutergesundheit Anacker, Gerhard, (Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft, Aussenstelle Clausberg, Oberellen OT Clausberg); 1. Einleitung Die gehört
1 Nr.: V-094 Beeinflussung der qualität durch die Eutergesundheit Anacker, Gerhard, (Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft, Aussenstelle Clausberg, Oberellen OT Clausberg); 1. Einleitung Die gehört
4.2 Kokulturen Epithelzellen und Makrophagen
 Ergebnisse 4.2 Kokulturen Epithelzellen und Makrophagen Nach der eingehenden Untersuchung der einzelnen Zelllinien wurden die Versuche auf Kokulturen aus den A549-Epithelzellen und den Makrophagenzelllinien
Ergebnisse 4.2 Kokulturen Epithelzellen und Makrophagen Nach der eingehenden Untersuchung der einzelnen Zelllinien wurden die Versuche auf Kokulturen aus den A549-Epithelzellen und den Makrophagenzelllinien
Biochemische Übungen II Teil 3: Flow Cytometry/FACS. Dr. Richard Weiss
 Biochemische Übungen II Teil 3: Flow Cytometry/FACS Dr. Richard Weiss A) Flow Cytometry Durchflußzytometrie (flow cytometry) Ermöglicht die simultane Messung mehrerer physikalischer Charakteristika einzelner
Biochemische Übungen II Teil 3: Flow Cytometry/FACS Dr. Richard Weiss A) Flow Cytometry Durchflußzytometrie (flow cytometry) Ermöglicht die simultane Messung mehrerer physikalischer Charakteristika einzelner
Bei näherer Betrachtung des Diagramms Nr. 3 fällt folgendes auf:
 18 3 Ergebnisse In diesem Kapitel werden nun zunächst die Ergebnisse der Korrelationen dargelegt und anschließend die Bedingungen der Gruppenbildung sowie die Ergebnisse der weiteren Analysen. 3.1 Ergebnisse
18 3 Ergebnisse In diesem Kapitel werden nun zunächst die Ergebnisse der Korrelationen dargelegt und anschließend die Bedingungen der Gruppenbildung sowie die Ergebnisse der weiteren Analysen. 3.1 Ergebnisse
Einfluss der Zellgehalte der Milch auf die Milchleistung von Kühen
 Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei MV Einfluss der Zellgehalte der Milch auf die Milchleistung von Kühen Birgit Rudolphi Institut für Tierproduktion Dummerstorf Landesforschungsanstalt
Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei MV Einfluss der Zellgehalte der Milch auf die Milchleistung von Kühen Birgit Rudolphi Institut für Tierproduktion Dummerstorf Landesforschungsanstalt
Die Zellen des Immunsystems Kein umschlossenes Organsystem; Immunzellen zirkulieren im Blut und im lymphatischen System
 Die Zellen und Organe des Immunsystems Die Zellen des Immunsystems Kein umschlossenes Organsystem; Immunzellen zirkulieren im Blut und im lymphatischen System Leukozyten (Weiβblutzellen): - neutrophile
Die Zellen und Organe des Immunsystems Die Zellen des Immunsystems Kein umschlossenes Organsystem; Immunzellen zirkulieren im Blut und im lymphatischen System Leukozyten (Weiβblutzellen): - neutrophile
Medizinische Immunologie. Vorlesung 6 Effektormechanismen
 Medizinische Immunologie Vorlesung 6 Effektormechanismen Effektormechanismen Spezifische Abwehrmechanismen Effektormechanismen der zellulären Immunantwort - allgemeine Prinzipien - CTL (zytotoxische T-Lymphozyten)
Medizinische Immunologie Vorlesung 6 Effektormechanismen Effektormechanismen Spezifische Abwehrmechanismen Effektormechanismen der zellulären Immunantwort - allgemeine Prinzipien - CTL (zytotoxische T-Lymphozyten)
4.6. MR-tomographische Untersuchung an Leber, Milz und Knochenmark
 4.6. MR-tomographische Untersuchung an Leber, Milz und Knochenmark Die folgenden Darstellungen sollen einen Überblick über das Signalverhalten von Leber, Milz und Knochenmark geben. Die Organe wurden zusammen
4.6. MR-tomographische Untersuchung an Leber, Milz und Knochenmark Die folgenden Darstellungen sollen einen Überblick über das Signalverhalten von Leber, Milz und Knochenmark geben. Die Organe wurden zusammen
Hämatopoese TITAN. Dezember 2005 S.Gärtner
 Hämatopoese Alle reifen Blutzellen stammen von pluripotenten hämatopoetischen Stammzellen ab, die sich von Geburt an im Knochenmark, in der Leber und der Milz befinden. Hämatopoese Die hämapoetischen Stammzelle
Hämatopoese Alle reifen Blutzellen stammen von pluripotenten hämatopoetischen Stammzellen ab, die sich von Geburt an im Knochenmark, in der Leber und der Milz befinden. Hämatopoese Die hämapoetischen Stammzelle
NEUE BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN MONOKLONALE ANTIKÖRPER
 NEUE BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN MONOKLONALE ANTIKÖRPER Was sind Antikörper? Antikörper patrouillieren wie Wächter im Blutkreislauf des Körpers und achten auf Krankheitserreger wie Bakterien, Viren und Parasiten
NEUE BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN MONOKLONALE ANTIKÖRPER Was sind Antikörper? Antikörper patrouillieren wie Wächter im Blutkreislauf des Körpers und achten auf Krankheitserreger wie Bakterien, Viren und Parasiten
Aus der Tierklinik für Geburtshilfe und Fortpflanzungsstörungen des Fachbereiches Veterinärmedizin der Freien Universität Berlin (Standort Mitte)
 Aus der Tierklinik für Geburtshilfe und Fortpflanzungsstörungen des Fachbereiches Veterinärmedizin der Freien Universität Berlin (Standort Mitte) Eutergesundheitsstörungen bei Mutterkühen Inaugural Dissertation
Aus der Tierklinik für Geburtshilfe und Fortpflanzungsstörungen des Fachbereiches Veterinärmedizin der Freien Universität Berlin (Standort Mitte) Eutergesundheitsstörungen bei Mutterkühen Inaugural Dissertation
Im Einsatz reduziert der C-Chip das Infektionsrisiko durch minimierte Exposition zu biologisch aktiven, infektiösen Materialien.
 Tipps zum Zählen von Zellen mit der neuen Einweg-Zählkammer C-Chip C Chip Biochrom AG Information Die Einweg-Zählkammer C-Chip aus Kunststoff sieht genauso aus wie die bekannte Neubauer improved -Zählkammer.
Tipps zum Zählen von Zellen mit der neuen Einweg-Zählkammer C-Chip C Chip Biochrom AG Information Die Einweg-Zählkammer C-Chip aus Kunststoff sieht genauso aus wie die bekannte Neubauer improved -Zählkammer.
Stärkt Sport das Immunsystem?
 Sport Frank Huhndorf Stärkt Sport das Immunsystem? Studienarbeit 1 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung...2 2. Das Immunsystem...3 2.1 Die Leukozyten...3 2.2 Die Aufgabenverteilung der Leukozyten...4 3. Auswirkungen
Sport Frank Huhndorf Stärkt Sport das Immunsystem? Studienarbeit 1 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung...2 2. Das Immunsystem...3 2.1 Die Leukozyten...3 2.2 Die Aufgabenverteilung der Leukozyten...4 3. Auswirkungen
Zellen des Immunsystems
 7 Zellen des Immunsystems S. H. E. Kaufmann.1 Hämatopoese 8. Polymorphkernige Granulozyten 8.3 Lymphozyten 9.4 Zellen des mononukleär- phagozytären Systems 11.5 Antigenpräsentierende Zellen 1 Stefan H.
7 Zellen des Immunsystems S. H. E. Kaufmann.1 Hämatopoese 8. Polymorphkernige Granulozyten 8.3 Lymphozyten 9.4 Zellen des mononukleär- phagozytären Systems 11.5 Antigenpräsentierende Zellen 1 Stefan H.
1.1 Einführung in die Problematik 1 1.2 Zielsetzung 9
 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 1.1 Einführung in die Problematik 1 1.2 Zielsetzung 9 2. Material und Methoden 2.1 Material 2.1.1 Chemikalien 11 2.1.2 Materialien für die Säulenchromatographie 12 2.1.3
Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 1.1 Einführung in die Problematik 1 1.2 Zielsetzung 9 2. Material und Methoden 2.1 Material 2.1.1 Chemikalien 11 2.1.2 Materialien für die Säulenchromatographie 12 2.1.3
Halte das Papier sofort nach dem Auftupfen gegen das Licht. Föhne die Flecken trocken und halte das Filterpapier noch einmal gegen das Licht.
 Fettfleckprobe Pipetten, Filterpapier, Föhn Speiseöl, Wasser, verschiedene Milchsorten, Sahne Tropfe auf ein Filterpapier 1 Tropfen Wasser, 1 Tropfen Öl und jeweils einen Tropfen von jeder Milchsorte und
Fettfleckprobe Pipetten, Filterpapier, Föhn Speiseöl, Wasser, verschiedene Milchsorten, Sahne Tropfe auf ein Filterpapier 1 Tropfen Wasser, 1 Tropfen Öl und jeweils einen Tropfen von jeder Milchsorte und
Beurteilungen von Veränderungen in der Protein-Elektrophorese
 1 Beurteilungen von Veränderungen in der Protein-Elektrophorese Darstellung - Kurvenbild (Pherogramm) - Quantitative Veränderungen Interpretation - Bewertung der Relevanz - Kommentierung Protein-Elektrophorese
1 Beurteilungen von Veränderungen in der Protein-Elektrophorese Darstellung - Kurvenbild (Pherogramm) - Quantitative Veränderungen Interpretation - Bewertung der Relevanz - Kommentierung Protein-Elektrophorese
Morphologie: BILDER und Begriffe
 Morphologie: BILDER und Begriffe 1. WBC Besonderheiten A) Quantitative Besonderheiten im morphologischen Bild der Neutrophilen Neutrophilie (mikroskopisches Bild bei 800-1000facher Vergrößerung) mikroskopisch:
Morphologie: BILDER und Begriffe 1. WBC Besonderheiten A) Quantitative Besonderheiten im morphologischen Bild der Neutrophilen Neutrophilie (mikroskopisches Bild bei 800-1000facher Vergrößerung) mikroskopisch:
Veränderungen in ausgewählten Verhaltensweisen bei brünstigen Kühen in der Milchproduktion
 Veränderungen in ausgewählten Verhaltensweisen bei brünstigen Kühen in der Milchproduktion Berit Füllner und Heiko Scholz, Hochschule Anhalt, Fachbereich LOEL Die Fruchtbarkeit der Milchkühe wird durch
Veränderungen in ausgewählten Verhaltensweisen bei brünstigen Kühen in der Milchproduktion Berit Füllner und Heiko Scholz, Hochschule Anhalt, Fachbereich LOEL Die Fruchtbarkeit der Milchkühe wird durch
Chronische lymphatische Leukämie
 Chronische lymphatische Leukämie Zytologie Immunphänotypisierung Prof. Dr. med. Roland Fuchs Dr. med. J. Panse Medizinische Klinik IV Zytogenetik Prof. Dr. med. Detlef Haase Zentrum Innnere Medizin 1/17
Chronische lymphatische Leukämie Zytologie Immunphänotypisierung Prof. Dr. med. Roland Fuchs Dr. med. J. Panse Medizinische Klinik IV Zytogenetik Prof. Dr. med. Detlef Haase Zentrum Innnere Medizin 1/17
Schattauer Schattauer 2010 Schattauer GmbH, Stuttgart
 7 Blut 2010 GmbH, Stuttgart Blutzellen Megakaryoblast Proerythroblasten/Erythroblasten Fettzelle Proerythroblasten/Erythroblasten Zellen der myeloischen Differenzierungsreihen Knochenmark, Rind. Färbung
7 Blut 2010 GmbH, Stuttgart Blutzellen Megakaryoblast Proerythroblasten/Erythroblasten Fettzelle Proerythroblasten/Erythroblasten Zellen der myeloischen Differenzierungsreihen Knochenmark, Rind. Färbung
Alien Invasion I. Univ.-Prof. Dr. Albert Duschl
 Alien Invasion I Univ.-Prof. Dr. Albert Duschl Bakterien und wir Bakterien sind ein normaler und notwendiger Teil unserer Umwelt. Unser Körper enthält 10 14 Bakterien, aber nur 10 13 Eukaryontenzellen.
Alien Invasion I Univ.-Prof. Dr. Albert Duschl Bakterien und wir Bakterien sind ein normaler und notwendiger Teil unserer Umwelt. Unser Körper enthält 10 14 Bakterien, aber nur 10 13 Eukaryontenzellen.
Y Y. Natürliche (Angeborene) Immunität. Spezifische (erworbene) Immunität. Bakterien. Lymphozyt. T-Lymphozyten. EPITHELIALE Barriere PHAGOZYTEN
 Natürliche (Angeborene) Immunität Bakterien Spezifische (erworbene) Immunität B-Lymphozyten EPITHELIALE Barriere Knochenmark Y Y Y Y Y PHAGOZYTEN Stammzelle kleiner Lymphoblasten Effektor- Lymphozyt mechanismen
Natürliche (Angeborene) Immunität Bakterien Spezifische (erworbene) Immunität B-Lymphozyten EPITHELIALE Barriere Knochenmark Y Y Y Y Y PHAGOZYTEN Stammzelle kleiner Lymphoblasten Effektor- Lymphozyt mechanismen
Etablierung, Validierung und praktische Anwendung einer multiplex real-time RT-PCR zum Nachweis des Rabbit Haemorrhagic Disease Virus
 Aus dem Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover und dem Institut für Virusdiagnostik des Friedrich-Loeffler-Instituts, Insel Riems Etablierung, Validierung und praktische Anwendung
Aus dem Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover und dem Institut für Virusdiagnostik des Friedrich-Loeffler-Instituts, Insel Riems Etablierung, Validierung und praktische Anwendung
8. Statistik Beispiel Noten. Informationsbestände analysieren Statistik
 Informationsbestände analysieren Statistik 8. Statistik Nebst der Darstellung von Datenreihen bildet die Statistik eine weitere Domäne für die Auswertung von Datenbestände. Sie ist ein Fachgebiet der Mathematik
Informationsbestände analysieren Statistik 8. Statistik Nebst der Darstellung von Datenreihen bildet die Statistik eine weitere Domäne für die Auswertung von Datenbestände. Sie ist ein Fachgebiet der Mathematik
SHIGATOXIN-SPEZIFISCHE IMMUNGLOBULINE UND AUSSCHEIDUNG VON SHIGATOXIN-BILDENDEN ESCHERICHIÄ COLI BEI KÄLBERN
 Aus dem Institut für Hygiene und Infektionskrankheiten der Tiere Justus-Liebig-Universität Gießen Betreuer: PD Dr. med. vet. C. Menge SHIGATOXIN-SPEZIFISCHE IMMUNGLOBULINE UND AUSSCHEIDUNG VON SHIGATOXIN-BILDENDEN
Aus dem Institut für Hygiene und Infektionskrankheiten der Tiere Justus-Liebig-Universität Gießen Betreuer: PD Dr. med. vet. C. Menge SHIGATOXIN-SPEZIFISCHE IMMUNGLOBULINE UND AUSSCHEIDUNG VON SHIGATOXIN-BILDENDEN
Kontrolle des murinen Cytomegalovirus durch. y6 T-Zellen
 Kontrolle des murinen Cytomegalovirus durch y6 T-Zellen Der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zur Erlangung des Doktorgrades Dr. rer. nat. vorgelegt
Kontrolle des murinen Cytomegalovirus durch y6 T-Zellen Der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zur Erlangung des Doktorgrades Dr. rer. nat. vorgelegt
Einfluss von Immunsuppressiva auf die antivirale T-Zellantwort ex vivo
 Aus der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin Tübingen Abteilung Kinderheilkunde I mit Poliklinik Ärztlicher Direktor: Professor Dr. R. Handgretinger Einfluss von Immunsuppressiva auf die antivirale
Aus der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin Tübingen Abteilung Kinderheilkunde I mit Poliklinik Ärztlicher Direktor: Professor Dr. R. Handgretinger Einfluss von Immunsuppressiva auf die antivirale
Flavonoide in Zitronensaft. Stabilität und antioxidative Wirkung
 Medizin Vanessa Schuh Flavonoide in Zitronensaft. Stabilität und antioxidative Wirkung Masterarbeit UNTERSUCHUNGEN ZUR STABILITÄT UND ANTIOXIDATIVEN WIRKUNG VON FLAVONOIDEN IM ZITRONENSAFT Masterarbeit
Medizin Vanessa Schuh Flavonoide in Zitronensaft. Stabilität und antioxidative Wirkung Masterarbeit UNTERSUCHUNGEN ZUR STABILITÄT UND ANTIOXIDATIVEN WIRKUNG VON FLAVONOIDEN IM ZITRONENSAFT Masterarbeit
3.2.1 Neurogeneserate der magnetfeldbehandelten Tiere aus restriktiver Haltung
 Eigene Untersuchungen 25 3.2 Ergebnisse 3.2.1 Neurogeneserate der magnetfeldbehandelten Tiere aus restriktiver Haltung Untersucht wurde, ob die Magnetfeldbehandlung mit 1, 8, 12, 29 und 5 Hz einen Einfluss
Eigene Untersuchungen 25 3.2 Ergebnisse 3.2.1 Neurogeneserate der magnetfeldbehandelten Tiere aus restriktiver Haltung Untersucht wurde, ob die Magnetfeldbehandlung mit 1, 8, 12, 29 und 5 Hz einen Einfluss
VERSUCH 3: ERSTELLEN EINES BLUTBILDES
 VERSUCH 3: ERSTELLEN EINES BLUTBILDES LERNZIELE: 1) Immunphänotypisierung allergischer vs. naiver Mäuse 2) Auswertung von FACS Daten mittels Cyflogic Software 3) Statistischer Vergleich zwischen den Gruppen
VERSUCH 3: ERSTELLEN EINES BLUTBILDES LERNZIELE: 1) Immunphänotypisierung allergischer vs. naiver Mäuse 2) Auswertung von FACS Daten mittels Cyflogic Software 3) Statistischer Vergleich zwischen den Gruppen
VERSUCH 2: GRUNDLAGEN DER DURCHFLUSSZYTOMETRIE
 VERSUCH 2: GRUNDLAGEN DER DURCHFLUSSZYTOMETRIE LERNZIELE: 1) Theoretische Grundlagen der Durchflusszytometrie 2) Trockentraining mit dem FACS-Simulator 3) Erstellen einer Kalibrierung am Gerät mittels
VERSUCH 2: GRUNDLAGEN DER DURCHFLUSSZYTOMETRIE LERNZIELE: 1) Theoretische Grundlagen der Durchflusszytometrie 2) Trockentraining mit dem FACS-Simulator 3) Erstellen einer Kalibrierung am Gerät mittels
Eutergesundheit in Hessen, Entwicklung, aktuelle Situation und Ausblick
 Eutergesundheit in Hessen, Entwicklung, aktuelle Situation und Ausblick Dr. Michael Zschöck Gießen, 18.06.2014 Produktionswerte aus tierischer Erzeugung in Deutschland 2010 16% 10% 26% 4% 1% 43% Kuhmilch
Eutergesundheit in Hessen, Entwicklung, aktuelle Situation und Ausblick Dr. Michael Zschöck Gießen, 18.06.2014 Produktionswerte aus tierischer Erzeugung in Deutschland 2010 16% 10% 26% 4% 1% 43% Kuhmilch
T-Lymphozyten. T-Lymphozyten erkennen spezifisch nur zell- ständige Antigene (Proteine!) und greifen sie direkt an. verantwortlich.
 T-Lymphozyten T-Lymphozyten erkennen spezifisch nur zell- ständige Antigene (Proteine!) und greifen sie direkt an. Sie sind für die zellvermittelte Immunität verantwortlich. Antigenerkennung B Zellen erkennen
T-Lymphozyten T-Lymphozyten erkennen spezifisch nur zell- ständige Antigene (Proteine!) und greifen sie direkt an. Sie sind für die zellvermittelte Immunität verantwortlich. Antigenerkennung B Zellen erkennen
Vergleichbarkeitsklassen
 ÖQUASTA Seite: 1/ 5 Parameter: Hämoglobin Parameter: Hämatokrit Parameter: MCV Parameter: MCHC Parameter: RDW-CV Parameternummer,name ÖQUASTA Seite: 2/ 5 Parameter: RDW-CV Parameter: Erythrozyten Parameter:
ÖQUASTA Seite: 1/ 5 Parameter: Hämoglobin Parameter: Hämatokrit Parameter: MCV Parameter: MCHC Parameter: RDW-CV Parameternummer,name ÖQUASTA Seite: 2/ 5 Parameter: RDW-CV Parameter: Erythrozyten Parameter:
Hierarchie der Blutzellen
 Hierarchie der Blutzellen Erythozyten Anzahl: 4,2-6,5 Mio/µl Blut (Frauen: 4,2-5,4 Mio/µl, Männer: 4,6-6,2 Mio/µl) Größe: 7-8 µm Proerythrozyten Normoblasten Auflösung des Kerns, Ausschwemmen in Blut Retikulozyten
Hierarchie der Blutzellen Erythozyten Anzahl: 4,2-6,5 Mio/µl Blut (Frauen: 4,2-5,4 Mio/µl, Männer: 4,6-6,2 Mio/µl) Größe: 7-8 µm Proerythrozyten Normoblasten Auflösung des Kerns, Ausschwemmen in Blut Retikulozyten
Kuh - und umweltassoziierte Mastitiserreger Klassische Nachweismethoden, Vorkommen, Resistenzentwicklung, Therapieansätze *
 Kuh - und umweltassoziierte Mastitiserreger Klassische Nachweismethoden, Vorkommen, Resistenzentwicklung, Therapieansätze * Klaus Fehlings Fachabteilung Eutergesundheitsdienst und Milchhygiene des Tiergesundheitsdienstes
Kuh - und umweltassoziierte Mastitiserreger Klassische Nachweismethoden, Vorkommen, Resistenzentwicklung, Therapieansätze * Klaus Fehlings Fachabteilung Eutergesundheitsdienst und Milchhygiene des Tiergesundheitsdienstes
Inhalt 1 Das Immunsystem Rezeptoren des Immunsystems
 Inhalt 1 Das Immunsystem 1.1 Bedeutung des Immunsystems..................................... 1 1.2 Das Immunsystem unterscheidet zwischen körpereigen und körperfremd.................................................
Inhalt 1 Das Immunsystem 1.1 Bedeutung des Immunsystems..................................... 1 1.2 Das Immunsystem unterscheidet zwischen körpereigen und körperfremd.................................................
Standardisierte Vorgehensweisen und Regeln zur Gewährleistung von: Eindeutigkeit Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden sind nur dann zwingend
 Standardisierte Vorgehensweisen und Regeln zur Gewährleistung von: Eindeutigkeit Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden sind nur dann zwingend oder eindeutig, wenn keine alternativen Interpretationsmöglichkeiten
Standardisierte Vorgehensweisen und Regeln zur Gewährleistung von: Eindeutigkeit Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden sind nur dann zwingend oder eindeutig, wenn keine alternativen Interpretationsmöglichkeiten
Tierärztliche Hochschule Hannover
 Tierärztliche Hochschule Hannover Vergleich der magnetresonanztomographischen und computertomographischen Darstellung der Organstrukturen von Wasserschildkröten INAUGURAL - DISSERTATION zur Erlangung des
Tierärztliche Hochschule Hannover Vergleich der magnetresonanztomographischen und computertomographischen Darstellung der Organstrukturen von Wasserschildkröten INAUGURAL - DISSERTATION zur Erlangung des
Basale Aufgabe eines Immunsystems
 Komponenten und Aufbau des Immunsystems Initiation von Immunantworten lymphatische Organe Erkennungsmechanismen Lymphozytenentwicklung Entstehung und Verlauf adaptiver Immunantworten 1 Basale Aufgabe eines
Komponenten und Aufbau des Immunsystems Initiation von Immunantworten lymphatische Organe Erkennungsmechanismen Lymphozytenentwicklung Entstehung und Verlauf adaptiver Immunantworten 1 Basale Aufgabe eines
Inhaltsverzeichnis.
 IX 1 Das Immunsystem: eine Übersicht l 1.1 Was ist Immunologie? 2 1.2 Seit wann gibt es ein Immunsystem? 2 1.3 Unser Immunsystem 4 Äußere Schutzmechanismen 4 Das angeborene Immunsystem ist die erste Verteidigungslinie
IX 1 Das Immunsystem: eine Übersicht l 1.1 Was ist Immunologie? 2 1.2 Seit wann gibt es ein Immunsystem? 2 1.3 Unser Immunsystem 4 Äußere Schutzmechanismen 4 Das angeborene Immunsystem ist die erste Verteidigungslinie
Tipps und Tricks für die Präanalytik des konventionellen Differenzialblutbildes
 Tipps und Tricks für die Präanalytik des konventionellen Differenzialblutbildes Xtra Vol. 15.2 2012 Nr. 1 Das Differentialblutbild ist eine Routineuntersuchung in der medizinischen Labordiagnostik und
Tipps und Tricks für die Präanalytik des konventionellen Differenzialblutbildes Xtra Vol. 15.2 2012 Nr. 1 Das Differentialblutbild ist eine Routineuntersuchung in der medizinischen Labordiagnostik und
Methylglyoxal in Manuka-Honig (Leptospermum scoparium):
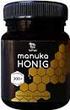 Methylglyoxal in Manuka-Honig (Leptospermum scoparium): Bildung, Wirkung, Konsequenzen DISSERTATION zur Erlangung des akademischen Grades Doctor rerum naturalium (Dr. rer. nat.) vorgelegt der Fakultät
Methylglyoxal in Manuka-Honig (Leptospermum scoparium): Bildung, Wirkung, Konsequenzen DISSERTATION zur Erlangung des akademischen Grades Doctor rerum naturalium (Dr. rer. nat.) vorgelegt der Fakultät
Eutergesundheit Landwirtschaftskammer Oberösterreich
 Eutergesundheit Landwirtschaftskammer Oberösterreich Beratungsstelle Rinderproduktion (Stand August 2013) Gesunde Euter und die Produktion von qualitativ hochwertiger Milch sind ein wesentlicher Beitrag
Eutergesundheit Landwirtschaftskammer Oberösterreich Beratungsstelle Rinderproduktion (Stand August 2013) Gesunde Euter und die Produktion von qualitativ hochwertiger Milch sind ein wesentlicher Beitrag
Granulozytenfunktionstest und ELISpot. PD Dr. med. Monika Lindemann
 Granulozytenfunktionstest und ELISpot PD Dr. med. Monika Lindemann 1 Granulozytenfunktionstest (NBT-Test) Bedeutung und Prinzip Zur Abwehr mikrobieller Infektionen sind sowohl ein intaktes Erkennungssystem,
Granulozytenfunktionstest und ELISpot PD Dr. med. Monika Lindemann 1 Granulozytenfunktionstest (NBT-Test) Bedeutung und Prinzip Zur Abwehr mikrobieller Infektionen sind sowohl ein intaktes Erkennungssystem,
EliSpot in der Borreliose-Diagnostik
 EliSpot in der Borreliose-Diagnostik 27.02.2016 Update Lyme Disease for Practitioners BCA-clinic Augsburg Infektion - Infektionserkrankung Invasion und Vermehrung von Mikroorganismen im menschlichen Organismus
EliSpot in der Borreliose-Diagnostik 27.02.2016 Update Lyme Disease for Practitioners BCA-clinic Augsburg Infektion - Infektionserkrankung Invasion und Vermehrung von Mikroorganismen im menschlichen Organismus
Zweigbibliothek Medizin
 Sächsäsche Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) Zweigbibliothek Medizin Diese Dissertation finden Sie original in Printform zur Ausleihe in der Zweigbibliothek Medizin Nähere
Sächsäsche Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) Zweigbibliothek Medizin Diese Dissertation finden Sie original in Printform zur Ausleihe in der Zweigbibliothek Medizin Nähere
Einfluss von Clostridienbelastung und Hygieneniveau auf Zellgehalt und Keimzahl
 Einfluss von Clostridienbelastung und Hygieneniveau auf Zellgehalt und Keimzahl Fragestellung: In der Praxis werden immer wieder die Fragen gestellt: Gibt es zwischen den 3 Qualitätsmerkmalen der Milch
Einfluss von Clostridienbelastung und Hygieneniveau auf Zellgehalt und Keimzahl Fragestellung: In der Praxis werden immer wieder die Fragen gestellt: Gibt es zwischen den 3 Qualitätsmerkmalen der Milch
Grundlagen der Durchflusszytometrie. Dipl.-Ing. Markus Hermann
 Grundlagen der Durchflusszytometrie 1 Durchflusszytometrie Definition : Automatisierte Licht- und Fluoreszenzmikroskopie an Einzelzellen im kontinuierlichen Probendurchfluss! FACS: Fluorescence activated
Grundlagen der Durchflusszytometrie 1 Durchflusszytometrie Definition : Automatisierte Licht- und Fluoreszenzmikroskopie an Einzelzellen im kontinuierlichen Probendurchfluss! FACS: Fluorescence activated
Bildungausstrich HD
 Februar 2012 Bildungausstrich 11-11-HD Mit dem Ringversuch 11-11-HD hat das CSCQ den Teilnehmern kostenlos einen zusätzlichen Ausstrich zu Weiterbildungszwecken angeboten. Dieses Dokument entspricht dem
Februar 2012 Bildungausstrich 11-11-HD Mit dem Ringversuch 11-11-HD hat das CSCQ den Teilnehmern kostenlos einen zusätzlichen Ausstrich zu Weiterbildungszwecken angeboten. Dieses Dokument entspricht dem
5. Oktober 2011. Wie interpretiert man den quantitativen Immunstatus
 5. Oktober 2011 Wie interpretiert man den quantitativen Immunstatus Dr. med. Volker von Baehr Zelluläre Elemente des Immunsystems Unspezifisches Immunsystem (angeboren, nicht lernfähig) Monozyten Gewebemakrophagen
5. Oktober 2011 Wie interpretiert man den quantitativen Immunstatus Dr. med. Volker von Baehr Zelluläre Elemente des Immunsystems Unspezifisches Immunsystem (angeboren, nicht lernfähig) Monozyten Gewebemakrophagen
5 Zusammenfassung und Schlussfolgerung
 5 Zusammenfassung und Schlussfolgerung Einleitung In der Schwangerschaft vollziehen sich Veränderungen des Kohlenhydratstoffwechsels im Sinne einer Insulinresistenz sowie eines Anstieges der Blutfettwerte.
5 Zusammenfassung und Schlussfolgerung Einleitung In der Schwangerschaft vollziehen sich Veränderungen des Kohlenhydratstoffwechsels im Sinne einer Insulinresistenz sowie eines Anstieges der Blutfettwerte.
Strahleninduzierte Apoptose bei ESRT im Mausmodell
 Strahleninduzierte Apoptose bei ESRT im Mausmodell Die Apoptose ist von vielen ineinandergreifenden Mechanismen abhängig, in deren Regulationsmittelpunkt die Caspasen als ausführende Cysteinproteasen stehen.
Strahleninduzierte Apoptose bei ESRT im Mausmodell Die Apoptose ist von vielen ineinandergreifenden Mechanismen abhängig, in deren Regulationsmittelpunkt die Caspasen als ausführende Cysteinproteasen stehen.
Dr. med. Joachim Teichmann
 Aus dem Zentrum für Innere Medizin Medizinische Klinik und Poliklinik III Klinikum der Justus-Liebig-Universität Giessen (Direktor: Prof. Dr. med. R.G. Bretzel) Knochenstoffwechsel und pathogenetisch relevante
Aus dem Zentrum für Innere Medizin Medizinische Klinik und Poliklinik III Klinikum der Justus-Liebig-Universität Giessen (Direktor: Prof. Dr. med. R.G. Bretzel) Knochenstoffwechsel und pathogenetisch relevante
Institute for Immunology and Thymus Research Laboratory for Autologous Adult Stem Cell Research and Therapy
 Institute for Immunology and Thymus Research Laboratory for Autologous Adult Stem Cell Research and Therapy Rudolf-Huch-Str. 14 D- 38667 Bad Harzburg Tel: +49 (0)5322 96 05 14 Fax: +49 (0)5322 96 05 16
Institute for Immunology and Thymus Research Laboratory for Autologous Adult Stem Cell Research and Therapy Rudolf-Huch-Str. 14 D- 38667 Bad Harzburg Tel: +49 (0)5322 96 05 14 Fax: +49 (0)5322 96 05 16
Einführung in die Immunologie Zellen & Organe
 Das Immunsystem Einführung in die Immunologie Zellen & Organe Kirsten Gehlhar Das Immunsystem (lat.: immunis = frei, unberührt) ist kein einzelnes Organ. Es besteht aus spezialisierten Zellen im Blut und
Das Immunsystem Einführung in die Immunologie Zellen & Organe Kirsten Gehlhar Das Immunsystem (lat.: immunis = frei, unberührt) ist kein einzelnes Organ. Es besteht aus spezialisierten Zellen im Blut und
RESOLUTION OIV/OENO 427/2010 KRITERIEN FÜR METHODEN ZUR QUANTIFIZIERUNG VON POTENTIELL ALLERGENEN RÜCKSTÄNDEN EIWEISSHALTIGER SCHÖNUNGSMITTEL IM WEIN
 RESOLUTION OIV/OENO 427/2010 KRITERIEN FÜR METHODEN ZUR QUANTIFIZIERUNG VON POTENTIELL ALLERGENEN RÜCKSTÄNDEN EIWEISSHALTIGER SCHÖNUNGSMITTEL IM WEIN Die GENERALVERSAMMLUNG, unter Berücksichtigung des
RESOLUTION OIV/OENO 427/2010 KRITERIEN FÜR METHODEN ZUR QUANTIFIZIERUNG VON POTENTIELL ALLERGENEN RÜCKSTÄNDEN EIWEISSHALTIGER SCHÖNUNGSMITTEL IM WEIN Die GENERALVERSAMMLUNG, unter Berücksichtigung des
3.3.1 Referenzwerte für Fruchtwasser-Schätzvolumina ( SSW)
 50 3.3 Das Fruchtwasser-Schätzvolumen in der 21.-24.SSW und seine Bedeutung für das fetale Schätzgewicht in der 21.-24.SSW und für das Geburtsgewicht bei Geburt in der 36.-43.SSW 3.3.1 Referenzwerte für
50 3.3 Das Fruchtwasser-Schätzvolumen in der 21.-24.SSW und seine Bedeutung für das fetale Schätzgewicht in der 21.-24.SSW und für das Geburtsgewicht bei Geburt in der 36.-43.SSW 3.3.1 Referenzwerte für
Austausch von gentechnisch veränderten Tieren zwischen experimentellen Tierhaltungen
 Austausch von gentechnisch veränderten Tieren zwischen experimentellen Tierhaltungen Werner Nicklas Detmold, 30. März 2012 Hygiene beschreibt ganz allgemein alle Maßnahmen, die zur Erhaltung der Gesundheit
Austausch von gentechnisch veränderten Tieren zwischen experimentellen Tierhaltungen Werner Nicklas Detmold, 30. März 2012 Hygiene beschreibt ganz allgemein alle Maßnahmen, die zur Erhaltung der Gesundheit
Grundlagen der Immunologie
 Grundlagen der Immunologie 11. Vorlesung Zytokine und ihre Rezeptoren Fundamentale Eigenschaften der Zytokine Niedriges Molekulargewicht (10-40 kda) Glykoproteine werden von isolierten Zellen nach Aktivierung
Grundlagen der Immunologie 11. Vorlesung Zytokine und ihre Rezeptoren Fundamentale Eigenschaften der Zytokine Niedriges Molekulargewicht (10-40 kda) Glykoproteine werden von isolierten Zellen nach Aktivierung
Komponenten und Aufbau des Immunsystems Initiation von Immunantworten. lymphatische Organe. Erkennungsmechanismen. Lymphozytenentwicklung
 Komponenten und Aufbau des Immunsystems Initiation von Immunantworten lymphatische Organe Erkennungsmechanismen Lymphozytenentwicklung Entstehung und Verlauf adaptiver Immunantworten 1 Dendritische Zellen
Komponenten und Aufbau des Immunsystems Initiation von Immunantworten lymphatische Organe Erkennungsmechanismen Lymphozytenentwicklung Entstehung und Verlauf adaptiver Immunantworten 1 Dendritische Zellen
Man kann die Fähigkeit des Körpers, körperfremde Strukturen (Antigene) abzuwehren in 2 Kategorien einteilen:
 Immunbiologie 1 Zum Immunsystem gehören verschiedene Organe, hochspezialisierte Zellen und ein Gefäßsystem, die alle zusammenarbeiten, um den Körper von Infektionen zu befreien. Rechts sind die verschiedenen
Immunbiologie 1 Zum Immunsystem gehören verschiedene Organe, hochspezialisierte Zellen und ein Gefäßsystem, die alle zusammenarbeiten, um den Körper von Infektionen zu befreien. Rechts sind die verschiedenen
Fachbereich: Liquoranalytik. Änderungen: Quellenangabe für Referenzbereich Liquor-Laktat. A4 F Rev. 2 / Freigegeben -
 Freigegeben Seite 1 von 6 Stand: 28.02.2013 Bearbeiter: J. Böhm Fachbereich: Liquoranalytik Änderungen: Quellenangabe für LiquorLaktat erhöhte Werte niedrige Werte P:\13_zentrallabor\publickataloge\flklq
Freigegeben Seite 1 von 6 Stand: 28.02.2013 Bearbeiter: J. Böhm Fachbereich: Liquoranalytik Änderungen: Quellenangabe für LiquorLaktat erhöhte Werte niedrige Werte P:\13_zentrallabor\publickataloge\flklq
Belegarbeit 5. Praxismodul
 Berufsakademie Dresden LfULG Abt. 9 Referat 91 Studienrichtung Agrarmanagement Am Park 3 04886 Köllitsch Belegarbeit 5. Praxismodul Thema: Untersuchungen zum Haptoglobinnachweis mittels dem Analysegerät
Berufsakademie Dresden LfULG Abt. 9 Referat 91 Studienrichtung Agrarmanagement Am Park 3 04886 Köllitsch Belegarbeit 5. Praxismodul Thema: Untersuchungen zum Haptoglobinnachweis mittels dem Analysegerät
Standardisieren Sie die manuelle Differenzierung in Ihrem Labor
 Standardisieren Sie die manuelle Differenzierung Einleitung Die Interpretation von Ausstrichen peripheren Bluts spielt eine große Rolle bei der Diagnose hämatologischer Krankheiten und stellt daher eine
Standardisieren Sie die manuelle Differenzierung Einleitung Die Interpretation von Ausstrichen peripheren Bluts spielt eine große Rolle bei der Diagnose hämatologischer Krankheiten und stellt daher eine
Immundefizienz-Virus bei Mensch bzw. Katze. - der Infektion mit einem Immundefizienz-Virus (HIV, SIV, FIV, BIF) und
 HIV- SIV FIV Allgemeines (1): - es muß unterschieden werden zwischen - der Infektion mit einem Immundefizienz-Virus (HIV, SIV, FIV, BIF) und - der Ausbildung eines manifesten Krankheits- Syndroms, das
HIV- SIV FIV Allgemeines (1): - es muß unterschieden werden zwischen - der Infektion mit einem Immundefizienz-Virus (HIV, SIV, FIV, BIF) und - der Ausbildung eines manifesten Krankheits- Syndroms, das
Der neue HP ColorSphere Toner. Eine neue Formel und eine neue Technologie als Ergebnis von über 20 Jahren Forschung
 Der neue HP ColorSphere Toner Eine neue Formel und eine neue Technologie als Ergebnis von über 20 Jahren Forschung Beim Laserdruck, das heißt beim elektrofotografischen Druckprozess (EP), wird die Bedeutung
Der neue HP ColorSphere Toner Eine neue Formel und eine neue Technologie als Ergebnis von über 20 Jahren Forschung Beim Laserdruck, das heißt beim elektrofotografischen Druckprozess (EP), wird die Bedeutung
Aus dem Institut für Virologie des Fachbereiches Veterinärmedizin der Freien Universität Berlin
 Aus dem Institut für Virologie des Fachbereiches Veterinärmedizin der Freien Universität Berlin und dem Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin in Berlin Seroepidemiologische
Aus dem Institut für Virologie des Fachbereiches Veterinärmedizin der Freien Universität Berlin und dem Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin in Berlin Seroepidemiologische
Immunologie. immunis (lat.) = frei, unberührt. Wissenschaft vom Abwehrsystem von Lebewesen gegen fremde Substanzen und Krankheitserreger
 Immunologie immunis (lat.) = frei, unberührt Wissenschaft vom Abwehrsystem von Lebewesen gegen fremde Substanzen und Krankheitserreger Historisches Louis Pasteur (1822-1895): aktive Immunisierung gegen
Immunologie immunis (lat.) = frei, unberührt Wissenschaft vom Abwehrsystem von Lebewesen gegen fremde Substanzen und Krankheitserreger Historisches Louis Pasteur (1822-1895): aktive Immunisierung gegen
Statistische Randnotizen
 Landkreis /Weser Februar 08 Stabsstelle Regionalentwicklung Az.: 12.01.20 Statistische Randnotizen Geburtenziffern im Landkreis /Weser und den anderen Kreisen im Bezirk Hannover Einleitung Kenntnis über
Landkreis /Weser Februar 08 Stabsstelle Regionalentwicklung Az.: 12.01.20 Statistische Randnotizen Geburtenziffern im Landkreis /Weser und den anderen Kreisen im Bezirk Hannover Einleitung Kenntnis über
Die Wirkung von Insulin und (-)-Phenylephrin auf ph i# [Na + ] i# [Ca 2+ ] i# [K + ]i und Plasmamembranpotential von Cardiomyocyten adulter Ratten
![Die Wirkung von Insulin und (-)-Phenylephrin auf ph i# [Na + ] i# [Ca 2+ ] i# [K + ]i und Plasmamembranpotential von Cardiomyocyten adulter Ratten Die Wirkung von Insulin und (-)-Phenylephrin auf ph i# [Na + ] i# [Ca 2+ ] i# [K + ]i und Plasmamembranpotential von Cardiomyocyten adulter Ratten](/thumbs/55/37585315.jpg) Die Wirkung von Insulin und (-)-Phenylephrin auf ph i# [Na + ] i# [Ca 2+ ] i# [K + ]i und Plasmamembranpotential von Cardiomyocyten adulter Ratten DISSERTATION zur Erlangung des Doktorgrades des Fachbereichs
Die Wirkung von Insulin und (-)-Phenylephrin auf ph i# [Na + ] i# [Ca 2+ ] i# [K + ]i und Plasmamembranpotential von Cardiomyocyten adulter Ratten DISSERTATION zur Erlangung des Doktorgrades des Fachbereichs
Nachweis- (NG) und Bestimmungsgrenzen (BG)
 1 Freiheitsgrade Nachweis- (NG) und Bestimmungsgrenzen (BG) - Die Anzahl von Freiheitsgraden hängt vor allem von der Anzahl der verfügbaren Informationen ab (A). (A) f = n-v-m f: Freiheitsgrade n: Anzahl
1 Freiheitsgrade Nachweis- (NG) und Bestimmungsgrenzen (BG) - Die Anzahl von Freiheitsgraden hängt vor allem von der Anzahl der verfügbaren Informationen ab (A). (A) f = n-v-m f: Freiheitsgrade n: Anzahl
Epidemiologische Untersuchung zur Verbreitung der Räude beim Rotfuchs (Vulpes vulpes) in Baden-Württemberg
 Aus dem Chemischen-und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe Außenstelle Heidelberg und aus dem Institut für Parasitologie und Internationale Tiergesundheit des Fachbereiches Veterinärmedizin der Freien
Aus dem Chemischen-und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe Außenstelle Heidelberg und aus dem Institut für Parasitologie und Internationale Tiergesundheit des Fachbereiches Veterinärmedizin der Freien
Differenzialblutbild
 Differenzialblutbild TEAS Themen Erythrozyten, Leukozyten, Färbung nach Pappenheim. Prinzip Beim manuellen Differenzialblutbild wird ein kleiner Blutstropfen auf einem Objektträger so ausgestrichen, dass
Differenzialblutbild TEAS Themen Erythrozyten, Leukozyten, Färbung nach Pappenheim. Prinzip Beim manuellen Differenzialblutbild wird ein kleiner Blutstropfen auf einem Objektträger so ausgestrichen, dass
Wie lange sollte eine Kuh leben? Untersuchungen zur Nutzungsdauer und Lebensleistung bei Deutschen Holstein Kühen
 Wie lange sollte eine Kuh leben? Untersuchungen zur Nutzungsdauer und Lebensleistung bei Deutschen Holstein Kühen Prof. Dr. Anke Römer Humboldt-Universität zu Berlin Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät
Wie lange sollte eine Kuh leben? Untersuchungen zur Nutzungsdauer und Lebensleistung bei Deutschen Holstein Kühen Prof. Dr. Anke Römer Humboldt-Universität zu Berlin Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät
4.1. Herstellung des CH2/CH3-trunkierten dimerisierten anti-cd30-igg1-tnf- Fusionsproteins
 ERGEBNISSE 29 4. Ergebnisse 4.1. Herstellung des CH2/CH3-trunkierten dimerisierten anti-cd3-igg1-tnf- Fusionsproteins Im vorliegenden Immunzytokin wurden die Domänen CH2/CH3 des humanen Fc-Fragmentes durch
ERGEBNISSE 29 4. Ergebnisse 4.1. Herstellung des CH2/CH3-trunkierten dimerisierten anti-cd3-igg1-tnf- Fusionsproteins Im vorliegenden Immunzytokin wurden die Domänen CH2/CH3 des humanen Fc-Fragmentes durch
Biometrie im neuen Antragsverfahren
 8. Fortbildungsveranstaltung der GV-SOLAS für Tierschutzbeauftragte und Behördenvertreter Warum biometrische Planung? Einfachste Antwort: Weil es im Genehmigungsantrag so vorgesehen ist. 2 Warum biometrische
8. Fortbildungsveranstaltung der GV-SOLAS für Tierschutzbeauftragte und Behördenvertreter Warum biometrische Planung? Einfachste Antwort: Weil es im Genehmigungsantrag so vorgesehen ist. 2 Warum biometrische
Die antivirale Therapie der chronischen Hepatitis B: Identifikation neuer Resistenzmutationen und Optimierung der Verlaufskontrolle
 Angefertigt am Fachbereich 08 - Biologie und Chemie in Zusammenarbeit mit dem Institut für Medizinische Virologie am Fachbereich 11- Medizin der Justus-Liebig-Universität Gießen Die antivirale Therapie
Angefertigt am Fachbereich 08 - Biologie und Chemie in Zusammenarbeit mit dem Institut für Medizinische Virologie am Fachbereich 11- Medizin der Justus-Liebig-Universität Gießen Die antivirale Therapie
Entzündung. Teil 2.
 Teil 2 www.patho.vetmed.uni-muenchen.de/matnew.html Einleitung - Definition der Entzündung - Einteilungsmöglichkeiten einer Entzündung - Klinischer Verlauf - Zeitlicher Verlauf - Art der Ausbreitung -
Teil 2 www.patho.vetmed.uni-muenchen.de/matnew.html Einleitung - Definition der Entzündung - Einteilungsmöglichkeiten einer Entzündung - Klinischer Verlauf - Zeitlicher Verlauf - Art der Ausbreitung -
Bachelorarbeit. Was ist zu tun?
 Bachelorarbeit Was ist zu tun? Titelseite Zusammenfassung/Summary Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Einleitung Material und Methoden Ergebnisse Diskussion Ausblick Literaturverzeichnis Danksagung
Bachelorarbeit Was ist zu tun? Titelseite Zusammenfassung/Summary Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Einleitung Material und Methoden Ergebnisse Diskussion Ausblick Literaturverzeichnis Danksagung
Abwehr II/1. Seminar Block 8 WS 08/09. Dr. Mag. Krisztina Szalai krisztina.szalai@meduniwien.ac.at
 Abwehr II/1 Seminar Block 8 WS 08/09 Dr. Mag. Krisztina Szalai krisztina.szalai@meduniwien.ac.at Abwehr I.: angeborene, natürliche Abwehr Abwehr II.: erworbene, spezifische Abwehr Immunantwort natürliche
Abwehr II/1 Seminar Block 8 WS 08/09 Dr. Mag. Krisztina Szalai krisztina.szalai@meduniwien.ac.at Abwehr I.: angeborene, natürliche Abwehr Abwehr II.: erworbene, spezifische Abwehr Immunantwort natürliche
Rekombinante Antikorperfragmente fur die. Zoonosediagnostik
 Rekombinante Antikorperfragmente fur die Zoonosediagnostik Von der Fakultat fur Lebenswissenschaften der Technischen Universitat Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig zur Erlangung des Grades eines Doktors
Rekombinante Antikorperfragmente fur die Zoonosediagnostik Von der Fakultat fur Lebenswissenschaften der Technischen Universitat Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig zur Erlangung des Grades eines Doktors
INHALTSVERZEICHNIS VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN VERZEICHNIS DER TABELLEN VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN EINLEITUNG LITERATUR
 INHALTSVERZEICHNIS VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN VERZEICHNIS DER TABELLEN VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN I VI IX XIII 1 EINLEITUNG 2 LITERATUR 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1. Anatomie des Ellbogengelenkes
INHALTSVERZEICHNIS VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN VERZEICHNIS DER TABELLEN VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN I VI IX XIII 1 EINLEITUNG 2 LITERATUR 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1. Anatomie des Ellbogengelenkes
Leukozyten, Neubauer-Kammer, Türk sche Lösung, Hämolyse, Leukozytose, Leukopenie.
 Manuelle Zählung der Leukozyten TEAS Themen Leukozyten, Neubauer-Kammer, Türk sche Lösung, Hämolyse, Leukozytose, Leukopenie. Prinzip Leukozyten werden, wie Erythrozyten, mit dem mikroskopischen Zählkammerverfahren
Manuelle Zählung der Leukozyten TEAS Themen Leukozyten, Neubauer-Kammer, Türk sche Lösung, Hämolyse, Leukozytose, Leukopenie. Prinzip Leukozyten werden, wie Erythrozyten, mit dem mikroskopischen Zählkammerverfahren
Aufgabenblock 4. Da Körpergröße normalverteilt ist, erhalten wir aus der Tabelle der t-verteilung bei df = 19 und α = 0.05 den Wert t 19,97.
 Aufgabenblock 4 Aufgabe ) Da s = 8. cm nur eine Schätzung für die Streuung der Population ist, müssen wir den geschätzten Standardfehler verwenden. Dieser berechnet sich als n s s 8. ˆ = = =.88. ( n )
Aufgabenblock 4 Aufgabe ) Da s = 8. cm nur eine Schätzung für die Streuung der Population ist, müssen wir den geschätzten Standardfehler verwenden. Dieser berechnet sich als n s s 8. ˆ = = =.88. ( n )
β2-microglobulin deficient mice lack CD4-8+cytolytic T cells
 β2-microglobulin deficient mice lack CD4-8+cytolytic T cells Mäuse mit einem Knock-out bezüglich ß-Microglobulin sind nicht in der Lage CD4-8+ cytotoxische T-Zellen zu bilden Nature,Vol 344, 19. April
β2-microglobulin deficient mice lack CD4-8+cytolytic T cells Mäuse mit einem Knock-out bezüglich ß-Microglobulin sind nicht in der Lage CD4-8+ cytotoxische T-Zellen zu bilden Nature,Vol 344, 19. April
Anhang 4. Bias durch Überdiagnose von papillären Mikrokarzinomen
 Anhang 4 Bias durch Überdiagnose von papillären Mikrokarzinomen Bias durch Überdiagnose von papillären Mikrokarzinomen H. Bertelsmann AG Epidemiologie und Medizinische Statistik Universität Bielefeld Dezember
Anhang 4 Bias durch Überdiagnose von papillären Mikrokarzinomen Bias durch Überdiagnose von papillären Mikrokarzinomen H. Bertelsmann AG Epidemiologie und Medizinische Statistik Universität Bielefeld Dezember
Empfindlichkeit nichtinvasiver Lungenfunktionsmarker zur Detektion der Wirkung einer kurzzeitigen oxidativen oder osmotischen inhalativen Belastung
 CAMPUS INNENSTADT DIREKTOR: PROF. DR. D. NOWAK Empfindlichkeit nichtinvasiver Lungenfunktionsmarker zur Detektion der Wirkung einer kurzzeitigen oxidativen oder osmotischen inhalativen Belastung M. Ehret,
CAMPUS INNENSTADT DIREKTOR: PROF. DR. D. NOWAK Empfindlichkeit nichtinvasiver Lungenfunktionsmarker zur Detektion der Wirkung einer kurzzeitigen oxidativen oder osmotischen inhalativen Belastung M. Ehret,
Aus der Klinik für Wiederkäuer und Schweine (Innere Medizin und Chirurgie) der Justus-Liebig-Universität Gießen Betreuer: Prof. Dr. K.
 Aus der Klinik für Wiederkäuer und Schweine (Innere Medizin und Chirurgie) der Justus-Liebig-Universität Gießen Betreuer: Prof. Dr. K. Doll und dem Institut für Veterinär-Physiologie der Justus-Liebig-Universität
Aus der Klinik für Wiederkäuer und Schweine (Innere Medizin und Chirurgie) der Justus-Liebig-Universität Gießen Betreuer: Prof. Dr. K. Doll und dem Institut für Veterinär-Physiologie der Justus-Liebig-Universität
Lage- und Streuungsparameter
 Lage- und Streuungsparameter Beziehen sich auf die Verteilung der Ausprägungen von intervall- und ratio-skalierten Variablen Versuchen, diese Verteilung durch Zahlen zu beschreiben, statt sie graphisch
Lage- und Streuungsparameter Beziehen sich auf die Verteilung der Ausprägungen von intervall- und ratio-skalierten Variablen Versuchen, diese Verteilung durch Zahlen zu beschreiben, statt sie graphisch
