П А Л И М П С Е С Т P A L I M P S E S T
|
|
|
- Adrian Adenauer
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 219
2 П А Л И М П С Е С Т Меѓународно списание за лингвистички, книжевни и културолошки истражувања P A L I M P S E S T International Journal for Linguistic, Literary and Cultural Research Год. I, Бр. 2 Штип, 2016 Vol. I, No 2 Stip, 2016 ISSN
3 ПАЛИМПСЕСТ Меѓународно списание за лингвистички, книжевни и културолошки истражувања ИЗДАВА Универзитет Гоце Делчев, Филолошки факултет, Штип, Република Македонија ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК Ранко Младеноски УРЕДУВАЧКИ ОДБОР Виктор Фридман, Универзитет во Чикаго, САД Толе Белчев, Универзитет Гоце Делчев, Република Македонија Нина Даскаловска, Универзитет Гоце Делчев, Република Македонија Ала Шешкен, Универзитет Ломоносов, Руска Федерација Олга Панкина, НВО Македонски културен центар, Руска Федерација Георгета Раца, Универзитет Банат, Романија Астрид Симоне Грослер, Универзитет Банат, Романија Горан Калоѓера, Универзитет во Риека, Хрватска Дејан Дуриќ, Универзитет во Риека, Хрватска Шандор Чегледи, Универзитет во Панонија, Унгарија Ева Бус, Универзитет во Панонија, Унгарија Хусејин Озбај, Универзитет Гази, Република Турција Зеки Ѓурел, Универзитет Гази, Република Турција Елена Дараданова, Универзитет Св. Климент Охридски, Република Бугарија Ина Христова, Универзитет Св. Климент Охридски, Република Бугарија Џозеф Пониах, Национален институт за технологија, Индија Сатхарај Венкатесан, Национален институт за технологија, Индија Петар Пенда, Универзитет во Бања Лука, Босна и Херцеговина Данило Капасо, Универзитет во Бања Лука, Босна и Херцеговина Мета Лах, Универзитет во Љубљана, Република Словенија Намита Субиото, Универзитет во Љубљана, Република Словенија Ана Пеличер-Санчез, Универзитет во Нотингам, Велика Британија Мајкл Грини, Универзитет во Нотингам, Велика Британија Татјана Ѓурин, Универзитет во Нови Сад, Република Србија Диана Поповиќ, Универзитет во Нови Сад, Република Србија Жан Пол Мејер, Универзитет во Стразбур, Република Франција Жан Марк Веркруз, Универзитет во Артуа, Република Франција Регула Бусин, Швајцарија Натале Фиорето, Универзитет во Перуџа, Италија Оливер Хербст, Универзитет во Вурцбург, Германија
4 PALIMPSEST International Journal for Linguistic, Literary and Cultural Research PUBLISHED BY Goce Delcev University, Faculty of Philology, Stip, Republic of Macedonia EDITOR-IN-CHIEF Ranko Mladenoski EDITORIAL BOARD Victor Friedman, University of Chicago, United States of America Tole Belcev, Goce Delcev University, Republic of Macedonia Nina Daskalovska, Goce Delcev University, Republic of Macedonia Alla Sheshken, Lomonosov Moskow State University, Russian Federation Olga Pankina, NGO Macedonian Cultural Centre, Russian Federation Georgeta Rata, Banat University, Romania Astrid Simone Grosler, Banat University, Romania Goran Kalogjera, University of Rijeka, Croatia Dejan Duric, University of Rijeka, Croatia Sándor Czegledi, University of Pannonia, Hungary Éva Bús, University of Pannonia, Hungary Husejin Ozbaj, GAZİ University, Republic of Turkey Zeki Gurel, GAZİ University, Republic of Turkey Elena Daradanova, Sofia University St. Kliment Ohridski, Republic of Bulgaria Ina Hristova, Sofia University St. Kliment Ohridski, Republic of Bulgaria Joseph Ponniah, National Institute of Technology, India Sathyaraj Venkatesan, National Institute of Technology, India Petar Penda, University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina Danilo Capasso, University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina Meta Lah, University of Ljubljana, Republic of Slovenia Namita Subiotto, University of Ljubljana, Republic of Slovenia Ana Pellicer Sanchez, The University of Nottingham, United Kingdom Michael Greaney, Lancaster University, United Kingdom Tatjana Durin, University of Novi Sad, Republic of Serbia Diana Popovic, University of Novi Sad, Republic of Serbia Jean-Paul Meyer, University of Strasbourg, French Republic Jean-Marc Vercruysse, Artois University, French Republic Regula Busin, Switzerland Natale Fioretto, University of Perugia, Italy Oliver Herbst, University of Wurzburg, Germany
5 РЕДАКЦИСКИ СОВЕТ Драгана Кузмановска Толе Белчев Нина Даскаловска Билјана Ивановска Светлана Јакимовска Марија Леонтиќ Јована Караникиќ Јосимовска ЈАЗИЧНО УРЕДУВАЊЕ Даница Гавриловска Атанасовска (македонски јазик) Весна Продановска (англиски јазик) Толе Белчев (руски јазик) Билјана Ивановска (германски јазик) Марија Леонтиќ (турски јазик) Светлана Јакимовска (француски јазик) Јована Караникиќ Јосимовска (италијански јазик) ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК Славе Димитров АДРЕСА ПАЛИМПСЕСТ РЕДАКЦИСКИ СОВЕТ Филолошки факултет ул. Крсте Мисирков бр. 10-А п. фах 201 МК-2000 Штип, Македонија ISSN Meѓународното научно списание Палимпсест излегува двапати годишно во печатена и во електронска форма на посебна веб-страница на веб-порталот на Универзитетот Гоце Делчев во Штип: Трудовите во списанието се објавуваат на следните јазици: македонски јазик, англиски јазик, германски јазик, француски јазик, руски јазик, турски јазик и италијански јазик. Трудовите се рецензираат.
6 EDITORIAL COUNCIL Dragana Kuzmanovska Tole Belcev Nina Daskalovska Biljana Ivanovska Svetlana Jakimovska Marija Leontik Jovana Karanikik Josimovska LANGUAGE EDITORS Danica Gavrilovska-Atanasovska (Macedonian language) Vesna Prodanovska (English language) Tole Belcev (Russian language) Biljana Ivanovska (German language) Marija Leontik (Turkish language) Svetlana Jakimovska (French language) Jovana Karanikik Josimovska (Italian language) TECHNICAL EDITOR Slave Dimitrov ADDRESS PALIMPSEST EDITORIAL COUNCIL Faculty of Philology Krste Misirkov 10-A P.O. Box 201 MK-2000, Stip, Macedonia ISSN The International Scientific Journal Palimpsest is issued twice per year in printed form and online at the following website of the web portal of Goce Delcev University in Stip: Papers can be submitted and published in the following languages: Macedonian, English, German, French, Russian, Turkish and Italian language. All papers are peer-reviewed.
7
8 СОДРЖИНА / TABLE OF CONTENTS 11 ПРЕДГОВОР Д-р Драгана Кузмановска, декан на Филолошкиот факултет во Штип FOREWORD Dragana Kuzmanovska, PhD, Dean of the Faculty of Philology in Stip ЈАЗИК / LANGUAGE Даринка Маролова ПОСТАПКИ ПРИ ПРЕВЕДУВАЊЕТО НАСЛОВИ НА КНИЖЕВНИ ДЕЛА ОД ГЕРМАНСКИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК Darinka Marolova PROCEDURES WHEN TRANSLATING LITERARY WORKS TITLES FROM GERMAN INTO MACEDONIAN Natalija Pop Zarieva, Krste Iliev COMPARATIVE LINGUISTIC ANALYSIS OF RUSSIAN AND ENGLISH PROVERBS AND SAYINGS КНИЖЕВНОСТ / LITERATURE Igor Grbić OCCIDENTOCENTRIC FALLACY: DOWNSIZING THE WORLD, OR KEEPING THE OTHERNESS OF THE OTHER Марија Ѓорѓиева-Димова ИСТОРИЈАТА КАКО ИНТЕРТЕКСТ Marija Gjorgjieva Dimova HISTORY AS AN INTERTEXT Stefano Redaelli POETICHE MATEMATICHE, MATEMATICHE POETICHE Stefano Redaelli MATHEMATICAL POETICS, POETICAL MATHEMATICS Bilge Kaya Yiğit SİNOPLU SAFÂYÎ HAYATI ESERLERİ VE İNEBAHTI VE MOTON UN FETHİNİ ANLATAN FETİHNAMESİ Bilge Kaja Jigit SAFAYÎ WHO IS FROM SINOP, HIS LIFE, HIS WORKS AND THE FETIHNAME OF INEBAHTI AND MOTON
9 Snežana Petrova L ACTION TRAGIQUE DES «FURIEUX»: LA MÉDÉE DE CORNEILLE ET SES SOURCES ANTIQUES Snežana Petrova THE TRAGIC ACTION OF FURIOUS : MEDEA BY CORNEILLE AND ITS ANCIENT SOURCES Eva Gjorgjievska LES MOTIFS DU MATRICIDE DANS LES ÉCRITS DE JEUNESSE DE MARCEL PROUST Eva Gjorgjievska THE THEMES OF MATRICIDE IN THE EARLY WRITINGS OF MARCEL PROUST Mahmut Çelіk, Alirami İbraіmі SABİT YUSUF UN KÖTÜ YÜREKLİ OLAN KİMDİR ADLI HİKÂYESINDE AİLE KAVRAMI Mahmut Celіk, Alirami İbraіmі THE FAMILY IN SABIT YUSUF S KÖTÜ YÜREKLİ OLAN KİMDİR? STORY Славчо Ковилоски ЗАПИСИ НА МАРГИНИТЕ: ОД КНИЖЕВНОТО НАСЛЕДСТВО НА МАНАСТИРОТ ТРЕСКАВЕЦ Slavcho Koviloski RECORDS ON THE MARGINS: FROM THE MONASTERY LITERARY HERITAGE OF TRESKAVEC КУЛТУРА / CULTURE Трајче Стојанов ЕДНА МОЖНА КРИТИКА НА БАХТИНОВАТА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА ДОСТОЕВСКИ Trajce Stojanov A POSSIBLE CRITIQUE ON BAHTIN S INTERPRETATION OF DOSTOEVSKY Ana Popova LES PUISSANCES CÉLESTES ET LA SECONDE VENUE DU CHRIST SUR LES FRESQUES DE SAINT-GEORGES À POLOŠKO Ana Popova THE CELESTIAL POWERS AND THE SECOND COMING OF CHRIST IN THE PAINTED DECORATION OF ST. GEORGE AT POLOŠKO Екатерина Намичева, Петар Намичев АВТЕНТИЧНОСТА И ЗНАЧЕЊЕТО НА ТРАДИЦИОНАЛНИТЕ НАСЕЛБИ ВО МАКЕДОНИЈА Ekaterina Namiceva, Petar Namicev AUTHENTICITY AND PRIDE OF VERNACULAR SETTLEMENTS IN MACEDONIA
10 МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА / TEACHING METHODOLOGY Regula Busin REDEMITTEL AUS SICHT DES FREMDSPRACHLICHEN ERWACHSENENUNTERRICHTS Regula Busin PHRASES FROM THE PERSPECTIVE OF FOREIGN-LANGUAGE ADULT EDUCATION Игор Станојоски ФОНЕТСКИ И ФОНОЛОШКИ ДЕВИЈАЦИИ ВО УПОТРЕБАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК КАЈ ПОЛСКИТЕ И УКРАИНСКИТЕ СТУДЕНТИ Igor Stanojoski PHONETIC AND PHONOLOGICAL DEVIATIONS IN THE USE OF MACEDONIAN LANGUAGE BY POLISH AND UKRAINIAN STUDENTS ПРИКАЗИ / BOOK REVIEWS Весна Мојсова-Чепишевска МАКЕДОНСТВОТО КАКО СИМБОЛ НА ГРАДИТЕЛСТВОТО Vesna Mojsova Chepishevska THE MACEDONIANSHIP AS A SYMBOL OF BUILDING Марија Гркова ЗА ЧУВАЊЕТО НА ИДЕНТИТЕТОТ НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК Marija Grkova THE MAINTENANCE OF THE MACEDONIAN S LANGUAGE IDENTITY ДОДАТОК / APPENDIX 199 ПОВИК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ТРУДОВИ ВО МЕЃУНАРОДНОТО НАУЧНО СПИСАНИЕ ПАЛИМПСЕСТ CALL FOR PAPERS FOR THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL PALIMPSEST
11 МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА TEACHING METHODOLOGY 157
12 158
13 UDC: '373.7 Übersichtsbeitrag Review paper Regula Busin REDEMITTEL AUS SICHT DES FREMDSPRACHLICHEN ERWACHSENENUNTERRICHTS Abstract: Redemittel spielen beim Erwerb kommunikativer Fremdsprachenkompetenz eine zentrale Rolle. An der Schnittstelle von Sprachwissenschaft und Methodik des Unterrichts geht der vorliegende Aufsatz der Frage nach, was Redemittel sind, welche spezifischen Funktionen sie innehaben und was sie trotz bestehender Vorbehalte zu leisten vermögen. Einen Schwerpunkt bildet die Beschreibung der Teilschritte von Redemittelarbeit sowie weiterer Aspekte, die DaF- und DaZ-Unterricht im Hinblick auf die Befähigung der Lerner zu interkultureller Verständigung beachten sollten. Schlüsselwörter: handlungsorientierter Fremdsprachenunterricht; Kommunikative Wende; Interkulturalität; Redemittel; Didaktik/ Methodik; DaF/ DaZ. 1. Einleitung Seit den 60er-Jahren wird Fremdsprachenkompetenz zunehmend wichtiger. Viele Menschen sind ausbildungs-, berufs- oder migrationsbedingt auf die Kenntnis einer zweiten oder gar mehrerer Fremdsprachen angewiesen. Diese dienen nicht nur der Erschliessung von Ressourcen, sondern in hohem Mass auch der praktischen Verständigung im Alltag. Entsprechend gefragt ist ein handlungsorientierter Fremdsprachenunterricht, der der erfolgreichen Bewältigung sozialer Interaktionen im fremdsprachlichen Umfeld Rechnung trägt. Dem Einsatz von Redemitteln kommt dabei ein fester Platz zu. Die skizzierte Verschiebung bzw. Umgewichtung der Ziele des fremdsprachlichen Unterrichts verlangt grundlegende methodisch-didaktische Anpassungen. Insbesondere der Erwachsenenunterricht wird vorrangig einer pragmatischkontextbezogenen Ausrichtung folgen, während die Kernaufgabe des klassischen Schulunterrichts weiterhin darin besteht, sich vertiefter systemischer Sprachbetrachtung zu widmen und in deren Rahmen auch die Literalität angemessen zu berücksichtigen. 2. Die Kommunikative Wende im Fremdsprachenunterricht Die bis heute nachhaltige Kommunikative Wende wurde im deutschsprachigen Raum durch den Englischdidaktiker Hans-Eberhard Piepho eingeleitet: Den Lernenden sollte über das herkömmliche lehrerzentrierte Nachahmen und Wiederholen hinaus notwendigerweise die Möglichkeit zur frei formulierten spontanen Äusserung eingeräumt werden. Dem Postulat lag die Überzeugung 159
14 zugrunde, authentische Kommunikation lasse sich ausschliesslich über das selbstbestimmte Sprechen erreichen. Inwieweit es dem fremdsprachlichen Unterricht gelingen kann, kommunikative Kompetenz derart zu vermitteln, dass sie sich mehr oder weniger direkt auf interkulturelle Gesprächssituationen ausserhalb des Klassenzimmers übertragen lässt, muss an anderer Stelle untersucht werden. 1 Es sollte aber ein vordringliches Ziel des Fremdsprachenunterrichts sein, der verbreiteten frustrierenden Erfahrung früherer Sprachlerngenerationen, viel Zeit in den Erwerb einer Fremdsprache investiert zu haben, um in alltagsrelevanten Sprachhandlungen am Ende doch zu versagen ( sprachlos zu bleiben), aktiv entgegenzuwirken. Das Anbieten und Einüben einschlägiger Redemittel ist ein Weg, fremdsprachliches Kommunizieren zu unterstützen und zu erleichtern. Die sichere Verwendung von Redemitteln ist mit ein Bewertungskriterium bei sämtlichen offiziellen Sprachprüfungen. 3. Was sind Redemittel? 3.1 Formale Bestimmung Redemittel, seltener auch Diskursmittel, zählen inzwischen zu den unverzichtbaren Bestandteilen moderner Sprachlehrmittel, entsprechende Listen lassen sich zudem unter diversen Links im Internet abrufen. 2 Es handelt sich um Mittel in der Bedeutung von Werkzeugen, die als solche zugleich eine Mittlerfunktion zwischen den Kommunikationsteilnehmern übernehmen.,rede impliziert dabei Mündlichkeit, was insofern seine Berechtigung hat, als die überwiegende Zahl der aufgeführten Redemittel tatsächlich für den mündlichen Gebrauch vorgesehen ist. Im Sinne der Linguistik beinhaltet Rede indessen alle in einer natürlichen Sprache vollzogenen Äusserungen, sodass unter die zur Verfügung stehenden Redemittel auch solche für den schriftlichen Bereich fallen. Für die begriffliche Erfassung der einzelnen Redemittel existiert bis dato keine einheitliche Terminologie. Unter anderen finden sich, teilweise überlappend, die folgenden Bezeichnungen: - feste Formulierungen (für den mündlichen Bereich) Textbausteine (für den schriftlichen Bereich) - einfache Wortverbindungen Radio hören - stehende Wendungen, nach meiner Erfahrung darunter idiomatische Ausdrücke ins Gras beissen - Phraseologismen (Phraseme) Wurst sein - Gesprächsroutinen wie soll ich sagen Insgesamt lassen sich Redemittel als standardisierte sprachliche Mittel beschreiben, deren Einsatz dem Verfolgen einer Absicht, der Erfüllung eines Zwecks oder der Erreichung eines Ziels dient. Daraus folgt, dass die Anwendung von Redemitteln 160
15 regelmässig einer (bewusst oder unbewusst getroffenen) Intention gehorcht, deren spezifischer funktionaler Gehalt näher bestimmt werden kann. 3.2 Klassifizierung nach Funktion In Sprachlehrmitteln erscheinen Redemittel zumeist nach Relevanz für die aktuellen Belange der betreffenden Einheiten (Kapitel, Lektionen) gruppiert. Ihre themenübergreifende lehrmittelunabhängige Benutzung wird dadurch erschwert. Eine umfängliche und differenzierte Sortierung der Redemittel nach Funktionsklassen verdankt sich dem Romanisten und Didaktiker Heribert Rück (Rück, 1989, Seite 22). 3 Nach eingehender Prüfung bereits bestehender linguistischer und didaktischer Taxonomien schlägt Rück eine Gliederung in fünf Klassen vor, die er wiederum in diverse Subklassen einteilt. Um Benutzerfreundlichkeit möglichst zu gewährleisten, nimmt er bei der jeweiligen Zuordnung der Redemittel die Unterscheidung,Initiieren und,reagieren vor. 4 Nachstehend werden die einzelnen Funktionsklassen wiedergegeben und exemplarisch durch ein deutschsprachiges Redemittel zu einer der von Rück etablierten Subklassen illustriert. Initiieren Reagieren Kontaktpflege (Contactiva) jemandem etwas wünschen Guten Appetit! Danke, gleichfalls! Gefühlsausdruck (Affektiva) Ärger ausdrücken Das ist aber ärgerlich! Allerdings... Willensausdruck (Volitiva) Zustimmung einholen Darf ich eintreten? Selbstverständlich! Darstellung (Expositiva) informieren Ich lebe schon lange hier. Argumentation (Argumentativa) Gewissheit äussern Das wird sich sicherlich geben. Ah ja? Wenn du bloss recht hast! 3.3 Voraussetzungen des Vollzugs Wenn Redemittel auf das dialogische, dem situativen Kontext angepasste Sprechen (Sprachhandeln) ausgelegt sind, gilt es auch den Beziehungsaspekt anzuerkennen, der Kommunikation unweigerlich eignet und sie je nachdem massgeblich beeinflusst. Gemäss dem Kommunikationsquadrat, auch Nachrichtenquadrat, Vier-Seiten- oder Vier-Ohren-Modell, des Psychologen und Kommunikationswissenschaftlers 161
16 Friedemann Schulz von Thun (1981) sind beim Übermitteln einer Nachricht vier Seiten wirksam: - der Sachinhalt (worüber der Sender informiert) - die Selbstkundgabe (was der Sender von sich selbst zu erkennen gibt) - der Beziehungshinweis (was der Sender vom Empfänger hält bzw. wie er zu diesem steht) - der Appell (was der Sender beim Empfänger erreichen möchte) (Schulz von Thun, 1981, Seite 15) 5 Kommunikation, verstanden als (wechselseitige) Informationsübertragung, findet demnach auf verschiedenen Ebenen statt und bezieht parasprachliche sowie nichtsprachliche Elemente mit ein. Im Vollzug des Sprachhandelns ist rein verbales Interagieren von vornherein ausgeschlossen jedem Austausch liegt eine bestimmte psychische Konstellation zugrunde, deren besondere Umstände in Betracht gezogen werden müssen. Im Fall fremdsprachlicher Kommunikation kommen die ungleichen Prägungen durch Ausgangs- und Zielkultur komplizierend oder auch bereichernd hinzu. 4. Redemittel und Fremdsprachenunterricht 4.1 Allgemeine Überlegungen Wie gezeigt wurde, ist Sprachhandeln durch die Wirkungsgrössen Intention, Kontext und Beziehung determiniert. Ihr Zusammenspiel begründet die Wahl der Mittel und reguliert resp. moduliert deren Gebrauch. Es ist daher unerlässlich, im fremdsprachlichen Unterricht allen drei Faktoren die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. Mit der blossen Bereitstellung von Redemittelsammlungen ist es nicht getan. Weit mehr noch als bei der Wortschatzarbeit sind die Lernenden beim Erwerb von Redemitteln auf sorgfältige Vermittlung und beim Training auf praktische Anleitung angewiesen, die sie auch mit Zwischentönen und Bedeutungsnuancen (Konnotationen) vertraut machen. 6 Solcher Bedarf herrscht speziell im DaF-Unterricht (Deutsch als Fremdsprache), dessen Teilnehmer sich für gewöhnlich in keinem fremdsprachlichen Umfeld bewegen, Redemittel also im eigentlichen Sinn erlernen, währenddem DaZ-Lerner (Deutsch als Zweitsprache) sich im Alltag bereits in der Zweitsprache verständigen und sich Redemittel somit auch unter natürlichen Bedingungen aneignen. 4.2 Teilschritte der Redemittelarbeit Um den komplexen Vorgang der Redemittelarbeit im Fremdsprachenunterricht zu veranschaulichen, werden nachstehend seine Komponenten umrissen und zu den Unterrichtsbeteiligten in Beziehung gesetzt. 162
17 Auf Lernerseite lassen sich im Prozess von der ersten Begegnung mit Redemitteln bis zu ihrer einwandfreien anpassungsfähigen Beherrschung sieben Teilschritte festhalten (eigene Darstellung): 1) Wahrnehmen auditiv/ visuell > 2) Erfassen/ Verstehen Form / Inhalt > 3) Begreifen - grammatische Struktur - Bedeutung Intention/ Funktion; Initiieren, Reagieren Situationszusammenhang Verhältnis der Gesprächsteilnehmer zueinander > 4) Vergleichen kontrastive Gegenüberstellung von Äquivalenten in der Herkunftssprache > 5) Aktivieren/ Imitieren kontrollierte Anwendungen nach Vorbild > 6) Trainieren/ Automatisieren selbständige Anwendungen durch eigene Beispiele > 7) Verfügen/ Abrufen souveräner Gebrauch (frei; angemessen; flexibel) im realen Kontext In Analogie dazu stellen sich dem Unterrichtsverantwortlichen die Aufgaben 1) Vorlegen/ Hinführen > 2) und 3) Analysieren/ Erklären > 5) Vor-bilden/ Korrigieren > 6) Anregen/ Überprüfen Die ersten drei Teilschritte werden ebenso wie der fünfte auf Basis des instruktiven, der sechste und siebte Teilschritt auf Basis des konstruktiven Lernens bzw. Lehrens ausgeführt. Eine Sonderstellung nimmt der fakultative vierte Teilschritt ein: In Fällen, in denen der Unterrichtsverantwortliche der Herkunftssprache der Lerner nicht kundig ist, übernehmen diese das kontrastive Vergleichen selbstgesteuert
18 4.3 Didaktische Herausforderungen: Auswahl und Interkulturalität Der Auswahl geeigneter Redemittel kommt grosse Bedeutung zu. Bei ihr wird sich der Unterrichtsverantwortliche grundsätzlich von den Kriterien Themenbezug und Kompetenzstufe leiten lassen. Wie erwähnt sind Zusammenstellungen von Redemitteln an passender Stelle in nahezu allen neueren Sprachlehrwerken vorhanden. Ihr Auffinden nimmt also nicht allzu viel Zeit in Anspruch. Mehr Aufwand dagegen verlangt die kritische Durchsicht und allfällige Anpassung der vorgeschlagenen Redemittel. Sprache ist stetem Wandel unterworfen, hauptsächlich ihr mündlicher Gebrauch ändert sich im heutigen Zeitalter rasch. Dem Unterrichtsverantwortlichen obliegt es, Redemittel hinsichtlich ihrer Aktualität und Praktikabilität zu hinterfragen und sich im Zweifelsfall diesbezüglich bei Zielsprachlern abzusichern. Dass die Auswahl der Redemittel auf das Kompetenzniveau der jeweiligen Gruppe abgestimmt (stufenadäquat) vorgenommen werden muss, versteht sich von selbst. Allerdings sieht sich der Unterrichtsverantwortliche in den seltensten Fällen einer homogenen Gruppe von Lernern gegenüber. Zwar wurden 2001 die verschiedenen Sprachniveaus durch den Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) festgelegt, dennoch bleibt Interimsprache (Interlanguage) wesentlich durch individuelle Variation geprägt, sodass die Bandbreite auf ein und derselben Stufe angetroffener Sprachfertigkeiten mitunter beträchtlich ist. Dem daraus erwachsenden Bedürfnis nach Binnendifferenzierung kann im Zug der Redemittelarbeit mit der Unterscheidung von Grund- und Zusatzanforderungen begegnet werden, die sich am persönlichen Potenzial der einzelnen Lerner orientiert. 8 Z. B. Grundanforderung Zusatzanforderung Zusatzanforderung jemanden vorstellen Das ist... Darf ich dir... Ich würde Sie vorstellen? gerne miteinander bekanntmachen... Interkulturalität ist ein derzeit oft bemühtes Schlagwort. Dem Fremdsprachenunterricht eröffnet sich eine Vielzahl von Möglichkeiten, kulturvermittelnd zu agieren, vorab in der Wortschatz- und Redemittelarbeit. 9 Ihre Umsetzung bedingt beim Unterrichtsverantwortlichen ein hohes Bewusstsein über die Zielkultur (die womöglich mit seiner Herkunftskultur zusammenfällt), das in der Bereitschaft der Lernenden, sich mit deren Besonderheiten unvoreingenommen zu beschäftigen, Entsprechung finden muss. Spezielles Augenmerk gilt dabei dem, was allgemein (und etwas altmodisch) mit Sitten und Bräuchen, Gepflogenheiten und Ritualen bezeichnet wird. Aufs Engste mit diesen verbunden ist das Gebot der Höflichkeit, das nicht bloss formal, sondern vor allem auch auf der Beziehungsebene eingehalten werden muss (s. Schulz von Thun). Bei der Einführung einschlägiger Redemittel zu kultursensiblen Themen wie Geld, Alter, Sexualität oder Religion, sollte der Unterrichtsverantwortliche deshalb nicht davor zurückschrecken, Dos and Don ts ausgiebig zu erörtern, um die Lerner 164
19 vor peinlichen Situationen oder gar vermeidbaren Tabuverletzungen innerhalb der Zielkultur zu bewahren. 10 Die Praxis hat gewiesen, dass es für das Gelingen interkultureller Kommunikation ausserdem hilfreich ist, den Lernenden Überbrückungs- und Verlegenheitsphrasen (filler phrases) an die Hand zu geben, die sie befähigen, eine vorübergehende Blockade zu signalisieren oder ihre Deutungsunsicherheit angesichts der Äusserung oder des Verhaltens ihres Gegenübers zu spiegeln. Z.B. Blockade drohendes Missverständnis Jetzt habe ich den Faden verloren... ; Wie war nochmal das Wort für...? Habe ich Sie richtig verstanden,... ; Ist es so, dass...? Solche Redemittel wirken sowohl klärend (Informationsebene) als auch entlastend (Beziehungsebene). 4.4 Hinweise zur Methodik Der zumeist beschrittene Weg bei der Vermittlung kommunikativer Kompetenz führt über die möglichst realitätsnahe Simulierung prototypischer Situationen des Alltags im geschützten Raum der Lerngemeinschaft. Die Grundzüge szenariobasierten Unterrichts bestehen in der - Wahl des Szenarios - Formulierung/ Visualisierung des zu erreichenden Ziels - Erarbeitung der Mittel, die zur Zielerreichung benötigt werden (Wortschatz, Redemittel) - praktischen Durchführung (szenisches Spiel) - weiterführenden Auswertung Das Prinzip der Handlungsorientierung wird durch partizipative Unterrichtsführung auf der einen und kooperative Unterrichtsbeteiligung auf der anderen Seite erfüllt (s. 2. Abschn. 1). Das bedeutet, dass Projektabläufe ebenso wie die zugehörigen sprachlichen und materiellen Handlungsprodukte 11 vom Unterrichtsverantwortlichen und den Lernenden gemeinschaftlich geplant bzw. realisiert werden. Die bewusste Verschränkung von Inhalt, Methode und Ziel ist hierbei erfolgversprechend, weil das kommunikative partnerschaftliche Unterrichtshandeln für das spätere Alltagshandeln modellhaft ist. Gegen die Methoden des kommunikativen Ansatzes und die Redemittelarbeit im Speziellen werden allerdings auch Bedenken erhoben, die hier vorgebracht und kritisch beleuchtet werden sollen. Einwand 1 Das häufige mangelhafte Sprechen der Lerner zeitigt innerhalb der Gruppe eine Multiplikation der Fehler, anstatt sie zu diminuieren. Entgegnung Nicht alle Lerner des gleichen Niveaus begehen dieselben Fehler, was das Risiko einer gruppenbedingten Fehlgewöhnung eher 165
20 unwahrscheinlich macht. Wo der Unterrichtsverantwortliche selbst nicht korrigierend Einfluss nehmen kann oder will, können die Lernenden aufgefordert werden, als Mitsachverständige in dieser Funktion einzuspringen. Die Lernenden sollen den Unterricht als Ort erleben, an dem ihnen erste Gehversuche in der fremden Sprache erlaubt sind, ohne dass sie gleich Konsequenzen zu befürchten haben. Die Erfahrung, dass anderen ebenfalls Fehler unterlaufen, bewirkt einen Hemmungsabbau und entspannt die Atmosphäre, was mögliche Nachteile der unvollkommenen regen Sprechaktivität durch die Lernenden aufwiegt. Einwand 2 Die eingeübten Gesprächssituationen sind fingiert, Echtheit ist nicht gegeben. Entgegnung Zu Übungszwecken durchgeführtes Sprachhandeln kann auch im besten Fall nur realitätsimitierendes bzw. realitätsantizipierendes Musterhandeln sein, das auf den Ernstfall, sprich auf das künftige Bestehen im Alltag gerichtet ist. 12 Das heisst aber nicht, dass im Rahmen von Übungsorganisation und Unterrichtsinteraktionen nicht laufend Situationen entstehen, in denen spontan und authentisch kommuniziert wird (s. Piepho) und folglich viele der trainierten Fertigkeiten ungezwungene Anwendung finden. 13 Einwand 3 Entgegnung Authentizität lässt sich auch über den direkten Kontakt mit Zielsprachlern herstellen. Dafür eignen sich vor allem Lerntandems, Mail-Partnerschaften und Austauschprogramme, zu denen der Fremdsprachenunterricht Anstoss geben kann. Radio- und TV-Kanäle strahlen zielsprachliche Sendungen aus, die sich in die Redemittelarbeit integrieren lassen. Immersionsunterricht schliesslich bietet Gelegenheit, sich über den eigentlichen Fremdsprachenunterricht hinaus im schulischen Gebrauch der Zielsprache zu üben. Beim Redemitteltraining wird die Kreativität der Norm geopfert. Der Wert von Redemitteln liegt für die Sprachlernenden in deren Verlässlichkeit. Diese gründet auf der vielfachen Erprobung und Bewährung in der Kommunikation zwischen Zielsprachlern. Als vorformulierte und mithin reproduzierbare Ausdrücke sind Redemittel naturgemäss normativ. Vor allem am Beginn des Sprachlernprozesses sind sie als obligate Leitplanken für das Gespräch unentbehrlich. Mit zunehmender Sprachsicherheit des Lernenden können sie als Versatzstücke flexibel kombiniert und variabel ergänzt werden (s. 4.2)
21 5. Fazit Redemittelarbeit wird heute als zentraler Bereich des fremdsprachlichen Unterrichts verstanden, der die konventionelle Arbeit am Vokabular unterstützt, komplettiert und sie im Hinblick auf den Erwerb kommunikativer Kompetenz zielführend erweitert. Auch wenn keine verbindliche Übereinkunft darüber besteht, wie die Kategorie Redemittel exakt zu fassen sei, so liegt doch eine sehr plausible Beschreibung der spezifischen Funktionen von Redemitteln vor, die für den Unterricht fruchtbar gemacht werden kann. Redemittelarbeit ist ein anspruchsvoller Prozess, der in diversen Teilschritten abläuft und formale, inhaltliche sowie soziale Gesichtspunkte inkludiert. Eine spannende Herausforderung ergibt sich aus den Unterschieden zwischen Ausgangs- und Zielkultur, die eingehender Reflexion bedürfen. Die persönliche Erfahrung zeigt, dass es höchst sinnvoll ist, die Lernenden auch für die Fälle nicht reibungslos vonstattengehender Kommunikation auszurüsten. Trotz gelegentlich geäusserter Vorbehalte stellt die Redemittelarbeit im Fremdsprachenunterricht ein ebenso abwechslungsreiches wie effizientes Programm zur Erlangung kommunikativer Fitness dar. Anmerkungen 1 Die strukturelle Verschiedenheit von schulischem und ausserschulischem Sprachalltag thematisiert der Artikel von Cathomas (2007). 2 Eine breite Palette an Redemitteln ist beispielsweise über die Deutsche Welle (DW) (o. D.) zugänglich. 3 Sämtliche der angeführten Funktionsklassen sind von Rück übernommen. Obschon älteren Datums ist die Einteilung in punkto Gründlichkeit und Übersichtlichkeit m. W. singulär geblieben. 4 Redemittel fungieren auch als Kommunikationstreiber ein Wort gibt das andere, wie das Deutsche weiss. Der Wechsel von Rede und Gegenrede (Antwort) ist für das Gespräch und seine Aufrechterhaltung konstituierend. 5 Schulz von Thun führt Karl Bühlers Organon-Modell von 1934 (drei semantische Funktionen des sprachlichen Zeichens: Darstellung, Ausdruck, Appell) und Paul Watzlawicks Erkenntnis von 1969 (jede Aussage kann unter einem Inhalts- und einem Beziehungsaspekt verstanden werden) in seinem Nachrichtenquadrat zusammen. 6 Stimmt man der Auffassung zu, Redemittel seien Lebensmittel im weitesten Sinn, drängt sich ein Vergleich mit dem Kochen auf: Die besten Zutaten sind zu nichts nütze ohne das Wissen, wie sich aus ihnen eine schmackhafte und bekömmliche Mahlzeit zubereiten lässt. Kenntnisse über Eigenschaften, Verhalten und Wirkung der Lebensmittel sind für ein befriedigendes Ergebnis unabdingbar. 7 Komparative Rückgriffe auf die Ausgangssprache sind durchaus mit dem Grundsatz liberalisierter Einsprachigkeit vereinbar. Vgl. dazu den Beitrag von Butzkamm (1990). Für den Lerner sind sie ein doppelter Gewinn, indem sie einerseits seinen Blick für die Ausgangssprache schärfen und andererseits seinen Horizont in Bezug auf die Andersartigkeit der Zielsprache erweitern. 167
22 8 Gerade gut ausgebildete Lerner oder solche mit anderweitigen Fremdsprachenkenntnissen geben sich mit einfacheren Ausdrucksweisen oft nicht zufrieden. Sie können mit Zusatzanforderungen bzw. Ausbauvarianten individualisiert bedient werden. 9 Eine vertiefte Auseinandersetzung mit der interkulturellen Dimension im Fremdsprachenunterricht leistet der Aufsatz von Wesłowska (2013). 10 Der Bedeutsamkeit von kulturellen Tabus und deren Implikationen für den Fremdsprachenunterricht gehen die Überlegungen von Schröder (1997) nach. 11 Materielle Handlungsprodukte können etwa Lernplakate, Redemittelkarten oder Dialogschemen, sprachliche Handlungsprodukte Debatten, Verhandlungen, Interviews o. Ä. sein. 12 Insofern weist die Redemittelarbeit Parallelen zum sportlichen Wettkampftraining auf. 13 Gemeint sind Sprachhandlungen wie Nachfragen/ Sich-Vergewissern, Sich-Entschuldigen, Etwas-Vereinbaren etc. 14 Sogar das Spiel als anerkanntermassen kreative Tätigkeit beruft sich auf Normen. Eine willentliche Abwandlung der Spielregeln durch den Spieler setzt sowohl deren Kenntnis als auch ein gewisses Mass an Spielpraxis bzw. -erfahrung voraus. Literatur Butzkamm, W. (1990). Die kompliziertere Lösung ist die richtige: Aufgeklärte Einsprachigkeit. Rückblick und Ausblick. Der fremdsprachliche Unterricht, 104 (24), Web. 27. August Cathomas, R. (2007). Neue Tendenzen der Fremdsprachendidaktik das Ende der kommunikativen Wende? Beiträge zur Lehrerbildung, 25 (2), Web. 27. August DW.COM Deutsche Welle (o. D.). Grundwortschatz Deutsch Englisch. Expressions. Deutsch Interaktiv. Abgerufen am 27. August Rück H. (1989). Redemittel des Französischen. Materialien und Unterrichtsvorschläge. Stuttgart: Klett. Schröder, H. (1997). Tabus, interkulturelle Kommunikation und Fremdsprachenunterricht. Überlegungen zur Relevanz der Tabuforschung für die Fremdsprachendidaktik. Abgerufen am 27. August informationen/artikel_zur_tabuforschung/tabu_artikel_1997.pdf. Schulz von Thun F. (1981). Miteinander reden 1. Störungen und Klärungen. Allgemeine Psychologie der Kommunikation. Reinbek: Rowohlt. Wesłowska, D. (2013). Interkulturalität Neue Dimension im Fremdsprachenunterricht am Beispiel der Wortschatzarbeit. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Germanica, 9, Web. 27. August
23 Regula Busin Phrases From the Perspective of Foreign-Language Adult Education Abstract: Phrases play an important part for the acquisition of communicative foreign language skills. At the interface between linguistic science and methodology of teaching, the present paper covers the nature of phrases, their applicability and their integral importance despite existing criticism. A focal point showcasing the sub steps involved with the teaching of phrases considering the capabilities they possess for intercultural understanding to learners of German as a foreign language and as a second language. Keywords: action orientated language teaching; communicative turn; interculturality; phrases; didactics and methodology; German as a foreign language/ German as a second language. 169
24 ПАЛИМПСЕСТ Меѓународно списание за лингвистички, книжевни и културолошки истражувања PA L I M P S E S T International Journal for Linguistic, Literary and Cultural Research Год. I, Бр. 1 Штип, 2016 ISSN Vol. I, No 1 Stip, 2016
Project report Gymnasien Meran
 Project report Gymnasien Meran Plurilingual education preparing for a plurilingual future grammar school with different focuses; Sprachengymnasium - focus on languages: German, Italian, English, French,
Project report Gymnasien Meran Plurilingual education preparing for a plurilingual future grammar school with different focuses; Sprachengymnasium - focus on languages: German, Italian, English, French,
Bildungsstandards für die fortgeführte Fremdsprache (Englisch/Französisch) für die Allgemeine Hochschulreife. Einführung, Überblick und Ausblick
 Bildungsstandards für die fortgeführte Fremdsprache (Englisch/Französisch) für die Allgemeine Hochschulreife Einführung, Überblick und Ausblick 1 Gliederung Verwandtschaft! Standortbestimmung: Diskursfähigkeit!
Bildungsstandards für die fortgeführte Fremdsprache (Englisch/Französisch) für die Allgemeine Hochschulreife Einführung, Überblick und Ausblick 1 Gliederung Verwandtschaft! Standortbestimmung: Diskursfähigkeit!
Lehrplan für alle LV Sprachen - Wahlpflichtfach (S6-S7)
 Schola Europaea Büro des Generalsekretärs Referat für Pädagogische Entwicklung Ref.: 2017-09-D-25-de-2 DEUTSCHE VERSION Lehrplan für alle LV Sprachen - Wahlpflichtfach (S6-S7) GENEHMIGT VOM 12. UND 13.
Schola Europaea Büro des Generalsekretärs Referat für Pädagogische Entwicklung Ref.: 2017-09-D-25-de-2 DEUTSCHE VERSION Lehrplan für alle LV Sprachen - Wahlpflichtfach (S6-S7) GENEHMIGT VOM 12. UND 13.
LehrplanPLUS Realschule Englisch Klasse 5. Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick. 1. Aufbau des Lehrplans
 Realschule Englisch Klasse 5 Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick Der Englischunterricht an der Realschule ist wie schon bisher kommunikativ ausgerichtet. Die grundlegenden Voraussetzungen für eine
Realschule Englisch Klasse 5 Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick Der Englischunterricht an der Realschule ist wie schon bisher kommunikativ ausgerichtet. Die grundlegenden Voraussetzungen für eine
Modulhandbuch. Lehramtsbezogener Masterstudiengang Master of Education (M.Ed.) Gymnasium Fach Englisch in Koblenz
 Modulhandbuch Lehramtsbezogener Masterstudiengang Master of Education (M.Ed.) Gymnasium Fach Englisch in Koblenz Modulübersicht M.Ed. Englisch für das Lehramt Gymnasium in Koblenz (Stand: Sept. 0) Lehrveranstaltung
Modulhandbuch Lehramtsbezogener Masterstudiengang Master of Education (M.Ed.) Gymnasium Fach Englisch in Koblenz Modulübersicht M.Ed. Englisch für das Lehramt Gymnasium in Koblenz (Stand: Sept. 0) Lehrveranstaltung
LehrplanPLUS Mittelschule Englisch Klasse 5. Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick. 1. Aufbau des Lehrplans
 Mittelschule Englisch Klasse 5 Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick Der Englischunterricht an der Mittelschule ist wie schon bisher - kommunikativ ausgerichtet. Die grundlegenden Voraussetzungen
Mittelschule Englisch Klasse 5 Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick Der Englischunterricht an der Mittelschule ist wie schon bisher - kommunikativ ausgerichtet. Die grundlegenden Voraussetzungen
Zentrale Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler
 Klasse 9 Unterrichtsvorhaben 9.1: Begegnungen in literarischen Texten 1. Leitsequenz: Kurze Erzähltexte (Deutschbuch, Kap.4, S. 77 ff.: Begegnungen - Kreatives Schreiben zu Bildern und Parabeln ; Deutschbuch,
Klasse 9 Unterrichtsvorhaben 9.1: Begegnungen in literarischen Texten 1. Leitsequenz: Kurze Erzähltexte (Deutschbuch, Kap.4, S. 77 ff.: Begegnungen - Kreatives Schreiben zu Bildern und Parabeln ; Deutschbuch,
Fachseminar Fremdsprachen/ Pflicht 1. Thema: Grundlagen der Planung einer Fremdsprachenstunde
 Fachseminar Fremdsprachen/ Pflicht 1. Thema: Grundlagen der Planung einer Fremdsprachenstunde Lernbereich im LP: Relevanz: Klassenstufe 3/ 4 Charakter, Stellung und Prinzipien von Fremdsprachenunterricht
Fachseminar Fremdsprachen/ Pflicht 1. Thema: Grundlagen der Planung einer Fremdsprachenstunde Lernbereich im LP: Relevanz: Klassenstufe 3/ 4 Charakter, Stellung und Prinzipien von Fremdsprachenunterricht
Sommercamp 2010 Umweltbildung und Nachhaltigkeit Lernen in der Ökostation Freiburg vom 6. bis Bildungsplanbezug Englisch
 7. Bildungsplanbezug Sommercamp 2010 Umweltbildung und Nachhaltigkeit Lernen in der Ökostation Freiburg vom 6. bis 10. 9.2010 Bildungsplanbezug Englisch Grundlage für die Konzeption und Vermittlung der
7. Bildungsplanbezug Sommercamp 2010 Umweltbildung und Nachhaltigkeit Lernen in der Ökostation Freiburg vom 6. bis 10. 9.2010 Bildungsplanbezug Englisch Grundlage für die Konzeption und Vermittlung der
Staatsexamensaufgaben DiDaZ: Didaktikfach
 Staatsexamensaufgaben DiDaZ: Didaktikfach Frühjahr 2014 bis Herbst 2017 Sortiert nach Schwerpunkten Themenübersicht: 1. Interkultureller Sprachunterricht / Interkulturelle Kompetenz 2. Literarische Texte
Staatsexamensaufgaben DiDaZ: Didaktikfach Frühjahr 2014 bis Herbst 2017 Sortiert nach Schwerpunkten Themenübersicht: 1. Interkultureller Sprachunterricht / Interkulturelle Kompetenz 2. Literarische Texte
DaF-Lehrwerke aus Sicht algerischer Germanistikstudenten
 Germanistik Mohamed Chaabani DaF-Lehrwerke aus Sicht algerischer Germanistikstudenten Wissenschaftlicher Aufsatz 1 DaF-Lehrwerke aus Sicht algerischer Germanistikstudenten Chaabani Mohamed Abstract Die
Germanistik Mohamed Chaabani DaF-Lehrwerke aus Sicht algerischer Germanistikstudenten Wissenschaftlicher Aufsatz 1 DaF-Lehrwerke aus Sicht algerischer Germanistikstudenten Chaabani Mohamed Abstract Die
Staatsexamensthemen DiDaZ - Didaktikfach (Herbst 2013 bis Fru hjahr 2017)
 Staatsexamensthemen DiDaZ - Didaktikfach (Herbst 2013 bis Fru hjahr 2017) Übersicht - Themen der letzten Jahre Themenbereiche Prüfung (H : Herbst, F : Frühjahr) Interkultureller Sprachunterricht / Interkulturelle
Staatsexamensthemen DiDaZ - Didaktikfach (Herbst 2013 bis Fru hjahr 2017) Übersicht - Themen der letzten Jahre Themenbereiche Prüfung (H : Herbst, F : Frühjahr) Interkultureller Sprachunterricht / Interkulturelle
Kommunikation mit Krankenkassen. Holger Ohmann
 Kommunikation mit Krankenkassen Holger Ohmann Kommunikation als Schlüsselelement Axiom: Man kann nicht NICHT kommunizieren. [Paul Watzlawick] Erfahrung: Solange der Mensch lebt, kommuniziert er. Verbal:
Kommunikation mit Krankenkassen Holger Ohmann Kommunikation als Schlüsselelement Axiom: Man kann nicht NICHT kommunizieren. [Paul Watzlawick] Erfahrung: Solange der Mensch lebt, kommuniziert er. Verbal:
Modelle der Kommunikation. 1. Technisches Kommunikationsmodell Shannon&Weaver 2. Eisbergmodell Sigmund Freud 3. 4 Seiten Modell Schulz von Thun
 Modelle der Kommunikation 1. Technisches Kommunikationsmodell Shannon&Weaver 2. Eisbergmodell Sigmund Freud 3. 4 Seiten Modell Schulz von Thun 1 Ein einfaches Modell der Kommunikation: Shannon & Weaver
Modelle der Kommunikation 1. Technisches Kommunikationsmodell Shannon&Weaver 2. Eisbergmodell Sigmund Freud 3. 4 Seiten Modell Schulz von Thun 1 Ein einfaches Modell der Kommunikation: Shannon & Weaver
3. Modulbeschreibungen. 3.1 Modulbeschreibungen Fachwissenschaft. Introduction to Latin
 3. Modulbeschreibungen 3.1 Modulbeschreibungen Fachwissenschaft arbeitsaufwand Einführung Latein Introduction to Latin 12 360 Stunden Staatsexamen - grundlagenorientiert jedes Wintersemester - Entwicklung
3. Modulbeschreibungen 3.1 Modulbeschreibungen Fachwissenschaft arbeitsaufwand Einführung Latein Introduction to Latin 12 360 Stunden Staatsexamen - grundlagenorientiert jedes Wintersemester - Entwicklung
Susanne Kollmann Ines Zwanger
 Susanne Kollmann Ines Zwanger 1. Übersetzung Englisch-Deutsch als Teil eines Studiums der Englischen Philologie 2. Untersuchung zu den Anwendungsmöglichkeiten des GER im Bereich der Übersetzung 3. Probleme
Susanne Kollmann Ines Zwanger 1. Übersetzung Englisch-Deutsch als Teil eines Studiums der Englischen Philologie 2. Untersuchung zu den Anwendungsmöglichkeiten des GER im Bereich der Übersetzung 3. Probleme
Italienisch. Stundentafel Kurzgymnasium (Oberstufe) Bildungsziele. Richtziele
 Italienisch Stundentafel Kurzgymnasium (Oberstufe) Profil sprachlich musisch math.-naturwiss. wirtsch.- rechtl. SPF L, S, I, Ru E Gr Mu BG B, C AM, P WR 3.1 4 0 0 0 0 0 0 0 3.2 4 0 0 0 0 0 0 0 4.1 4 0
Italienisch Stundentafel Kurzgymnasium (Oberstufe) Profil sprachlich musisch math.-naturwiss. wirtsch.- rechtl. SPF L, S, I, Ru E Gr Mu BG B, C AM, P WR 3.1 4 0 0 0 0 0 0 0 3.2 4 0 0 0 0 0 0 0 4.1 4 0
Soziale Kommunikation Austausch, Vermittlung und Aufnahme
 Verständigung mithilfe von Sprache oder Zeichen - zwischen Menschen - Maschinen und Menschen - Maschinen und Maschinen. Soziale Kommunikation Austausch, Vermittlung und Aufnahme von Informationen zwischen
Verständigung mithilfe von Sprache oder Zeichen - zwischen Menschen - Maschinen und Menschen - Maschinen und Maschinen. Soziale Kommunikation Austausch, Vermittlung und Aufnahme von Informationen zwischen
Modulhandbuch Studiengang Master of Education (Lehramt) Französisch, HF Prüfungsordnung:
 Modulhandbuch Studiengang Master of Education (Lehramt) Französisch, HF Prüfungsordnung: 659-1-2017 Sommersemester 2018 Stand: 09. April 2018 Universität Stuttgart Keplerstr. 7 70174 Stuttgart Kontaktpersonen:
Modulhandbuch Studiengang Master of Education (Lehramt) Französisch, HF Prüfungsordnung: 659-1-2017 Sommersemester 2018 Stand: 09. April 2018 Universität Stuttgart Keplerstr. 7 70174 Stuttgart Kontaktpersonen:
Konkretisierung der Ausbildungslinien im Fach Spanisch
 Konkretisierung der slinien im Fach Spanisch Stand: September 2012 slinie Entwicklungsstufen der slinien im VD Gym A: Unterricht konzipieren 1 Den Wortschatz und die Grammatik kommunikationsorientiert
Konkretisierung der slinien im Fach Spanisch Stand: September 2012 slinie Entwicklungsstufen der slinien im VD Gym A: Unterricht konzipieren 1 Den Wortschatz und die Grammatik kommunikationsorientiert
Auf welchem Ohr hören Sie, wenn Sie mit Ihrem Partner reden? Mit welchem Schnabel senden Sie mit Vorliebe und in welchen Situationen?
 Kommunikationsprobleme im Alltag Wenn die Kommunikation zwischen den Beteiligten schiefläuft, kann es zu fatalen Missverständnissen kommen. Diese Missverständnisse können zu massiven Komplikationen führen,
Kommunikationsprobleme im Alltag Wenn die Kommunikation zwischen den Beteiligten schiefläuft, kann es zu fatalen Missverständnissen kommen. Diese Missverständnisse können zu massiven Komplikationen führen,
Stoffplan Französisch, WVB
 Stoffplan Französisch, WVB Französisch 1. Didaktisches Konzept Französisch ist als zweite Landessprache der Schweiz und im Umgang mit unserem Nachbarn Frankreich ein unentbehrliches Verständigungsmittel.
Stoffplan Französisch, WVB Französisch 1. Didaktisches Konzept Französisch ist als zweite Landessprache der Schweiz und im Umgang mit unserem Nachbarn Frankreich ein unentbehrliches Verständigungsmittel.
Grundsätze zur Leistungsbewertung im Fach Latein. 1. Allgemeine Vereinbarungen / Vorbemerkungen
 Grundsätze zur Leistungsbewertung im Latein 1. Allgemeine Vereinbarungen / Vorbemerkungen Das Leistungskonzept orientiert sich an den Vorgaben des Kernlehrplans NRW. Die rechtlich verbindlichen Grundsätze
Grundsätze zur Leistungsbewertung im Latein 1. Allgemeine Vereinbarungen / Vorbemerkungen Das Leistungskonzept orientiert sich an den Vorgaben des Kernlehrplans NRW. Die rechtlich verbindlichen Grundsätze
Beurteilungskriterien und wesentliche Bereiche Englisch / 5. Klasse
 Beurteilungskriterien und wesentliche Bereiche Englisch / 5. Klasse sfeststellung Folgende en während des Schuljahres bilden die Grundlage der Benotung: Mündliche sfeststellungen Zwei im 1 Semester Eine
Beurteilungskriterien und wesentliche Bereiche Englisch / 5. Klasse sfeststellung Folgende en während des Schuljahres bilden die Grundlage der Benotung: Mündliche sfeststellungen Zwei im 1 Semester Eine
Green Line Band 3 (G9) Synopse mit dem neuen Kerncurriculum am Gymnasium des Landes Hessen 2011 für die Klasse 7
 Green Line Band 3 (G9) Synopse mit dem neuen Kerncurriculum am Gymnasium des Landes Hessen 2011 für die Klasse 7 Vorbemerkung Green Line 3 (G9) der 3. Band einer neu konzipierten Lehrwerksgeneration für
Green Line Band 3 (G9) Synopse mit dem neuen Kerncurriculum am Gymnasium des Landes Hessen 2011 für die Klasse 7 Vorbemerkung Green Line 3 (G9) der 3. Band einer neu konzipierten Lehrwerksgeneration für
Verpflich tungsgrad. Voraussetzung für die Teilnahme. Modulbezeichnung Englischer Modultitel Modul 1. Niveaustufe. für die Vergabe von LP
 Anlage 2: Modulliste Modulbezeichnung Englischer Modultitel Modul 1 Grundwissen Deutsch als Fremdsprache Fundamentals of German as a Foreign Language LP Verpflich tungsgrad Niveaustufe 9 Pflicht Basismodul
Anlage 2: Modulliste Modulbezeichnung Englischer Modultitel Modul 1 Grundwissen Deutsch als Fremdsprache Fundamentals of German as a Foreign Language LP Verpflich tungsgrad Niveaustufe 9 Pflicht Basismodul
Schuleigener Arbeitsplan im Fach Französisch für die Jahrgangsstufen 6-10
 Schuleigener Arbeitsplan im Fach Französisch für die Jahrgangsstufen 6-10 Gymnasium Marianum Meppen (Stand: August 2016) Einleitende Bemerkungen Der niedersächsische Bildungsserver (NiBis) hält zu den
Schuleigener Arbeitsplan im Fach Französisch für die Jahrgangsstufen 6-10 Gymnasium Marianum Meppen (Stand: August 2016) Einleitende Bemerkungen Der niedersächsische Bildungsserver (NiBis) hält zu den
Hinweise zur Umsetzung mit deutsch.kompetent
 1 Texten und : und Kurzprosa des 20. Jahrhunderts Erzählende Texte untersuchen Typ 4b ca. 20 Stunden - berichten über Ereignisse unter Einbeziehung eigener Bewertungen und beschreiben komplexe Vorgänge
1 Texten und : und Kurzprosa des 20. Jahrhunderts Erzählende Texte untersuchen Typ 4b ca. 20 Stunden - berichten über Ereignisse unter Einbeziehung eigener Bewertungen und beschreiben komplexe Vorgänge
Zur Vorbereitung auf die ÖSD-PrüferInnenausbildung
 Zur Vorbereitung auf die ÖSD-PrüferInnenausbildung Bitte lesen Sie folgende Informationen als Vorbereitung auf die ÖSD-PrüferInnenschulung genau durch! Wir möchten Sie auf den folgenden Seiten für die
Zur Vorbereitung auf die ÖSD-PrüferInnenausbildung Bitte lesen Sie folgende Informationen als Vorbereitung auf die ÖSD-PrüferInnenschulung genau durch! Wir möchten Sie auf den folgenden Seiten für die
Nonverbale Kommunikation im DaF-Unterricht
 Germanistik Julia Basakina Nonverbale Kommunikation im DaF-Unterricht Studienarbeit Ludwig- Maximilians- Universität München Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften Institut für Deutsch als Fremdsprache
Germanistik Julia Basakina Nonverbale Kommunikation im DaF-Unterricht Studienarbeit Ludwig- Maximilians- Universität München Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften Institut für Deutsch als Fremdsprache
Modulhandbuch. für den lehramtsbezogenen Masterstudiengang M.Ed. Englisch für das Lehramt Realschule plus
 Modulhandbuch für den lehramtsbezogenen Masterstudiengang M.Ed. Englisch für das Lehramt Realschule plus Modulübersicht M.Ed. Englisch Realschule plus (Koblenz) Stand: November 0 Lehrveranstaltung (Art
Modulhandbuch für den lehramtsbezogenen Masterstudiengang M.Ed. Englisch für das Lehramt Realschule plus Modulübersicht M.Ed. Englisch Realschule plus (Koblenz) Stand: November 0 Lehrveranstaltung (Art
Vorblick Einfuhrung und Problemstellung Bedeutung des untersuchten Themas Ziele der Arbeit Struktur der Arbeit 18
 Inhaltsverzeichnis Vorblick 13 1. Einfuhrung und Problemstellung 15 1.1 Bedeutung des untersuchten Themas 15 1.2 Ziele der Arbeit 16 1.3 Struktur der Arbeit 18 2. Die interkulturelle Fremdsprachendidäktik
Inhaltsverzeichnis Vorblick 13 1. Einfuhrung und Problemstellung 15 1.1 Bedeutung des untersuchten Themas 15 1.2 Ziele der Arbeit 16 1.3 Struktur der Arbeit 18 2. Die interkulturelle Fremdsprachendidäktik
Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule
 Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule Kompetenzbereiche: Sach-, Methoden-, Urteils-, Handlungskompetenz Synopse aller Kompetenzerwartungen Sachkompetenz
Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule Kompetenzbereiche: Sach-, Methoden-, Urteils-, Handlungskompetenz Synopse aller Kompetenzerwartungen Sachkompetenz
Interkulturelle Kompetenzen: Where are we?
 Interkulturelle Kompetenzen: Where are we? Stand: 21.07.2017 Jahrgangsstufen Fach/Fächer Übergreifende Bildungsund Erziehungsziele Zeitrahmen Benötigtes Material 5 (E1) bzw. 6 (E2) im 1. Halbjahr Englisch
Interkulturelle Kompetenzen: Where are we? Stand: 21.07.2017 Jahrgangsstufen Fach/Fächer Übergreifende Bildungsund Erziehungsziele Zeitrahmen Benötigtes Material 5 (E1) bzw. 6 (E2) im 1. Halbjahr Englisch
Inhalte Wahlfachseminar Englisch auf 6 Ausbildungs-Quartale (18 Monate VD = 60 Kw = ca. 30 Seminarsitzungen = 5 pro Quartal)
 Inhalte Wahlfachseminar Englisch auf 6 Ausbildungs-Quartale (18 Monate VD = 60 Kw = ca. 30 Seminarsitzungen = 5 pro Quartal) Quartal Handlungssituation Erschließungsfragen Fachliche Ausbildungsinhalte
Inhalte Wahlfachseminar Englisch auf 6 Ausbildungs-Quartale (18 Monate VD = 60 Kw = ca. 30 Seminarsitzungen = 5 pro Quartal) Quartal Handlungssituation Erschließungsfragen Fachliche Ausbildungsinhalte
Konzeption der Seminarfolge: Curriculum: Voraussetzungen: Über Sprachkönnen und Fachwissen verfügen
 Konzeption der Seminarfolge: - Modulare Anlage - Semesterübergreifende Teilnahme - Einführungssitzungen: o Hinweis auf Rahmenrichtlinien und Curricula, die EPAS, den europäischen Referenzrahmen für Fremdsprachen
Konzeption der Seminarfolge: - Modulare Anlage - Semesterübergreifende Teilnahme - Einführungssitzungen: o Hinweis auf Rahmenrichtlinien und Curricula, die EPAS, den europäischen Referenzrahmen für Fremdsprachen
Guten Abend! Wie geht es Euch?
 Guten Abend! Wie geht es Euch? Guten Abend! Wie geht es Dir? Kommunikationsmodelle. Ziel dabei ist es, die Zusammenhänge, Ebenen und Prozesse der Kommunikation möglichst einfach und in kleinerem Rahmen
Guten Abend! Wie geht es Euch? Guten Abend! Wie geht es Dir? Kommunikationsmodelle. Ziel dabei ist es, die Zusammenhänge, Ebenen und Prozesse der Kommunikation möglichst einfach und in kleinerem Rahmen
Leseproben Fernstudienlehrbriefe
 Weiterbildender Masterstudiengang»Technische Kommunikation«Leseproben Fernstudienlehrbriefe Marit Fiedler Kommunikationstheorie Wissenschaftliche Weiterbildung Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Vorwort...5
Weiterbildender Masterstudiengang»Technische Kommunikation«Leseproben Fernstudienlehrbriefe Marit Fiedler Kommunikationstheorie Wissenschaftliche Weiterbildung Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Vorwort...5
KLASSE 9. In aller Munde - Sprachge Kenntnisse in Bezug auf Funktion, Bedeutung und Funktionswandel von Wörtern
 Schulinternes Curriculum für das Fach Deutsch - Sekundarstufe I Orientiert am Kemlehrplan G8, bezogen auf das Deutschbuch von Cornelsen, Neue Ausgabe KLASSE 9 Ein Blau, ein Rot - Gedichte er- stehen -
Schulinternes Curriculum für das Fach Deutsch - Sekundarstufe I Orientiert am Kemlehrplan G8, bezogen auf das Deutschbuch von Cornelsen, Neue Ausgabe KLASSE 9 Ein Blau, ein Rot - Gedichte er- stehen -
befähigen, berufliche Handlungssituationen erfolgreich zu bewältigen.
 Das Ziel jeder Berufsausbildung ist es, die Lernenden zu befähigen, berufliche Handlungssituationen erfolgreich zu bewältigen. Die Ausbildung zur Assistentin / zum Assistenten Gesundheit und Soziales ist
Das Ziel jeder Berufsausbildung ist es, die Lernenden zu befähigen, berufliche Handlungssituationen erfolgreich zu bewältigen. Die Ausbildung zur Assistentin / zum Assistenten Gesundheit und Soziales ist
Einführung in die Interkulturelle Wirtschaftskommunikation
 Prof. Dr. Jürgen Bolten, Universität Jena Einführung in die Interkulturelle Wirtschaftskommunikation 01: Kommunikationsbegriffe Themenspektrum Kommunikation Multikulturalität, Interkulturalität Transkulturalität
Prof. Dr. Jürgen Bolten, Universität Jena Einführung in die Interkulturelle Wirtschaftskommunikation 01: Kommunikationsbegriffe Themenspektrum Kommunikation Multikulturalität, Interkulturalität Transkulturalität
Lehrplan Grundlagenfach Französisch
 toto corde, tota anima, tota virtute Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft Lehrplan Grundlagenfach Französisch A. Stundendotation Klasse 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wochenstunden 4 3 3 4 B. Didaktische
toto corde, tota anima, tota virtute Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft Lehrplan Grundlagenfach Französisch A. Stundendotation Klasse 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wochenstunden 4 3 3 4 B. Didaktische
Psychologie und die Schulsituation
 Psychologie und die Schulsituation In den siebziger und achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts herrschte unter den Psychologen großer Optimismus, die Schule mit Anleihen aus der Psychotherapie,
Psychologie und die Schulsituation In den siebziger und achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts herrschte unter den Psychologen großer Optimismus, die Schule mit Anleihen aus der Psychotherapie,
Fachorientierter DaZ-Unterricht in Vorbereitungsklassen der Sekundarstufe. Gabriele Kniffka
 Fachorientierter DaZ-Unterricht in Vorbereitungsklassen der Sekundarstufe Gabriele Kniffka Ausgangslage 1. Deutlicher Anstieg der Zahlen neu zugewanderter Kinder und Jugendlicher im Jahr 2015 (vgl. von
Fachorientierter DaZ-Unterricht in Vorbereitungsklassen der Sekundarstufe Gabriele Kniffka Ausgangslage 1. Deutlicher Anstieg der Zahlen neu zugewanderter Kinder und Jugendlicher im Jahr 2015 (vgl. von
Standards für die Berufsoberschule in den Fächern Deutsch, fortgeführte Pflichtfremdsprache, Mathematik
 Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland BESCHLUSSSAMMLUNG DER KMK, BESCHLUSS-NR. 471 R:\B1\KMK-BESCHLUSS\RVBOS-DPM98-06-26.DOC Standards für
Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland BESCHLUSSSAMMLUNG DER KMK, BESCHLUSS-NR. 471 R:\B1\KMK-BESCHLUSS\RVBOS-DPM98-06-26.DOC Standards für
Standards Englisch Hauptschule
 Standards Englisch Hauptschule Aufgabenfeld Unterrichten: Ich habe gelernt, weitgehend einsprachig zu unterrichten. Planungskompetenz Personale Kompetenz insbesondere Entscheidungskompetenz und Flexibilität
Standards Englisch Hauptschule Aufgabenfeld Unterrichten: Ich habe gelernt, weitgehend einsprachig zu unterrichten. Planungskompetenz Personale Kompetenz insbesondere Entscheidungskompetenz und Flexibilität
Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS
 Jahrgangsstufe 3/4 Fach Zeitrahmen Benötigtes Material Themengebiet Englisch E 3/4 4.3 Familie und Freunde Kompetenzerwartungen This is my family Stand: 05.05.2016 2 Unterrichtseinheiten 2 Arbeitsblätter,
Jahrgangsstufe 3/4 Fach Zeitrahmen Benötigtes Material Themengebiet Englisch E 3/4 4.3 Familie und Freunde Kompetenzerwartungen This is my family Stand: 05.05.2016 2 Unterrichtseinheiten 2 Arbeitsblätter,
Fachlehrplan Fremdsprache
 Pharma-Assistentin EFZ/ Pharma-Assistent EFZ Fachlehrplan Fremdsprache Version März 2008 Der Lehrplan ist ein Dokument, welches im Verlauf der Umsetzung von den Lehrkräften kritisch überprüft werden muss.
Pharma-Assistentin EFZ/ Pharma-Assistent EFZ Fachlehrplan Fremdsprache Version März 2008 Der Lehrplan ist ein Dokument, welches im Verlauf der Umsetzung von den Lehrkräften kritisch überprüft werden muss.
SPIEL - Auswahlantworten Übung zum CLIL-Ansatz
 Anlage 1a Dr. Luisa Martinelli SPIEL - Auswahlantworten Übung zum CLIL-Ansatz Wähle jeweils die richtige Antwort aus. Trag in das Schema hier unten die Buchstaben ein, die der Antwort entsprechen, die
Anlage 1a Dr. Luisa Martinelli SPIEL - Auswahlantworten Übung zum CLIL-Ansatz Wähle jeweils die richtige Antwort aus. Trag in das Schema hier unten die Buchstaben ein, die der Antwort entsprechen, die
Zur Inhalts- und Handlungsorientierung im mediengestützten Fremdsprachenunterricht
 Zur Inhalts- und Handlungsorientierung im mediengestützten Fremdsprachenunterricht Theoretische Grundlagen und praktische Anwendungen der Szenariendidaktik Jörg Roche Konzept zur Entwicklung von Unterrichtsmaterialien
Zur Inhalts- und Handlungsorientierung im mediengestützten Fremdsprachenunterricht Theoretische Grundlagen und praktische Anwendungen der Szenariendidaktik Jörg Roche Konzept zur Entwicklung von Unterrichtsmaterialien
0505 FIRST LANGUAGE GERMAN
 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education MARK SCHEME for the June 2005 question paper 0505 FIRST LANGUAGE GERMAN 0505/03 Paper 3 (Continuous
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education MARK SCHEME for the June 2005 question paper 0505 FIRST LANGUAGE GERMAN 0505/03 Paper 3 (Continuous
Kompetenzorientierte Nachbesprechung
 Kompetenzorientierte Nachbesprechung Name : Datum: UB Nr.: Klasse: Thema der Stunde: Bitte beachten Sie, dass in einer zeitlich begrenzten Beratungssituation nicht alle Indikatoren eine Rolle spielen können.
Kompetenzorientierte Nachbesprechung Name : Datum: UB Nr.: Klasse: Thema der Stunde: Bitte beachten Sie, dass in einer zeitlich begrenzten Beratungssituation nicht alle Indikatoren eine Rolle spielen können.
Studienjahr 2014/15 Registrierung und Anmeldung unter
 Studienjahr 2014/15 ONLINE-Kurse Deutsch als Fremdsprache (DaF) Registrierung und Anmeldung unter http://www.vhb.org Virtuelle Hochschule Bayern Geschäftsstelle Luitpoldstraße 5 96052 Bamberg Telefon:
Studienjahr 2014/15 ONLINE-Kurse Deutsch als Fremdsprache (DaF) Registrierung und Anmeldung unter http://www.vhb.org Virtuelle Hochschule Bayern Geschäftsstelle Luitpoldstraße 5 96052 Bamberg Telefon:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Genial! Deutsch DAZ/DAF - Schritt für Schritt zukunftsfit - Schulbuch Deutsch - Serviceteil Das komplette Material finden Sie hier:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Genial! Deutsch DAZ/DAF - Schritt für Schritt zukunftsfit - Schulbuch Deutsch - Serviceteil Das komplette Material finden Sie hier:
Ausbildungslinien im Fach Italienisch
 slinien im Fach Italienisch Stand: September 2012 slinie Entwicklungsstufen der slinien im VD Gym A: Unterricht konzipieren 1 Auf der Grundlage der Lernbereiche der Bildungsstandards und des Gemeinsamen
slinien im Fach Italienisch Stand: September 2012 slinie Entwicklungsstufen der slinien im VD Gym A: Unterricht konzipieren 1 Auf der Grundlage der Lernbereiche der Bildungsstandards und des Gemeinsamen
Experimentelle Erschließung der Umwelt (Grundschule)
 Pädagogik Anne-Kathrin Rappsilber Experimentelle Erschließung der Umwelt (Grundschule) Physikalische Eigenschaften der Luft und deren Auswirkungen auf das Wetter Bachelorarbeit Inhalt 1 Einleitung...
Pädagogik Anne-Kathrin Rappsilber Experimentelle Erschließung der Umwelt (Grundschule) Physikalische Eigenschaften der Luft und deren Auswirkungen auf das Wetter Bachelorarbeit Inhalt 1 Einleitung...
Erste nationale fide-konferenz Bern 15. Mai 2012 Lernzielbeschreibungen Illustration der Lernziele
 Lernzielbeschreibungen Illustration der Lernziele Martin Müller, Institut für Mehrsprachigkeit, Freiburg i. Üe. Urs Egli, KOST Koordinationsstelle der Klubschulen, Zürich Lernzielbeschreibungen Illustration
Lernzielbeschreibungen Illustration der Lernziele Martin Müller, Institut für Mehrsprachigkeit, Freiburg i. Üe. Urs Egli, KOST Koordinationsstelle der Klubschulen, Zürich Lernzielbeschreibungen Illustration
Alexander Thomas Kulturstandardmodell und Friedemann Schulz von Thuns Kommunikationsquadrat
 Pädagogik Friederike Knoblauch Alexander Thomas Kulturstandardmodell und Friedemann Schulz von Thuns Kommunikationsquadrat Vergleich zweier Konzepte zur interkulturellen Kommunikation anhand einer kritischen
Pädagogik Friederike Knoblauch Alexander Thomas Kulturstandardmodell und Friedemann Schulz von Thuns Kommunikationsquadrat Vergleich zweier Konzepte zur interkulturellen Kommunikation anhand einer kritischen
Abenteuer Kommunikation Teil 1. Abenteuer Sprache 2002 Jugendamt der Stadt Dortmund, Abteilung Tageseinrichtungen für Kinder
 Abenteuer Kommunikation Teil 1 1 1 Man kann nicht nicht kommunizieren. 1 2 Man kann sich nicht nicht verhalten. 1 3 Jedes Verhalten hat einen Mitteilungscharakter. 1 4 Material der Kommunikation Sprache
Abenteuer Kommunikation Teil 1 1 1 Man kann nicht nicht kommunizieren. 1 2 Man kann sich nicht nicht verhalten. 1 3 Jedes Verhalten hat einen Mitteilungscharakter. 1 4 Material der Kommunikation Sprache
Präsentation von Susanne Flükiger, Stabsstelle Pädagogik, Kanton Solothurn. PP Medienanlass
 Präsentation von Susanne Flükiger, Stabsstelle Pädagogik, Kanton Solothurn (Didaktische) Grundgedanken Was ist das Ziel des Fremdsprachenunterrichts? Wie erwerben wir neues Wissen? Wie lernen wir die erste
Präsentation von Susanne Flükiger, Stabsstelle Pädagogik, Kanton Solothurn (Didaktische) Grundgedanken Was ist das Ziel des Fremdsprachenunterrichts? Wie erwerben wir neues Wissen? Wie lernen wir die erste
Übersicht Handlungssituationen Fachseminar Spanisch Duisburg
 Übersicht Handlungssituationen Fachseminar Spanisch Duisburg. Schritt. Schritt Baustein- Nr. LAA-Bedürfnis Themenschwerpunkt Quartal/Anz ahl der Sitzungen Zuordnung der fachspezifischen Aspekte zum Kerncurriculum
Übersicht Handlungssituationen Fachseminar Spanisch Duisburg. Schritt. Schritt Baustein- Nr. LAA-Bedürfnis Themenschwerpunkt Quartal/Anz ahl der Sitzungen Zuordnung der fachspezifischen Aspekte zum Kerncurriculum
Lebende Fremdsprache 4. Schulstufe. Einführung + Praxisbeispiele
 Lebende Fremdsprache 4. Schulstufe Einführung + Praxisbeispiele Was sind die GK4? Definieren, was Schüler/innen am Ende der vierten Schulstufe im Fach Lebende Fremdsprache können sollen. Kompetenzbeschreibungen
Lebende Fremdsprache 4. Schulstufe Einführung + Praxisbeispiele Was sind die GK4? Definieren, was Schüler/innen am Ende der vierten Schulstufe im Fach Lebende Fremdsprache können sollen. Kompetenzbeschreibungen
Erwartete Kompetenzen am Ende des 4. Schuljahrganges. Die Schüler erwerben Kompetenzen in folgenden Bereichen :
 Ebene 1 erwerben Kompetenzen in folgenden Bereichen : 1. Funktionale kommunikative Kompetenzen 1.2 Verfügung über sprachliche Mittel 2. Methodenkompetenzen 3. Interkulturelle Kompetenzen Ebene 2 1. Funktionale
Ebene 1 erwerben Kompetenzen in folgenden Bereichen : 1. Funktionale kommunikative Kompetenzen 1.2 Verfügung über sprachliche Mittel 2. Methodenkompetenzen 3. Interkulturelle Kompetenzen Ebene 2 1. Funktionale
Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS
 Jahrgangsstufe 4 Fach Zeitrahmen Benötigtes Material Themengebiet Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS Englisch E 3/4 4.3 Freizeit und Feste Kompetenzerwartungen E 3/4 1 E 3/4 1.1 E 3/4 3 1 Unterrichtseinheit
Jahrgangsstufe 4 Fach Zeitrahmen Benötigtes Material Themengebiet Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS Englisch E 3/4 4.3 Freizeit und Feste Kompetenzerwartungen E 3/4 1 E 3/4 1.1 E 3/4 3 1 Unterrichtseinheit
Durch Kompetenzorientierung aufs Leben vorbereiten Englisch unterrichten mit Blue Line, Red Line, Orange Line
 Durch Kompetenzorientierung aufs Leben vorbereiten Englisch unterrichten mit Blue Line, Red Line, Orange Line Dr. Frank Haß Institut für Angewandte Didaktik Faktoren gelingenden Lernens Vielfältige Motivierung
Durch Kompetenzorientierung aufs Leben vorbereiten Englisch unterrichten mit Blue Line, Red Line, Orange Line Dr. Frank Haß Institut für Angewandte Didaktik Faktoren gelingenden Lernens Vielfältige Motivierung
Der fachspezifische Beitrag des Fremdsprachenunterrichts zur Sprachbildung
 Prof. Dr. Daniela Caspari Freie Universität Berlin Der fachspezifische Beitrag des Fremdsprachenunterrichts zur Sprachbildung 10.5.2017 LISUM Berlin-Brandenburg Gliederung 1. Ansätze zur SB in der Fremdsprachendidaktik
Prof. Dr. Daniela Caspari Freie Universität Berlin Der fachspezifische Beitrag des Fremdsprachenunterrichts zur Sprachbildung 10.5.2017 LISUM Berlin-Brandenburg Gliederung 1. Ansätze zur SB in der Fremdsprachendidaktik
EINFÜHRUNG IN DIE FACHDIDAKTIK DES FRANZÖSISCHEN KLAUSUR
 Name: Matrikel-Nr. SS 2013 EINFÜHRUNG IN DIE FACHDIDAKTIK DES FRANZÖSISCHEN KLAUSUR 15.Juli 2013 Note: (Bearbeitungszeit: 60 min.) / 72 BE Die folgenden Fragen sollten Sie in der Regel stichpunktartig
Name: Matrikel-Nr. SS 2013 EINFÜHRUNG IN DIE FACHDIDAKTIK DES FRANZÖSISCHEN KLAUSUR 15.Juli 2013 Note: (Bearbeitungszeit: 60 min.) / 72 BE Die folgenden Fragen sollten Sie in der Regel stichpunktartig
DaZ-Förderung im Deutschunterricht Sprachbewusstheit anregen, Fördersituationen schaffen. Beate Lütke. Blitzlicht
 DaZ-Förderung im Deutschunterricht Sprachbewusstheit anregen, Fördersituationen schaffen Fortbildung Sprache im Fachunterricht" 07./08.04.2011, Bozen Blitzlicht Geben Sie reihum einen kurzen Kommentar
DaZ-Förderung im Deutschunterricht Sprachbewusstheit anregen, Fördersituationen schaffen Fortbildung Sprache im Fachunterricht" 07./08.04.2011, Bozen Blitzlicht Geben Sie reihum einen kurzen Kommentar
Modulhandbuch. zu der Prüfungsordnung. Teilstudiengang Deutsch im Studiengang Master of Education Lehramt für Sonderpädagogische Förderung
 Modulhandbuch zu der Prüfungsordnung Teilstudiengang Deutsch im Studiengang Master of Education Lehramt für Sonderpädagogische Förderung Inhaltsverzeichnis Fachliche Kernkompetenz Literatur 3 Fachliche
Modulhandbuch zu der Prüfungsordnung Teilstudiengang Deutsch im Studiengang Master of Education Lehramt für Sonderpädagogische Förderung Inhaltsverzeichnis Fachliche Kernkompetenz Literatur 3 Fachliche
Anlage 2: Modulliste. 8. Anlage 2 erhält folgende Fassung: Niveaustufe. Modulbezeichnung. Voraussetzung für die Teilnahme. für die Vergabe von LP
 8. Anlage 2 erhält folgende Fassung: Anlage 2: Modulliste Modulbezeichnung (Modulkürzel sind kein Namensbestandteil) LP Verpflichtungsgrad Niveaustufe Qualifikationsziele Voraussetzung für die Teilnahme
8. Anlage 2 erhält folgende Fassung: Anlage 2: Modulliste Modulbezeichnung (Modulkürzel sind kein Namensbestandteil) LP Verpflichtungsgrad Niveaustufe Qualifikationsziele Voraussetzung für die Teilnahme
Sprachen als Schlüssel. - zu globaler Zusammenarbeit und - zu interkulturellem Verständnis
 Sprachen als Schlüssel - zu globaler Zusammenarbeit und - zu interkulturellem Verständnis Detlefsengymnasium Glückstadt März 2014 Sprachliches Profil Detlefsengymnasium Glückstadt Sprachliches Profil Detlefsengymnasium
Sprachen als Schlüssel - zu globaler Zusammenarbeit und - zu interkulturellem Verständnis Detlefsengymnasium Glückstadt März 2014 Sprachliches Profil Detlefsengymnasium Glückstadt Sprachliches Profil Detlefsengymnasium
Nataša Ćorić Gymnasium Mostar Bosnien und Herzegowina
 Nataša Ćorić Gymnasium Mostar Bosnien und Herzegowina n Inhalt Der passive und der aktive Wortschatz Das vernetzte Lernen Die Einführung von neuem Wortschatz Phasen der Wortschatzvermittlung Techniken
Nataša Ćorić Gymnasium Mostar Bosnien und Herzegowina n Inhalt Der passive und der aktive Wortschatz Das vernetzte Lernen Die Einführung von neuem Wortschatz Phasen der Wortschatzvermittlung Techniken
Höhen und Tiefen mit Assistenz durchleben. und mit guter Kommunikation verbessern
 Höhen und Tiefen mit Assistenz durchleben und mit guter Kommunikation verbessern Kann uns ein größeres Glück widerfahren, als für eine Weile die Dinge mit den Augen des Anderen betrachten zu können? Henry
Höhen und Tiefen mit Assistenz durchleben und mit guter Kommunikation verbessern Kann uns ein größeres Glück widerfahren, als für eine Weile die Dinge mit den Augen des Anderen betrachten zu können? Henry
zu überprüfen und zu präzisieren. Dabei stehen folgende Fragestellungen im Vordergrund:
 1. Einleitung Die Beschreibung und kritische Beurteilung von Alltagsargumentation wird durch das Wissen um häufig gebrauchte Denk- und Schlussmuster in einer Gesellschaft erleichtert. Abseits formal gültiger
1. Einleitung Die Beschreibung und kritische Beurteilung von Alltagsargumentation wird durch das Wissen um häufig gebrauchte Denk- und Schlussmuster in einer Gesellschaft erleichtert. Abseits formal gültiger
VERGLEICH LEHRPLAN PASSEPARTOUT Lehrplan 21
 VERGLEICH LEHRPLAN PASSEPARTOUT Lehrplan 21 Übersicht zur Einpassung der Französisch und Englisch) in den Stand 16. September 2014 1 Projektvorgaben (Aussprachepapier zum Fachbereich Sprachen, von der
VERGLEICH LEHRPLAN PASSEPARTOUT Lehrplan 21 Übersicht zur Einpassung der Französisch und Englisch) in den Stand 16. September 2014 1 Projektvorgaben (Aussprachepapier zum Fachbereich Sprachen, von der
RCAE Research Center for Applied Education. Lernfortschrittsblatt SCHREIBEN. Begleitdokument
 RCAE Research Center for Applied Education Lernfortschrittsblatt SCHREIBEN Begleitdokument Lernfortschrittsblatt Schreiben RCAE Research Center for Applied Education GmbH Khevenhüllerstraße 9 Klagenfurt
RCAE Research Center for Applied Education Lernfortschrittsblatt SCHREIBEN Begleitdokument Lernfortschrittsblatt Schreiben RCAE Research Center for Applied Education GmbH Khevenhüllerstraße 9 Klagenfurt
LEBENDE FREMDSPRACHE
 1 von 5 Anlage A Sechster Teil A Pflichtgegenstände 2. Oberstufe b) Wahlpflichtgegenstände aa) zusätzlich als alternative Pflichtgegenstände in der Oberstufe LEBENDE FREMDSPRACHE (Englisch, Französisch,
1 von 5 Anlage A Sechster Teil A Pflichtgegenstände 2. Oberstufe b) Wahlpflichtgegenstände aa) zusätzlich als alternative Pflichtgegenstände in der Oberstufe LEBENDE FREMDSPRACHE (Englisch, Französisch,
Grammatikunterricht als Schule der Aufmerksamkeit
 Grammatikunterricht als Schule der Aufmerksamkeit 1. Der Begriff der Grammatik 2. Implizites und explizites Sprachwissen 3. Interlangue 4. Aufgabe der Grammatik 5. Automatisierung 6. Umgang mit Fehlern
Grammatikunterricht als Schule der Aufmerksamkeit 1. Der Begriff der Grammatik 2. Implizites und explizites Sprachwissen 3. Interlangue 4. Aufgabe der Grammatik 5. Automatisierung 6. Umgang mit Fehlern
Globalisierung und Bildung. Grenzen und Möglichkeiten
 Globalisierung und Bildung Grenzen und Möglichkeiten Globales Lernen Eine Präsentation von Susanne Jeuk und Regina Winkler-Sangkuhl Alfred K. Treml: Was ist Entwicklungspädagogik? Entwicklungspädagogik
Globalisierung und Bildung Grenzen und Möglichkeiten Globales Lernen Eine Präsentation von Susanne Jeuk und Regina Winkler-Sangkuhl Alfred K. Treml: Was ist Entwicklungspädagogik? Entwicklungspädagogik
Logopädische Handlungsmöglichkeiten bei selektivem Mutismus im Kindes- und Jugendalter
 HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit BSc-Studiengang Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie Tina
HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit BSc-Studiengang Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie Tina
Handout: Kommunikative Grammatik Nadine Custer
 Unter dem Begriff kommunikative Grammatik versteht man eine Orientierung im Fremdsprachenunterricht, bei dem die Vermittlung der Grammatik in erster Linie auf kommunikativem Wege erfolgen soll. 1) Traditionelle
Unter dem Begriff kommunikative Grammatik versteht man eine Orientierung im Fremdsprachenunterricht, bei dem die Vermittlung der Grammatik in erster Linie auf kommunikativem Wege erfolgen soll. 1) Traditionelle
Curriculare Struktur der Lehrerinnen und Lehrerausbildung im Vorbereitungsdienst. Konkretisierung für das Lehramt an Grundschulen
 Kompetenzbereiche Fremdsprachen Schule und Beruf Die aus dem Auftrag des jeweiligen Faches resultierenden beruflichen Aufgaben auf dem Hintergrund fachlicher, fachdidaktischer und pädagogischer Orientierungen
Kompetenzbereiche Fremdsprachen Schule und Beruf Die aus dem Auftrag des jeweiligen Faches resultierenden beruflichen Aufgaben auf dem Hintergrund fachlicher, fachdidaktischer und pädagogischer Orientierungen
+ % % > V \ æ w fi œ t, 9 \ } & œ. j E %! d œ, æ, & & & > d > c c! : % j % q S ˆ S ; i ; ˆ X S S ' ; ˆ ' b X m ˆ ; e
 ø % F %! f E % j c F c. F. F! d ^ œ t S 6 i m ˆ f m S ` ` ; e S $ @ ; S S i M S j i ; S k ; S ` ; S S e S ' = i m m S º > f E > f E F c d % j f E d j c m % % m! > f E % % F d! f E m % > c _ 6! j! f E q
ø % F %! f E % j c F c. F. F! d ^ œ t S 6 i m ˆ f m S ` ` ; e S $ @ ; S S i M S j i ; S k ; S ` ; S S e S ' = i m m S º > f E > f E F c d % j f E d j c m % % m! > f E % % F d! f E m % > c _ 6! j! f E q
Synopse für Let s go Band 3 und 4
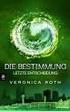 Synopse für Let s go Band 3 und 4 Umsetzung der Anforderungen des Kerncurriculums Englisch für die Sekundarstufe I an Hauptschulen Hessen 1 Kompetenzbereich Kommunikative Kompetenz am Ende der Jahrgangsstufe
Synopse für Let s go Band 3 und 4 Umsetzung der Anforderungen des Kerncurriculums Englisch für die Sekundarstufe I an Hauptschulen Hessen 1 Kompetenzbereich Kommunikative Kompetenz am Ende der Jahrgangsstufe
Einfach Sprachen lernen.
 Einfach Sprachen lernen. Unser Leitbild In jedem Menschen steckt enormes Potential, welches erkannt und sichtbar gemacht werden muss. Das hat uns die langjährige Erfahrung und Arbeit mit Lernenden gezeigt.
Einfach Sprachen lernen. Unser Leitbild In jedem Menschen steckt enormes Potential, welches erkannt und sichtbar gemacht werden muss. Das hat uns die langjährige Erfahrung und Arbeit mit Lernenden gezeigt.
Texte als Grundlage der Kommunikation zwischen Kulturen
 Sylwia Adamczak-Krysztofowicz Texte als Grundlage der Kommunikation zwischen Kulturen Eine Studie zur Kultur- und Landeskundevermittlung im DaF-Studium in Polen Verlag Dr. Kovac Inhaltsverzeichnis VORWORT
Sylwia Adamczak-Krysztofowicz Texte als Grundlage der Kommunikation zwischen Kulturen Eine Studie zur Kultur- und Landeskundevermittlung im DaF-Studium in Polen Verlag Dr. Kovac Inhaltsverzeichnis VORWORT
Synopse zu Red Line 5 und 6
 Bildungsstandards und Inhaltsfelder Synopse zu Red Line 5 und 6 Realschule, Englisch, Klasse 9 und 10 für Hessen Vorbemerkung Das Kerncurriculum Englisch für hessische Realschulen gibt Auskunft über die
Bildungsstandards und Inhaltsfelder Synopse zu Red Line 5 und 6 Realschule, Englisch, Klasse 9 und 10 für Hessen Vorbemerkung Das Kerncurriculum Englisch für hessische Realschulen gibt Auskunft über die
Sprachpraxis Französisch IV
 Modulbeschreibungsformular Fachwissenschaft für das Lehramtsfach Französisch (Master) Sprachpraxis Französisch IV 537145000 180 h 6 LP Modulbeauftragter Véronique Barth-Lemoine WS oder SS des Moduls Master
Modulbeschreibungsformular Fachwissenschaft für das Lehramtsfach Französisch (Master) Sprachpraxis Französisch IV 537145000 180 h 6 LP Modulbeauftragter Véronique Barth-Lemoine WS oder SS des Moduls Master
Internationaler Expertenworkshop Deutsch als Fremdsprache für MINT-Fächer: Grundlagen und curriculare Ansätze
 Internationaler Expertenworkshop Deutsch als Fremdsprache für MINT-Fächer: Grundlagen und curriculare Ansätze Universität Leipzig, 24. bis 26. Juli 2014 Thematische Kernfragen zu den Gruppenarbeitsphasen
Internationaler Expertenworkshop Deutsch als Fremdsprache für MINT-Fächer: Grundlagen und curriculare Ansätze Universität Leipzig, 24. bis 26. Juli 2014 Thematische Kernfragen zu den Gruppenarbeitsphasen
Inhaltsauszug zum Kommunikationstrainer
 Inhaltsauszug zum Kommunikationstrainer 1. Grundlagen der Kommunikation 1.1 Definition 1.2 Kommunikationsmodelle 1.2.1 Schulz von Thun 1.2.2 Paul Watzlawick 1.3 Zuhörtechniken 1.4 Fragetechniken 1.5 Standpunkt
Inhaltsauszug zum Kommunikationstrainer 1. Grundlagen der Kommunikation 1.1 Definition 1.2 Kommunikationsmodelle 1.2.1 Schulz von Thun 1.2.2 Paul Watzlawick 1.3 Zuhörtechniken 1.4 Fragetechniken 1.5 Standpunkt
Mit Kommunikation Menschen begeistern. Präsidentenkonferenz Swiss Sailing, 24. März 2018, Ittigen
 Mit Kommunikation Menschen begeistern Präsidentenkonferenz Swiss Sailing, 24. März 2018, Ittigen Man kann nicht nicht kommunizieren Wichtiger Grundsatz in der Kommunikation: Man kann nicht nicht kommunizieren.
Mit Kommunikation Menschen begeistern Präsidentenkonferenz Swiss Sailing, 24. März 2018, Ittigen Man kann nicht nicht kommunizieren Wichtiger Grundsatz in der Kommunikation: Man kann nicht nicht kommunizieren.
Englischdidaktik in den Studiengängen Sekundarstufe II
 Fachportrait Englischdidaktik in den Studiengängen Sekundarstufe Fachverständnis Sie wollen Englisch auf der Sekundarschulstufe (Maturitäts-, Fachmaturitäts-, Diplom- und Berufsschulen) unterrichten, Ihre
Fachportrait Englischdidaktik in den Studiengängen Sekundarstufe Fachverständnis Sie wollen Englisch auf der Sekundarschulstufe (Maturitäts-, Fachmaturitäts-, Diplom- und Berufsschulen) unterrichten, Ihre
Sachinformation und Begleitinformationen im Kommunikationsprozess
 Sachinformation und Begleitinformationen im Kommunikationsprozess Menschliche Kommunikation findet auf mehreren Ebenen statt. Zumindest muss neben dem Sachinhalt (Inhaltsebene bzw. Inhaltsaspekt) auch
Sachinformation und Begleitinformationen im Kommunikationsprozess Menschliche Kommunikation findet auf mehreren Ebenen statt. Zumindest muss neben dem Sachinhalt (Inhaltsebene bzw. Inhaltsaspekt) auch
Lehren im EBA-Bereich. Mehr als Inhalte vermitteln!
 Lehren im EBA-Bereich Mehr als Inhalte vermitteln! Inhalte Wodurch wird das Lehren beeinflusst? oder wäre es einfacher darüber zu diskutieren, welche Faktoren das Lehren nicht beeinflussen? Wie lässt sich
Lehren im EBA-Bereich Mehr als Inhalte vermitteln! Inhalte Wodurch wird das Lehren beeinflusst? oder wäre es einfacher darüber zu diskutieren, welche Faktoren das Lehren nicht beeinflussen? Wie lässt sich
Beurteilungskriterien für die Leistungsbeurteilung in Englisch
 Beurteilungskriterien für die sbeurteilung in Englisch Inhalt» 1.-4. Klasse» 5. Klasse» 6. Klasse» 7. Klasse» 8. Klasse sfeststellung Englisch / 1. 4. Klasse Folgende en während des Schuljahres bilden
Beurteilungskriterien für die sbeurteilung in Englisch Inhalt» 1.-4. Klasse» 5. Klasse» 6. Klasse» 7. Klasse» 8. Klasse sfeststellung Englisch / 1. 4. Klasse Folgende en während des Schuljahres bilden
telc Sprachenzertifikate
 telc Sprachenzertifikate die Chance für Ihr Kind! Informationen für Eltern www.telc.net Die telc B1-Prüfung in Englisch hat mich bestärkt, meine Sprachkenntnisse weiter zu vertiefen. In Bewerbungen kann
telc Sprachenzertifikate die Chance für Ihr Kind! Informationen für Eltern www.telc.net Die telc B1-Prüfung in Englisch hat mich bestärkt, meine Sprachkenntnisse weiter zu vertiefen. In Bewerbungen kann
Hermann Hesse-Gymnasium Calw. Schulcurriculum Englisch. Zielsetzung - 1
 Zielsetzung Aufgrund der zunehmenden Bedeutung der englischen Sprache im Alltag nimmt das Fach Englisch als 1. Fremdsprache eine herausragende Stellung ein. Die Schulcurricula zielen auf eine ständig sich
Zielsetzung Aufgrund der zunehmenden Bedeutung der englischen Sprache im Alltag nimmt das Fach Englisch als 1. Fremdsprache eine herausragende Stellung ein. Die Schulcurricula zielen auf eine ständig sich
I NFORMATIONSVERANSTALTUNG
 I NFORMATIONSVERANSTALTUNG ZUR P RÜFUNG IM F ACH S CHULPÄDAGOGIK NACH LPO I VOM 13.03.2008 Termine Staatsexamen Nach der LPO I vom 13.03.2008 wählen Sie aus den Erziehungswissenschaften ein Fach, in dem
I NFORMATIONSVERANSTALTUNG ZUR P RÜFUNG IM F ACH S CHULPÄDAGOGIK NACH LPO I VOM 13.03.2008 Termine Staatsexamen Nach der LPO I vom 13.03.2008 wählen Sie aus den Erziehungswissenschaften ein Fach, in dem
