Fachkonferenz BMBF-Fördermaßnahme»Kommunen innovativ«am 19. und 20. September 2017 in Hamburg-Wilhelmsburg. Dokumentation
|
|
|
- Oswalda Hofer
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Fachkonferenz BMBF-Fördermaßnahme»Kommunen innovativ«am 19. und 20. September 2017 in Hamburg-Wilhelmsburg Dokumentation
2 Inhaltsverzeichnis 1 Begrüßung und Einführung Kommunale Transformationsprozesse als Herausforderung für Wissenschaft und Praxis Impressionen der Veranstaltung Schlaglichter auf die Verbundprojekte Fokusthema 1: Infrastruktur und Daseinsvorsorge Fokusthema 2: Innenentwicklung mit neuen Instrumenten Fokusthema 3: Partizipation & Innovation in Reallaboren Fokusthema 4: Datenmanagement & Entscheidungstools Marktplatz der Projekte Diskussionspanel: kommunale Praxis trifft Wissenschaft Wissenschaft trifft kommunale Praxis Parallele Arbeitsforen zu den Fokusthemen Arbeitsforum 1: Infrastruktur und Daseinsvorsorge Arbeitsforum 2: Innenentwicklung mit neuen Instrumenten Arbeitsforum 3: Partizipation und Innovation in Reallaboren Arbeitsforum 4: Datenmanagement und Entscheidungstools Impressionen aus den Arbeitsforen Abschlusspanel: Blick nach vorn Erwartungen und Empfehlungen an»kommunen innovativ« Alle Präsentationen der Veranstaltung stehen zum Download zur Verfügung unter Impressum KomKomIn - Wissenschaftliches Begleit-, Vernetzungs- und Transfervorhaben Deutsches Institut für Urbanistik ggmbh Dr. Stephanie Bock, Jan Abt, Julia Diringer Raum & Energie Institut für Planung, Kommunikation und Prozessmanagement GmbH Katrin Fahrenkrug, Dr. Michael Melzer, Lutke Blecken Telefon: (030) komkomin@difu.de
3 1 Begrüßung und Einführung MinDirig Wilfried Kraus, Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Herr Wilfried Kraus stellt die Fördermaßnahme Kommunen Innovativ als Teil des BMBF-Rahmenprogramms Forschung für Nachhaltige Entwicklung (FONA³) vor. Für Kommunen bestehen derzeit große Herausforderungen in so zentralen Themen wie demografischer Wandel, veränderte Landnutzung, Globalisierung und Digitalisierung. Kommunen sind die Orte, an denen diesen Herausforderungen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung begegnet werden kann. In der Nachhaltigkeitsstrategie für Deutschland sind die nationalen Ziele vor dem Hintergrund der UN-Nachhaltigkeitsziele zu einem gemeinsamen Verständnis gebündelt. MinDirig Wilfried Kraus (BMBF) Zur Umsetzung bedarf es innovativer Projekte und Lösungsansätze, Technologieoffenheit und Innovation, es bedarf der Partnerschaft von kommunalen Akteuren und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Jedes Projekt hat einen konkreten Anwendungsbezug und soll auf andere Kommunen übertragbar sein. Die Fachkonferenz dient als Austauschplattform, um die vielfältigen Aktivitäten der Kommunen besser zu vernetzen, zu kommunizieren und ihnen Hebelkraft zu verleihen. Dabei geht es um gemeinsame Ansätze von Praxis und Wissenschaft, Einbeziehen der unterschiedlichen Akteure, konkrete Realisierungsvorschläge und deren Umsetzung in den Kommunen. 3
4 2 Kommunale Transformationsprozesse als Herausforderung für Wissenschaft und Praxis Prof. Dr. Uwe Schneidewind, Wuppertal Institut Präsident und wissenschaftlicher Geschäftsführer Prof. Dr. Uwe Schneidewind hält in seiner Rede ein Plädoyer für eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis. Ein gemeinsames Arbeiten von Wissenschaft und Praxis auf gleicher Augenhöhe mit viel Empathievermögen ermöglicht ein produktives Miteinander. Dementsprechend sollten auch die Verbundprojekte bei ihrer Konzeption auf eine gleichberechtigte Ebene zwischen Wissenschaft und Praxis achten. Denn komplizierte reale Zusammenhänge erfordern vermehrt den Einsatz Prof. Dr. Uwe Schneidewind wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Praxis. Reallabore können hierbei helfen, ebenbürtige Experimentiergemeinschaften aufzubauen und wissenschaftliche Ansätze unter realistischen Bedingungen anzuwenden. Die Transformative Wissenschaft beschäftigt sich mit diesen neuen Dimensionen der Inter- und Transdisziplinarität. Ausgangspunkte sollten dabei konkrete Probleme aus der Praxis sein. Das Kontextwissen der praktischen Akteure sollte dabei einbezogen werden, so dass eine gemeinsame Wissensproduktion unter Best Practice-Ansätzen stattfinden kann. Derzeit gibt es jedoch noch wenig Anerkennung für diese Vorgehensweise, da die gängige wissenschaftliche Herangehensweise ein Labor mit kontrollierten Bedingungen vorsieht. Diese sind innerhalb eines Reallabors kaum gegeben, weswegen Veränderungen der Rahmenbedingungen keine effektiven wissenschaftlichen Bedingungen mehr gewährleisten. Folglich bedarf es im Rahmen der Transformativen Wissenschaft vor allem Querdenker, um die Herausforderungen der Gesellschaft zu bewältigen. 4 Präsentation zum Download.
5 3 Impressionen der Veranstaltung 5
6 4 Schlaglichter auf die Verbundprojekte Das Team des Begleitprojektes KomKomIn stellt die Verbundprojekte der Fördermaßnahme geordnet nach den Fokusthemen knapp vor, um den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen Überblick über die vielfältigen Inhalte und Ansätze der Projekte zu geben. 4.1 Fokusthema 1: Infrastruktur und Daseinsvorsorge Dr. Stefanie Bock, Deutsches Institut für Urbanistik Unter Daseinsvorsorge wird die Grundversorgung der Bevölkerung mit lebenswichtigen Dienstleistungen und Infrastrukturen verstanden. Hierzu gehören bspw. Einrichtungen der Nahversorgung, Gesundheits- und Bildungseinrichtungen, Zugang zu öffentlichen Verkehren, aber auch der Bereich der technischen Infrastruktur wie Wasser- und Energieversorgung, Abfall- und Abwasserentsorgung und moderne Kommunikationsdienstleistungen. Zu denken ist aber auch an Rettungsdienste und Feuerwehr. Insbesondere in den vom demografischen Wandel betroffenen ländlichen aber auch städtischen Räumen ist die Aufrechterhaltung vieler dieser Aufgaben der Daseinsvorsorge gefährdet. Sinkende Nachfrage und veränderte Bevölkerungsstruktur gehen einher mit Tragfähigkeitsproblemen und gewandelten Bedarfen. Das bedeutet, dass existenzielle Fragen der Grundversorgung neu gestellt werden müssen. Eine Vielzahl der im Rahmen der BMBF-Fördermaßnahme Kommunen innovativ geförderten Projekte knüpft hier an und setzt sich mit der Frage auseinander, wie die Angebote und Infrastrukturen der Daseinsvorsorge an die neuen Entwicklungen angepasst werden können. Die konkreten Fragestellungen fallen dabei unterschiedlich aus auch weil der Schuh nicht überall an der gleichen Stelle drückt. In den zehn Projekten des Fokusthemas Infrastruktur und Daseinsvorsorge geht es um» Lösungsansätze vor dem Hintergrund einer nachhaltigen und resilienten Stadtund Regionalentwicklung,» die Einbindung unterschiedlicher Akteure mit dem besonderen Fokus auf bürgerschaftlichem Engagement und der Rolle der Zivilgesellschaft,» dezentrale und regionale Lösungen sowie» Finanzierungskonzepte. 6
7 TempALand Kommunen stellen sich auf Bevölkerung mit multilokalen Lebensweisen ein Kommune/Region: Fünf Kommunen des Diepholzer Landes (Diepholz, Rehden, Lemförde, Barnstorf, Wagenfeld) und der Landkreis Diepholz Verbundkoordinator: Leibniz Universität Hannover fokusland Bürger und Kommunen sorgen gemeinsam für mehr Lebensqualität in ihrer Region Kommune/Region: Amt Peenetal/Loitz und 14 weitere Gemeinden Verbundkoordinator: Akademie für Nachhaltige Entwicklung Mecklenburg-Vorpommern lebenswert Hessische Kommunen erproben ganzheitliches Entwicklungsmanagement Kommune/Region: Stadt Eschwege, Stadt Bad Sooden-Allendorf, Gemeinde Meinhard, Gemeinde Meißner, Stadt Witzenhausen Verbundkoordinator: ISOE Institut für sozial-ökologische Forschung NoLA Damit Ressourcen des Abwassers für Land und Energie genutzt werden können Kommune/Region: Gemeinde Rohrbach/Thüringen Verbundkoordinator: Bauhaus-Universität Weimar 7 KOMOBIL2035 Neue Kooperation von Ehren- und Hauptamtlichen für nachhaltige Mobilität Kommune/Region: Gemeinde Rainau, Landkreis Heidenheim, Landkreis Ostalbkreis Verbundkoordinator: Regionalverband Ostwürttemberg
8 imona Eine Region verknüpft Personenverkehr und Nahversorgung zu zukunftsfähiger Mobilität Kommune/Region: Landkreis Freyung-Grafenau Verbundkoordinator: Landkreis Freyung-Grafenau JuMoWestküste Vier Landkreise vereinen Standortvorteile und fördern die Karrieren künftiger Fachleute Kommune/Region: Landkreise Dithmarschen, Nordfriesland, Pinneberg und Steinburg Verbundkoordinator: Kreis Dithmarschen, Fachdienst Gesundheit, Betreuung und Projektplanung DeWaK Wie sich soziale Einrichtungen für verschiedene Generationen zukunftsfähig etablieren lassen Kommune/Region: Ennepe-Ruhr-Kreis, Stadt Herten Verbundkoordinator: Technische Universität Dortmund 8 KuDeQua Bürger beteiligen sich an öffentlichen Dienstleistungen im eigenen Stadtquartier Kommune/Region: Stadt Dortmund Verbundkoordinator: Stadt Dortmund KoDa_eG Wie Bürgergenossenschaften Leistungen der Daseinsvorsorge zukunftsfähig tragen können Kommune/Region: Gemeinden Oberreichenbach, Posterstein und Schuttertal, Stadt Offenburg Verbundkoordinator: Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung (zze) an der Evangelischen Hochschule Freiburg (FIVE) e. V.
9 4.2 Fokusthema 2: Innenentwicklung mit neuen Instrumenten Jan Abt, Deutsches Institut für Urbanistik Für die Lebensqualität der Städte und Gemeinden ist es entscheidend, ihre Ortskerne wieder zu stärken. Einzelhandel, Kultur und soziales Leben entwickeln sich auf den Marktplätzen, den Altstädten und den Zentren der Dörfer. Dies braucht eine gewisse Dichte. Viele Verbundprojekte der Fördermaßnahme Kommunen innovativ gehen daher neue Wege, um brachgefallene Flächen und Gebäude wieder zu nutzen und Innenstädte zu beleben. Sie wurden unter dem Fokusthema Innenentwicklung gruppiert, was die Strategie bezeichnet, den zukünftigen Entwicklungsbedarf dadurch zu decken, dass innerörtliche, bereits erschlossene Flächen aktiviert und bebaut werden. Die einzelnen Ansätze, die hier verfolgt werden, reagieren auf die unterschiedlichen Fragestellungen und Ausgangslagen der Kommunen. So werden neue Finanzinstrumente erprobt, mit denen Gemeinden und Bürger historische Gebäude selbst sanieren können. Es werden Frühwarnsysteme entwickelt, um rechtzeitig zu erkennen, wo Gebäude in Zukunft leerstehen werden. Mit dreidimensionalen Visualisierungen wird Bewohnerinnen und Bewohnern verdeutlicht, welche Brachen sich für eine Neubebauung anbieten. Gemeinden schließen sich zusammen, um soziale Angebote miteinander anzubieten und Orte und Ortskerne wieder attraktiv und lebendig zu gestalten. 9 Ortsinnenentwicklung Hessische Pilotgemeinden schaffen Zentren mit mehr Lebensqualität Kommune/Region: Gemeinden Butzbach, Nidda und Ortenberg (Hessen) Verbundkoordinator: Stadt Butzbach KOMET Acht Gemeinden gestalten gemeinsam ihr kommunales und landschaftliches Potenzial Kommune/Region: acht benachbarte Gemeinden im Süden Thüringens Verbundkoordinator: Landkreis Ilm-Kreis
10 AktVis Drei Gemeinden planen innerstädtische Entwicklung gemeinsam mit der Bevölkerung Kommune/Region: Gemeinden Bensheim, Münster und Otzberg (Hessen) Verbundkoordinator: Technische Universität Darmstadt, Fachgebiet Landmanagement LebensRäume Landkreis fördert mit bedarfsgerechtem Wohnraum attraktive Innenentwicklung Kommune/Region: Kreis Steinfurt (Nordrhein-Westfalen) Verbundkoordinator: Öko-Institut e. V. Flächenmanagement Wie bestehende Unternehmen und Gewerbeflächen zukunftsfähig genutzt werden Kommune/Region: Landkreis Osnabrück (Niedersachsen) Verbundkoordinator: oleg Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbh MOSAIK Strategien des Zusammenlebens verschiedener Kulturen und Generationen Kommune/Region: Remscheid (Nordrhein-Westfalen) Verbundkoordinator: Technische Universität Dortmund, Fachgebiet Raumordnung und Planungstheorie KIF Gemeinden bauen einen freiwilligen und selbstverwalteten Fonds zur Innenentwicklung auf Kommune/Region: 47 Gemeinden der Landkreise Nienburg/Weser und Gifhorn (Niedersachsen) Verbundkoordinator: Landkreis Nienburg/Weser 10
11 Bürgerfonds Initiativen engagieren sich für historische Fachwerkstädte und Ortszentren Kommune/Region: vier Städte aus Thüringen, Hessen und Niedersachsen Verbundkoordinator: Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte e.v. 4.3 Fokusthema 3: Partizipation & Innovation in Reallaboren Dr. Michael Melzer, Institut Raum & Energie Partizipation ist ein Leitgedanke der ganzen Fördermaßnahme und aller Verbundvorhaben. Partizipation im Sinne eines aktiven Miteinanders aller Akteure, von Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürgern gilt als Grundvoraussetzung für die Entwicklung und Umsetzung akzeptanzfähiger Innovationen. Dennoch werden das Wie und Wann und mit Wem bei Beteiligungsprozessen noch oft eher intuitiv beantwortet. Es geht um die Entwicklung von Beteiligungskonzepten, die belastbar erprobt von Kommunen eingesetzt werden können. 11 Dem Fokusthema sind deshalb die Vorhaben zugeordnet, die sich ganz explizit mit der Entwicklung von Beteiligungskonzepten befassen, die belastbar erprobt von Kommunen eingesetzt werden können. Es geht darum,» welche Formate bei welchen Ausgangsbedingungen zielgerichtet sind,» welche Akteure bei welchen Aufgabenstellungen erforderlich sind und wie sie erreicht werden können,» welche Governance-Strukturen nachhaltig eine Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt befördern und hinderliche Machtstrukturen auflösen (und wer dafür das Mandat erteilt),» wie der Dialog zu einer gemeinsamen Projektarbeit, zu Co-Produktion führt und» wer die Verfolgung des Innovationsanspruchs bei der Partizipation wie sichert und in diesem Kontext nicht zuletzt, welche Rolle Wissenschaft und Beratung dabei übernehmen können oder auch dürfen.
12 Kleinstadt gestalten Junge Menschen schaffen Orte mit Mehrwert für die Gemeinde Kommune/Region: Stadt Weißwasser Verbundkoordinator: Stadtverein Weißwasser e.v. TransformBar Engagierte Bürger und Kommunen schaffen mehr Lebensqualität durch Beteiligung Kommune/Region: Stadt Münsingen, Stadt Treuenbrietzen Verbundkoordinator: DIALOGIK mbh Wat Nu? Tourismusgemeinden bestimmen ihre Zukunftsperspektiven im Reallabor Kommune/Region: Wangerland, Juist, Spiekeroog, Norden Verbundkoordinator: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg KoSI-Lab Wie im Soziallabor aus guten Taten kommunaler Gewinn erwächst Kommune/Region: Stadt Dortmund, Stadt Wuppertal Verbundkoordinator: Technische Universität Dortmund 12 CoProGrün Wie Wissenschaftler, Bürger und Unternehmer urbanes Grün wirtschaftlich erhalten Kommune/Region: Regionalverband Ruhr Verbundkoordinator: Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen MIGOEK Ländliche Kommunen wollen die Wirtschaftskraft von Migranten fördern und nutzen Kommune/Region: Landkreise Cloppenburg, Holzminden, Werra-Meißner
13 Verbundkoordinator: HAWK Hildesheim-Holminden-Göttingen IN² Ländliche Gemeinden schaffen Möglichkeiten zur dauerhaften Integration von Zuwanderern Kommune/Region: Verbandsgemeinden Gerolstein, Rockenhausen Verbundkoordinator: Institut für Technologie und Arbeit e.v., Kaiserslautern LAZIKN2030 Zwei Kommunen entwickeln mit Jugendlichen Szenarien für mehr Nachhaltigkeit Kommune/Region: Sandersdorf-Brehna und Barnstorf Verbundkoordinator: Stadt Sandersdorf-Brehna Fokusthema 4: Datenmanagement & Entscheidungstools Lutke Blecken, Institut Raum & Energie Dem Fokusthema Datenmanagement & Entscheidungstools sind Verbundprojekte zugeordnet, deren Schwerpunkt darauf liegt, Methoden und Werkzeuge zu entwickeln, die unterschiedliche Akteure auf kommunaler und regionaler Ebene dabei unterstützen, ihre Planungen auf Veränderungen durch den demografischen Wandel, aber z.b. auch auf soziale Veränderungen anzupassen. Hilfreich kann das in ganz unterschiedlichen Handlungsfeldern sein, wie z.b. der Wohnbauentwicklung oder der Anpassung von Infrastrukturen, aber auch bei der kommunalen Finanzpolitik. Dafür analysieren sie die vergangene Entwicklung und generieren Prognosen oder auch Szenarien einer künftigen Entwicklung. Jedes Tool nutzt eine Vielzahl von Daten, für die entsprechende Datenmanagementsysteme entwickelt werden müssen. Bei der Entwicklung und anschließenden Nutzung der Entscheidungstools hat die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Kommunen eine große Bedeutung: Die Wissenschaft liefert entsprechende Methoden und Werkzeuge, um Informationen zu generieren. Kommunen und andere Akteure wiederum liefern Daten für die Tools und sind die Anwender der Werkzeuge. Daher müssen sie an ihren Bedürfnissen ausgerichtet sein. Ohne eine Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis sind passfähige Lösungen kaum möglich.
14 WEBWiKo Kommunen erproben flexible Planungsinstrumente für die interkommunale Regionalentwicklung Kommune/Region: Großraum Bremen Verbundkoordinator: Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen e.v. KomMonitor Nordrhein-Westfälische Städte schaffen ein Monitoring für eine fachübergreifende Stadtplanung Kommune/Region: Städte Essen und Mülheim an der Ruhr Verbundkoordinator: InWIS Institut für Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt- und Regionalentwicklung GmbH NaKoFi 14 Wie die Nachhaltigkeit kommunaler Finanzen bewertet werden kann Kommune/Region: Stadt Cottbus Verbundkoordinator: Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften IER-SEK Stadtentwickler und Unternehmer planen Wohnstandorte vorausschauend und miteinander Kommune/Region: Stadt Zwickau Verbundkoordinator: Stadt Zwickau, Stabsstelle Stadtentwicklung
15 5 Marktplatz der Projekte Der Marktplatz der Projekte bildet einen zentralen Baustein der Fachkonferenz. Er bietet allen Projekten die Möglichkeit, in einen intensiven Austausch mit anderen Projekten zu gelangen. Hierfür präsentiert sich jedes Projekt auf einem Marktstand u.a. mit Postern. Im Laufe der Veranstaltung besteht im Rahmen von individuellen Rundgängen, die dem Prinzip einer offenen Messeausstellung ähneln, die Möglichkeit, thematische und methodische Nähen untereinander zu identifizieren, voneinander zu lernen und eine künftige Zusammenarbeit vorzubereiten. 15
16 6 Diskussionspanel: kommunale Praxis trifft Wissenschaft Wissenschaft trifft kommunale Praxis Im ersten Diskussionspanel diskutieren Vertreterinnen und Vertreter von Kommunen, der Wissenschaft und des Projektträgers Jülich, moderiert von Katrin Fahrenkrug, Institut Raum & Energie, wie die Zusammenarbeit zwischen kommunaler Praxis und Wissenschaft organisiert sein muss, um einen gegenseitigen Mehrwert zu erzielen. 16 Von links nach rechts: Angelika Sack (Landkreis Nienburg, KIF), Dr. Axel Timpe (RWTH Aachen, CoProGrün), Maike Hauschild (Projektträger Jülich), Jana Werg (e-fect, TransformBar), Ralf Keller (Zentrum für gute Taten Wuppertal, KosiLab), Ulla Schauber (Bauhaus-Universität Weimar), Björn Mühlena (Bürgermeister der Gemeinde Wangerland, WatNu?), Katrin Fahrenkrug (Institut Raum & Energie) Björn Mühlena, Bürgermeister der Gemeinde Wangerland, vertritt auf dem Podium das Projekt WatNu, das auf die Ortsentwicklung der Kommunen Wangerland, Juist, Spiekeroog und Norden an der niedersächsischen Nordseeküste fokussiert. In der Region fehlte bisher eine wissenschaftliche Betrachtung demografischer Veränderungen, auch um einen Blick von außen zu ermöglichen. Schwierig bei der Zusammenarbeit ist manchmal die unterschiedliche wissenschaftliche und kommunale Sprache. Hilfreich sind die grenzübergreifenden Arbeiten des Projektes mit der Reichsuniversität Groningen, um Erfahrungen aus den Niederlanden aufnehmen zu können.
17 Das Vorhaben KoSI-Lab wird von Ralf Keller vom Zentrum für gute Taten Wuppertal vertreten: Im Projekt geht es primär um die Vermittlung von ehrenamtlichen Aufgaben. Die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft funktioniert sehr gut, auch wenn die Beteiligten teilweise neue Vokabeln lernen müssen. Die Wissenschaft stellt im Projekt Methoden und Verfahren zur Verfügung, u.a. um die vielen vorhandenen, aber isoliert durchgeführten ehrenamtlichen Projekte zu vernetzen. Wichtig ist aus Sicht von Herrn Keller, diese Prozesse auch langfristig zu verstetigen. Innerhalb des Projektes TransformBar, so Jana Werg von e-fect, ist das verbindende Element der beiden Kommunen Münsingen und Treuenbrietzen die Distanz zur Großstadt einmal Stuttgart, einmal Berlin. Beide Kommunen liegen einerseits nicht mehr im Speckgürtel der Städte, andererseits aber noch so nahe, dass sie keine eigene Identität ausbilden. Im Vorhaben sollen konkrete Projekte durch bürgerschaftliches Engagement angestoßen werden, Engagement und Beteiligung sollen in der Verwaltung verankert werden und ein Austausch zwischen den Kommunen hergestellt werden. Die Rolle der Wissenschaft besteht im Projekt darin, implizites Wissen explizit zu machen, es teilbar zu machen und den Verwaltungen Wissen und Argumentationshilfen zu liefern, um bürgerschaftliches Engagement in den Städten zu verankern. Dr. Axel Timpe von der RWTH Aachen beschreibt das Vorgehen von CoProGrün. Die Aufgabe der Wissenschaft im Projekt liegt in der Moderation der Beteiligungsprozesse, wobei zweigleisig vorgegangen wird: zuerst werden die unterschiedlichen Akteure individuell angesprochen, damit sie sich eingebunden fühlen und ihre Probleme eingebracht werden. Anschließend werden sie aus ihrem Setting geholt und Akteure zusammengebracht, die sonst nicht miteinander reden. Gemeinsam können so Ziele entwickelt werden. Diese werden dann thematisch von Arbeitsgruppen weiterentwickelt. Ziel des Austauschs ist es, das Mindset und die jeweilige Peer Group zu erweitern. 17 Die Aufgaben von Ulla Schauber von der Bauhaus-Universität Weimar als wissenschaftliche Begleitung des Projekts KOMET liegen in der näheren Beleuchtung und Reflektion der Dialog- und Austauschprozesse innerhalb des Vorhabens. Dabei wird das Format eines kollegialen Austauschs genutzt: Wissen zur Gestaltung des demografischen Wandels ist bereits in der Region vorhanden, die Wissenschaft moderiert und gibt spannende Denkanstöße, die aufgrund ihrer neutralen Stellung auch mal provokativ sein können. Die Idee für das Projekt wurde vom Landkreis Ilm-Kreis und dem Biosphärenreservat entwickelt und anschließend an die Universität herangetragen, um sie als Partner zu gewinnen. Frau Schauber plädiert dafür, Dialogprozesse auch langfristig finanziell zu unterstützen, z.b. durch entsprechende Förderrichtlinien, da nicht-investive Maßnahmen neben baulichen und technischen Maßnahmen zur Gestaltung des demografischen Wandels nicht zu unterschätzen sind. Angelika Sack vom Landkreis Nienburg stellt die neue, aber spannende Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis im Vorhaben KIF vor. Die Wissenschaft liefert die Methodenkenntnisse, um die Idee eines interkommunalen Innenentwicklungsfonds in einem Planspiel zu erproben und seine Wirkungen zu analysieren. Zur Umsetzung eines
18 Projektansatzes, der auf eine Ökonomisierung von Flächen abzielt, sind die Praxispartner im Projekt auf eine Zusammenarbeit mit der Wissenschaft zwingend angewiesen. Maike Hauschild vom Projektträger Jülich sieht bei der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis Schwerpunkte bei der Entwicklung von Instrumenten und bei der Kommunikation. Durch die Rückkopplung in die Praxis kann die Wissenschaft Produkte entwickeln, die von der Praxis gebraucht werden. Sie stellt dann nicht mehr Fragen, die die Praxis gar nicht interessieren. Ziel aller Projekte muss es sein, Synergien zu knüpfen und die Wissenschaft bei praxisnahen Fragen und Problemen einzubinden. Ergänzt wird die Diskussion durch Beiträge aus den Projekten JuMoWestküste, KuDeQua und fokusland, bei denen die Initiative zur Teilnahme an Kommunen innovativ jeweils von kommunalen Akteuren ausging. So führt der wissenschaftliche Partner bei JuMoWestküste beispielsweise Befragungen durch, um festzustellen, ob sich im Rahmen des Projektes bei Jugendlichen Bewusstseinsveränderungen bezüglich ihrer Mobilität zeigen. Im Projekt KuDeQua ergab sich eine Zusammenarbeit mit der Wissenschaft, da der Kommune alleine keine Instrumente zur Verfügung standen, die vielfältigen Ideen aus der Bürgerschaft zur Qualifizierung von Nebenzentren umzusetzen. Daraufhin wurde wissenschaftliche Unterstützung zur Umsetzung weiterer Schritte hinzugezogen. Es zeigt sich bereits, dass die Rolle der Wissenschaft aufgrund ihrer Neutralität zur Akzeptanzbeschaffung in politischen Gremien als Mediator wichtig ist, genauso aber auch im Umgang mit der Bürgerschaft. Aus dem Projekt fokusland wurde angemerkt, dass die Diskussion um die Gestaltung des demografischen Wandels bisher vor allem durch die Raumordnung und die Politik geführt wird. Ziel der Wissenschaft im Projekt ist daher einerseits, Aspekte des bürgerschaftlichen Engagements und sozialer Fragen stärker in die Raumordnung einzubringen, andererseits Akzeptanz für Projekte zu schaffen, indem sich die Bevölkerung mit Projektergebnissen identifizieren kann. 18 Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass Kommunen künftig stärker den Mehrwert einer Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen im Rahmen von Förderprogrammen, aber auch darüber hinaus, sehen und dementsprechend transdisziplinäre Vorhaben zum Umgang mit ihren Herausforderungen initiieren sollten. Im Gegenzug gilt aber auch, dass Universitäten stärker Fragestellungen mit einem praktischen Bezug in den Vordergrund rücken müssen. Kommunen innovativ mit seinen 30 Verbundprojekten kann hierfür eine wichtige Vorbildfunktion übernehmen.
19 7 Parallele Arbeitsforen zu den Fokusthemen Vier Arbeitsforen dienen zum gemeinsamen thematischen Austausch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, um Nähen zwischen den Projekten zu analysieren und Synergien zu identifizieren. In allen Arbeitsforen wird anhand von kurzen Inputs ausgewählter Vorhaben dargestellt, welche Aufgabenstellungen und Herausforderungen im Fokusthema bestehen, welche Handlungsansätze verfolgt werden und welche ersten Erfahrungen sich ableiten lassen. Anschließend werden für thematische Schwerpunkte in Kleingruppen Handlungsansätze und Erfolgsfaktoren, aber auch Aspekte für einen weiteren Erfahrungsaustausch diskutiert. 7.1 Arbeitsforum 1: Infrastruktur und Daseinsvorsorge Moderation: Katrin Fahrenkrug, Institut Raum & Energie Die Herausforderungen des demografischen Wandels haben umfassende Konsequenzen für die Daseinsvorsorge und Infrastruktur der Kommunen. In sämtlichen Bereichen des Wohnens, der Mobilität, Bildung, Gesundheit, Energie, Wasser und Abfall sind Veränderungen seitens des Nachfrageumfangs oder in Hinblick auf die Ausgestaltung der Leistungen sichtbar. Viele Verbundprojekte versuchen, mithilfe neuer Ideen und Ansätze die Daseinsvorsorge langfristig zu sichern und die öffentlichen Dienstleistungen zu gewährleisten. Dabei verfolgen die unterschiedlichen, thematischen Schwerpunkte der Vorhaben das gemeinsame Ziel, kooperative Entwicklungen einzugehen und Synergien zwischen Wissenschaft und Praxis unter Einbezug der Bevölkerung zu nutzen. 19 Input einzelner Projekte TempALand (Prof. Dr. Frank Othengrafen, Universität Hannover) Im Projekt TempALand liegt der Fokus auf multilokalen Lebensweisen der Bevölkerung, insbesondere von Fachkräften, im Diepholzer Land. Chancen und Herausforderungen bestehen vor allem darin, dass Infrastruktur (phasenweise) vorgehalten und finanziert und die Nachfrage nach kleinen, kurzfristig (temporär) mietbaren und möblierten Wohnungen bedient werden muss, um lebenswertes Wohnen zu ermöglichen. Darüber hinaus begünstigt die Multilokalität den phasenweisen Anpassungsdruck der Infrastruktur und wird in Bezug auf die Sicherung von Fachkräften als Chance begriffen. Auch die interkommunale Zusammenarbeit und die Zusammenarbeit von Ehrenamt und Verwaltung wird als Perspektive bezüglich der Nachfrage nach all-in-one-dienstleistungen gesehen. Präsentation zum Download.
20 Fokusland (Prof. Dr. Peter Adolphi, Nachhaltigkeitsforum) Im Projekt Fokusland sollen Bürger und Kommunen gemeinsam für mehr Lebensqualität im ländlichen Raum Mecklenburg-Vorpommerns sorgen. Dafür werden engagierte Personen und Initiativen miteinander vernetzt und unterstützt. Dabei geht es primär darum, die unterschiedlichen Diskussionsbedarfe zwischen Grundsatzdiskussionen und der Umsetzungsdringlichkeit von Ideen zu vereinen und Raum für Austausch zu schaffen. Ausschlaggebend für eine weitere Beteiligung der Akteure ist jedoch nicht nur der Austausch, sondern vor allem die Erarbeitung von Ergebnissen, um den Aufwand der Akteure zu rechtfertigen. Präsentation zum Download. lebenswert (Dr. Martin Zimmermann, ISOE) Das Vorhaben lebenswert erarbeitet ein ganzheitliches, interkommunales Entwicklungsmanagement, das innerhalb hessischer Kommunen erprobt wird. Schwerpunkte sind die Wasserversorgung bzw. Abwasserbeseitigung, das Wohnungsangebot (altersgerechtes Wohnen, energetische Sanierung) und die Nahversorgung/Nahmobilität. In der Diskussion stellte sich heraus, dass bei anderen Projekten vor allem Interesse bezüglich der Monitoringinstrumente sowie der Berücksichtigung von Klimaanpassung und der Analyse von Leerstand besteht. 20 Präsentation zum Download. imona (Prof. Dr. Ulrike Stopka, Uni Dresden) Im Rahmen von imona sollen Mobilität und Nahversorgung im Landkreis Freyung-Grafenau durch private Fahrzeuge und ÖPNV verbunden werden. Dabei werden vor allem Senioren und mobilitätseingeschränkte Personen adressiert. Aber auch für Jugendliche soll durch Mitfahrgelegenheiten mehr Flexibilität geboten werden. Dafür müssen Ehrenamt und Vereine sowie die Politik eingebunden werden. Präsentation zum Download.
21 Ergebnisse 21 Diskussion thematischer Schwerpunkte in Kleingruppen An den Diskussionstischen werden folgende thematische Schwerpunkte vertieft: 1. Mobilität: Welche innovativen und realistischen Optionen gibt es? 2. Soziale Infrastruktur: Welche Angebote braucht eine zukunftsfähige Daseinsvorsorge? 3. Technische Infrastruktur: Welche Spielräume haben Kommunen? 4. Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation: Wie lässt sich eine effektive Öffentlichkeitsarbeit sichern? 5. Governance: Welche Governancestrukturen helfen?
22 22
23 23
24 7.2 Arbeitsforum 2: Innenentwicklung mit neuen Instrumenten Moderation: Jan Abt (Difu) Innenentwicklung ist ein zentrales Ziel verschiedener Verbundprojekte in der Fördermaßnahme Kommunen innovativ, das sie mit unterschiedlichen, innovativen Modellen verfolgen. Ein gemeinsamer Ansatzpunkt für viele Projekte ist die Rolle der Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der Innenentwicklung. Hierbei werden einerseits Ansätze verfolgt, die die Bevölkerung für die Themen von Nachverdichtung und Zentrenentwicklung sensibilisieren und andererseits ihre Handlungsoptionen für wirkungsvolle Maßnahmen der Gemeindeentwicklung ausbauen. Damit rücken häufig weiche Instrumente in den Mittelpunkt, die gleichsam Aspekte von Partizipation, Gemeinschaftssinn, lokaler Identität und zivilgesellschaftlichem Engagement betonen. Im Gegensatz zu rechtlichen oder planerischen Instrumenten hängt der Erfolg dieser Sensibilisierungs- und Motivierungsinstrumente maßgeblich davon ab, in wie weit sich auch ein Wandel in der Planungskultur und im Selbstverständnis hoheitlichem Handelns zeigt und wahrnehmbar vermittelt werden kann. Viele Ansätze der Innenentwicklung innerhalb der Fördermaßnahme Kommunen innovativ berühren daher in ihrem Kern Grundsatzfragen der Governance. Input einzelner Projekte KOMET (Dr. Thomas Scheller, Landkreis Ilm-Kreis) Das Projekt KOMET stärkt die gemeinsame Siedlungsplanung und Ortsentwicklung von acht Gemeinden im Thüringer Wald. Dies beinhaltet die Erprobung und Anpassung bestehender Demografie- oder Nachhaltigkeits-Checks für Vorhaben der Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung (z.b. der Vitalitätscheck des Landes Thüringen) und die Erarbeitung kommunenübergreifender regionaler Entwicklungskonzepte für Siedlungen (wie z.b. ein interkommunales Siedlungskonzept), technische oder soziale Infrastrukturen und Mobilität. Vor allem aber stellte Herr Dr. Scheller die Erfahrungen aus den Bürgerbeteiligungsprozessen in den Vordergrund seines Inputs, denn die Arbeit von KOMET beinhaltet eine Beteiligungsstrategie für den Dialog, wie mit dem demografischen Wandel umgegangen werden soll. Kommunale Entscheidungsträger, Bürgerschaft und die organisierte Zivilgesellschaft sollen über einen breit angelegten und zielgruppenspezifischen Beteiligungsprozess mobilisiert werden, um gemeinsam Ideen zu generieren und Handlungsansätze zu entwickeln. Im ersten Projektjahr wurden hierbei acht Bürgerwerkstätten durchgeführt und in Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern zentrale Themen für die Entwicklung der beteiligten Kommunen identifiziert. Um den Zusammenhalt der Bewohnerinnen und Bewohner zu stärken lohnt es sich, kleine echte Projekte zu schaffen, anstatt neue weniger greifbare Konzepte zu erarbeiten. Präsentation zum Download. 24
25 AktVis (Prof. Dr. Hans Joachim Linke, Technische Universität Darmstadt) In Ortskernen bestehen vielmals Flächenpotentiale, die aber nicht ausgeschöpft werden können. Häufig sind Eigentümer der Flächen nicht ausreichend motiviert, um diese Möglichkeiten zu nutzen. Das Projekt AktVis entwickelt daher Prozesse und Instrumente zur Flächenaktivierung, in dem es die lokale Bevölkerung für das Thema Innenentwicklung sensibilisiert. Durch 3D-Visualisierung von Potenzialflächen auf verschiedenen Maßnahmen und eine gestufte Beteiligungsstrategie sollen insbesondere Eigentümerinnen und Eigentümer von innerörtlichen Brachflächen dafür gewonnen werden, ihre Grundstücke für eine zukunftsfähige Gemeindeentwicklung in Wert zu setzen. Beratungsangebote und Wirtschaftlichkeitsberechnungen flankieren diesen Prozess der Bewusstseinsbildung und nehmen zugleich Ängste vor einer möglichen Neubebauung. Damit fokussiert AktVis auf die individuellen und sozialen Aspekte als Hebel für eine verstärkte Innenentwicklung in den Gemeinden. Präsentation zum Download. KIF (Dr. Marta Jacuniak-Suda, Landkreis Nienburg) Im Projekt KIF wird ein freiwilliger und selbstverwalteter Fonds entwickelt, aus dem Gemeinden Innentwicklungsmaßnahmen finanzieren können. Hierfür werden vor allem die rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen geklärt, die ein funktionsfähiges Fondsmodell benötigt. Gleichzeitig geht es darum, die interkommunale Kooperation der Fonds-Gemeinden auszubauen, ohne die ein auf Freiwilligkeit basierender Fonds nicht funktionieren kann. Dr. Marta Jacuniak-Suda verwies auf das klare Bekenntnis der Bürgermeister zur Innenentwicklung, als einen wesentlichen Schritt, um eine kommunenübergreifende Innenentwicklung auf den Weg zu bringen. 25 Präsentation zum Download. Bürgerfonds (Dr. Uwe Ferber, Stadt Land UG) Einen besonderen Ansatz, um die Handlungsfähigkeit von Bürgergruppen zu stärken, verfolgt das Projekt Bürgerfonds. Mit dem namensgebenden Bürgerfonds kann der Erwerb sanierungsbedürftiger, historischer Bausubstanz erfolgen, die dann durch lokale Initiativen gesichert, zwischengenutzt und bespielt wird. Dadurch können solche wertvollen Bauten in den Ortskernen erhalten werden und mit ihren Funktionen die Innenstädte beleben. Bürgerfonds nimmt bürgerschaftlichen Initiativen das Risiko eines Eigenerwerbs von Immobilien und ermöglicht es ihnen damit, sich auf Fragen der Instandsetzung, Nutzung und Kommunikation zu fokussieren. Fehlende immobilienwirtschaftliche Kenntnisse der Bürgergruppen gilt es durch entsprechende Weiterbildung zu begegnen, um erfolgreich Projekte umzusetzen und zu verstetigen. Die erzielten Pachterträge fließen in den Fonds zurück, womit weitere Objekte gesichert werden können. Präsentation zum Download.
26 Diskussion thematischer Schwerpunkte in Kleingruppen An den Diskussionstischen werden folgende thematische Schwerpunkte vertieft: 1. Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation: Die Bevölkerung aktivieren und gute Öffentlichkeitsarbeit betreiben. 2. Innenentwicklung verankern: Die Region mitnehmen und den Gedanken der Innenentwicklung verankern 3. Leerstände, Brachen und Potenzialflächen erfassen und beobachten 4. Rechtliche, organisatorische und finanzielle Rahmenbedingungen ausnutzen und erweitern 26
27 27
28 7.3 Arbeitsforum 3: Partizipation und Innovation in Reallaboren Moderation: Dr. Michael Melzer (Institut Raum & Energie) Partizipation ist eine Grundvoraussetzung für die Entwicklung und Umsetzung akzeptanzfähiger, innovativer Maßnahmen zur Gestaltung des demografischen Wandels. Dementsprechend weisen alle Verbundvorhaben partizipative Ansätze im Sinne eines aktiven Miteinanders von Akteuren aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft auf. Einige Projekte befassen sich dabei mit der Entwicklung von Beteiligungskonzepten, die über die klassischen Formen der Ansprache und Mitwirkung hinausgehen und belastbar erprobt von Kommunen eingesetzt werden können. Von besonderer Bedeutung sind Reallabore, in denen unterschiedliche Akteure mit wissenschaftlicher Beratung konkrete Fragestellungen informell bearbeiten. TransformBar (Frank Ulmer, dialogik) Für eine erfolgreiche Partizipation sind im Projekt Transformbar unterschiedliche Faktoren von Relevanz: Wichtig ist die Rückendeckung durch Bürgermeister, die Vorteilsargumentation bei der Verwaltung und der Bürgerschaft (die nicht zuletzt über gemeinsame Projekte gesucht werden muss) sowie Transparenz. Nicht erwartete Nebeneffekte und erfolge müssen flexibel erfasst werden können. Eine zentrale Botschaft lautet, dass Partizipationsprozesse nicht bis zum Ende vorgeplant werden können, sondern viel Flexibilität erfordern. Das ist gerade auch bei Forschungsprojekten und den dafür geltenden Regelungen zu berücksichtigen. 28 WatNu (Ernst Schäfer, Arsu) Das Projekt Wat Nu nutzt unterschiedliche Beteiligungsformate wie Zukunftsgespräche mit Politik und Verwaltung, eine Auftaktveranstaltung in Form eines Cafés, Bürgerwerkstätten, Mental Maps, Filminterviews, einen Fotowettbewerb und eine digitale Werkstatt. Leitend ist dabei jeweils die Frage, welche Partizipateure es gibt und wie relevante erreicht werden können. Wichtig für die weitere Arbeit sind die Auswertung und der Umgang mit den erarbeiteten Ergebnissen: Die beteiligten Bürgerinnen und Bürger müssen Erfolge sehen, um auch weiter für den Beteiligungsprozess motiviert werden zu können. Präsentation zum Download. KoSI-Lab (Jürgen Schultze, TU Dortmund) Das Projekt KoSI-Lab erarbeitet in Abgrenzung zum Reallabor modellhaft zwei Labore sozialer Innovation als realexperimentellen Ansatz sogenannte KoSI-Labs. KoSI-Labs sind dabei Räume und Ressourcen für Teams aus Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Forschung sowie der Bürgerschaft. Sie stellen neuartige, offene Institutionen der kollaborativen Bearbeitung von kommunalen Schlüsselproblemen dar. Dabei geht es darum, neue soziale, praxisnahe Lösungen auf Augenhöhe aller Akteure und mit dem Mandat der
29 Stadtgesellschaft zu entwickeln und zu erproben. Der Mehrwert des KoSI-Lab ist somit, dass eine soziale Infra- und Netzwerkstruktur geschaffen wird. Präsentation zum Download. KuDeQua (Michaela Bonan, Stadt Dortmund) Das Projekt KuDeQua entwickelt kultur- und demografiesensibel bürgerschaftlich getragene Finanzierungs- und Organisationsmodelle für gesellschaftliche Dienstleistungen im Quartier, die aus dem Bedarf der Bürgerschaft entstanden sind. Ziele sind unter anderem, Bürgerbeteiligungsprozesse zu stärken, umsetzungsfähige Dienstleistungsfelder zu identifizieren sowie neue Finanzmodelle zu entwickeln und Banken zu sensibilisieren, um abschließend neue übertragbare Leistungs-, Organisations- und Finanzierungsmodelle zu entwickeln. So sollen Versorgungslücken geschlossen werden und das Projekt als Wegweiser für andere Kommunen dienen. Der wichtigste Erfolgsfaktor einer Bürgerbeteiligung liegt darin, dass sich Bürgerinnen und Bürger nur beteiligen, wenn sie die Gründe der Beteiligung nachvollziehen können und wenn ihre Vorschläge transparent weiterentwickelt und genutzt werden. Präsentation zum Download. Ergebnisse Die gemeinsame Diskussion zeigt, dass die geförderten Vorhaben sehr unterschiedliche Ansätze und Ziele verfolgen. Steht bei einigen die direkte Beteiligung der Menschen vor Ort und beispielsweise inklusive Ansätze im Mittelpunkt, so zielen andere Vorhaben auf den Aufbau intermediärer Strukturen und die Mitwirkung organisierter Gruppen. Die Diskussion macht deutlich, dass die oft vorhandenen Unklarheiten und Ungenauigkeiten in der Abgrenzung von Partizipationsansätzen, Engagement, Kooperation und Koproduktion die Einschätzung der Chancen und Risiken einzelner Ansätze erschweren. Erst wenn die Zielsetzungen und Akteure genau benannt sind, können Reichweite, Erfolg und Übertragbarkeiten erkannt und entwickelt werden. Es gilt zu klären,» welche Formate bei welchen Ausgangsbedingungen zielgerichtet sind,» welche Akteure bei welchen Aufgabenstellungen einbezogen werden sollten und wie sie erreicht werden können,» wo die Grenzen zwischen Beteiligung, Engagement und Koproduktion verlaufen,» welche Governance-Strukturen nachhaltig eine Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt befördern und hinderliche Machtstrukturen auflösen (und wer dafür das Mandat erteilt),» wie der Dialog zu einer gemeinsamen Projektarbeit, zu Co-Produktion führt und» wer die Verfolgung des Innovationsanspruchs bei der Partizipation wie sichert und welche Rolle Wissenschaft und Beratung dabei übernehmen können oder auch dürfen. 29
30 Ausgewählte Botschaften der Arbeitsgruppe sind insbesondere:» Partizipation ist ein Prozess, der letztlich von vielen Akteuren gestaltet wird. Solche Prozesse erfordern eine hohe Flexibilität, die gerade auch im Design von Forschungsprojekten berücksichtigt werden muss.» Es gibt nicht eine ideale Form / ein ideales Format der Partizipation. Vielmehr müssen sehr unterschiedliche Ausgangsbedingungen berücksichtigt werden. Gerade auch Reallabore sind immer nur ein Format in Partizipationsprozessen.» Wichtig ist, dass man immer das Ziel im Auge behält, also fragt, ob die Partizipation Innovation und Nachhaltigkeit unterstützt.» Eine immer wieder offene Frage ist, woher das Mandat für den Partizipationsprozess kommt, wieweit es reicht und wer die Akteure auswählt.» Damit eng verbunden ist der Fakt, dass eine leistungsfähige Partizipation erhebliche Ressourcen erfordert. Die Arbeitsgruppe sieht es für notwendig an, dass Kommunen dafür über eine eigene Innovationsstelle verfügen. 30
31 31
32 7.4 Arbeitsforum 4: Datenmanagement und Entscheidungstools Moderation: Lutke Blecken (Institut Raum & Energie) Entscheidungen über Planungen und Maßnahmen zur Gestaltung des demografischen Wandels basieren u.a. auf Informationen über den Status-quo und Prognosen bzw. Szenarien künftiger Entwicklungen. Hilfreich können hier entsprechende Entscheidungstools sein, die die vergangene Entwicklung analysieren und Prognosen bzw. Szenarien der künftigen Entwicklung generieren. Eine zentrale Herausforderung besteht dabei darin, passfähige Tools zu entwickeln, die einerseits die richtigen Informationen liefern, andererseits vom Nutzer dauerhaft selbständig angewendet werden können. Zu berücksichtigen ist der Datenschutz. Dieser setzt den Tools in einigen Bereichen Grenzen, zum Beispiel in der Detailschärfe möglicher Aussagen. Input einzelner Projekte KomMonitor (Dr. Alexandra Lindner, InWIS) Zielsetzung des Projektes KomMonitor ist die Entwicklung eines kommunalen Monitoringsystems, um den Auswirkungen urbaner Veränderungsprozesse im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung zu begegnen. Dabei werden die Themenfelder Demografie, Sozialstruktur, Wohnen, Umwelt und Migration bearbeitet. Aufbauend auf eine Datenmodellierung und -aufbereitung werden GIS-gestützt Indikatoren berechnet, diese anwendungsfallbezogen aggregiert und bewertet. Anschließend werden sie über standardisierte Geodienste in einer interaktiven Web-Anwendung bereitgestellt. Die Informationen des Systems sollen leicht zu erschließen sein, weswegen ein Schwerpunkt auf die Entwicklung einer grafischen Benutzeroberfläche gelegt wird, auf der sich der Nutzer ohne Vorwissen zurechtfinden kann. Hierfür wird er durch grafische Elemente unterstützt und die Navigation wird einfach gehalten. Im Ergebnis soll der Nutzer Handlungsempfehlungen in Bezug auf soziale/politische Fragestellungen ableiten können. 32 Präsentation zum Download. WEBWiKo (Laura Wette, Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen e.v.) Im Projekt WEBWiKo werden Werkzeuge und Methoden zur Erstellung kleinräumiger Bevölkerungsprognosen und Wirkungsszenarien erarbeitet, wobei ein Fokus auf die Nutzung der Ergebnisse in interkommunaler Kooperation gelegt wird. So sind beispielsweise ein Nebeneinander von Wachstum und Schrumpfen und der unterschiedliche Bedarf an Infrastruktureinrichtungen und Siedlungsflächen zu berücksichtigen. Im Ergebnis sollen eine gemeinsame Dateninfrastruktur, ein gemeinsamer Werkzeugkasten und kooperative Analysen/Szenarien vorliegen, um die kooperative Planung zu unterstützen. Herausforderungen bei der Erarbeitung bestehen derzeit vor allem hinsichtlich
33 » der Erstellung kleinräumiger Bevölkerungsprognosen: Kleinräumigkeit vs. Validität der Prognose, Probleme angesichts einer Prognose auf Rasterbasis, Akzeptanz der Prognose in Verwaltung und Politik;» der Anonymisierung der Daten: Anforderungen an den Datenschutz;» der Wirkungszusammenhänge/-szenarien: Vereinheitlichung der Planungsansätze in den Kommunen und Bezug gleichartiger Daten aus den Kommunen. Präsentation zum Download. NaKoFi (Dr. Gunther Markwardt, TU Dresden) Ziele des Projektes NaKoFi sind eine Bewertung der Nachhaltigkeit kommunaler Haushalte und Berücksichtigung von internen und externen Faktoren auf die Haushaltsentwicklung, der Entwurf von Szenarien für die zukünftige Entwicklung, eine Standardisierung in der Bewertung und die Aufbereitung der Projektergebnisse in einer Datenbank. Herausforderungen bestehen in der Datenerfassung (geringe Verfügbarkeit von makroökonomischen Daten auf Gemeindeebene, Zeitreihenbrüche durch Gesetzesänderungen und Umstellung des kommunalen Rechnungswesens, sehr kurze Zeitreihen z.b. in der Analyse der Jahresabschlüsse, Zuordbarkeit der Kosten in der Leistungserstellung (kommunale Aufgaben) und Vergleichbarkeit der Daten) sowie in der Datenaufbereitung (Standardisierung des Vorgehens, Anwendbarkeit der Modelle für kommunale Entscheider sicherstellen (Komplexität, Interpretierbarkeit), Auswahl des geeigneten Tools für die Anwendung in der Kommune, Verfügbarkeit des Tools; Offline (z.b. in Excel) oder Online (Datenbank) und Kosten des Tools für Erstellung, Pflege und Betrieb). 33 Präsentation zum Download. IER-SEK (Tim Neumann, FH Zwickau) Das Projekt IER-SEK entwickelt ein Instrument zur Entscheidungsunterstützung für Großvermieter z.b. für bzw. gegen Neubau, Ersatzneubau, Sanierungen oder Rückbau. Dabei sollen Zielsetzungen von Stadtentwicklungskonzepten berücksichtigt werden. Die Erarbeitung erfolgt im Spannungsfeld zwischen dem operativen Geschäft der Unternehmen, der strategischen Kommunalpolitik und strategischen Unternehmensentscheidungen. In technischer Hinsicht bestehen Herausforderungen bezüglich Datenschutz (Rollenkonzept und Zugriffsrechte, Zugriffsmonitoring) der Systemlandschaft der Wohnungswirtschaft (unterschiedliches Niveau der Datenqualität, laufende Implementierungen, verfügbare Schnittstellen) und der Systemlandschaft der Stadt Zwickau (überhaupt Schnittstellen nach außen?, Hosting), in organisatorischer Hinsicht bezüglich Datenschutz (Kooperationsvertrag, schriftliche Bestätigungen), innerkommunale Kommunikation (zentraler Ansprechpartner, Behäbigkeit einer öffentlichen Verwaltung), der Statistikstelle der Stadt Zwickau (nicht in jeder Kommune, Wahlkalender zu berücksichtigen) und der Konzeptvielfalt in einer Kommune (INSEK, wohnpolitisches Konzept, F-Plan). Präsentation zum Download.
34 Diskussion thematischer Schwerpunkte in Kleingruppen An den Diskussionstischen werden folgende thematische Schwerpunkte vertieft: 1. Beteiligung im Erarbeitungsprozess: Wie lassen sich die potenziellen Nutzer von Entscheidungstools in den Erarbeitungsprozess einbeziehen, um ein passfähiges Ergebnis zu erzielen? 2. Verankerung der Ergebnisse: Wie kann sichergestellt werden, dass die erarbeiteten Entscheidungstools von der Zielgruppe (z.b. Politik und Verwaltung) dauerhaft genutzt und ihre Ergebnisse akzeptiert werden? 3. Datenmanagement und technische Umsetzung: Welche Herausforderungen stellen das Datenmanagement und die technische Umsetzung der Entscheidungstools an die Verbundprojekte? 34
35 7.5 Impressionen aus den Arbeitsforen 35
36 8 Abschlusspanel: Blick nach vorn Erwartungen und Empfehlungen an»kommunen innovativ«im Abschlusspanel ziehen sechs Vertreterinnen und Vertreter von Verbundprojekten der zweiten Förderrunde ein erstes Resümee der Fachveranstaltung. Moderiert von Dr. Stephanie Bock, Deutsches Institut für Urbanistik (Difu), diskutieren sie, welche Inspirationen sie für ihre weitere Arbeit aus der Veranstaltung ziehen können, welche Erkenntnisse sie besonders überrascht oder irritiert haben und welche Fragen offengeblieben sind. Auf dem Podium diskutieren» Thomas Eble, Regionalverband Ostwürttemberg (KOMOBIL_2035),» Michael Cullmann, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rockenhausen (IN²),» Susanne Menke, Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbh (oleg) (Flächenmanagement),» Prof. Dr. Thorsten Wiechmann, Technische Universität Dortmund (MOSAIK),» Prof. Dr. Leonie Wagner, Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen (MIGOEK) und» Prof. Dr. Hans Joachim Linke, Technische Universität Darmstadt (AktVis). Gefragt nach ihren Eindrücken von der Fachkonferenz betonen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die alle neu zum Netzwerk der Kommunen innovativ -Vorhaben hinzugekommen sind, die Vielzahl der in den geförderten Vorhaben behandelten Ansätze und Themen. Sie heben vor allem den intensiven Austausch auf dem Marktplatz der Projekte als besonderen Gewinn der Veranstaltung hervor. So konnte auch die Praxis viele für sie relevante Ideen kennenlernen und in das eigene Vorhaben und die Arbeit vor Ort mitnehmen. Als wichtig benannt werden zudem die Diskussionen zu praxisorientierter Wissenschaft und das damit in Zusammenhang stehende neue Verhältnis von Kommunen und Wissenschaft. Übereinstimmend bewerten die Diskussionsteilnehmerinnen und - teilnehmer das Konzept der Veranstaltung, das darauf zielte, Projekte der ersten und zweiten Förderrunde zu verknüpfen und zu vernetzen, als gelungen. Für die nächste Veranstaltung wünschen sich einige der Gesprächsbeteiligten eine stärkere thematische Fokussierung. In diesem Zusammenhang sollte diskutiert werden, welche Aspekte der in den Projekten bearbeiteten Fragestellungen wirklich neu und innovativ sind. Zudem wird der Wunsch geäußert, in der Folgeveranstaltung intensive Diskussionsmöglichkeiten in kleineren thematischen Arbeitsgruppen vorzusehen. Möglich sein sollte zusätzlich ein Austausch über den Kreis der an der Fördermaßnahme Beteiligten hinaus, um einerseits auf deren Erfahrungen und Erkenntnisse zurückgreifen und andererseits die eigenen Ergebnisse weitergeben zu können. 36
Fachkonferenz der BMBF-Fördermaßnahme»Kommunen innovativ«
 Fachkonferenz der BMBF-Fördermaßnahme Termin Dienstag, 19. und Mittwoch, 20. September 2017 Tagungsort Bürgerhaus Wilhelmsburg Mengestr. 20, 21107 Hamburg 1 Ziele der Fachkonferenz Die Fachkonferenz zur
Fachkonferenz der BMBF-Fördermaßnahme Termin Dienstag, 19. und Mittwoch, 20. September 2017 Tagungsort Bürgerhaus Wilhelmsburg Mengestr. 20, 21107 Hamburg 1 Ziele der Fachkonferenz Die Fachkonferenz zur
Die Fördermaßnahme.»Kommunen innovativ«
 Die Fördermaßnahme»Kommunen innovativ« Die Fördermaßnahme»Kommunen innovativ«kurzgefasst Kommunen innovativ» ist eine Fördermaßnahme des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (2016-2020)» schafft
Die Fördermaßnahme»Kommunen innovativ« Die Fördermaßnahme»Kommunen innovativ«kurzgefasst Kommunen innovativ» ist eine Fördermaßnahme des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (2016-2020)» schafft
Fachkonferenz 2018 der BMBF-Fördermaßnahme»Kommunen innovativ«
 Fachkonferenz 2018 der BMBF-Fördermaßnahme»Kommunen innovativ«termin Dienstag, 18. und Mittwoch, 19. September 2018 Tagungsort Dietrich-Keuning-Haus Leopoldstr. 50-58 44147 Dortmund 1 Ziele der Fachkonferenz
Fachkonferenz 2018 der BMBF-Fördermaßnahme»Kommunen innovativ«termin Dienstag, 18. und Mittwoch, 19. September 2018 Tagungsort Dietrich-Keuning-Haus Leopoldstr. 50-58 44147 Dortmund 1 Ziele der Fachkonferenz
Kommunen innovativ. Neue Forschungsprojekte für Regionen im demografischen Wandel
 Kommunen innovativ Neue Forschungsprojekte für Regionen im demografischen Wandel Forschung für Kommunen Für ein Mehr an Lebensqualität gehen Kommunen Kooperationen mit Wissenschaftlern ein. Entscheider
Kommunen innovativ Neue Forschungsprojekte für Regionen im demografischen Wandel Forschung für Kommunen Für ein Mehr an Lebensqualität gehen Kommunen Kooperationen mit Wissenschaftlern ein. Entscheider
Das kommunale Demografiekonzept der Verbandsgemeinde Winnweiler
 28. Oktober 2013 Das kommunale Demografiekonzept der Verbandsgemeinde Winnweiler Der demografische Wandel in vielen Orten im Zusammenwirken mit zunehmender Ressourcenknappheit stellt eine der zentralen
28. Oktober 2013 Das kommunale Demografiekonzept der Verbandsgemeinde Winnweiler Der demografische Wandel in vielen Orten im Zusammenwirken mit zunehmender Ressourcenknappheit stellt eine der zentralen
Kommunen innovativ. Kurzinformation zur Förderrichtlinie
 Kommunen innovativ Kurzinformation zur Förderrichtlinie Zielsetzung Mit der Fördermaßnahme Kommunen innovativ verfolgt das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) folgende Ziele: Hilfe für Regionen
Kommunen innovativ Kurzinformation zur Förderrichtlinie Zielsetzung Mit der Fördermaßnahme Kommunen innovativ verfolgt das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) folgende Ziele: Hilfe für Regionen
IEK Dornum und Baltrum Gemeinsames Handlungskonzept
 Dornum und Baltrum [zwanzig30] Perspektiven bewusst gestalten! IEK Dornum und Baltrum Gemeinsames Handlungskonzept Inhalt Hintergrund Informationen zum Städtebauförderprogramm Vorgehen zur Erstellung des
Dornum und Baltrum [zwanzig30] Perspektiven bewusst gestalten! IEK Dornum und Baltrum Gemeinsames Handlungskonzept Inhalt Hintergrund Informationen zum Städtebauförderprogramm Vorgehen zur Erstellung des
#ODD16 #OGMNRW 1/5
 Wir plädieren für ein offenes NRW Wir sind Akteure aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Kultur und setzen uns dafür ein, den Prozess der Offenheit, Zusammenarbeit und
Wir plädieren für ein offenes NRW Wir sind Akteure aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Kultur und setzen uns dafür ein, den Prozess der Offenheit, Zusammenarbeit und
Partizipation in der sozialen Stadt(teil)entwicklung
 Partizipation in der sozialen Stadt(teil)entwicklung Vortrag am 19. November 2015 in Paris Prof. Dr. Heidi Sinning ISP Institut für Stadtforschung, Planung und Kommunikation Tage der Thüringer Wohnungswirtschaft
Partizipation in der sozialen Stadt(teil)entwicklung Vortrag am 19. November 2015 in Paris Prof. Dr. Heidi Sinning ISP Institut für Stadtforschung, Planung und Kommunikation Tage der Thüringer Wohnungswirtschaft
Integration vor Ort: Koordination und Vernetzung
 Integration vor Ort: Koordination und Vernetzung Dialogforum: Brücken schlagen Kooperationen für die nachhaltige Prozesssteuerung BBE-Kongress: Menschen stärken Menschen, 9./10. November 2017 Gudrun Kirchhoff
Integration vor Ort: Koordination und Vernetzung Dialogforum: Brücken schlagen Kooperationen für die nachhaltige Prozesssteuerung BBE-Kongress: Menschen stärken Menschen, 9./10. November 2017 Gudrun Kirchhoff
Internationale Städte-Plattform für Nachhaltige Entwicklung
 Internationale Städte-Plattform für Nachhaltige Entwicklung Im Auftrag des Durchgeführt von Deutscher Städtetag Sabine Drees Gereonstraße 18 32, 50670 Köln +49 (0) 221 3771 214 sabine.drees@staedtetag.de
Internationale Städte-Plattform für Nachhaltige Entwicklung Im Auftrag des Durchgeführt von Deutscher Städtetag Sabine Drees Gereonstraße 18 32, 50670 Köln +49 (0) 221 3771 214 sabine.drees@staedtetag.de
KOMMUNEN WAGEN NEUE WEGE
 KOMMUNEN WAGEN NEUE WEGE Prozessorientierte Kommunalentwicklung als Handlungsansatz zur Gestaltung gesellschaftlicher Megatrends Robert Freisberg Robert Freisberg, Tag der Landesplanung am 18.02.2016 Folie
KOMMUNEN WAGEN NEUE WEGE Prozessorientierte Kommunalentwicklung als Handlungsansatz zur Gestaltung gesellschaftlicher Megatrends Robert Freisberg Robert Freisberg, Tag der Landesplanung am 18.02.2016 Folie
LAG Mittlere Isarregion. 1. Ziele der Entwicklungsstrategie und ihre Rangfolge
 1. Ziele der Entwicklungsstrategie und ihre Rangfolge 1.1. Einleitung Mit der Fortschreibung der LES engagiert sich die e. V. für die Umsetzung der Europa 2020 Strategie in ihrer Region. Um im eigenen
1. Ziele der Entwicklungsstrategie und ihre Rangfolge 1.1. Einleitung Mit der Fortschreibung der LES engagiert sich die e. V. für die Umsetzung der Europa 2020 Strategie in ihrer Region. Um im eigenen
GEMEINSAM FÜRS DORF QUALIFIZIERUNGSPROGRAMM FÜR EHRENAMTLICH TÄTIGE
 Kommunen innovativ. GEMEINSAM FÜRS DORF QUALIFIZIERUNGSPROGRAMM FÜR EHRENAMTLICH TÄTIGE Blick auf Ortenberg -Lißberg MACH MIT. FÜR DEIN DORF. Kommunen innovativ. LIEBE BÜRGERINNEN UND BÜRGER, unsere Region
Kommunen innovativ. GEMEINSAM FÜRS DORF QUALIFIZIERUNGSPROGRAMM FÜR EHRENAMTLICH TÄTIGE Blick auf Ortenberg -Lißberg MACH MIT. FÜR DEIN DORF. Kommunen innovativ. LIEBE BÜRGERINNEN UND BÜRGER, unsere Region
GEMEINSAM FÜRS DORF QUALIFIZIERUNGSPROGRAMM FÜR EHRENAMTLICH TÄTIGE
 Kommunen innovativ. GEMEINSAM FÜRS DORF QUALIFIZIERUNGSPROGRAMM FÜR EHRENAMTLICH TÄTIGE Blick auf Ortenberg -Lißberg MACH MIT. FÜR DEIN DORF. Kommunen innovativ. LIEBE BÜRGERINNEN UND BÜRGER, unsere Region
Kommunen innovativ. GEMEINSAM FÜRS DORF QUALIFIZIERUNGSPROGRAMM FÜR EHRENAMTLICH TÄTIGE Blick auf Ortenberg -Lißberg MACH MIT. FÜR DEIN DORF. Kommunen innovativ. LIEBE BÜRGERINNEN UND BÜRGER, unsere Region
Was sind Ziele und Aufgaben der lokalen Arbeitsgruppe?
 Was sind Ziele und Aufgaben der lokalen Arbeitsgruppe? Die lokale Arbeitsgruppe dient als eine Austausch- und Kommunikationsplattform für erwachsene Unterstützer, die ein Interesse an den Belangen von
Was sind Ziele und Aufgaben der lokalen Arbeitsgruppe? Die lokale Arbeitsgruppe dient als eine Austausch- und Kommunikationsplattform für erwachsene Unterstützer, die ein Interesse an den Belangen von
Nachhaltige Transformation urbaner Räume ( )
 Nachhaltige Transformation urbaner Räume (2016-2019) Aktuelle Fördermaßnahme der Sozial-ökologischen Forschung (SÖF) des BMBF im Forschungsrahmenprogramm FONA Forschung für nachhaltige Entwicklung Aktuelle
Nachhaltige Transformation urbaner Räume (2016-2019) Aktuelle Fördermaßnahme der Sozial-ökologischen Forschung (SÖF) des BMBF im Forschungsrahmenprogramm FONA Forschung für nachhaltige Entwicklung Aktuelle
KOMET Kooperativ Orte managen im UNESCO Biosphärenreservat Thüringer Wald = Interkommunale Kooperation und Nachhaltigkeit
 Dr. Thomas Scheller Verbundkoordinator KOMET KOMET Kooperativ Orte managen im UNESCO Biosphärenreservat Thüringer Wald = Interkommunale Kooperation und Nachhaltigkeit 1 . Modellraum - Wer war und ist beteiligt?
Dr. Thomas Scheller Verbundkoordinator KOMET KOMET Kooperativ Orte managen im UNESCO Biosphärenreservat Thüringer Wald = Interkommunale Kooperation und Nachhaltigkeit 1 . Modellraum - Wer war und ist beteiligt?
Regionalforum Nachhaltige Entwicklung in den Kommunen des Biosphärenreservates Vessertal-Thüringer Wald
 Regionalforum Nachhaltige Entwicklung in den Kommunen des Biosphärenreservates Vessertal-Thüringer Wald 8. April 2016 Katrin Nolting Forschung für nachhaltige Entwicklung und Verein Zukunftsfähiges Thüringen
Regionalforum Nachhaltige Entwicklung in den Kommunen des Biosphärenreservates Vessertal-Thüringer Wald 8. April 2016 Katrin Nolting Forschung für nachhaltige Entwicklung und Verein Zukunftsfähiges Thüringen
Herausforderung Nachhaltigkeitsstrategie Bestandsaufnahme in den Kommunen
 Herausforderung Nachhaltigkeitsstrategie Bestandsaufnahme in den Kommunen Albrecht W. Hoffmann Bonn Symposium 2015 Bilder von Stadt 2 Bonn Symposium 2015, AG Bestandsaufnahme Bilder von Stadt 3 Bonn Symposium
Herausforderung Nachhaltigkeitsstrategie Bestandsaufnahme in den Kommunen Albrecht W. Hoffmann Bonn Symposium 2015 Bilder von Stadt 2 Bonn Symposium 2015, AG Bestandsaufnahme Bilder von Stadt 3 Bonn Symposium
Neue Wege für kommunale Nachhaltigkeit im Zeichen der Agenda 2030
 Neue Wege für kommunale Nachhaltigkeit im Zeichen der Agenda 2030 20 Jahre Lokale Agenda Osnabrück Carlo Schick Osnabrück, 04. November 2018 04/11/18 1 Die stellt sich vor Wir sind ein unabhängiges Netzwerk
Neue Wege für kommunale Nachhaltigkeit im Zeichen der Agenda 2030 20 Jahre Lokale Agenda Osnabrück Carlo Schick Osnabrück, 04. November 2018 04/11/18 1 Die stellt sich vor Wir sind ein unabhängiges Netzwerk
Umsetzung und Finanzierung von Vorhaben aus Energie-, Quartiers- und Klimaschutzkonzepten für Kommunen
 Umsetzung und Finanzierung von Vorhaben aus Energie-, Quartiers- und Klimaschutzkonzepten für Kommunen ENERGIE BRAUCHT ZUKUNFT - ZUKUNFT BRAUCHT ENERGIE Cleantech-Jahreskonferenz 2015 Dr. Uwe Mixdorf,
Umsetzung und Finanzierung von Vorhaben aus Energie-, Quartiers- und Klimaschutzkonzepten für Kommunen ENERGIE BRAUCHT ZUKUNFT - ZUKUNFT BRAUCHT ENERGIE Cleantech-Jahreskonferenz 2015 Dr. Uwe Mixdorf,
Das Düsseldorfer Stadtentwicklungskonzept Düsseldorf Wachstum fördern, Zukunft gestalten
 Das Düsseldorfer Stadtentwicklungskonzept Düsseldorf 2020 + Wachstum fördern, Zukunft gestalten 1. Anlass Am 29. November 2006 beauftragte der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung die Verwaltung
Das Düsseldorfer Stadtentwicklungskonzept Düsseldorf 2020 + Wachstum fördern, Zukunft gestalten 1. Anlass Am 29. November 2006 beauftragte der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung die Verwaltung
Gesund alt werden in Bruchsal Eine Herausforderung für die Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger
 NAIS Neues Altern in der Stadt Bruchsal Ein Projekt zur Neuorientierung der kommunalen Seniorenpolitik Gesund alt werden in Bruchsal Eine Herausforderung für die Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger Volker
NAIS Neues Altern in der Stadt Bruchsal Ein Projekt zur Neuorientierung der kommunalen Seniorenpolitik Gesund alt werden in Bruchsal Eine Herausforderung für die Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger Volker
Gegenwart und Zukunft: Integrität und Komplexität der Agenda 2030 und deren Übertragung auf Kommunen
 Gegenwart und Zukunft: Integrität und Komplexität der Agenda 2030 und deren Übertragung auf Kommunen SDG-TAG 2017 - Das Köln, das wir wollen Sebastian Eichhorn Landesarbeitsgemeinschaft Lokale Agenda 21
Gegenwart und Zukunft: Integrität und Komplexität der Agenda 2030 und deren Übertragung auf Kommunen SDG-TAG 2017 - Das Köln, das wir wollen Sebastian Eichhorn Landesarbeitsgemeinschaft Lokale Agenda 21
Kommune und Nachhaltigkeit. Martin Müller Fachberater Bürgerengagement
 Kommune und Nachhaltigkeit Martin Müller Fachberater Bürgerengagement 2 Teile: 1. Wie tickt Verwaltung 2. Wie kommt man zusammen..., der Sport und die Kommune Nachhaltige Entwicklung in allen drei AGENDA-Feldern
Kommune und Nachhaltigkeit Martin Müller Fachberater Bürgerengagement 2 Teile: 1. Wie tickt Verwaltung 2. Wie kommt man zusammen..., der Sport und die Kommune Nachhaltige Entwicklung in allen drei AGENDA-Feldern
Forschung wird zum Stadtgespräch. Die Städte von morgen zu gestalten heißt, die Bewohnerinnen und Bewohner von heute einzubeziehen.
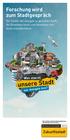 Forschung wird zum Stadtgespräch Die Städte von morgen zu gestalten heißt, die Bewohnerinnen und Bewohner von heute einzubeziehen. WISSENSCHAFTSJAHR 2015 ZUKUNFTSSTADT Liebe Leserinnen und Leser, die nachhaltige
Forschung wird zum Stadtgespräch Die Städte von morgen zu gestalten heißt, die Bewohnerinnen und Bewohner von heute einzubeziehen. WISSENSCHAFTSJAHR 2015 ZUKUNFTSSTADT Liebe Leserinnen und Leser, die nachhaltige
Vortrag Dr.-Ing. Henning Stepper Dienstag,
 Bedeutung von Sport und Bewegung für die nachhaltige Stadtentwicklung - zukünftige Leistungsfähigkeit von Sport und Bewegung in der kommunalen Entwicklung, - Gesunde Kommune : Bedeutung von Sport und Bewegung
Bedeutung von Sport und Bewegung für die nachhaltige Stadtentwicklung - zukünftige Leistungsfähigkeit von Sport und Bewegung in der kommunalen Entwicklung, - Gesunde Kommune : Bedeutung von Sport und Bewegung
Jetzt das Morgen gestalten
 Jetzt das Morgen gestalten Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg 3. März 2007 Warum braucht Baden-Württemberg eine Nachhaltigkeitsstrategie? Baden-Württemberg steht vor großen Herausforderungen, die
Jetzt das Morgen gestalten Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg 3. März 2007 Warum braucht Baden-Württemberg eine Nachhaltigkeitsstrategie? Baden-Württemberg steht vor großen Herausforderungen, die
Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf die öffentliche Planung und Steuerung Carsten Große Starmann
 Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf die öffentliche Planung und Steuerung Carsten Große Starmann Hannover, 21.04.2015 Eckpunkte des demographischen Wandels 3 Bunter 1 Weniger Sinkende Geburtenzahlen
Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf die öffentliche Planung und Steuerung Carsten Große Starmann Hannover, 21.04.2015 Eckpunkte des demographischen Wandels 3 Bunter 1 Weniger Sinkende Geburtenzahlen
TempALand. - Temporäre An- und Abwesenheiten und deren Auswirkungen auf Land und Gesellschaften
 TempALand - Temporäre An- und Abwesenheiten und deren Auswirkungen auf Land und Gesellschaften Fachkonferenz der BMBF-Fördermaßnahme»Kommunen innovativ«prof. Dr. Frank Othengrafen I 20. September 2017
TempALand - Temporäre An- und Abwesenheiten und deren Auswirkungen auf Land und Gesellschaften Fachkonferenz der BMBF-Fördermaßnahme»Kommunen innovativ«prof. Dr. Frank Othengrafen I 20. September 2017
zur Erarbeitung einer Engagementstrategie für das Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen eines partizipativen Prozesses
 Kurzkonzept zur Erarbeitung einer Engagementstrategie für das Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen eines partizipativen Prozesses 1 Einleitung In Nordrhein-Westfalen gibt es eine vielfältige Engagementlandschaft
Kurzkonzept zur Erarbeitung einer Engagementstrategie für das Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen eines partizipativen Prozesses 1 Einleitung In Nordrhein-Westfalen gibt es eine vielfältige Engagementlandschaft
Aktives Leerstandsmanagement in ländlich-peripheren Räumen
 Fachforum Aktives Leerstandsmanagement in ländlich-peripheren Räumen Nützliches Instrumentarium oder aussichtslose Anstrengung? Aufwand & Nutzen - Erfolgsfaktoren & Stolpersteine Donnerstag, 27.09.2018
Fachforum Aktives Leerstandsmanagement in ländlich-peripheren Räumen Nützliches Instrumentarium oder aussichtslose Anstrengung? Aufwand & Nutzen - Erfolgsfaktoren & Stolpersteine Donnerstag, 27.09.2018
Demografischer Wandel als Herausforderung für die Weiterbildung
 Demografischer Wandel als Herausforderung für die Weiterbildung DIE Forum 2018 Regionale Weiterbildung gestalten. Disparitäten überwinden 3.-4. Dezember 2018, Bonn Prof. Dr. Ulrich Klemm Sächsischer Volkshochschulverband
Demografischer Wandel als Herausforderung für die Weiterbildung DIE Forum 2018 Regionale Weiterbildung gestalten. Disparitäten überwinden 3.-4. Dezember 2018, Bonn Prof. Dr. Ulrich Klemm Sächsischer Volkshochschulverband
- Flächenmanagement in niedersächsischen Städten und Gemeinden
 Workshop: Flächen sparen - Flächenmanagement in niedersächsischen Städten und Gemeinden Prof. Dr. Ruth Rohr-Zänker Kommunalkongress Niedersachsen Stadt & Klima 06. Mai 2014 in Hannover Flächen sparen als
Workshop: Flächen sparen - Flächenmanagement in niedersächsischen Städten und Gemeinden Prof. Dr. Ruth Rohr-Zänker Kommunalkongress Niedersachsen Stadt & Klima 06. Mai 2014 in Hannover Flächen sparen als
Nationale Stadtentwicklungspolitik. Foto: Bundesregierung/ Kühler
 Nationale Stadtentwicklungspolitik Foto: Bundesregierung/ Kühler Aktuelle Herausforderungen der Stadtentwicklung Globalisierung und Arbeitsmarkt Foto: Bundesregierung/ Reineke Klimawandel Foto: Bundesregierung/
Nationale Stadtentwicklungspolitik Foto: Bundesregierung/ Kühler Aktuelle Herausforderungen der Stadtentwicklung Globalisierung und Arbeitsmarkt Foto: Bundesregierung/ Reineke Klimawandel Foto: Bundesregierung/
Monitor Nachhaltige Kommune. Projektpräsentation
 Monitor Nachhaltige Kommune Projektpräsentation Sektoren / Ebenen Herausforderungen Lösungsansatz Rahmenbedingung: Bei der nachhaltigen Gestaltung der Zukunft übernimmt die lokale Ebene eine zentrale Rolle.
Monitor Nachhaltige Kommune Projektpräsentation Sektoren / Ebenen Herausforderungen Lösungsansatz Rahmenbedingung: Bei der nachhaltigen Gestaltung der Zukunft übernimmt die lokale Ebene eine zentrale Rolle.
Input: Die Zukunft der Sportvereine im Ostalbkreis
 Input: Die Zukunft der Sportvereine im Ostalbkreis Sportkreistag am 28. März 2014 Thomas Eble Verbandsdirektor des Regionalverbands Ostwürttemberg Gliederung Region Ostwürttemberg - Ausgangslage Modellvorhaben
Input: Die Zukunft der Sportvereine im Ostalbkreis Sportkreistag am 28. März 2014 Thomas Eble Verbandsdirektor des Regionalverbands Ostwürttemberg Gliederung Region Ostwürttemberg - Ausgangslage Modellvorhaben
BUSINESS INNOVATION ENGINEERING CENTER BIEC
 FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR ARBEITSWIRTSCHAFT UND ORGANISATION IAO BUSINESS INNOVATION ENGINEERING CENTER BIEC Digitalisierung und Transformation beginnen bei den Menschen DIE INNOVATIONSFÄHIGKEIT DES BADEN-WÜRTTEMBERGISCHEN
FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR ARBEITSWIRTSCHAFT UND ORGANISATION IAO BUSINESS INNOVATION ENGINEERING CENTER BIEC Digitalisierung und Transformation beginnen bei den Menschen DIE INNOVATIONSFÄHIGKEIT DES BADEN-WÜRTTEMBERGISCHEN
Bürgerbeteiligung und Integration
 Bürgerbeteiligung und Integration Kommunaler Dialog Zusammenleben mit Flüchtlingen Stuttgart, 21. Januar 2016 www.komm.uni-hohenheim.de Fragen 1. Integration von Flüchtlingen: Warum sind Bürgerbeteiligung
Bürgerbeteiligung und Integration Kommunaler Dialog Zusammenleben mit Flüchtlingen Stuttgart, 21. Januar 2016 www.komm.uni-hohenheim.de Fragen 1. Integration von Flüchtlingen: Warum sind Bürgerbeteiligung
Gläserne Konversion. Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Förderprogramms REFINA
 Gläserne Konversion Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Förderprogramms REFINA Grundidee des Forschungsvorhabens 1. Umsetzung kommunalen nachhaltigen Flächenmanagements
Gläserne Konversion Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Förderprogramms REFINA Grundidee des Forschungsvorhabens 1. Umsetzung kommunalen nachhaltigen Flächenmanagements
Planungszellen zur Kommunal- und Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz
 Planungszellen zur Kommunal- und Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz Dr. Birgit Böhm 26.09.2009 Tagung Akteure verstehen, stärken und gewinnen! der Stiftung Mitarbeit in der Evangelischen Akademie Loccum
Planungszellen zur Kommunal- und Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz Dr. Birgit Böhm 26.09.2009 Tagung Akteure verstehen, stärken und gewinnen! der Stiftung Mitarbeit in der Evangelischen Akademie Loccum
Mobilisierung des Innenentwicklungspotenzials in den Städten und Gemeinden des Landkreises Darmstadt-Dieburg
 Mobilisierung des Innenentwicklungspotenzials in den Städten und Gemeinden des Landkreises Darmstadt-Dieburg Bürgerversammlung Münster 18. Mai 2017 LEADER-Gebietskulisse / Fördergebiet Ländlicher Raum
Mobilisierung des Innenentwicklungspotenzials in den Städten und Gemeinden des Landkreises Darmstadt-Dieburg Bürgerversammlung Münster 18. Mai 2017 LEADER-Gebietskulisse / Fördergebiet Ländlicher Raum
Geschaffene Ausbildungsstrukturen regional verankern gute Konzepte und Instrumente verstetigen
 Geschaffene Ausbildungsstrukturen regional verankern gute Konzepte und Instrumente verstetigen Regionalworkshop 7. Mai 2008, Würzburg Florian Neumann, Simone Adler JOBSTARTER- am Forschungsinstitut Betriebliche
Geschaffene Ausbildungsstrukturen regional verankern gute Konzepte und Instrumente verstetigen Regionalworkshop 7. Mai 2008, Würzburg Florian Neumann, Simone Adler JOBSTARTER- am Forschungsinstitut Betriebliche
Strategische Ziele K2020 Planungsstand 2014/2015
 Strategische Ziele der Stadt Kronberg im Taunus Einführung Basierend auf der erstmaligen strategischen Zielplanung für das Haushaltsjahr 2012, hat der Magistrat bei der Vorbereitung für die Haushaltsplanverfahren
Strategische Ziele der Stadt Kronberg im Taunus Einführung Basierend auf der erstmaligen strategischen Zielplanung für das Haushaltsjahr 2012, hat der Magistrat bei der Vorbereitung für die Haushaltsplanverfahren
Lokale Bildungsverbünde für städtischen Zusammenhalt Wie Bildung und Stadtentwicklung neue Bildungslandschaften gestalten
 Lokale Bildungsverbünde für städtischen Zusammenhalt Wie Bildung und Stadtentwicklung neue Bildungslandschaften gestalten Treffen der Fachgruppen Bildung und Stadtentwicklung und Lokales Bildungsmanagement
Lokale Bildungsverbünde für städtischen Zusammenhalt Wie Bildung und Stadtentwicklung neue Bildungslandschaften gestalten Treffen der Fachgruppen Bildung und Stadtentwicklung und Lokales Bildungsmanagement
Ministerialdirigent Andreas Minschke Abteilungsleiter Strategische Landesentwicklung, Kataster- und Vermessungswesen
 Nachgefragt: Die Demografie-Strategien der drei mitteldeutschen Länder v Demografischer Wandel im Freistaat Thüringen - Prognosen, Maßnahmen und Instrumente Ministerialdirigent Andreas Minschke Abteilungsleiter
Nachgefragt: Die Demografie-Strategien der drei mitteldeutschen Länder v Demografischer Wandel im Freistaat Thüringen - Prognosen, Maßnahmen und Instrumente Ministerialdirigent Andreas Minschke Abteilungsleiter
INTEGRIERTES KOMMUNALES ENTWICKLUNGSKONZEPT (IKEK) OBER-RAMSTADT
 INTEGRIERTES KOMMUNALES ENTWICKLUNGSKONZEPT (IKEK) OBER-RAMSTADT Leitbild-Visionen zum IKEK Ober-Ramstadt Vorwort Im Rahmen des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) wurde gemeinsam mit
INTEGRIERTES KOMMUNALES ENTWICKLUNGSKONZEPT (IKEK) OBER-RAMSTADT Leitbild-Visionen zum IKEK Ober-Ramstadt Vorwort Im Rahmen des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) wurde gemeinsam mit
Herzlich Willkommen. Informationsveranstaltung Bürgerbeteiligung in Großpösna. 14. August 2018, Großpösna
 Herzlich Willkommen Informationsveranstaltung Bürgerbeteiligung in Großpösna 14. August 2018, Großpösna Gliederung Begrüßung Vorstellung der Akademie für Lokale Demokratie (ALD) Warum mehr Beteiligung?
Herzlich Willkommen Informationsveranstaltung Bürgerbeteiligung in Großpösna 14. August 2018, Großpösna Gliederung Begrüßung Vorstellung der Akademie für Lokale Demokratie (ALD) Warum mehr Beteiligung?
Lebens.Räume im Wandel nachhaltig gestalten:
 Lebens.Räume im Wandel nachhaltig gestalten: Geplanter Kursaufbau mit Stichworten zum Inhalt Organisatorischer Rahmen 3 Blöcke á 1,5 SSt, 4 ECTS-AP + 2 Blöcke á 2,25 SSt, 6 ECTS-AP + 1 Block mit 0,5 SSt,
Lebens.Räume im Wandel nachhaltig gestalten: Geplanter Kursaufbau mit Stichworten zum Inhalt Organisatorischer Rahmen 3 Blöcke á 1,5 SSt, 4 ECTS-AP + 2 Blöcke á 2,25 SSt, 6 ECTS-AP + 1 Block mit 0,5 SSt,
IÖB-Tool Modul B1 / 3c/2014. Fragebogen zur Evaluierung innovationsfördernder Beschaffungsvorgänge. S. Supper T. Steffl U. Bodisch.
 3c/2014 IÖB-Tool Modul B1 / Fragebogen zur Evaluierung von IÖB Fragebogen zur Evaluierung innovationsfördernder Beschaffungsvorgänge der öffentlichen Hand S. Supper T. Steffl U. Bodisch Berichte aus Energie-
3c/2014 IÖB-Tool Modul B1 / Fragebogen zur Evaluierung von IÖB Fragebogen zur Evaluierung innovationsfördernder Beschaffungsvorgänge der öffentlichen Hand S. Supper T. Steffl U. Bodisch Berichte aus Energie-
Integriertes Stadtentwicklungskonzept (INSEK) Leipzig 2030 Oberbürgermeister Burkhard Jung
 Integriertes Stadtentwicklungskonzept (INSEK) Leipzig 2030 Oberbürgermeister Burkhard Jung 2 2 Georg-Schwarz-Straße Situation 2017 3 Stadtumbau in Leipzig ist die Anpassung eines wertvollen Mantels an
Integriertes Stadtentwicklungskonzept (INSEK) Leipzig 2030 Oberbürgermeister Burkhard Jung 2 2 Georg-Schwarz-Straße Situation 2017 3 Stadtumbau in Leipzig ist die Anpassung eines wertvollen Mantels an
Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin Abteilung Soziales und Gesundheit Sozialamt Juli 2011
 Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin Abteilung Soziales und Gesundheit Sozialamt 1 Juli 2011 Leitlinien für die Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements des Bezirksamtes Treptow-Köpenick von Berlin
Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin Abteilung Soziales und Gesundheit Sozialamt 1 Juli 2011 Leitlinien für die Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements des Bezirksamtes Treptow-Köpenick von Berlin
Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Akteure
 Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Akteure Themenblock 2 - Impuls Syke 1. Querschnittsworkshop 25. Oktober 2010, Jena Dr. Guido Nischwitz, IAW 0) Einführung Zum Verständnis (von Begriffen) Einbeziehung
Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Akteure Themenblock 2 - Impuls Syke 1. Querschnittsworkshop 25. Oktober 2010, Jena Dr. Guido Nischwitz, IAW 0) Einführung Zum Verständnis (von Begriffen) Einbeziehung
Auf den Ortskern kommt es an! Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Innenentwicklung ländlicher Gemeinden
 Auf den Ortskern kommt es an! Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Innenentwicklung ländlicher Gemeinden Der Werra-Meißner-Kreis ist vom Demografischen Wandel der am stärksten betroffene Landkreis
Auf den Ortskern kommt es an! Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Innenentwicklung ländlicher Gemeinden Der Werra-Meißner-Kreis ist vom Demografischen Wandel der am stärksten betroffene Landkreis
BAGSO-Bildungsangebot. Im Alter IN FORM Gesunde Lebensstile in Kommunen fördern
 BAGSO-Bildungsangebot Im Alter IN FORM Gesunde Lebensstile in Kommunen fördern 1 Gesellschaftliche Aufgabe: Gesundheitsförderung älterer Menschen Die Zielsetzungen zur Gesundheitsförderung für ältere Menschen
BAGSO-Bildungsangebot Im Alter IN FORM Gesunde Lebensstile in Kommunen fördern 1 Gesellschaftliche Aufgabe: Gesundheitsförderung älterer Menschen Die Zielsetzungen zur Gesundheitsförderung für ältere Menschen
Modellprojekt Umbau statt Zuwachs regional abgestimmte Siedlungsentwicklung von Kommunen im Bereich der REK Weserbergland plus
 Modellprojekt Umbau statt Zuwachs regional abgestimmte Siedlungsentwicklung von Kommunen im Bereich der REK Weserbergland plus gefördert durch: Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft,
Modellprojekt Umbau statt Zuwachs regional abgestimmte Siedlungsentwicklung von Kommunen im Bereich der REK Weserbergland plus gefördert durch: Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft,
I ntegriertes K ommunales E ntwicklungskonzept K - onzept Marktgemeinde Eiterfeld
 I ntegriertes K ommunales E ntwicklungskonzept K - onzept Marktgemeinde Eiterfeld Koordinierungstermin WI-Bank 05.06.2014 Vorstellung des Projektes 1. Ausgangssituation und Analyse 2. IKEK-Prozess 3. Ergebnisse
I ntegriertes K ommunales E ntwicklungskonzept K - onzept Marktgemeinde Eiterfeld Koordinierungstermin WI-Bank 05.06.2014 Vorstellung des Projektes 1. Ausgangssituation und Analyse 2. IKEK-Prozess 3. Ergebnisse
W11 - Energiewende in Städten & Quartieren: Wissenschaft als Praxispartner der Kommunen (Teil1)
 W11 - Energiewende in Städten & Quartieren: Wissenschaft als Praxispartner der Kommunen (Teil1) Stadt forscht Zukunft! 14. BMBF-Forum für Nachhaltigkeit, 5. 6. Juni 2018, Leipzig #FONA2018 W11 - Energiewende
W11 - Energiewende in Städten & Quartieren: Wissenschaft als Praxispartner der Kommunen (Teil1) Stadt forscht Zukunft! 14. BMBF-Forum für Nachhaltigkeit, 5. 6. Juni 2018, Leipzig #FONA2018 W11 - Energiewende
Mögliche Querschnittsthemen der BMBF- Fördermaßnahme»Kommunen innovativ«
 Mögliche Querschnittsthemen der BMBF- Fördermaßnahme»Kommunen innovativ«inhalt Vorbemerkung... 1 1. Kommunen und Forschung... 2 2. Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit... 2 3. Finanzierung und Geschäftsmodelle...
Mögliche Querschnittsthemen der BMBF- Fördermaßnahme»Kommunen innovativ«inhalt Vorbemerkung... 1 1. Kommunen und Forschung... 2 2. Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit... 2 3. Finanzierung und Geschäftsmodelle...
Aktenzeichen: Bearbeitender Fachbereich/Fachgebiet/Team: 800 Bürger-/ Unternehmerservice, Wirtschaftsförderung Datum:
 BESCHLUSSVORLAGE öffentlich Vorlage-Nr.: 077.2/2014 Aktenzeichen: LR Bearbeitender Fachbereich/Fachgebiet/Team: 800 Bürger-/ Unternehmerservice, Wirtschaftsförderung Datum: 16.09.2014 Beratungsfolge der
BESCHLUSSVORLAGE öffentlich Vorlage-Nr.: 077.2/2014 Aktenzeichen: LR Bearbeitender Fachbereich/Fachgebiet/Team: 800 Bürger-/ Unternehmerservice, Wirtschaftsförderung Datum: 16.09.2014 Beratungsfolge der
Bauen und Wohnen Aktuelle Wohnungspolitik des Landes
 Bauen und Wohnen Aktuelle Wohnungspolitik des Landes Folie 1 Aktuelle wohnungspolitische Ausgangslage Insgesamt in Deutschland wie auch in RLP keine Wohnungsknappheit wie Anfang der 90er Jahre Regionale
Bauen und Wohnen Aktuelle Wohnungspolitik des Landes Folie 1 Aktuelle wohnungspolitische Ausgangslage Insgesamt in Deutschland wie auch in RLP keine Wohnungsknappheit wie Anfang der 90er Jahre Regionale
Entwicklung des Ländlichen Raums im Freistaat Thüringen. Prof. Dr. Karl-Friedrich Thöne. Strategische Überlegungen zum Politikfeld
 Adenauer-Gespräch im Lindenhof am 27.02.2012 Die Thüringer Landesentwicklung aktiv gestalten! Strategische Überlegungen zum Politikfeld Entwicklung des Ländlichen Raums im Freistaat Thüringen Prof. Dr.
Adenauer-Gespräch im Lindenhof am 27.02.2012 Die Thüringer Landesentwicklung aktiv gestalten! Strategische Überlegungen zum Politikfeld Entwicklung des Ländlichen Raums im Freistaat Thüringen Prof. Dr.
PARTIZIPATION SCHAFFFT BAUKULTUR
 Partizipation WagnisART PARTIZIPATION SCHAFFFT BAUKULTUR PREIS FÜR BAUKULTUR der Metropolregion München 2018 x Inhalt 01 Orte des guten Zusammenlebens 02 Konstellation 03 Faktoren des guten Gelingens 04
Partizipation WagnisART PARTIZIPATION SCHAFFFT BAUKULTUR PREIS FÜR BAUKULTUR der Metropolregion München 2018 x Inhalt 01 Orte des guten Zusammenlebens 02 Konstellation 03 Faktoren des guten Gelingens 04
Kommunale Überflutungsvorsorge Planer im Dialog
 Kommunale Überflutungsvorsorge Planer im Dialog Vortrag am 10.01.2018 im Rahmen des Symposiums Gemeinsam handeln Risiken vermindern. Hochwasser- und Starkregenrisikomanagement in Nordrhein-Westfalen Vera
Kommunale Überflutungsvorsorge Planer im Dialog Vortrag am 10.01.2018 im Rahmen des Symposiums Gemeinsam handeln Risiken vermindern. Hochwasser- und Starkregenrisikomanagement in Nordrhein-Westfalen Vera
Ansätze zur Fachkräftesicherung im ländlichen Raum. Das Projekt Masterplan Duderstadt 2020
 Ansätze zur Fachkräftesicherung im ländlichen Raum Das Projekt Masterplan Duderstadt 2020 Volkswirteforum Düsseldorf, 26.09.2011 Dr. Jörg Lahner (HAWK) Warum DUDERSTADT 2020? Aktuelle Entwicklungen: Abwanderung
Ansätze zur Fachkräftesicherung im ländlichen Raum Das Projekt Masterplan Duderstadt 2020 Volkswirteforum Düsseldorf, 26.09.2011 Dr. Jörg Lahner (HAWK) Warum DUDERSTADT 2020? Aktuelle Entwicklungen: Abwanderung
INNENSTADTNAHES WOHNEN FÜR ÄLTERE MENSCHEN IN ESCHWEILER PERSPEKTIVE 2030
 INNENSTADTNAHES WOHNEN FÜR ÄLTERE MENSCHEN IN ESCHWEILER PERSPEKTIVE 2030 Bericht zum 1. Planungsworkshop mit Bewohnerinnen und Bewohnern, Organisationen und Einrichtungen aus dem Bereich der Seniorenarbeit,
INNENSTADTNAHES WOHNEN FÜR ÄLTERE MENSCHEN IN ESCHWEILER PERSPEKTIVE 2030 Bericht zum 1. Planungsworkshop mit Bewohnerinnen und Bewohnern, Organisationen und Einrichtungen aus dem Bereich der Seniorenarbeit,
Gemeinde Bernstadt Alb-Donau-Kreis. Bernstadt - SORGENDE GEMEINSCHAFT im DIALOG mit der ZUKUNFT
 Gemeinde Bernstadt Alb-Donau-Kreis Bernstadt - SORGENDE GEMEINSCHAFT im DIALOG mit der ZUKUNFT 1 MITEINANDER - FÜREINANDER INTERKOMMUNALE NACHBARSCHAFTSHILFE/BÜRGERVEREIN BERNSTADT-WEIDENSTETTEN-HOLZKIRCH-HÖRVELSINGEN
Gemeinde Bernstadt Alb-Donau-Kreis Bernstadt - SORGENDE GEMEINSCHAFT im DIALOG mit der ZUKUNFT 1 MITEINANDER - FÜREINANDER INTERKOMMUNALE NACHBARSCHAFTSHILFE/BÜRGERVEREIN BERNSTADT-WEIDENSTETTEN-HOLZKIRCH-HÖRVELSINGEN
Erfahrungen und Beispiele aus der beteiligungsorientierten Kommunalentwicklung. Thomas Ködelpeter Ökologische Akademie e.v.
 Erfahrungen und Beispiele aus der beteiligungsorientierten Kommunalentwicklung Thomas Ködelpeter Ökologische Akademie e.v. Thesen zur Zukunft peripherer Räume 1. Periphere ländliche Räume sind zukunftsfähig,
Erfahrungen und Beispiele aus der beteiligungsorientierten Kommunalentwicklung Thomas Ködelpeter Ökologische Akademie e.v. Thesen zur Zukunft peripherer Räume 1. Periphere ländliche Räume sind zukunftsfähig,
Kommunale und interkommunale Vernetzung
 Kommunale und interkommunale Vernetzung Wolfgang.Waehnke@bertelsmann-stiftung.de Kiel, 9. September 2011 9. September 2011 Seite 1 Demographieprojekte der Bertelsmann Stiftung Diverse Demographieprojekte
Kommunale und interkommunale Vernetzung Wolfgang.Waehnke@bertelsmann-stiftung.de Kiel, 9. September 2011 9. September 2011 Seite 1 Demographieprojekte der Bertelsmann Stiftung Diverse Demographieprojekte
Regional arbeiten, bundesweit wirken
 Regional arbeiten, bundesweit wirken Das Aktionsprogramm regionale Daseinsvorsorge, Projektassistenz Auftaktveranstaltung der Modellregion Landkreis Trier-Saarburg am 27. März 2012 in Trier 1 Aktionsprogramm
Regional arbeiten, bundesweit wirken Das Aktionsprogramm regionale Daseinsvorsorge, Projektassistenz Auftaktveranstaltung der Modellregion Landkreis Trier-Saarburg am 27. März 2012 in Trier 1 Aktionsprogramm
KOMOBIL2035 Netzwerk für nachhaltige Mobilität
 NEUE KOOPERATIONSFORMEN ZWISCHEN HAUPT- UND EHRENAMT KOMOBIL2035 Netzwerk für nachhaltige Mobilität Andrzej Sielicki, Regionalverband Ostwürttemberg 6. DECOMM - MOBIL AUF DEM LAND - Wie lässt sich die
NEUE KOOPERATIONSFORMEN ZWISCHEN HAUPT- UND EHRENAMT KOMOBIL2035 Netzwerk für nachhaltige Mobilität Andrzej Sielicki, Regionalverband Ostwürttemberg 6. DECOMM - MOBIL AUF DEM LAND - Wie lässt sich die
Bürgerschaftliches Engagement und demografische Herausforderungen in ländlichen Strukturen
 Zentrum für kooperative Forschung an der DHBW Stuttgart Fachtagung Netzwerk Bürgerengagement Förderung und Unterstützung des Ehrenamts im Landkreis Bad Kissingen Bad Bocklet, 21.09.2013 Bürgerschaftliches
Zentrum für kooperative Forschung an der DHBW Stuttgart Fachtagung Netzwerk Bürgerengagement Förderung und Unterstützung des Ehrenamts im Landkreis Bad Kissingen Bad Bocklet, 21.09.2013 Bürgerschaftliches
Netzausbau und Windenergie in Brandenburg. Neue Wege zum Dialog
 Netzausbau und Windenergie in Brandenburg Neue Wege zum Dialog Impuls Agentur für angewandte Utopien e.v. Gestaltung von Dialog- und Beteiligungsprozessen Pilotprojekt Energiewende und Demokratie in Brandenburg
Netzausbau und Windenergie in Brandenburg Neue Wege zum Dialog Impuls Agentur für angewandte Utopien e.v. Gestaltung von Dialog- und Beteiligungsprozessen Pilotprojekt Energiewende und Demokratie in Brandenburg
GRÜNBERG Ein Handlungsrahmen für die aktive Gestaltung der Zukunft unserer Stadt. Grünberg gestaltet Zukunft
 GRÜNBERG 2025 Ein Handlungsrahmen für die aktive Gestaltung der Zukunft unserer Stadt Grünberg gestaltet Zukunft Präambel Die Stadt Grünberg hat einen Leitbildprozess angestoßen, um die zukünftige Entwicklung
GRÜNBERG 2025 Ein Handlungsrahmen für die aktive Gestaltung der Zukunft unserer Stadt Grünberg gestaltet Zukunft Präambel Die Stadt Grünberg hat einen Leitbildprozess angestoßen, um die zukünftige Entwicklung
Im Fokus Das URBACT II Projekt HerO - Heritage as Opportunity
 Im Fokus Das URBACT II Projekt HerO - Heritage as Opportunity HerO Heritage as Opportunity (Kulturerbe als Chance): Förderung von Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit historischer Stadtlandschaften in
Im Fokus Das URBACT II Projekt HerO - Heritage as Opportunity HerO Heritage as Opportunity (Kulturerbe als Chance): Förderung von Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit historischer Stadtlandschaften in
Soziale Dorfentwicklung ein Auftrag für die Landentwicklung
 Soziale Dorfentwicklung ein Auftrag für die Landentwicklung Forum Ländliche Entwicklung 2017 am 25.01.2017 in Berlin Begleitveranstaltung der ArgeLandentwicklung und der DLKG Das soziale Dorf - als Ankerpunkt
Soziale Dorfentwicklung ein Auftrag für die Landentwicklung Forum Ländliche Entwicklung 2017 am 25.01.2017 in Berlin Begleitveranstaltung der ArgeLandentwicklung und der DLKG Das soziale Dorf - als Ankerpunkt
Synfonie. Ein Innovationsforum Mittelstand
 Synfonie Ein Innovationsforum Mittelstand Vorwort Wenn Forschergeist und Unternehmertum aufeinandertreffen, dann ist der Nährboden dafür gelegt, dass Neues entsteht. Diesen Nährboden wollen wir mit den
Synfonie Ein Innovationsforum Mittelstand Vorwort Wenn Forschergeist und Unternehmertum aufeinandertreffen, dann ist der Nährboden dafür gelegt, dass Neues entsteht. Diesen Nährboden wollen wir mit den
Rio+20 vor Ort. Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektiven lokaler Nachhaltigkeitsaktivitäten in Deutschland. Dr. Edgar Göll & Katrin Nolting, IZT
 Rio+20 vor Ort Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektiven lokaler Nachhaltigkeitsaktivitäten in Deutschland Lokaler Aktionstag Nachhaltigkeit Treptow-Köpenick Berlin-Köpenick, 4. Juni 2012, Rathaus Dr.
Rio+20 vor Ort Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektiven lokaler Nachhaltigkeitsaktivitäten in Deutschland Lokaler Aktionstag Nachhaltigkeit Treptow-Köpenick Berlin-Köpenick, 4. Juni 2012, Rathaus Dr.
Fläche sparen durch Innenentwicklung? Landkreis Nienburg/Weser
 ARL-Kongress, München, 26.-27.04.2018 Fläche sparen durch Innenentwicklung? Zwischenergebnisse aus dem Forschungs- und Implementationsprojekt Kommunaler Innenentwicklungsfonds Dr. Marta Jacuniak-Suda,
ARL-Kongress, München, 26.-27.04.2018 Fläche sparen durch Innenentwicklung? Zwischenergebnisse aus dem Forschungs- und Implementationsprojekt Kommunaler Innenentwicklungsfonds Dr. Marta Jacuniak-Suda,
Herzlich Willkommen! 1. Arbeitsgruppe
 Herzlich Willkommen! 1. Arbeitsgruppe Dr. Annette Wilbers-Noetzel Klaus Ludden Michael Ripperda Folie 1 Gebietskulisse LEADER LAG Tecklenburger Land ILEK südliches Osnabrücker Land ILEK Gütersloh Folie
Herzlich Willkommen! 1. Arbeitsgruppe Dr. Annette Wilbers-Noetzel Klaus Ludden Michael Ripperda Folie 1 Gebietskulisse LEADER LAG Tecklenburger Land ILEK südliches Osnabrücker Land ILEK Gütersloh Folie
Nachhaltige Kommunalentwicklung gemeinsam auf dem Weg in die Zukunft
 Nachhaltige Kommunalentwicklung gemeinsam auf dem Weg in die Zukunft Pilotprojekt des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft mit den BE-Netzwerken der Kommunalen Landesverbände und dem Zukunftsbüro
Nachhaltige Kommunalentwicklung gemeinsam auf dem Weg in die Zukunft Pilotprojekt des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft mit den BE-Netzwerken der Kommunalen Landesverbände und dem Zukunftsbüro
Bundesprogramm Ländliche Entwicklung
 Bundesprogramm Ländliche Entwicklung bmel.de Liebe Bürgerinnen und Bürger, der ländliche Raum ist das starke Rückgrat unseres Landes. Um die Lebensqualität in ländlichen Regionen attraktiv zu halten und
Bundesprogramm Ländliche Entwicklung bmel.de Liebe Bürgerinnen und Bürger, der ländliche Raum ist das starke Rückgrat unseres Landes. Um die Lebensqualität in ländlichen Regionen attraktiv zu halten und
DIGITALE AGENDA DES LANDES SACHSEN-ANHALT. Magdeburg,
 DIGITALE AGENDA DES LANDES SACHSEN-ANHALT Magdeburg, 24.05.2017 Wirtschaft und Wissenschaft 4.0 Zukunft. Digital. Vernetzt. Digitale Agenda des Landes Sachsen-Anhalt 2 AGENDA Aktuelle Ausgangslage Ziele
DIGITALE AGENDA DES LANDES SACHSEN-ANHALT Magdeburg, 24.05.2017 Wirtschaft und Wissenschaft 4.0 Zukunft. Digital. Vernetzt. Digitale Agenda des Landes Sachsen-Anhalt 2 AGENDA Aktuelle Ausgangslage Ziele
MORO Aktionsprogramm Regionale Daseinsvorsorge Starterkonferenz am 1. und 2. Dezember 2011 in Berlin
 Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung MORO Aktionsprogramm Regionale Daseinsvorsorge Starterkonferenz am 1. und 2. Dezember 2011 in Berlin Raumbezogene Maßnahmen zur Sicherung
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung MORO Aktionsprogramm Regionale Daseinsvorsorge Starterkonferenz am 1. und 2. Dezember 2011 in Berlin Raumbezogene Maßnahmen zur Sicherung
Herzlich Willkommen. zum Bürgerauftakt. Stadtentwicklungsprozess der Stadt Kraichtal. 14. April Stadt Kraichtal Sitzung des Gemeinderats
 25.03.2015 Herzlich Willkommen zum Bürgerauftakt Stadtentwicklungsprozess der Stadt Kraichtal 14. April 2015 Stadt Kraichtal Sitzung des Gemeinderats die STEG 53 Jahre Stadtentwicklung 430 Sanierungsmaßnahmen
25.03.2015 Herzlich Willkommen zum Bürgerauftakt Stadtentwicklungsprozess der Stadt Kraichtal 14. April 2015 Stadt Kraichtal Sitzung des Gemeinderats die STEG 53 Jahre Stadtentwicklung 430 Sanierungsmaßnahmen
Leitlinien Bürgerbeteiligung Wuppertal
 Leitlinien Bürgerbeteiligung Wuppertal V.2 / Beraten am 22.2.17 Präambel noch zu beraten Der Rat der Stadt Wuppertal hat 2.3.2016 die Stabsstelle Bürgerbeteiligung beauftragt, Leitlinien für Bürgerbeteiligung
Leitlinien Bürgerbeteiligung Wuppertal V.2 / Beraten am 22.2.17 Präambel noch zu beraten Der Rat der Stadt Wuppertal hat 2.3.2016 die Stabsstelle Bürgerbeteiligung beauftragt, Leitlinien für Bürgerbeteiligung
Gesundheitsfördernde Verhältnisse gemeinsam planen und gestalten
 Gesundheitsfördernde Verhältnisse gemeinsam planen und gestalten Dr. Heike Köckler TU Dortmund, Fakultät Raumplanung, SRP 15. September 2014 Workshop Stadtentwicklung trifft Gesundheit Kommunen gemeinsam
Gesundheitsfördernde Verhältnisse gemeinsam planen und gestalten Dr. Heike Köckler TU Dortmund, Fakultät Raumplanung, SRP 15. September 2014 Workshop Stadtentwicklung trifft Gesundheit Kommunen gemeinsam
Erstes Demografie-Forum. Eichstetten am 11. April 2018
 Erstes Demografie-Forum Eichstetten am 11. April 2018 Impressionen Soziale Bindungen & Nachbarschaft Ehrenamt Koordination des Ehrenamts: Stabsstelle; hegen und pflegen; Workshops; gemeinsames Ziel; offenes
Erstes Demografie-Forum Eichstetten am 11. April 2018 Impressionen Soziale Bindungen & Nachbarschaft Ehrenamt Koordination des Ehrenamts: Stabsstelle; hegen und pflegen; Workshops; gemeinsames Ziel; offenes
Statement des Landesjugendringes RLP zu einem neu zu gründenden Landesnetzwerk Ehrenamt am
 Statement des Landesjugendringes RLP zu einem neu zu gründenden Landesnetzwerk Ehrenamt am 10.08.2018 Sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin Dreyer, sehr geehrter Herr Hartnuß, sehr geehrte Damen und Herren,
Statement des Landesjugendringes RLP zu einem neu zu gründenden Landesnetzwerk Ehrenamt am 10.08.2018 Sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin Dreyer, sehr geehrter Herr Hartnuß, sehr geehrte Damen und Herren,
Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung
 Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung - Regionale Aspekte bei der Umsetzung globaler Nachhaltigkeitsziele - Montag, 20.02.2017 Julian Cordes Ablauf 1. Der Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen
Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung - Regionale Aspekte bei der Umsetzung globaler Nachhaltigkeitsziele - Montag, 20.02.2017 Julian Cordes Ablauf 1. Der Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen
Leerstandsmanagement. Ortsbürgermeisterdienstbesprechung, Geschäftsführung entra Regionalentwicklung GmbH
 Leerstandsmanagement Ortsbürgermeisterdienstbesprechung, 18.03.2014 Referentin: Sandra Heckenberger Geschäftsführung entra Regionalentwicklung GmbH Ausgangssituation Kurze Recherche bei den Kommunen (Verbandsgemeinde
Leerstandsmanagement Ortsbürgermeisterdienstbesprechung, 18.03.2014 Referentin: Sandra Heckenberger Geschäftsführung entra Regionalentwicklung GmbH Ausgangssituation Kurze Recherche bei den Kommunen (Verbandsgemeinde
Förderinitiative Forschungscampus
 Förderinitiative Forschungscampus Vorwort Die Innovationskraft Deutschlands stärken, indem Wissen und Ressourcen gebündelt werden das ist ein Ziel der Hightech-Strategie. Mit der Förderinitiative Forschungscampus
Förderinitiative Forschungscampus Vorwort Die Innovationskraft Deutschlands stärken, indem Wissen und Ressourcen gebündelt werden das ist ein Ziel der Hightech-Strategie. Mit der Förderinitiative Forschungscampus
Neue Kommunikationsansätze in der Metropolregion Hamburg
 Neue Kommunikationsansätze in der Metropolregion Hamburg Katrin Fahrenkrug, Raum & Energie Institut für Planung, Kommunikation und Prozessmanagement GmbH, Wedel/ Hamburg Vortrag auf dem 3. REFINA-Statusseminar
Neue Kommunikationsansätze in der Metropolregion Hamburg Katrin Fahrenkrug, Raum & Energie Institut für Planung, Kommunikation und Prozessmanagement GmbH, Wedel/ Hamburg Vortrag auf dem 3. REFINA-Statusseminar
50plus den demografischen Wandel im Quartier gestalten. BMBF-Forum für Nachhaltigkeit
 50plus den demografischen Wandel im Quartier gestalten BMBF-Forum für Nachhaltigkeit 23.09.2014 Chancen für Ludwigsburg partizipativer Prozess Die 11 Themenfelder des SEK Attraktives Wohnen Wirtschaft
50plus den demografischen Wandel im Quartier gestalten BMBF-Forum für Nachhaltigkeit 23.09.2014 Chancen für Ludwigsburg partizipativer Prozess Die 11 Themenfelder des SEK Attraktives Wohnen Wirtschaft
Gemeinsam für eine Nachhaltige Gemeindeentwicklung in Lüneburg
 ANSPRECHPARTNER_INNEN/ KONTAKT. Wenn Sie sich dabei beteiligen möchten zu einer Nachhaltigen Entwicklung der Stadt Lüneburg beizutragen und das LaborN aktiv mitgestalten wollen, wenden Sie sich gerne an:
ANSPRECHPARTNER_INNEN/ KONTAKT. Wenn Sie sich dabei beteiligen möchten zu einer Nachhaltigen Entwicklung der Stadt Lüneburg beizutragen und das LaborN aktiv mitgestalten wollen, wenden Sie sich gerne an:
Innovative Kooperation und Verwaltungsmodernisierung im Freistaat Sachsen - Innovationskommune und Innovationsnetzwerk Sachsen -
 Innovative Kooperation und Verwaltungsmodernisierung im Freistaat Sachsen - Innovationskommune und Innovationsnetzwerk Sachsen - 15. egovernment-wettbewerb Finalistentag in Berlin Ausgangslage in Sachsen
Innovative Kooperation und Verwaltungsmodernisierung im Freistaat Sachsen - Innovationskommune und Innovationsnetzwerk Sachsen - 15. egovernment-wettbewerb Finalistentag in Berlin Ausgangslage in Sachsen
LEADER-Entwicklungsstrategie Sächsische Schweiz Herausforderungen, Vorgehensweise und Zeitplan
 LEADER-Entwicklungsstrategie Sächsische Schweiz 2014-2020 Herausforderungen, Vorgehensweise und Zeitplan AG Strategie LES Stadt Wehlen, 16. Juni 2014 Gliederung 1. LEADER-Förderung in Sachsen 2014-2020
LEADER-Entwicklungsstrategie Sächsische Schweiz 2014-2020 Herausforderungen, Vorgehensweise und Zeitplan AG Strategie LES Stadt Wehlen, 16. Juni 2014 Gliederung 1. LEADER-Förderung in Sachsen 2014-2020
Rückmeldungen aus den Regionalen Foren und dem Nationalen Forum - ein erster Bericht - Karlsruhe,
 Rückmeldungen aus den Regionalen Foren und dem Nationalen Forum - ein erster Bericht - Karlsruhe, 17.09.2008 1. Nationales Forum zur biologischen Vielfalt, Fachkongress am 6. Dez. 2007 Expertengespräche
Rückmeldungen aus den Regionalen Foren und dem Nationalen Forum - ein erster Bericht - Karlsruhe, 17.09.2008 1. Nationales Forum zur biologischen Vielfalt, Fachkongress am 6. Dez. 2007 Expertengespräche
IKEK Marburg Abschlussveranstaltung
 IKEK Marburg Abschlussveranstaltung 03.05.2016, 19:00 Uhr Stadtverordnetensitzungssaal, Marburg Tagesordnung 1. Begrüßung 2. Das IKEK Leitbild 3. Vorstellung der Projekte 4. Resümee zum IKEK Verfahren
IKEK Marburg Abschlussveranstaltung 03.05.2016, 19:00 Uhr Stadtverordnetensitzungssaal, Marburg Tagesordnung 1. Begrüßung 2. Das IKEK Leitbild 3. Vorstellung der Projekte 4. Resümee zum IKEK Verfahren
