Zentrum für Antisemitismusforschung
|
|
|
- Victor Schneider
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Zentrum für Antisemitismusforschung 2012 bis 2014
2 2012 bis
3 Inhaltsverzeichnis Zum Geleit 4 Forschung Antisemitismus 8 Nationalsozialismus und Holocaust 18 Rassismus 27 Kooperationen und Forschungsverbünde 31 Die Arbeitsstelle Jugendgewalt und Rechtsextremismus 34 Nachwuchsförderung 37 Studium und Lehre Masterstudiengang»Interdisziplinäre Antisemitismusforschung«48 Lehrveranstaltungen 50 Bibliothek und Archiv 55 Veranstaltungen Forschungskolloquium 62 Laufende Veranstaltungsreihen 67 Abgeschlossene Veranstaltungsreihen 73 Konferenzen und Tagungen 76 Workshops 82 Lesungen und Vorträge 88 Buchvorstellungen und Ausstellungen 91 Vorträge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 95 Publikationen Publikationen des Zentrums für Antisemitismusforschung 104 Publikationen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 112 Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler 122 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 124 Verein der Freunde und Förderer
4 Zum Geleit Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ZfA im April 2015 Was heißt und zu welchem Ende studiert man den Antisemitismus? Es sind diese beiden, Friedrich Schiller nur unwesentlich modifizierenden Fragen, um die sich die Debatten in der Antisemitismusforschung immer wieder aufs Neue drehen: So kann man sich einerseits trefflich über Definitionsfragen streiten und andererseits den Sinn und Zweck des eigenen wissenschaftlichen Tuns völlig unterschiedlich interpretieren. Beides hat eminent politische Implikationen, was letztlich auch die große Außenwirkung unseres tatsächlich sehr kleinen Querschnittfaches begründet, aber auch die Gefahr einer gewissen Selbstbezogenheit in sich birgt. In diesem komplexen Spannungsfeld steht beziehungsweise bewegt sich das Zentrum für Antisemitismusforschung seit nunmehr über dreißig Jahren. Denn obgleich sich die Schwerpunkte der Arbeit, je nach den Konjunkturen der Wissenschaft, den Forschungsfeldern der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder den langfristigen Zielvorgaben der Leitung hier und da verschoben haben mögen, so zeigt doch der Blick zurück auf das ursprüngliche Arbeitsprogramm aus den 1970er-Jahren eine geradezu erstaunliche thematische Konstanz: Im Mittelpunkt der Tätigkeit des 1982 schließlich gegründeten Zentrums sollte die Analyse des historischen Antisemitismus seit dem 19. Jahrhundert stehen, die als grundlegend angesehen wurde einerseits für ein vertieftes Verständnis der jüdischen Geschichte und andererseits für die umfassende Erforschung des deutschen Massenmordes an den europäischen Juden. Der Gegenwartsbezug wurde damals zwar nicht außer Acht gelassen, galt aber vor dreißig Jahren als bei weitem nicht so dringlich wie heute. Auch Fragen von Flucht, Exil und Migration standen durchaus auf dem Programm, wurden aber ebenfalls eher historisch, vor allem mit Bezug zum Nationalsozialismus, als aktuell interpretiert. Wenn sich also eine gewisse Tendenz aus der umfangreichen Tätigkeit des Zentrums für Antisemitismusforschung der letzten dreißig Jahre ablesen lässt, dann ist dies eine stetig wachsende Erweiterung um aktuelle Themen und Fragestellungen. Diese soll und darf nicht auf Kosten der historischen Grundlagenforschung gehen, macht aber sehr wohl die Bedeutung der europäischen und außereuropäischen Bezüge unserer Arbeit immer wieder deutlich, wie nicht zuletzt die von unseren Doktorandinnen und Doktoranden gewählten Themen zeigen, die sich mit dem Phänomen des Antisemitismus über Epochen und Grenzen hinweg beschäftigen. Auch die wichtigste Neuerung der letzten Jahre betrifft den Bereich der Nachwuchsförderung: Mit dem Start des Masterstudiengangs»Interdisziplinäre Antisemitismusforschung«im Wintersemester 2014/15 ist es nun erstmals möglich, eine fundierte wissenschaftliche Ausbildung in diesem sehr spezifischen Feld zu erhalten, das jedoch Anschlussmöglichkeiten in eine Vielzahl von Fächern, benachbarten Themen und entsprechenden beruflichen Tätigkeiten bietet. Neben der eigenen wissenschaftlichen Forschung und der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist und bleibt die Vermittlung unserer Tätigkeit in die akademische, politische, aber auch die allgemein interessierte Öffentlichkeit ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Die Bandbreite der unterschiedlichen Formate von Konferenzen und Workshops über regelmäßige Kolloquien und Weiterbildungsveranstaltungen bis hin zu Diskussionsabenden, Lesungen und Ausstellungen weist unsere Arbeit als im besten Sinne des Wortes gesellschaftlich engagierte Wissenschaft aus. Vor der eingangs erwähnten Gefahr der Selbstreferentialität wiederum schützen uns eine nicht geringe Anzahl von institutionellen wie individuellen Kooperationen, Partnerschaften, internationalen Projekten sowie, last but not least, die am ZfA forschenden Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler, die unsere Arbeit um den so notwendigen Blick von außen ergänzen. Die vorliegende Dokumentation derselben, die einen Zeitraum von drei Jahren abdeckt und erstmals in gedruckter Form erscheint, ist, allem vorher Gesagten zum Trotz, weniger als traditionelle»planerfüllung«zu lesen, denn als Momentaufnahme eines dynamischen, sich personell wie inhaltlich stets verändernden, aber immer grundlegend offenen und pluralistischen Forschungs- und Diskussionsprozesses zu verstehen. Mein Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen sowie Wegbegleitern des ZfA, deren Arbeit und Engagement dieser (Drei-)Jahresbericht würdigen möchte. Stefanie Schüler-Springorum 4 5
5 Forschung 6 7
6 Forschung Sticker und Stigmata Antisemitismus Das Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin besitzt einen Bestand von mehreren hundert Stickern, also Klebezetteln, Briefverschlussmarken, Reklame- und Sammelmarken mit antisemitischen Botschaften zum Teil im Original, zum Teil als Digitalisate aus der Sammlung Wolfgang Haney. Die ältesten Marken stammen von 1880, die jüngsten aus der Gegenwart. Dieses historische Material spiegelt die Bilder, Argumentationsweisen und die soziale Praxis des Antisemitismus auf engem Raum wider und ermöglicht eine lebensnahe Auseinandersetzung mit der Feindbildkonstruktion. Diese und andere historische Klebezettel sind Ausgangspunkt des Forschungsprojektes»Sticker und Stigmata«, das die Kulturgeschichte und Medialität dieses Kommunikationsmediums untersucht. Handelt es sich bei den Klebezetteln um eine Marginalie moderner Druckmedien, die im Wesentlichen mit anderen Einblattdrucken und fliegenden Blättern vergleichbar sind? Oder unterscheiden sich die Kleinformate mit klebbarer Rückseite davon grundsätzlich? Schließlich zeichnet die Aufkleber aus, dass sie an bestimmten Orten platziert und dadurch mit besonderer Bedeutung versehen werden. Dies verweist auf die Bedeutung territorialer Markierungen, die mit Aufklebern vorgenommen werden. Der Normverstoß, der das Anbringen von Klebezetteln im öffentlichen Raum bedeutet, verleiht den Zetteln wiederum eine eigene Glaubwürdigkeit. Das Forschungsprojekt konzentriert sich auf Bestände antisemitischer und rassistischer Klebemarken und -zettel von 1880 bis in die Gegenwart sowie auf korrespondierende Gegenagitationen durch das gleiche Medium. Neben den Beständen des Zentrums für Antisemitismusforschung werden private Sammlungen, Bestände im Bundesarchiv Koblenz, umfangreiche Materialien im Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv Berlin und Bestände einzelner Landes- und Stadtarchive herangezogen. Aus den Landes- und Stadtarchiven, der Wiener Library London und den Central Archives for the History of the Jewish People in Jerusalem stammen Zeugnisse, die zur Erforschung der Rezeptionsgeschichte antisemitischer Aufkleber dienen und über die Wirkung des Mediums im öffentlichen Raum Aufschluss geben. Das Forschungsprojekt ist eingebunden in eine Forschergruppe am Zentrum Jüdische Studien, die von Anna-Dorothea Ludewig, Hannah Lotte Lund (bis 2014), Irmela von der Lühe (ab 2014) und Isabel Enzenbach geleitet wird. Münden soll es in einer Publikation zur Kulturgeschichte des Mediums, seiner Bildsprache und seines Gebrauchs sind bereits zentrale Ergebnisse des Forschungsprojektes in die Ausstellung»Angezettelt«eingeflossen, die ähnlich wie das Schülerprojekt»Sticker und Stigma«die Forschungsinhalte des Projektes einem breiten Publikum zugänglich machen und vermitteln möchte. Forschungsprojekt Projektbearbeitung: Dr. Isabel Enzenbach Klebezettel, vermutlich des Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, 1920er-Jahre, Sammlung Wolfgang Haney 8 9
7 Forschung Forschung Angezettelt. Antisemitische Aufkleber und Gegenwehr Sticker und Stigma. Aufkleber als Alltagspropaganda in Geschichte und Gegenwart Die Ausstellung»Angezettelt. Antisemitische Aufkleber und Gegenwehr«dokumentiert die Alltagspraxis der Judenfeindschaft in Deutschland vom Ende des 19. Jahrhunderts bis heute anhand eines außergewöhnlichen Mediums: der Klebemarke. Die Ausstellung veranschaulicht den Entstehungszusammenhang der Bewegung, die sich unter dem Begriff des Antisemitismus sammelt und Juden für all diejenigen Erscheinungen der modernen Gesellschaft verantwortlich macht, die den eigenen Vorstellungen widersprechen. Die Ausstellung schildert, wie die Hasspropaganda der Klebezettel wahrgenommen und wie auf sie reagiert wurde und wird. Sie kontextualisiert die judenfeindlichen Aussagen und stellt ihnen Exponate gegenüber, die die jeweils zeitgenössische Gegenargumentation zeigen, sie dekonstruiert antisemitische Körperbilder, die für die Verbreitung der Idee einer jüdischen Rasse von Bedeutung waren, und thematisiert die durch Marken und Aufkleber propagierten Geschlechterbilder des Antisemitismus. Schüler und Schülerinnen des Robert Blum Gymnasiums und des Carl-von-Ossietzky-Gymnasiums in Berlin erarbeiten in einem von der Robert-Bosch-Stiftung geförderten Projekt eine Schülerausstellung zu judenfeindlichen Aufklebern und ihrer Wirkung. Sie haben dazu mit historischen Klebemarken und zetteln gearbeitet, Quellen zur Rezeption dieses Mediums analysiert und interpretiert, mit eigenen Fotos aktuelle Aufkleber dokumentiert, Ausstellungstexte verfasst und mit einem Grafiker das Gestaltungskonzept entwickelt. Schülerprojekt Projektleitung: Dr. Isabel Enzenbach Die Ausstellung verknüpft die Darstellung der Judenfeindschaft mit der Geschichte jüdischer und nicht-jüdischer Gegenwehr. Sie berichtet von juristischem, propagandistischem und zivilgesellschaftlichem Widerstand und wirft einen Blick auf die Gegenwart des antisemitischen Ressentiments. Schließlich zeigt sie verwandte Feindbilder, die mit dem gleichen Medium verbreitet werden, und präsentiert auch hier den vielgestaltigen Kampf gegen verschiedene Formen von Rassismus und anderen Ungleichheitsideologien. Grundlage der Ausstellung sind mehrere Hundert Briefverschluss-, Briefsiegel- und Reklamemarken, Klebe-, Handund Streuzettel mit judenfeindlichen Texten und Bildern aus der Sammlung des renommierten Berliner Privatsammlers Wolfgang Haney. Hinter der Präsentation der verschiedenen Aufkleber steht eine mehrjährige wissenschaftliche Recherche zur Datierung, zu Produzenten und Vertreibern, den Fundorten, Gebrauchsweisen und Reaktionen verschiedener Akteure.»Angezettelt«entstand als Kooperationsprojekt mit dem Museum für Kommunikation Frankfurt/Main unter der Leitung von Isabel Enzenbach und in Zusammenarbeit mit Dr. Marcus Funck, Maren Jung-Diestelmeier, Karolin Nedelmann, Nassrin Sadeghi und den Gestaltern Alexander Horn und Roxana Raschidi (hauserlacour). Die Ausstellung war von Juni bis September 2014 im Frankfurter Museum für Kommunikation zu sehen. Auf Grund der äußerst positiven Eröffnung der Ausstellung»Angezettelt«im Museum für Kommunikation Frankfurt am Main, Foto: Dirk Ostermeier, Museum für Kommunikation Frankfurt am Main. Resonanz wird die Ausstellung vom 10. Mai bis 25. Juli 2015 in einer mobilen Version im Aktiven Museum Spiegelgasse in Wiesbaden und vom 6. August bis 15. Oktober 2015 im Dokumentationszentrum Prora gezeigt werden. Zur Ausstellung erschienen ein Begleitheft und ein reich bebildertes Booklet, in dem das Konzept, ausgewählte Exponate und Ausstellungssegmente sowie Möglichkeiten vorgestellt werden, die Ausstellung an weiteren Orten zu zeigen. Die Publikation ist über die Homepage des Zentrums für Antisemitismusforschung kostenlos abrufbar. Ausstellungsprojekt Projektleitung: Dr. Isabel Enzenbach Sketchboard des Schülerprojekts»Sticker und Stigma«10 11
8 Forschung Forschung Gruppenbezogene Ressentiments im Vergleich Antisemitismus als Problem und Symbol. Phänomene und Interventionen in Berlin Gegenstand der Studie ist die intersubjektive Kommunikation gruppenbezogener Ressentiments unter deutschen Durchschnittsbürgern. Ihre empirische Basis bilden Gruppendiskussionen und Einzelinterviews. Acht dieser Gruppendiskussionen sowie 90 Einzelinterviews wurden im Laufe des Jahres 2014 durchgeführt. Im Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses steht die Frage nach Familienähnlichkeiten und Unterschieden zwischen antijüdischen und anderen gruppenbezogenen Ressentiments. Die analytische Perspektive ist in mehrfacher Hinsicht eine komparative beziehungsweise kontrastive. Um mehr Trennschärfe zu erlangen, werden zunächst einmal sowohl ressentimentgeladene als auch ressentimentfreie und ressentimentabwehrende Beiträge über Juden sowie andere Gruppen in den Fokus gerückt. Untersucht wird demnach nicht nur, ob und wie entsprechende Ressentiments seitens der Probanden»zur Sprache«gebracht, möglicherweise gerechtfertigt, bestätigt oder befeuert werden, sondern auch, wie sie gegebenenfalls pariert werden, und was ihnen argumentativ entgegengesetzt wird. In einem nächsten Schritt wird es darum gehen, die dergestalt geschärften, ressentimentspezifischen Befunde erneut komparativ beziehungsweise kontrastiv zu beleuchten und ihre Familienähnlichkeiten und Unterschiede mittels adäquater Vergleichsparameter herauszuarbeiten. Das qualitative Forschungsprojekt wurde 2013 begonnen und wird gefördert von der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur. Forschungsprojekt Projektbearbeitung: Dr. Julijana Ranc und Patrick Delaney Die in Kooperation mit der Landeskommission Berlin gegen Gewalt entstandene Studie befasst sich unter anderem mit folgenden Fragen: Welche Konzepte gegen heutigen gen Antisemitismus gibt es in Berlin? Wer beobachtet mit welchen Instrumenten die verschiedenen aktuellen antisemitischen Phänomene? Welche Erklärungsversuche, Ursachenanalysen und Einschätzungen der festgestellten Phänomene gibt es und wovon hängen diese ab? Welche Handlungsempfehlungen können aus den Erkenntnissen insbesondere für die Bearbeitung des Themas im pädagogischen Kontext abgeleitet werden? Die Studie»Antisemitismus als Problem und Symbol. Phänomene und Interventionen in Berlin«ist die jüngste in der Reihe der in Zusammenarbeit mit der Landeskommission Berlin gegen Gewalt am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin entstandenen Arbeiten mit einem ausdrücklichen Berlinbezug. Ihre Ergebnisse wurden im Januar 2015 im Rahmen einer Veranstaltung im Rathaus Charlottenburg einer interessierten Fachöffentlichkeit vorgestellt. Sie erschien in der Publikationsreihe der Landeskommission Berlin gegen Gewalt»Berliner Forum Gewaltprävention«und kann über die Homepage des Zentrums für Antisemitismusforschung oder unter berlin.de/lb/lkbgg/ kostenfrei heruntergeladen werden. Forschungsprojekt Projektleitung: Prof. Dr. Werner Bergmann Projektbearbeitung: Dr. Michael Kohlstruck und Dr. Dr. Peter Ullrich Bei der Beantwortung dieser Fragen werden zwei zentrale Aspekte in Rechnung gestellt: Es gibt, erstens, antisemitische Erscheinungen von Vorurteilen über sprachliche Äußerungen bis hin zu strafbaren Handlungen. Konstitutiv für antisemitische Phänomene sind die Ebenen von Welterklärung und Verfolgungspraxis, wobei das Verhältnis von Ideologie und Praxis jeweils unterschiedlich ausfallen kann. Die Thematisierung von aktuellen antisemitischen Phänomenen erfolgt, zweitens, vor dem Hintergrund des historischen Genozids an den Jüdinnen und Juden durch das nationalsozialistische Deutschland heute unter der Geltung der staats- und gesellschaftspolitisch institutionalisierten Norm des Anti-Antisemitismus. Antisemitismus und Sichtweisen auf Antisemitismus sind angemessen nur in der Doppelperspektive auf Problem und Symbol zu betrachten. Ein Serviceteil informiert über Anlaufstellen zum Thema und vorhandene Materialien für die Bildungsarbeit
9 Forschung Forschung Die Praxis von Vorurteils- und Gewaltprävention in zwei Berliner Quartieren Antisemitische Verschwörungstheorien im 21. Jahrhundert In Kooperation mit der Landeskommission Berlin gegen Gewalt untersuchte die Arbeitsstelle Jugendgewalt und Rechtsextremismus am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin die Praxis von Vorurteils- und Gewaltprävention bei Kindern und Jugendlichen. Der Fokus der Untersuchung lag dabei auf der lokalen Interventionsund Präventionspraxis. Sie konzentriert sich auf Gebiete im Rahmen des Programms»Soziale Stadt«und behandelte die beiden Quartiersmanagement-Gebiete Moabit-West Beusselstrasse in Mitte und Falkenhagener Feld Ost in Spandau. Untersucht wurde die Praxis von Prävention und Intervention bei Gewalttätigkeiten und Vorurteilen auf der Ebene kleiner Sozialräume. Das Ergebnis ist eine systematische Bestandsaufnahme dieser Praxis, die Bewertungen der Akteurinnen und Akteure sowie Anregungen enthält und auch Befunde aus der Fachliteratur aufnimmt. Zwei zentrale Untersuchungsfragen wurden beantwortet: Erstens wurde danach gefragt, ob und wie in den Untersuchungsgebieten im engeren Sinne primärpräventiv gehandelt wird. Welche Konzepte spielen dabei eine Rolle? Welche Entscheidungen wurden dazu gefällt? Zweitens wurde gefragt, wie von den pädagogischen Akteurinnen und Akteuren mit aktuellen Gewaltproblemen und Gruppenfeindschaften umgegangen wird. Methodisch wurden für die Bearbeitung dieser Fragen vor allem Interviews mit dem Personal von Kindertagesstätten, Grundschulen und freien Trägern geführt. Darüber hinaus wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Senatsverwaltungen und Bezirksämtern befragt und die Forschungsliteratur zu diesem Themenbereich ausgewertet. Untersucht wurden ausführlich die Sozialstruktur der Untersuchungsregionen, die Strategien der Gewalt- und Vorurteilsprävention im Verhältnis zum erweiterten Bildungsauftrag, die Rahmenbedingungen der schulischen und der sozialpädagogischen Arbeit sowie Aspekte von Kooperation und Vernetzung. Mit dieser dritten Studie in Zusammenarbeit mit der Landeskommission Berlin gegen Gewalt setzte die Arbeitsstelle Jugendgewalt und Rechtsextremismus am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin die Reihe ihrer 2007 begonnenen Arbeiten mit einem ausdrücklichen Berlinbezug fort. Sie alle stehen unter der Leitfrage, in welcher Weise rechtsextremen Herausforderungen angemessen begegnet werden kann. Während die erste Studie auf der Basis einer Umfrage nach Projekten gegen Rechtsextremismus im Allgemeinen fragte (2007), wurde in der zweiten Studie der Fokus auf die Prävention von»rechter Gewalt«gelegt (2009). Mit der Studie»Die Praxis von Vorurteils- und Gewaltprävention in zwei Berliner Quartieren«wurde dieser Denkansatz fortgeführt und erweitert: Im Fokus standen nun die Probleme von Gruppenaversionen und gruppenbezogener Gewalt im Allgemeinen. Die Studie wurde im Januar 2013 im Rahmen einer Veranstaltung im Rathaus Charlottenburg vorgestellt. Sie erschien in der Publikationsreihe der Landeskommission Berlin gegen Gewalt»Berliner Forum Gewaltprävention«und kann über die Homepage des Zentrums für Antisemitismusforschung oder unter kostenfrei heruntergeladen werden. Verschwörungstheorien haben eine lange Tradition, insbesondere solche, die gegen Juden gerichtet sind. Sie bieten einfache Erklärungsmuster für komplizierte Sachverhalte und erfüllen die Funktion eines geschlossenen dichotomen Weltbildes, das in säkularisierten Gesellschaften als Religionsersatz dienen kann. Mit Hilfe des Internets verbreiten sich solche verschwörungstheoretischen Mythen in rasender Geschwindigkeit und werden häufig durch immer neue Schleifen konspirativer Zuschreibungen potenziert. Der Zirkelschluss, den die Erfinder oder Verbreiter solcher Theorien anbieten, blendet jegliche Graustufen aus, bedient ein einfach gestricktes Weltbild und unterscheidet allenfalls zwischen»gut und Böse«beziehungsweise zwischen Schwarz und Weiß. Makabere Blüten treiben diese irrwitzigen Verschwörungstheorien, wenn sie gar den Tsunami als Folge eines jüdischen Komplotts ausmachen. Ursache der Naturkatastrophe seien, so die Vertreter dieser Theorien aus dem rechtsextremen Lager, die Zündung einer amerikanisch-jüdischen Atombombe im Sumatra-Graben oder Erdölbohrungen gewesen. Im Zentrum des Bandes sollen die Entwicklungen in Deutschland stehen. Im Zeitalter des Internets allerdings, in dem verschwörungstheoretische Zuschreibungen über nationale Grenzen hinweg virulent sind beziehungsweise agitiert werden, ist ein Blick auf europäische und weltweite Entwicklungen unabdingbar. Das Buchprojekt entsteht im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung. Es wurde 2014 begonnen, publiziert werden sollen seine Ergebnisse voraussichtlich Buchprojekt Projektbearbeitung: Dr. Juliane Wetzel Bereits wenige Stunden nach den Anschlägen vom 11. September 2001 kursierten die ersten Verschwörungstheorien. Dabei wird oft antisemitisch argumentiert: Viele Verschwörungsgläubige wähnen jüdische Drahtzieher hinter den Anschlägen. Das Internet begünstigt und beschleunigt die Entstehung und Verbreitung solcher Verschwörungstheorien. Foto: ullstein bild Reuters Forschungsprojekt Projektbearbeitung: Dr. Michael Kohlstruck unter Mitarbeit von Birgit Glock, Carl-Eric Linsler und Konstanze Dobberke 14 15
10 Forschung Forschung Antisemitismus und Bilder von Juden bei»post-deutschen«in mehreren Generationen Antisemitismus und Geschlecht Obwohl keine belastbaren, repräsentativen Erhebungen existieren, die einen spezifischen migrantischen oder muslimischen Antisemitismus nachweisen, wird im wissenschaftlichen und politischen Milieu immer wieder von einem wachsenden»muslimischen Antisemitismus«gesprochen. Dabei werden in Deutschland lebende Menschen ganz unterschiedlicher Herkunftsmilieus seit einigen Jahren pauschal unter dem Oberbegriff»Muslim«zusammengefasst. Um einerseits den Konstruktionscharakter dieser Zuschreibung und andererseits den Bezug zur deutschen Lebenswelt zu verdeutlichen, arbeitet das Projekt mit der Wortschöpfung»Post-Deutsche/Neu-Deutsche«und untersucht Antisemitismus zudem in seiner Generationenspezifik. Dabei wird der Fokus auf muslimische Post- Deutsche gelegt, deren Vorfahren in den 1960er-Jahren aus der Türkei nach Deutschland ausgewandert sind. Diese Gruppe bildet die größte muslimische Gruppierung in Deutschland und hat daher eine erhebliche Aussagekraft. Die Studie basiert auf qualitativen Interviews, die mit post-deutschen Familien in drei oder vier Generationen durchgeführt werden, wobei Klasse und Milieuzugehörigkeit, Alter, Geschlecht und Herkunftsregion der ersten Ge- neration in der Türkei wichtige Auswahlkriterien bilden. Es soll unter anderem folgenden Fragen nachgegangen werden: Welche Bilder von Juden wurden von der ersten Generation nach Deutschland gebracht? Wie werden diese Bilder an die nächsten Generationen, die in Deutschland aufwachsen, transferiert? Gibt es einen besonderen Antisemitismus, den die erste Generation aus der Türkei nach Deutschland importiert hat? Wie beeinflusst das Aufnahmeland Deutschland die unterschiedlichen Generationen der hybriden Neu-Deutschen bezüglich ihrer Haltung zu Juden beziehungsweise antijüdischer Ressentiments? Das Forschungsprojekt wurde 2013 begonnen. Forschungsprojekt Projektbearbeitung: Dr. Dilek Güven Zwei schaukelnde Mädchen in Berlin-Kreuzberg. Mit welchen Bildern von Juden die in Deutschland geborene Generation von Post-Deutschen aufgewachsen ist, das untersucht das Forschungsprojekt»Antisemitismus und Bilder von Juden bei»post-deutschen«in mehreren Generationen«. Foto: ullstein bild - Günter Peters Schon bei einer kursorischen Durchsicht von Bildern oder Karikaturen aus der»klassischen Phase«des modernen Antisemitismus fällt sofort deren in hohem Maße geschlechtliche Aufladung ins Auge. Erstaunlicherweise hat sich die historische Forschung bislang jedoch kaum mit diesem so offensichtlichen Konnex zwischen Antisemitismus und Geschlechterordnung beschäftigt. Beides, eine Kenntnis der Geschichte des Antisemitismus wie auch der Genese der bürgerlichen Geschlechterbilder, ist jedoch für ein Verständnis der Moderne unerlässlich. Aus dieser Perspektive sind Antisemitismus und Misogynie eng verzahnte Ausdrucksformen der antimodernen Vision einer nach außen exklusiven und nach innen streng hierarchisch strukturierten Gesellschaft. Das Forschungsprojekt setzt hier an, analysiert die Geschlechterimaginationen des modernen Antisemitismus und vergleicht diese mit anderen rassistischen Ausgrenzungen. Hierbei liegen die Schwerpunkte zum einen auf dem Gewaltpotenzial des Antisemitismus im 20. Jahrhundert, zum anderen auf dessen Wandelbarkeit: Betrachtet man die verschiedenen Facetten des sekundären Antisemitismus der Nachkriegszeit, so wird schnell deutlich, dass dieser scheinbar ohne dramatisch aufgeladene Geschlechterbilder auszukommen scheint. Erst in einem Längsschnitt von der Aufklärung bis heute kann folglich die Erklärungskraft geschlechtergeschichtlicher Ansätze für den modernen Antisemitismus ausgelotet werden; in einem zweiten Schritt soll dies europäisch vergleichend geschehen, um entsprechende kulturelle Spezifika, aber auch Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Das Forschungsprojekt wurde 2012 begonnen. Forschungsprojekt Projektbearbeitung: Prof. Dr. Stefanie Schüler-Springorum Gustav Klimts»Judith I«aus dem Jahr 1901, das Judith mit dem Kopf des Holofernes zeigt, gilt als Ikone der ambivalenten Gestalt der»schönen Jüdin«. Österreichische Galerie Belvedere, Foto: ullstein bild - Heritage Images / Fine Art Images 16 17
11 Geschlossener Wartesaal. Hilfe für deutsche und österreichische Juden in Schweden Forschung Nationalsozialismus und Holocaust In den letzten Jahren ist die Vorgeschichte zum Holocaust an den europäischen Juden, die zögernde, ablehnende Haltung potentieller Aufnahmeländer gegenüber jüdischen Emigranten, zunehmend Gegenstand der Forschung geworden. Das Ziel des Projektes ist es, die Möglichkeiten, Grenzen und Bedingungen zu beschreiben, die deutsche und österreichische Juden vorfanden, wenn sie versuchten, zwischen 1933 und 1945 in das neutrale, demokratische Schweden zu emigrieren. Während politische Flüchtlinge in Schweden auf eine liberale Asylpraxis mit Bleiberecht vertrauen konnten, wurde jüdischen Flüchtlingen allenfalls ein Transitaufenthalt gestattet. Eine Schlüsselstellung nahm dabei die Jüdische Gemeinde Stockholms ein, deren Handlungsspielräume und Entscheidungspraxis im Zentrum des Forschungsprojekts stehen. Die Jüdische Gemeinde in Stockholm, Zentrum der rund 7000 in Schweden lebenden Juden, wurde durch die schwedischen Behörden im Entscheidungsprozess über die Einreise als eine den staatlichen Trägern vorgelagerte Instanz eingesetzt. Wie eine Art Clearingstelle musste sie staatliche Politik umsetzen, konnte manchmal aber auch die staatlichen Entscheidungsprozesse beeinflussen. Das Projekt untersucht, wie das zuständige Hilfskomitee in diesen Prozessen agierte. Die Frage nach seinen Handlungsspielräumen ist bislang nicht ausreichend untersucht worden, war aber oft Gegenstand von Polemik. Dabei interessiert insbesondere die Frage nach formellen und vor allem informellen Netzwerken schwedischer jüdischer Organisationen mit deutschen Organisationen jüdischer Selbsthilfe. Der Informationsfluss zwischen Berlin, Wien und Stockholm war ebenso wichtig für die Entscheidungen des Stockholmer Hilfskomitees wie die spontane Hilfe schwedischer Gemeindemitglieder es für die deutschen Flüchtlinge war. Das Ziel des Projektes ist, anhand eines Beispiellandes mit einer hervorragenden Quellenüberlieferung exemplarisch die Reaktion einer jüdischen Gemeinde auf die Flüchtlingswelle aus dem Deutschen Reich zu untersuchen. So sollen Vorannahmen über geleistete oder verweigerte Solidarität ausländischer Juden überprüft werden. Zudem wird ein neues Licht auf die Lage der Flüchtenden und die Selbsthilfe jüdischer Organisationen in Deutschland und Österreich geworfen. Nelly Sachs ( ) wurde von den Nationalsozialisten ins Exil gezwungen und fand wie etwa 3000 andere deutsche und österreichische Juden mit Unterstützung der schwedisch-jüdischen Gemeinde Asyl in Schweden, Foto: bpk / Riwkin Forschungsprojekt Projektleitung: Prof. Dr. Stefanie Schüler-Springorum Projektbearbeitung: Dr. Clemens Maier-Wolthausen Das Projekt wurde von 2010 bis 2014 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. Seine Ergebnisse werden 2016 als Buch im Wallstein Verlag erscheinen
12 Forschung Forschung Zionistische Fluchthilfe im Königreich Jugoslawien. Die Rettung der mitteleuropäischen Juden Kriegsende und Neubeginn Von der Technischen Hochschule zur Technischen Universität Berlin Zwischen 1933 und 1941 flohen mehr als mitteleuropäische Juden über das Königreich Jugoslawien. Ihre Aufnahme, Versorgung und Weiterleitung oblag ausschließlich den lokalen jüdischen Gemeinden und Organisationen. Ziel des Forschungsprojektes ist es, die transnationalen Hilfsstrukturen und Netzwerke der jugoslawisch-jüdischen Organisationen, die die Rettung zehntausender mitteleuropäischer Juden ermöglichten, zu rekonstruieren. Dieser Rekonstruktion geht eine Untersuchung der politischen und intellektuellen Wandlungsprozesse voraus, die die Juden Jugoslawiens auf ihrem Weg zu mehrheitlich zionistisch dominierten Gemeinden durchliefen. Ihre Organisationen und Akteure, ihre nationalen und transnationalen Wirkräume werden hier erforscht. Die Analyse der inner-zionistischen Debatten und Richtungskämpfe, die sich aus den Auseinandersetzungen mit dem Nationalsozialismus, seiner Judenpolitik und seinen Ausläufern in Jugoslawien ergaben, wird entscheidend die europäische Dimension verstehen helfen, die die nationalsozialistische Politik von Beginn an hatte. Durch die Anwendung theoretischer Konzepte der transnationalen Geschichte und der Verflechtungsgeschichte werden die vielfältigen Netzwerke aufgezeigt, die zwischen den jugoslawischen und den mitteleuropäischen jüdischen Institutionen entstanden. Darüber hinaus werden erstmals die kulturellen, ökonomischen und persönlichen Verflechtungen zwischen dem deutschsprachigen und dem jugoslawischen Raum rekonstruiert, die infolge der Fluchtbewegung und -organisation sichtbar wurden. Ein übergeordnetes Ziel des Forschungsprojektes ist die Einbindung der facettenreichen jugoslawisch-jüdischen Geschichte wie etwa die der (Vor-)Geschichte des Holocaust in die deutschsprachige Südosteuropaforschung. Das Forschungsprojekt wurde 2012 begonnen und durch die TU Berlin finanziert. Forschungsrojekt Projektbearbeitung: Dr. Marija Vulesica Nach zwölf Jahren Nationalsozialismus war die Technische Hochschule Berlin völlig zerstört: Innerlich hatte sie durch die ideologische Gleichschaltung der Hochschule und den Ausschluss aller»nichtarischen«und politisch unliebsamen Hochschulangehörigen gelitten, äußerlich war sie deutlich von den Zerstörungen des Krieges gezeichnet. Dennoch wurde der Lehrbetrieb bereits ein Jahr später wieder aufgenommen. Um den Bruch mit der nationalsozialistischen Vergangenheit zu dokumentieren, wurde die Neueröffnung bewusst nicht als Wiedereröffnung begangen: Anstelle der Technischen Hochschule öffnete am 9. April 1946 unter der Regie der britischen Besatzungsmacht die Technische Universität Berlin ihre Pforten. Doch fand mit der Umbenennung auch eine wirkliche Zäsur statt? Für die Wiederaufnahme des Lehrbetriebes wurde Lehrpersonal benötigt, viele ehemalige Hochschulangehörige waren jedoch Mitglieder der NSDAP gewesen. Manche von ihnen hatten sich wegen ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit an der Hochschule gar nicht erst zurückgemeldet, andere waren im Krieg gefallen. Um die Lehre gewährleisten zu können, wurden manche ehemaligen NSDAP-Mitglieder schließlich doch wieder eingestellt. Angesichts ihrer fachlichen Fähigkeiten und wissenschaftlichen Verdienste wurde über ihren Einsatz für den Nationalsozialismus großzügig hinweg gesehen. Neben diesen Ausnahmen machten in den nachfolgenden Jahren Gesetze und Bestimmungen das Netz für ehemalige Nationalsozialisten durchlässiger. Nach und nach kehrten viele von ihnen als Lehrende an die TU zurück, gehörten ihr als Emeriti an oder bekamen Ehrenwürden verliehen. Das Projekt ist als Fortsetzung zur ebenfalls von Dr. Carina Baganz erforschten Geschichte der Technischen Hochschule Berlin während des Nationalsozialismus zu sehen und wird aus Mitteln der TU Berlin finanziert. Das Projekt wurde 2014 begonnen. Seine Ergebnisse werden 2016 anlässlich des 70. Jahrestags der Gründung als TU Berlin in einer Ausstellung präsentiert. Forschungs- und Ausstellungsprojekt Projektbearbeitung: Dr. Carina Baganz Jüdische Bewohner Kroatiens mit dem 1941 eingeführten Judenstern und dem Anfangsbuchstaben des kroatischen Wortes für Jude, Juni Foto: ullstein bild - Roger-Viollet Um die Geschichte der TU Berlin in den ersten Jahren nach ihrer Gründung geht es in dem Forschungs- und Ausstellungsprojekt»Kriegsende und Neubeginn«. Schwerpunkte sind unter anderem die Personalpolitik, dabei vor allem die Entnazifizierung und Rückkehr belasteter Wissenschaftler, die Rückberufungen ehemals vertriebener Hochschulangehöriger und die Situation der Studierenden. Hauptgebäude, Kriegsschäden werden behoben (um 1945), Foto: TU Berlin 20 21
13 Forschung Vertriebene Wissenschaften an der Technischen Hochschule Berlin 1933 bis 1945 Forschung Der»Luftmeldekopf Südost«(»Dienststelle Klatt«) der deutschen Nachrichtendienste und die nachrichtendienstlichen Grundlagen der deutschen Kriegführung gegen die Sowjetunion Wie alle anderen Universitäten war auch die Technische Hochschule Berlin zwischen 1933 und 1945 Teil des nationalsozialistischen Systems. Bereits vor 1933 hatten sich große Teile des Lehrpersonals und der Studierendenschaft der nationalsozialistischen Bewegung angeschlossen. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten gingen sie dann auch bald gegen missliebige Personen an der Hochschule vor. Während des sogenannten Judenboykotts vom 1. April 1933 forderten sie»nichtarische«wissenschaftler auf, sich aus»rücksicht auf die derzeitige Volksstimmung«beurlauben zu lassen. Manche kamen dem nach, um Schlimmeres zu verhindern. Mit dem»gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums«vom 7. April 1933 wurde dann die rechtliche Grundlage für die nationalsozialistische Personalpolitik geschaffen. In den Jahren 1933 bis 1938 wurden daraufhin an der TH Berlin mindestens 107 Wissenschaftler aus»rassischen«oder politischen Gründen entlassen. Einige von ihnen nahmen sich angesichts dieser Entwicklungen das Leben. Mindestens drei der Entlassenen kamen in Konzentrations- beziehungsweise Vernichtungslagern ums Leben. Auch Studierende waren von Ausgrenzung und Vertreibung betroffen: Politisch Andersdenkende, allen voran die wenigen KPD-Mitglieder, wurden ab 1933 relegiert,»nichtariern«wurde nach und nach die Möglichkeit genommen, Prüfungen abzulegen und Abschlüsse zu erwerben. Das absolute Studienverbot für sogenannte Volljuden kam am 11. November 1938, doch auch sogenannte Mischlinge durften bald nur noch mit einer Genehmigung des Reichserziehungsministers studieren. Seit 1941 beschäftigte die TH Berlin zudem Zwangsarbeiter, anfangs nur vereinzelt für Kohlehof- oder Transportarbeiten, später in großem Umfang. So existierte ab Sommer 1944 auf dem Hochschulgelände ein»ostarbeiterlager«mit mindestens 140 Männern, Frauen und Kindern, die vor allem die Schäden beheben mussten, die die Hochschule durch Luftangriffe erlitten hatten. Die TU Berlin als Nachfolgerin der TH hat sich dieses Kapitels ihrer Geschichte angenommen. Auslöser für das vom ehemaligen Präsidenten der TU Berlin, Kurt Kutzler, am Zentrum für Antisemitismusforschung 2009 ins Leben gerufene Forschungsprojekt»Vertriebene Wissenschaften an der TH Berlin 1933 bis 1945«war Dimitri Stein, der im November 2008 an seine Alma Mater zurückgekehrt war, um zu beenden, was ihm 1943 als sogenanntem Mischling verwehrt blieb: der Abschluss seines Promotionsverfahrens. Bei der Vorstellung der Ergebnisse im Jahr 2013 entschuldigte sich der TU-Präsident im Namen der Universität öffentlich für die Vertreibung und Diskriminierung von Hochschulmitgliedern während der NS-Zeit. Nachgelesen werden können die Ergebnisse der Studie in der 2013 im Metropol Verlag erschienenen Publikation»Diskriminierung, Ausgrenzung, Vertreibung: Die Technische Hochschule Berlin während des Nationalsozialismus«. Forschungsprojekt Projektbearbeitung: Dr. Carina Baganz Carina Baganz: Diskriminierung, Ausgrenzung, Vertreibung: Die Technische Hochschule Berlin während des Nationalsozialismus, Berlin Der Wiener Immobilienmakler Richard Kauder ( ), Sohn eines mit seiner Familie zum Katholizismus übergetretenen k.u.k.-militärarztes, galt nach dem Anschluss Österreichs als»volljude«und floh nach Ungarn. Dort lebte er von der Beschaffung von Devisen und Einreisesichtvermerken sowie gefälschten Taufscheinen für andere jüdische Flüchtlinge, bis er von der ungarischen Polizei inhaftiert und Anfang 1940 über die deutsche Grenze abgeschoben wurde. Aus der anschließenden Gestapo-Haft in Wien befreite ihn Oberst Rudolf von Marogna-Redwitz, katholisch-konservativer Hitler-Gegner, Freund von Kauders verstorbenem Vater und seit Ende 1939 Leiter der Abwehrstelle Wien, der Wiener Außenstelle des Nachrichtendienstes der Wehrmacht. Da Marogna-Redwitz Kauder und seine Mutter nur so weiterhin vor Verfolgung, Deportation und Ermordung schützen konnte, trat Kauder als V-Mann in die Dienste der Abwehrstelle Wien. Unter der Tarnidentität eines fiktiven, in Berlin geborenen Nichtjuden Richard Gustav Klatt wurde er anschließend nach Sofia geschickt, um von dort Informationen über die Türkei zu beschaffen und per Funk nach Wien zu übermitteln. Seine als»max-meldungen«gekennzeichneten Informationen zu Truppenbewegungen der Roten Armee, Lage und Belegung sowjetischer Flugplätze sowie taktischen und strategischen Planungen des sowjetischen Generalstabes genossen bald einen legendären Ruf. In Ermangelung anderer Informationsquellen stuften sie die Feindlagebearbeiter in den Generalstäben der Luftwaffe und des Heeres, wie die von Oberst Reinhard Gehlen geleitete Abteilung Fremde Heere Ost, als»kriegswichtig«ein. Bereits während des Krieges, aber vor allem in der Nachkriegszeit versuchten der britische und der sowjetische Geheimdienst der Quelle dieser Meldungen auf die Spur zu kommen. Was ihnen in ihrer durch den Kalten Krieg beschränkten Wahrnehmung nicht gelang, machten jahrelange Archivrecherchen vor allem in Washington, London, Moskau, Sofia, Madrid, Wien und Berlin möglich: In dem Forschungsprojekt wurden nicht nur die Lebensläufe Richard Kauders, seiner Freunde und Mitarbeiter, Vorgesetzten und Gegenspieler rekonstruiert und die Rezeption der Klatt-Meldungen durch deutsche und alliierte Stellen nachgezeichnet, sondern auch das Rätsel um die Herkunft der»max-meldungen«gelöst. Abschließend wurden in einer detaillierten Auseinandersetzung mit den Ausführungen zu Klatt in der Erinnerungs-, populären und Forschungsliteratur die Strukturen einer Mythologie der Spionage herausgearbeitet und kritisch hinterfragt. Das Forschungsprojekt wurde 2003/2004 begonnen und zwischen 2005 und 2009 von der Hans und Christine von Dohnanyi-Stiftung und der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit Forschungsstipendien und von der Robert Bosch GmbH mit einem Reisekostenzuschuss gefördert. Seine Ergebnisse sind im Dezember 2014 als Buch erschienen. Forschungsprojekt Projektbearbeitung: Dr. Winfried Meyer Winfried Meyer, Klatt. Hitlers jüdischer Meisteragent gegen Stalin. Überlebenskunst in Holocaust und Geheimdienstkrieg, Berlin
14 Forschung Grüne Grenze: Der Maler Franz Heckendorf, seine Fluchthilfe für Berliner Juden und ihre Folgen Forschung Briefe und Kassiber Hans von Dohnanyis aus der Haft bei Militärjustiz und Gestapo Der Berliner Maler Franz Heckendorf ( ) galt in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg als einer der bedeutendsten Exponenten der»jungen Kunst«. Ende der 11920er-Jahre machte Heckendorf als überzeugter Anhänger der Weimarer Demokratie auch wichtige staatliche Ereignisse zum Gegenstand seiner künstlerischen Tätigkeit. Als»Maler der Republik«wurde er nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten als»politisch unzuverlässig«eingestuft, mit einem generellen Mal- und Ausstellungsverbot belegt und seine Bilder wurden wegen ihrer expressionistischen Bildsprache 1937 als»entartet«aus den Museen entfernt. Unter dem Vorwand von Landschaftsstudien am Rhein erkundete Heckendorf im Frühjahr 1942 einen Fluchtweg für seinen ersten Mäzen, den jüdischen Holzhändler Kurt Schüler. Nachdem diesem im Mai 1942 eine spektakuläre Flucht auf Schweizer Territorium gelungen war, suchten weitere Juden und Jüdinnen aus dem Berliner Untergrund Heckendorfs Hilfe bei der Flucht in die Schweiz. Als die schweizerische Grenzwacht die deutsche Grenzpolizei Mitte Februar 1943 auf die auffällige Häufung illegaler Grenzübertritte von Berliner Juden in ihrem Bereich aufmerksam machte, flog Heckendorfs Netzwerk auf. Der achtzehnte von ihm betreute Flüchtling wurde kurz vor der Grenze festgenommen, wenig später wurden auch Heckendorf sowie drei seiner Helfer verhaftet und im März 1944 vom Sondergericht Freiburg als»volksschädlinge«zu hohen Zuchthausstrafen verurteilt. An Heckendorfs Fluchthilfe für Juden und deren Folgen sollte mit einer Ausstellung erinnert werden. Zur Vorbereitung dieser Ausstellung wurden ergänzende Recherchen zu den Biographien Heckendorfs, seiner Helfer und der Geretteten durchgeführt und diese dokumentierende Fotos, Dokumente und Objekte ermittelt. So konnten unter anderem von Heckendorf gefälschte Ausweispapiere sowie seine an seine Lebensgefährtin gerichteten Briefe aus der Haft gefunden werden. Vor allem aber wurden etliche der von Heckendorf in der Haft produzierten kleinformatigen Zeichnungen und Aquarelle ausfindig gemacht. Viele von ihnen waren zur Begleichung der gegen Heckendorf neben der Zuchthausstrafe verhängten Geldstrafe in seiner Zelle gepfändet und versteigert worden und auf diese Weise auf den Kunstmarkt gelangt. Mangels ausreichender Finanzierung musste die Ausstellung leider unmittelbar nach Beginn der bezahlten Vorbe- reitungsarbeiten Ende 2012 abgesagt werden. Stattdessen soll nun unter gleichem Titel ein Buch erscheinen, das viele der in der Haft entstandenen Arbeiten Heckendorfs abbilden wird und für das bereits ein großzügiger Druckkostenzuschuss von der Ernst-von-Siemens-Kunststiftung in München zugesagt ist. Ausstellungsprojekt Projektbearbeitung: Dr. Winfried Meyer Franz Heckendorf: Auferstehender Christus, gemalt im Arbeitshaus Kaltenstein in Vaihingen an der Ens, Ostern 1945, Dr. Winfried Meyer, Berlin Der liberal eingestellte Reichsgerichtsrat Hans von Dohnanyi ( ) war seit 1938 maßgeblich an den Planungen und Vorbereitungen nationalkonservativer Militärs und Zivilisten für einen Sturz des NS-Regimes durch einen Militärputsch beteiligt. Als Leiter des Referats»Politische Berichterstattung«im Amt Ausland/Abwehr, der Berliner Zentrale des Nachrichtendienstes der Wehrmacht, ermöglichte Dohnanyi im Herbst 1942 mit einer als Agenteneinsatz getarnten Rettungsaktion einer Gruppe jüdischer Berliner die lebensrettende Ausreise in die Schweiz. Auch Hinweise regimetreuer Offiziere auf diese Rettungsaktion führten schließlich zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens des Reichskriegsgerichts gegen Dohnanyi. Mit dessen Durchführung wurde der brutale Oberstkriegsgerichtsrat Manfred Roeder beauftragt, der als Ankläger gerade zahlreiche Todesurteile gegen Angehörige der Widerstandsgruppe»Rote Kapelle«durchgesetzt hatte. Am 5. April 1943 wurde Dohnanyi von Roeder festgenommen und ins Berliner Wehrmachtuntersuchungsgefängnis eingeliefert. Nach mehreren Haftstationen wurde er schließlich auf Weisung Hitlers am 6. April 1945 in das KZ Sachsenhausen verschleppt, wo ein dubioses SS-Standgericht ein Todesurteil wegen Landesverrats gegen ihn verhängte, das drei Tage später vollstreckt wurde. Von allen Stationen seiner Haft hat Dohnanyi seiner Frau Briefe schreiben können, die zwar sämtlich der Zensur unterlagen, aber doch auf bemerkenswerte Weise Zeugnis ablegen vom Leiden Dohnanyis unter der Trennung von seiner Familie, seiner zunehmend von Galgenhumor begleiteten Fähigkeit zur Selbstreflexion und einer manchmal fast kindlichen Freude an seinen in der Haft gemachten Fortschritten im Zeichnen und Malen. Als herausragender Jurist und politischer Taktiker erwies sich Dohnanyi dagegen in den geheimen Nachrichten an seine Frau, die als winzige Kassiber in Deckeln von Marmeladengläsern oder den doppelten Böden von Pappbechern sowie durch Markierungen von Wörtern in Briefen und Büchern transportiert wurden. Im Auftrag der Hans und Christine von Dohnanyi-Stiftung, Hamburg, wurden im Jahr 2013 die überwiegend handschriftlichen Originale der offiziellen Briefe transkribiert, die Nachrichten in erhalten gebliebenen Büchern erstmals seit 1943 entschlüsselt und alle Texte mit den zu ihrem Verständnis erforderlichen Anmerkungen versehen. Ab 2014 wurden einleitende Texte zu Hans von Dohnanyis Rolle in den Planungen eines Staatsstreichs gegen Hitler und zu den einzelnen Stationen seiner Haft verfasst. Mit diesen Texten und Anmerkungen werden die Briefe und geheimen Botschaften Hans von Dohnanyis im Herbst 2015 unter dem den Briefen entlehnten Titel»Gott hat mir keinen Panzer ums Herz gegeben«bei der Deutschen Verlags-Anstalt, München, erscheinen. Editionsprojekt Projektbearbeitung: Dr. Winfried Meyer Hans von Dohnanyi: Selbstporträt mit entzündeter Vene, Wehrmachtuntersuchungsgefängnis Berlin, 24. Juli 1943, Barbara Bayer-von Dohnanyi, München 24 25
15 Forschung Konservativer Widerstand zwischen Umsturz und Regimereform: Staatsstreichplanungen und politische Programmatik der NS-Gegner im Amt Ausland/Abwehr Den Anstoß für dieses Forschungsprojekt gab der mehrere Jahre zurückliegende Fund eines Dokumentenkonvoluts auf einem von den National Archives der USA herausgegebenen Mikrofilm. Das Konvolut enthielt in den Jahren 1938 und 1939 entstandene Szenarien für eine Übernahme der Reichsgewalt durch die Wehrmacht, mehrere Aufrufe einer nach dem Sturz Hitlers einzusetzenden provisorischen Regierung, den Entwurf einer neuen Reichsverfassung und programmatische Redeentwürfe für alle Bereiche staatlicher Politik. Diese»Umsturz-Dokumente«waren bisher weitestgehend unbekannt und sind daher von der Forschung zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus nicht berücksichtigt worden. Verfasst worden waren die»umsturz-dokumente«mit Wissen von Admiral Wilhelm Canaris, dem Chef des Amtes Ausland/Abwehr im OKW, im Auftrag von Oberst Hans Oster, dem Leiter der Zentralabteilung des Amtes, von dem in der Abwehr tätigen Marineoffizier Franz Maria Liedig, dem reichskatholischen Schriftsteller Friedrich Alfred Schmid Noerr und dem Diplomaten Otto Werner von Hentig. Die in den»umsturz-dokumenten«enthaltene Programmatik entsprang zweifellos völkischem Denken und zielte auf die Errichtung eines autoritären Ständestaates, dessen Vorbild, ohne explizit genannt zu werden, der österreichische Ständestaat zwischen 1933 und 1938 gewesen sein dürfte. Damit stellt sich die Frage, inwieweit die politische Programmatik der»umsturz-dokumente«lediglich eine Fortschreibung von Positionen der»konservativen Revolution«aus der Zeit der Weimarer Republik darstellte oder aus der radikalen Negation des nationalsozialistischen Unrechtsstaats entwickelt oder wenigstens weiterentwickelt wurde. Hinsichtlich der Reichweite ihrer praktischen Umsetzung muss weiterhin gefragt werden, ob lediglich eine Regimereform oder ein grundsätzlicher Bruch mit dem NS-Regime angestrebt wurde. Diesen Fragen wird durch die genauere Untersuchung zweier Aspekte der politischen Programmatik der»umsturz-dokumente«nachgegangen, erstens des Verständnisses des Nationalsozialismus als einer Variante des Bolschewismus und zweitens der Haltung zur nationalsozialistischen Judenverfolgung. Aus dem völkischen Ansatz wird zwar eine milde Separierung der Juden als»fremdrassige«abgeleitet, aber deren Schutz durch die»volksgemeinschaft«gefordert und die NS-Judenverfolgung schärfstens kritisiert. Im Fokus stehen außerdem die Haltung der Autoren zur NS-Judenverfolgung in ihrem privaten und dienstlichen Alltag, die über Mittelmänner versuchte Einflussnahme auf die Heeresführung und die Kontaktaufnahme mit den Regierungen der potentiellen Feindstaaten. Das Forschungsprojekt wurde 2014 begonnen und wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. Forschungsprojekt Projektbearbeitung: Dr. Winfried Meyer Rassismus 26 27
16 Forschung Forschung Arbeit, kolonialer Rassismus, Antisemitismus: Historische Relationen Bevölkerungseinstellungen gegenüber Sinti und Roma Ausgehend von aktuellen Debatten über die Vergleichbarkeit von Kolonialismus und Nationalsozialismus befasst sich das Forschungsvorhaben mit den Relationen zwischen kolonialem Rassismus und Antisemitismus. Dabei ist die Beobachtung leitend, dass sowohl kolonialrassistische als auch antisemitische Selbst- und Fremddefinitionen nicht unwesentlich auf dem Topos»Arbeit«basierten. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen also Zuschreibungen, die einen jeweils spezifischen Zusammenhang zwischen Arbeit und Zugehörigkeit konstituierten. Das Ziel ist aufzuzeigen, dass und auf welche Weise sich diese Zuschreibungen wechselseitig überlagerten. Gleichwohl wird es darum gehen, den Unterschieden zwischen den jeweiligen Wissensformationen nachzugehen. Das Forschungsvorhaben wird sich im Wesentlichen auf deutschsprachige Autoren konzentrieren. Angestrebt ist eine historische Längsschnittanalyse, die um 1800 einsetzt und mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten 1933 endet. Dabei wird folgende Hypothese zugrunde gelegt: Während die Kolonisierten in einem (Natur-)Zustand gewissermaßen»vor der Arbeit«situiert wurden, wurden Juden mit vermeintlich destruktiven Tätigkeiten assoziiert, die sich als»anti-arbeit«beschreiben lassen. Beide Zuschreibungen korrespondierten mit der Vorstellung, dass sich im Zuge eines Jahrhunderte andauernden Disziplinierungsprozesses ein spezifisch christliches/weißes/arisches Arbeitsethos herausgebildet hätte, das vor allem von Fleiß, aber auch von Gemeinnutz gekennzeichnet sei und eine grundlegende Höherwertigkeit anzeige. Methodisch orientiert sich das Forschungsvorhaben am intersektionalen Ansatz und an der historischen Diskursanalyse. Es geht von der Prämisse aus, dass verschiedene Formen sozialer Ungleichheit empirisch miteinander verwoben sind, und dass historisch-spezifische Aussageformationen, in denen Ungleichheit hergestellt wurde, auf die konstitutiven Wechselwirkungen zwischen Wissen und Macht sowie auf die damit zusammenhängenden Grenzen des Sag- und Denkbaren verweisen. Indem es die jeweiligen Mechanismen des Ein- und Ausschlusses zusammen denkt und miteinander verknüpft, möchte das Forschungsvorhaben auch zur Überwindung der disziplinären Grenzen zwischen Rassismus- und Antisemitismusforschung beitragen. Der Forschungsantrag erhielt eine TU-interne Anschubfinanzierung und wurde bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft eingereicht, die ihn im August 2014 bewilligte. Das Forschungsprojekt wird im Oktober 2015 beginnen. Forschungsantrag Projektbeantragung und -bearbeitung: Dr. Felix Axster In der Erhebung»Bevölkerungseinstellungen gegenüber Sinti und Roma«wurden Vorurteile gegenüber Europas größter Minderheit sowie das Wissen über diese Minderheit untersucht und Empfehlungen zum Abbau von Diskriminierungen gegeben. Die Studie ergab, dass Sinti und Roma von einem beträchtlichen Teil der deutschen Mehrheitsbevölkerung nicht als gleichberechtigte Mitbürger und Mitbürgerinnen wahrgenommen werden. Unwissenheit und in Teilen offene Ablehnung prägen die Einstellungen gegenüber dieser seit Jahrhunderten in Europa lebenden Minderheit. 19 Prozent der Befragten haben eine dezidiert negative Einstellung gegenüber Sinti und Roma. Bei keiner anderen Gruppe zeigt sich ein so durchgängig deutliches Bild der Ablehnung. Die Analyse der soziodemografischen Daten belegt, dass es bei der zu beobachtenden Ablehnung von Sinti und Roma keine klar definierbare Trägerschicht gibt, sondern sie in allen Bevölkerungsgruppen anzutreffen ist. Die Einstellungen sind jedoch weniger starr und festgefügt, als es bei einem klaren Feindbild der Fall ist, und die ermittelten Antworten sprechen über die gesamte Umfrage hinweg für eine eher unentschiedene Haltung. So zum Beispiel zeigt die Studie, dass es sich im Fall der Ablehnung vorrangig um eine Missbilligung sozial unerwünschter Verhaltensmuster handelt. Aus den Ergebnissen ist aber auch auf Mitleid für Sinti und Roma zu schließen. Die abgelehnten Merkmale werden als Resultat sozialer Ausgrenzung und Armut verstanden und nicht als unveränderliche ethnisch-kulturelle Eigenschaften. Insbesondere die qualitativen Interviews zeigen eine allgemeine Offenheit, die allerdings nicht als erhöhtes Maß an Empathie gelten kann. Sie bietet aber die Möglichkeit, dass sich die Gleichgültigkeit zu einem Interesse an Sinti und Roma sowie zu einem Verständnis ihrer Lebenssituationen wandeln kann, wenn es einen Anlass dazu gibt. Es zeigt sich also ein durchaus zwiespältiges Bild: Zum einen werden Sinti und Roma als eine Gruppe betrachtet, der mit Integrationsmaßnahmen geholfen und deren Diskriminierung unterbunden werden soll. Dazu gehören Integrationsangebote, ein freier Zugang zum Arbeitsmarkt, die Bereitstellung von Sozialleistungen sowie die Stärkung von Minderheitenrechten. Zum anderen erscheinen sie als eine Bedrohung, der man mit exkludierenden und kontrollierenden Maßnahmen begegnen sollte. Dazu gehören das Eingreifen der Jugendämter, Einreisebeschränkungen, Polizeikontrolle, Abschiebung, gesonderte Unterbringung, Kriminalitätsbekämpfung und die Bekämpfung von Leistungsmissbrauch. In diesen Ergebnissen wird deutlich, dass in der Bevölkerung nur eine sehr inkonsistente Vorstellung von der Minderheit herrscht. Sinti und Roma sind der Bevölkerung als Gruppe nicht vertraut. Zu vielen Fragen fehlte den Interviewten sowohl auf kognitiver wie auch auf emotionaler Ebene der Bezug zu dem Thema. Dass es allerdings keines klaren Feindbildes bedarf, um situativ ein hohes Maß an Ablehnung gegenüber Sinti und Roma zu äußern, belegen die Ergebnisse ebenso. Die 2013 bundesweit durchgeführte Studie basiert auf quantitativen Erhebungen im Rahmen einer repräsentativen Forsa-Umfrage sowie auf qualitativen Interviews und Experteninterviews. Sie wurde im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes vom Zentrum für Antisemitimusforschung der TU Berlin und dem Institut für Vorurteils- und Konfliktforschung erarbeitet. Ihre Ergebnisse wurden 2014 unter dem Titel»Zwischen Gleichgültigkeit und Ablehnung. Bevölkerungseinstellungen gegenüber Sinti und Roma«veröffentlicht. Forschungsprojekt Projektleitung: Prof. Dr. Wolfgang Benz Prof. Dr. Werner Bergmann Projektbearbeitung: Dr. Miriam Bistrovi ć, Joachim Krauß Wissenschaftliche Beratung: Dr. Brigitte Mihok 28 29
17 Kooperationen und Forschungsverbünde 30 31
18 Kooperationen und Forschungsverbünde Kooperationen und Forschungsverbünde Kooperationen und Forschungsverbünde Das Zentrum für Antisemitismusforschung legt seit Jahren großen Wert auf Vernetzung und Kooperation auf lokaler, regionaler, nationaler wie internationaler Ebene. Neben den vielfältigen wissenschaftlichen Kontakten der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich von Japan bis nach Chile, von Südafrika bis nach Norwegen, von Australien bis nach Kanada erstrecken und zu zahlreichen intensiven Arbeitsbeziehungen führen, unterhält das ZfA zur Zeit folgende offizielle Kooperationen im In- und Ausland: Zentrum Jüdische Studien Berlin-Brandenburg (ZJS) Das Zentrum für Antisemitismusforchung ist Gründungsmitglied des Zentrums Jüdische Studien Berlin-Brandenburg (ZJS), einem Kooperationsprojekt der Humboldt-Universität zu Berlin, der Freien Universität Berlin, der Technischen Universität Berlin, der Universität Potsdam, der Universität Frankfurt/Oder, des Abraham Geiger Kollegs sowie des Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch-jüdische Studien. Das zentrale Anliegen des ZJS besteht zunächst einmal darin, die bereits existierende interdisziplinäre Vielfalt in den Jüdischen Studien im Berlin-Brandenburgischen Raum sichtbar zu machen, die die Fächer Geschichte, Philosophie, Judaistik, Theologie, Literatur- und Musikwissenschaften, Kunstgeschichte und Antikengeschichte umfasst, und Synergien zwischen den Forschenden und den Forschungseinrichtungen mit einem breiten Kooperationsangebot zu intensivieren. In diesem Kontext hat das Zentrum Jüdische Studien im Wintersemester 2013/14 in Kooperation mit dem ZfA erstmals eine öffentliche Ringvorlesung organisiert, die sich mit den»vergessenen Vergessenen«, den jüdischen Armen und Unterschichten in der Moderne beschäftigte. Darüber hinaus unterstützt das ZJS die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, der im Bereich der jüdischen Studien, des jüdisch-christlichen beziehungsweise des islamisch-jüdisch-christlichen Austausches sowie der Museen- und Gedenkstättenarbeit tätig ist. Das ZfA ist im Direktorium durch Stefanie Schüler-Springorum vertreten, die im Wintersemester 2014/15 turnusgemäß für ein Jahr auch die Sprecherfunktion übernommen hat. Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft des Leo Baeck Instituts (WAG) Die im Dezember 1989 gegründete Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft des Leo Baeck Instituts in der Bundesrepublik Deutschland (WAG), der Stefanie Schüler-Springorum seit 2009 vorsteht, ist eine Vereinigung von Historikerinnen und Historikern, die sich der Erforschung und Darstellung der deutsch-jüdischen Geschichte seit dem Beginn der Emanzipation widmet. Sie führt jährliche Doktorandenkolloquien, alle zwei Jahre Tagungen mit deutschen und israelischen Nachwuchswissenschaftlern sowie internationale Symposien durch. So konnte sich im Juli 2012, gefördert durch das deutsch-israelische Zukunftsforum, eine ausgewählte Gruppe deutscher und israelischer Nachwuchswissenschaftler am ZfA treffen, während im Herbst 2014 erstmals die neu gegründete WAG-Postdoktorandengruppe dort tagte. Außerdem veranstaltet sie regelmäßige Sektionen auf dem Deutschen Historikertag. Die Ergebnisse des WAG Panels zum Thema»Schuld Sühne Recht: Gerechtigkeitsvorstellungen, Rachephantasien und juristische Interventionen um 1945/46«auf dem Historikertag 2012, das von Stefanie Schüler-Springorum zusammen mit Ulrike Weckel (Giessen) konzipiert wurde, erschienen im Jahrbuch für Antisemitismusforschung Als Kooperationsveranstaltung zwischen dem ZfA, der WAG und dem ZJS fand im November 2014 der Workshop zum Thema»Survivors. Politics and Semantics of a Concept«statt. International Consortium for Research on Antisemitism and Racism (ICRAR) Das Zentrum für Antisemitismusforschung ist Gründungsmitglied des International Consortium for Research on Antisemitism and Racism (ICRAR). Das im November 2011 gegründete Netzwerk vereint führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Universitäten und Instituten in ganz Europa, Israel und den USA, die sich gemeinsam zum Ziel gesetzt haben, der Antisemitismusforschung neue Impulse zu verleihen. Seine Arbeit stellte das Netzwerk erstmals im Sommer 2013 auf dem World Congress for Jewish Studies in Jerusalem auf einem Panel mit dem Titel»Antisemitism: A Useful Category of Historical Analysis?«vor. Die erste Konferenz des Netzwerks fand ebenfalls im Sommer 2013 in London statt. Sie war dem Thema»Boycotts - Past and Present«gewidmet und wurde vom Pears Institute for the Study of Antisemitism ausgerichtet. Im Juni 2014 folgte eine weitere Konferenz in Budapest zum Thema»Narratives of Violence«. Die dritte internationale Konferenz des Netzwerks wurde von dem ZfA organisiert. Sie fand unter dem Titel»Gender, Memory and Genocide«im Juni 2015 in Berlin statt und war dem Völkermord an den Armeniern gewidmet. International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) Das Zentrum für Antisemitismusforschung ist seit vielen Jahren mit der International Holocaust Remembrance Alliance, vormals Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research (ITF), assoziert. Die inzwischen 31 Mitgliedsstaaten der IHRA erstellen anhand eines festen Fragenkataloges in regelmäßigen Abständen einen Bericht zur Situation der»holocaust-erziehung«, der Erinnerungsarbeit und der Forschung zum Thema Holocaust in ihrem Land. Mitautorin des aktuellen deutschen Länderberichts ist Juliane Wetzel, Mitglied der deutschen Delegation der IHRA. Als Vorsitzende des Subcommittees»Killing Sites«der IHRA hat sie zudem zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus dem Komitee im Januar 2014 eine Konferenz zum Thema Massengräber / Killing Sites organisiert. Die Ergebnisse sind in Buchform im Januar 2015 unter dem Titel»Killing Sites Research and Remembrance«beim Berliner Metropol Verlag erschienen. Research Network Gender in anti-semitism, (Neo-)Orientalism and Occidentalism (ReNGOO) Das Zentrum für Antisemitismusforschung ist Partner des von Ulrike Brunotte initiierten und von der Niederländischen Wissenschafts-Organisation geförderten internationalen Netzwerkes Research Network Gender in anti-semitism, (Neo-)Orientalism and Occidentalism. Die Kooperationspartner kamen im Juni 2013 in Maastricht zum ersten Workshop mit dem Thema»Gender, Sexual Nationalism, Antisemitism, and Orientalism in European Identity Discourses«zusammen. Im Jahr darauf folgte ein weiterer Workshop in Berlin zum Thema Homophobie:»The Homophobic Argument. Towards an Entangled History of European and Middle Eastern Identity Discourses on Gender and Sexuality«. Die Ergebnisse dieses Workshops, herausgegeben von Christina von Braun, Claudia Bruns, Achim Rohde und Stefanie Schüler-Springorum, werden 2016 bei Ashgate in London erscheinen. Europa-Universität Viadrina, Frankfurt /Oder Das Zentrum für Antisemitismusforschung kooperiert mit der Axel Springer-Stiftungsprofessur für deutsch-jüdische Literatur- und Kulturgeschichte, Exil und Migration an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder. Der an der Europa-Universität Viadrina im April 2012 neu eingerichtete Lehrstuhl widmet sich in der kulturwissenschaftlichen Forschung und Lehre der deutsch-jüdischen Literatur- und Kulturgeschichte, der Literatur des Exils und der Migration im deutschsprachigen, europäischen und außereuropäischen Raum vom ausgehenden 18. bis zum 21. Jahrhundert. Gemeinsam bieten beide Einrichtungen seit dem Wintersemester 2014 das Modul»Literarische Repräsentationen von Selbstbehauptung und Verfolgung«an Forschungsverbund: Hate Pictures. Bildpraktiken und aversive Emotionen in der visuellen Kultur des Politischen Der Forschungsverbund untersucht Hate Pictures vom 19. bis ins 21. Jahrhundert, das heißt unbewegte und populäre Bilder wie Fotografien, Karikaturen, Plakate oder Gemälde, die auf die Mobilisierung von aversiven Emotionen wie Hass, Angst, Wut, Ekel etc. zielen. Das massenmediale Zeitalter wurde besonders durch die Produktion, Zirkulation und Rezeption visueller Artefakte geprägt, nicht zuletzt weil mit diesen Bildern auch die Gefühlswelten in europäischen Gesellschaften maßgeblich beeinflusst wurden. Weil dabei gerade Gruppenbildungsprozesse durch gemeinschaftliche Gefühlslagen abgesichert und soziale In- wie Exklusionsmechanismen emotional geteilt wurden, muss auch eine moderne Kulturgeschichte des Politischen über bisherige Ansätze der Propaganda- und Vorurteilsforschung hinausgehen und dem Verhältnis von Visualität und Emotionalität eine herausragende Bedeutung beimessen. Der seit 2014 existierende Forschungsverbund ist am Zentrum für Antisemitismusforschung angesiedelt, ein größerer Antrag auf Förderung ist in Vorbereitung. Neben Stefanie Schüler-Springorum und Carl-Eric Linsler gehören ihm Uffa Jensen (wissenschaftlicher Mitarbeiter am MPI für Bildungsforschung), Jan Plamper (Professor für Geschichte am Goldsmiths College, London), Susanne Regener (Professorin für Mediengeschichte an der Universität Siegen / Affiliate Professor für Kultur- und Mediengeschichte an der Universität Kopenhagen) und Michael Wildt (Professor für Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert mit Schwerpunkt im Nationalsozialismus an der Humboldt-Universität zu Berlin) an
19 Die Arbeitsstelle Jugendgewalt und Rechtsextremismus Die Arbeitsstelle Jugendgewalt und Rechtsextremismus Die Einrichtung der Arbeitsstelle Jugendgewalt und Rechtsextremismus wurde 1999 von Wolfgang Benz, dem damaligen Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung, initiiert. Mit der Arbeitsstelle wurde eine Schnittstelle zwischen der politischen und pädagogischen Praxis einerseits und der wissenschaftlichen Praxis andererseits eingerichtet. Die Arbeitsstelle wurde zunächst aus Mitteln der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin finanziert und wird seit 2008 von der TU Berlin getragen. Geleitet wird sie seit dem Jahr 2000 von Michael Kohlstruck. Hintergrund ihrer Gründung war die Feststellung, dass rechtsextreme Aktivitäten und fremdenfeindliche Verhaltensweisen spätestens seit der deutschen Vereinigung als ein dauerhaftes Problem existieren. Während rechtsextreme Parteien jedoch in den letzten Jahren aufs Ganze gesehen an Anhängern verloren haben, geht von parteidistanten Zusammenschlüssen und verschiedenen rechtsextremen Jugendszenen eine anhaltende Attraktivität aus. Forschungen zeigen, dass der überwiegende Teil der fremdenfeindlichen Gewalttätigkeiten von jungen Männern unter 25 Jahren begangen wird. Sie treten meist in Gruppen auf, deren Verhaltensstil durch eine Enttabuisierung, ja Ästhetisierung körperlicher Gewalttätigkeiten und minderheitenfeindlicher Haltungen gekennzeichnet ist. Rechtsextreme Jugendszenen stellen ein Übergangsfeld dar, das von typisch jugendkulturellem Verhalten und von politischen Aktivitäten gleichermaßen gekennzeichnet ist. Die Überlagerung von Jugendkultur und politischem Extremismus kann zu ideologischen Radikalisierungen und zu unerwünschten Lernprozessen führen. Andererseits bieten aber niedrigschwellige Zugänge zu diesen Szenen auch Ansatzpunkte für Interventionen. Hier sind Elternhaus, Schule und Ausbildungseinrichtungen sowie die Kinder- und Jugendhilfe gefragt. Hier möchte die Arbeitsstelle Jugendgewalt und Rechtsextremismus ansetzen und eine kontinuierliche und professionelle pädagogische Praxis mit Kindern und Jugendlichen unterstützen. Ziel ihrer Arbeit ist es, jungen Menschen in offenen Milieus positive Erfahrungen eines zivilen Zusammenlebens und selbstbestimmter Bildungsprozesse zu ermöglichen. Die Arbeitsstelle informiert über Jugendgewalt, Fremdenfeindschaft und Rechtsextremismus und berät bei der Konzeption, Planung und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen. Sie wirkt bei Fortbildungsveranstaltungen mit und berät Akteure in der kritischen Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus. Sie betreibt zudem im Rahmen von Lokal- und Regionalstudien Forschungen zur Situation von Jugendlichen in Berlin und Brandenburg. Ihre Zielgruppen sind dabei öffentliche und freie Träger der Jugendhilfe, Lehrkräfte und andere Pädagogen sowie Dienststellen der Bundesländer Berlin und Brandenburg. Um dieses Ziel zu erreichen, führte die Arbeitsstelle auch in den Jahren 2012 bis 2014 eine Reihe (fach-)öffentlicher Vorträge und Workshops vor unterschiedlichsten Auditorien durch, um Einzelaspekte des Themenfeldes der Arbeitsstelle Jugendgewalt und Rechtsextremismus zu erörtern. Die Veranstaltungen dienten gleichermaßen der Weiterbildung und der Verbindung der Fachdiskurse von Praktikern und Wissenschaftlern. Darüber hinaus nahm die Beratung und Fortbildung einen wichtigen Platz in der Tätigkeit der Arbeitsstelle ein. Dazu gehörte die wissenschaftliche Beratung und Begleitung des Mobilen Beratungsteams (MBT) im Rahmen des Handlungskonzeptes der Landesregierung»Tolerantes Brandenburg«. Während monatlicher Teamsitzungen beziehungsweise Klausurtagungen wurde das zwölfköpfige Team informiert und beraten. Ferner arbeitete die Arbeitsstelle mit dem Berliner Beratungsnetzwerk zusammen und wirkte bei dem BIK-Netz Präventionsnetz gegen Rechtsextremismus mit. Neben der Aufklärung und Beratung widmete sich die Arbeitsstelle zudem der wissenschaftlichen Erforschung der von ihr identifizierten Themenfelder. In den Jahren 2012 bis 2014 entstanden in Kooperation mit der Landeskommission Berlin gegen Gewalt zwei Studien. Das im Jahr 2011 begonnene Forschungsprojekt»Die Praxis von Vorurteils- und Gewaltprävention in zwei Berliner Quartieren«wurde im Jahr 2012 abgeschlossen. In den Jahren 2013 und 2014 wurde das Forschungsprojekt»Antisemitismus in Berlin 2010 bis 2013«gemeinsam mit Peter Ullrich durchgeführt und abgeschlossen. Leiter der Arbeitsstelle Jugendgewalt und Rechtsextremismus: Dr. Michael Kohlstruck 34 35
20 Nachwuchsförderung 36 37
21 Nachwuchsförderung Nachwuchsförderung Nachwuchsförderung Die Ausbildung und umfassende Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Antisemitismusforschung und benachbarten Themenfeldern ist eine zentrale Aufgabe des Zentrums für Antisemitismusforschung. Durch seinen forschungsorientierten Masterstudiengang»Interdisziplinäre Antisemitismusforschung«bietet das ZfA seinen Studierenden eine wissenschaftlich fundierte Ausbildung an, die ihnen sowohl innerhalb als auch außerhalb der akademischen Welt Berufsperspektiven eröffnet. Doktorandinnen und Doktoranden ebenso wie Post-Doktorandinnen und Post-Doktoranden bietet das ZfA die Möglichkeit, unter der Leitung erfahrener Kolleginnen und Kollegen eigenständig zu forschen und sich wissenschaftlich weiter zu qualifizieren. Wichtigster Bestandteil der Nachwuchsförderung am ZfA ist die strukturierte Doktorandenausbildung, die derzeit im Rahmen eines hauseigenen Forschungskollegs zum»ersten Weltkrieg und den Konflikten der europäischen Nachkriegsordnung ( )«angeboten wird. Darüber hinaus ist das ZfA, vertreten durch Stefanie Schüler-Springorum, Teil mehrerer auswärtiger Graduiertenschulen: der am Max Planck Institut für Bildungsforschung angesiedelten International Max Planck Research School for Moral Economies of Modern Societies (IMPRS Moral Economies), der Doktorandenschule des Zentrums Jüdische Studien sowie dem Ludwig-Rosenberg-Kolleg am Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam. Daneben werden am ZfA natürlich auch individuelle Promotions- und Habilitationsvorhaben angeregt, begleitet und betreut. Forschungskolleg: Der Erste Weltkrieg und die Konflikte der europäischen Nachkriegsordnung ( ) Kaum ein Topos wurde in der Fülle von Publikationen, Reden, Ausstellungen und Gedenkveranstaltungen zum 100. Jahrestag des Beginns des Ersten Weltkriegs so oft und so empathisch zitiert wie die Wendung des amerikanischen Diplomaten George F. Kennan, der den Ersten Weltkrieg als die»urkatastrophe des 20. Jahrhunderts«bezeichnet hatte. Welche katastrophalen Folgen der Erste Weltkrieg für die Geschichte des 20. Jahrhunderts hatte, zeigt sich nicht zuletzt in der vor allem in Ostmittel- und Zentraleuropa zu beobachtenden Radikalisierung des Antisemitismus. Wie und inwiefern der Krieg diese Wirkung auf die europäischen Gesellschaften hervorgerufen hat und welche Unterschiede in den verschiedenen europäischen Ländern auszumachen sind, das untersuchen die Doktorandinnen und Doktoranden des Forschungskollegs»Der Erste Weltkrieg und die Konflikte der europäischen Nachkriegsordnung ( )«. Das seit Juli 2012 bestehende Kolleg ist Herzstück der strukturierten Doktorandenförderung am ZfA. Es wird von der Einstein Stiftung Berlin finanziert und gemeinsam von den Professoren Werner Bergmann und Ulrich Wyrwa (TU Berlin / Universität Potsdam) in Zusammenarbeit mit den Professoren Jörg Baberowski (HU Berlin) und Uwe Puschner (FU Berlin) geleitet. Die aus verschiedenen europäischen Ländern stammenden Doktorandinnen und Doktoranden arbeiten in ihren Promotionsprojekten zu den Entwicklungen in zehn europäischen Ländern. Hana Ćopić fragt nach dem Antisemitismus im Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg. Karolina Filipowska untersucht die Beziehungen zwischen Deutschen, Polen und Juden in Posen im und unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg. Tamás Kohut widmet sich der Radikalisierung des Antisemitismus in Ungarn in den Jahren von 1914 bis Marie-Christin Lux Dissertationsprojekt präsentiert anhand der Kriegskorrespondenzen jüdischer und nicht-jüdischer Ehepaare eine verflechtende Analyse weiblicher und männlicher Erfahrungswelten in Frankreich während des Ersten Weltkriegs. Anastasia Surkov untersucht die Auflösung des Ansiedlungsrayons während des Ersten Weltkriegs und geht der Frage nach, wie die flüchtende jüdische Bevölkerung in den Gebieten des Zarenreiches aufgenommen wurde, die ihnen vorher weitgehend verschlossen geblieben waren. Elisabeth Weber untersucht die Haltung des rumänischen Staates seiner jüdischen Bevölkerung während des Ersten Weltkriegs gegenüber und fragt nach den Reaktionen einheimischer jüdischer Verbände sowie der internationalen Weltöffentlichkeit darauf. Yasmina Zian widmet sich der Ausprägung und Entwicklung des Antisemitismus in Belgien in der Zeit von 1900 bis Matteo Perrisinotto, dessen Promotionsvorhaben in Kooperation mit der Universität Triest entsteht, untersucht den Antisemitismus in Italien während des Ersten Weltkriegs. Thomas Stoppacher, dessen Dissertationsprojekt sich in Vorbereitung befindet und in Zusammenarbeit mit dem Centrum für Jüdische Studien der Universität Graz entsteht, wird den Antisemitismus in Österreich-Ungarn während des Ersten Weltkriegs untersuchen. Carl-Eric Linsler, dessen Arbeit über das Leo Baeck Fellowship Programm der Studienstiftung des deutschen Volkes finanziert wird, widmet sich der transnationalen Geschichte der deutsch-jüdischen Familie Frank zwischen Paris und Frankfurt unter besonderer Berücksichtigung der Kriegsjahre und des französischen Antisemitismus. Isabelle Daniel, deren Promotionsvorhaben von der Heinrich-Böll-Stiftung finanziert wird, untersucht auf der Basis eines akteursorientierten Ansatzes die Strategien, mit denen radikalnationalistische Publizistinnen und Publizisten von 1927 bis 1933 mediale Sprechräume besetzten. Dem Kolleg assoziert ist zudem Jan-Philipp Pomplun, Kollegiat am Walter Rathenau Kolleg, dessen Promotionsprojekt sich der Geschichte der deutschen Freikorps zur Zeit der Weimarer Republik widmet. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten werden zum Teil in Zusammenarbeit mit Universitäten ihrer Heimatländer beziehungsweise ihren Heimatinstitutionen betreut. Die Dissertationsprojekte, die im Rahmen des Kollegs entstehen, sind zunächst als einzelne Länderstudien konzipiert, es wird in ihnen aber auch nach den transnationalen Prozessen und den gegenseitigen Verflechtungen der antisemitischen Diskurse gefragt. Um diese gegenseitige Bezugnahme zu gewährleisten, treffen sich die Doktorandinnen und Doktoranden regelmäßig zur inhaltlichen und methodischen Diskussion ihrer Arbeiten. Den Abschluss des Gesamtprojektes wird eine Monographie über die Radikalisierung des Antisemitismus in Europa von 1914 bis 1923 unter europäisch-vergleichender Perspektive bilden, die eine integrative Gesamtdarstellung über die Beziehungen von Juden und Nichtjuden in den Jahren von Krieg, Revolution und Gegenrevolution leisten wird und vom wissenschaftlichen Leiter des Kollegs, Ulrich Wyrwa, erarbeitet werden wird. Das Forschungskolleg knüpft an das bereits abgeschlossene Doktorandenkolleg»Antisemitismus in Europa. Nationale Kontexte, Kulturtransfer und europäischer Vergleich ( )«am Zentrum für Antisemitismusforschung an, in dem bereits neun Doktorandinnen und Doktoranden aus verschiedenen europäischen Ländern, sowie ein Postdoc-Projekt die Entstehung des Antisemitismus unter europäisch-vergleichender Perspektive untersuchten. International Max Planck Research School for Moral Economies of Modern Societies Moderne Gesellschaften, bestimmt durch differente und divergente Moralkonzepte, können nicht mehr im Sinne eines monolithischen Systems verstanden und analysiert werden. Vorstellungen von Gerechtigkeit, Anstand, und Moralität befinden sich in ständigen Aushandlungsprozessen zwischen verschiedenen Gemeinschaften, Klassen, Geschlechtern und Institutionen. Moralische und emotionale Regime sind abhängig von den sie umgebenden historischen Prozessen und Strukturen und somit stets im Wandel begriffen. Doch wie entstanden»moral Economies«, die konkurrierende Werte und Normen ordneten und hierarchisierten? Wie beeinflussten Moralsysteme zwischenmenschliche Beziehungen, die Bildung von sozialen Gruppen und nicht zuletzt politische Entwicklungen? Welche Schlüsse lassen sich hieraus mit Blick auf die Entstehung von Macht und Machtverhältnissen ziehen? Dies sind nur einige der Fragen, deren Beantwortung sich Doktorandinnen und Doktoranden der IMPRS Moral Economies zum Ziel gesetzt haben. Gemeinsamer Fokus der Forschungsprojekte ist die Untersuchung moralischer Werte in ökonomischen, sozialen, kulturellen und politischen Sphären. Die IMPRS Moral Economies besteht seit 2013 als Kooperation des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung mit dem Friedrich-Meinecke-Institut der FU Berlin, dem Institut für Geschichtswissenschaften der HU Berlin und dem Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin. Die IMPRS Moral Economies bietet ein exzellentes Forschungsumfeld, abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse junger Nachwuchswissenschaftler. Das strukturierte Doktorandenprogramm ermöglicht wissenschaftliche Qualifizierung durch Seminare, Workshops und akademische Retreats. Der intensive Kontakt zu den betreuenden Professoren, die Förderung eigenständigen Arbeitens und der Austausch der Doktoranden untereinander stehen dabei besonders im Vordergrund. Die Internationalisierung wird durch Kooperationen mit amerikanischen Partneruniversitäten (University of Chicago, University of California, Berkeley) gefördert. Im Rahmen des Doktorandenprogramms werden jährlich sechs Stipendien vergeben. Vom Zentrum für Antisemitismusforschung werden derzeit zwei Promotionsvorhaben betreut. Petru Szedlacsek untersucht, wie die Eliten der 38 39
22 Nachwuchsförderung Nachwuchsförderung Szekler das Symbol der bergigen Landschaft nutzten, um eine Ideologie der Abgelegenheit zu entwickeln, welche gleichzeitig ihren Anspruch auf lokale Autonomie im 20. Jahrhundert unterstützen sollte. Thomas Rohringer stellt heraus, auf welche Weise die Kriegsopfer auf die geschlechterspezifischen Moralvorstellungen reagierten, die der britischen und österreichischen Sozialpolitik während der Zwischenkriegszeit zugrunde lagen. Graduiertenschule des Zentrums Jüdische Studien Ziel der Graduiertenschule des Zentrums Jüdische Studien Berlin-Brandenburg ist es, junge Nachwuchswissenschaftler und -wissenschaftlerinnen in Forschung und Lehre im Bereich Jüdischer Studien zu begleiten und zu unterstützen. Neben der Möglichkeit der Vernetzung bietet die Graduiertenschule deshalb Raum für themenspezifische Arbeitsgruppen, Konzeption und Ausrichtung von Tagungen, Konferenzen und Workshops sowie regelmäßige Fortbildungsangebote. Die Graduiertenschule des Zentrums Jüdische Studien Berlin-Brandenburg förderte im Zeitraum neun Doktoranden und fünf Postdoktoranden. Am Zentrum für Antisemitismusforschung wird derzeit ein Promotionsvorhaben betreut: Mohammad A. S. Sarhangis Dissertation, die sich mit der Darstellung des bewaffneten jüdischen Widerstands in US-amerikanischen Spielfilmen über den Holocaust auseinandersetzt. Daneben fungiert Stefanie Schüler-Springorum als Zweitbetreuerin mehrerer anderer Projekte. Als Post-Doktorandin arbeitet Isabel Enzenbach seit 2012 am ZJS beziehungsweise am ZfA. Ihr Arbeitsgebiet umfasst sowohl die visuelle und mediale Geschichte des Antisemitismus im 19. und 20. Jahrhundert als auch Fragen des historischen Lernens und der pädagogischen Intervention. Ludwig Rosenberg Kolleg Das Ludwig Rosenberg Kolleg ist ein interdisziplinäres Graduiertenkolleg der Hans Böckler Stiftung (HBS) und des Moses Mendelssohn Zentrums Potsdam (MMZ), das sich den historischen Bezügen zwischen Judentum und Arbeiterbewegung in der Moderne widmet. Das ZfA ist am Kolleg durch Stefanie Schüler-Springorum vertreten, die aber im Berichtszeitraum noch keine Betreuung übernehmen konnte. In den Jahren 2012 bis 2014 abgeschlossene Habilitationsprojekte betreut durch Prof. Dr. Werner Bergmann 2013 Jan Weyand: Historische Wissenssoziologie des modernen Antisemitismus. Genese und Typologie einer Wissensformation am Beispiel des deutschsprachigen Diskurses (Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg) In den Jahren 2012 bis 2014 abgeschlossene Promotionsprojekte betreut durch Prof. Dr. Stefanie Schüler-Springorum 2012 Philipp Nielsen: Between Promised Land and Broken Promise: Jews, the Right, and the State in Germany between 1871 and 1935 (Yale University Boston) Iryna Kashtalian: The repressive factors of USSRs internal policy and everyday life in Bielorussia (Freie Universität Berlin) Akim Jah: Die Deportation der Juden aus Berlin und das Sammellager Große Hamburger Straße (Freie Universität Berlin) 2013 David Jünger: Vor dem Entscheidungsjahr. Jüdische Emigrationsfragen im nationalsozialistischen Deutschland 1933 bis 1938 (Universität Leipzig) Jan-Hinnerk Antons: Zwischen nationaler Fixierung und pragmatischen Zukunftsentwürfen: Ukrainische Displaced Persons in der britischen Zone (Universität Hamburg) Katarzyna Friedla: Jüdische Lebenswelten in Breslau und Wroclaw : Umgangs- und Überlebensstrategien, Selbstbehauptung und Identität, Verfolgungserfahrung (Universität Basel) 2014 Svenja Bethke:»Kriminalität«und»Recht«in den jüdischen Ghettos Warschau, Litzmannstadt und Wilna im Zweiten Weltkrieg (Universität Hamburg) Marcel Bois: Kommunisten gegen Hitler und Stalin. Die linke Opposition der KPD in der Weimarer Repulik (Universität Hamburg) Tobias Kühne: Das Netzwerk»Neu Beginnen«und die Berliner SPD nach 1945 (TU Berlin) betreut durch Prof. Dr. Werner Bergmann 2012 Yael Ben-Moshe: Die Darstellung Hitlers. Formung kollektiver Erinnerung an Hitler in deutschen und amerikanischen historischen Spielfilmen zwischen Elke Gryglewski: Arabisch-palästinensische und türkische Berliner Jugendliche in ihrem Verhältnis zu Nationalsozialismus und Shoah. Eine Studie zur Pädagogik der Anerkennung Gerrit Hausen:»Die Revolution in der Schublade«. Verfolgte DDR-Literatur und Innere Emigration Klaus Richter: Antisemitismus in Litauen. Christen, Juden und die»emanzipation«der Bauern (Forschungskolleg: Antisemitismus in Europa. Nationale Kontexte, Kulturtransfer und europäischer Vergleich ( ) 2013 Franziska Ehricht: Die Einbindung bildungsbenachteiligter Jugendlicher muslimischer Herkunft in die historisch-politische Bildungsarbeit zu Nationalsozialismus und Holocaust. Eine Fallstudie Christoph Leiska: Räume der Begegnung - Räume der Differenz. Jüdische Integration und Antisemitismus in Göteborg und Kopenhagen (Forschungskolleg: Antisemitismus in Europa. Nationale Kontexte, Kulturtransfer und europäischer Vergleich ( )) 2014 Christina Herkommer: Erinnerung - Medien - Geschlecht. Die Repräsentation der Rollen von Frauen im Nationalsozialismus in der Berichterstattung des Nachrichtenmagazins DER SPIEGEL, betreut durch Prof. Dr. Wolfgang Benz 2012 Britta Schellenberg:»Rechtsextremismus«und»Fremdenfeindlichkeit«im öffentlichen Diskurs der Bundesrepublik Deutschland. Die Debatte über den Fall Mügeln Andrea Rudorff: Frauen in den Außenlagern des Konzentrationslagers Groß-Rosen 2013 Yasemin Shooman:»...weil ihre Kultur so ist«- Das Zusammenspiel von Kultur, Religion, Ethnizität, Geschlecht und Klasse im antimuslimischen Rassismus Angelina Ettrich: Arbeits- und Konzentrationslager Plaszow bei Krakau Tanja von Fransecky: Flucht von Juden aus Deportationszügen in Frankreich, Belgien und den Niederlanden Sonja Niehaus: Haltungen und Verhalten von nichtjüdischen Deutschen gegenüber Jüdinnen und Juden in Erinnerungsinterviews mit Überlebenden des Holocaust (1933 bis 1938) 2014 Svetlana Burmistr: Selbst- und Fremdbilder in der nationalsozialistischen Besatzungspresse am Beispiel der»minsker Zeitung«(April Juni 1944) Anna Rohr: Dr. Heinrich Spiero ( ) und sein Wirken für die Christen jüdischer Herkunft unter dem NS-Regime Esther Sattig: Das Zigeunerlager Ravensburg-Ummenwinkel Mario Wenzel: Ausbeutung vor der Vernichtung. Die Arbeitslager für Juden im Distrikt Krakau des Generalgouvernements betreut durch apl. Prof. Dr. Michael Grüttner Sven Kinas: Entlassungen von Hochschullehrern an preußischen Universitäten Fallstudien zu den Universitäten Berlin, Frankfurt am Main, Greifswald und Halle 40 41
23 Nachwuchsförderung Nachwuchsförderung Laufende Promotionsprojekte (Arbeitstitel) betreut durch Prof. Dr. Stefanie Schüler-Springorum Marco Claas: Gewalt, Mythen und Rituale in der Falange Española (Gerda Henkel Stiftung, abgeschlossen 2015) Philipp Dinkelaker: Ehrengerichts- und Strafverfahren gegen Überlebende der Shoah im Deutschland der Nachkriegszeit (Hans-Böckler-Stiftung) Karoline Georg: Die jüdischen Häftlinge im Berliner Konzentrationslager Columbia-Haus 1933 bis 1936 (Hans-Böckler-Stiftung) Frank Görlich: Fluchpunkt Transnistrien. Grenzüberschreitende Biographien und historische Kontinuitäten zwischen Erstem Weltkrieg und nationalsozialistischer Ostexpansion (Bundesbeauftragter für Kultur und Medien/ Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa) Amir Heinitz: Friedrich Rosen and German Relations with the Orient (Leo Baeck Fellowship Programm der Studienstiftung des deutschen Volkes) Jenny Hestermann: Hinter den Kulissen: Deutsche Politiker in Israel in den Jahren (Leo Baeck Fellowship Programm der Studienstiftung des deutschen Volkes, abgeschlossen 2015) Katja Limbächer: Kontinuitäten der Diskriminierung»asozialer«Mädchen im NS und in der bundesdeutschen Nachkriegszeit. Gefährdetenfürsorge und Pflegeamtsarbeit: Ambivalenzen weiblicher Fürsorge zwischen Zuwendung, Norm und Ausgrenzung (Heinrich-Böll-Stiftung) Carl-Eric Linsler: Jewish Identities during the First World War: The History of the Frank Family as a Franco-German Family Biography (Forschungskolleg: Der Erste Weltkrieg und die Konflikte der europäischen Nachkriegsordnung ( ), finanziert über das Leo Baeck Fellowship Programm der Studienstiftung des deutschen Volkes) Hanno Plass: Zwischen den Welten: jüdische Apartheidsgegner im englischen Exil 1960 bis 1990 (Rosa-Luxemburg-Stiftung) Viola Rautenberg-Alianov: Geschlechtergeschichtliche Perspektiven auf die deutsch-jüdische Einwanderung nach Palästina in den 1930er-Jahren (Leo Baeck Fellowship Programm der Studienstiftung des deutschen Volkes) Irina Rebrova: Memory about the Holocaust in Soviet and Post-Soviet Russian Discourses on World War II. The Case of North Caucasus (Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin) Hendryk Rohn: Die Deutsche Arbeitsfront als Transporteur der nationalsozialistischen Weltanschauung. Der Presseund Propagandaapparat der größten NS-Massenorganisation Thomas Rohringer: Räume und emotionale Stile. Kriegsopfer in der Zwischenkriegszeit, 1920er 1930er Jahre (International Max Planck Research School for Moral Economies of Modern Societies) Mohammad A. S. Sarhangi: Martyrium, Revolte, Kino: Die Darstellung des bewaffneten jüdischen Widerstands in US-amerikanischen Spielfilmen über den Holocaust (Zentrum Jüdische Studien Berlin-Brandenburg) Petru Szedlacsek: Politische Funktionen der Ideologie der Abgelegenheit: Die Vorstellung des Szeklerlands als moralischer Ort kulturellen Widerstands im 20. Jahrhundert (International Max Planck Research School for Moral Economies of Modern Societies) Achim Wörn: Juden in Stettin (Leo Baeck Fellowship Programm der Studienstiftung des deutschen Volkes) Efrat Yeger: A History of Violence in Berlin-Prenzlauer Berg: Views and Expressions of Violence (Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk) Christian Zech: Siegfried Aufhäuser. Exil und Remigration eines Gewerkschafters (Hans-Böckler-Stiftung) betreut durch Prof. Dr. Werner Bergmann Khaled Al-Hashimi: Radicalization of Society Growing Moral Support for Suicide Bombers among Moderate Arabs in the West and the Middle East Sina Arnold: Antisemitismusdiskurse in der US-amerikanischen Linken nach 9/11 (abgeschlossen 2015) Susanne Bressan: Gudrun Ensslin: Die Biographie einer RAF-Terroristin im Kontext des öffentlichen und privaten Umgangs mit dem nationalsozialistischen Erbe in Deutschland (Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk) Hana Ćopić: Antisemitismus im Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen (Forschungskolleg: Der Erste Weltkrieg und die Konflikte der europäischen Nachkriegsordnung ) Max Czolleck: Das Antisemitismus-Dispositiv (Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk) Isabelle Daniel: Neue Medien, neue Akteure. Antisemitismus in der Propaganda radikalnationalistischer Journalistinnen und Journalisten im Berlin der Weimarer Republik (Forschungskolleg: Der Erste Weltkrieg und die Konflikte der europäischen Nachkriegsordnung , finanziert von der Heinrich-Böll-Stiftung) Yasmin Dean:»What are you? I am not a What!«Selbstpositionierungsprozesse im Kontext von Rassifizierung in Deutschland seit 1989 (Hans-Böckler-Stiftung) Florian Eisheuer: Von der»volksseele«zur»rassenhygiene«. Antisemitismus und völkisches Denken in der Ethnologie (Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk) Karolina Filipowska: Deutsche, Polen und Juden. Antisemitismus in Posen im und nach dem Ersten Weltkrieg (Forschungskolleg: Der Erste Weltkrieg und die Konflikte der europäischen Nachkriegsordnung ) Hans-Peter Gruber: Felix Weil: Sozialist, Mäzen, Verleger, Publizist. Eine politische Biographie Maren Jung-Diestelmeier: Die Rolle visueller Stereotype bei der Radikalisierung und ethnischen Aufladung des deutschen Nationalismus. Eine Untersuchung des deutschen Großbritannienbildes im Massenmedium Postkarte (Studienstiftung des Deutschen Volkes) Tamás Kohut: Die Radikalisierung des Antisemitismus in Ungarn in den Jahren von 1914 bis 1920 (Forschungskolleg: Der Erste Weltkrieg und die Konflikte der europäischen Nachkriegsordnung ) Veselina Kuleska: Antisemitismus in Bulgarien (Forschungskolleg: Antisemitismus in Europa. Nationale Kontexte, Kulturtransfer und europäischer Vergleich , finanziert durch die Volkswagen-Stiftung) Marie-Christin Lux: Als Jude, als Frau, als Intellektueller Kriegserfahrungen in den Korrespondenzen französischer jüdischer und nicht-jüdischer Ehepaare ( ) (Forschungskolleg: Der Erste Weltkrieg und die Konflikte der europäischen Nachkriegsordnung ) Maria Margaroni: Von der Zerstörung der Juden auf dem Peloponnes 1821 zur Ritualmordbeschuldigung auf Korfu Gerüchte und Gewalt im Griechenland des 19. Jahrhunderts (Forschungskolleg: Antisemitismus in Europa. Nationale Kontexte, Kulturtransfer und europäischer Vergleich , finanziert durch die Volkswagen-Stiftung) Sonja Nadolny: Die severischen Kaiserfrauen (abgeschlossen 2015) Iulia Onac: Antisemitismus in Rumänien (Forschungskolleg: Antisemitismus in Europa. Nationale Kontexte, Kulturtransfer und europäischer Vergleich , finanziert durch die Volkswagen-Stiftung) Dana Schieck: Edith Baumann eine politische Biographie Ilka Schröder:»Antisemitismus»Missgeburt«des Nationalismus?«Zum systemischen Zusammenhang von Nationalismus und Antisemitismus Florian Schubert: Antisemitismus unter Fußballanhängern (Hans-Böckler-Stiftung) Anastasia Surkov: Die Auflösung des Ansiedlungsrayons während des Ersten Weltkrieges. Das zaristische Vielvölkerimperium und seine Juden (Forschungskolleg: Der Erste Weltkrieg und die Konflikte der europäischen Nachkriegsordnung ) 42 43
24 Nachwuchsförderung Nachwuchsförderung Elisabeth Weber: Zwischen Erwartung und Ernüchterung Die jüdische Bevölkerung während des Ersten Weltkriegs in Rumänien (Forschungskolleg: Der Erste Weltkrieg und die Konflikte der europäischen Nachkriegsordnung ) Yasmina Zian: Jüdische Ausländer in Belgien: Der Einfluss des Ersten Weltkriegs auf ihr Leben und ihre Beziehung zur Fremdenpolizei ( ) (Forschungskolleg: Der Erste Weltkrieg und die Konflikte der europäischen Nachkriegsordnung ) betreut durch Prof. Dr. Wolfgang Benz Toby Axelrod: Confrontation with History: Post-War Germans face their own family s role or local role in Third Reich crimes Jörg Beier: Die Bedeutung des Antisemitismus im italienischen Faschismus Maria Borowski: Homosexuelle in der DDR Ramona Ehret: Der Umgang mit der Geschichte des frühen Konzentrationslagers im Schloss Neu-Augustusburg in Weißenfels Markus End: Ortlos, fremd und grenzverwischend. Genese und Funktion identitätsbedrohender Stereotypen im Antitziganismus Clemens Escher: Die Anhängerschaft Adenauers (abgeschlossen 2015) Ulrich Fritz: Unordnung des Terrors: Fallstudien zu den Außenlagern des KZ Flossenbürg Christian Gaubert: Die DDR im Spiegel musealer Präsentationen Malte Gebert: Kontinuitäten im Wandel Die Aktualität antisemitischer Klassiker im panarabischen-islamistischen Antisemitismus am Beispiel Ägyptens und der Palästinensischen Autonomiegebiete Silvia Goldbaum Tarabani Fracapane: Silence, historical truth and minority identity. Persecutions and deportations of Jews from Denmark Ulrike Hammel: Neid und Antisemitismus. Antriebskräfte eines Vorurteils Matthias Heisig: Jacob Schapiro. Leben und Unternehmen eines»automobilkönigs«der Weimarer Republik, Karlheinz Hofmann: Autobahn und Automobil: Filmpropaganda zur Massenmotorisierung im Nationalsozialismus Daniela Honigmann: Die Gesprächsinitiative der SPD Berlin und der SED während der achtziger Jahre Johannes Ibel: Schicksale Die Häftlinge des Konzentrationslagers Flossenbürg Franziska Jahn: Eine Stätte nationalsozialistischer Repression Das KZ Riga Kaiserwald (abgeschlossen 2015) Katharina Kretzschmar: Identität im Konflikt Identität und Perspektiven palästinensischer und palästinensisch-israelischer Studenten in Deutschland Anna Kutschkau: Antisemitismus als Alltagsgeschichte. Das Verhalten der westdeutschen Mehrheitsgesellschaft gegenüber der jüdischen Minderheit zwischen 1945 und 1960 Enrique Luz Garuti Sales: Wunsch und Feindbild in den nationalsozialistischen Propagandaplakaten: Die Geschichtsmythen der»volksgemeinschaft«und der»jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung«während des»totalen Krieges«( ) Andreas Mix: Das Konzentrationslager Warschau Birgit Müller: Dänemark unter deutscher Besatzung. Dänische Deportierte in NS-Konzentrationslagern Thomas Muggenthaler: Hinrichtungen von Zwangsarbeitern im Rahmen der»sonderbehandlungen«in Niederbayern und der Oberpfalz in der Zuständigkeit der Gestapostelle Regensburg im Vergleich mit den Gestapoleitstellen Nürnberg und München Stefanie Nathow: Zirkus im Nationalsozialismus Verena Paetow: Geschichte, Formen und Bedeutung der Erinnerung in Frankreich an das Konzentrationslager Ravensbrück Stefan Petke: Muslime in Wehrmacht und Waffen-SS.»Fremdvölkische«Soldaten als Verteidiger der deutschen»volksgemeinschaft«und ihres»lebensraumes«? Kontinuitäten und Brüche bei der Durchsetzung des nationalsozialistischen Volksgemeinschafts- und Lebensraumkonzeptes (abgeschlossen 2015) Jan-Philipp Pomplun: Sozialgeschichte der Freikorps in der Weimarer Republik Andreas Pretzel: Radikalisierung der nationalsozialistischen Homosexuellenverfolgung im Zusammenwirken von Polizei und Justiz am Beispiel Berlins Ulrike Wegehaupt: Das Lagerpersonal des KZ Lichtenburg Bjoern Weigel: Vom deutschen zum»arischen«theater Die Vernichtung jüdischer Gewerbetätigkeit an den Berliner Theatern (abgeschlossen 2015) Nazan Yildirim: Geschichtsbild Integration Rechtsstaatlichkeit. Die Wahrnehmung und Identifikation deutscher Geschichte und gesellschaftlicher Werte von Schülern mit türkischem Migrationshintergrund an Berliner Oberschulen Anke Zimmermann: Zwischen rassistischer Verfolgung und politischer Gefangenschaft: Lebensschicksale tschechisch-jüdischer Intellektueller nach 1945 in Dokumenten und Erinnerungen Ole Zimmermann: Die Revolution 1918/1919 in Cuxhaven Vom Arbeiter- und Soldatenrat zur»sozialistischen Republik«Guilhem Zumbaum-Tomasi: Deutsche in der Résistance 1940 bis
25 Studium und Lehre 46 47
26 Studium und Lehre Studium und Lehre Der Masterstudiengang»Interdisziplinäre Antisemitismusforschung«Seit seiner Gründung hat sich das Zentrum für Antisemitismusforschung an der Lehre der TU Berlin beteiligt: Unser Lehrangebot stand und steht grundsätzlich Studierenden aller Fachrichtungen offen. Waren dies in den ersten Jahrzehnten vorwiegend Studierende der Geschichts- und Politikwissenschaft, wurden unsere Lehrveranstaltungen später fester Bestandteil der geistes- und sozialwissenschaftlichen Bachelor- und Masterstudiengänge an der TU Berlin im Wahlpflicht- und Wahlbereich. Um in der Antisemitismusforschung wissenschaftlichen Nachwuchs ausbilden zu können, bedurfte es jedoch der Einrichtung eines eigenen forschungsorientierten Masterstudiengangs. Der Studiengang»Interdisziplinäre Antisemitismusforschung«ist im Wintersemester 2014/15 erfolgreich gestartet. Die Interdisziplinarität und internationale Ausrichtung des Studiengangs soll durch interne und externe Kooperationen sichergestellt werden. So ist ein gemeinsam mit dem Masterstudiengang»Bildungswissenschaft«angebotenes Modul»Interkulturelle Bildungsplanung und -entwicklung«ebenso Bestandteil des Studiengangs wie eine Kooperation mit dem Lehrstuhl für deutsch-jüdische Literatur- und Kulturgeschichte, Exil und Migration an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder im Modul»Literarische Repräsentationen von Selbstbehauptung und Verfolgung«. Darüber hinaus verweisen wir auf anrechenbare affine Module komplementärer Studiengänge an der Fakultät I der TU Berlin und den anderen Berliner Hochschulen. In den kommenden Jahren ist auf der Grundlage bewährter Zusammenarbeit eine enge Studienkooperation und die Einrichtung eines Double-Degree Programms mit akademischen Einrichtungen in London (Pears Institute for the Study of Antisemitism, Birkbeck, University of London), Tel Aviv (Steven Roth Institute for the Study of Contemporary Antisemitism and Racism) und Los Angeles (Shapell-Guerin Chair in Jewish Studies) vorgesehen. Der Masterstudiengang»Interdisziplinäre Antisemitismusforschung«vermittelt umfassende Kenntnisse in Ursachen, Ausformungen und Wirkungen der historischen wie der gegenwärtigen Judenfeindschaft und anderen, zumeist damit verbundenen, rassistischen Ausgrenzungen. Weitere Schwerpunkte bilden die pädagogische Bearbeitung und mediale Vermittlung dieser Phänomene. Neben den fachlichen Inhalten bilden methodische Kompetenzen einen zweiten Qualifizierungsschwerpunkt: die Fähigkeit zur Analyse von Ursachen, Verlaufsformen und Wirkungen gesellschaftlicher Konflikte und der damit verbundenen Wahrnehmungsmuster, die Entwicklung angemessener Bearbeitungsformen, die Fähigkeit zur rationalen und dabei kultursensiblen Bearbeitung von Konflikten (kulturelle Kompetenz), die Reflexion und Weiterentwicklung der sozialen Kompetenzen wie Team-, Kritik- und Konfliktfähigkeit sind weitere Qualifikationsziele des Studiengangs. Das Lehrangebot umfasst neben den themenspezifischen Lehrveranstaltungen auch ein Berufspraktikum und Vertiefungsmöglichkeiten im Wahlpflichtbereich. Studierende haben die Möglichkeit, ein Semester an einer Universität im Ausland zu absolvieren. Das Zentrum für Antisemitismusforschung unterstützt den Aufenthalt mit Partnerinstitutionen in Großbritannien, Israel und den USA. Der Studiengang will seinen Studierenden sowohl innerhalb als auch außerhalb der wissenschaftlichen Laufbahn Berufsperspektiven eröffnen. Der Studiengang qualifiziert seine Absolventinnen und Absolventen für Berufsfelder und Tätigkeiten, für die der wissenschaftlich fundierte Umgang mit Antisemitismus, dem Holocaust, Problemen der Vorurteils- und Konfliktforschung, mit ethnischen Konflikten, der Situation von Minderheiten und Migrationsfolgen beziehungsweise deren Vermittlung zentral ist. Der Studiengang profiliert für Tätigkeiten der Vermittlung der einzelnen Bereiche in der außerakademischen Lehre und (Weiter-)Bildung, im Journalismus, in Gedenkstätten, Museen und Verlagen, in staatlichen und nichtstaatlichen Stellen der Migrationsarbeit sowie in der Arbeit gegen Extremismus und Fremdenfeindlichkeit. Die Möglichkeit der vertieften Schwerpunktbildung innerhalb des Studiengangs bildet zudem die Voraussetzung zur Erlangung spezifischer Kompetenzen in Wissenschaft und Forschung, die in einem anschließenden Promotionsstudium ausgebaut werden können. Koordination des Masterstudiengangs: Dr. Marcus Funck Studierende des Masterstudiengangs»Interdisziplinäre Antisemitismusforschung«48 49
27 Studium und Lehre Studium und Lehre Lehrveranstaltungen Wintersemester 2011/2012 Werner Bergmann Judenfeindschaft in bildlichen Darstellungen (Vorlesung)»Ethnische Säuberungen«im Europa des 20. Jahrhunderts (Seminar) Texte des nationalsozialistischen Antisemitismus (Seminar) Verena Buser / Franziska Jahn Nach dem Holocaust: Zeugnisse Überlebender als Quellen zur Geschichte des Holocaust und Nationalsozialismus (Seminar) Bernward Dörner»Fragt uns, wir sind die Letzten...«Studierende fragen Zeugen der NS-Herrschaft, Teil I (Seminar) Rainer Erb Unternehmen»Overlord«(Seminar) Michael Kohlstruck Politische Generationen in Deutschland. Konzepte und Phänomene (Seminar) Stefanie Schüler-Springorum Deutsch-jüdische Geschichte in der Moderne, Teil I (Vorlesung) Der Nationalsozialismus: Geschichte und Wahrnehmung (Seminar) Sommersemester 2012 Bernward Dörner Tagebücher aus der NS-Zeit als historische Quelle (Seminar) Rainer Erb Friedrich II. und die Nachwelt (Seminar) Marcus Funck Modernekritik und Judenfeindschaft im 19. Jahrhundert (Seminar) Mechthild Gilzmer Deutsch-tunesische Hochschulbegegnung - Erinnerungskulturen im Vergleich: Deutschland - Tunesien (Seminar) Michael Kohlstruck Vom Nutzen und Nachteil des Präventionismus (Seminar) Stefanie Schüler-Springorum Deutsch-jüdische Geschichte in der Moderne, Teil II: Vom Kaiserreich bis 1989 (Vorlesung) Buchenwald: Geschichte und Nachgeschichte (Seminar) Wintersemester 2012/13 Werner Bergmann Stereotypen Vorurteile Feindbilder (Vorlesung) Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts? Verlauf und Deutungen des Ersten Weltkriegs (Vorlesung) Antisemiten: Biographische Zugänge zu einer Weltanschauung ( ) (Seminar) Werner Bergmann / Ulrich Wyrwa Die Radikalisierung des Antisemitismus in Europa ( ): Der Erste Weltkrieg, die mitteleuropäischen Revolutionen von 1918/1919 und die Nachkriegskrisen (Colloquium) Bernward Dörner»Fragt uns, wir sind die Letzten...«Studierende fragen Zeugen der NS-Herrschaft, Teil II (Seminar) Isabel Enzenbach Wie über Antisemitismus aufklären? (Seminar) Rainer Erb Der aktuelle Rechtsextremismus Ideologie, Organisationen, Aktionen (Seminar) Marcus Funck»Ich bin ein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens«. Ignatz Bubis: Ein jüdisches Leben in Deutschland nach 1945 (Seminar) Marcus Funck / Dagmar Thorau Stadt Bürger Partizipation: Politik und Herrschaft in europäischen Städten Michael Kohlstruck Jugendgewalt in Berlin (Seminar) Achim Rohde Faschismus, Holocaust und die arabische Welt: Transnationale Historiographie in einem politisierten Umfeld (Seminar) Stefanie Schüler-Springorum Zur Geschichte der nationalsozialistischen Judenverfolgung (Vorlesung) Widerstand des Herzens oder Aufstand des Gewissens: Der Widerstand gegen den Nationalsozialismus in geschlechtergeschichtlicher Perspektive (Seminar) Sommersemester 2013 Werner Bergmann Geschichte des Antisemitismus von (Vorlesung) Nation-Building und Nationalismus (Seminar) Namenspolitik Die Umbenennung von Straßen (Seminar) NS-Täterforschung (Seminar) Bernward Dörner»Der Gelbe Stern«. Die Kennzeichnung von Juden durch das NS-Regime (Seminar) Isabel Enzenbach / Marcus Funck Antisemitismus ausstellen. Stategien und Paradoxien visueller Kommunikation des Antisemitismus (Seminar) Rainer Erb»Kriegsgewalt«Sprachliche und bildliche Darstellung militärischer Gewalt im 19. und 20. Jahrhundert (Seminar) Michael Kohlstruck Vergangenheitspolitik, Geschichtspolitik, Erinnerungspolitik (Seminar) Stefanie Schüler-Springorum Der Holocaust im Film (Vorlesung) Der Holocaust im Film (Seminar) Wintersemester 2013/14 Rosmarie Beier-de Haan Berliner Themenjahr»Zerstörte Vielfalt«. Erinnerungsarbeit und Erziehung für die Zukunft? (Seminar) Werner Bergmann Antisemitismus in Deutschland von 1945 bis heute (Vorlesung) Gewaltgeschichte: antijüdische Gewalt im 19./20. Jahrhundert (Seminar) Staatsverbrechen bestrafen und erinnern (Seminar) Bernward Dörner Gegen den Strom. Rettungsversuche während des Holocaust (Seminar) Rainer Erb Der NSU-Komplex. Rechtsterrorismus, Wahrnehmung und Tataufklärung (Seminar) Marcus Funck Lektüre und Interpretation historischer Quellen: Feldpostbriefe im Zweiten Weltkrieg (Seminar) Dilek Güven Migration und ihre Folgen in der Bundesrepublik Deutschland und Westeuropa: Vom Gastarbeiter zum Mitbürger (Seminar) 50 51
28 Studium und Lehre Studium und Lehre Michael Grüttner Das nationalsozialistische Deutschland, (Seminar) Michael Kohlstruck Studien zum aktuellen Antisemitismus in Deutschland Konzepte, Methoden und Befunde (Seminar) Stefanie Schüler-Springorum Jüdische Jugend in Deutschland (Seminar) Stefanie Schüler-Springorum / Carina Baganz Diskriminierung, Ausgrenzung, Vertreibung: Die Technische Hochschule Berlin während des Nationalsozialismus (Seminar) Sommersemester 2014 Werner Bergmann Völkermord in vergleichender Perspektive (Vorlesung) NS-Judenverfolgung im frühen deutschen Spielfilm (Vorlesung) NS-Judenverfolgung im frühen deutschen Spielfilm (Seminar) Verschwörungstheorien in Geschichte und Gegenwart (Seminar) Bernward Dörner Denunziation im»dritten Reich«(Seminar) Rainer Erb Der Zweite Weltkrieg im amerikanischen Spielfilm (Seminar) Marcus Funck / Philipp Nielsen Traum und Albtraum. Juden und Stadt in der Moderne (Seminar) Dilek Güven Antisemitismus und Migranten in Deutschland (Seminar) Michael Kohlstruck Antisemitismus-Vorwürfe in Politik und Kultur der Bundesrepublik (Seminar) Wintersemester 2014/15 Felix Axster Antimuslimischer Rassismus: Zur Auseinandersetzung über Reichweite und Grenzen analytischer Kategorien (Seminar) Massenmedien: Strategien des Ausschluss und der Selbstbehauptung (Seminar) Werner Bergmann Rassismus Einführung in die Geschichte und Theorie (Vorlesung) Geschichte der Judenfeindschaft (Vorlesung) Stereotypen Vorurteile Feindbilder (Hauptseminar) Bernward Dörner»Fragt uns, wir sind die Letzten...«Studierende fragen Zeugen der NS-Herrschaft und des Umgangs mit den NS-Verbrechen nach 1945 (Seminar) Isabel Enzenbach Selbstorganisation marginalisierter Gruppen (Seminar) Rainer Erb Das Kriegsende in Europa (Seminar) Marcus Funck Die Grenzen Europas. Europavorstellungen und Europakonzeptionen im 19. und 20. Jahrhundert (Seminar) Quellenkurs Antisemitismus (Übung) Manfred Gailus Protestanten, Katholiken und Antisemitismus im»dritten Reich«(Seminar) Dilek Güven Minderheitenpolitik der Republik Türkei: Nationalismus, Ethnizität und Rassismus (Seminar) Die Geschichte der Juden im Osmanischen Reich und der Türkei: Vom Millet zur Minderheit (Seminar) Michael Grüttner Antisemitismus in den faschistischen Bewegungen der Zwischenkriegszeit (Seminar) Michael Kohlstruck Theorie des Antisemitismus und Historie antisemitischer Phänomene (Seminar) Daniel Mahla Israel und Polen: Beziehungen im Schatten der Vergangenheit? (Seminar) 52 53
29 Bibliothek und Archiv 54 55
30 Bibliothek und Archiv Bibliothek und Archiv Die Bibliothek Rund Bände umfasst die Sammlung der Bibliothek gegenwärtig. Die Encyclopaedia Judaica gehört dazu. Die Bibliothek des Zentrums für Antisemitismusforschung ist eine öffentlich zugängliche Spezialbibliothek, die ihren Leserinnen und Lesern eine umfangreiche Sammlung an Literatur zur Geschichte des Antisemitismus bietet. Neben wissenschaftlichen Fachbüchern, Nachschlagewerken und Zeitschriften besitzt sie auch zahlreiche andere Medien wie Plakate, Flugblätter und Bilderbögen. Grundstock der 1983 aufgebauten wissenschaftlichen Bibliothek bildet eine Sammlung von 3500 Bänden, zu denen antisemitische Schriften vom 17. bis zum 20. Jahrhundert ebenso gehören wie Klassiker der Antisemitismusforschung. Die Sammlung konnte im Laufe der Jahre kontinuierlich erweitert werden und umfasst gegenwärtig rund Bände. Hinzu kommen rund 200 Zeitschriften, die laufend gehalten werden. Durch Käufe und Schenkungen wird der Bestand ständig erweitert, so dass die Sammlung jährlich um rund 1000 neue und antiquarische Bücher wächst. Schwerpunkt der Bibliothek sind Quellen und Darstellungen, die die Entwicklung der Judenfeindschaft im Europa des 19. und 20. Jahrhunderts, von der Entstehung der antisemitischen Bewegung über die nationalsozialistische Judenverfolgung und den Holocaust bis zu neuen Formen der Judenfeindschaft in der Gegenwart, dokumentieren. Darüber hinaus sammelt die Bibliothek historische und aktuelle Publikationen zur Beziehungsgeschichte zwischen Juden und Nichtjuden in und außerhalb Deutschlands, einschließlich Lebensberichten zur jüdischen Verfolgungsgeschichte im 20. Jahrhundert. Die Bibliothek besitzt zudem eine Reihe jüdischer Tageszeitungen, Gemeindeblätter und wissenschaftlicher und kulturpolitischer Zeitschriften und sammelt systematisch Neuerscheinungen zur Regional- und Ortsgeschichte. Außerdem bietet die Bibliothek Forschungsliteratur aus verschiedenen Disziplinen zur Analyse der sozialen, sozial- und individualpsychologischen Hintergründe des Antisemitismus und eng mit ihm verwandter, historisch oft mit ihm zusammen auftretender Phänomene, wie zum Beispiel Fremdenfeindlichkeit oder Minderheitenkonflikte. Die Bibliothek hält zudem Standardwerke der Vorurteils-, Aggressions-, Autoritarismus-, Faschismus-, Nationalismus-, Rassismus-, Migrations-, Minoritäten-, Imperialismus- und Genozidforschung bereit. Der gesamte Bestand ist im Online-Katalog der Universitätsbibliothek der TU Berlin erfasst und so recherchierbar. Die Bibliothek befindet sich in der 9. Etage des ehemaligen Telefunken-Hochhauses am Ernst-Reuter-Platz und ist eine reine Präsenzeinrichtung. Es sind 16 Arbeitsplätze mit einer wunderbaren Aussicht auf Berlin vorhanden. Vorrangig steht die Bibliothek Forschenden und Studierenden des Zentrums für Antisemitismusforschung zur Verfügung, heißt aber auch alle anderen wissenschaftlich Interessierten herzlich willkommen. In den vergangenen Jahren zählte die Bibliothek übrigens rund 1000 Besucher jährlich. Blick in die Bibliothek des Zentrums für Antisemitismusforschung. Leitung: Dr. Marion Neiss 56 57
31 Bibliothek und Archiv Bibliothek und Archiv Das Archiv Im Archiv des Zentrums für Antisemitismusforschung finden sich mehrere bedeutende Sammlungen zu den Themenfeldern Antisemitismus, Nationalsozialismus, Rassismus und Rechtsextremismus. Im Archiv des Zentrums für Antisemitismusforschung werden Dokumente aus den Gebieten Antisemitismus, Nationalsozialismus, Rassismus und Rechtsextremismus, aber auch aus angrenzenden Gebieten, wie etwa der deutschjüdischen Geschichte und der Exilgeschichte gesammelt. Ein bedeutender Teil der Sammlungen dokumentiert die antisemitische und rassistische Politik des NS-Regimes und gibt Auskunft über Verfolgung, Vertreibung und Ermordung der jüdischen Bevölkerung in Deutschland. So enthält beispielsweise die Sammlung»Testaments to the Holocaust«aus dem Archiv der Wiener Library in London, die auf 76 Mikrofilmrollen vorliegt, neben nationalsozialistischem Propagandamaterial auch jüdische Augenzeugenberichte über die nationalsozialistische Verfolgung sowie Fotos zu jüdischem Leben in der Weimarer Republik und unter nationalsozialistischer Herrschaft. Die Sammlung»Diamant«gibt Auskunft über Antisemitismus und jüdisches Leben in Deutschland. Ihr Hauptaugenmerk sind die Erfassung jüdischer Friedhöfe und deren Schändungen in Deutschland seit der Weimarer Republik, sie enthält jedoch auch eine Dokumentensammlung zu den im Novemberpogrom 1938 zerstörten Synagogen. Darüber hinaus verfügt das Archiv über mehrere Sammlungen autobiografischer Dokumente, darunter unveröffentlichte Manuskripte und Unterlagen deutscher Juden, in denen sich die Erfahrungen von Verfolgung und Flucht aus dem nationalsozialistischen Deutschland spiegeln. Zur Emigration deutscher Juden gibt auch das Archiv der American Federation of Jews from Central Europe in New York Auskunft. Die Emigrantenorganisation vertritt seit 1939 die Interessen der aus dem nationalsozialistischen Deutschland in die USA geflüchteten Juden und engagierte sich gegenüber der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der»wiedergutmachung«. Das Archiv bietet darüber hinaus elektronischen Zugang zum Visual History Archive der USC Shoah Foundation, das die weltweit größte Oral-History-Sammlung zu Nationalsozialismus und Holocaust darstellt. Auf 196 Mikrofilmrollen zugänglich ist außerdem der gesamte»dp-germany«/»leo W. Schwarz Papers«-Bestand des YIVO Institute for Jewish Research in New York. Dabei handelt es sich um eine zentrale Quelle zur Geschichte der jüdischen Displaced Persons und zur jüdischen Geschichte im Nachkriegsdeutschland. Ein weiterer zentraler Bestand des Archivs sind die Akten der Nürnberger Prozesse aus den Jahren 1945 bis 1948, die eine wesentliche Quelle zur juristischen Aufarbeitung des Nationalsozialismus darstellen. Ferner stehen im Archiv eine Reihe von Periodika auf Mikrofilm zur Verfügung. Dazu zählen antisemitische Organe, wie die»alldeutschen Blätter«oder»Der Stürmer«ebenso wie Periodika zur Abwehr des Antisemitismus, etwa die»abwehrblätter«oder die»c.v. Zeitung«. Einen Spezialbestand bilden die gesammelten Ausgaben 30 jiddischer Zeitungen aus dem Berlin der Weimarer Republik. Die Entwicklung und Wahrnehmung von Antisemitismus, Rechtsextremismus, Minderheitenfragen und den Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit in jüngerer Zeit dokumentiert eine Presseausschnittsammlung für den Zeitraum von 1983 bis 2009 sowie eine Sammlung rechtsextremer und antisemitischer Publikationen, Flugblätter, Aufkleber und anonymer Briefe vorwiegend aus den 1980er- und 1990er-Jahren. Der Bestand des Archivs ist bisher noch nicht in einer Datenbank erfasst. In den Räumen des Archivs stehen jedoch Findbücher zur Verfügung, die einen näheren Überblick über die Bestände geben. Das Archiv des Zentrums für Antisemitismusforschung befindet sich in der 8. Etage des ehemaligen Telefunken-Hochhauses am Ernst-Reuter-Platz und kann nach vorheriger Anmeldung besucht werden. Kontakt: Udo Bartholdy 58 59
32 Veranstaltungen 60 61
33 Veranstaltungen Forschungskolloquium des Zentrums für Antisemitismusforschung Forschungskolloquium Das Forschungskolloquium dient der Vorstellung und Diskussion aktueller Forschungsvorhaben. Es findet während des Semesters wöchentlich immer mittwochs von 18:15 bis 19:45 Uhr statt und steht ohne Anmeldung allen wissenschaftlich Interessierten unabhängig von einer Hochschulzugehörigkeit offen, auch zum Besuch einzelner Termine. 14. Dezember 2011 Marco Claas (Hamburg): Formen der Gewalt in der Falange Española, Januar 2012 Tanja von Fransecky (Berlin): Fluchten und Fluchtversuche jüdischer Deportierter aus Deportationszügen in Westeuropa 2. Mai 2012 Maria Vera von der Heydt (Berlin):»Geltungsjuden«im Zweiten Weltkrieg 9. Mai 2012 Felix Wiedemann (Berlin): Der Alte Orient in antisemitischen Rassen- und Geschichtskonstruktionen um 1900 Ort: Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin Veranstalter: Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin 11. Januar 2012 Konstanze Nöhrenberg (Berlin): Die Fans zweier Mannschaften. Hertha BSC und Union Berlin 16. Mai 2012 Antonia Schmid (Potsdam): Wir sind die Anderen! Antisemitismus im deutschen Film nach 1989 Wintersemester 2011/ Oktober 2011 Verena Paetow (Berlin): Der französische Ravensbrück-Prozess gegen den ehemaligen Lagerkommandanten Fritz Suhren 26. Oktober 2011 Veselina Kulenska (Berlin): Antisemitismus in Bulgarien am Ende des 19. Jahrhunderts 2. November 2011 Svenja Bethke (Hamburg):»Kriminalität«und Recht im jüdischen Ghetto in Osteuropa während des Zweiten Weltkrieges 9. November 2011 Jan Weyand (Erlangen): Zur Transformation des christlichen in den modernen Antisemitismus 16. November 2011 Valérie Dubslaff (Lyon): Weiblichkeiten im parteipolitischen Rechtsextremismus: der Geschlechterdiskurs der NPD 23. November 2011 Miloslav Szabó (Berlin / Prag): Die»Judenfrage«in der Slowakei November 2011 René Moehrle (Potsdam): Triest, Mussolini und die Judenverfolgung in Italien Dezember 2011 Anna Menny (München): Spanien und sein jüdisches Erbe. Sepharad in offiziellen Erinnerungsdiskursen 18. Januar 2012 Marion Klein (Berlin): Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Eine empirische Untersuchung von Schülererfahrungen 25. Januar 2012 Andrea Rudorff (Berlin): Die Frauenaußenlager des KZ Groß-Rosen 1. Februar 2012 Andrea Hopp (Schönhausen (Elbe) / Berlin): Antijüdische Vorurteile adliger Frauen: zwei Fallbeispiele ( ) 8. Februar 2012 Stefan Dölling (Berlin):»Volkstumskämpfer«sudetendeutscher Paramilitarismus Februar 2012 Frank Görlich (Berlin): Ostkolonialismus und Massengewalt. Biographische Studien zur nationalsozialistischen Russlanddeutschenpolitik Sommersemester April 2012 Juliane Wetzel (Berlin): Der Antisemitismusbericht des Expertenkreises (2011) 18. April 2012 Pina Bock (Leipzig): Der Topos»Deutsche Arbeit«im nationalen Diskurs ( ) 25. April 2012 Julika Rosenstock (Berlin): Warum Gleichheitskritik im Zeitalter der Gleichheit? Eine rechtsphilosophische Antwort 23. Mai 2012 Regina Fritz (Wien): Der Umgang mit dem Holocaust in Ungarn Mai 2012 Gisela Holfter (Limerick): Zum irischen Exil und der Exilforschung in Irland 6. Juni 2012 Franziska Jahn (Berlin): Das KZ Riga-Kaiserwald und seine Außenlager 13. Juni 2012 Carl Chung (Berlin): Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Berlin 20. Juni 2012 Maren Jung-Diestelmeier (Berlin): Visuelle Stereotype:»Wir«und»Die Anderen«auf Bildpostkarten im Deutschen Kaiserreich 27. Juni 2012 Akim Jah (Berlin): Die Deportation der Juden und das Sammellager Große Hamburger Straße in Berlin 4. Juli 2012 Mechtild Gilzmer (Berlin):»Sephardische«Juden aus dem Maghreb und ihre Repräsentation in der postkolonialen Diaspora 11. Juli 2012 Stefan Petke (Berlin): Muslime in Wehrmacht und Waffen-SS 62 63
34 Veranstaltungen Veranstaltungen Wintersemester 2012/ Oktober 2012 Stephan Glienke (Hannover): Geschichtswissenschaftliche Auftragsforschung im politischen Raum 24. Oktober 2012 Sylke Kirschnik (Berlin): Alfred Döblin, das Scheunenviertelpogrom und die»reise in Polen«9. Januar 2013 Jan Taubitz (Erfurt): Videointerviews als Katalysatoren der Erinnerung. Die Transformation des Holocaust in den USA seit den 1970er-Jahren 16. Januar 2013 Armin Steil (Bielefeld): Moschee, Minarett und Muezzinruf. Zur symbolischen Konstruktion des Fremden in Konflikten um islamische Raumsymbole 22. Mai 2013 Alexandra Klei (Berlin): Ort Ereignis Erinnerung. Topographie und Architektur ehemaliger Konzentrationslager im Wandel 29. Mai 2013 Juliane Michael (Göttingen): Osteuropäisch-jüdische Migranten in der Berliner Unterhaltungskunst der 1920er und 1930er Jahre 6. November 2013 Claudia Fröhlich (Hannover / Berlin): Der halbierte Rechtsstaat. Die juristische Aufklärung der NS-Vergangenheit in der frühen Bundesrepublik 13. November 2013 Aischa Ahmed (Berlin): Arabische Präsenzen, Völkerschauen und die Frage der gesellschaftlich Anderen in Deutschland (1896/1927) 31. Oktober 2012 Kurt Schilde (Berlin): Früher NS-Terror in Berlin - Eine neue Sichtung der»braunbücher«(paris 1933/1934) 7. November 2012 Mirjam Zadoff (München): Werner Scholem. Juden - Kommunismus - Antisemitismus 14. November 2012 Helmut Thome (Halle): Zur Soziologie des Gewissens 21. November 2012 Barbara Manthe (Köln): Kölner Richter im Generalgouvernement. Sorgerechtsentscheidungen bei deutsch-polnischen»mischlingskindern«28. November 2012 Peter Ullrich (Berlin): Ambivalenzen der Wachsamkeit. Antisemitismusvorwürfe in der aktuellen öffentlichen Kommunikation 5. Dezember 2012 Jasmin Dean (Berlin): Selbstpositionierungsprozesse in Schwarzen und Jüdischen Communities in Deutschland nach Dezember 2012 Olaf Kistenmacher (Hamburg): Schuldabwehr als Motiv für Israel-Feindschaft? Zu einem Erklärungsansatz für den Antisemitismus von links 19. Dezember 2012 Ronald Hirte / Friedrich von Klinggräff (Weimar / Genf): Von Buchenwald nach Europa. Das Vermächtnis der Häftlinge und die europäische Einigung 30. Januar 2013 Carl-Eric Linsler (Berlin): Jüdische Identitäten während des Ersten Weltkriegs. Frankreich und Deutschland im Vergleich 6. Februar 2013 Sven Deppisch (München): Höhere Polizeiausbildung in Deutschland zwischen den 1920er und den 1950er Jahren 13. Februar 2013 Heiko Beyer (Göttingen): Die Messung antisemitischer Einstellungen mittels experimenteller Designs Sommersemester April 2013 Evelyn Annuß (Bochum): (An-)Ästhetisierung des Politischen? Zum Formwandel des nationalsozialistischen Massentheaters 17. April 2013 Tobias Kühne (Berlin): Das Netzwerk»Neu Beginnen«und die Berliner SPD nach April 2013 Katharina Erbe (Berlin): Rebellin, Heldin, Geisteskranke. Die jüdische Frauenrechtlerin Bertha Pappenheim und ihr Kampf gegen den Mädchenhandel 8. Mai 2013 Péter Bihari (Budapest): Systemwandel und die Juden im Ungarn des 20. Jahrhunderts 15. Mai 2013 Mathias Berek (Leipzig / Tel- Aviv): Preußisch-jüdisches Deutschland. Der Protosoziologe Lazarus im 19. Jahrhundert 5. Juni 2013 Jennifer Steuer (Mannheim): Günter Grass:»Was gesagt werden muss«literaturwissenschaftliche und politische Reaktionen 12. Juni 2013 Sina Arnold (Berlin): Antisemitismusdiskurse in der gegenwärtigen US-amerikanischen Linken 19. Juni 2013 Henning Fauser (Paris / Halle-Wittenberg): Deutschlandbilder ehemaliger französischer KZ-Häftlinge 3. Juli 2013 Lida Barner (London / Berlin):»Jüdische Patente sind zu arisieren«. Geistiges Eigentum von Juden im Nationalsozialismus 10. Juli 2013 Marcin Siadkowski (Warschau): Die Emigration polnischer Juden und die internationale Politik zwischen 1918 und 1945 Wintersemester 2013/ Oktober 2013 Marta Ansilewska (Potsdam): Die religiös-nationale Identität der polnischen Holocaustkinder nach Oktober 2013 Benjamin Wachtler (Leipzig):»Da wollte man von Hitler nichts mehr wissen«nationalsozialismus und Krieg in Berufsbiographien deutscher Nachkriegspsychoanalytiker- Innen 30. Oktober 2013 Achim Wörn (Berlin): Die jüdische Bevölkerung Stettins in den Jahren November 2013 Jan Weyand (Erlangen): Historische Wissenssoziologie des modernen Antisemitismus 4. Dezember 2013 Florian Schubert (Berlin): Antisemitismus von Fußballfans 11. Dezember 2013 Hanno Plass (Hamburg / Berlin): Jüdische AntiapartheidsgegnerInnen im ANC Aktivismus, Exil, Erfahrung 18. Dezember 2013 Klaus Richter (Birmingham): Juden als Akteure des (Wieder-)Aufbaus Ostmitteleuropas, Januar 2014 Katja Gosdek / Andrea Hopp (Schönhausen / Berlin): Bismarck und die Rechtsextremen. Erfahrungen aus der Altmark (Sachsen-Anhalt) 15. Januar 2014 Christoph Kopke (Potsdam): Rechte Gewalt: Aufarbeitung von Tötungsdelikten im Land Brandenburg 22. Januar 2014 Dorothy Mas (London): Nationalpolitische Erziehungsanstalten (NAPOLA) 29. Januar 2014 Peter Ullrich / Michael Kohlstruck (Berlin): Antisemitismus in Berlin ( ) 5. Februar 2014 Alexander Sedlmaier (Bangor / Mainz):»Schmutzige Exportgeschäfte mit Chile, Südafrika, Israel...«. Boykottaktionen der radikalen Linken in der BRD 64 65
35 Veranstaltungen Veranstaltungen 12. Februar 2014 Marie-Christin Lux (Berlin): Versteckter Antisemitismus? Die Umsetzung der Union sacrée in Frankreich während des Ersten Weltkrieges Sommersemester April 2014 Felix Axster (Berlin): Kolonialrassismus und Antisemitismus. Historische Interdependenzen 23. April 2014 Michael Höttemann (Marburg): Der subjektive Sinn der Norm des Anti-Antisemitismus. Theoretische Überlegungen und erste empirische Ergebnisse 30. April 2014 Henri Zukier (Jerusalem): Historische und soziale Dynamiken von Antisemitismus und ihr Verhältnis zum Holocaust 7. Mai 2014 Hana Ćopić (Berlin): Juden als ideale Jugoslawen. Antisemitismus im Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen? 14. Mai 2014 Vincent Duclert (Paris): Antisemitismus aus Sicht französischer Gelehrter um die Jahrhundertwende 21. Mai 2014 Johanna Linsler (Paris): Opfer der»möbel-aktion«. Die Position der Juden in Frankreich nach dem Holocaust 28. Mai 2014 Jenny Hestermann (Berlin): Hinter den Kulissen. Reisen deutscher Politiker nach Israel in den 1970er-Jahren 4. Juni 2014 Rainer Erb (Berlin): Der NSU-Komplex 11. Juni 2014 Katerina Capkova (Prag): Nachkriegsjahre der Juden in Polen und in den böhmischen Ländern. Ein Blick aus der Peripherie 25. Juni 2014 Johanna Langenbrinck (Berlin): Gewalt gegen Juden und Jüdinnen, Berlin Juli 2014 Maximilian Strnad (München): Stigma»jüdisch versippt«. In Mischehe verfolgte Familien Juli 2014 Miriam Bistrović / Joachim Krauß (Berlin): Bevölkerungseinstellungen gegenüber Sinti und Roma 16. Juli 2014 Isabelle Daniel (Berlin): Antisemitismus in den Medien der Weimarer Republik Wintersemester 2014/ Oktober 2014 Mohammad Sarhangi (Berlin): Martyrium und Revolte: Über die Darstellung des bewaffneten jüdischen Widerstands im US-amerikanischen Kino 22. Oktober 2014 Kevin McNamara (St. Andrews, Schottland): In the Service of His Majesty s Government: The British Consular Network in the Third Reich, Oktober 2014 Geneviève Warland (Louvain-la-Neuve, Belgien): Der Historiker Martin Philippson ( ) im Kontext der belgischen Geschichtswissenschaft und Gesellschaft: eine anti-jüdische oder eine anti-deutsche Frage? 5. November 2014 Dana von Suffrin (München): Pflanzen für Palästina! Naturwissenschaften im Jischuw ( ) 12. November 2014 Cordelia Heß (Göteborg / Berlin): Ostforschung,»Judenforschung«und»Archivschutz«: Kurt Forstreuter ( ) und das Staatsarchiv Königsberg 19. November 2014 Yasmina Zian (Brüssel / Berlin): Kriegserfahrung als Radikalisierung des Nationalismus? Der Erste Weltkrieg und die»jüdischen Ausländer«in Belgien 26. November 2014 Felicitas Meyer (Essen): Der Pogrom von Constantine im August Dezember 2014 Max Czollek (Berlin): Das Antisemitismus-Dispositiv 10. Dezember 2014 Fabian Virchow (Düsseldorf): Presseberichterstattung über die NSU-Mordserie vor ihrer Enttarnung 17. Dezember 2014 Elisabeth Weber (Berlin): Im Krieg für gleiche Rechte: Balkankrieg, Erster Weltkrieg und die jüdische Bevölkerung Rumäniens Januar 2015 Martin Liepach (Frankfurt am Main): Schulbuchanalyse»Fragen an die jüdische Geschichte«14. Januar 2015 Gerd Kühling (Berlin): NS-Erinnerung in Berlin. Verfolgte des Dritten Reiches und geschichtspolitisches Engagement im Kalten Krieg Januar 2015 Anastasia Surkov (Berlin): Die Auflösung des Ansiedlungsrayons während des Ersten Weltkrieges: Das zaristische Vielvölkerimperium und seine Juden 28. Januar 2015 Kilian Bartikowski (Lancaster, Großbritannien): Das Jahr 1938 in Deutschland und Italien aus der Sicht britischer Diplomaten 4. Februar 2015 Simon Teune (Berlin): Kontextbedingungen für lokales Engagement gegen die extreme Rechte 11. Februar 2015 Tim Buchen (Frankfurt/Oder): Die»weiße Internationale«oder der Versuch der imperialen Neuordnung Ostmitteleuropas Laufende Veranstaltungsreihen 66 67
36 Veranstaltungen Veranstaltungen BLICKWINKEL. Antisemitismuskritisches Forum für Bildung und Wissenschaft Tagungsreihe Antisemitismus, Rassismus, Islamfeindlichkeit Migrationsgesellschaft, Konkurrenzen, Bildungsstrategien: Diese Stichworte prägen zunehmend die gesellschaftliche, wissenschaftliche und pädagogische Auseinandersetzung mit Vorurteilen und mit ausgrenzenden Denk- und Deutungsmustern. Die Tagungsreihe»Blickwinkel«beleuchtet zeitgemäße Analysen und Reflexionen, diskutiert innovative Bildungsansätze, setzt diskurskritische Akzente und bietet Raum zu Austausch und Vernetzung. Expert_innen aus Wissenschaft und Bildungspraxis betrachten dabei Antisemitismus als herkunfts- und schichtenübergreifendes Phänomen und suchen nach innovativen Zugängen zur pädagogischen Bearbeitung von Antisemitismus, die den vielfältigen Identitäts- und Geschichtsbezüge innerhalb der Migrationsgesellschaft gerecht werden. In den Jahren 2012 bis 2013 haben die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus e.v. (KIgA, Berlin), die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ, Berlin), das Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin sowie das Pädagogische Zentrum des Fritz Bauer Instituts und des Jüdischen Museums Frankfurt unter dem Titel»Blickwinkel. Antisemitismus in der Migrationsgesellschaft«in Berlin, Frankfurt am Main, Köln und Nürnberg jeweils mit etwa 130 Pädagog_innen und Wissenschaftler_innen Erkenntnisse und Erfahrungen zu den Themen»Bildungsansatz Alltagskultur«,»Bildungszugang Gender«und»Kontext Nahostkonflikt«ausgetauscht. Seit 2014 wird die Reihe mit dem neuen Kooperationspartner Bildungsstätte Anne Frank (Frankfurt am Main) unter dem Titel»Blickwinkel. Antisemitismuskritisches Forum für Bildung und Wissenschaft«fortgesetzt. Die fünfte Tagung der Reihe fand 2014 in Jena statt und widmete sich dem Thema»Antisemitismus und Rassismus: Verflechtungen?«. Die nächste Tagung wird 2015 in Kassel zum Thema»Religion: Diskurse Reflexionen Bildungsansätze«stattfinden. 2. Tagung: Bildungsansatz Alltagskultur Mai 2012 Im Zentrum der Tagung stand die Frage nach den alltagskulturellen Aspekten von Antisemitismus. Im engen Austausch von Wissenschaft und Bildungspraxis wurden die Schnittstellen von Alltagskulturen und Antisemitismus analysiert und die Potenziale präventiv-pädagogischer Konzepte diskutiert. Ort: Jugendamt der Stadt Frankfurt am Main Veranstalter: Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin, in Kooperation mit dem Pädagogischen Zentrum des Fritz Bauer Instituts und des Jüdischen Museums Frankfurt, der Jugendbegegnungsstätte Anne Frank und dem Jugendbildungswerk Frankfurt am Main Gefördert im Rahmen des Bundesprogramms TOLERANZ FÖRDERN KOMPETENZ STÄRKEN des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Begrüßung Christiane van den Borg (Leiterin des Jugend- und Sozialamts der Stadt Frankfurt am Main), Martin Salm (Stiftung EVZ) Alltagskultur, Antisemitismus und Pädagogik ein Themenaufriss Barbara Schäuble (Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, Holzminden) Facetten und Bedingungsfaktoren antisemitischer Einstellungen bei Jugendlichen Kurt Möller (Hochschule Esslingen) Alltagskultur als pädagogisches Handlungsfeld Stephan Bundschuh (Fachhochschule Koblenz) Alltagskultur und Antisemitismusprävention Reflexionen zwischen Empirie, Bildungstheorie und Praxis Diskussion: Gabriele Rohmann (Archiv der Jugendkulturen e. V.), Kurt Möller (Hochschule Esslingen), Stephan Bundschuh (Fachhochschule Koblenz) Moderation: Barbara Schäuble (Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, Holzminden) Überleitung Ulla Kux, Stiftung EVZ Vertiefungsangebote: 1. Fußball als thematischer Zugang in der antisemitismuskritischen Bildungsarbeit Potenziale und Konzepte Gerd Dembowski (Deutsche Akademie für Fußballkultur), Andreas Koch (KIgA e. V.) 2. Antisemitismuskritische Bildungsarbeit mit Medien Juliane Wetzel (Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin), Tami Ensinger (JugendBegegnungsStätte Anne Frank), Sabine Hoffmann (Gallus Zentrum Jugendkultur und Neue Medien) 3. Nationale Kulturen? Antisemitismus im Spannungsfeld von Selbstverständnis und Zuschreibung Rosa Fava (Jüdisches Museum Berlin), Ufuk Topkara (Graduiertenkolleg Islamische Theologie) 4. Musik und mehr Jugendkulturen als antisemitismuskritischer Bildungsansatz Jan Buschbom (Violence Prevention Network), Gabriele Rohmann (Archiv der Jugendkulturen e. V.) Sichtbares und Unsichtbares: Geschichte und Emotionen im Kontext von Antisemitismus in Bildung und Gesellschaft Podium: Uffa Jensen (Max-Planck-Institut für Bildungsforschung), Mehmet Senel (IB-Bildungsstätte Hadamar), Marina Chernivsky (Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e. V.»Perspektivwechsel«) Moderation: Margrit Frölich (Evangelische Akademie Arnoldshain) Tagungsresümee Gottfried Kößler (Fritz Bauer Institut), Anne Goldenbogen (KIgA e. V.) 3. Tagung: Bildungszugang Gender Oktober 2012 Die Tagung widmete sich dem Zusammenhang zwischen Antisemitismus und Gender. An der Schnittstelle von Wissenschaft und pädagogischer Praxis wurde dabei diskutiert, wie in der Migrationsgesellschaft unterschiedliche Macht- und Diskriminierungsverhältnisse zusammenwirken und was das wiederum für gesellschaftliche und präventiv-pädagogische Strategien und Konzepte bedeutet. Ort: Forum Volkshochschule, Rautenstrauch-Joest-Museum, Köln Veranstalter: Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus e.v., Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, Zentrum für Antisemitimusforschung der TU Berlin, in Kooperation mit dem Pädagogischen Zentrum des Fritz-Bauer-Instituts und des Jüdischen Museums Frankfurt, der Kölnischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit und der Volkshochschule der Stadt Köln Gefördert im Rahmen des Bundesprogramms TOLERANZ FÖRDERN KOMPETENZ STÄRKEN des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Begrüßung Martin Salm (Stiftung EVZ), Andrea Pohlmann-Jochheim (Volkshochschule Köln) Gender, Antisemitismus und Bildung ein Themenaufriss Heike Radvan (Amadeu Antonio Stiftung, Berlin) World-Café Anne Goldenbogen (KIgA e.v.) Antisemitismuskritische Bildungsprozesse in der Reflexion von Migration und Geschlecht Astrid Messerschmidt (Pädagogische Hochschule Karlsruhe) Die friedfertige Antisemitin? Geschlechterverhältnis und Antisemitimus Ljiljana Radonic (Universität Wien) Reflexion Moderation: Deborah Krieg (JugendBegegnungsStätte Anne Frank, Frankfurt am Main) Überleitung Juliane Wetzel (Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin) Vertiefungsangebote: 1. Antisemitische Körperbilder des Nationalsozialismus und intersektionale Bildungsarbeit Meike Günther (wissenschaftliche Referentin), Tatjana Volpert (BildungsBausteine gegen Antisemitismus) 2. Bilder von Juden, Muslimen und Schwarzen. Geschlecht als Analysekategorie aktueller Schulbuchdarstellungen Isabel Enzenbach (Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin) 3. Antisemitismus in Männlichkeitskonstruktionen Simona Pagano (Europa Universität Viadrina / Università degli Studi Napoli L Orientale) 4. Geschlechterdimensionen im Nahostkonflikt und in seiner Wahrnehmung in Deutschland Achim Rohde (Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin) 68 69
37 Veranstaltungen Veranstaltungen 5. Rechtsextremismus, Prävention und Geschlecht Esther Lehnert (Fachstelle Gender und Rechtsextremismus der Amadeu Antonio Stiftung) Reflexion Moderation: Deborah Krieg (JugendBegegnungsStätte Anne Frank, Frankfurt am Main)»Race, Class, Gender«Zuschreibungen und Verschränkungen im Kontext von Antisemitismus und Antisemitismuskritik Podium: Abousoufiane Akka (NeRaS Netzwerk Rassismus an Schulen, Hamburg), Marina Khanide (Trainerin für interkulturelle Verständigung, München), Karin Stögner (Institut für Konfliktforschung, Universität Wien) Moderation: Marcus Meier (Kölnische Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit) Resümee und Ausblick Ulla Kux (Stiftung EVZ) 4. Tagung: Kontext Nahostkonflikt September 2013 Die vierte Tagung der Reihe Blickwinkel. Antisemitismus in der Migrationsgesellschaft befragte das Verhältnis von Antisemitismus und Nahostkonflikt in Deutschland im Spiegel von Wissenschaft und Bildungspraxis. Ein wichtiger Aspekt der Tagung war es, Anstöße für einen qualifizierten Umgang mit Inhalten und mit Mustern von Kommunikation zu geben. Ort: Caritas Pirckheimer Haus, Nürnberg Veranstalter: Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus e.v., Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, Zentrum für Antisemitimusforschung der TU Berlin, in Kooperation mit dem Pädagogischen Zentrum des Fritz-Bauer-Instituts und des Jüdischen Museums Frankfurt Gefördert im Rahmen des Bundesprogramms TOLERANZ FÖRDERN KOMPETENZ STÄRKEN des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Begrüßung Martin Salm (Stiftung EVZ) Interaktiver thematischer Einstieg Ulla Kux (Stiftung EVZ), Malte Holler (KIgA e.v.) Themenaufriss: Der Nahostkonflikt und Antisemitismuskritische Bildung Monique Eckmann (Haute école de travail social, Fachhochschule Westschweiz, Genf) Antisemitismus und Nahostkonflikt: Zusammenhänge und Spannungsfelder im Widerstreit einer Migrationsgesellschaft Podium: Ulrich Bielefeld (Hamburger Institut für Sozialforschung), Omar Kamil (Simon-Dubnow-Institut), Christine Mähler (ConAct), Muhammad Sameer-Murtaza (Islamwissenschaftler bei der Stiftung Weltethos) Moderation: Jutta Weduwen (Aktion Sühnezeichen Friedensdienste) Starke Emotionen (Sozial-)Psychologische Perspektiven auf die Wahrnehmung des Nahostkonfliktes in Deutschland Micha Brumlik (Erziehungswissenschaftler) Theorie-Praxis-Handbuch zur kritischen Auseinandersetzung mit Antisemitismus (Hg.) KigA e.v. - Präsentation Anne Goldenbogen, Andreas Koch (KIgA e.v.) Überleitung Juliane Wetzel (Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin) Vertiefungsangebote: 1. Jenseits von Schwarz-Weiß: Der Nahostkonflikt in der Jugendbildung Anne Goldenbogen, Andreas Koch (KIgA e.v.) 2. Gegen Juden, gegen Muslime Zwischen Stigmatisierung, Dominanzkultur und Selbstbehauptung. Andrés Nader (RAA Berlin) 3. Reflexionen: Antisemitismus und Nahostkonflikt in Biographie, Familie und Erfahrung Lena Inowlocki (Fachhochschule Frankfurt am Main), Julia Bernstein (Universität zu Köln) 4. Antisemitismus und Nahostkonflikt in reflexiv orientierter Fortbildung Tami Ensinger, Christa Kaletsch (Bildungsstätte Anne Frank, Frankfurt am Main) 5. Der Anti-Bias-Ansatz im Kontext von Antisemitismus Žaklina Mamutovic, Kerem Atasever (Bildungsteam Berlin-Brandenburg e.v.) 6. Konkurrierende Narrative? Der Nahostkonflikt in der historischen Bildung Guy Band (Freier Mitarbeiter Haus der Wannseekonferenz), Jan Krebs (Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland Ausstellung 7xjung) Reflexion Workshopphase Konflikt und Kommunikation im Kontext von Antisemitismus und Nahostkonflikt Gespräch: Alexandra Senfft (Autorin und Publizistin) Moderation: Malte Holler (KIgA e.v.) Resümee und Ausblick Hanne Thoma (Diplom-Politologin), Ulla Kux (Stiftung EVZ) 5. Tagung: Antisemitismus und Rassismus: Verflechtungen? September 2014 Im Mittelpunkt der Tagung stand die Frage nach den Verflechtungen zwischen Antisemitismus und Rassismus. Diskutiert wurde dabei, ob und wie Antisemitismus und Rassismus als verflochten, unterschiedlich oder zusammen gedacht werden können und was dies für die pädagogische Praxis einer Migrationsgesellschaft bedeutet, in der verschiedene Erfahrungen von Ungleichheit aufeinander treffen. Ort: Stadtteilzentrum LISA, Jena Veranstalter: Bildungsstätte Anne Frank Frankfurt am Main, Pädagogisches Zentrum des Fritz-Bauer-Instituts und des Jüdischen Museums Frankfurt, Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, Zentrum für Antisemitimusforschung der TU Berlin Begrüßung und Eröffnung Albrecht Schröter (Oberbürgermeister Jena), Martin Salm (Stiftung EVZ), Ulla Kux (Stiftung EVZ) Interaktiver Einstieg Deborah Krieg (Bildungsstätte Anne Frank, Frankfurt am Main)»Verflechtungen«von Antisemitismus und Rassismus aus wissenschaftlicher Sicht Yasemin Shooman (Historikerin, Jüdisches Museum Berlin) Zum Verhältnis von Antisemitismus und Rassismus in Forschung und öffentlicher Diskussion Podium: Friedemann Bringt (Kulturbüro Sachsen, Dresden), Anne Giebel (Office for Democratic Institutions and Human Rights, Warschau), Nicola Lauré al-samarai (Historikerin, Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, Berlin), Yasemin Shooman (Historikerin, Jüdisches Museum Berlin), Juliane Wetzel (Historikerin, Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin) Moderation: Sabena Donath (Zentralrat der Juden in Deutschland) Umgang mit Antisemitismus und Rassismus aus pädagogischer Sicht Monique Eckmann (Soziologin, Schweiz) Überleitung Vertiefungsangebote: 1. Postkolonialität und Antisemitismus als Zugänge der politischen Bildungsarbeit Rehema Busch (Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, Frankfurt am Main), Deborah Krieg (Bildungsstätte Anne Frank, Frankfurt am Main) 2. Antisemitismus und Rassismus in Beratung und Intervention Friedemann Bringt (Kulturbüro Sachsen, Dresden) 3. Antisemitismus zwischen Muslimfeindlichkeit und Islamismus Nadim Gleitsmann (ufuq.de, Hamburg) 4. Gerechtigkeitsempfindungen und Diskriminierungserfahrungen Manuel Glittenberg (Bildungsstätte Anne Frank, Frankfurt am Main), Christa Kaletsch (Bildungsstätte Anne Frank, Frankfurt am Main) 5. Mediale Konstruktion von Juden und Muslimen in Deutschland Türkân Kanbıçak (Pädagogisches Zentrum des Fritz Bauer Instituts und des Jüdischen Museums, Frankfurt am Main), Manfred Levy (Pädagogisches Zentrum des Fritz Bauer Instituts und des Jüdischen Museums, Frankfurt am Main) Erkenntnisse aus den Vertiefungsangeboten Besprechbarkeit von Antisemitismus und Rassismus im Organisationshandeln? Podium: Anne Broden (Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit NRW, Düsseldorf), Bernd Fechler (Organisationsberater und Trainer, Frankfurt am Main), Heike Radvan (Amadeu Antonio Stiftung, Berlin) Moderation: Jamila Adamou (Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, Hessische Landeszentrale für politische Bildung, Wiesbaden) Tagungsbeobachtungen Astrid Messerschmidt (Erziehungswissenschaftlerin, Pädagogische Hochschule Karlsruhe) 70 71
38 Veranstaltungen ZfA im Dialog: Gespräche über Ressentiments Veranstaltungsreihe Im Oktober 2014 wurde am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin eine neue Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen.»zfa im Dialog: Gespräche über Ressentiments«ist eine öffentliche Gesprächsreihe, die aktuelle Debatten zum Thema Antisemitismus aufgreift und diese mit hochkarätigen Gästen diskutiert. Unter dem Titel»Déjà-vu? Zur gegenwärtigen Debatte um Antisemitismus«war die Auftaktveranstaltung der im Zuge des Gaza-Krieges im Sommer 2014 geführten Auseinandersetzung um das Ausmaß antisemitischer Ressentiments in Deutschland gewidmet. Die Veranstaltungsreihe wird 2015 fortgesetzt. Déjà-vu? Zur gegenwärtigen Debatte um Antisemitismus 20. Oktober 2014 Im Zuge des Krieges zwischen Israel und Gaza in diesem Sommer flammte die Auseinandersetzung über das Wesen des Antisemitismus wieder auf. Anlass waren judenfeindliche Parolen, die auf propalästinensischen Demonstrationen gerufen wurden, sowie Angriffe auf Juden und Synagogen. Einige Kommentatoren sprachen von»blankem Judenhass«und konstatierten eine neue Qualität des Antisemitismus. Andere werteten die judenfeindlichen Ausfälle als einzelne Normverstöße. Die Debatte zeigte einmal mehr, dass die Frage, was Antisemitismus eigentlich sei, in besonderer Weise aufgeladen und mit politischen Implikationen verbunden ist. Deswegen machte die Gesprächsveranstaltung die Debatte selbst zum Gegenstand kritischer Reflexion und ergründete überdies die Untiefen des regelmäßig wiederkehrenden Antisemitismusstreits. Ort: orangelab Veranstalter: Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin Mit Stefanie Schüler-Springorum, Direktorin des Zentrums für Antisemitismusforschung der TU Berlin, diskutierten: Omri Boehm, Philosoph, New York Micha Brumlik, Erziehungswissenschaftler, Berlin Carolin Emcke, Journalistin, Berlin Abgeschlossene Veranstaltungsreihen 72 73
39 Veranstaltungen Veranstaltungen Antisemitismus in Europa Vortragsreihe Dezember Juni 2014 In der Vortragsreihe wurden auf der Basis aktueller Studien die Entstehung und Entwicklung des Antisemitismus in verschiedenen Teilen Europas in den Blick genommen. Die Reihe lieferte einen Beitrag zu der Frage, welche Bedeutung dem Holocaust und dem Antisemitismus für die europäische Geschichte und für die historische Selbstverständigung des sich vereinigenden Europas zukommt. Ort: Topographie des Terrors Veranstalter: Stiftung Topographie des Terrors und Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin in Verbindung mit der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas 3. Dezember 2013»Katzenmusik«und»Judenjagd«. Ausgrenzung und Ermordung der westgalizischen Juden in mikrohistorischer Perspektive Eröffnung der Vortragsreihe: Prof. Dr. Andreas Nachama (Berlin) Vortrag: Dr. Tim Buchen (Frankfurt/Oder) Moderation: Prof. Dr. Stefanie Schüler-Springorum (Berlin) 29. April 2014 Wirtschaftlicher oder nationaler Antisemitismus? Die»Judenfrage«in der Slowakei im 19. und 20. Jahrhundert Vortrag: Dr. Miloslav Szabó (Prag) Moderation: Prof. Dr. Werner Bergmann (Berlin) 10. Juni 2014 Judenverfolgung in Triest während Faschismus und Nationalsozialismus Vortrag: Dr. René Moehrle (Trier) Moderation: Prof. Dr. Ulrich Wyrwa (Potsdam / Berlin) DIE vergessenen VERGESSENEN - Juden als Verlierer der Moderne Ringvorlesung Wintersemester 2013/14 Juden als Wegbereiter und Profiteure der Moderne sind verbreitete Topoi der historischen Forschung und der populärwissenschaftlichen Wahrnehmung. Die Juden waren jedoch keineswegs alle Gewinner der Moderne, unter ihnen gab es zahlreiche Verlierer. Als solche können sie als doppelt vergessen gelten: Vergessen wurden sie zunächst im metaphorischen Sinne, weil sie mit der dynamischen Entwicklung nicht Schritt halten konnten und auf dem Weg in die moderne Gesellschaft verloren gingen. Vergessen wurden sie ein zweites Mal, als die Historiographie die Juden zu modernen Bürgern par excellence erklärte. Die Ringvorlesung widmete sich diesen Verlierern aus sozial- und kulturwissenschaftlicher Perspektive. In den einzelnen Vorträgen wurden Gruppen und Personenkreise vorgestellt, die der großen Erzählung vom Judentum in der Moderne nicht entsprechen. Ort: Humboldt-Universität zu Berlin Veranstalter: Zentrum Jüdische Studien, Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin Gefördert von: Bundesministerium für Bildung und Forschung 12. Dezember 2013 Anne-Christin Saß (Essen): Wanderarme und Hausierer Lebensweisen und Alltag einer stigmatisierten Minderheit Januar 2014 Monika Richarz (Berlin): Jüdische Mägde Die weibliche Unterschicht der Juden zu Beginn der Moderne 23. Januar 2014 Veronika Hennings (Oldenburg):»Du sollst den Sabbat heiligen!«religion als ein Aspekt jüdischer Arbeitsfürsorge 6. Februar 2014 Stefanie Fischer (Berlin): Vergessene, aber keine Verlierer: Jüdische Viehhändler zu Beginn des 20. Jahrhunderts 7. Januar 2014 Antisemitismus zwischen Tschechen und Deutschen. Die Rolle des Antisemitismus in den böhmischen Ländern im 19. und 20. Jahrhundert Vortrag: Dr. Michal Frankl (Prag) Moderation: Prof. Dr. Werner Bergmann (Berlin) 11. Februar 2014 Juden und Jugoslawen: Unter Brüdern und Mördern ( ) Vortrag: Dr. Marija Vulesica (Berlin) Moderation: Prof. Dr. Ulrich Wyrwa (Potsdam / Berlin) 18. März 2014 Antisemitismus, Wirtschaft und judenfeindliche Gewalt in Litauen Vortrag: Dr. Klaus Richter (Birmingham) Moderation: Prof. Dr. Stefanie Schüler-Springorum (Berlin) 17. Oktober 2013 Andreas Gotzmann (Erfurt): Die vergessenen Vergessenen Annäherungen an einen neuen Forschungsbereich der deutsch-jüdischen Geschichte 31. Oktober 2013 Sabine Hering (Potsdam): Menschen auf der Durchreise Die jüdische Wanderfürsorge in Deutschland 14. November 2013 Andreas Brämer (Hamburg):» in pecuniärer Beziehung leider fast Proletarier, doch Gottlob geistig emanzipirt«zur ökonomischen und sozialen (Not-)Lage jüdischer Religions- und Elementarlehrer in Preußen ( ) 28. November 2013 Karolin Steinke (Berlin): Transnationale Netzwerke Jüdische Eierhändler in Berlin In der Berliner Grenadierstrasse, 1920er-Jahre, Foto: bpk / Friedrich Seidenstücker 74 75
40 Veranstaltungen Konferenzen und Tagungen Emotions and the History of Modern Anti-Semitism Internationale Konferenz April 2012 Obwohl bereits Jean-Paul Sartre in seinem berühmten, 1946 erschienen Buch»Réflexions sur la question juive«den Antisemitismus als eine Emotion, gar als»leidenschaft«, bezeichnete, wurden die Verbindungen zwischen der Geschichte der Gefühle und der des Antisemitismus bisher kaum systematisch untersucht. Vor diesem Hintergrund beleuchtete die international besetzte Tagung»Emotions and the History of Modern Anti-Semitism«antisemitisch geprägtes Gedankengut in Europa vom Ende des 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts: Filme, Reden, Literatur, Bilder und Werbung wurden dabei ebenso analysiert wie Moralvorstellungen oder gruppendynamische Prozesse, die Emotionen wie Hass und Angst zu verheerenden Gewaltexzessen gegen Juden eskalieren ließen. Ort: Max-Planck-Institut für Bildungsforschung Veranstalter: Max-Planck-Institut für Bildungsforschung (Uffa Jensen) in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin (Stefanie Schüler-Springorum) und dem Leo Baeck Institute London (Raphael Gross, Daniel Wildmann) Welcome Ute Frevert (Berlin) Stefanie Schüler-Springorum (Berlin) Raphael Gross (Frankfurt am Main / London) Daniel Wildmann (London) Introduction Uffa Jensen (Berlin): The History of Emotions. A New Perspective on Modern Anti-Semitism? I. Writing Emotions Into the History of Anti-Semitism Jonathan Judaken (Memphis): Anxiety and Modernity. Talcott Parsons, Sartre, and the Frankfurt School on Modern Anti-Semitism Comment: Detlev Claussen (Hannover) II. Emotions and Anti-Semitic Violence Russell Spinney (Santa Fe): Expanding the Emotional Economy of Anti-Semitism in the Weimar Republic Stefan Wiese (Berlin): The Emotional Micro-Politics of Collective Violence Pride, Fear, and the Jewish Pogroms of Late Imperial Russia Comment: Christhard Hoffmann (Bergen) III. Anti-Semitism Rational or Irrational? Werner Bergmann (Berlin): The Negation of Emotions in Modern Anti-Semitism. The»Antisemitismus der Vernunft«Anthony Kauders (Keele / Munich): Good Feelings, Bad Rationality: The Problem with Jewish Reason Comment: Robert S. Wistrich (Jerusalem) IV. Emotions, Anti-Semitism and Media Nathan D. Abrams (Bangor): Reverse Stereotypes. Anti-Anti-Semitic Counter-Communication in Contemporary Cinema Daniel Wildmann (London): German TV Crime Series and German Emotions Jews in»tatort«remco Ensel (Nijmegen): Singing about Muhamad Al- Durra. The Emotional Mobilization of the Israeli-Palestinian Conflict (in the Netherlands and Elsewhere) Comment: Darcy Buerkle (Northampton / Berlin) V. Anti-Semitism and Emotions Across Europe Ulrich Wyrwa (Berlin), with Maciej Moszyński, Klaus Richter, Miloslav Szabó and Marija Vulesica (all Berlin): Anti-Semitic Emotions in Europe ( ). Similarities and Differences of Anti-Semitic Feelings in Various Czarist and Habsburg Regions Comment: Andrea Hopp (Berlin) VI. Emotions, Anti-Semitism and National Socialism Alexandra Przyrembel (Berlin): Mixed Feelings.»Race Defilement«and Anti-Semitic Violence, Werner Konitzer (Frankfurt am Main): Moral Feelings and Hatred: Some Reflections about the Role of Emotions in the»race Defilement«-Pogroms Comment: Michael Wildt (Berlin) VII. Emotions and Postwar Anti-Semitism Anna Parkinson (Chicago):»Death of the Adversary«. The Affective Structure of Anti-Semitism in Postwar Psychoanalytic Literature Katharina Obens (Berlin): Emotions and Counter-Memory. Young Germans Impressions and Perceptions After Meeting a Survivor of the Holocaust Comment: Susan Neiman (Potsdam / Berlin) VIII. Final Discussion Imperiale Biographien: Elitekarrieren in den Vielvölkerreichen der Romanows, Habsburger und Osmanen ( ) Internationale Konferenz Mai 2012 und Juli 2012 Die Vielvölkerreiche der Romanows, Habsburger und Osmanen gerieten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Bewegung: Staatsausbau, Industrialisierung, Verkehrsrevolution und Städtewachstum führten in den drei großen Landimperien zu einer bislang nicht gekannten Mobilität ihrer Bewohner. Dabei formierten sich neue mobile Eliten, die schnell zu zentralen Akteuren des Wandels wurden. Sie waren daran beteiligt, die Beziehungen zwischen Zentrum und Peripherie wie auch das Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft neu auszuhandeln. Der Blick auf derartige imperiale Biographien ermöglicht nicht nur einen neuen Zugang zu jenen Menschen, die das Imperium als Teil ihrer Lebenswege erfuhren, sondern eröffnet auch neue Perspektiven auf imperiale Mobilitätsmuster, Karrierewege und Elitenzirkulation sowie auf neue Exklusionsmuster und soziale Gegenbewegungen. Zwei Tagungen in Berlin im Mai 2012 und in Bamberg im Juli 2012 versammelten neue Forschungsbeiträge zu dem Konzept der imperialen Biografien. Ort: Technische Universität Berlin und Otto-Friedrich-Universität Bamberg Veranstalter: Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin (Tim Buchen), Leibniz Universität Hannover (Malte Rolf) Ungarn: Antisemitismus, Roma-Feindlichkeit und Demokratie? Internationale Konferenz 8. November 2012 Seit dem Regierungswechsel in Ungarn 2010 hat sich die Lage der Minderheiten im Land dramatisch verschlechtert, insbesondere die der Roma, aber auch antisemitische Vorurteile sind im öffentlichen Diskurs virulenter geworden. Die Presse- und Medienfreiheit sowie die Unabhängigkeit der Justiz werden immer mehr eingeschränkt, das öffentliche Klima zunehmend nationalistisch aufgeladen. Die Konferenz beschäftigte sich mit den politischen Entwicklungen in Ungarn und deren Auswirkungen auf Minderheiten. Diskutiert wurden Antisemitismus, Roma-Feind
41 Veranstaltungen Veranstaltungen lichkeit, Geschichtsmythen sowie Einschränkungen der Meinungsfreiheit und die daraus folgenden Gefahren für die Demokratie. Ort: Technische Universität Berlin Veranstalter: Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin Eröffnung und Begrüßung Stefanie Schüler-Springorum Ágnes Heller (Budapest): Das unverdaute Erbe des ungarischen Antisemitismus Keno Verseck (Berlin): Ungarns Un-Demokraten. Aufstieg und Konsolidierung der national-radikalen Jobbik-Partei Margit Feischmidt (Budapest): Rechtsradikale Mobilisierung und interethnische Konflikte. Fallanalyse Gyöngyöspata Szilvia Varró (Budapest): Roma, Rechtsextremismus und die Rolle der Medien Julia Váradi (Budapest): Demokratie und Meinungsfreiheit Krisztian Ungváry (Budapest): Rechte Erinnerungen. Geschichtsmythen in der ungarischen Erinnerungspolitik Podiumsdiskussion Ilan Mor (Israelischer Botschafter in Budapest) Ágnes Heller (Philosophin, Budapest) Szilvia Varró (Journalistin, Budapest) András Kovács (Historiker, Budapest) Gedächtnis und Gewalt. Nationale und transnationale Erinnerungsräume im östlichen Europa Internationale Konferenz Juni 2013 Die Konferenz versammelte 23 geladene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich aus geschichts- und literaturwissenschaftlicher, soziologischer, politologischer und juristischer Perspektive mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden europäischer Erinnerungsräume beschäftigten, nach möglichen Fundamenten europäischer Erinnerung fragten und darüber diskutieren, ob es eine europäische Erinnerungsgemeinschaft gibt oder überhaupt geben sollte. Insbesondere ging es dabei auch um die Legitimität sowie die erinnerungspolitische und ethische Stabilität einer europäischen Gemeinschaft, deren Grundlage Gewalt und Vernichtungsgeschehen sind. Ort: Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder Veranstalter: Herbert und Elsbeth Weichmann-Stiftung in Zusammenarbeit mit der Axel Springer-Stiftungsprofessur für deutsch-jüdische Literatur- und Kulturgeschichte, Exil und Migration (Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/ Oder) und dem Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin Grußwort Dr. Gunter Pleuger (Präsident der Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder) Eröffnung Prof. Kerstin Schoor (Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder) Prof. Dan Diner (Jerusalem / Leipzig): Erkenntnis und Erinnerung. Über jüdische Gedächtnisorte in Europa Chair: Prof. Gertrud Pickhan (Berlin) Dr. habil. Birgit Schwelling (Konstanz): Homogenität, Konflikt, Ähnlichkeit. Überlegungen zu Kategorien der Vermessung des europäischen Erinnerungsraums Prof. Walter Schmitz (Dresden): Theresienstadt die Barockstadt als Erinnerungsort des Holocaust Lesung mit der Autorin Irena Brežná (Basel) Moderation: Dr. Dirk Wissen (Stadt- und Regionalbibliothek Frankfurt/Oder) Chair: Prof. Bożena Chołuj (Frankfurt/Oder) Prof. Claus-Dieter Krohn (Hamburg / Lüneburg): Europa-Konzepte des deutschsprachigen Exils Dr. Andree Michaelis (Frankfurt/Oder): Aus dem Holocaust eine europäische Kultur: Verfolgung, Exil und Katharsis bei Imre Kertész Chair: Prof. Stefanie Schüler-Springorum (Berlin) Prof. Marek Kucia (Krakau/Kraków): Die Bedeutungen von Auschwitz in Polen von 1945 bis heute Prof. Jerzy Kałążny (Posen/Poznań):»Sadistisch-pornografische Vision«oder eine»bittere Komödie über Trauma«? Zum Roman»Noc Żywych Żydów«[Die Nacht der lebenden Juden] von Igor Ostachowicz und seiner Aufnahme in Polen Chair: PD Dr. Kirsten Heinsohn (Hamburg) Dr. Katrin Stoll (Warschau/Warszawa): Palimpsest Warszawa: polnische und jüdische Erinnerungszeichen, Formen des Gedenkens und Praktiken der Überschreibung im Stadtraum Muranów Prof. Delphine Bechtel (Paris): Kommemoration im heutigen Galizien: von der selektiven Erinnerung bis zum Revisionismus? Chair: Prof. Kerstin Schoor (Frankfurt/Oder) Dr. Wolf Kaiser (Berlin): Kooperation und Dissens. Gedenkstätten im europäischen Gedächtnisraum. Prof. Jan C. Joerden (Frankfurt/Oder): Aufarbeitung von staatlichem Unrecht durch Strafgerichte oder Wahrheitskommissionen? Roundtable: Verordnete Erinnerung? Die Fragilität einer europäischen Konstruktion Podium: Prof. D. Bechtel (Paris), Prof. G. Pickhahn (Berlin), Prof. J. C. Joerden (Frankfurt/Oder), Dr. K. Erik Franzen (München) Diskussionsleitung: Prof. St. Schüler-Springorum (Berlin) Chair: Prof. Anette Werberger (Frankfurt/Oder) Svetlana Burmistr (Berlin): Der»Große Vaterländische Krieg«fernab vom Heldenmythos:»Der Krieg hat kein weibliches Gesicht«von Svetlana Alexievich als Gegenposition zur sowjetischen Erinnerungspolitik Prof. Stiliyan Jotov (Sofia):»Die Rettung der bulgarischen Juden«70 Jahre Konflikt der Interpretationen Chair: Dr. K. Erik Franzen (München) Frauke Wetzel (Dresden): Erinnerung im lokalen Raum Das Beispiel Usti nad Labem nach 1945 Christian Dietrich (Frankfurt/Oder): Exil in der Heimat. Das Bild von Rudolf Petershagen in den Medien der DDR und das Narrativ vom gewaltfreien Ende des Zweiten Weltkriegs in Greifswald Abschlussdiskussion Kontakte und Kulturtransfer im historischen Raum Ostpreußen ( ) Internationale Tagung September 2013 Wurde die historische Region Ostpreußens in den vergangenen zehn Jahren in erster Linie von den Literaturwissenschaften beziehungsweise aus erinnerungstheoretischer Perspektive thematisiert, so untersuchte die Tagung»Kontakte und Kulturtransfer im historischen Raum Ostpreußen ( )«Identitäten, Loyalitäten und Kulturtransfer in Ostpreußen und der Oblast Kaliningrad vom 18. bis ins 21. Jahrhundert. Ziel der Konferenz war es zudem, die nationale Perspektive aufzubrechen und Ostpreußen stattdessen als multiethnische Region und Ort vielfältiger Identitäten zu verstehen, die von Ost wie West gleichermaßen geprägt wurden. Ort: Thomas-Mann-Kulturzentrum, Nida (Litauen) Veranstalter: Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin, Institut für die Geschichte und Archäologie der Ostseeregion an der Universität Klaipėda, Thomas-Mann-Kulturzentrum, Academia Baltica Gefördert von der Fritz Thyssen Stiftung Begrüßung Silva Pocytė (Leiterin des Instituts für die Geschichte und Archäologie der Ostseeregion, Universität Klaipėda) Zur Geschichte des Thomas-Mann-Hauses in Nida Lina Motuzienė (Thomas-Mann-Kulturzentrum, Nida) Keynote-Vortrag Andreas Kossert (Berlin): Ostpreußen und sein Nachleben. Von der Hartnäckigkeit eines historischen Phänomens Einführende Bemerkungen Stefanie Schüler-Springorum (Berlin), Vasilijus Safronovas (Klaipėda), Klaus Richter (Birmingham) I. Loyalitäten- und Identitätspolitik in Ostpreußen Chair: Vacys Vaivada (Klaipėda) Arūnas Baublys (Klaipėda): Von der Hofkirche bis in die Intellektuelle Elite. Die Reformierten Prediger in Preußen Jahrhundert Darius Barasa (Klaipėda): Konfessionalisierung als Mittel der gesellschaftlichen und kulturellen Integration im Ostpreußen des 18. Jahrhunderts Kommentar: Esther-Beate Körber (Berlin) II. Grenzregionen und Kulturtransfer Chair: Klaus Richter (Birmingham) Jan Musekamp (Frankfurt/Oder): Die Königlich-preußische Ostbahn und die deutsch-polnischen grenzüberschreitenden Beziehungen im 19. Jahrhundert Anna Zglińska (Toruń):»Ein Blick nach Russland«. Mythos und Realität von Grenze und Grenzland zwischen Preußen 78 79
42 Veranstaltungen Veranstaltungen und Russland im 19. Jahrhundert Kommentar: Christian Pletzing (Sankelmark) III. Definition von Raum und räumliche Praxis Chair: Lina Motuzienė (Klaipėda) Axel Walter (Osnabrück): (Re-)Konstruktionen altpreußischer Identität(en) in Ostpreußen. Die Anfänge der regionalen Kulturgeschichtsschreibung (Arnoldt, Lilienthal, Pisanski) im 18. Jahrhundert und ihre Nachwirkungen Nijolė Strakauskaitė (Klaipėda): Kurorte Ostpreußens im Kontext der Geschichte der Popularisierung des Tourismus (19. Jh. erste Hälfte des 20. Jhs.) Vasilijus Safronovas (Klaipėda): Die Schaffung eines nationalen Raums im Preußischen Litauen um 1900 Kommentar: Jörg Hackmann (Szczecin) IV. Interkulturelle Kontakte und der Wandel von einer imperialen zu einer nationalen Ordnung Chair: Silva Pocytė (Klaipėda) Charles Perrin (Atlanta): Zwischen deutscher und litauischer Kultur, zwischen Intelligenzija und Bauerntum. Die intellektuelle Entwicklung von Martynas Jankus ( ) Romualdas Adomavičius (Klaipėda): Der Hafen von Klaipėda als Ort kultureller Kontakte in der Zwischenkriegszeit Andrzej Kopiczko (Olsztyn): Die Katholische Kirche im Memelland Kommentar: Ruth Leiserowitz (Warschau) V. Folgen von Annexionen Chair: Werner Bergmann (Berlin) Stefan Thierfelder (Freiburg): Der Ostdeutsche Heimatdienst und die Volksabstimmungszeit in Ostpreußen. Anfang vom Ende der friedlichen Koexistenz? Machteld Wenken (Vienna): Zwangsarbeitserfahrungen polnischer Kinder in Ego-Dokumenten und Selbstzeugnissen Kommentar: Andrzej Sakson (Poznań) VI. Umschreibungen Ostpreußens Chair: Stefanie Schüler-Springorum (Berlin) Bert Hoppe (Berlin): Kaliningrad als»preußisches Atlantis«Ilya Dementyev (Kaliningrad): Vom»Alten Slavialand«zum»Verlorenen Paradies«. Die Aufarbeitung des kulturellen Erbes im kulturellen Gedächtnis der Bürger Kaliningrads (Ende der 1940er Anfang der 1980er-Jahre) Lina Motuzienė (Klaipėda): Die Vergangenheit als Grundlage kultureller Kontakte. Initiativen gesellschaftlicher Gruppen in Kaliningrad im späten 20. Jh. Kommentar: Stefanie Schüler-Springorum (Berlin) Abschlussdiskussion Moderation: Ruth Leiserowitz (Warschau) Antisemitism in Europe Today: the Phenomena, the Conflicts Internationale Konferenz November 2013 Am 75. Jahrestag der antisemitischen Pogrome vom 9. November 1938 luden das Jüdische Museum Berlin, die Stiftung Erinnerung Verantwortung Zukunft (EVZ) und das Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin zu einer internationalen Konferenz nach Berlin ein. Sie widmete sich aktuellen Erscheinungsformen des Antisemitismus in Europa. Über zwei Tage konnten die über 100 Teilnehmenden fünfzehn Kurzvorträgen von ebenso vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus vierzehn europäischen Ländern folgen. In fünf thematischen Panels stellten sie ihre neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse aus ihrer jeweiligen fachspezifischen Perspektive vor und zur Diskussion. Dabei wurden fünf Erscheinungsformen des gegenwärtigen Antisemitismus vergleichend in den Blick genommen und jeweils entsprechende Länderstudien einander gegenübergestellt. Die Ergebnisse der Konferenz erschienen 2014 im Jahrbuch für Antisemitismusforschung. Ort: Jüdisches Museum Berlin Veranstalter: Jüdisches Museum Berlin, Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft und Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin Welcome Cilly Kugelmann (Jüdisches Museum Berlin) Martin Salm (Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft) Stefanie Schüler-Springorum (Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin) I. Traditional Forms of Antisemitism in Europe András Kovács: Hungary Anatoly Podolski: Ukraine Henrik Bachner: Sweden Chair: Christhard Hoffmann II. Remembering the Holocaust and Antisemitism Jolanta Ambrosewicz-Jacobs: Poland Gintare Malinauskaite: Lithuania Margit Reiter: Austria Chair: Juliane Wetzel Public Lecture Brian Klug: What do we mean when we say»antisemitism«? Comment: Detlev Claussen III. New Antisemitism Criticism of Israel or Antisemitism? Peter Ullrich: Germany David Feldmann: Great Britain Dilek Güven: Turkey Chair: Sergey Lagodinsky IV. Anti-Judaism Religion and anti-jewish and pro-israeli Reactions Michał Bilewicz: Poland Nikolai Mitrokhin: Russia Anna Menny: Spain Chair: Rainer Kampling V. Antisemitism in the Context of Racism and Hostility towards other Minorities Evelien Gans: Netherlands Jean-Yves Camus: France Lenka Bustikova: Slovakia Chair: Werner Bergmann Closing remarks Stefanie Schüler-Springorum Antisemitism in Greece: Past and Present Trajectories Internationale Konferenz Juli 2014 Der Antisemitismus kennt im heutigen Griechenland verschiedene Erscheinungsformen. Sowohl traditionelle als auch moderne Ausdrücke des Judenhasses haben hier eine lange Geschichte. Die verschiedenen Aspekte antisemitischer Stereotype, Ressentiments und Vorurteile innerhalb der griechischen Gesellschaft zu diskutieren, das war das Ziel der im Juli 2014 stattgefundenen Konferenz. Die Beiträgerinnen und Beiträger beleuchteten dabei die religiöse, politische, wirtschaftliche und soziale Dimension des Phänomens. Ort: Technische Universität Berlin Veranstalter: Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin, Centrum Modernes Griechenland der Freien Universität Berlin (CeMoG), National Centre for Social Research, Athens (EKKE) Opening Remarks Stefanie Schüler-Springorum (Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin) Miltos Pechlivanos (Centrum Modernes Griechenland der Freien Universität Berlin) Nicolas Demertzis (National Centre for Social Research Athen) Key Note Speech Minna Rozen (University of Haifa): Antisemitism in Greece: New Perspectives on Old Prejudices I. The Inter-War Years and Antisemitism Chair: Kostas Sarris (Freie Universität Berlin) Rena Molho: The Close Ties between Nationalism and Antisemitism: The Hellenisation of Salonika, Paris Papamichos Chronakis (Brown University, Providence):»Vipers«and»Snakes«,»Komitadjis«and»Pseudo-Nationalists«: Anti-Zionist Discourses in Interwar Greece Maria Vassilikou (Institut für Zeitgeschichte, Berlin): Exit-Voice-Loyalty: Jewish Responses to Antisemitism in Salonika II. The Holocaust and its Aftermath Chair: Atina Grossmann (Humboldt-Universität zu Berlin) Leon Saltiel (University of Macedonia, Thessaloniki): Local-Decision Making and the Holocaust: The Case of Thessaloniki Stratos Dordanas (University of Macedonia, Thessaloniki): Service for the Disposal of Jewish Property (YDIP): German Intervention and Profitable Procedures Gabriella Etmektsoglou (New York University Berlin): Survivors Unwanted: Postwar Antisemitism in Southeastern Europe: The Case of Greece Giorgos Antoniou (International Hellenic University, Thessaloniki): Holocaust Survivors and Memory of the Holocaust 80 81
43 Veranstaltungen Veranstaltungen III. Greek Political Culture and Antisemitism Chair: Marcus Funck (Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin) Jean Cohen (Journalist): Left Antisemitism in Greece, Despina Papadimitriou / Vassiliki Georgiadou (Panteion University of Athens): Antisemitism in the Greek Far Right after 1974 Elias Dinas / Spyros Kosmidis (University of Oxford): Antisemitism in Greece: Evidence from a Survey Experiment IV. Antisemitism and Greek Society Chair: Werner Bergmann (Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin) Nicolas Demertzis (National Centre for Social Research, Athens): Holocaust and Social Trauma in Greece Today Tassos Anastassiadis (McGill University, Montreal): Greek-Orthodox (political) Theology and Antisemitism: An Interwar Greek-German Debate and its Present Legacy Tobias Blümel (Freie Universität Berlin): Forms of Antisemitism in the Media in Contemporary Greece Nikos Zaikos (University of Macedonia, Thessaloniki): An Unstipulated Case. Holocaust Denial and the Greek Legal Order V. Antisemitism in Europe Chair: Rainer Liedtke (TU Darmstadt) Juliane Wetzel (Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin): Italy Anna Menny (Institut für die Geschichte der Deutschen Juden, Hamburg): Spain Albena Taneva (Sofia University): Bulgaria Katerina Kralova (Charles University Prag): Greece Workshops Kolonialismus und Nationalsozialismus Potenzial und Problematik des Vergleichs Interner Workshop 3. Mai 2013 Gegenwärtig hat die Frage nach dem Verhältnis zwischen Kolonialismus und Nationalsozialismus Konjunktur. Dies lässt sich zum einen auf die verstärkte Aufmerksamkeit zurückführen, die die Geschichte des deutschen Kolonialismus nicht zuletzt in Folge des Imports der»postcolonial Studies«seit einigen Jahren erfährt. Zum anderen stellt sich im Zuge von Migration und Globalisierung zunehmend die Herausforderung, ehedem national und mehrheitsgesellschaftlich orientierte Erinnerungspolitiken neu zu verhandeln und entsprechend unterschiedliche Gewalterfahrungen aufeinander zu beziehen. Im Workshop wurden laufende Forschungsarbeiten vorgestellt, die sich allesamt mit dem Verhältnis zwischen Kolonialismus und Nationalsozialismus beziehungsweise Kolonialrassismus und Antisemitismus befassen. Ausgehend von diesen Forschungsarbeiten wurden ethische, konzeptionelle und methodologische Fragen und Probleme diskutiert. Ort: Zentrum Jüdische Studien Berlin-Brandenburg Veranstalter: Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin (Felix Axster) Multiculturalism in historical perspective: Germany in the 20th and 21st Century Interner Workshop September 2013 Im Rahmen der Kooperation mit der Universität Haifa, dem Pears Institute for the Study of Antisemitism, Birbeck College in London, Nonna Meyer vom CNRS-CEE (Centre for European Studies), Sciences Po, Paris und Kollegen aus Madrid hat das ZfA im September 2013 in Berlin an der Technischen Universität einen Workshop zu»multiculturalism in historical perspective: Germany in the 20th and 21st Century«organisiert, der Theorie und Praxis zusammenbrachte. Wissenschaftliche Beiträge und Berichte aus der praktischen Erfahrung einer Reihe von NGOs, die im Bildungsbereich zum Thema arbeiten, ergänzten sich gegenseitig. Ort: Technische Universität Berlin Veranstalter: Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin Welcome and Introduction Stefanie Schüler-Springorum Marcel Berlinghoff: Exclusive Integration? Migration regimes in 20th century Germany Andreas Kossert: A New Cultural Pluralism? Germany and its refugees after Challenges and changes to postwar society Urmila Goel: The Recruitment of Workers German Migration Histories Patrice Poutrus: Asylum in Post-war Germany. Refugee admission policies and their practical implementation in the Federal Republic and the GDR Dorothee Wierling: West Germans, East Germans,»Foreigners«. Ethnic conflicts after German unification Andreas Zick: Blatant and Subtle Antisemitism in Post-War Germany societal and social psychological roots of a traditional enmity Karen Körber: Russian Jews in Germany after 1989 Yasemin Shooman: Phobia, Racism, Religious Intolerance how to conceptualize hostility towards Islam and Muslims Juliane Wetzel: Forms of Antisemitism Today and the Internet as Tool for Spreading Propaganda Sergej Lagodinsky: Confronting Antisemitism: German law between history and diversity Presentation of Berlin Projects: Anne Goldenbogen / Aycan Demirel: Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus e.v. Sawsan Chebli: Jung, Muslimisch, Aktiv Hanne Thoma: Task Force Education on Antisemitism / American Jewish Committee Elke Gryglewski: Haus der Wannsee-Konferenz Esra Kücük: Junge Islam Konferenz World War I: A Turning Point in the History of Antisemitism? Internationaler Workshop 26. Juni 2014 Der internationale Workshop war aktuellen Forschungsfragen und methodischen Zugängen zur Geschichte des Ersten Weltkriegs gewidmet. Doktorandinnen und Doktoranden des am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin angesiedelten Forschungskollegs»Der Erste 82 83
44 Veranstaltungen Veranstaltungen Weltkrieg und die Konflikte der europäischen Nachkriegsordnung ( )«hatten dabei Gelegenheit, sich mit international renommierten Forschern aus Israel, Polen, Kanada und Ungarn bezüglich ihrer Forschungsansätze und -ergebnisse auszutauschen. Ort: The Hebrew University of Jerusalem Veranstalter: Leonid Nevzlin Research Center for Russian and East European Jewry, The Hebrew University of Jerusalem; Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin; The Cummings Center for Russian and East European Studies, Tel Aviv University; The Stephen Roth Institute for the Study of Contemporary Antisemitism and Racism, Tel Aviv University Greetings and Introduction: Ulrich Wyrwa Iris Rachamimov Semion Goldin I. Germany and Its Jews Chair: Ofer Ashkenazi Carl-Eric Linsler: Jewish Family History as a Comparative Approach to the Jewish Experience of the First World War Kalman Weiser: Shifting Relevance of Yiddish during and after WWI and Its Role in the Ideologies of German Yiddish Researchers Who Later Became Nazi Scholars II. The»Jewish Question«in Russia and Poland Chair: Ela Bauer Semion Goldin: The Jewish Policy of Russian Authorities as a Case Study of the Systemic Crisis in the Russian Empire, Grzegorz Krzywiec: The Attitude of Polish Nationalism Towards the Jewish Question in WWI and Its Aftermath: Rethinking the Genesis of Fascism in Poland III. Hungarian Jewry and the Great War Chair: Iris Rachamimov Ilse Lazaroms: Between Lamentation and Loyalty: The Hungarian Jewish Predicament in the Wake of the Great War Tamás Kohut: Antisemitism in Hungary during the First World War: The Decisive Home Front IV. West European Perspectives Chair: Guy Miron Marie-Christin Lux: Gender and Experiences of War in Writings of French Jewish Intellectuals: The Correspondence of Robert and Alice Hertz Yasmina Zian: Consequences of the First World War on the Construction of the Image of Jewish Foreigners. V. South-East European Perspective Chair: Marcos Silber Elisabeth Weber: Battling for Citizenship: The Union of Native Jews and the Wars in Romania Hana Ćopić: The War Diary of the Jewish Reserve Officer Moša Mevorah, VI. Concluding Discussion Chair: Scott Ury Participants: Iris Rachamimov, Ulrich Wyrwa 9. Europäische Sommer-Universität Ravensbrück:»Asozial«. Kontinuitäten sozialer Stigmatisierung im 20. Jahrhundert Sommer-Universität 31. August September 2014 Seit vielen Jahren veranstaltet die Gedenkstätte Ravensbrück äußerst erfolgreich die Europäische Sommer-Universität Ravensbrück. Das ZfA war im Jahr 2014 erstmals offizieller Kooperationspartner und wird diese Zusammenarbeit auch in den nächsten Jahren fortsetzen. Im Zentrum der 9. Europäischen Sommer-Universität Ravensbrück standen Formen und Geschichte sozialer Stigmatisierung im 20. Jahrhundert. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf der Semantik, insofern als Sprache nicht nur Abbild, sondern zentraler Faktor bei der Formung von Realität ist. Einen weiteren Schwerpunkt stellte der geschlechterhistorische Zugang dar, also die Frage, inwieweit die Kategorien des»asozialen«, des Abweichenden und Deklassierten, immer auch geschlechtsspezifisch konnotiert sind. Ein Interesse an den Gesellschaftsordnungskonzepten der NS-Zeit hat sich erst in den letzten Jahren entwickelt. Die Erforschung der sozialrassistisch begründeten Verfolgungspraxis ist nach wie vor ein Desiderat. Ziel der 9. Sommer-Universität 2014 war es, mit ihrer Frage nach den Traditionslinien sozialer Stigmatisierung im 20. Jahrhundert zu einer reflektierten Auseinandersetzung mit gegenwärtigen Formen von Ausgrenzung, Stigmatisierung und Verfolgung, auch in West- und Osteuropa, beizutragen. Ort: Technische Universität Berlin und Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück Veranstalter: Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück / Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin Gefördert von: Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg, Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg, Daimler AG I. Auftaktveranstaltung in Berlin:»Asozial«. Kontinuitäten sozialer Stigmatisierung im 20. Jahrhundert Grußwort: Sabine Kunst (Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur in Brandenburg) Moderation: Stefanie Schüler-Springorum (Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin) Gisela Bock (Prof. em., Freie Universität Berlin): Geschlechterdimensionen von»asozialität«in der nationalsozialistischen Rassenpolitik Bodo Mrozek (Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam): Die Figur des Rowdy im Realsozialismus Thomas Etzemüller (Universität Oldenburg): Exklusion und Inklusion im schwedischen Sozialstaat nach 1945 II. Zur Vorgeschichte der nationalsozialistischen Verfolgungspraxis von»asozialen«begrüßung: Insa Eschebach (Gedenkstätte Ravensbrück) Moderation: Stefanie Schüler-Springorum (Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin) Wolfgang Ayaß (Universität Kassel):»Asozial«. Zur Geschichte eines Kernbegriffs sozialer Ausgrenzung Brigitte Kerchner (Freie Universität Berlin): Normal oder anormal? Konstruktionsprozesse seit 1800 Julia Hörath (Humboldt-Universität zu Berlin):»Sichern und Bessern«. Konzeptionelle Anknüpfungspunkte der nationalsozialistischen»asozialen«-verfolgung in den Diskursen der Strafrechts- und Wohlfahrtspflege 1880 bis 1933 Parallele Workshops: Wolfgang Ayaß, Brigitte Kerchner, Julia Hörath Franziska Lamott (Autorin / Supervisorin): Die Bändigung des Weiblichen. Zur Pathologisierung und Kriminalisierung der Frau III.»Asoziale«Häftlinge im KZ Ravensbrück und im»jugendschutzlager Uckermark«Thematische Rundgänge Moderation: Insa Eschebach Alyn Beßmann (KZ-Gedenkstätte Neuengamme): Als»asozial«verfolgte Frauen im KZ Ravensbrück Verena Buser (Humboldt-Universität zu Berlin): Die Sprache der Deklassierung: Die Einweisung junger Frauen in das»jugendschutzlager Uckermark«Moderation: Matthias Heyl (Gedenkstätte Ravensbrück) Marie-Luise Conen (Familientherapeutin):»Immer wieder versucht, eine Existenz aufzubauen...«biographische Forschungen zu einem»asozialen«häftling im KZ Ravensbrück Christa Paul (Sozialpädagogin, Hamburg): Anpassung und Selbstbehauptung. Ein identitätstheoretischer Zugang zur lebensgeschichtlichen Verarbeitung von Fürsorgeerfahrung 1936 bis 1956 Forschungsbörse Moderation: Johanna Kootz Gunnar Richter (Gedenkstätte Breitenau): Mediale Vorstellung der künstlerischen Projekte zur Geschichte Breitenaus auf der documenta (13) IV. Die nationalsozialistische Verfolgung von»asozialen«moderation: Thomas Schaarschmidt (Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam) Patrick Wagner (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg): Deutsche Kriminalisten und deutsche Sinti: Die Erfindung, Erfassung und Verfolgung einer vermeintlich»asozialen«ethnie im 19. und 20. Jahrhundert Elizabeth Harvey (University of Nottingham): Die Konstruktion des»minderwertigen«in der Fotografie im NS Sylvia de Pasquale (Gedenkstätten Brandenburg an der Havel): Als»asozial«inhaftierte Männer im Zuchthaus Brandenburg: Stigmatisierung, Verfolgung und Ermordung durch die Justiz Parallele Workshops: Patrick Wagner, Elizabeth Harvey, Sylvia de Pasquale V. Kontinuitäten sozialer Stigmatisierung nach 1945 Moderation: Andrea Genest (Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde) Thomas Lindenberger (Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam): Kriminalisierung und/oder Resozialisierung? Deutsche (Dis-)Kontinuitäten im Umgang mit»asozialen«nach
45 Veranstaltungen Veranstaltungen Stefan Romey (Vorstandsvorsitzender der Hamburger Stiftung Hilfe für NS-Verfolgte): Entschädigung von»asozialen«in West und Ost Joachim Krauß (Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin):»Asozial«in Zeiten der Umwertung. Bruch oder Kontinuität in Südosteuropa / Rumänien Parallele Workshops: Thomas Lindenberger, Stefan Romey, Joachim Krauß Tucké Royale (Performer) / Franziska Schnoor (Dramaturgin): Zentralrat der Asozialen in Deutschland eine soziale Plastik Moderation: Julia Hörath (Humboldt-Universität zu Berlin) Osteuropa und der Erste Weltkrieg Internationaler Workshop 6. bis 7. November 2014 Doktorandinnen und Doktoranden des Forschungskollegs»Der Erste Weltkrieg und die Konflikte der europäischen Nachkriegsordnung ( )«während des Workshops»Osteuropa und der Erste Weltkrieg«am DHI Warschau, Foto: DHI Warschau Der in Kooperation mit dem Deutschen Historischen Institut Warschau organisierte internationale Workshop diente der Präsentation und Diskussion aktueller Forschungsarbeiten zur Geschichte des Ersten Weltkriegs in Ost- und Westeuropa. Doktorandinnen und Doktoranden des am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin angesiedelten Forschungskollegs»Der Erste Weltkrieg und die Konflikte der europäischen Nachkriegsordnung ( )«hatten dabei Gelegenheit, sich bezüglich ihrer Forschungsansätze und -ergebnisse mit Forscherinnen und Forschern aus Polen auszutauschen. Ort: Deutsches Historisches Institut Warschau Veranstalter: Deutsches Historisches Institut Warschau, Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin Pawel Brudek: Bilder vom Osten in der»deutschen Warschauer Zeitung«Isabelle Daniel: Antisemitismus in der Propaganda rechter Agitatorinnen und Agitatoren der Weimarer Republik Hana Ćopić: Antisemitismus im Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen Karolina Filipowska: Polen und Deutsche gegen Juden. Posener Konfliktebenen in den Jahren Grzegorz Krzywiec: Die polnischen Konservativen und ihr Antisemitismus vor und während des Weltkriegs Stephan Lehnstaedt: Imperialismus in Polen in zwei Weltkriegen Ruth Leiserowitz: Minderheiten in Polen und Litauen während des Ersten Weltkriegs Marie-Christin Lux: Als Jude, als Frau, als Intellektueller Kriegserfahrungen in den Korrespondenzen französischer jüdischer und nicht-jüdischer Ehepaare ( ) Matteo Perrisinotto: Berichterstattung italienisch-jüdischer Zeitungen zum Ersten Weltkrieg Jan-Philipp Pomplun: Deutsche Freikorps: Sozialgeschichte und Kontinuitäten paramilitärischer Gewalt in der Zwischenkriegszeit Thomas Stoppacher: Die Radikalisierung des Antisemitismus in Österreich von 1914 bis 1923 Piotr Szlanta: Wilhelm II und seine polnischen Untertanen Elisabeth Weber: Juden in Rumänien während des Ersten Weltkriegs Yasmina Zian: Ist alles nach dem Krieg anders? Die Entwicklung der Beziehung zwischen den jüdischen Ausländern und dem Staat Belgien ( ) Survivors - Politics and Semantics of a Concept Internationaler Workshop November 2014 Wissenschaftler aus sieben Ländern widmeten sich zwei Tage lang der Figur des»überlebenden«aus interdisziplinärer Perspektive. Die Vorträge thematisierten die Verwendungsweisen und Definitionsversuche des Begriffs im Wandel der Zeit, die Figur des»überlebenden«in der Kunst und seine Rolle für die Literatur- und Geschichtswissenschaft sowie die politische Dimension des Begriffs in der aktuellen Debatte um Restitution und moralische Wiedergutmachung. Ort: Technische Universität Berlin Veranstalter: Zentrum Jüdische Studien und Zentrum für Antisemitismusforschung in Kooperation mit der Wissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft des Leo Baeck Instituts (WAG) Gefördert von: Bundesministerium für Bildung und Forschung, Ernst-Reuter-Gesellschaft der Freunde, Förderer und Ehemaligen der Freien Universität Berlin e.v., Freie Universität Berlin Greetings Stefanie Schüler-Springorum (Zentrum für Antisemitismusforschung) Keynote Lecture Atina Grossmann (Professor of History, Cooper Union New York and DAAD Walter Benjamin Visiting Professor): Remapping Death and Survival Shifting Geographies and Definitions Introduction Alina Bothe (Berlin) / Markus Nesselrodt (Berlin) I. Who is a Survivor? (I) Early Postwar Definitions Chair: Karen Körber (Berlin) Thomas Rahe (Bergen-Belsen): Survival and New Beginnings. Jews and Roma in Bergen-Belsen 1945 Katarzyna Person (Warsaw): Building a Community of Survivors in the Post-War Jewish Honor Courts II. Semantics of Survival Chair: Micha Brumlik (Berlin) Adam Stern (Cambridge): Survival Before Auschwitz. On Rosenzweig and Christianity Linda Asquith (Nottingham):»What did you survive?«an Exploration of the Nature of Being a Survivor and the Concept of a Survivor Hierarchy Zofia Waślicka (Prague): The Use of the Term»Survivor«in Poland III. Politics of Survival Chair: Michael Wildt (Berlin) Susanna Schrafstetter (Vermont): Hidden Jews as a Subgroup of German Holocaust Survivors Antoine Burgard (Lyon / Montréal):»Child to be Placed with a Family who Will Appreciate his Tragic Past«. Early Understandings of Young Survivors and Future Migrants Experiences in Immediate Post-War Europe Benno Nietzel (Bielefeld): The Jewish Claims Conference and Reparations for Holocaust Survivors IV. On Survival in Literature Chair: Eva Lezzi (Berlin) Daniel Pedersen (Stockholm): Surviving through Poetry The Case of Nelly Sachs Andree Michaelis (Frankfurt/Oder): The Survivor as Writer and as Witness or Why Primo Levi Did not Want to Be Called a»survivor«jan Taubitz (Erfurt / Berlin): From Anne Frank to Amy Bellette: How Philip Roth Anticipated the Memory Boom and the Role of the Survivor Keynotes: Survival Post Migration Chair: Stefanie Schüler-Springorum (Berlin) Anne Rothe (Detroit): Survivors Made in America: Intersections of Social Darwinism, Holocaust Memory, and Popular Culture Noam Zadoff (Bloomington): Bridging the Abyss? Holocaust Survivors in Israel V. Who is a Survivor? (II) Responses by Historians Chair: Juliane Wetzel (Berlin) Elisabeth Gallas (Jerusalem): Framing Holocaust Research in New York The Role of Survivor Historians in the Aftermath of World War II Julia Menzel (Lüneburg): Between»Nothing«and»Something«. Narratives of Survival in H. G. Adler s Scholarly and Literary Analysis of the Shoah René Schlott (Potsdam): The Survivor as a Historian. Raul Hilberg ( ) and the Holocaust Historiography VI. Survivors Movements Chair: Atina Grossmann (New York / Berlin) Sebastian Schönemann (Koblenz): The Name Registry as Testimony: About the Commemorative Function of Survivors Early Tracing Services Ran Zwigenberg (Penn State): From the Ashes: Hiroshima, the Holocaust and the Rise of the»survivor«as a Moral Category Closing Remarks Stefanie Schüler-Springorum (Berlin) 86 87
46 Veranstaltungen des Zentrums Veranstaltungen Lesungen und Vorträge Lange Nacht der Wissenschaften 2. Juni 2012 Anlässlich der»langen Nacht der Wissenschaften«stellte das Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin seine Arbeit unter der Überschrift»Integration und Ausgrenzung«vor. Dabei gewährten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ZfA in jeweils halbstündigen Vorträgen einen kurzen Einblick in ihre aktuellen Arbeitsbereiche. Ort: Universitätsbibliothek der TU Berlin Veranstalter: TU Berlin Begrüßung und Einführung: Stefanie Schüler-Springorum Miriam Bistrović: Reaktionen auf den Antisemitismusbericht des unabhängigen Expertenkreises Winfried Meyer: Beseitigung eines Zeugen der Krankenmorde. Die Ermordung des Gendarmeriemeisters a.d. Jakob Küchle im KZ Sachsenhausen Verena Buser: Kindersucharchiv des Internationalen Suchdienstes (IST) in Bad Arolsen Rainer Erb: Antisemitismus, Rassismus und Rechtsterrorismus am Beispiel der Terrorgruppe»Nationalsozialistischer Untergrund NSU«Carl-Eric Linsler: Judenfeindliche Alltagspropaganda von 1880 bis 1945 Svetlana Burmistr:»Das neue Europa unter deutschem Adler«Selbst- und Fremdbilder in der nationalsozialistischen Auslandspropaganda Julika Rosenstock: Über Menschengleichheit und Gleichheitskritik. Erläuterungen zum modernen Gleichheitsideal und der rechtsextremen Kritik daran Frank Görlich: Der schwäbische Heimatdicher Karl Götz und die Juden. Texte und Kontexte Bernward Dörner: Das Tagebuch Friedrich Kellners aus der NS-Zeit Marcus Funck: Rebell oder Volksheld, Geisteskranker oder Freiheitskämpfer? Louis Riel und die umstrittenen Grundlagen der Minderheitenrechte in Kanada»Über die Kennzeichen des Judenthums«Die Deutsche Tischgesellschaft 1811/1812 Szenisches Colloquium 9. Dezember wurden 200 Jahre Emanzipation der Juden in Preußen gefeiert. Das Edikt, das aus Juden Staatsbürger machte, war allerdings schon zu Zeiten seiner Entstehung umstritten und umkämpft unmittelbar in seiner Entstehungszeit gründete sich in Berlin ein Verein, der explizit auch getaufte Juden daran hindern wollte, sich in die Gesellschaft»einzuschleichen«: Die Christlich Deutsche Tischgesellschaft war eine Vereinigung patriotisch gesinnter Männer, die sich 14tägig in einer Kneipe trafen, zum gemeinsamen Essen, Vortrag und Debatte. Als besonderes Format wurden satirisch-politische Tischreden kultiviert, unter denen Achim von Arnims»Kennzeichen des Judentums«die berüchtigste ist. Die Veranstaltung widmete sich der»nachtseite der Emanzipation«, dem Nebeneinander von Aufklärung und Antisemitismus in derselben Gesellschaft, am selben Tisch. Von Hannah Lotte Lund Mit Johanna Spantzel, Maximilian Mann, Janko Danailow, Maria-Danaé Bansen Am Flügel: Sorin Creciun Ort: Mendelssohn-Remise, Berlin Veranstalter: Mendelssohn-Gesellschaft, Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin, Zentrum Jüdische Studien Berlin-Brandenburg Avi Sagi-Schwartz: The Case of the Holocaust: Early Separation and Loss of Parents. Vulnerability and Resilience across Generations Vorlesung 17. Januar 2013 Während des Holocaust waren Minderjährige und Erwachsene mit extrem traumatischen Umständen konfrontiert. Avi Sagi-Schwartz beschäftigt sich in diesem Kontext speziell mit zwei Fragen: Weisen»Child Survivors«, die als Kinder und Jugendliche traumatische Ereignisse wie den Holocaust überlebten, fast siebzig Jahre nach Ende des Krieges noch Spätfolgen dieser Erlebnisse auf? Und wurde das Trauma an die nachfolgenden Generationen weitergegeben? Avi Sagi-Schwartz ist Professor für Psychologie und Leiter des Center for the Study of Child Development and Department of Psychology an der Universität Haifa. In seinem Vortrag am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin präsentierte er Ergebnisse seiner Forschung aus zwei Jahrzehnten. Ort: Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin Veranstalter: Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin»Juden, zur Sonne, zur Freiheit«Eine musikalisch-biografische Revue zum 150. Geburtstag der SPD 6. März 2013 Wer waren die großen jüdischen Namen der Sozialdemokratie, warum engagierten sich jüdische Frauen und Männer auf Seiten der politischen Linken, was konnten sie dort bewirken und welchen Verlauf nahmen ihre oftmals sehr ungewöhnlichen Lebenswege? Anlässlich des 150. Geburtstags der SPD veranstaltete das Jüdische Museum gemeinsam mit der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands eine musikalisch-biografische Revue mit dem Titel»Juden, zur Sonne, zur Freiheit«. Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel, die Sängerin und Schauspielerin Jasmin Tabatabai und viele weitere prominente Gäste führten durch das Leben bekannter jüdischer Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Unter Mitwirkung von Jasmin Tabatabai und Katrin Schüler-Springorum Moderation: Stefanie Schüler-Springorum Ort: Jüdisches Museum Berlin Veranstalter: Jüdisches Museum Berlin gemeinsam mit der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands unter Kooperation des Zentrums für Antisemitismusforschung der TU Berlin und des Arbeitskreises jüdischer Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 88 89
47 Veranstaltungen Veranstaltungen des Zentrums Sander L. Gilman: Die Beschneidung: Identitätspolitik und/oder Gesundheitsfrage? Vortrag 8. Mai 2013 Die aktuelle Debatte über die Knabenbeschneidung in den USA und in Europa kommt immer wieder auf die Frage zurück, ob dieser Eingriff eine positive oder negative Auswirkung auf die Gesundheit hat. Die Geschichte dieser Behauptungen und ihrer Bedeutungen ist nicht so eindeutig, wie beide Seiten es gerne darstellen. Ihr nachzuspüren trägt dazu bei, die ideologischen Beweggründe dieser Debatte aufzudecken. Sander L. Gilman ist Distinguished Professor of the Liberal Arts and Sciences und Professor für Psychiatrie an der Emory University in Atlanta. Ort: Jüdisches Museum Berlin Veranstalter: Jüdisches Museum Berlin in Kooperation mit dem Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin Jonathan Judaken: Critical Theories of Anti-Semitism: Post-Holocaust Reflections on Modernity and Modern Judeophobia Vortrag 29. Mai 2013 Jonathan Judaken stellte am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin sein aktuelles Forschungsprojekt vor, das eine vergleichende Geschichte bedeutender Theorien zur Judeophobie in den Werken von Jean-Paul Sartre, Hannah Arendt, Mitgliedern der Frankfurter Schule, Talcott Parsons, Zygmunt Baumann, Jean-François Lyotard sowie in den Werken der beiden bedeutenden Historiker Léon Poliakov und George Mosse, darstellt. Jonathan Judaken hält den Spence L. Wilson Chair in Humanities am Rhodes College in Memphis, Tennessee. Ort: Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin Veranstalter: Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin Jutta Ditfurth: Der Baron, die Juden und die Nazis. Reise in eine Familiengeschichte Lesung 24. Januar 2014 Jutta Ditfurth las aus ihrem Buch»Der Baron, die Juden und die Nazis. Reise in eine Familiengeschichte«und diskutierte anschließend mit Marcus Funck darüber. Im Mai 1990 reiste Jutta Ditfurth an die Orte ihrer Kindheit und Jugend, die in der DDR lagen, es waren Schlösser, Rittergüter und Großgrundbesitz, mithin geriet die Reise zu einer»fahrt in die feudale Vergangenheit meiner Familie«. Schloß Windischleuba bei Altenburg gehörte bis 1945 dem Urgroßonkel von Jutta Ditfurth, Börries Freiherr von Münchhausen, der in seiner Jugend pro-jüdische Balladen geschrieben und sich zum glühenden Antisemiten gewandelt hatte. Wann und warum, so fragt Jutta Ditfurth, hat sich der Adel dem antisemitischen Lager angeschlossen? Und warum müssen heute die Repräsentanten der Stadt Kohren-Sahlis den»großen Balladendichter«ehren und dessen Judenhass leugnen? Ort: Literaturhaus Berlin Veranstalter: Literaturhaus Berlin in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Antisemititismusforschung der TU Berlin Yair Mintzker: Die vielfachen Tode von Jud Süss: 4. Februar 1738 Öffentlicher Abendvortrag 10. Februar 2014 Yaer Mintzker stellte im Rahmen seines Vortrages sein aktuelles Forschungsprojekt vor, dass sich mit einem der berüchtigsten Ereignisse des achtzehnten Jahrhunderts in Deutschland auseinandersetzt: der Prozess und die Hinrichtung Joseph Süss Oppenheimers, diffamierend auch»jud Süss«genannt, in Stuttgart während der 1730er-Jahre. Yair Mintzker ist Assistant Professor für Geschichte an der Princeton University. Lange Nacht der Wissenschaften 10. Mai 2014 Das Forschungskolleg des Zentrums für Antisemitismusforschung der TU Berlin war zur»langen Nacht der Wissenschaften«mit dem Thema»Die Radikalisierung des Antisemitismus in Europa«vertreten. Doktorandinnen und Doktoranden des Forschungskollegs»Der Erste Weltkrieg und die Konflikte der europäischen Nachkriegsordnung«stellten Flugblätter, Aufrufe und Pamphlete zum Beginn des Krieges aus fünf europäischen Ländern vor. Mit Hana Ćopić, Isabelle Daniel, Carl-Eric Linsler, Marie-Christin Lux, Elisabeth Weber, Yasmina Zian, Werner Bergmann und Ulrich Wyrwa Ort: Universitätsbibliothek der TU Berlin Veranstalter: TU Berlin Novembertage. 5 x 9. November Lesung und Diskussion 9. November 2014 Zum»Schicksalstag der Deutschen«erklärt, fallen auf den 9. November mehrere weichenstellende Ereignisse der deutschen Zeitgeschichte: die Hinrichtung Robert Blums und die gescheiterte Revolution von 1848, die Abdankung des letzten deutschen Kaisers und die erfolgreiche Revolution von 1918, Hitlers Putschversuch von 1923, der Pogrom gegen die deutschen Juden 1938 und schließlich der Fall der Berliner Mauer Bei der im Rahmen der Veranstaltungsreihe»30 Tage Kunst 2014«stattgefundenen Abendveranstaltung, wurden Texte aus den jeweiligen Epochen gelesen und darüber diskutiert, ob der 9. November die bessere Wahl für einen Nationalfeiertag gewesen wäre. Ort: Orangelab Veranstalter: Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin Buchvorstellungen und Ausstellungen Ort: Zentrum für Antisemitismusforschung, TU Berlin Veranstalter: Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin, gemeinsam mit dem Kolloquium Globalgeschichte der FU Berlin 90 91
48 Veranstaltungen Veranstaltungen Die Praxis von Vorurteils- und Gewaltprävention in zwei Berliner Quartieren Vorstellung des Forschungsberichts 22. Januar 2013 Im Auftrag der Landeskommission Berlin gegen Gewalt untersuchte die Arbeitsstelle Jugendgewalt und Rechtsextremismus am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin die Praxis von Vorurteils- und Gewaltprävention bei Kindern und Jugendlichen. Der Fokus der Untersuchung lag dabei auf der konkreten Praxis vor Ort. Untersucht wurden deshalb zwei Quartiersmanagement-Gebiete im Rahmen des Programms»Soziale Stadt«: Moabit-West Beusselstrasse in Mitte und Falkenhagener Feld Ost in Spandau. Die Ergebnisse der Studie wurden im Rahmen einer Veranstaltung der Landeskommission Berlin gegen Gewalt vorgestellt. Mit Michael Kohlstruck, Stefanie Schüler-Springorum, Christian Matzdorf, Elvira Berndt, Jürgen Schendel Ort: Rathaus Charlottenburg, Berlin Veranstalter: Landeskommission Berlin gegen Gewalt, Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin Isabel Enzenbach und Wolfgang Haney: Alltagskultur des Antisemitismus im Kleinformat: Vignetten der Sammlung Wolfgang Haney ab 1880 Buchvorstellung 24. Januar 2013 Auf Briefkästen, Schaufenstern und Liebesbriefen, in Telefonzellen und S-Bahnhöfen, überall klebten sie: kleine antisemitische Marken und Zettel. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts verbreitet, in der Weimarer Republik und in der Zeit des Nationalsozialismus populäres Medium der Selbstmobilisierung, spiegeln die Kleinformate die ganze Themenpalette antisemitischer Propaganda. Mehr als 300 antisemitische Aufkleber, aber auch Marken der Gegenagitation zeigen Alltagskultur und soziale Praxis des Antisemitismus. Mit Isabel Enzenbach und Christoph Kreutzmüller. Ort: Zentrum Jüdische Studien Berlin-Brandenburg Veranstalter: Zentrum Jüdische Studien Berlin-Brandenburg, Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin und Metropol Verlag Die Entstehung des Antisemitismus in der Habsburgermonarchie Symposium und Buchvorstellung 19. März 2013 Während des Symposiums wurden die ersten drei Bände der Reihe»Studien zum Antisemitismus in Europa«, die sich mit drei Regionen der Habsburgermonarchie beschäftigen vorgestellt: Böhmen-Mähren, Kroatien-Slawonien und Galizien. Damit wurde von den Rändern und kleinen Ländern her der Antisemitismus in der Habsburgermonarchie in den Blick genommen. Es wurden die jeweils besonderen Ausprägungen in den cis- und transleitanischen Teilen ebenso erkundet, wie die Zusammenhänge zwischen antisemitischen Stimmungen und sozialen Konflikten. Gefragt wurde nach den spezifischen Ausprägungen der jeweiligen politischen Kultur in den verschiedenen Landesteilen, und was diese für die konkrete Form des Antisemitismus bedeutete. Dabei wurde nicht zuletzt auch die Rolle der katholischen Kirche beleuchtet. Schließlich wurde die These, der zufolge der Antisemitismus in der Habsburgermonarchie allein aus den Nationalitätenkonflikten zu erklären sei, kritisch hinterfragt. Mit Tim Buchen, Michal Frankl, Marija Vulesica und Ulrich Wyrwa. Ort: Universität Graz Veranstalter: Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin in Zusammenarbeit mit dem Centrum für Jüdische Studien an der Karl-Franzens Universität Graz Vertriebene Wissenschaften Die Technische Hochschule Berlin während des Nationalsozialismus Buchvorstellung 10. Juli 2013 Die Ausgrenzung und Vertreibung jüdischer und politisch unliebsamer Wissenschaftler und Studierender sowie die Verhinderung und Entziehung akademischer Grade und Ehrenwürden in der Zeit des Nationalsozialismus gehören zu einem der dunkelsten Kapitel der Vorgängereinrichtung der Technischen Universität Berlin. Das Forschungsprojekt»Vertriebene Wissenschaften an der TH Berlin «am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin setzte sich mit dieser Zeit des Unrechts auseinander. Die Ergebnisse und das Buch»Diskriminierung, Ausgrenzung, Vertreibung: Die Technische Hochschule Berlin während des Nationalsozialismus«, für das Carina Baganz verantwortlich zeichnete, wurden 2013 öffentlich an der TU Berlin vorgestellt. Das Projekt wurde von der Gesellschaft von Freunden der TU Berlin e.v. ideell und finanziell unterstützt. Mit Carina Baganz, Manfred Gentz, Filiz Dagci Ort: TU Berlin Veranstalter: TU Berlin Peter Ullrich: Deutsche, Linke und der Nahostkonflikt. Politik im Antisemitismus- und Erinnerungsdiskurs Buchvorstellung und Podiumsdiskussion 31. Oktober 2013 Linke Nahostdiskurse im Spannungsfeld von Erinnerungszwang und Erinnerungsabwehr immer wieder wird in Deutschland kontrovers diskutiert, ob, wann und warum israelkritische Positionen zum Nahostkonflikt nur kaschierter Antisemitismus seien. Peter Ullrich beleuchtet neue Perspektiven: Einerseits haben Lernprozesse der vergangenen Jahrzehnte dazu geführt, dass die linke Nahostdebatte in Deutschland heute komplexer und ausgewogener ist denn je. Andererseits bleiben doch die Gefahren für eine universalistische linke Position erkennbar. Immer wieder droht der Umschlag ins Partikulare, sei es in Form von Antisemitismus, Rassismus, Islamfeindlichkeit oder extremer Überidentifikation mit Konfliktakteuren. Aus wissenssoziologischer und diskursanalytischer Perspektive untersucht der Autor verschiedene Aspekte des deutschen Blicks auf den Nahostkonflikt. Ort: Rosa-Luxemburg-Stiftung, Berlin Veranstalter: Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin und Rosa-Luxemburg-Stiftung, Berlin Mit Peter Ullrich, Werner Bergmann und Micha Brumlik Handbuch des Antisemitismus Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart, Band 6 Buchvorstellung 17. Dezember 2013 Der 6. Band des auf sieben Bände angelegten»handbuchs des Antisemitismus«versammelt rund 450 Beiträge über antisemitische Publikationen aus aller Welt, die als Perio- dika wie»der Stürmer«oder»La France Juive«, als Einzelschriften wie Martin Luthers»Von den Juden und ihren Lügen«und»Ains Juden buechlins verlegung«seines katholischen Widersachers Johannes Eck den Antijudaismus und den Antisemitismus maßgeblich beeinflussten. Es wurden auch Publikationen aufgenommen, deren Ziel der Kampf gegen den Antisemitismus war. Dazu gehören die»abwehrblätter«, Émile Zolas»J accuse!«oder die C. V.-Zeitung. Von historischen literarischen Mythen wie der Legende von Ahasver, dem»ewigen Juden«, reicht die Skala der Topoi bis zu aktuellen Manifesten der Holocaust-Leugnung und des Antizionismus. Mit Wolfgang Benz und Ehrhart Körting Ort: Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen beim Bund Veranstalter: Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin und De Gruyter-Verlag Elke Gryglewski: Anerkennung und Erinnerung. Zugänge arabisch-palästinensischer und türkischer Berliner Jugendlicher zum Holocaust Buchvorstellung 5. Mai 2014 Dass Jugendliche palästinensischer und türkischer Herkunft die Beschäftigung mit der Shoah mehrheitlich ablehnen und sich bei diesem Thema antisemitisch äußern, ist eine weitverbreitete Meinung. Elke Gryglewski, seit 1995 wissenschaftlich-pädagogische Mitarbeiterin in der Gedenkund Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz, stellt die Gegenthese auf, dass sich auch diese Jugendlichen für den Holocaust interessieren und Empathie für die Opfer entwickeln, wenn sie sich mit ihren Familiengeschichten anerkannt fühlen. In mehrmonatigen Projekten arbeitete sie als Pädagogin der Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz mit Jugendlichen aus diesen Communities. Ihr begleitendes Forschungsprojekt zeigt, wie sie tatsächlich Zugänge zur Geschichte des Nationalsozialismus und der Shoah fanden. Dieser Befund ist nicht nur für das Lernen über die Geschichte der Shoah relevant. Auch die Frage, wie pädagogische Antworten auf neue Formen des Antisemitismus aussehen könnten, ist hier berührt. Ort: Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin Veranstalter: Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin 92 93
49 Veranstaltungen Veranstaltungen Angezettelt. Antisemitismus im Kleinformat Ausstellung 6. Juni bis 21. September 2014 Sie kleben fast überall: Klebemarken, Aufkleber oder»spuckis«. Seit dem späten 19. Jahrhundert gibt es die kostengünstigen Sticker. Von Beginn an werden sie gesammelt, getauscht und im öffentlichen Raum verbreitet. Als Möglichkeit der politischen Agitation erfreut sich das neue Medium bei Antisemiten großer Beliebtheit. Auf Briefkästen, Schaufenstern und Liebesbriefen, in Telefonzellen und S-Bahnhöfen begegnen die Menschen den judenfeindlichen Bildern und Parolen. Doch jüdische Organisationen und Vereine wehren sich bald gegen diese Hetze und bekämpfen öffentlich die antisemitische Propaganda. Das Museum für Kommunikation zeigte in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Antisemitismusforschung erstmals mehrere Hundert solcher Marken aus der Sammlung Wolfgang Haney. Ort: Museum für Kommunikation Frankfurt Kooperationspartner: Zentrum für Antisemitismusforschung, Museum für Kommunikation Frankfurt Vorträge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Axster, Felix Kolonialismus und Nationalsozialismus - Potenzial und Problematik des Vergleichs (Zentrum Jüdische Studien Berlin-Brandenburg, Mai 2013) Working on Whiteness. Notions of Productivity in German Colonialism and National Socialism (Birkbeck, University of London, März 2014) Work, Colonial Racism and Anti-Semitism. Historical Relations (Association for Jewish Studies, Baltimore, Dezember 2014) Baganz, Carina Diskriminierung, Ausgrenzung, Vertreibung: Die Technische Hochschule Berlin während des Nationalsozialismus (TU Berlin, Juli 2013) Befreiung des Konzentrationslagers Wöbbelin (KZ-Gedenkstätte, Wöbbelin, Mai 2014) Bergmann, Werner The Negations of Emotion in Modern Anti-Semitism: The»Antisemitismus der Vernunft«(Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin, April 2012) Begleitprogramm: 17. Juni 2014 Vortrag von Peter Steinbach: Der Widerstand des 20. Juli 1944 und die Haltung der Akteure zum Antisemitismus 30. Juni 2014 Öffentlicher Vortrag von Prof. Christian Wiese: Christlicher Antijudaismus und moderner Antisemitismus: Kontinuitäten und Diskontinuitäten 19. Juli 2014 Netzwerkstatt: Rechtsradikalismus im Netz Wölfe auf der Datenautobahn von der Freiheit im Netz 21. September 2014 Finissage/Podiumsdiskussion: Antisemitismus und Gegenwehr. Schauplatz Medien Mit Detlev Claussen, Ulrike Weckel, Isabel Enzenbach und Marcus Funck Eröffnung der Ausstellung»Angezettelt«im Museum für Kommunikation Frankfurt am Main, Foto: Dirk Ostermeier, Museum für Kommunikation Frankfurt am Main Problems of Comparative Research on Anti-Semitic Attitudes (Schloss Herrenhausen, Hannover, April 2013) Problems of German-Jewish Emigrants on Their Return to Post-War Germany (Universität Bergen, Juni 2013) Ćopić, Hana Juden als ideale Jugoslawen. Antisemitismus im Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen? (Zentrum für Antisemitismusforschung, Berlin, Mai 2014) Das Kriegstagebuch des jüdischen Reserveoffiziers Moša Mevorah (Lange Nacht der Wissenschaften, TU Berlin, Mai 2014) Homophobia as social impotence and tool of political manipulation in former Yugoslavia (Humboldt-Universität zu Berlin, Juni 2014) The War Diary of the Jewish Reserve Officer Moša Mevorah, (Hebrew University, Jerusalem, Juni 2014) 94 95
50 Veranstaltungen Veranstaltungen Antisemitismus im Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen (Deutsches Historisches Institut Warschau, November 2014) Daniel, Isabelle»Now we are scarred.«the 1916»Jew Census«and its Impact on Post-War Anti-Semitism in Germany (Universität Warschau, Mai 2013) Die Kriegserfahrung jüdischer Soldaten in Deutschland während des Ersten Weltkriegs (Lange Nacht der Wissenschaften, TU Berlin, Mai 2014) Antisemitismus in der Propaganda rechter Agitatorinnen und Agitatoren in der Weimarer Republik (Deutsches Historisches Institut Warschau, November 2014) Enzenbach, Isabel Pre-Unification Germany (University of Cambridge, März 2013) Antisemitismus im Kleinformat. Alltagspropaganda seit 1880 (Universität Salzburg, Mai 2013) The role of evaluation (OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, Warschau, Mai 2013) Antisemitism Today (Yad Vashem, Jerusalem, Oktober 2013) Juden im Kampf um den öffentlichen Raum (Zentrum Jüdische Studien Berlin-Brandenburg, November 2013) Anti-semitic propaganda in the public sphere in the German Kaiserreich and the Weimar Republic (Yad Vashem, Jerusalem, Dezember 2013) War je ein großer Geist Antisemit? (Museum für Kommunikation, Frankfurt am Main, Juni 2014) Deutsch-jüdisch-israelische Beziehungsgeschichten (Ben-Gurion University of the Negev, Be er Sheva, September 2014) Medien und Zivilgesellschaft bei der Verbreitung, Perpetuierung und Dekonstruktion judenfeindlicher Stereotype (Museum für Kommunikation, Frankfurt am Main, September 2014) Antisemitismus ausstellen? (Zentrum Jüdische Studien Berlin-Brandenburg, Oktober 2014) Antisemitismus ausstellen? (Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk, Neversdorf, November 2014) Antisemitismus ausstellen? (Universität Osnabrück, November 2014) Neue Qualität oder Déja Vu? (Europäische Janusz Korczak Akademie, München, November 2014) Visual Practices in Anti-Semitic Street Art (Association for Jewish Studies, Baltimore, Dezember 2014) Filipowska, Karolina Polen und Deutsche gegen Juden. Posener Konfliktebenen in den Jahren (Deutsches Historisches Institut Warschau, November 2014) Funck, Markus Sektionskommentar (University of Cambridge, März 2013) Sektionskommentar (Universität Konstanz, September 2013) Gailus, Manfred Der Protest der Protestantinnen. Die Frauen der Bekennenden Kirche (Christuskirche Dresden-Strehlen, April 2014) Die protestantische Historikerin und Pädagogin Dr. Elisabeth Schmitz und ihre Denkschrift gegen die Judenverfolgung (1935/36) (Thomaszentrum der Ev. Kirchengemeinde Querenburg, Bochum, Mai 2014) 80 Jahre Barmer Bekenntnissynode 1934 (Luisenkirche Berlin, Mai 2014) Pogroms in Early 19th Century Germany (The Wiener Library for the Study of the Holocaust and Genocide, London, Mai 2014) Aufruf zum Heiligen Krieg. Der Berliner Domprediger Bruno Doehring und der Erste Weltkrieg (Lepsiushaus Potsdam, Oktober 2014) 1939 Kirche im Nationalsozialismus (Herrnhuter Brüdergemeine Berlin-Neukölln, November 2014)»Mir aber zerriss es das Herz!«Elisabeth Schmitz und ihre Denkschrift gegen die Judenverfolgung (Kirchengemeinde Reinbek b. Hamburg, November 2014) Mit Herz und Verstand Protestantische Frauen im Widerstand gegen die NS-Rassenpolitik (Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Berlin-Spandau, November 2014) Kirchliche Machtergreifung als politisch-religiöses Erweckungserlebnis (Bildungswerk der Humanistischen Union NRW, Wuppertal, November 2014) Grüttner, Michael Die deutschen Universitäten im Dritten Reich (Universität Münster, März 2013) Stand und Säumnisse der deutschen NS-Forschung: Die Geisteswissenschaften (Leopold-Wenger-Institut für Rechtsgeschichte, Ludwig Maximilians Universität München, Oktober 2013) Die»Machtergreifung«an den Universitäten (Ruhr-Universität Bochum, Januar 2014) La Primera Guerra Mundial y el nacimiento del Nacional Socialismo (Universitat Autònoma de Barcelona, Mai 2014) Die studentischen Korporationen und der Nationalsozialismus (Landeszentrale für politische Bildung Thüringen, Eisenach, Juni 2014) Berufungen und Berufungspolitik an der Berliner Universität (Interdisziplinäres Zentrum für Wissenschafts- und Technikforschung, Bergische Universität Wuppertal, September 2014) Güven, Dilek Antisemitism in Turkey (Jüdisches Museum Berlin, November 2013) Die Istanbuler Pogrome vom September 1955 (Lepsiushaus Potsdam, Oktober 2014) Kohlstruck, Michael Holocaust? Erinnerungspolitik im deutschen Rechtsextremismus der Gegenwart (Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, Heidelberg, Januar 2012) Zielobjekt Kommune: Rechtsextreme Gedenkveranstaltungen im ländlichen Raum (Otto-von-Bismarck-Stiftung, Außenstelle Schönhausen, Februar 2012) Aktuelle Tendenzen im Rechtsextremismus (Bundeszentrale für politische Bildung, Berlin, März 2012) Ziviler Ungehorsam eine symbolische Macht (Landespräventionsrat Sicherheitsoffensive Brandenburg, Potsdam, April 2012) Kontinuität und Veränderungen im aktuellen Rechtsextremismus (Fachtag gegen Rechtsextremismus, Cottbus, Mai 2012) Kontinuität und Veränderungen im aktuellen Rechtsextremismus (Quartiersmanagement Moabit-West, Stadtteilplenum, November 2012) Rechtsextremismus in der Bundesrepublik Deutschland aktuelle Entwicklungen (Diakonie Deutschland, Berlin, Dezember 2012) Jugendlicher Rechtsextremismus Wo muss Prävention ansetzen? (Landkreis und Hansestadt Lüneburg, Dezember 2012) Die SS in der kulturellen Praxis des heutigen Rechtsextremismus (Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung, TU Dresden, Dezember 2012) Rechtsextreme / vorurteilsmotivierte Gewalt und Möglichkeiten ihrer Prävention (Landespräventionsrat Brandenburg / Landeskommission Berlin gegen Gewalt, Potsdam, Juni 2013) Rechtsextreme Jugendkulturen (Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn, Juni 2013)»Schwierige Jungs«- zufriedene Männer. Zur Bedeutung von Selbstkompetenz und Männlichkeit (Manne e.v., Lübbenau, Oktober 2013) Gefahr aus der Mitte. Herausforderungen des Rechtsextremismus (Protestantischer Männerverein Kaiserslautern, November 2013) 96 97
51 Veranstaltungen Veranstaltungen Wie man heute in Deutschland über Antisemitismus spricht: Der Antisemitismus-Bericht des Expertenkreises an den Deutschen Bundestag (2011) (RWTH Aachen, Januar 2014) Rechtsextremismus als pädagogische Herausforderung (RAA Brandenburg, Potsdam, März 2014) Vortrag zur Expertise des Handlungskonzepts der Landesregierung»Tolerantes Brandenburg für eine starke und lebendige Demokratie«(Aktionsbündnis Brandenburg, Potsdam, Juli 2014) Inklusion Variationen über ein Thema (Demokratie, Integration, Brandenburg e.v., Seddin, August 2014) Was macht rechte Jugendkulturen attraktiv? Soziale Dynamiken und politische Rahmenbedingungen (Deutsch-Französisch-Schweizerische Oberrheinkonferenz, Pirmasens, September 2014) Die Funktionen von Fremdenfeindschaft und Antisemitismus in der rechtsextremen Bewegung (zusammen mit Rainer Erb, Zentrum Technik und Gesellschaft, TU Berlin, Oktober 2014) Alternativen anbieten. Sozial- und Bildungsarbeit als Antwort auf Extremismen (Brücke Köprü / Degrin e.v. / Muslimische Studierendengemeinschaft Europa, Nürnberg, Oktober 2014) Herausforderungen für deutsche Kommunen (Stadt Ludwigshafen am Rhein, November 2013)»Asozial«in Zeiten der Umwertung. Bruch oder Kontinuität in Südosteuropa / Rumänien (Europäische Sommer-Universität Ravensbrück, August / September 2014) Linsler, Carl-Eric Judenfeindliche Alltagspropaganda von 1880 bis 1945 (Lange Nacht der Wissenschaften, TU Berlin, Juni 2012) Jüdische Identitäten während des Ersten Weltkriegs. Frankreich und Deutschland im Vergleich (Zentrum für Antisemitismusforschung, Januar 2013) Loyalitätskonflikte und Positionierungen deutscher Juden zum Ersten Weltkrieg (Lange Nacht der Wissenschaften, TU Berlin, Mai 2014) Jüdische Familiengeschichte als transnationale Verflechtungsgeschichte: Die Familie Frank und der Erste Weltkrieg (Fritz-Bauer-Institut, Frankfurt am Main, Juni 2014) Jewish Family History as a Comparative Approach to the Jewish Experience of the First World War (London Jewish Museum, Juni 2014) Jewish Family History as a Comparative Approach to the Study of Anti-Semitism during the First World War (Hebrew University, Jerusalem, Juni 2014) Gender and experiences of war in writings of French Jewish intellectuals The correspondence of Robert and Alice Hertz (Hebrew University, Jerusalem, Juni 2014) Un antisémitisme caché? La complexité des expériences de guerre dans les correspondances des couples juifs et non-juifs (Historial de la Grande Guerre Péronne, Juni / Juli 2014) Als Jude, als Frau, als Intellektueller Kriegserfahrungen in den Korrespondenzen französischer jüdischer und nicht-jüdischer Ehepaare ( ) (Deutsches Historisches Institut Warschau, November 2014) Maier-Wolthausen, Clemens Kindertransports to Sweden. Reaching out across the Baltic (University of Uppsala, November 2014) Flucht nach Schweden. Peter Blachsteins Exiljahre (Geschichtswerkstatt Eimsbüttel, Hamburg, November 2014) Kindertransporte nach Schweden. Hilfe über die Ostsee (Zentrum Jüdische Studien Berlin-Brandenburg, Dezember 2014) Meyer, Winfried Beseitigung eines Zeugen der NS-Krankenmorde: Die Ermordung des Gendarmeriemeisters a. D. Jakob Küchle im KZ Sachsenhausen (Lange Nacht der Wissenschaften, TU Berlin, Juni 2012) Über Menschengleichheit und Gleichheitskritik. Erläuterungen zum modernen Gleichheitsideal und der rechtsextremen Kritik daran (Lange Nacht der Wissenschaften, TU Berlin, Juni 2012) Zum Wandel des Rechtsstaats durch den Rechtsradikalismus (Deutsche Gesellschaft für Soziologie, Ruhr Universität Bochum, Oktober 2012) Rechtliche Aspekte der Beschneidungsdebatte (Zentrum für Antisemitismusforschung, September 2013) Schüler-Springorum, Stefanie Treulose Frauen Sanfte Männer. Überlegungen zur deutsch-jüdischen Geschlechtergeschichte (Universität Wien, März 2012) Génesis y actualidad del antisemitismo moderno (Consejo Superior de Investigaciones, Madrid, März 2012) La guerra como aventura: la Legión Condor en España (Universidad del País Vasco, Bilbao, April 2012) Genesis and Contemporary Relevance of Modern Anti-Semitism (Hebrew University, Jerusalem, Juni 2012) Sektionsleitung: Schuld Sühne Recht: Gerechtigkeitsvorstellungen, Rachephantasien und juristische Interventionen um 1945/46 (Deutscher Historikertag, Mainz, September 2012) Erfassung politisch motivierter Kriminalität (Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen im Deutschen Bundestag, Berlin, November 2014) Rechtsextremismus als pädagogische Herausforderung (RAA Brandenburg, Potsdam, November 2014) Die AfD politische Einschätzung einer neuen Partei (DGB Brandenburg, Flecken Zechlin, November 2014) Kohut, Tamás Antisemitism in Hungary during the First World War: The Decisive Home Front (Hebrew University, Jerusalem, Juni 2014) Krauß, Joachim Unterwegs in Europa, Wanderungsbewegungen und ihre Lux, Marie-Christin Versteckter Antisemitismus? Die Umsetzung der Union sacrée in Frankreich während des Ersten Weltkrieges (Zentrum für Antisemitismusforschung, Februar 2013) Versteckter Antisemitismus? Französisch-jüdische Beziehungen im Zeichen der Union sacrée während des Ersten Weltkrieges (Freie Universität Berlin, Dezember 2013) Die Kriegserfahrung jüdischer Soldaten in Frankreich während des Ersten Weltkriegs (Lange Nacht der Wissenschaften, TU Berlin, Mai 2014) Gender and experiences of war in writings of French Jewish intellectuals The correspondence of Robert and Alice Hertz (London Jewish Museum, Juni 2014) Rudolf Karl von Ripper:»Ècraser l infâme!«haft im Columbia-Haus und im KZ Oranienburg und ihre künstlerische Verarbeitung (Förderverein zum Gedenken an die NS-Verbrechen auf und um das Tempelhofer Flugfeld e.v., Berlin, November 2012) Rohde, Achim Geschlechterdimensionen im Nahostkonflikt und in seiner Wahrnehmung in Deutschland (Blickwinkel-Tagung, Köln, Oktober 2012) Rosenstock, Julika Warum Gleichheitskritik im Zeitalter der Gleichheit? Eine rechtsphilosophische Antwort (Zentrum für Antisemitismusforschung, April 2012) The Witness and the Holocaust Oral Testimonies and Historical Knowledge (The Pears Institute for the Study of Anti-Semitism, London, Oktober 2012) Männer, Frauen, Emanzipation? Deutsch-jüdische Geschlechterbeziehungen im langen 19. Jahrhundert (Freie Universität Berlin, Januar 2013) The Witness and the Holocaust. Oral Testimonies and Historical Knowledge (European Holocaust Research Infrastructure Advisory Board Meeting, Amsterdam, April 2013) Was wir alles nicht wissen. Deutsche-jüdische Geschlechtergeschichte im langen 19. Jahrhundert (Centre for Gender and Diversity, Maastricht University, Mai 2013) 98 99
52 Veranstaltungen Veranstaltungen Nationale Schande, Universelle Lehre: Die Darstellung von Nationalsozialismus und Holocaust in Museen (Universität Kopenhagen, Mai 2013) Alter Wein in neuen Schläuchen? Perspektiven der Antisemitismusforschung (Zentrum für Zeithistorische Forschung, Potsdam, Juni 2013) Non Jewish-Perspectives on German-Jewish History: A Generational Project? (Leo Baeck Institute Jerusalem, Juli 2013) Between East and West. The Jewish Community of Königsberg (Institut of Russian History of the Russian Academy of Sciences, Kaliningrad, November 2013) Kontinuitäten antisemitischer Gewalt vor und nach 1933 (Universität Bochum, Dezember 2013) Antisemitismus und Geschlecht (Georg-August-Universität Göttingen, Januar 2014) Furcht und Elend. Juden in Königsberg unter nationalsozialistischer Herrschaft (Nordost-Institut Lüneburg, Februar 2014) Antisemitismus im Fußball (Jugendkongress der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, Berlin, Februar 2014)»Easterners.«Minorities in the German Empire 1871 to 1914 (University of London, Mai 2014) Antisemitismus und Geschlecht (TU Berlin, Juni 2014) The Witness and the Holocaust. Oral Testimonies and Historical Knowledge (Mémorial de la Shoah, Paris, Juni 2014) Sektionsleitung: Vom Verlust als Erfolg erzählen: Erfahrungen und Wahrnehmungen jüdischer Migrationsbewegungen im 20. Jahrhundert (Deutscher Historikertag, Göttingen, September 2014) Die neuere Antisemitismusforschung und ihr Platz in den Jüdischen Studien (Universität Potsdam, Oktober 2014) Vom Vorteil, eine Frau zu sein. Zur deutsch-jüdischen Ge- schlechtergeschichte in der Moderne (Zentrum Jüdische Studien Berlin-Brandenburg, Oktober 2014) Antikommunismus als regierende Partei: Spanien (Jena Center für die Geschichte des 20. Jahrhunderts, November 2014) Ullrich, Peter»Da wollte man von Hitler nichts mehr wissen«nationalsozialismus und Krieg in Berufsbiographien deutscher NachkriegspsychoanalytikerInnen (zusammen mit Benjamin Wachtler, Zentrum für Antisemitismusforschung, Oktober 2013) Anti-Semitism, Anti-Zionism and criticism of Israel as a discursive field (Jüdisches Museum Berlin, November 2013) Der Antisemitismus der anderen. Tendenzen der öffentlichen Kommunikation über Antisemitismus in der Bundesrepublik (RWTH Aachen, Januar 2014) Antisemitismus in Berlin ( ) (zusammen mit Michael Kohlstruck, Zentrum für Antisemitismusforschung, Januar 2014) Anti-Semitism, Anti-Zionism, Criticism of Israel in Germany Problems, Debated Issues, Learning Processes (University of Uppsala, April 2014) Vulesica, Marija Bischof Strossmayer s Fever, Pain and the Jews (Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin, April 2012) Ein publizistisches Bollwerk gegen die»judenfresserischen Notizen«. Die Osijeker Zeitung»Die Drau«und die Formierung des politischen Antisemitismus in Kroatien und Slawonien (Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen, Juni 2012) Juden und Antisemitismus an den jugoslawischen Universitäten (Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien, Juni 2012) Lavoslav Schick. Ein südslawischer Zionist im mitteleuropäischen Grenzraum (Andrássy Universität Budapest, Oktober 2012) The Yugoslav Zionists and the Forms of Resistance to National Socialism and Antisemitism in Europe (Leo Baeck Institute Jerusalem, Februar 2013) Formen und Bedingungen des Widerstands jugoslawischer Zionistinnen und Zionisten (Moses Mendelssohn Zentrum, Berlin, April 2013) Yugoslav Jews and their Post-War Efforts to the Documentation of Jewish Pre-War Life and Holocaust (Jüdisches Museum Prag, Oktober 2014) Weber, Elisabeth Die Kriegserfahrung jüdischer Soldaten in Rumänien während des Ersten Weltkriegs (Lange Nacht der Wissenschaften, TU Berlin, Mai 2014) Battling for Citizenship: The Union of Native Jews and the Wars in Romania (Hebrew University, Jerusalem, Juni 2014) Juden in Rumänien während des Ersten Weltkriegs (Deutsches Historisches Institut Warschau, November 2014) Im Krieg für gleiche Rechte: Balkankrieg, Erster Weltkrieg und die jüdische Bevölkerung Rumäniens (Zentrum für Antisemitismusforschung, Dezember 2014) Wetzel, Juliane Bezüge zwischen historischem Antisemitismus und aktuellem Rechtsextremismus (Bundeszentrale für politische Bildung, Köln, Februar 2013) Antisemitismus in der Bundesrepublik (Akademie für politische Bildung, Tutzing, Mai 2013) Towards a Comparability of Antisemitism and Islamophobia (Centre for Gender and Diversity, Maastricht University, Mai 2013) Towards a Comparability of Antisemitism and Islamophobia (Czech-Arab Centre for Cultural Dialogue, Prag, Mai 2013) Forms of Antisemitism Today and the Internet as Tool for Spreading Propaganda (Zentrum für Antisemitismusforschung, September 2013) Das Lernen über den Holocaust via Internet. Möglichkeiten und Fallstricke (Italien-Zentrum der TU Dresden, November 2013) Eine bayerische Siedlung wird zum osteuropäischen Shtetl. Zur Geschichte des jüdischen Displaced Persons Lagers Föhrenwald (Ludwig Maximilians Universität München, April 2014) Waiting for Emigration. The Jewish Displaced Persons in Germany after World War II (Holocaust Education Trust, Dublin, August 2014) Trivialization of the Holocaust (Holocaust Education Trust, Dublin, August 2014) Wyrwa, Ulrich Blicke auf das galizische Judentum (Institut für Osteuropäische Geschichte Wien, März 2013) Zian, Yasmina Belgische antisemitische Karikaturen aus der Zeit des Ersten Weltkriegs (Lange Nacht der Wissenschaften, TU Berlin, Mai 2014) Consequences of the First World War on the Construction of the Image of Jewish Foreigners in Belgium (Hebrew University, Jerusalem, Juni 2014) L expérience collective de la grande guerre enrichie à l aune de celles d étrangers en Belgique (Historial de la Grande Guerre Péronne, Juni / Juli 2014) Colporteur avant, collaborateur pendant et communiste après. L influence de la Première Guerre mondiale sur la représentation et l attitude de l Etat belge envers»juif étranger«(université libre de Bruxelles, September 2014) War nach dem Krieg alles anders? Die Entwicklung der Beziehung zwischen jüdischen Ausländern und dem Staat Belgien, (Deutsches Historisches Institut Warschau, November 2014) Kriegserfahrung als Radikalisierung des Nationalismus? Der Erste Weltkrieg und die»jüdischen Ausländer«in Belgien (Zentrum für Antisemitismusforschung, November 2014)
53 Publikationen
54 Publikationen Publikationen des Zentrums für Antisemitismusforschung Jahrbuch für Antisemitismusforschung Herausgegeben von Stefanie Schüler-Springorum für das Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin Redaktion: Werner Bergmann, Marcus Funck, Dilek Güven (seit 2014) Geschäftsführende Redakteurin: Juliane Wetzel Metropol Verlag, Berlin Das seit 1992 erscheinende Jahrbuch für Antisemitismusforschung ist ein international renommiertes Forum für wissenschaftliche Beiträge zur Antisemitismus-, Vorurteils- und Minderheitenforschung. Es ist fächer- und länderübergreifend ausgerichtet und veröffentlicht wissenschaftliche Beiträge zur Geschichte der Judenfeindschaft, zur nationalsozialistischen Verfolgungspolitik, zum Holocaust, zu Emigration und Exil sowie zu Rechtsextremismus, Minoritätenkonflikten und zur Theorie des Vorurteils. Jahrbuch 21 (2012) Themenschwerpunkt der 21. Ausgabe des Jahrbuchs für Antisemitismusforschung bilden Beiträge zu Antisemitismus und Judentum in Litauen. Fokus der Beiträge sind die litauisch-jüdischen Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert, die Zunahme von Antisemitismus und antijüdischer Gewalt im Verlauf des 20. Jahrhunderts sowie die Erinnerungen an den Holocaust in Litauen. Die Beiträge gehen auf den Workshop»No Simple Stories: Lithuanian-Jewish relations between coexistence and violence«zurück, der im Februar 2011 am Londoner Institute of Jewish Studies stattfand. Unter der Rubrik»Antisemitismus«finden sich darüber hinaus Beiträge, die sich mit weiteren Aspekten des Antisemitismus in Geschichte und Gegenwart beschäftigen. Sie widmen sich unter anderem der Vorgeschichte des»berliner Antisemitismusstreits«, antijüdischen Emotionen adeliger Frauen im 19. und 20. Jahrhundert, dem Antisemitismus in deutschsprachigen Lexika des Kaiserreichs und der Weimarer Republik, dem Antisemitismus in Deutschland in empirischen Studien aus den Jahren 1996 und 2006, der Mordserie des Nationalsozialistischen Untergrunds sowie dem Antisemitismus innerhalb der»occupy«-bewegung in den USA. Jahrbuch 22 (2013) Einen Schwerpunkt der 22. Ausgabe des Jahrbuchs für Antisemitismusforschung stellt die Dokumentation einer Sektion des Deutschen Historikertages 2012 zum Thema»Schuld Sühne Recht«dar. Vier Beiträge erörtern das Verhältnis von Rache und Recht, von Vorstellungen über Schuld und Buße unmittelbar nach 1945 aus zeitgenössischer Perspektive. Ein zweiter Schwerpunkt der Ausgabe dokumentiert die Beiträge der Veranstaltungsreihe»Blickwinkel. Antisemitismus in der Migrationsgesellschaft«, die von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, dem Fritz Bauer Institut sowie dem Zentrum für Antisemitismusforschung durchgeführt wird. Die Beiträge beleuchten den Zusammenhang zwischen Antisemitismus, Alltag und Geschlecht im Kontext der Migrationsgesellschaft aus unterschiedlicher Perspektive, theoriegeleitet wie praxisbezogen. Darüber hinaus finden sich unter der Rubrik»Antisemitismus«eine Reihe weiterer Fallstudien zur Geschichte des Antisemitismus. Von Breslau 1453 bis Entebbe 1976 sind hier klassische biografische Ansätze, historiografiekritische Analysen bis hin zu Begriffsreflexionen versammelt. Jahrbuch 23 (2014) Schwerpunkte der 23. Ausgabe des Jahrbuchs für Antisemitismusforschung sind die Rolle von Emotionen für den modernen Antisemitismus des 19. Jahrhunderts sowie die Erscheinungsformen des Antisemitismus im heutigen Europa. Welche Bedeutung emotionale Aspekte für die Herausbildung des modernen Antisemitismus hatten, zeigen die im Jahrbuch vereinten Beiträge, die auf die im April 2012 stattgefundene Tagung des Zentrums für Antisemitismusforschung zu»emotions and the History of Modern Anti-Semitism«zurückgehen. Die Beiträge belegen, dass der moderne Antisemitismus bereits zum Zeitpunkt seiner Entstehung europaweit Weltanschauung und Leidenschaft zugleich war. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Analyse des gegenwärtigen Antisemitismus in Europa gewidmet. In zwölf Länderstudien werden aktuelle Erscheinungsformen des Antisemitismus in Österreich, Großbritannien, Litauen, der Türkei, Polen, Schweden, den Niederlanden, Deutschland, Spanien, Ungarn und der Slowakei untersucht. Die Beiträge sind Ergebnis der im November 2013 in Berlin stattgefundenen Tagung»Antisemitism in Europe Today: the Phenomena, the Conflicts«
55 Publikationen Publikationen Handbuch des Antisemitismus Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart Im Auftrag des Zentrums für Antisemitismusforschung der TU Berlin herausgegeben von Wolfgang Benz In Zusammenarbeit mit Werner Bergmann, Rainer Kampling, Juliane Wetzel, Ulrich Wyrwa Redaktion: Brigitte Mihok De Gruyter Oldenbourg (bis 2014 De Gruyter/Saur) Das Handbuch des Antisemitismus versammelt das vorhandene Wissen zum Phänomen der Judenfeindschaft ohne zeitliche und räumliche Begrenzung. Antisemitismus als ältestes religiöses, kulturelles, soziales und politisches Vorurteil wird in allen Aspekten dargestellt und erläutert: als Einstellung, als Politikmuster, als Instrumentalisierung von Emotionen, als Aggression vom Pogrom bis zum Genozid. Terminologische Probleme und Theorien der Antisemitismusforschung werden ebenso dargestellt wie Ereignisse und Sachkomplexe, Organisationen und Publikationen. Auch die Wirkungsgeschichte des Antisemitismus wird in Beiträgen über Film, Theater, Literatur und Kunst berücksichtigt. Die Verfasser sind international renommierte Historiker, Politologen, Sozialwissenschaftler, Psychologen, Literaturwissenschaftler und andere ausgewiesene Fachleute, die den aktuellen Stand der Forschung präsentieren. In den Jahren 2012 bis 2015 erschienen Band 5 bis 8 des Handbuchs des Antisemitismus. Band 5 (2012): Organisationen, Institutionen, Bewegungen In Band 5 behandeln mehr als 140 Autoren in 330 Artikeln Parteien und Vereine, staatliche Behörden und kirchliche Vereinigungen, Nichtregierungsorganisationen und informelle Gruppierungen, Institute, wissenschaftliche oder soziale Gesellschaften, in deren Programm oder Praxis Judenfeindschaft eine Rolle spielte oder immer noch spielt. Ebenso sind Vereinigungen und Zusammenschlüsse, die sich die Bekämpfung des Antisemitismus zum Ziel gesetzt haben, in diesem Band zu finden. Band 6 (2013): Publikationen Band 6 bietet Informationen über Verlage, Zeitungen und Zeitschriften sowie über zahlreiche Traktate, Aufsätze und Bücher, die, angefangen mit den Flugschriften des 15. und 16. Jahrhunderts bis in die Gegenwart, für die Geschichte der Judenfeindschaft eine Rolle spielen. Insgesamt 450 Artikel, verfasst von 150 Experten zur antisemitischen Publizistik in Geschichte und Gegenwart sowie ihrer Abwehr, machen den Band zum unverzichtbaren Kompendium. Band 7 (2014): Literatur, Film, Theater und Kunst In Band 7 geben knapp 300 Artikel, verfasst von 120 Autoren, einen Überblick über den kulturellen Antisemitismus in Film und Theater, Literatur und Kunst. Thematisiert werden einerseits Romane und Bühnenstücke, Filme und Werke der Bildenden Kunst, die als Vehikel der Judenfeindschaft fungierten. Andererseits beinhaltet das Handbuch auch Artikel zu künstlerischen Beiträgen, die sich der Abwehr des Antisemitismus und der Aufarbeitung des Holocaust verschrieben haben. Band 8 (2015): Nachträge und Register Mit Band 8 ist das Handbuch des Antisemitismus abgeschlossen. Der Band enthält 125 Nachträge zu allen thematischen Bereichen des Handbuchs. Ferner bietet er einen Überblicksessay des Herausgebers zur Geschichte der Judenfeindschaft in der Form des religiösen Antijudaismus und des rassistischen Antisemitismus; erläutert werden die aktuellen Entwicklungslinien und Phänomene wie sekundärer Antisemitismus, Antizionismus und islamistischer Antisemitismus. Kumulierte Register (Personen sowie Orte und Regionen) erleichtern die Benutzung des Gesamtwerks
56 Publikationen Publikationen Studien zum Antisemitismus in Europa Band 3: Band 4: Band 5: Herausgegeben von Werner Bergmann und Ulrich Wyrwa Metropol Verlag, Berlin Die 2011 gegründete Schriftenreihe publiziert wissenschaftliche Studien, die sich mit der Entstehung und Entwicklung des modernen Antisemitismus in Europa auseinandersetzen. Ziel der Reihe ist es, die Geschichte des modernen Antisemitismus von seiner Entstehung im 19. Jahrhundert über seine Radikalisierung im Ersten Weltkrieg bis hin zu seiner Kulmination im Holocaust an den europäischen Juden aus einer europäisch-vergleichenden Perspektive darzustellen. Die Reihe möchte damit einen Beitrag zur Aufarbeitung einer europäischen Vergangenheit leisten. In den Jahren 2012 bis 2014 erschienen Band 2 bis 7 der Reihe Studien zum Antisemitismus in Europa. Band 2: Marija Vulesica: Die Formierung des politischen Antisemitismus in den Kronländern Kroatien-Slawonien , Berlin Kroatien und Slawonien, Kronländer der Habsburgermonarchie, galten bisher als Region mit kaum ausgeprägtem Antisemitismus. Marija Vulesica zeigt, dass der Antisemitismus auch in die kroatische politische Kultur Eingang gefunden hatte. Insbesondere die oppositionellen Parteien, die sich gegen die deutsche und ungarische Vormachtstellung in Kroatien-Slawonien richteten, machten Juden als deren Handlager aus. Antisemitismus war jedoch nicht nur ein Symptom nationaler, sondern ebenso sozialer Konflikte. Indem sie vor allem Zeitungen der Opposition auswertet, arbeitet die Autorin die Wirkmacht der transnationalen antisemitischen Bewegungen innerhalb der Habsburgermonarchie heraus. Tim Buchen: Antisemitismus in Galizien. Agitation, Gewalt und Politik gegen Juden in der Habsburgermonarchie um 1900, Berlin Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts veränderte sich mit den rechtlichen, politischen und wirtschaftlichen Umwälzungen der Diskurs der»jüdischen Frage«auch im habsburgischen Kronland Galizien grundlegend. Klerikale und populistische Politiker traten als neue Akteure auf und propagierten die Abkehr von der Assimilation und Zivilisierung der Juden. Sie nahmen die christlichen Wähler in die Pflicht, Juden aus dem sozialen und ökonomischen Leben auszuschließen. Als im Sommer 1898 eine antijüdische Gewaltwelle das Land erschütterte, wurden die Ereignisse Teil antisemitischer Politik im Wiener Reichsrat. Die Studie geht dem Zusammenwirken von Agitation, Gewalt und Politik gegen Juden an der Peripherie der Donaumonarchie nach und zeigt in dichten Beschreibungen die Funktionen und Grenzen von Propaganda, Gerüchten und Massenmedien. Sie erklärt die Bedeutung von Antisemitismus für die Politik und das Zusammenleben von Christen und Juden am Vorabend des Ersten Weltkriegs. Die Studie wurde ausgezeichnet mit dem Wissenschaftlichen Förderpreis des Botschafters der Republik Polen 2011, dem Immanuel-Kant-Forschungspreis des Bundesbeauftragten für Kultur und Medien 2012 und dem Preis»Geisteswissenschaften International«des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels Klaus Richter: Antisemitismus in Litauen. Christen, Juden und die»emanzipation«der Bauern ( ), Berlin Während in anderen Regionen des Russischen Reiches im späten 19. und frühen 20. Jahrhun dert judenfeindliche Pogrome das Land erschütterten, blieben die Beziehungen von Christen und Juden in Litauen weitgehend friedlich. Zeitgleich entwickelten der sich formierende li tauische Nationalismus und die katholischen Eliten Strategien zur Stärkung der Bauernschaft. Am Beispiel judenfeindlicher Gewalt und wirtschaftlicher Praxis der Bauern untersucht Klaus Richter die Auswirkungen dieser Strategien auf die alltäglichen Beziehungen zwischen der ländlich geprägten christlichen und der städtisch orientierten jüdischen Bevölkerung. Manfred Hettling / Michael G. Müller / Guido Hausmann (Hrsg.): Die»Judenfrage«ein europäisches Phänomen?, Berlin 2013 In der entstehenden»bürgerlichen Gesellschaft«des ausgehenden 18. Jahrhunderts veränderte sich die Stellung der jüdischen Minderheit: Das Versprechen bürgerlicher und nationaler Gleichheit konnte als Verlockung wie als Bedrohung wahrgenommen werden, von Juden wie von der jeweiligen Mehrheitsgesellschaft. Daraus entstanden in den einzelnen Ländern Diskussionen um die»judenfrage«. In diesen politisch-gesellschaftlichen Ordnungsdebatten wurden Bedingungen, Möglichkeiten und Grenzen einer rechtlichen Gleichstellung und sozialen Integration der Juden erörtert. Diese Kontroversen über die Stellung der jüdischen Minderheit dienten dabei zugleich als Selbstverständigungsdebatte über politische Grundwerte der Mehrheitsgesellschaft. Die»Judenfrage«erweist sich damit auch als Indikator für nationale Selbstverständigungsprozesse, besonders in politischen Umbruch- und Krisensituationen. Dabei schrieb man Juden sehr unterschiedliche Rollen zu, die Modelle reichten von radikaler Exklusion bis zu weitgehender Inklusion. Der Band stellt nationale Debatten exemplarisch dar und vergleichend nebeneinander. Geografisch liegt der Schwerpunkt auf dem mittel-, ostmittel- und südeuropäischen Raum, zeitlich behandeln die Beiträge die Phase vom späten 18. bis ins frühe 20. Jahrhundert
57 Publikationen Publikationen Band 6: Miloslav Szabó:»Von Worten zu Taten«. Die slowakische Nationalbewegung und der Antisemitismus , Berlin Die Beziehung zwischen dem modernen Antisemitismus und dem Nationalismus im 19. und 20. Jahrhundert sind für weite Teile Ostmitteleuropas immer noch unerforscht. Die vorliegende Studie versucht, eines dieser Desiderata am Beispiel der slowakischen Nationalbewegung zu beheben. Dabei wird an die Erkenntnisse der neueren Nationalismusforschung angeknüpft, die nation-building prozessual und situativ begreift. Die in der Monographie untersuchten Kategorien wie»slowakische Nation«,»Rasse«oder»Volk«sind nicht nur für die Analyse der antisemitischen Wir-Gruppe ausschlaggebend, als deren Gegensatz»die Juden«figurierten, vielmehr gewähren sie Einblick in die komplizierten Zusammenhänge zwischen der antisemitischen Semantik und Praxis. Band 7: René Moehrle: Judenverfolgung in Triest während Faschismus und Nationalsozialismus , Berlin Das Triestiner Judentum war seit dem 13. Jahrhundert fester Bestandteil der nordadriatischen Hafenstadt. Doch Judenfeindschaft gehörte in den über 500 Jahren Habsburgerherrschaft zu den wiederkehrenden Themen. In Italien, dem Triest nach dem Ersten Weltkrieg zufiel, waren die Juden emanzipiert. In Triest hatten sie hohe wirtschaftliche Positionen inne, machten aber auch als Faschisten politische Karriere. Dennoch avancierte die Stadt mit der drittgrößten jüdischen Gemeinde Italiens zum Versuchslabor eines Staatsantisemitismus, den Mussolini offiziell von Triest aus ankündigte. Seit der deutschen Besetzung Italiens regierte Friedrich Rainer von 1943 bis Kriegsende als Oberster Kommissar die Operationszone Adriatisches Küstenland, deren Hauptstadt Triest war. Dort errichtete Odilo Globocnik die Risiera di San Sabba, das einzige Konzentrationslager der südlichen Hemisphäre mit einem Verbrennungsofen. Reihe Antisemitismus. Geschichte und Strukturen Herausgegeben für das Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin von Wolfgang Benz Klartext Verlag Essen Zuletzt erschien Band 7 der Reihe. Band 7: Günther Jikeli Antisemitismus und Diskriminierungswahrnehmungen junger Muslime in Europa. Ergebnisse einer Studie unter jungen muslimischen Männern, Essen Es gibt einen spezifisch muslimischen Antisemitismus in Europa. Dieser kann latent, aber auch massiv und aggressiv geäußert werden und stellt eine Gefahr für Juden dar. Günther Jikeli weist nach, dass sich der Antisemitismus muslimischer Jugendlicher weder durch Diskriminierungserfahrungen erklären noch auf»israelkritik«oder Antizionismus reduzieren lässt. Der Autor hat muslimische, männliche Jugendliche aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien zu ihren Diskriminierungserfahrungen, Identitäten und Einstellungen zu Juden befragt. Diskriminierungen werden in den Ländern unterschiedlich empfunden, wie sich auch die Identifikation als Deutscher, Franzose bzw. Brite unterscheidet. Die ablehnende Haltung gegenüber Juden ist hingegen länderübergreifend. Reihe Dokumente, Texte, Materialien Herausgegeben vom Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin Metropol Verlag Berlin Die Serie ist Themen der deutsch-jüdischen Geschichte, der Antisemitismus- und Holocaustforschung gewidmet. Sie dient der Veröffentlichung von Texten aller wissenschaftlich-literarischen Gattungen: Quellen von der Autobiographie, dem Tagebuch, dem subjektiven Bericht bis zur Edition amtlicher Akten. Hilfsmittel wie Bibliographien sind ebenso eingeschlossen wie Essays zu aktuellem Anlass oder wissenschaftliche Monographien, aber auch Materialsammlungen, die einen ersten Überblick oder Annäherungen an komplexe Fragestellungen erleichtern sollen. Das Anliegen der Reihe ist die Förderung des deutsch-jüdischen Diskurses in Wissenschaft und Öffentlichkeit. Zuletzt erschien Band 77 der Reihe. Band 77: Kilian Bartikowski Der italienische Antisemitismus im Urteil des Nationalsozialismus , Berlin Das Urteil des NS-Regimes über den Umgang des italienischen Bündnispartners mit Juden schwankte zwischen angemessen und zu milde. In den 1920er-Jahren war der Antisemitismus im faschistischen Italien noch latent. Dies änderte sich ab Mitte der 1930er-Jahre mit dem Erlass antisemitischer Gesetze und der Zunahme antisemitischer Ressentiments. In Berlin wurde diese Entwicklung begrüßt. Infolge der Radikalisierung der nationalsozialistischen Judenpolitik und der im Zweiten Weltkrieg entstandenen Spannungen im Verhältnis zum italienischen Verbündeten werteten die Nationalsozialisten dessen Antisemitismus erneut als zu zurückhaltend. Der Nachkriegsmythos vom»guten Italiener«lässt sich damit hingegen nicht belegen
58 Publikationen Publikationen Publikationen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Herausgeberschaft: Bergmann, Werner mit Ulrich Wyrwa: The Making of Antisemitism as a Political Movement. Political History as Cultural History ( ), Quest. Issues in Contemporary Jewish History 3 (2012). Casquete, Jesús mit Santiago de Pablo, José Luis de la Granja und Ludger Mees: Diccionario ilustrado de símbolos del nacionalismo vasco, Madrid Enzenbach, Isabel mit Wolfgang Haney: Antisemitismus im Kleinformat. Alltagspropaganda seit Vignetten, Marken und Klebezettel aus der Sammlung Wolfgang Haney, Berlin mit Detlef Pech und Christina Klätte: Kinder und Zeitgeschichte: Jüdische Geschichte und Gegenwart, Nationalsozialismus und Antisemitismus, Berlin Gailus, Manfred mit Clemens Vollnhals: Mit Herz und Verstand. Protestantische Frauen im Widerstand gegen die NS-Rassenpolitik, Göttingen Monographien: Axster, Felix Koloniales Spektakel in 9x14. Bildpostkarten im Deutschen Kaiserreich, Bielefeld Baganz, Carina Diskriminierung, Ausgrenzung, Vertreibung: Die Technische Hochschule Berlin während des Nationalsozialismus, Berlin Bistrović, Miriam / Krauß, Joachim (mit Wolfgang Benz, Werner Bergmann) Zwischen Gleichgültigkeit und Ablehnung. Bevölkerungseinstellungen gegenüber Sinti und Roma. Expertise für die Antidiskriminierungsstelle des Bundes durch das Zentrum für Antisemitismusforschung und das Institut für Vorurteils- und Konfliktforschung e.v., Berlin Delaney, Patrick Gouvernementalität in der alternden Gesellschaft. Wohnen im Alter zwischen Neoliberalismus und Solidarität, Berlin Funck, Marcus Kanada. Ein Länderporträt, Berlin La guerra como aventura. La Legión Cóndor en la guerra civil española , Madrid Ullrich, Peter Deutsche, Linke und der Nahostkonflikt. Politik im Antisemitismus- und Erinnerungsdiskurs, Göttingen Vulesica, Marija Die Formierung des politischen Antisemitismus in den Kronländern Kroatien und Slawonien , Berlin Wyrwa, Ulrich Strategien im europäisch-jüdischen Abwehrkampf. Das Engagement der Juden in Europa gegen den entstehenden Antisemitismus ( ), Graz Publikationen in Sammelbänden Axster, Felix Empathie für wen? Reflektionen über (das Erbe von) NS-Täter_innenschaft im gegenwärtigen deutschen und österreichischen Dokumentarfilm, in: Lisa Bolyos / Katharina Morawek (Hrsg.): Diktatorpuppe zerstört, Schaden gering. Kunst und Geschichtspolitik im Postnazismus, Wien 2012, S Kohlstruck, Michael mit Dirk Wilking: Brandenburgisches Institut für Gemeinwesenberatung. Einblicke IV. Ein Werkstattbuch, Potsdam Rohde, Achim mit Samira Alayan und Sarhan Dhouib: The Politics of Education Reform in the Middle East. Self and Other in Textbooks and Curricula, New York Schüler-Springorum, Stefanie mit Uffa Jensen: Gefühle gegen Juden, Geschichte und Gesellschaft 4 (2013), Themenheft. Wyrwa, Ulrich mit Werner Bergmann: The Making of Antisemitism as a Political Movement. Political History as Cultural History ( ), Quest. Issues in Contemporary Jewish History 3 (2012). Grüttner, Michael Das Dritte Reich (Gebhardt. Handbuch der Deutschen Geschichte, Bd. 19), Stuttgart Maier-Wolthausen, Clemens mit Katja Happe und Barbara Lambauer (Bearb.): Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland , Bd. 12: Westund Nordeuropa Juni , Berlin Meyer, Winfried Klatt: Hitlers jüdischer Meisteragent gegen Stalin. Überlebenskunst in Holocaust und Geheimdienstkrieg, Berlin Schmidt, Monika Die jüdischen Aktionäre des Zoologischen Gartens zu Berlin. Namen und Schicksale, Berlin Schüler-Springorum, Stefanie Perspektiven deutsch-jüdischer Geschichte: Geschlecht und Differenz, Paderborn Arbeit, Teilhabe und Ausschluss, in: Birthe Kundrus / Sybille Steinbacher (Hrsg.): Kontinuitäten und Diskontinuitäten. Der Nationalsozialismus in der Geschichte des 20. Jahrhunderts, Göttingen 2013, S Baganz, Carina Vom Wachmann zum Inoffiziellen Mitarbeiter. Täter der frühen sächsischen Konzentrationslager und ihr Wirken für die Staatssicherheit, in: Günther Heydemann / Jan Erik Schulte / Francesca Weil (Hrsg.): Sachsen und der Nationalsozialismus, Göttingen 2014, S Bergmann, Werner Vom Zitat zur Parole. Das Weltbild völkisch-antisemitischer Spruchmarken, in: Isabel Enzenbach / Wolfgang Haney (Hrsg.): Antisemitismus im Kleinformat. Alltagspropaganda seit Vignetten, Marken und Klebezettel aus der Sammlung Wolfgang Haney, Berlin 2012, S Hep-Hep-Krawalle, in: Dan Diner (Hrsg.): Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur, Bd. 3, Stuttgart 2012, S
59 Publikationen Publikationen Der Schatten der Aufklärung. Antisemitische Ausgrenzungs- und Vernichtungsvorstellungen in Klassik, Romantik und Vormärz von , in: Hannes Heer / Sven Fritz (Hrsg.):»Weltanschauung en marche«. Die Bayreuther Festspiele und die»juden« , Würzburg 2013, S Herbert Arthur Strauss, in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 25, Berlin 2013, S Rassismus / Antisemitismus, in: Christian Gudehus / Michaela Christ (Hrsg.): Gewalt. Ein interdisziplinäres Handbuch, Stuttgart / Weimar 2013, S sowie zahlreiche Einträge in: Wolfgang Benz (Hrsg.): Handbuch des Antisemitismus, Bd. 5 und 6, Berlin 2012 und Bistrović, Miriam diverse Einträge in: Wolfgang Benz (Hrsg.): Handbuch des Antisemitismus, Bd. 6, Berlin Casquete, Jesús La importancia de llamarse Horst: modernización, germanidad y nombres de pila en la Alemania nazi, in: I. Sánchez de la Yncera / M. Rodríguez Fouz (Hrsg.): Dialécticas de la postsecularidad. Pluralismo y corrientes de secularización, Barcelona 2012, S »Wie vergessen nicht, uns zu erinnern«: Der Kalender des radikalen Nationalismus im Baskenland, in: Peter Waldmann / Stefan Malthaner (Hrsg.): Radikale Milieus. Das soziale Umfeld terroristischer Gruppen, Frankfurt am Main 2012, S mit José Luis de la Granja: La celebración de la patria vasca: invención y evolución del Aberri Eguna, in: Ludger Mees (Hrsg.): La celebración de la nación: símbolos, mitos y lugares de memoria, Granada 2012, S Dörner, Bernward zahlreiche Einträge in: Wolfgang Benz (Hrsg.): Handbuch des Antisemitismus, Bd. 6, Berlin Enzenbach, Isabel Frühes historisches Lernen. Jüdische Geschichte, Nationalsozialismus und nationalsozialistische Judenverfolgung, in: Hanns-Fred Rathenow / Birgit Wenzel / Norbert H. Weber (Hrsg.): Handbuch Nationalsozialismus und Holocaust, Schwalbach 2013, S sowie diverse Einträge in: Wolfgang Benz (Hrsg.): Handbuch des Antisemitismus, Bd. 5, Berlin Gailus, Manfred Diskurse, Bewegungen, Praxis: Völkisches Denken und Handeln bei den»deutschen Christen«, in: Uwe Puschner / Clemens Vollnhals (Hrsg.): Die völkisch-religiöse Bewegung im Nationalsozialismus. Eine Beziehungs- und Konfliktgeschichte, Göttingen 2012, S Ein selbstzerstörerischer Bruderkampf. Das protestantische Berlin ( ), in: Michael Wildt / Christoph Kreutzmüller (Hrsg.): Berlin Stadt und Gesellschaft im Nationalsozialismus, München 2013, S mit Clemens Vollnhals: Protestantische Frauen mit viel Empathie und klugem Eigensinn. Zur Einführung, in: Manfred Gailus / Clemens Vollnhals (Hrsg.): Mit Herz und Verstand. Protestantische Frauen im Widerstand gegen die NS-Rassenpolitik, Göttingen 2013, S Elisabeth Schmitz und ihre Denkschrift gegen die Judenverfolgung 1935/36. Biografie einer»protestierenden Protestantin«, in: Manfred Gailus / Clemens Vollnhals (Hrsg.): Mit Herz und Verstand. Protestantische Frauen im Widerstand gegen die NS-Rassenpolitik, Göttingen 2013, S »Pöbelexcesse«oder Straßenpolitik? Vom großen Protest der»kleinen Leute«um 1848, in: Rüdiger Hachtmann / Susanne Kitschun / Rejane Herwig (Hrsg.): Akteure und Schauplätze der Berliner Revolution, Freiburg 2013, S »Ein Feld weiß und reif zu einer Geistesernte liegt vor uns!«deutsche Protestanten im Ersten Weltkrieg, in: Rolf Hosfeld (Hrsg.): Johannes Lepsius - Eine deutsche Ausnahme. Der Völkermord an den Armeniern, Humanitarismus und Menschenrechte, Göttingen 2013, S Fatale Entgleisungen. Protestantische Pfarrer in der Zwischenkriegszeit, in: Deutsches Historisches Museum (Hrsg.): Leben nach Luther. Eine Kulturgeschichte des evangelischen Pfarrhauses, Berlin 2013, S Karl Barth, Elisabeth Schmitz, and Her Denkschrift against the Persecution of Jews, in: Hilary Earl / Karl A. Schleunes (Hrsg.): Lessons and Legacies XI: Expanding Perspectives on the Holocaust in a Changing World, Evanston IL 2014, S Die mutigen Frauen des sogenannten Kirchenkampfes und warum die Kirche sie nach 1945 so gründlich vergessen hat, in: August H. Leugers-Scherzberg / Lucia Scherzberg (Hrsg.): Genderaspekte in der Aufarbeitung der Vergangenheit (theologie.geschichte, Beiheft 8), Saarbrücken 2014, S Sonnenfinsternis. Protestantische Pfarrhäuser und der Nationalsozialismus, in: Die Gazette. Das politische Kulturmagazin 40, Winter 2013/2014, S Heinrich Grüber als Pfarrer in der Kirchengemeinde Berlin-Kaulsdorf, in: Beate Barwich (Hrsg.): Veni creator spiritus. Heinrich Grüber - Gerechter unter den Völkern, Leipzig 2014, S Evangelische Pfarrer und Kirchen im Ersten Weltkrieg, in: Gerhard Bauer / Gorch Pieken / Matthias Rogg (Hrsg.): 14 - Menschen - Krieg. Essays zur Ausstellung zum Ersten Weltkrieg, Militärhistorisches Museum der Bundeswehr Dresden 2014, S Grüttner, Michael Die Hochschulkommission der NSDAP, in: Ursula Ferdinand, Hans-Peter Kröner und Ioanna Mamali (Hrsg.): Medizinische Fakultäten in der deutschen Hochschullandschaft , Heidelberg 2013, S Die deutschen Universitäten im Dritten Reich, in: Michael Custodis (Hrsg.): Herman-Walther Frey: Ministerialrat, Wissenschaftler, Netzwerker. NS-Hochschulpolitik und die Folgen, Münster 2014, S La Primera Guerra Mundial y el nacimiento del Nacionalsocialismo, in: Francisco Morente / Javier Rodrigo (Hrsg.): Tierras de nadie. La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias, Granada 2014, S Hopp, Andrea»We were so bürgerlich!«rekonstruktionen jüdischer Bürgerlichkeit am Beispiel Frankfurt am Main, in: Stefan Gerber / Werner Greiling / Tobias Kaiser / Klaus Ries (Hrsg.): Zwischen Stadt, Staat und Nation. Bürgertum in Deutschland, Teil 1., Göttingen 2014, S Zum Antiliberalismus adeliger Frauen: Familienalltag bei Otto von Bismarck, in: Ewald Grothe / Ulrich Sieg (Hrsg.): Liberalismus als Feindbild. Göttingen 2014, S Linsler, Carl-Eric diverse Einträge in: Wolfgang Benz (Hrsg.): Handbuch des Antisemitismus, Bd. 6, Berlin Kohlstruck, Michael Können Verhinderungsblockaden von angemeldeten Demonstrationen als ziviler Ungehorsam gelten?, in: Michael Kohlstruck / Dirk Wilking: Brandenburgisches Institut für Gemeinwesenberatung. Einblicke IV. Ein Werkstattbuch, Potsdam 2012, S Bildungsarbeit und die Bekämpfung des Rechtsextremismus, in: Rosa Luxemburg Stiftung / Akademie für Politische Bildung / Referat für Neonazismus und Strukturen / Ideologien der Ungleichwertigkeit (Hrsg.): Wem gehört die Bildungsarbeit? Bildungsarbeit des Verfassungsschutzes in Zeiten der»extremismus«-doktrin, Berlin 2012, S Bürgernähe und Bürgerkontrolle schließen sich aus. Der Verfassungsschutz überspannt den Bogen, in: Weiterdenken - Heinrich-Böll-Stiftung Sachsen/ Kulturbüro Sachsen (Hrsg.): Wer schützt die Verfassung? Kritik zu den Verfassungsschutzbehörden und Perspektiven jenseits der Ämter, Dresden 2013, S Klaus Mehnert. Intellektueller für Nichtintellektuelle?, in: Richard Faber / Uwe Puschner (Hrsg.): Intellektuelle und Antiintellektuelle im 20. Jahrhundert, Frankfurt am Main 2013, S Das»Tolerante Brandenburg«fördert die Demokratisierung der Demokratie, in: Landtag Brandenburg Drucksache 5/7317: Bericht der Landesregierung zur Umsetzung des Handlungskonzepts»Tolerantes Brandenburg«der Landesregierung. 4. Bericht der Landesregierung gemäß Beschluss des Landtages vom 25. März 2010»Rechtsextremismus konsequent bekämpfen«, Potsdam 2013, S Die alte Grafschaft Ruppin ein Erinnerungsort mit Tradition, in: Christine Holste / Barbara von Reibnitz (Hrsg.): A propos. Kulturwissenschaftliche Miszellen von und für Richard Faber, Würzburg 2013, S
60 Publikationen Publikationen Der Wunsiedler Weg. Eine erfolgreiche Doppelstrategie, in: Julia Hasse / Gregor Rosenthal / Joachim Twisselmann (Hrsg.): Wunsiedel ist bunt - nicht braun! Die Auseinandersetzungen um das Heß-Grab verändern die politische Kultur, Berlin / Bad Alexandersbad 2013, S mit Manfred Rolfes und Wilfried Schubarth:»Tolerantes Brandenburg«- Herausforderungen einer institutionalisierten Rechtsextremismusprävention auf Landesebene, in: Wilfried Schubarth (Hrsg.): Nachhaltige Prävention von Kriminalität, Gewalt und Rechtsextremismus. Beiträge aus Wissenschaft und Praxis, Potsdam 2014, S Nachhaltige Prävention von Rechtsextremismus bei Jugendlichen in Schule und Jugendhilfe, in: Wilfried Schubarth (Hrsg.): Nachhaltige Prävention von Kriminalität, Gewalt und Rechtsextremismus. Beiträge aus Wissenschaft und Praxis, Potsdam 2014, S Die alte Grafschaft Ruppin - ein zeitgenössischer Erinnerungsort mit langer Tradition, in: Hanna Delf von Wolzogen / Richard Faber / Helmut Peitsch (Hrsg.): Theodor Fontane: Berlin, Brandenburg, Preußen, Deutschland, Europa und die Welt, Würzburg 2014, S mit Wilfried Schubarth und Manfred Rolfes: Expertise zum Handlungskonzept der Landesregierung»Tolerantes Brandenburg für eine starke und lebendige Demokratie«, im Auftrag des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg, Koordinierungsstelle»Tolerantes Brandenburg«, Potsdam Krauß, Joachim Entwicklung und Folgen der Romafeindlichkeit in Rumänien und Ungarn, in: Hans-Peter Killguss / Esther Quicker (Hrsg.): Sinti und Roma zwischen Ausgrenzung und Selbstbehauptung. Stimmen und Hintergründe zur aktuellen Debatte, Köln 2013, S Ideen zur»bürgerlichen Verbesserung der Zigeuner«. Produktion und Reproduktion von Wissen im Zeichen der Aufklärung, in: Kristina-Monika Hinneburg / Grazyna Jurewicz (Hrsg.): Zwischen Universalismus und partikularem Anspruch. Das Prinzip Aufklärung, Laboratorium Aufklärung Bd. 25, München 2014, S Maier-Wolthausen, Clemens Ilse Reifeisen und die Kindertransporte nach Schweden, in: Elisabeth Cosanne-Schulte-Huxel (Hrsg.):»Mein liebes Ilsekind«. Mit dem Kindertransport nach Schweden Briefe an eine gerettete Tochter, Essen 2013, S »Es liegt mir daran, daß Fräulein Nelly Sachs Aufnahme in Schweden findet.«der Kampf um die Rettung der Nelly Sachs, in: Izabela Dahl / Jorunn Sem Fure (Hrsg.): Skandinavien als Zuflucht für jüdische Intellektuelle , Berlin 2014, S Peter Blachstein in Schweden, in: Ludger Heid (Hrsg.): Das linke Gewissen. Peter Blachstein ( ). Eine politische Biographie, Berlin 2014, S Meyer, Winfried mit Roland Brauckmann: Geschichtspolitik und Ausstellungsdidaktik. Ein Streitgespräch über die Dauerausstellung in der Gedenk- und Begegnungsstätte Leistikowstraße Potsdam, in: Wolfgang Benz (Hrsg.): Ein Kampf um Deutungshoheit. Politik, Opferinteressen und historische Forschung. Die Auseinandersetzungen um die Gedenk- und Begegnungsstätte Leistikowstraße Potsdam, Berlin 2013, S Rom in den Schatten stellen. NS-Monumentalbauten, Antikenrezeption und Sklavenarbeit, in: Dagmar Thorau / Gernot Schaulinski: Mythos Germania. Vision und Verbrechen, Berlin 2014, S Mihok, Brigitte Fusgeyer-Bewegung, in: Wolfgang Benz (Hrsg.): Handbuch des Antisemitismus, Bd. 5, Berlin 2012, S Wenn sich Geschichte dem politischen Erinnerungsinteresse beugen muss. Das»Haus des Terrors«in Budapest, in: Wolfgang Benz (Hrsg.): Ein Kampf um Deutungshoheit. Politik, Opferinteressen und historische Forschung, Berlin 2013, S Roma-Feindlichkeit: Von Angstszenarien zur Kriminalisierung, in: Wolfgang Benz / Sir Peter Ustinov Institut (Hrsg.): Ressentiment und Konflikt. Vorurteile und Feindbilder im Wandel, Schwalbach/Taunus 2014, S Rohde, Achim Zwischen Friedhof und»denkmal des Unbekannten Soldaten«Gedenkkultur für gefallene Soldaten im Irak, , in: Manfred Hettling und Jörg Echternkamp (Hrsg.): Gefallenengedenken im globalen Vergleich Nationale Tra- dition, politische Legitimation und Individualisierung der Erinnerung, München 2012, S Totalitarianism Revisited: Framing the History of Ba thist Iraq, in: Jordi Tejel / Peter Sluglett / Riccardo Bocco / Hamit Bozarslan (Hrsg.): Writing the Modern History of Iraq. Historiographical and Political Challenges, New Jersey 2012, S Bridging Conflicts through History Education? A Case Study from Israel/Palestine, in: Samira Alayan / Achim Rohde / Sarhan Dhouib (Hrsg.): The Politics of Education Reform in the Middle East. Self and Other in Textbooks and Curricula, New York 2012, S Introduction, in: Samira Alayan / Achim Rohde / Sarhan Dhouib (Hrsg.): The Politics of Education Reform in the Middle East. Self and Other in Textbooks and Curricula, New York 2012, S mit Ronen Zeidel und Amatzia Baram: Between the Unknown Soldier Monument and the Cemetery: Commemorating Fallen Soldiers in Iraq, , in: Stefan Milich / Friederike Pannewick / Leslie Tramontini (Hrsg.): Conflicting Narratives: War, Violence and Memory in Iraqi Culture, Wiesbaden 2012, S Schüler-Springorum, Stefanie Dialog ohne Witwen? Nationalismus und Gewalt im Baskenland, in: Klaus Weinhauer und Jörg Requate (Hrsg.): Gewalt ohne Ausweg? Terrorismus als Kommunikationsprozess in Europa seit dem 19. Jahrhundert, Frankfurt am Main 2012, S Juden, Holländer, Deutsche. Eine kleine Nachkriegsgeschichte, in: Dan Diner / Gideon Reuveni / Yfaat Weiss (Hrsg.): Deutsche Zeiten. Geschichte und Lebenswelt. Festschrift zur Emeritierung von Moshe Zimmermann, Göttingen 2012, S A Soft Hero. Male Jewish Identity in Imperial Germany through the Autobiography of Aron Liebeck, in: Benjamin Maria Baader / Sharon Gillerman / Paul Lerner (Hrsg.): Jewish Masculinities. German Jews, Gender and History, Bloomington 2012, S Lokal, Regional, Global? Ein Plädoyer dafür, die Synagoge (auch) im Dorf zu lassen, in: Boaz Neumann / Galili Shahar / Roni Hirsh-Ratzkovsky (Hrsg.): History and Its Discontents - Between Germans and Jews. Festschrift für Shulamith Volkov, Tel Aviv 2012, S Vom Wartesaal zur (unmöglichen) Heimat. Juden in Deutschland nach 1945, in: Isabel Enzenbach / Detlef Pech / Christina Klätte (Hrsg.): Kinder und Zeitgeschichte. Jüdische Geschichte und Gegenwart, Nationalsozialismus und Antisemitismus, Berlin 2012, S Welche Quellen für welches Wissen? Zum Umgang mit jüdischen Selbstzeugnissen und Täterdokumenten, in: Dorothee Gelhard / Irmela von der Lühe (Hrsg.): Wer zeugt für den Zeugen. Positionen jüdischen Erinnerns im 20. Jahrhundert, Frankfurt am Main 2012, S Welche Quellen für welches Wissen? Zum Umgang mit jüdischen Selbstzeugnissen und Täterdokumenten, in: Michael Brenner / Maximilian Strnad (Hrsg.): Der Holocaust in der deutschsprachigen Geschichtswissenschaft. Bilanz und Perspektiven, Göttingen 2012, S Evrejskaja obščina Kenigsberga, gg.: Il ja Al tman / Kirl Feferman / Jürgen Zarusky (Hrsg.): V otbleske»chrustal noj noči«: evrejskaja obščina Kenigsberga, presledovanie i spasenie evreev Evropy. Materialy 8-j Meždunarodnoj konferencii»uroki Cholokosta i sovremennaja Rossija«, Moskau / Kaliningrad 2014, S Reichstag, in: Dan Diner (Hrsg.): Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur, Bd. 5, Stuttgart 2014, S Borderliners. Identitäten in einer Grenzregion, in: Elke-Vera Kotowski (Hrsg.): Das Kulturerbe deutschsprachiger Juden. Eine Spurensuche in den Ursprungs-, Transitund Emigrationsländern, Berlin 2014, S Vulesica, Marija Anastasia, Chrysogonus und Donatus in Zadar, in: Joachim Bahlcke / Stefan Rohdewald / Thomas Wünsch (Hrsg.): Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Konstitution und Konkurrenz im nationen- und epochenübergreifenden Zugriff, Berlin 2013, S Die Ermordung der Juden in den jugoslawischen Gebieten , in: Djordje Tomic / Roland Zschächner / Mara Puskarevic / Allegra Schneider (Hrsg.): Mythos Partizan. (Dis-) Kontinuitäten der jugoslawischen Linken: Geschich
61 Publikationen Publikationen te, Erinnerungen und Perspektiven, Hamburg / Münster 2013, S »An Antisemitic Aftertase«: Anti-Jewish Violence in Habsburg Crotia, in: Robert Nemes / Daniel Unowsky (Hrsg.): Sites of European Antisemitism in the Age of Mass Politics , Lebanon NH 2014, S sowie zahlreiche Einträge in: Wolfgang Benz (Hrsg.): Handbuch des Antisemitismus, Bd. 5 und 6, Berlin 2012 und Wetzel, Juliane Antisemitism and Holocaust Remembrance, in: Günther Jikeli / Joëlle Allouche-Benayoun (Hrsg.): Perceptions of the Holocaust in Europe and Muslim Communities. Sources, Comparisons and Educational Challenges, Dordrecht / Heidelberg 2013, S Parallelen zwischen Antisemitismus und Islamfeindschaft heute, in: Gideon Botsch / Olaf Glöckner / Christoph Kopke / Michael Spieker (Hrsg.): Islamophobie und Antisemitismus ein umstrittener Vergleich, Berlin 2012, S Judenfeindliche Stereotypisierungen: Das Beschneidungsurteil im öffentlichen Diskurs, in: Johannes Heil / Stephan J. Kramer (Hrsg.): Beschneidung: Das Zeichen des Bundes in der Kritik. Zur Debatte um das Kölner Urteil, Berlin 2012, S Die Lager für»jüdische Displaced Persons«in Deutschland nach 1945, in: Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (Hrsg.): Forschungen zum Nationalsozialismus und dessen Nachwirkungen in Österreich, Wien 2012, S »Informierter Verdacht«. Antisemitismus unter Muslimen in Deutschland als empirisches Problem und mediale Zuschreibung, in: Richard Gebhardt / Anne Klein / Marcus Meier (Hrsg.): Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft. Beiträge zur kritischen Bildungsarbeit, Weinheim / Basel 2012, S Moderner Antisemitismus unter Muslimen in Deutschland, in: Thorsten Gerald Schneiders (Hrsg.): Verhärtete Fronten. Der schwere Weg zu einer vernünftigen Islamkritik, Wiesbaden 2012, S Antisemitismus und die Erinnerung an den Holocaust, in: Günther Jikeli / Kim Robin Stoller / Joëlle Allouche-Benayoun (Hrsg.): Umstrittene Geschichte: Ansichten zum Holocaust unter Muslimen im internationalen Vergleich, Frankfurt am Main 2013, S Eine Trivialisierung des Holocaust? Der 23. August als Gedenktag an die Opfer von Stalinismus und Nationalsozialismus, in: Wolfgang Benz (Hrsg.): Ein Kampf um Deutungshoheit. Politik, Opferinteressen und Historische Forschung. Die Auseinandersetzung um die Gedenk- und Begegnungsstätte Leistikowstrasse Potsdam, Berlin 2013, S Linke Stereotypisierungen von Juden und Jüdinnen: Zwischen sekundärem und israelbezogenem Antisemitismus, in: Milena Detzner / Ansgar Drücker (Hrsg.): Antisemitismus ein gefährliches Erbe mit vielen Gesichtern. Handreichung zu Theorie und Praxis, Düsseldorf 2013, S Jüdische Displaced Persons im Nachkriegsdeutschland , in: Anne-Katrin Henkel / Thomas Rahe (Hrsg.): Publizistik in jüdischen Displaced-Persons-Camps. Charakteristik, Medien und bibliothekarische Überlieferung, Frankfurt am Main 2014, S sowie zahlreiche Einträge in: Wolfgang Benz (Hrsg.): Handbuch des Antisemitismus, Bd. 5 und 6, Berlin 2012 und Ullrich, Peter mit Peter Nowak: Diskursive Grauzonen und die Fallstricke der Solidarität. Ein Gespräch mit Peter Ullrich, in: Peter Nowak: Kurze Geschichte der Antisemitismusdebatte in der deutschen Linken, Münster 2013, S Wyrwa, Ulrich»La questione ebraica«. Der Begriff»Judenfrage«in der italienischen Sprache und die Juden in der neueren Geschichte Italiens, in: Manfred Hettling / Michael G. Müller / Guido Hausmann (Hrsg.): Die»Judenfrage«ein europäisches Phänomen?, Berlin 2013, S »L Osservatore Cattolico«and Davide Albertario: Catholic Public Relations and Antisemitic Propaganda in Milan, in: Robert Nemes / Daniel Unowsky (Hrsg.): Sites of European Antisemitism in the Age of Mass Politics , Lebanon NH 2014, S sowie zahlreiche Einträge in: Wolfgang Benz (Hrsg.): Handbuch des Antisemitismus, Bd. 5, Berlin Publikationen in wissenschaftlichen Fachzeitschriften: Axster, Felix Präfixe, Abgrenzungen, Solidarität, in: Zeitschrift für Kulturwissenschaften 8 (2014), Nr. 1, Bergmann, Werner»Nicht aus den Niederungen des Hasses und des Aberglaubens«. Die Negation von Emotionen im Antisemitismus des deutschen Kaiserreichs, in: Geschichte und Gesellschaft 39 (2013), S mit Ulrich Wyrwa: The Making of Antisemitism as a Political Movement. Political History as Cultural History ( ), in: Quest. Issues in Contemporary History 3 (2012), S Ausschreitungen gegen Juden in Litauen im Kontext antijüdischer Gewalt im Europa des 19. und 20. Jahrhunderts: Krisenphasen und die Zunahme des Gewaltniveaus, in: Jahrbuch für Antisemitismusforschung (21) 2012, S mit Anna Verena Münch: Antisemitismus in Deutschland 1996 und 2006 ein Vergleich, in: Jahrbuch für Antisemitismusforschung (21) 2012, S Casquete, Jesús Hitler y el discurso nazi de género, in: Claves de Razón Práctica 224 (2012), S Ein Geschichtswissenschaftler wird Geschichte: Zum Tod von Eric Hobsbawm, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 60 (2012), S Commemorative Calendar and Reproduction of Basque Radical Nationalism, in: Politics, Religion & Ideology 13 (2013), S Símbolos de Navarra, Navarra en sus símbolos, in: Historia Contemporánea 47 (2013), S Un mundo»pequeño«, otro mundo»grande«: el discurso de género del nacionalsocialismo, in: Revista de Estudios Políticos 159 (2013), S Eric Hobsbawm en Berlín, : la forja de un comunista, in: Ayer 96 (2014), S Daniel, Isabelle Ideologie bewirkt Verhalten, in: Journal Exit. Zeitschrift für Deradikalisierung und Demokratische Kultur 3 (2013), S Enzenbach, Isabel Antisemitismus als soziale Praxis, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 62 (2012), S Stamps, stickers and stigmata. A social practice of antisemitim in a slide show, in: Quest. Issues in Contemporary Jewish History 65 (2012), S mit Detlef Pech: Zeitgeschichte thematisieren in der Grundschule. Zum Stand einer Diskussion und ihrer Leerstellen am Beispiel der Thematisierung von Holocaust, Nationalsozialismus und jüdischer Geschichte, in: Medaon 11 (2012), S Antisemitische Karikaturen: An der Nase herumgeführt, 16. August 2015, URL: oesterreich/lernmaterial-unterricht/antisemitismus/antisemitische-karikaturen/antisemitische-karikaturen/ An%20der%20Nase%20herumgefuhrt.pdf. Gailus, Manfred Ist die Aufarbeitung der NS-Zeit beendet? Anmerkungen zur kirchlichen Erinnerungskultur seit der Wende von 1989/90, in: Kirchliche Zeitgeschichte 27 (2014), Nr. 1, S A Crusade, a Holy War: Protestant Preaching in War-time , in: Contemporary Church History Quaterly 20 (2014), Nr. 4. Güven, Dilek Der neue Antisemitismus Kritik an Israel oder Antisemitismus? Das Beispiel Türkei, in: Jahruch für Antisemitismusforschung 23 (2014), S Hopp, Andrea Antijüdische Emotionen adeliger Frauen. Zwei Fallbeispiele ( ), in: Jahrbuch für Antisemitismusforschung 21 (2012), S
62 Publikationen Publikationen Antisemitismus und Emotionen im Europa des 19. Jahrhunderts: ein Kommentar, in: Jahrbuch für Antisemitismusforschung 23 (2014), S Linsler, Carl-Eric mit Michael Kohlstruck, Birgit Glock, Konstanze Dobberke: Die Praxis von Vorurteils- und Gewaltprävention in zwei Berliner Quartieren, in: Berliner Forum Gewaltprävention 14 (2012), Nr. 47, S »Jüdische Erfahrungen des Ersten Weltkriegs«. Die Geschichte der Familie Frank als deutsch-französische Familienbiographie, in: Portal Militärgeschichte, 26. Mai 2014, URL: Lux, Marie-Christin Versteckter Antisemitismus in Frankreich während des Ersten Weltkriegs, in: Das 19. Jahrhundert in Perspektive. Geschichtswissenschaftliche Forschungen aus Deutschland und Frankreich, , URL: hypotheses.org/1787. Zwischen Union sacrée und verstecktem Antisemitismus. Die Beziehungen zwischen Juden und Nicht-Juden in Frankreich während des Ersten Weltkriegs (Projektskizze), in: Portal Militärgeschichte, , URL: Kohlstruck, Michael Strategien gegen Rechtsextremismus, in: Berliner Forum Gewaltprävention, 14 (2012), Nr. 46, S Pädagogische und soziale Arbeit mit»rechtsextremistisch gefährdeten«jungen Leuten ein historischer Überblick, in: Interventionen. Zeitschrift für Verantwortungspädagogik 1 (2012), S mit Birgit Glock, Carl-Eric Linsler und Konstanze Dobberke: Die Praxis von Vorurteils- und Gewaltprävention in zwei Berliner Quartieren, in: Berliner Forum Gewaltprävention 14 (2012), Nr. 47, S Vorurteilsmotivierte Gewalt und Möglichkeiten ihrer Prävention, in: Berliner Forum Gewaltprävention, 14 (2013), Nr. 49, S mit Daniel Krüger: Das Märkerlied und seine Wirkungsgeschichte, in: Der Speicher (Jahresschrift des Kreismuseums Finsterwalde) 15 (2013), S mit Peter Ullrich, unter Mitarbeit von Franziska Paul und Jakob Quentin: Antisemitismus als Problem und Symbol. Phänomene und Interventionen in Berlin, in: Berliner Forum Gewaltprävention 15 (2014) Nr. 52, S Krauß, Joachim Verweigerte Nachbarschaft: Roma in Rumänien, in: Religion und Gesellschaft in Ost und West 9 (2012), S Roma und»zigeuner«in Buch und Medien, in: Religion und Gesellschaft in Ost und West 4 (2013), S Multifunktionale Sündenböcke. Roma in und aus Rumänien, in: DAMID Magazin für Migrations- und Entwicklungspolitik 3/4 (2013), S Maier-Wolthausen, Clemens Eine unmögliche Reise. Ein Brief der Kinder- und Jugendalija in Schweden von 1940, in: Medaon 8 (2014), S Meyer, Winfried Beseitigung eines Zeugen des nationalsozialistischen Krankenmords: Die Ermordung des Gendarmeriemeisters a. D. Jakob Küchle im KZ Sachsenhausen, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 60 (2012), S Sein oder Nichtsein: Der Wiener Jude Dr. Johann Koessler als V-Mann»Kolberg«des deutschen und Doppelagent»Hamlet«des britischen Nachrichtendienstes, in: Journal for Intelligence, Propaganda and Security Studies 6 (2012), Nr. 1, S »Nachhut«-Gefechte. Die Arbeitsgemeinschaft ehemaliger Abwehr-Angehöriger (AGEA), der Bundesnachrichtendienst und die Geschichtsschreibung des deutschen militärischen Nachrichtendienstes im Zweiten Weltkrieg, in: Journal for Intelligence, Propaganda and Security Studies 6 (2012), Nr. 2, S Subtile Reparaturarbeiten am Gehlen-Mythos. Anmerkungen zu Magnus Pahl, Fremde Heere Ost. Hitlers militärische Feindaufklärung (Berlin 2012), in: Journal for Intelligence, Propaganda and Security Studies 7 (2013), Nr. 1, S Schüler-Springorum, Stefanie mit Uffa Jensen: Einführung: Gefühle gegen Juden. Die Emotionsgeschichte des modernen Antisemitismus, in: Geschichte und Gesellschaft 4 (2013), S Juden, zur Sonne, zur Freiheit!, in: Neue Gesellschaft / Frankfurter Hefte 60 (2013), Nr. 5, S mit Uffa Jensen: Antisemitismus und Emotionen, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 28-30/2014, S Ullrich, Peter Fragmentierter Antisemitismus. Aktuelle Befunde und ein Kommentar zur Antisemitismusdebatte, in: MIZ - Materialien und Informationen zur Zeit 42 (2013), S mit Benjamin Wachtler und Christina Schröder:»Da wollte man nichts mehr von Hitler wissen«. Nationalsozialismus und Krieg in Berufsbiographien alter deutscher PsychoanalytikerInnen, in: Psyche Zeitschrift für die Psychoanalyse und ihre Anwendungen 67 (2013), S mit Michael Kohlstruck, unter Mitarbeit von Franziska Paul und Jakob Quentin: Antisemitismus als Problem und Symbol. Phänomene und Interventionen in Berlin, in: Berliner Forum Gewaltprävention 15 (2014) Nr. 52, S Vulesica, Marija How Antisemitic was the Political Catholicism in Croatia-Slavonia around 1900?, in: Quest. Issues in Contemporary Jewish History 3 (2012), S Überlegungen zu einer Jüdischen Geschichte oder zur Geschichte der Juden in Südosteuropa, in: Südosteuropäische Hefte 1 (2012), S »Meine Erinnerungen sind so schrecklich«. Zum Tode der kroatischen Historikern und schweigsamen Zeitzeugin Prof. Dr. Mirjana Gross, in: Südosteuropäische Hefte 1 (2012), S »Und das alles hat mich in ein tagelanges Fieber geworfen«. Ein Zeitungsartikel und seine Wirkung auf den kroatischen Bischof Josip Juraj Strossmayer, in: Jahrbuch für Antisemitismusforschung 23 (2014), S Wetzel, Juliane Erscheinungsformen und Verbreitungen antisemitischer Einstellungen in Deutschland und Europa, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 28-30/2014, S Wyrwa, Ulrich mit Werner Bergmann: The Making of Antisemitism as a Political Movement. Political History as Cultural History ( ), in: Quest. Issues in Contemporary History 3 (2012), S Antisemitic Agitation and the Emergence of Political Catholicism in Mantua around 1900, in: Quest. Issues in Contemporary Jewish History 3 (2012), S The Image of Antisemites in German and Austrian Caricatures, in: Quest. Issues in Contemporary Jewish History 3 (2012), S Antisemitische Emotionen im Europa des 19. Jahrhunderts. Ego-Dokumente, biografische Episoden und poetische Verarbeitungen aus ostmittel- und südeuropäischen Räumen. Eine Einführung, in: Jahrbuch für Antisemitismusforschung 23 (2014), S Der italienische Demokrat Francesco Domenico Guerrazzi und der Ausbruch aufgestauter antisemitischer Aggressionen, in: Jahrbuch für Antisemitismusforschung 23 (2014), S Antisemitismus als Leidenschaft. Biographische Zugänge und europäische Dimensionen. Ein Resümee, in: Jahrbuch für Antisemitismusforschung 23 (2014), S Zum Hundertsten nichts Neues. Deutschsprachige Neuerscheinungen zum Ersten Weltkrieg (Teil I), in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 62 (2014), S Zian, Yasmina Le»colporteur«, le»profiteur«et le»bolchevique«. Trois visions du juif étranger en Belgique marquées par la Première Guerre mondiale, in: Muséon, Revue du Musée Juif de Belgique 6 (2014), S
63 Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler Das ZfA ist seit Jahrzehnten eine zentrale Anlaufstelle für Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler aus dem In- und Ausland, die in Berlin zu den Themenfeldern Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit arbeiten wollen. In den Jahren 2012 bis 2014 begrüßte das ZfA insgesamt dreizehn Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler. Prof. Dr. Yuji Ishida, Universität Tokyo Juli September 2012 Forschungsthema am ZfA: Genozidforschung Dr. Krzysztof Makowski Juli August 2012 Forschungsthema am ZfA: Ethnische Beziehungen in den polnischen Gebieten im 19. und 20. Jahrhundert Dr. Jesus Casquete, Universidad del Pais Vasco, Bilbao seit August 2012 Forschungsthema am ZfA: Blut und Totalitarismus: Die Konstruktion von Nazi-Märtyrern Marcin Siadkowski Oktober 2012 Juli 2014 Forschungsthema am ZfA: Die Beziehung zwischen Polen, Großbritannien, Deutschland und der Zionistischen Bewegung im Kontext der jüdischen Emigration nach Palästina während der Zwischenkriegszeit Prof. Dr. Steven Englund, New York University seit November 2012 Forschungsthema am ZfA: Die Entstehung des Antisemitismus in Deutschland, Österreich und Frankreich im Vergleich Prof. Dr. Shikego Inoue, Universität Sofia Mai 2012 März 2013 Forschungsthema am ZfA: Deutsche Arbeitsfront und Erinnerungskulturen im Vergleich Prof. Dr. András Kovács, Central European University, Budapest April Juni 2013 Forschungsthema am ZfA: Jewish Issues in Communist Archives Prof. Dr. Christhard Hoffmann, University of Bergen Oktober November 2013 Forschungsthema am ZfA: Exploring the Pasts of Immigrants and Minorities: The Emergence of Ethnic History in Europe, Jonathan Judaken, Ph.D., Rhodes College, Memphis Mai 2013 Forschungsthema am ZfA: Critical Theories of Antisemitism: Confronting Modernity and Modern Judeophobia Dr. Uri Ganani, Tel Aviv University Juni Dezember 2014 Forschungsthema am ZfA: The Concept of Innerlichkeit (inwardness) as an Aesthetic and Ideological Category in German-Jewish Modernism Dr. Cordelia Hess, Universität Stockholm Oktober 2014 Forschungsthema am ZfA: Juden im spätmittelalterlichen Deutschordensstaat Preußen Dr. Daniel Mahla, Israel Institute, Washington Oktober Dezember 2014 Forschungsthema am ZfA: Die Einflüsse des europäischen Nationalismus auf die jüdische Orthodoxie Jacob Ari Labendz, Ph.D., Washington University, St. Louis Oktober 2014 Mai 2015 Forschungsthema am ZfA: Jews and the State in Communist Central Europe: The Czech Lands,
64 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Leitung Prof. Dr. Stefanie Schüler Springorum Prof. Dr. Werner Bergmann Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Dr. Marcus Funck Dr. Dilek Güven (seit 2013) Dr. Michael Kohlstruck Dr. Achim Rohde (bis 2013) Dr. Juliane Wetzel Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Projekten Dr. Felix Axster Dr. Carina Baganz Dr. Miriam Bistrović (bis 2014) Patrick Delaney (bis 2014) Dr. Isabel Enzenbach Joachim Krauß (bis 2014) Dr. Clemens Maier-Wolthausen (bis 2014) Dr. Winfried Meyer Dr. Brigitte Mihok Dr. Julijana Ranc Dr. Monika Schmidt (bis 2014) Dr. Marija Vulesica Prof. Dr. Ulrich Wyrwa Außerplanmäßige Professoren und Privatdozenten apl. Prof. Dr. Bernward Dörner PD Dr. Rainer Erb apl. Prof. Dr. Manfred Gailus apl. Prof. Dr. Michael Grüttner Sekretariate Ramona Haubold Carola Haring Bibliothek Dr. Marion Neiss = Tilo Katzmareck Archiv Udo Bartholdy Fellows Dr. Andrea Hopp Dr. Julika Rosenstock Dr. Dr. Peter Ullrich Studentische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Peter Buhr Sarah Dors-Nienas (bis 2014) Carl-Eric Linsler (bis 2013) Jakob Quentin Eva-Lotte Reimer (bis 2014) Claudia Schulz (bis 2013) Fabian Steinbrenner (bis 2015) Tobias Unger Sebastian Vogel Praktikantinnen und Praktikanten Sebastian Bähr (September Oktober 2014) Randi Becker (März April 2014) Julian Ehret (Februar März 2013) Susanna Habannake (Juli August 2014) Lina Henzel (August September 2012) Ramona Huber (Juli August 2013) Jakob Quentin (April Juni 2012) Ida Wittenberg (Februar März 2014)
65 Verein der Freunde und Förderer Der Verein der Freunde und Förderer des Zentrums für Antisemitismusforschung e.v. Verein der Freunde und Förderer Zur materiellen und ideellen Unterstützung der Aktivitäten des Instituts wurde im Frühjahr 1992 der»verein der Freunde und Förderer des Zentrums für Antisemitismusforschung«gegründet. Der Verein hat den Zweck, die Aufgaben des Zentrums für Antisemitismusforschung in Wissenschaft und Forschung zu fördern. Er hilft soweit es in seinen Möglichkeiten steht - bei der Lösung struktureller Schwierigkeiten und bei der Überwindung finanzieller Engpässe. Der Verein beteiligt sich auch an der Finanzierung von Doktorandenstipendien. Mitglieder und Förderer werden zu allen Veranstaltungen des Zentrums eingeladen und erhalten als Jahresgabe eine Publikation des Zentrums. Der Mitgliedsbeitrag ist derzeit auf mindestens 40 Euro festgesetzt. Für Geldzuwendungen kann eine Spendenbescheinigung ausgestellt werden. Vorstandsvorsitzende: Prof. Dr. Dorothee Wierling Stellvertretende Vorsitzende: Dr. Christl Wickert Schriftführerin: Dr. Juliane Wetzel Sollten Sie Interesse daran haben, unsere Arbeit zu unterstützen, dann laden wir Sie herzlich ein, Mitglied in unserem Verein zu werden. Für mehr Informationen wenden Sie sich bitte an: Dr. Juliane Wetzel Zentrum für Antisemitismusforschung Ernst-Reuter-Platz Berlin oder per wetz0154@mailbox.tu-berlin.de
66 128
67 Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin Ernst-Reuter-Platz Berlin
Der Hitler-Stalin-Pakt
 Geschichte Slava Obodzinskiy Der Hitler-Stalin-Pakt Ursachen, Entstehungsgeschichte,Vertragsverhandlungen und Folgen des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspaktes Studienarbeit 1 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis
Geschichte Slava Obodzinskiy Der Hitler-Stalin-Pakt Ursachen, Entstehungsgeschichte,Vertragsverhandlungen und Folgen des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspaktes Studienarbeit 1 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis
Der Nahostkonflikt in Deutschland
 Berlin goes Gaza Der Nahostkonflikt in Deutschland FACH UND SCHULFORM Geschichte/Politische Bildung, 9. Klasse ZEITRAHMEN 4 x 45 min LEHRPLANBEZUG Der Nahostkonflikt: historische Dimensionen; Gründung
Berlin goes Gaza Der Nahostkonflikt in Deutschland FACH UND SCHULFORM Geschichte/Politische Bildung, 9. Klasse ZEITRAHMEN 4 x 45 min LEHRPLANBEZUG Der Nahostkonflikt: historische Dimensionen; Gründung
Inhaltsverzeichnis. Vom Imperialismus in den Ersten Weltkrieg 10. Nach dem Ersten Weltkrieg: Neue Entwürfe für Staat und Gesellschaft
 Inhaltsverzeichnis Vom Imperialismus in den Ersten Weltkrieg 10 Ein erster Blick: Imperialismus und Erster Weltkrieg 12 Der Imperialismus 14 Vom Kolonialismus zum Imperialismus 15 Warum erobern Großmächte
Inhaltsverzeichnis Vom Imperialismus in den Ersten Weltkrieg 10 Ein erster Blick: Imperialismus und Erster Weltkrieg 12 Der Imperialismus 14 Vom Kolonialismus zum Imperialismus 15 Warum erobern Großmächte
Leitbild des Max Mannheimer Studienzentrums
 Leitbild des Max Mannheimer Studienzentrums 1. Einleitung 2. Zielgruppen unserer Bildungsangebote 3. Inhalte und Ziele unserer Arbeit 4. Grundsätze für das Lernen 1 1. Einleitung Das Max Mannheimer Studienzentrum
Leitbild des Max Mannheimer Studienzentrums 1. Einleitung 2. Zielgruppen unserer Bildungsangebote 3. Inhalte und Ziele unserer Arbeit 4. Grundsätze für das Lernen 1 1. Einleitung Das Max Mannheimer Studienzentrum
Russische Philosophen in Berlin
 Russische Philosophen in Berlin Julia Sestakova > Vortrag > Bilder 435 Julia Sestakova Warum wählten russische Philosophen vorzugsweise Berlin als Ziel ihres erzwungenen Exils? Was hatte ihnen das Land
Russische Philosophen in Berlin Julia Sestakova > Vortrag > Bilder 435 Julia Sestakova Warum wählten russische Philosophen vorzugsweise Berlin als Ziel ihres erzwungenen Exils? Was hatte ihnen das Land
WOLFRA MEYER zu UPTRUP. Kampf gegen die. jüdische Weltverschwörung" Propaganda und Antisemitismus der Nationalsozialisten bis METROPOL
 WOLFRA MEYER zu UPTRUP Kampf gegen die jüdische Weltverschwörung" Propaganda und Antisemitismus der Nationalsozialisten 19 19 bis 194 5 METROPOL ... Inhalt.. I. Einleitung.... i i 2. Interpretationen des
WOLFRA MEYER zu UPTRUP Kampf gegen die jüdische Weltverschwörung" Propaganda und Antisemitismus der Nationalsozialisten 19 19 bis 194 5 METROPOL ... Inhalt.. I. Einleitung.... i i 2. Interpretationen des
Qualifikationsphase 1 und 2: Unterrichtsvorhaben III
 Qualifikationsphase 1 und 2: Unterrichtsvorhaben III Thema: Die Zeit des Nationalsozialismus Voraussetzungen, Herrschaftsstrukturen, Nachwirkungen und Deutungen I Übergeordnete Kompetenzen Die Schülerinnen
Qualifikationsphase 1 und 2: Unterrichtsvorhaben III Thema: Die Zeit des Nationalsozialismus Voraussetzungen, Herrschaftsstrukturen, Nachwirkungen und Deutungen I Übergeordnete Kompetenzen Die Schülerinnen
Vor 25 Jahren hat Ungarn ein bedeutendes
 Sperrfrist: 1. April 2014, 18.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der 20-Jahr-Feier des
Sperrfrist: 1. April 2014, 18.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der 20-Jahr-Feier des
Georg-August-Universität Göttingen Modul M.Mus.31 Musik und Kulturanalyse
 Modul M.Mus.31 Musik und Kulturanalyse English title: Music and Cultural Analysis Die Studierenden erwerben in diesem Modul Kenntnisse kulturwissenschaftlicher (im Sinne der cultural studies) und kulturanalytischer
Modul M.Mus.31 Musik und Kulturanalyse English title: Music and Cultural Analysis Die Studierenden erwerben in diesem Modul Kenntnisse kulturwissenschaftlicher (im Sinne der cultural studies) und kulturanalytischer
Stoffverteilungsplan. Pflichtmodul: Nationalsozialismus und deutsches Selbstverständnis
 Buchner informiert C.C.Buchner Verlag Postfach 12 69 96003 Bamberg Stoffverteilungsplan Pflichtmodul: Nationalsozialismus und deutsches Selbstverständnis Epoche: Perspektive: Kategorien: Dimensionen: Neuzeit
Buchner informiert C.C.Buchner Verlag Postfach 12 69 96003 Bamberg Stoffverteilungsplan Pflichtmodul: Nationalsozialismus und deutsches Selbstverständnis Epoche: Perspektive: Kategorien: Dimensionen: Neuzeit
Einleitung. Martin Spieß. in: 100 Jahre akademische Psychologie in Hamburg. Eine Festschrift. Herausgegeben von Martin Spieß. Hamburg, S.
 Einleitung Martin Spieß in: 100 Jahre akademische Psychologie in Hamburg. Eine Festschrift. Herausgegeben von Martin Spieß. Hamburg, 2014. S. 13 14 Hamburg University Press Verlag der Staats- und Universitätsbibliothek
Einleitung Martin Spieß in: 100 Jahre akademische Psychologie in Hamburg. Eine Festschrift. Herausgegeben von Martin Spieß. Hamburg, 2014. S. 13 14 Hamburg University Press Verlag der Staats- und Universitätsbibliothek
Presseberichte. zur Umbenennung der Eduard-Spranger-Schule. in Frankfurt/M
 Presseberichte zur Umbenennung der Eduard-Spranger-Schule in Frankfurt/M JUNI 2017 FR, 7. Juni 2017 http://www.rheinpfalz.de/lokal/landau/artikel/landau-namensgeber-fuer-schule-war-antisemit/ Mittwoch,
Presseberichte zur Umbenennung der Eduard-Spranger-Schule in Frankfurt/M JUNI 2017 FR, 7. Juni 2017 http://www.rheinpfalz.de/lokal/landau/artikel/landau-namensgeber-fuer-schule-war-antisemit/ Mittwoch,
HAUSD E R KUNST. Arbeitsblatt für Schüler und Lehrer der Klassen 7 bis 9 Thema: Geschichte des Haus der Kunst Vom Nationalsozialismus bis heute
 HAUSD E R KUNST Archiv Galerie Dauerausstellung Arbeitsblatt für Schüler und Lehrer der Klassen 7 bis 9 Thema: Geschichte des Haus der Kunst Vom Nationalsozialismus bis heute! DATEN UND FAKTEN Hier tackern
HAUSD E R KUNST Archiv Galerie Dauerausstellung Arbeitsblatt für Schüler und Lehrer der Klassen 7 bis 9 Thema: Geschichte des Haus der Kunst Vom Nationalsozialismus bis heute! DATEN UND FAKTEN Hier tackern
Kinder und Jugendliche - Mit der Reichsbahn in den Tod
 Ausstellung der Initiative Stolpersteine für Konstanz Gegen Vergessen und Intoleranz Kinder und Jugendliche - Mit der Reichsbahn in den Tod 22. Oktober 30. November 2012 Verfolgte und deportierte Kinder
Ausstellung der Initiative Stolpersteine für Konstanz Gegen Vergessen und Intoleranz Kinder und Jugendliche - Mit der Reichsbahn in den Tod 22. Oktober 30. November 2012 Verfolgte und deportierte Kinder
Geschichte erinnert und gedeutet: Wie legitimieren die Bolschewiki ihre Herrschaft? S. 30. Wiederholen und Anwenden S. 32
 Stoffverteilungsplan Nordrhein-Westfalen Schule: 978-3-12-443030-4 Lehrer: Kernplan Geschichte 9. Inhaltsfeld: Neue weltpolitische Koordinaten Russland: Revolution 1917 und Stalinismus 1) Vom Zarenreich
Stoffverteilungsplan Nordrhein-Westfalen Schule: 978-3-12-443030-4 Lehrer: Kernplan Geschichte 9. Inhaltsfeld: Neue weltpolitische Koordinaten Russland: Revolution 1917 und Stalinismus 1) Vom Zarenreich
Synopse zum Pflichtmodul Flucht, Vertreibung und Umsiedlung im Umfeld des Zweiten Weltkrieges
 Synopse zum Pflichtmodul Flucht, Vertreibung und Umsiedlung im Umfeld des Zweiten Weltkrieges Buchners Kolleg Geschichte Ausgabe Niedersachsen Abitur 2018 (ISBN 978-3-661-32017-5) C.C.Buchner Verlag GmbH
Synopse zum Pflichtmodul Flucht, Vertreibung und Umsiedlung im Umfeld des Zweiten Weltkrieges Buchners Kolleg Geschichte Ausgabe Niedersachsen Abitur 2018 (ISBN 978-3-661-32017-5) C.C.Buchner Verlag GmbH
Inhalt. 1 Demokratie Sozialismus Nationalsozialismus. So findet ihr euch im Buch zurecht... 10
 Inhalt So findet ihr euch im Buch zurecht................................ 10 1 Demokratie Sozialismus Nationalsozialismus Das Deutsche Kaiserreich im Zeitalter des Imperialismus Orientierung gewinnen........................................
Inhalt So findet ihr euch im Buch zurecht................................ 10 1 Demokratie Sozialismus Nationalsozialismus Das Deutsche Kaiserreich im Zeitalter des Imperialismus Orientierung gewinnen........................................
Held, Horn, Marvakis Gespaltene Jugend
 Held, Horn, Marvakis Gespaltene Jugend JosefHeld Hans-Werner Horn Athanasios Marvakis Gespaltene Jugend Politische Orientierungen jugendlicher ArbeitnehmerInnen Leske + Budrich, Opladen 1996 Die Deutsche
Held, Horn, Marvakis Gespaltene Jugend JosefHeld Hans-Werner Horn Athanasios Marvakis Gespaltene Jugend Politische Orientierungen jugendlicher ArbeitnehmerInnen Leske + Budrich, Opladen 1996 Die Deutsche
Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Buchpräsentation
 Sperrfrist: 8.Juni 2015, 15.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Buchpräsentation Sinti
Sperrfrist: 8.Juni 2015, 15.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Buchpräsentation Sinti
Archiv Galerie Dauerausstellung
 H A U S D E R K U N S T Archiv Galerie Dauerausstellung Arbeitsblatt für Schüler und Lehrer der Klassen 10 bis 12 Thema: Ausstellungsgeschichte - Vom Propagandainstrument nationalsozialistischer Kunstpolitik
H A U S D E R K U N S T Archiv Galerie Dauerausstellung Arbeitsblatt für Schüler und Lehrer der Klassen 10 bis 12 Thema: Ausstellungsgeschichte - Vom Propagandainstrument nationalsozialistischer Kunstpolitik
Geschichte und Geschehen 4 Bayern (9. Jahrgangsstufe) Kapitel: Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg Obligatorische Inhalte
 Synopse Geschichte Klasse 9 auf Grundlage des Lehrplans 007 Geschichte und Geschehen BY Obligatorische und fakultative Inhalte ISBN 978---80- Themenbereich Lehrplan Geschichte und Geschehen Bayern (9.
Synopse Geschichte Klasse 9 auf Grundlage des Lehrplans 007 Geschichte und Geschehen BY Obligatorische und fakultative Inhalte ISBN 978---80- Themenbereich Lehrplan Geschichte und Geschehen Bayern (9.
Unterrichtsentwurf: Die Ideologie des Nationalsozialismus
 Geschichte Andreas Dick Unterrichtsentwurf: Die Ideologie des Nationalsozialismus Weltanschauung - Grundprinzip und gesellschaftliche Ordnung Unterrichtsentwurf RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITÄT HEIDELBERG Historisches
Geschichte Andreas Dick Unterrichtsentwurf: Die Ideologie des Nationalsozialismus Weltanschauung - Grundprinzip und gesellschaftliche Ordnung Unterrichtsentwurf RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITÄT HEIDELBERG Historisches
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Ich muss wissen, was ich machen will... - Ethik lernen und lehren in der Schule Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Ich muss wissen, was ich machen will... - Ethik lernen und lehren in der Schule Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Darüber spricht man nicht? Jugendforum denk!mal 17
 Darüber spricht man nicht? Jugendforum denk!mal 17 Das Jugendforum denk!mal bietet seit 14 Jahren Berliner Jugendlichen die Chance, öffentlich ihr Engagement gegen Rassismus, Antisemitismus und Ausgrenzung
Darüber spricht man nicht? Jugendforum denk!mal 17 Das Jugendforum denk!mal bietet seit 14 Jahren Berliner Jugendlichen die Chance, öffentlich ihr Engagement gegen Rassismus, Antisemitismus und Ausgrenzung
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg
 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg Schulversuch 41-6623.1-08/231 vom 17. September 2009 Lehrplan für das Berufskolleg Einjähriges Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg Schulversuch 41-6623.1-08/231 vom 17. September 2009 Lehrplan für das Berufskolleg Einjähriges Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife
Aktive Leserlenkung in "Jeder stirbt für sich allein" (Hans Fallada)
 Germanistik Gabriela Augustin Aktive Leserlenkung in "Jeder stirbt für sich allein" (Hans Fallada) Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung Seite 1 2. Leserlenkung von Anfang an Seite 2 3. Die Helden
Germanistik Gabriela Augustin Aktive Leserlenkung in "Jeder stirbt für sich allein" (Hans Fallada) Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung Seite 1 2. Leserlenkung von Anfang an Seite 2 3. Die Helden
Imperialismus und Erster Weltkrieg Hauptschule Realschule Gesamtschule Gymnasium Inhaltsfeld 8: Imperialismus und Erster Weltkrieg
 Imperialismus Hauptschule Realschule Gesamtschule Gymnasium Inhaltsfeld 8: Imperialismus Inhaltsfeld 6: Imperialismus Inhaltsfeld 8: Imperialismus 8. Inhaltsfeld: Imperialismus Inhaltliche Schwerpunkte
Imperialismus Hauptschule Realschule Gesamtschule Gymnasium Inhaltsfeld 8: Imperialismus Inhaltsfeld 6: Imperialismus Inhaltsfeld 8: Imperialismus 8. Inhaltsfeld: Imperialismus Inhaltliche Schwerpunkte
Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule
 Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule Kompetenzbereiche: Sach-, Methoden-, Urteils-, Handlungskompetenz Synopse aller Kompetenzerwartungen Sachkompetenz
Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule Kompetenzbereiche: Sach-, Methoden-, Urteils-, Handlungskompetenz Synopse aller Kompetenzerwartungen Sachkompetenz
15 Minuten Orientierung im Haus und Lösung der Aufgaben, 30 Minuten Vorstellung der Arbeitsergebnisse durch die Gruppensprecher/innen.
 Vorbemerkungen A. Zeiteinteilung bei einem Aufenthalt von ca.90 Minuten: 25 Minuten Vorstellung der Villa Merländer und seiner früheren Bewohner durch Mitarbeiter der NS-Dokumentationsstelle, danach Einteilung
Vorbemerkungen A. Zeiteinteilung bei einem Aufenthalt von ca.90 Minuten: 25 Minuten Vorstellung der Villa Merländer und seiner früheren Bewohner durch Mitarbeiter der NS-Dokumentationsstelle, danach Einteilung
Freundschaft am Arbeitsplatz - Spezifika einer persönlichen Beziehung im beruflichen Umfeld
 Geisteswissenschaft Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz - Spezifika einer persönlichen Beziehung im beruflichen Umfeld Bachelorarbeit Bakkalaureatsarbeit Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz
Geisteswissenschaft Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz - Spezifika einer persönlichen Beziehung im beruflichen Umfeld Bachelorarbeit Bakkalaureatsarbeit Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz
Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg
 Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg Strukturierender Aspekt: Herrschaft und politische Teilhabe; Gewaltsame Konflikte, Verfolgung und Kriege Thema (kursiv = Additum) Die Gegner der Demokratie gewinnen
Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg Strukturierender Aspekt: Herrschaft und politische Teilhabe; Gewaltsame Konflikte, Verfolgung und Kriege Thema (kursiv = Additum) Die Gegner der Demokratie gewinnen
Wie wurde Russland zur Sowjetunion? Welche Erfolge um welchen Preis erzielte das neue Sowjetsystem?
 Schulinternes Lernzkonzept im Fach Geschichte Jg 9.1 Version Dez. 2012-Nic/Gerwin Hinweise: 1. Fettdruck in der 1. Spalte = obligatorische Themen 2. Fettdruck in der 3. Spalte = dominant angestrebte Kompetenz
Schulinternes Lernzkonzept im Fach Geschichte Jg 9.1 Version Dez. 2012-Nic/Gerwin Hinweise: 1. Fettdruck in der 1. Spalte = obligatorische Themen 2. Fettdruck in der 3. Spalte = dominant angestrebte Kompetenz
Geschichte und Geschehen für das Berufskolleg. 1 Lebensformen früher und heute. 1.1 Fit für die Zukunft? Jugend in einer Gesellschaft im Wandel
 Stoffverteilungsplan Geschichte und Geschehen Baden-Württemberg Band: Berufskolleg (978-3-12-416450-4) Schule: Lehrer: Std. Lehrplan für das Berufskolleg (2009) Geschichte mit Gemeinschaftskunde Geschichte
Stoffverteilungsplan Geschichte und Geschehen Baden-Württemberg Band: Berufskolleg (978-3-12-416450-4) Schule: Lehrer: Std. Lehrplan für das Berufskolleg (2009) Geschichte mit Gemeinschaftskunde Geschichte
Die Vertreibung der Sudetendeutschen
 Geschichte Daniela Hendel Die Vertreibung der Sudetendeutschen Studienarbeit 1 Inhaltsverzeichnis Einführung 2-4 1. Vorgeschichte bis zum 2. Weltkrieg 1.1. Der tschechoslowakische Staat und die Sudetendeutschen
Geschichte Daniela Hendel Die Vertreibung der Sudetendeutschen Studienarbeit 1 Inhaltsverzeichnis Einführung 2-4 1. Vorgeschichte bis zum 2. Weltkrieg 1.1. Der tschechoslowakische Staat und die Sudetendeutschen
IDeA Individuelle Entwicklung und Lernförderung
 Projekt EDUCARE Leitbilder 'guter Kindheit' und ungleiches Kinderleben. Bildung, Betreuung und Erziehung aus der Perspektive der Politik, der Professionellen in Kinder tageseinrichtungen und Grundschulen,
Projekt EDUCARE Leitbilder 'guter Kindheit' und ungleiches Kinderleben. Bildung, Betreuung und Erziehung aus der Perspektive der Politik, der Professionellen in Kinder tageseinrichtungen und Grundschulen,
Modulhandbuch für den Studiengang Kunstgeschichte (Ergänzungsfach)
 Modulhandbuch für den Studiengang Kunstgeschichte (Ergänzungsfach) im Bachelorstudium der Philosophischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Stand: 03/2012 Inhaltsübersicht Basismodul I:
Modulhandbuch für den Studiengang Kunstgeschichte (Ergänzungsfach) im Bachelorstudium der Philosophischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Stand: 03/2012 Inhaltsübersicht Basismodul I:
Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Jahrgangsstufe EF
 Unterrichtsvorhaben A: Woran glaubst du? religiöse Orientierung in unserer pluralen Gesellschaft Inhaltsfeld 1: Der Mensch in christlicher Perspektive Inhaltliche Schwerpunkte: Religiosität in der pluralen
Unterrichtsvorhaben A: Woran glaubst du? religiöse Orientierung in unserer pluralen Gesellschaft Inhaltsfeld 1: Der Mensch in christlicher Perspektive Inhaltliche Schwerpunkte: Religiosität in der pluralen
DIGITAL NATIVES, DIGITAL IMMIGRANTS
 DIGITAL NATIVES, DIGITAL IMMIGRANTS ROBERT HELMDACH LUKAS WIEDERHOLD 1. Schlüsselworte Digital Natives, Digital Immigrants, E-Learning, Generation, Millennials, Net Generation, Netzgeneration 2. Kontext
DIGITAL NATIVES, DIGITAL IMMIGRANTS ROBERT HELMDACH LUKAS WIEDERHOLD 1. Schlüsselworte Digital Natives, Digital Immigrants, E-Learning, Generation, Millennials, Net Generation, Netzgeneration 2. Kontext
Sind Lehrkräfte für den Unterricht mit migrationsbedingt mehrsprachigen Schüler_innen (gut) vorbereitet? Wie werden die bisherigen Bemühungen von
 1. Einleitung Die Sprachenvielfalt im heutigen Deutschland wird immer größer. Eine hohe Anzahl an migrationsbedingt mehrsprachigen Schüler_innen an deutschen Schulen ist nicht nur in der gegenwärtigen
1. Einleitung Die Sprachenvielfalt im heutigen Deutschland wird immer größer. Eine hohe Anzahl an migrationsbedingt mehrsprachigen Schüler_innen an deutschen Schulen ist nicht nur in der gegenwärtigen
Stephan Mayer, MdB informiert aus Berlin
 Stephan Mayer, MdB informiert aus Berlin Berlin, 23. Juni 2017 Rede anlässlich der Beratung und Unterrichtung durch die Bundesregierung zum Bericht des Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus am Mittwoch,
Stephan Mayer, MdB informiert aus Berlin Berlin, 23. Juni 2017 Rede anlässlich der Beratung und Unterrichtung durch die Bundesregierung zum Bericht des Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus am Mittwoch,
Unterrichtsvorhaben I:
 Einführungsphase Lehrbuch Vorschläge für konkrete Unterrichtmaterialien Unterrichtsvorhaben I: Thema: Wie Menschen das Fremde, den Fremden und die Fremde wahrnahmen Fremdsein in weltgeschichtlicher Perspektive
Einführungsphase Lehrbuch Vorschläge für konkrete Unterrichtmaterialien Unterrichtsvorhaben I: Thema: Wie Menschen das Fremde, den Fremden und die Fremde wahrnahmen Fremdsein in weltgeschichtlicher Perspektive
Multimediales Archiv jüdischer Autorinnen und Autoren in Berlin
 Multimediales Archiv jüdischer Autorinnen und Autoren in Berlin 1933-1945 Berlin, das kulturelle und literarische Zentrum der Weimarer Republik, wird nach 1933 zum wichtigsten Zentrum jüdischer Kultur
Multimediales Archiv jüdischer Autorinnen und Autoren in Berlin 1933-1945 Berlin, das kulturelle und literarische Zentrum der Weimarer Republik, wird nach 1933 zum wichtigsten Zentrum jüdischer Kultur
Evangelisch in Ständestaat und Nationalsozialismus
 Margit Mayr Evangelisch in Ständestaat und Nationalsozialismus Zur Geschichte der evangelischen Kirche in Österreich unter besonderer Berücksichtigung oberösterreichischer Gemeinden im Ständestaat und
Margit Mayr Evangelisch in Ständestaat und Nationalsozialismus Zur Geschichte der evangelischen Kirche in Österreich unter besonderer Berücksichtigung oberösterreichischer Gemeinden im Ständestaat und
Herman Nohls Schriften und Artikel in der NS-Zeit
 Herman Nohls Schriften und Artikel in der NS-Zeit Dokumente 1933 1945 Fachbereich Erziehungswissenschaften Goethe-Universität Frankfurt am Main Dokumentation ad fontes II Dr. Benjamin Ortmeyer Fachbereich
Herman Nohls Schriften und Artikel in der NS-Zeit Dokumente 1933 1945 Fachbereich Erziehungswissenschaften Goethe-Universität Frankfurt am Main Dokumentation ad fontes II Dr. Benjamin Ortmeyer Fachbereich
Kunst- und Kulturgeschichte
 Leistungs- und Lernziele im Fach Kunst- und Kulturgeschichte (Wahlpflichtfach) 01.08.2008 1. Allgemeine Bildungsziele Zentral im Fach Kunst- und Kulturgeschichte ist einerseits die Auseinandersetzung mit
Leistungs- und Lernziele im Fach Kunst- und Kulturgeschichte (Wahlpflichtfach) 01.08.2008 1. Allgemeine Bildungsziele Zentral im Fach Kunst- und Kulturgeschichte ist einerseits die Auseinandersetzung mit
Die Akzeptanz der Evolution verschiedener Lehramtsstudierendengru... Deutschland und der Türkei
 Die Akzeptanz der Evolution verschiedener Lehramtsstudierendengruppen in Deutschland und der Türkei 09.01.2017 In den letzten Jahrzehnten traten vor allem evangelikale Christen als Gegner der Evolutionstheorie
Die Akzeptanz der Evolution verschiedener Lehramtsstudierendengruppen in Deutschland und der Türkei 09.01.2017 In den letzten Jahrzehnten traten vor allem evangelikale Christen als Gegner der Evolutionstheorie
Arbeitsblatt für Schüler und Lehrer der Klassen 10 bis 12 Thema: Architektur und Geschichte
 H A U S DERK U N S T Archiv Galerie Dauerausstellung Arbeitsblatt für Schüler und Lehrer der Klassen 10 bis 12 Thema: Architektur und Geschichte DATEN UND FAKTEN Hier tackern Das Haus der Kunst wurde von
H A U S DERK U N S T Archiv Galerie Dauerausstellung Arbeitsblatt für Schüler und Lehrer der Klassen 10 bis 12 Thema: Architektur und Geschichte DATEN UND FAKTEN Hier tackern Das Haus der Kunst wurde von
Buchner informiert. Stoffverteilungsplan. Pflichtmodul: Flucht, Vertreibung und Umsiedlung im Umfeld des Zweiten Weltkrieges
 Buchner informiert C.C.Buchner Verlag Postfach 12 69 96003 Bamberg Stoffverteilungsplan Pflichtmodul: Flucht, Vertreibung und Umsiedlung im Umfeld des Zweiten Weltkrieges Epoche: Perspektive: Kategorien:
Buchner informiert C.C.Buchner Verlag Postfach 12 69 96003 Bamberg Stoffverteilungsplan Pflichtmodul: Flucht, Vertreibung und Umsiedlung im Umfeld des Zweiten Weltkrieges Epoche: Perspektive: Kategorien:
9. Anhang: EU - Russland / Ukraine / Türkei. als Mitglieder in der EU: Utopie oder realistische Alternative?
 9. Anhang: EU - Russland / Ukraine / Türkei als Mitglieder in der EU: Utopie oder realistische Alternative? SS 2009 Prof. Dr. Friedrich Schneider, University of Linz, AUSTRIA 1 1. Einleitung 2. Einige
9. Anhang: EU - Russland / Ukraine / Türkei als Mitglieder in der EU: Utopie oder realistische Alternative? SS 2009 Prof. Dr. Friedrich Schneider, University of Linz, AUSTRIA 1 1. Einleitung 2. Einige
Rassismus in der Gesellschaft
 Geisteswissenschaft Anonym Rassismus in der Gesellschaft Examensarbeit Universität Paderborn Fakultät für Kulturwissenschaften Institut für Humanwissenschaften Fach: Soziologie Rassismus in der Gesellschaft
Geisteswissenschaft Anonym Rassismus in der Gesellschaft Examensarbeit Universität Paderborn Fakultät für Kulturwissenschaften Institut für Humanwissenschaften Fach: Soziologie Rassismus in der Gesellschaft
Schönbuch-Gymnasium Holzgerlingen Curriculum des Faches Geschichte für die Kursstufe (2-stündig)
 Schönbuch-Gymnasium Holzgerlingen Curriculum des Faches Geschichte für die Kursstufe (2-stündig) Jahrgangsstufe Kompetenzen und Inhalte des Bildungsplans 1. PROZESSE DER MODERNISIERUNG IN WIRTSCHAFT, POLITIK
Schönbuch-Gymnasium Holzgerlingen Curriculum des Faches Geschichte für die Kursstufe (2-stündig) Jahrgangsstufe Kompetenzen und Inhalte des Bildungsplans 1. PROZESSE DER MODERNISIERUNG IN WIRTSCHAFT, POLITIK
Profilstudium Bildungstheorie und Bildungsforschung
 Profilstudium Bildungstheorie und Bildungsforschung Master of Arts Erziehungswissenschaft Prof. Dr. Ruprecht Mattig Systematische Erziehungswissenschaft Prof. Dr. Ulrike Mietzner Historische Bildungsforschung
Profilstudium Bildungstheorie und Bildungsforschung Master of Arts Erziehungswissenschaft Prof. Dr. Ruprecht Mattig Systematische Erziehungswissenschaft Prof. Dr. Ulrike Mietzner Historische Bildungsforschung
Letzte Bücher aus der DDR Premieren & Bestseller 1989/90
 I: 1989 Revolution im Leseland Wenige Monate vor ihrem politischen Ende durch den Mut vieler Bürgerinnen und Bürger in der Friedlichen Revolution 1989/90 präsentierte sich die DDR in der Bundesrepublik
I: 1989 Revolution im Leseland Wenige Monate vor ihrem politischen Ende durch den Mut vieler Bürgerinnen und Bürger in der Friedlichen Revolution 1989/90 präsentierte sich die DDR in der Bundesrepublik
Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen
 Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen Eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung in Kooperation mit Prof. Dr. Dr. Helmut Schneider (Steinbeis-Hochschule Berlin) Seite 2 Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen
Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen Eine Untersuchung der Bertelsmann Stiftung in Kooperation mit Prof. Dr. Dr. Helmut Schneider (Steinbeis-Hochschule Berlin) Seite 2 Jugendliche aus Sicht der Erwachsenen
entschieden war. Nach dem Zweiten Weltkrieg folgte der mühsame Neuaufbau, der die Schule noch einmal erfolgreich ihre Arbeit aufnehmen ließ.
 Einleitung Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Geschichte einer Mädchenschule. Sie untersucht Voraussetzungen, Zielsetzungen und Ausprägungen der Mädchen- und Frauenbildung an einer katholischen
Einleitung Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Geschichte einer Mädchenschule. Sie untersucht Voraussetzungen, Zielsetzungen und Ausprägungen der Mädchen- und Frauenbildung an einer katholischen
Österreich im dritten Reich
 Österreich im dritten Reich Von Sandra von Zniniewicz Klasse: 12 FOS a Projekt: Klassenfahrt (Wien) Lehrer: Hr. Gunkel Gliederung 1. Einleitung 1 Seite 2. Hitler Österreich 2-3 3. Österreich Deutschland
Österreich im dritten Reich Von Sandra von Zniniewicz Klasse: 12 FOS a Projekt: Klassenfahrt (Wien) Lehrer: Hr. Gunkel Gliederung 1. Einleitung 1 Seite 2. Hitler Österreich 2-3 3. Österreich Deutschland
Rede des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesministerin für Bildung und Forschung, Thomas Rachel, MdB
 Rede des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesministerin für Bildung und Forschung, Thomas Rachel, MdB anlässlich der Eröffnung der Ausstellung Unbekanntes Kasachstan. Archaölogie im Herzen Asiens
Rede des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesministerin für Bildung und Forschung, Thomas Rachel, MdB anlässlich der Eröffnung der Ausstellung Unbekanntes Kasachstan. Archaölogie im Herzen Asiens
Geschichte eines Buches: Adolf Hitlers,Mein Kampf
 Othmar Plöckinger Geschichte eines Buches: Adolf Hitlers,Mein Kampf 1922-1945 Eine Veröffentlichung des Instituts für Zeitgeschichte R. Oldenbourg Verlag München 2006 Inhaltsverzeichnis Vorwort IX Einleitung
Othmar Plöckinger Geschichte eines Buches: Adolf Hitlers,Mein Kampf 1922-1945 Eine Veröffentlichung des Instituts für Zeitgeschichte R. Oldenbourg Verlag München 2006 Inhaltsverzeichnis Vorwort IX Einleitung
Analyse der Tagebücher der Anne Frank
 Germanistik Amely Braunger Analyse der Tagebücher der Anne Frank Unter Einbeziehung der Theorie 'Autobiografie als literarischer Akt' von Elisabeth W. Bruss Studienarbeit 2 INHALTSVERZEICHNIS 2 1. EINLEITUNG
Germanistik Amely Braunger Analyse der Tagebücher der Anne Frank Unter Einbeziehung der Theorie 'Autobiografie als literarischer Akt' von Elisabeth W. Bruss Studienarbeit 2 INHALTSVERZEICHNIS 2 1. EINLEITUNG
Fragen an die Ausstellung Krefeld und der Nationalsozialismus
 Die Ausstellung und der Fragebogen Die in den Ausstellungsräumen aushängenden Fragen mit den zusammenfassenden Überschriften der Räume sollen eine Hilfestellung zur Orientierung der Besucherinnen und Besucher
Die Ausstellung und der Fragebogen Die in den Ausstellungsräumen aushängenden Fragen mit den zusammenfassenden Überschriften der Räume sollen eine Hilfestellung zur Orientierung der Besucherinnen und Besucher
Deutsche im spanischen Bürgerkrieg
 Deutsche im spanischen Bürgerkrieg von Werner Abel - erschienen in der Litterata am Donnerstag, Juli 09, 2015 Neuerscheinung: Biographisches Lexikon. Deutsche im spanischen Bürgerkrieg. Werner Abel und
Deutsche im spanischen Bürgerkrieg von Werner Abel - erschienen in der Litterata am Donnerstag, Juli 09, 2015 Neuerscheinung: Biographisches Lexikon. Deutsche im spanischen Bürgerkrieg. Werner Abel und
I. Begrüßung Liedzitat
 Sperrfrist: 25.01.2012, 11:00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort Rede des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Bernd Sibler, anlässlich des Festakts Partnerschaft zwischen
Sperrfrist: 25.01.2012, 11:00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort Rede des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Bernd Sibler, anlässlich des Festakts Partnerschaft zwischen
Anhang: Modulbeschreibung
 Anhang: Modulbeschreibung Modul 1: Religionsphilosophie und Theoretische Philosophie (Pflichtmodul, 10 CP) - Ansätze aus Geschichte und Gegenwart im Bereich der Epistemologie und Wissenschaftstheorie sowie
Anhang: Modulbeschreibung Modul 1: Religionsphilosophie und Theoretische Philosophie (Pflichtmodul, 10 CP) - Ansätze aus Geschichte und Gegenwart im Bereich der Epistemologie und Wissenschaftstheorie sowie
PRESSEMAPPE INHALTSVERZEICHNIS. ABLAUF PRESSEKONFERENZ 06.06.2016, 11 Uhr
 PRESSEMAPPE INHALTSVERZEICHNIS Presseinformation Biografie Steffi Brandl und Ausstellungstexte Pressebilder ABLAUF PRESSEKONFERENZ 06.06.2016, 11 Uhr Thomas Köhler Direktor der Berlinischen Galerie Manfred
PRESSEMAPPE INHALTSVERZEICHNIS Presseinformation Biografie Steffi Brandl und Ausstellungstexte Pressebilder ABLAUF PRESSEKONFERENZ 06.06.2016, 11 Uhr Thomas Köhler Direktor der Berlinischen Galerie Manfred
Synopse zum Pflichtmodul Nationalstaatsbildung im Vergleich. Buchners Kolleg Geschichte Ausgabe Niedersachsen Abitur 2018 (ISBN )
 Synopse zum Pflichtmodul Nationalstaatsbildung im Vergleich Buchners Kolleg Geschichte Ausgabe Niedersachsen Abitur 2018 (ISBN 978-3-661-32017-5) C.C.Buchner Verlag GmbH & Co. KG Telefon +49 951 16098-200
Synopse zum Pflichtmodul Nationalstaatsbildung im Vergleich Buchners Kolleg Geschichte Ausgabe Niedersachsen Abitur 2018 (ISBN 978-3-661-32017-5) C.C.Buchner Verlag GmbH & Co. KG Telefon +49 951 16098-200
Thema: Nationalismus, Nationalstaat und deutsche Identität im 20. Jahrhundert
 Qualifikationsphase 2: Unterrichtsvorhaben IV Thema: Nationalismus, Nationalstaat und deutsche Identität im 20. Jahrhundert I Übergeordnete Kompetenzen en ordnen historische Ereignisse, Personen, Prozesse
Qualifikationsphase 2: Unterrichtsvorhaben IV Thema: Nationalismus, Nationalstaat und deutsche Identität im 20. Jahrhundert I Übergeordnete Kompetenzen en ordnen historische Ereignisse, Personen, Prozesse
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Der Nationalsozialismus - Die Geschichte einer Katastrophe
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Der Nationalsozialismus - Die Geschichte einer Katastrophe Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 7.-10. Schuljahr
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Der Nationalsozialismus - Die Geschichte einer Katastrophe Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 7.-10. Schuljahr
Geschichte - betrifft uns
 1983 9 Weltwirtschaftskrise 1929-1933, Ursachen und Folgen (n.v.) 10 Armut und soziale Fürsorge vor der Industrialisierung 11 Frieden durch Aufrüstung oder Abrüstung 1918-1939 12 Europa zwischen Integration
1983 9 Weltwirtschaftskrise 1929-1933, Ursachen und Folgen (n.v.) 10 Armut und soziale Fürsorge vor der Industrialisierung 11 Frieden durch Aufrüstung oder Abrüstung 1918-1939 12 Europa zwischen Integration
Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe Geschichte. Wahrnehmungskompetenz für Kontinuität und Veränderung in der Zeit
 Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe Geschichte Matrix Kompetenzanbahnung Kompetenzbereiche, und Themenfelder Durch die Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Aspekten der Themenfelder in den Kurshalbjahren
Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe Geschichte Matrix Kompetenzanbahnung Kompetenzbereiche, und Themenfelder Durch die Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Aspekten der Themenfelder in den Kurshalbjahren
Wissenschaftspropädeutik Gymnasium > Universität? Prof. Dr. A. Loprieno, 4. HSGYM-Herbsttagung, 12. November 2015
 Wissenschaftspropädeutik Gymnasium > Universität? Prof. Dr. A. Loprieno, 4. HSGYM-Herbsttagung, 12. November 2015 Gymnasium > Universität in historischer Perspektive Das frühneuzeitliche Modell (1500-1848):
Wissenschaftspropädeutik Gymnasium > Universität? Prof. Dr. A. Loprieno, 4. HSGYM-Herbsttagung, 12. November 2015 Gymnasium > Universität in historischer Perspektive Das frühneuzeitliche Modell (1500-1848):
Praxisbeispiel: freie Träger
 Praxisbeispiel: freie Träger Beratungsstelle für Angehörige von Inhaftierten in Nürnberg Fachtagung zur Arbeit mit Angehörigen von Inhaftierten am 09.12.2016 Ein Verein zwischen den Stühlen Fokus auf Familie
Praxisbeispiel: freie Träger Beratungsstelle für Angehörige von Inhaftierten in Nürnberg Fachtagung zur Arbeit mit Angehörigen von Inhaftierten am 09.12.2016 Ein Verein zwischen den Stühlen Fokus auf Familie
Buchner informiert. Vorläufiger Rahmenlehrplan Gymnasiale Oberstufe Geschichte, Land Brandenburg
 Vorläufiger Rahmenlehrplan Gymnasiale Oberstufe Geschichte, Land Brandenburg Buchners Kolleg Geschichte Ausgabe Brandenburg C. C. BUCHNERS VERLAG 1. Kurshalbjahr: Wandel und Revolutionen in Vormoderne
Vorläufiger Rahmenlehrplan Gymnasiale Oberstufe Geschichte, Land Brandenburg Buchners Kolleg Geschichte Ausgabe Brandenburg C. C. BUCHNERS VERLAG 1. Kurshalbjahr: Wandel und Revolutionen in Vormoderne
Das Tagebuch eines Radfahrbataillons aus dem Zweiten Weltkrieg auswerten 9/10 A 2
 Das Tagebuch eines Radfahrbataillons aus dem Zweiten Weltkrieg auswerten 9/10 A 2 Aufgabenstellung und Material In der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer
Das Tagebuch eines Radfahrbataillons aus dem Zweiten Weltkrieg auswerten 9/10 A 2 Aufgabenstellung und Material In der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer
Romani Rose Rede ERIAC, Berlin, 08. Juni 2017
 Romani Rose Rede ERIAC, Berlin, 08. Juni 2017 Sehr geehrter Staatsminister Roth, sehr geehrter Herr Generalsekretär Jagland, sehr geehrter Herr Soros, sehr geehrter Herr Bundesbeauftragter Koschyk, sehr
Romani Rose Rede ERIAC, Berlin, 08. Juni 2017 Sehr geehrter Staatsminister Roth, sehr geehrter Herr Generalsekretär Jagland, sehr geehrter Herr Soros, sehr geehrter Herr Bundesbeauftragter Koschyk, sehr
Schmerzhafte Erinnerung Die Ulmer Juden und der Holocaust
 Den jüdischen Bürgern im Gedächtnis der Stadt ihre eigene Geschichte und ihren Anteil an der Stadtgeschichte zurückzugeben. Dies ist der Anspruch von Alfred Moos und Silvester Lechner, langjähriger Leiter
Den jüdischen Bürgern im Gedächtnis der Stadt ihre eigene Geschichte und ihren Anteil an der Stadtgeschichte zurückzugeben. Dies ist der Anspruch von Alfred Moos und Silvester Lechner, langjähriger Leiter
Der Kanton Solothurn vor 100 Jahren Donnerstag, 27. November 2014, Uhr Museum Blumenstein, Solothurn. Kurzansprache Regierungsrat Dr.
 1 Es gilt das gesprochene Wort Der Kanton Solothurn vor 100 Jahren Donnerstag, 27. November 2014, 19.00 Uhr Museum Blumenstein, Solothurn Kurzansprache Regierungsrat Dr. Remo Ankli Sehr geehrter Herr Stadtpräsident
1 Es gilt das gesprochene Wort Der Kanton Solothurn vor 100 Jahren Donnerstag, 27. November 2014, 19.00 Uhr Museum Blumenstein, Solothurn Kurzansprache Regierungsrat Dr. Remo Ankli Sehr geehrter Herr Stadtpräsident
Methodenkompetenz: Die SuS erfassen unterschiedliche Perspektiven sowie kontroverse Standpunkte und geben sie zutreffend wieder.
 Inhaltsfeld : Neue weltpolitische Koordination - Russland: Revolution 117 und Stalinismus - USA: Aufstieg zur Weltmacht Kompetenzen beschreiben Zusammenhänge zwischen Vergangenheit und Gegen-wart unter
Inhaltsfeld : Neue weltpolitische Koordination - Russland: Revolution 117 und Stalinismus - USA: Aufstieg zur Weltmacht Kompetenzen beschreiben Zusammenhänge zwischen Vergangenheit und Gegen-wart unter
Studienkurs. Politikwissenschaft. Samuel Salzborn. Demokratie. Theorien, Formen, Entwicklungen. Nomos
 Studienkurs Politikwissenschaft Samuel Salzborn Demokratie Theorien, Formen, Entwicklungen Nomos 3782 Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage Böhlau Verlag Wien Köln Weimar Verlag Barbara Budrich Opladen
Studienkurs Politikwissenschaft Samuel Salzborn Demokratie Theorien, Formen, Entwicklungen Nomos 3782 Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage Böhlau Verlag Wien Köln Weimar Verlag Barbara Budrich Opladen
"Euthanasie" im NS-Staat: Die "Vernichtung lebensunwerten Lebens" Click here if your download doesn"t start automatically
 "Euthanasie" im NS-Staat: Die "Vernichtung lebensunwerten Lebens" Click here if your download doesn"t start automatically "Euthanasie" im NS-Staat: Die "Vernichtung lebensunwerten Lebens" Ernst Klee "Euthanasie"
"Euthanasie" im NS-Staat: Die "Vernichtung lebensunwerten Lebens" Click here if your download doesn"t start automatically "Euthanasie" im NS-Staat: Die "Vernichtung lebensunwerten Lebens" Ernst Klee "Euthanasie"
Selbstüberprüfung: Europa und die Welt im 19. Jahrhundert. 184
 3 01 Europa und die Welt im 19 Jahrhundert 8 Orientierung: Vormärz und Revolution (1815 1848) 10 Entstehung, Entwicklung und Unterdrückung der liberal-nationalen Bewegung (1813/15 1848) 12 Training: Interpretation
3 01 Europa und die Welt im 19 Jahrhundert 8 Orientierung: Vormärz und Revolution (1815 1848) 10 Entstehung, Entwicklung und Unterdrückung der liberal-nationalen Bewegung (1813/15 1848) 12 Training: Interpretation
DIE IDEOLOGIE DES NATIONALSOZIALISMUS
 Bernd Mütter - Falk Pingel DIE IDEOLOGIE DES NATIONALSOZIALISMUS Unterichtsmodell und Arbeitsbuch für die Sekundarstufe II Studienverlag Dr. N. Brockmeyer Bochum 1988 Inhalt Vorwort 9 A. SACHANALYSE 13
Bernd Mütter - Falk Pingel DIE IDEOLOGIE DES NATIONALSOZIALISMUS Unterichtsmodell und Arbeitsbuch für die Sekundarstufe II Studienverlag Dr. N. Brockmeyer Bochum 1988 Inhalt Vorwort 9 A. SACHANALYSE 13
Themenüberblick 11.1: Wie modern wurde die Welt um 1800?... 10
 Themenüberblick 11.1: Wie modern wurde die Welt um 1800?.................. 10 Kapitel 1: Die politischen Revolutionen in Amerika und Frankreich Ende des 18. Jahrhunderts............................ 14
Themenüberblick 11.1: Wie modern wurde die Welt um 1800?.................. 10 Kapitel 1: Die politischen Revolutionen in Amerika und Frankreich Ende des 18. Jahrhunderts............................ 14
Die Zwanziger Jahre Tanz auf dem Vulkan Aufgabenteil A und B
 A Beobachtungsaufgaben Eine oder mehrere der jeweils vier (a d) genannten Lösungen sind richtig. Markiere den entsprechenden Buchstaben durch Umkreisen! A1 Im Zuge der Inflation fehlte es zahlreichen Menschen
A Beobachtungsaufgaben Eine oder mehrere der jeweils vier (a d) genannten Lösungen sind richtig. Markiere den entsprechenden Buchstaben durch Umkreisen! A1 Im Zuge der Inflation fehlte es zahlreichen Menschen
man könnte fast sagen: Ingolstadt ist zur Zeit historische Kapitale des Freistaats!
 Sperrfrist: 11. Juni 2015, 15.30 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der Eröffnung
Sperrfrist: 11. Juni 2015, 15.30 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der Eröffnung
DEKOLONISIERUNG. Prof. Dr. Marc Frey Modul: Internationale Beziehungen in Vergangenheit und Gegenwart
 DEKOLONISIERUNG Prof. Dr. Marc Frey Modul: Internationale Beziehungen in Vergangenheit und Gegenwart Gegenstand Epoche: ~1918 - ~1965 Ende der Kolonialreiche Entstehen neuer Staaten Nord-Süd-Beziehungen
DEKOLONISIERUNG Prof. Dr. Marc Frey Modul: Internationale Beziehungen in Vergangenheit und Gegenwart Gegenstand Epoche: ~1918 - ~1965 Ende der Kolonialreiche Entstehen neuer Staaten Nord-Süd-Beziehungen
Critical Whiteness/ Anti- Rassismus Seminar am 26./ in Köln
 Critical Whiteness/ Anti- Rassismus Seminar am 26./27. 11 2011 in Köln Samstag, 26.11. 1) Speeddating- Was bedeutet Weiss sein für uns? 2) Was bedeutet Rassismus für uns? 3) Individueller Zeitstrahl über
Critical Whiteness/ Anti- Rassismus Seminar am 26./27. 11 2011 in Köln Samstag, 26.11. 1) Speeddating- Was bedeutet Weiss sein für uns? 2) Was bedeutet Rassismus für uns? 3) Individueller Zeitstrahl über
Eröffnung der Ausstellung Die Tafelrunde. Egon Schiele und sein Kreis in der Österreichischen Galerie Belvedere in Wien, am 13.
 Eröffnung der Ausstellung Die Tafelrunde. Egon Schiele und sein Kreis in der Österreichischen Galerie Belvedere in Wien, am 13. Juni 2006 Meine Damen und Herren! Einst verpönt, ist Egon Schiele zu einem
Eröffnung der Ausstellung Die Tafelrunde. Egon Schiele und sein Kreis in der Österreichischen Galerie Belvedere in Wien, am 13. Juni 2006 Meine Damen und Herren! Einst verpönt, ist Egon Schiele zu einem
Material-Anhang: Erscheinungsformen des Antisemitismus Zitate. Ach, die Juden haben Jesus. nicht umgebracht?
 Material-Anhang: Erscheinungsformen des Zitate Ach, die Juden haben Jesus nicht umgebracht? Und du, bist du eigentlich Jude? Sag ich dir gleich, aber was bist du denn? Ich, ich bin normal. Was ist denn
Material-Anhang: Erscheinungsformen des Zitate Ach, die Juden haben Jesus nicht umgebracht? Und du, bist du eigentlich Jude? Sag ich dir gleich, aber was bist du denn? Ich, ich bin normal. Was ist denn
Rassismus Perspektiven & Widerstände
 Zülfukar Çetin Savaş Taş (Hg.) Gespräche über Rassismus Perspektiven & Widerstände Yılmaz-Günay Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation
Zülfukar Çetin Savaş Taş (Hg.) Gespräche über Rassismus Perspektiven & Widerstände Yılmaz-Günay Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation
Es gilt das gesprochene Wort!
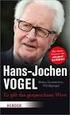 Rede von Herrn Oberbürgermeister Jürgen Roters anlässlich des Empfangs der ehemaligen Kölnerinnen und Kölner jüdischen Glaubens am 10. September 2014, 11:30 Uhr, Historisches Rathaus, Hansasaal Es gilt
Rede von Herrn Oberbürgermeister Jürgen Roters anlässlich des Empfangs der ehemaligen Kölnerinnen und Kölner jüdischen Glaubens am 10. September 2014, 11:30 Uhr, Historisches Rathaus, Hansasaal Es gilt
Ausstellung und Veranstaltungen. Befreiung Besetzung Neuanfang Erfahrungen im Jahr 1945
 Ausstellung und Veranstaltungen Befreiung Besetzung Neuanfang Erfahrungen im Jahr 1945 7. Mai 24. Juni 2015 Ausstellung Befreiung Besetzung Neuanfang Erfahrungen im Jahr 1945 7. Mai 24. Juni 2015 Vor 70
Ausstellung und Veranstaltungen Befreiung Besetzung Neuanfang Erfahrungen im Jahr 1945 7. Mai 24. Juni 2015 Ausstellung Befreiung Besetzung Neuanfang Erfahrungen im Jahr 1945 7. Mai 24. Juni 2015 Vor 70
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt: Napoleon Bonaparte - Der Herrscher über Europa
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Napoleon Bonaparte - Der Herrscher über Europa Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 6.-10. Schuljahr
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Napoleon Bonaparte - Der Herrscher über Europa Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 6.-10. Schuljahr
6215/J XXIV. GP. Dieser Text ist elektronisch textinterpretiert. Abweichungen vom Original sind möglich. ANFRAGE
 6215/J XXIV. GP - Anfrage 1 von 6 6215/J XXIV. GP Eingelangt am 09.07.2010 ANFRAGE der Abgeordneten Kitzmüller und weiterer Abgeordneten an den Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten
6215/J XXIV. GP - Anfrage 1 von 6 6215/J XXIV. GP Eingelangt am 09.07.2010 ANFRAGE der Abgeordneten Kitzmüller und weiterer Abgeordneten an den Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten
Berlin Gedenkstätte "Stille Helden" in Berlin
 Berlin Gedenkstätte "Stille Helden" in Berlin Geschichte Diese Gedenkstätte erinnert an jene mutigen Menschen, die während der nationalsozialistischen Diktatur verfolgten Juden beistanden. Oft werden sie
Berlin Gedenkstätte "Stille Helden" in Berlin Geschichte Diese Gedenkstätte erinnert an jene mutigen Menschen, die während der nationalsozialistischen Diktatur verfolgten Juden beistanden. Oft werden sie
3. Zwangssterilisation
 Zwangssterilisation Einführung und Bearbeitungsmöglichkeiten 3. Zwangssterilisation Einführung Mit der Zwangssterilisation begann der Völkermord an Sinti und Roma 1933 auf einer anfangs formalrechtlichen
Zwangssterilisation Einführung und Bearbeitungsmöglichkeiten 3. Zwangssterilisation Einführung Mit der Zwangssterilisation begann der Völkermord an Sinti und Roma 1933 auf einer anfangs formalrechtlichen
Liebe Seminargäste, liebe Freundinnen und Freunde der Gustav-Heinemann-Bildungsstätte,
 NEWSLETTER 11 I 2013 Liebe Seminargäste, liebe Freundinnen und Freunde der Gustav-Heinemann-Bildungsstätte, vor wenigen Wochen ist unser Programmheft für das Jahr 2014 erschienen. Wir freuen uns sehr,
NEWSLETTER 11 I 2013 Liebe Seminargäste, liebe Freundinnen und Freunde der Gustav-Heinemann-Bildungsstätte, vor wenigen Wochen ist unser Programmheft für das Jahr 2014 erschienen. Wir freuen uns sehr,
Fußballberichterstattung in der NS-Zeit
 Geschichte Tobias Bunse Fußballberichterstattung in der NS-Zeit Eine Analyse der Fachzeitschrift "Der Kicker" Examensarbeit Fußballberichterstattung in der NS-Zeit Schriftliche Hausarbeit vorgelegt im
Geschichte Tobias Bunse Fußballberichterstattung in der NS-Zeit Eine Analyse der Fachzeitschrift "Der Kicker" Examensarbeit Fußballberichterstattung in der NS-Zeit Schriftliche Hausarbeit vorgelegt im
Es ist mir eine große Freude, heute das Zentrum für Israel-Studien an der Ludwig- Maximilians-Universität München mit Ihnen feierlich zu eröffnen.
 Sperrfrist: 3.Juni 2015, 19.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung des Zentrums
Sperrfrist: 3.Juni 2015, 19.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung des Zentrums
Nichts ist verloren wenn Du es erzählst
 Nichts ist verloren wenn Du es erzählst Familie Rosenberg im Zwangslager Berlin-Marzahn, um 1938 Jugendforum denk!mal 16 Seit vielen Jahren bietet das Jugendforum denk!mal Berliner Jugendlichen die Chance,
Nichts ist verloren wenn Du es erzählst Familie Rosenberg im Zwangslager Berlin-Marzahn, um 1938 Jugendforum denk!mal 16 Seit vielen Jahren bietet das Jugendforum denk!mal Berliner Jugendlichen die Chance,
Abschlussveranstaltung des DFG- Graduiertenkollegs Kunst und Technik , 19 Uhr, TUHH, Denickestr. 22, Audimax II
 Seite 1 von 8 Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wissenschaft und Forschung DIE SENATORIN Abschlussveranstaltung des DFG- Graduiertenkollegs Kunst und Technik 21.1.2014, 19 Uhr, TUHH, Denickestr.
Seite 1 von 8 Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wissenschaft und Forschung DIE SENATORIN Abschlussveranstaltung des DFG- Graduiertenkollegs Kunst und Technik 21.1.2014, 19 Uhr, TUHH, Denickestr.
