Die erste Umweltenzyklika Laudato si : Ein neues Kapitel der katholischen Soziallehre
|
|
|
- Waldemar Meissner
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Jahrbuch des Vereins zum Schutz der Bergwelt (München), 81./82. Jahrgang 2016/17, S Die erste Umweltenzyklika Laudato si : Ein neues Kapitel der katholischen Soziallehre von Markus Vogt Keywords: ganzheitliche Ökologie; Humanökologie, Klima als Kollektivgut; buen vivir (gutes Leben) Laudato si ist die erste Umweltenzyklika der katholischen Kirche. Sie begreift den Klimawandel als epochale Herausforderung für die Zukunft der Menschheit, für globale und intergenerationelle Gerechtigkeit sowie für eine Revision des Naturverhältnisses. Ihr Leitbegriff ist ganzheitliche Ökologie, die systemtheoretische, ethisch-sozialökologische und schöpfungstheologische Dimensionen verbindet. In radikaler Kritik der gegenwärtigen Lebens- und Wirtschaftsstile fordert die Enzyklika eine ökologische Umkehr besonders der reichen Nationen sowie jedes Einzelnen. 1. Der katholische Verspätungsfaktor Die von Papst Franziskus am Pfingstsonntag, den 25. Mai 2015 erlassene Enzyklika Laudato si ( Gelobt seist Du, mein Herr! ) (Abb. 1 und 2) ist ein Meilenstein in der Entwicklung der katholischen Soziallehre. Erstmals wird das komplexe Themenfeld der ökologischen Herausforderung umfassend auf der Ebene der päpstlichen Lehrschreiben behandelt. Damit schlägt sie ein neues Kapitel der Lehrverkündigung auf. In diesem Mut zu einer radikalen thematischen Erweiterung ist sie mit der Enzyklika Populorum progressio vergleichbar, die Paul VI veröffentlichte und die zur Magna Charta kirchlicher Entwicklungszusammenarbeit wurde. Der rote Faden von Laudato si ist das Postulat einer ganzheitlichen Ökologie, das an die Wendung ganzheitliche Entwicklung aus der Entwicklungsenzyklika Pauls VI. anknüpft (vgl. Paul VI 1967, bes. Nr. 6-11). Es stellt diese jedoch erstmals konsequent unter den Anspruch ökologischer Erneuerung. Denn ohne eine solche alle Handlungsfelder durchdringende Erneuerung sind heute weder globale und intergenerationelle Gerechtigkeit noch humanverträgliche Technik zu denken. Angesichts der Dringlichkeit der Thematik, die angesichts ihrer existentiellen Bedeutung religiöse Dimensionen einschließt, ist es nicht erklärungsbedürftig, warum sich die katholische Kirche dazu äußert, sondern vielmehr, warum sie dies erst jetzt tut. Nach durchaus weitblickenden und klaren Worten der Päpste und vieler Bischöfe zu Umweltfragen in den 1960er, 70er und 80er Jahren (vgl. Vogt 2013, ) hat die Umweltenzyklika lange auf sich warten lassen. Man kann dies katholischen Verspätungsfaktor nennen. Hier bietet sich ein Vergleich zu den 1960er Jahren an: Erst 1963, damals aus Anlass der Kubakrise und des drohenden Atomkrieges, hat sich die Katholische Kirche systematisch in der Friedensenzyklika Pacem in terris zu den Menschenrechten bekannt. Heute sind die Menschenrechte als wichtigste Übersetzung des christlichen Kerngedankens der unbedingten Würde des Men- 1
2 schen in ordnungspolitischen Kategorien anerkannt. Eine in ähnlicher Weise verspätete, jedoch ordnungspolitisch grundlegende Innovation, leistet die Enzyklika Laudato si, indem sie den christlichen Schöpfungsglauben in Fragen ökologisch-tragfähiger Lebens- und Wirtschaftsstile von heute übersetzt. Ob es der katholischen Kirche noch gelingt, eine originäre, global wirksame Kompetenz im Bereich der Schöpfungsverantwortung aufzubauen, hängt davon ab, ob aus der Enzyklika auch institutionelle Konsequenzen gezogen werden, wie dies beispielsweise vor 50 Jahren nach der entwicklungsethischen Enzyklika Populorum progressio mit Justitia et Pax der Fall gewesen war. Ebenso bedarf sie der Flankierung durch einen wissenschaftlichen Diskurs hinsichtlich der Grundlagen und zentralen Herausforderungen einer zeitgemäßen, interdisziplinär vernetzten und global kommunikationsfähigen christlichen Umweltethik. Bisher fehlt es massiv an Kompetenzen und institutionellen Ressourcen, um dem hohen Anspruch der Enzyklika auch auf der Ebene des kirchlichen Handelns und der kirchlichen Politikberatung über individuelle Initiativen hinaus eine glaubwürdige Praxis folgen zu lassen. Abb. 1: Originalausgabe der Enzyklika Laudato si von Papst Franziskus (2015). ( allegati/29248/laudato.jpg). Abb. 2: Papst Franziskus. 2
3 2. Inhaltliche Leitlinien der Enzyklika Inhaltlich folgt die Enzyklika dem Aufbauschema sehen urteilen handeln. Sie beginnt mit einer aus dem intensiven Dialog mit verschiedenen Umweltwissenschaften hervorgegangenen Situationsanalyse, wobei insbesondere die Vermüllung des Planeten Erde (Nr ) hervorgehoben wird (1. Kapitel: Was unserem Haus widerfährt ). Der theologisch-ethischen Urteilsbildung sind drei Kapitel gewidmet, die man als innovative Verknüpfung von Schöpfungstheologie, Ethik und Ökologie kennzeichnen kann (2. Kapitel: Das Evangelium von der Schöpfung ; 3. Kapitel: Die menschliche Wurzel der ökologischen Krise ; 4. Kapitel: Eine ganzheitliche Ökologie ). Der praktische Teil ist in ein politisch-gesellschaftliches und ein pädagogisch-spirituelles Kapitel aufgeteilt (5. Kapitel: Leitlinien für Orientierung und Handeln ; 6. Kapitel: Ökologische Erziehung und Spiritualität ). Trotz des erheblichen Umfangs (217 Seiten in der offiziellen Ausgabe der deutschen Übersetzung; vgl. Franziskus 2015) ist die Enzyklika gut lesbar. Sie ist anschaulich geschrieben, und nach lateinamerikanischer Tradition durch eine bildreiche Sprache gekennzeichnet. Viele Beispiele aus dem Alltagsleben schlagen die Brücke zu möglichen Handlungskonsequenzen für jedermann. Zwei Gebete, ein christliches und ein für die interreligiöse Rezeption geeignetes, schließen den Text ab. Die spezifische Perspektive der Enzyklika auf ökosoziale Fragen, lässt sich durch folgende Merkmale charakterisieren: (a) Ein katastrophentheoretischer Ansatz, der davon ausgeht, dass die ökologischen Kapazitäten weitgehend überlastet, die Stabilität der ökologischen Systeme gefährdet sowie die Lebensräume zahlloser Menschen akut bedroht sind. Basis dieser Analysen ist ein intensiver Dialog mit den Umweltwissenschaften, insbesondere der Klimaforschung, sowie eine Rezeption zahlreicher Stimmen der Weltkirche. (b) Ein sozialökologischer Ansatz, der den grundlegenden Zusammenhang zwischen Umwelt- und Gerechtigkeitsfragen in den Mittelpunkt stellt. Globale und intergenerationelle Gerechtigkeit können demnach nicht ohne Umweltschutz erreicht werden; zugleich muss Umweltschutz aus ethischen und pragmatischen Gründen von den legitimen Interessen der Armen ausgehen. (c) Ein ökotheologischer Ansatz, der den Schrei der Schöpfung und die damit verbundene Not der Armen als Herausforderung für die Kirche und eine Revision des christlichen Naturverhältnisses versteht. Hierfür greift Franziskus insbesondere auf franziskanische Spiritualität zurück, bezieht jedoch auch Elemente orthodoxer, islamischer und lateinamerikanisch-indigener Traditionen ein. (d) Ein befreiungstheologischer Ansatz, der nicht nur ethische Postulate formuliert, sondern programmatisch auch Fragen von Macht, Korruption und systemischen Fehlentwicklungen anspricht und mit einem kämpferischen Impetus deren Überwindung fordert. (e) Ein gemäßigt biozentrischer Ansatz, der den despotischen, fehlgeleiteten, modernen Anthropozentrismus kritisiert und (Nr. 68f. und ) den Eigenwert der Schöpfung sowie die existentielle Verbundenheit aller Kreaturen emphatisch hervorhebt. Die herausgehobene Stellung des Menschen als Ebenbild Gottes werde dadurch nicht relativiert, sondern als Aufgabe der Verantwortung neu und bibelgemäß zum Ausdruck gebracht. (f) Ein praxisorientierter Ansatz, der jede und jeden einzelnen zu einer ökologischen Umkehr aufruft und davon ausgehend zugleich einen radikalen Richtungswechsel in der Lebens- und Wirtschaftsweise der reichen Nationen einfordert. 3
4 3. Franziskanische Spiritualität und lateinamerikanisches buen vivir Innovativ ist die Enzyklika nicht zuletzt dadurch, dass sie ihre kritische Zeitanalyse mit eindringlichen theologischen und anthropologischen Reflexionen des Menschen-, Welt-, Schöpfungs- und Gottesverständnisses verbindet (vgl. Wirz 2015, 420). Sie versteht Umweltschutz als Glaubenspraxis (Nr. 64) und rückt ihn damit ins Zentrum des Selbstverständnisses von Kirche und Theologie. Trotz aller Sorge um Klimawandel, Biodiversitätsverlust, Müllprobleme und regionale Wasserknappheiten sowie die damit verbundene soziale Not ist die Enzyklika auf einen Grundton der Ermutigung und der Dankbarkeit für die Gaben der Schöpfung gestimmt: Laudato si, Gelobt seist du (mein Herr), ist der Titel, der über allem steht. Er ist dem Sonnengesang des Franz von Assisi (Abb. 3) entlehnt, dessen Spiritualität der Freude, Einfachheit und geschwisterlichen Beziehung zu den Mitgeschöpfen die Enzyklika trägt. Schon mit der Wahl des Namens Franziskus bei seiner Wahl zum Papst hat sich Bergoglio eine ökologische Programmatik gegeben, da der naturverbundene Heilige seit 1979 als himmlischer Patron der Umweltschützer gilt: Ich nahm seinen Namen an als eine Art Leitbild und als eine Inspiration im Moment meiner Wahl zum Bischof von Rom. Ich glaube, dass Franziskus das Beispiel schlechthin für die Achtsamkeit gegenüber dem Schwachen und für eine froh und authentisch gelebte ganzheitliche Ökologie ist. (Laudatio si Nr. 10) Abb. 3: Franziskus predigt zu den Vögeln (Darstellung einer Legende aus den Fioretti von Giotto di Bondone, um 1295). Sermon_to_the_Birds.jpg 4
5 Unter Berufung auf den Heiligen sowie auf die Bibel versteht Papst Franziskus die Natur als ein prächtiges Buch [ ], in dem Gott zu uns spricht und einen Abglanz seiner Schönheit und Güte aufscheinen lässt (Nr. 12). Man kann die Enzyklika auch in die Tradition jesuitischer Frömmigkeit einordnen, die sich mit dem ignatianischen Motto Gott in allen Dingen finden umschreiben und als Spiritualität der weltzugewandten Aufmerksamkeit charakterisieren lässt. Unter dem Titel Das Evangelium der Schöpfung (Nr ) werden Schöpfungs- und Erlösungstheologie miteinander verbunden. Darüber hinaus werden damit auch grundlegende Überlegungen zur Natur als ein Zusammenhang offener Systeme (Nr. 79) und als Ort menschlicher Sinnerfahrungen verknüpft. Mit einem neueren Begriff könnte man dies als Ökotheologie bezeichnen (Altner 1989; McFague 1993; Wainwright/Susin/Wilfred 2009). Jedenfalls wird die Umweltkrise in der Enzyklika zum Anlass neuer Formen der Rückfrage nach der verborgenen Gegenwart Gottes in seiner Schöpfung: verborgen in der geheimnisvollen Schönheit, aber auch im Leid, das den Menschen zur Rückbesinnung auf die tragenden Werte des Lebens und zu einer neuen Verantwortungspraxis auffordert. Franziskus postuliert eine ökologische Umkehr (Nr. 5 und ) und spricht nicht weniger als 55-mal von einer Erneuerung des Lebensstils und der Konsummuster. Während in den öffentlichen Debatten Lebensstilfragen meist als eine bloß private und damit individuelle Angelegenheit betrachtet werden, bezieht der Papst mit seiner Kritik der Lebensstile die Position, dass diese angesichts ihrer globalen Folgen rechtfertigungsbedürftig sind (zum philosophischen und ökonomischen Hintergrund vgl. Jaeggi 2013; Paech 2013.). Damit gewinnt die Debatte, zu der sich bereits die Enzyklika Populorum progressio (1967) pointiert geäußert hatte (Nr. 12; 25; 41), eine neue Dynamik. Unter Bezugnahme auf die besonders in Lateinamerika starke Tradition des buen vivir (Acosta 2015) 1, also des guten Lebens, geht Franziskus davon aus, dass ein Kulturwandel im Verhältnis zur Natur einen Gewinn an Lebensqualität, wirtschaftlicher Vernunft und sozialer Gemeinschaft bringen wird. Aber auch eine zeitweise Rezession im reichen Westen sei zu erwarten, zumutbar und ethisch geboten: Darum ist die Zeit gekommen, in einigen Teilen der Welt eine gewisse Rezession zu akzeptieren und Hilfen zu geben, damit in andern Teilen ein gesunder Aufschwung stattfinden kann. (Nr. 191) 2 4. Das Klima als Kollektivgut Kennzeichnend für die Enzyklika ist ihre bildreiche Sprache: Die Natur ist nicht nur Schwester und Mutter Erde, sondern auch gemeinsames Haus (so der Untertitel der Enzyklika; Haus der Erde ist ein in der lateinamerikanischen Tradition geläufiger Topos (vgl. Boff 1996; ders. 2003). Diese drei Metaphern sind stark in der lateinamerikanischen Tradition verwurzelt. So haben Ecuador und Bolivien 2008 bzw den Schutz der Mutter Erde gegen postkoloniale Ressourcenausbeutung in ihre Verfassungen geschrieben. Vor diesem Hintergrund erhalten schon die ersten Zeilen der Enzyklika eine Verknüpfung der religiös-spirituellen mit der politischen Ebene. 1 Buen vivir bzw. summak kawsai, meint das Konzept des guten, naturverbundenen Lebens in der Tradition der indigenen Andenvölker. In der Enzyklika wird dies nicht explizit zitiert, steht aber deutlich im Hintergrund der breit entfalteten Ausführungen hierzu. 2 Auffallend ist, dass hier die deutsche Übersetzung den Terminus decrecimiento abschwächend mit zeitweiliger Rezension wiedergibt, was verkennt, dass hinter dem Begriff eine weltweite Debatte um Postwachstum bzw. degrowth steht; vgl. zu dieser Debatte aus philosophischer Sicht: Muraca 2014; Seidl /Zahrnt
6 Die Sorge für das gemeinsame Haus so der Untertitel der Enzyklika zielt auf eine Hausordnung für den solidarischen Umgang mit den globalen Ressourcen. Dabei wird das Klima als gemeinsames Gut apostrophiert (Nr ). Dieser Topos findet sich bereits im Kompendium der Soziallehre der Kirche, das die ethische Reflexion hinsichtlich der Problematik von Kollektivgütern mit der Klimafrage verknüpft (vgl. Päpstlicher Rat für Gerechtigkeit und Frieden 2006, Nr und ). Dies weitet die von Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert formulierte Eigentumstheorie, von der her die Christliche Sozialethik das Postulat der Gemeinwohlpflichtigkeit des Eigentums entwickelt hat, auf das Klima aus. Ökonomisch lässt sich ein Großteil der globalen Umweltdegradation im Kern als Kollektivgutproblem modellieren: Es findet Ressourcenübernutzung statt, weil ein entscheidender Teil der Bevölkerung den kurzfristigen Nutzen aus den Ressourcen individuell für sich beansprucht, während die Kosten verallgemeinert werden und diese sich langfristig gesehen negativ auf das Kollektiv auswirken. Elinor Ostrom hat anhand weltweiter Traditionen der Allmendenutzung untersucht, wie Gesellschaften beschaffen sein müssen, dass Kollektivgutbewirtschaftung funktioniert (Ostrom 1999; dies. 2011). Darauf könnte eine vertiefende Interpretation der Enzyklika zurückgreifen. Der Text deutet aber auch selbst wichtige Impulse in diesem Bereich an insbesondere im Blick auf regionale Gemeinschaften und Lebensstile in lateinamerikanischem Kontext (Nr ). Die Auffassung des Klimas als Kollektivgut hat weitreichende Konsequenzen für staatliche und gesellschaftliche Pflichten zum Klimaschutz. Sie fordert letztlich nichts Geringeres als die Transformation des Völkerrechts vom Koexistenz- zum Kooperationsrecht und damit einen neuen globalen Völkervertrag. Franziskus spricht in diesem Zusammenhang von gemeinsamen, aber differenzierte[n] Verantwortlichkeiten zum Klimaschutz (Nr. 170). Die eng mit dem Klimawandel verbundene Wasser- und Ernährungskrise wird als zentrale Herausforderung benannt und aus ethischer Perspektive reflektiert. Eine konkrete Forderung der Enzyklika in diesem Zusammenhang ist die Anerkennung der Menschen, die aufgrund ökologischer Degradation ihre Lebensräume verlassen müssen, als Flüchtlinge mit entsprechendem rechtlichem Status (Nr. 25). 5. Der schillernde Begriff von Ökologie Der Begriff Ökologie wird in der Enzyklika schillernd verwendet, teilweise deskriptiv für ökologische Systeme und Wirkungszusammenhänge, teilweise normativ als Postulat eines ganzheitlichen Handelns, das stets die Wechselwirkungen zwischen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Faktoren im Blick behält. Ökologische und soziale Gerechtigkeit werden als untrennbare Einheit verstanden. Denn Umweltschutz ist gerade in den ökologisch sensiblen Regionen des globalen Südens ein Medium der Armutsbekämpfung. Ökologie meint vor diesem Hintergrund nicht nur Naturschutz, sondern allgemeiner ein Denken in Beziehungszusammenhängen. Dieser methodische Ansatz knüpft zugleich an biblisches Denken an. Kennzeichnend für den vielschichtigen Begriff von Ökologie sind auch die Nominalverbindungen, in denen der Term gebraucht wird (Human-, Kultur-, Stadt-, Alltagsökologie u.a.; vgl. Nr ). Die ökologische Titelmetapher Haus der Erde ist ein vielschichtiges Wortspiel: Das Wort Haus, griechisch oikos, ist verwandt mit Ökologie, Ökonomie und Ökumene, was sich in der Enzyklika darin niederschlägt, dass sie ökologische Anliegen programmatisch mit ökonomischen Fragen sowie 6
7 dem Anspruch weltweiter Ökumene über die Grenzen von Nationen, Konfessionen, Religionen und Wissenschaftsdisziplinen hinweg verbindet. Besondere Bedeutung kommt dem Konzept der Humanökologie zu, das seit 1991 leitend für nahezu alle päpstlichen Äußerungen zu Umweltfragen ist und in einer Variation den ursprünglich angekündigten Titel Die Ökologie des Menschen prägte (zum Konzept der Humanökologie sowie seiner Rezeption in der katholischen Soziallehre vgl. Vogt 2014, ). Der Ausdruck ist jedoch umstritten, da er zuvor meist gebraucht wurde, um damit das Konzept der traditionellen Anthropozentrik, das den Menschen im Mittelpunkt der Schöpfung sieht, zu verteidigen. In geschickter Weise wird nun dieser Begriff zugleich aufgegriffen und modifiziert: Eingebunden in bioökologische Reflexionen ist eine Denaturalisierung des Begriffs ausgeschlossen. Zugleich wird erstmals radikal auf Ebene einer Enzyklika der despotische moderne Anthropozentrismus kritisiert (Nr. 68f. und ). Immer wieder hebt Franziskus den Eigenwert der Tiere und Pflanzen hervor und profiliert seine Ethik durch ästhetisch-poetische sowie spirituelle Zugänge zur Natur. Sprachlich auffallend ist, dass der Begriff Nachhaltigkeit nie als Nomen vorkommt, sondern lediglich als Adjektiv ( nachhaltig 19-mal) Verwendung findet. Franziskus vermeidet explizite Kontroversen um den Begriff, legt ihn jedoch gleichwohl mit seiner systematischen Verknüpfung ökologischer, sozialer und ökonomischer Fragen der Enzyklika konzeptionell zugrunde. Dabei setzt er implizit ein Konzept starker Nachhaltigkeit mit vorrangigem Schutz von Klima, Biodiversität und dem Zugang der Armen zu Süßwasser und fruchtbarem Boden voraus. Gleichwohl ist es eine verpasste Chance, dass der Begriff Nachhaltigkeit, der bereits in den 1970er Jahren im Weltrat der Kirchen etabliert war, nicht systematisch entfaltet wird. Aus meiner Sicht ist Nachhaltigkeit wie kein zweiter Begriff geeignet, die primär tugendethischen Impulse der biblischen und kirchlichen Tradition in ordnungsethische Kategorien zu übersetzen. Er könnte wie kein zweiter normativer Leitbegriff als missing link zwischen der theologischen Sprache auf der einen Seite und den gesellschaftspolitischen sowie ökonomischen Sprachspielen auf der anderen Seite vermitteln (vgl. Vogt 2013, ). Das Plädoyer, Nachhaltigkeit als viertes Sozialprinzip in die katholische Soziallehre zu integrieren, das nicht nur einzelne Wissenschaftler, sondern auch zahlreiche nationale Bischofskonferenzen seit den 1990er Jahren geäußert hatten (vgl. Münk 1998, ; Vogt/Numico 2006, bes ), wurde nicht aufgegriffen. 6. Erkenntnistheorie zum Klimadiskurs Die Enzyklika greift erstmals auf der Ebene der päpstlichen Lehrverkündigung das Problem des Klimawandels auf (Nr ). Dahinter steht eine lange Geschichte von Konferenzen und Gesprächen hierzu im Vatikan, in der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften und dem Päpstlichen Rat Justitia et Pax, in denen immer wieder die Einwände der sogenannten Klimaskeptiker (vgl. Rosenberger 2014, 93-99) gehört wurden. Mit der Feststellung der anthropogenen (menschlich verursachten) Zusammenhänge als Hauptursache des Klimawandels, die eine mögliche Wirksamkeit anderer Faktoren nicht ausschließen (Nr. 24), bezieht Papst Franziskus eindeutig Stellung. Methodisch bezeichnend ist, dass das Plädoyer für entschlossenen Klimaschutz angesichts der Kontroversen um dieses Thema vor allem in den US-amerikanischen Kirchen mit kommunikationstheore- 7
8 tischen Überlegungen verknüpft wird: zum Umgang mit unterschiedlichen Meinungen (vgl. Nr. 60f.), zur Schwäche der bisherigen Reaktionen auf die Umweltkrise bei den Entscheidungsträgern (vgl. Nr ) sowie zur Perspektive der am Rande Stehenden, die oft bloß als Anhängsel und Kollateralschaden abgetan würden (Nr. 49). Der Text kritisiert im Kontext der Klimadebatte einen Mangel an physischem Kontakt und Begegnung, [ ] der dazu beiträgt, einen Teil der Realität in tendenziösen Analysen zu ignorieren (Nr. 49). Die Haltungen, welche selbst unter den Gläubigen die Lösungswege blockieren, reichen von der Leugnung des Problems bis zur Gleichgültigkeit, zur bequemen Resignation oder zum blinden Vertrauen auf die technischen Lösungen. (Nr. 14) Diese erkenntnistheoretischen Überlegungen sind klar adressiert und kämpferisch. Innovativ für die Sozialethik ist hier nicht zuletzt die nachdrückliche Reflexion von Phänomenen der Macht: In befreiungstheologischer Tradition werden nicht nur wünschenswerte Ziele geschildert, sondern Systemzusammenhänge und Machtinteressen reflektiert, die dem Wandel entgegenstehen. Korruption und die Fixierung auf kurzfristige persönliche oder nationale Interessen werden schonungslos an den Pranger gestellt. Der Mangel an entschlossenem Klimaschutz wird aber auch als psychologische Verdrängung charakterisiert, die sich aus Befangenheit in den Gewohnheiten und Lebensstilen der Wohlstandsbürger ergibt und insofern ein Phänomen ist, für das die gesamte Gesellschaft die Verantwortung trägt: 8 Wenn wir auf den äußeren Eindruck schauen, hat es, abgesehen von einigen sichtbaren Zeichen der Verseuchung und des Verfalls, den Anschein, als seien die Dinge nicht so schlimm und der Planet könne unter den gegenwärtigen Bedingungen noch lange Zeit fortbestehen. Diese ausweichende Haltung dient uns, unseren Lebensstil und unsere Produktions- und Konsumgewohnheiten beizubehalten. Es ist die Weise, wie der Mensch sich die Dinge zurechtlegt, um all die selbstzerstörerischen Laster zu pflegen: Er versucht, sie nicht zu sehen, kämpft, um sie nicht anzuerkennen, schiebt die wichtigen Entscheidungen auf und handelt, als ob nichts passieren werde. (Nr. 59) Belege für solche interessengeleitete Blickverengungen finden sich keineswegs nur in der amerikanischen Presse, sondern auch in der deutschen Energieindustrie, die sich in der Öffentlichkeit kaum oder nur negativ zur Enzyklika geäußert hat. Bezogen auf den gegenwärtigen politikwissenschaftlichen Diskurs kann man diese für die katholische Soziallehre ungewohnten Reflexionen zu den Widerständen im umweltethischen Erkenntnisprozess in die Transformationsforschung einordnen: Charakteristisch ist eine Akzentverlagerung von Begründungsfragen zu solchen der erkenntnistheoretischen und sozialen Bedingungen für gesellschaftlichen Wandel (Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen 2011). Im Mittelpunkt steht nicht mehr die Frage Warum sollen wir uns wandeln?, sondern Wie kann der unvermeidliche Wandel gelingen?. Transformation by design statt transformation by desaster lautet die einprägsame Formel, die Harald Welzer und Bernd Sommer hierfür geprägt haben (Welzer/Sommer 2014). In christlichem Kontext wurde ein solcher transformationstheoretischer Ansatz bereits 2009 von der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) in einer Denkschrift ausformuliert. Dieser Ansatz wird seither in einem ökumenischen Diskussions- und Praxisprozess weitergeführt (vgl. Evangelische Kirche Deutschlands 2009; Ökumenischer Trägerverbund 2015). Beispielsweise hinsichtlich der Zusammenhänge von Klima- und Migrationsproblemen oder im Blick auf Umsetzungsmöglichkeiten in den Kirchen Deutschlands bietet der ökumenische Prozess ver-
9 tiefende Impulse zur Enzyklika, so wie diese den ökumenischen Prozess vor allem durch die weltweite Perspektive sowie die profilierte Theologie bereichern kann. 7. Zeichen der Zeit : eine dialogorientierte Theologie Den theologischen Denkhintergrund der Enzyklika bildet die Theologie der Zeichen der Zeit, die 1965 in der Pastoralkonstitution Gaudium et spes (Nr. 4 und 11) einen grundlegenden Perspektivenwechsel der katholischen Sozialethik eingeleitet hat. Die Herausforderungen der Krisen und Aufbrüche in der jeweiligen Gegenwart werden als Anrede Gottes an seine Kirche, die es im Licht des Evangeliums zu deuten gilt, verstanden (vgl. Hünermann 2006.). Konzeptionell ist die Enzyklika durch einen geschichtstheologischen Ansatz geprägt, der davon ausgeht, dass Gott selbst in der Geschichte wirkt und vom Menschen eine je neue Antwort einfordert, die durch Glaube und Liebe auch angesichts existentieller Bedrohungen Hoffnung zu vermitteln vermag. Die ökologische Krise wird als eine spirituelle Krise verstanden, die dazu veranlasst, das christliche Menschenbild und die daraus abgeleiteten kulturellen Leitwerte neu zu durchdenken. Versagen, Schuld und theologische Kurzsichtigkeit innerhalb der Kirche werden ebenso benannt wie die positiven Möglichkeiten einer christlich verankerten Verantwortungspraxis: Alle können wir als Werkzeuge Gottes an der Bewahrung der Schöpfung mitarbeiten, ein jeder von seiner Kultur, seiner Erfahrung, seinen Initiativen und seinen Fähigkeiten aus. (Nr. 14). Methodisch folgt der Theologie Zeichen der Zeit mit dem Dreischritt sehen - urteilen - handeln ein empiriebasierter, kontextueller und praxisbezogener Ansatz. Auf diese Weise gewinnt die christliche Botschaft immer wieder neu Aktualität, statt wie eine repetitive und abstrakte Botschaft [zu] klingen (Nr. 17). Die Beschreibung ökologischer und gesellschaftlicher Krisenphänomene verleiht dem dann folgenden ethischen und geistlichen Weg eine Basis der Konkretheit (Nr. 15). Dieser Weg wird als Dialog gekennzeichnet (insgesamt taucht der Begriff 23-mal auf). Im fünften Kapitel der Enzyklika, in dem es um Leitlinien für Orientierung und Handlung geht, fällt das Stichwort Dialog in jeder einzelnen Überschrift und kennzeichnet so einen Wandel im Modus der Sozialverkündigung. Der Dialog hat sowohl eine innerkirchliche Dimension (Dialog mit den Stimmen der Weltkirche, die erstmals ausführlich zitiert werden) als auch eine ökumenische und interreligiöse (vgl. besonders Nr. 7). Nicht nur Vorgängerpäpste, sondern auch der orthodoxe Patriarch Bartholomaios (Nr. 7-9) sowie der islamische Mystiker Al-Khawwas (Nr. 233) werden ausführlich zitiert, was als ein starkes ökumenisches Signal zu werten ist. 8. Medienecho und Wirkungspotentiale Die Enzyklika ist weltweit überwiegend mit starkem Medienecho und großer Zustimmung aufgenommen worden. Es gab und gibt jedoch auch kritische Stimmen, nicht nur von Seiten der Republikaner in den USA, die der Enzyklika schon im Vorfeld den Kampf angesagt haben, sondern auch in Deutschland. So beispielsweise von Daniel Deckers in der FAZ vom , der sie ein moralinsaures Gebräu und ein ungenießbares ökologisches Manifest mit abgestandener Polemik nennt (Deckers 2015). Jan Grossart spricht von antiliberalen Zerrbildern und einer Ausblendung der guten Seiten der industriellen Gegenwart (Grossart 2015). 9
10 Man kann den Skeptikern zugestehen, dass die radikale Kritik an den strukturell perversen Systemen der Wirtschaft (Nr. 52) und der konsumistischen Verwandlung des Planeten in eine unermessliche Mülldeponie (Nr. 21) wenig Raum gibt für Differenzierung. Die Chancen, Marktkräfte und innovative Technik für Umweltschutz und Armutsbekämpfung zu nutzen, werden kaum ausgelotet. Dennoch bleibt der Eindruck, dass die Skeptiker ein Weiter-so verteidigen, das sich zwar plausibel durch Systemzwänge begründen lässt, dessen moralische Unhaltbarkeit angesichts der ökosozialen Ambivalenzen und Selbstzerstörungspotentiale des kinetischen Imperativs ständiger Beschleunigung (Höhn 2006) jedoch längst offensichtlich geworden ist. Hier prallen unterschiedliche Weltbilder aufeinander, die auch die Theologie zutiefst herausfordern. Entscheidend für die Auseinandersetzung ist, dass die ökonomischen Analysen keineswegs reine Objektivität für sich beanspruchen können, sondern in hohem Maße von Modellannahmen abhängig sind (vgl. Schramm 2014, 12-18). Deren Voraussetzungen und Grenzen näher zu bestimmen, ist ein unverzichtbarer Kern des sozialethischen Umweltdiskurses. Die Enzyklika ist dem Stil prophetischer Rede zuzurechnen, die aus päpstlichem Mund vielen ungewohnt klingen mag. Aber gerade durch die Zuspitzung auf die Notwendigkeit einer ökologischen Umkehr (Nr ) im Sinne einer umfassenden gesellschaftlichen Transformation wirkt der Text aufrüttelnd. Mit einer radikalen Kritik des kurzsichtigen, rein ökonomischen Nutzendenkens legt er den Finger auf die entscheidende moralische Schwäche des gegenwärtigen Gesellschaftsmodells. Der Text spricht jeden Einzelnen sehr konkret in seinen Möglichkeiten der Lebensstilgestaltung sowie seiner individuellen Naturbeziehung an und ermutigt zum Glaubenszeugnis gelebter Schöpfungsverantwortung. Der Papst ist zu einem weltweit führenden Anwalt der Armen, der Natur und der Zukunft geworden. Mit dieser Botschaft im Rücken könnte die katholische Kirche zu einer starken Stimme für die Einheit von Klimaschutz, Armutsbekämpfung und Schöpfungsverantwortung werden. Schon jetzt wird der Text als eine der wichtigsten Umweltschriften der letzten Jahrzehnte eingeordnet (Hendricks 2015, 2-3). Die Enzyklika könnte zum Katalysator werden, der die brachliegenden Potentiale christlich-ökologischer Verantwortung aktiviert und die Kirche im Ökodiskurs zum Salz der Erde (Mt 5,13) werden lässt. Der Papst sieht die ökologische Herausforderung im Horizont eines epochalen Wandels: Während die Menschheit des post-industriellen Zeitalters vielleicht als eine der verantwortungslosesten der Geschichte in der Erinnerung bleiben wird, ist zu hoffen, dass die Menschheit vom Anfang des 21. Jahrhunderts in die Erinnerung eingehen kann, weil sie großherzig ihre schwerwiegende Verantwortung auf sich genommen hat. (Nr. 165) Als Fazit lässt sich festhalten: (1) Die Enzyklika Laudato si eröffnet ein neues Kapitel der katholischen Soziallehre, vergleichbar mit der Anerkennung der Menschenrechte vor 50 Jahren. (2) Aus der Verbindung von franziskanischer Schöpfungsspiritualität und lateinamerikanischem buen vivir ergibt sich ein innovativer Impuls für christlich-ökologische Lebensstile. (3) Das Klima und einige grundlegende Umweltressourcen werden in Weiterentwicklung der Eigentumstheorie des Thomas von Aquin als Kollektivgüter der Menschheit aufgefasst. (4) Der schillernde Begriff von Ökologie, mit seinem zugleich beschreibenden und ganzheitlich-wertenden Anspruch sowie seiner ethischen Neuinterpretation des Konzepts der Humanökologie ist innovativ, bedarf jedoch der Klärung in einer weiterführenden Debatte. 10
11 Literatur Acosta, A. (2015): Buen vivir. Vom Recht auf ein gutes Leben, München. Altner, G. (Hg.) (1989): Ökologische Theologie. Perspektiven zur Orientierung, Stuttgart. Arbeitsgemeinschaft Christliche Sozialethik (2015): Kommentare zur Enzyklika Laudato si. ( Abruf am ). Bischof, X. (2015): Ehrenpromotion des Ökumenischen Patriarchen Bartholomäus an der Katholisch-Theologischen Fakultät der LMU am 16. Mai 2014 in: MThZ 1/2015, Boff, L. (2003): Haus aus Himmel und Erde Erzählungen der brasilianischen Urvölker, Düsseldorf. Boff, L. (1996): Unser Haus die Erde. Den Schrei der Unterdrückten hören, Düsseldorf. Decker, D. (2015): Ein ökologisches Manifest, in: FAZ vom ( politik/ausland/europa/kommentar-zur-papst-enzyklika-ein-oeko-manifest html; Abruf am ). Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) (2009): Umkehr zum Leben. Nachhaltige Entwicklung im Zeichen des Klimawandels. Eine Denkschrift des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Hannover. Franziskus (2015): Enzyklika LAUDATO SI. Über die Sorge für das gemeinsame Haus (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 202 vom 24.Mai 2015), Bonn, 171 S. (Bezug und Downloads: ( Grossarth, J. (2015): Wo der Papst irrt, in: FAZ vom ( Abruf am ). Hendricks, B. (2015): Umweltschutz ist sozialer Fortschritt, in: ZdK (Hg.): Salzkörner 21. Jg. Nr. 4, 2-3. Höhn, H. (2006): Zeit-Diagnose. Theologische Orientierung im Zeitalter der Beschleunigung, Darmstadt. Ökumenischer Trägerverbund (2015): Ökumenischer Prozess Umkehr zum Leben.( umkehr-zum-leben.de/de/der-oekumenische-prozess; Abruf am ). Hünermann, P. (Hg.) (2006): Das Zweite Vatikanische Konzil und die Zeichen der Zeit heute. Anstöße zur weiteren Rezeption (Festschrift für Kardinal Lehmann), Freiburg. Jaeggi, R. (2013): Kritik von Lebensformen, Frankfurt. McFague, S. (1993): The Body of God. An Ecological Theology, Minneapolis. Münk, H. (1998): Nachhaltige Entwicklung und Soziallehre, in: StdZ 4: Muraca, B. (2014): Gut leben. Eine Gesellschaft jenseits des Wachstums, Berlin. Ostrom, E. (1999): Die Verfassung der Allmende. Jenseits von Staat und Markt, Tübingen. Ostrom, E. (2011): Was mehr wird, wenn wir teilen. Vom gesellschaftlichen Wert der Gemeingüter, München. Paech, N. (2013): Befreiung vom Überfluss - Auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie, 5. Aufl. München. Päpstlicher Rat für Gerechtigkeit und Frieden (2006): Kompendium der Soziallehre der Kirche, Freiburg. Paul VI (1967): Populorum progressio. Enzyklika über die Entwicklung der Völker, in: KAB (Hg.): Texte zur katholischen Soziallehre, 8. Aufl. Kevelaer 1992,
12 Rosenberger, M. (2014): Die Ratio der Klima-Religion. Eine theologisch-ethische Auseinandersetzung mit klimaskeptischen Argumenten, in: GAIA 2 (23. Jg.), Schramm, M. (2014): Das Abstrakte und das Konkrete. TTIP aus der Sicht einer Business Metaphysics, in: AMOSinternational 4, Seidl, I./Zahrnt, A. (Hg.) (2010): Postwachstumsgesellschaft. Konzepte für die Zukunft, Marburg. Vogt, M./Numico, S. (Hg.) (2006): Schöpfungsverantwortung in Europa. Konsultationen der Umweltbeauftragten des Rates der Europäischen Bischofskonferenzen, München. Vogt, M. (2014): Ökologische Gerechtigkeit und Humanökologie, in: Gabriel, I./Steinmair-Pösel, P. (Hg.): Gerechtigkeit in einer endlichen Welt. Ökologie, Wirtschaft, Ethik, Vogt, M. (2013): Prinzip Nachhaltigkeit. Ein Entwurf aus theologisch-ethischer Perspektive, 3. Auflage München. Wainwright, E./Susin, L./Wilfred, F. (2009): Ökotheologie. in: Concilium 3 (Jg. 45) Welzer, H./Sommer, B. (2014): Transformationsdesign - Wege in eine zukunftsfähige Moderne, München. Wirz, S. (2015): Auf einen anderen Lebensstil setzen. Ein Kommentar zur Enzyklika Laudato si von Franziskus, in: SKZ 35, Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) (2011): Welt im Wandel Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation, Berlin. Anschrift des Verfassers Prof. Dr. Markus Vogt Kath.-Theologische Fakultät der LMU Geschwister-Scholl-Platz München 12
Auf einen anderen Lebensstil setzten! Was will die Umweltenzyklika von Papst Franziskus erreichen
 Auf einen anderen Lebensstil setzten! Was will die Umweltenzyklika von Papst Franziskus erreichen Paulus Akademie Zürich, 2.9.2015, von Markus Vogt, LMU München 1. Innovation der Katholischen Soziallehre
Auf einen anderen Lebensstil setzten! Was will die Umweltenzyklika von Papst Franziskus erreichen Paulus Akademie Zürich, 2.9.2015, von Markus Vogt, LMU München 1. Innovation der Katholischen Soziallehre
Im Zeichen der Ökologie
 IMPULSE Im Zeichen der Ökologie Papst Franziskus definiert den Umweltschutz als Ausgangspunkt einer gesamtgesellschaftlichen Transformation MARKUS VOGT Geboren 1962 in Freiburg im Breisgau, Inhaber des
IMPULSE Im Zeichen der Ökologie Papst Franziskus definiert den Umweltschutz als Ausgangspunkt einer gesamtgesellschaftlichen Transformation MARKUS VOGT Geboren 1962 in Freiburg im Breisgau, Inhaber des
Würdigung der neuen Enzyklika Laudato si Über die Sorge für das gemeinsame Haus
 18.06.2015 PRESSEMITTEILUNGEN DER DEUTSCHEN Es gilt das gesprochene Wort! Würdigung der neuen Enzyklika Laudato si Über die Sorge für das gemeinsame Haus durch Prof. Dr. Markus Vogt, bei der Pressekonferenz
18.06.2015 PRESSEMITTEILUNGEN DER DEUTSCHEN Es gilt das gesprochene Wort! Würdigung der neuen Enzyklika Laudato si Über die Sorge für das gemeinsame Haus durch Prof. Dr. Markus Vogt, bei der Pressekonferenz
Die Erde unser Leben Geschenk und Verantwortung. Enzyklika Laudato si Über die Sorge für das gemeinsame Haus
 Die Erde unser Leben Geschenk und Verantwortung Enzyklika Laudato si Über die Sorge für das gemeinsame Haus ökologischen Laudato si, mi Signore Gelobt seist du, mein Herr Franz v. Assisi ökoloischen 1.
Die Erde unser Leben Geschenk und Verantwortung Enzyklika Laudato si Über die Sorge für das gemeinsame Haus ökologischen Laudato si, mi Signore Gelobt seist du, mein Herr Franz v. Assisi ökoloischen 1.
LAUDATO SI Über die Sorge für das gemeinsame Haus
 Papst Franziskus LAUDATO SI Über die Sorge für das gemeinsame Haus Grundbaustein Was ist eine Enzyklika? belehrendes oder ermahnendes Rundschreiben der Päpste bis heute eine wichtige Verlautbarungsform
Papst Franziskus LAUDATO SI Über die Sorge für das gemeinsame Haus Grundbaustein Was ist eine Enzyklika? belehrendes oder ermahnendes Rundschreiben der Päpste bis heute eine wichtige Verlautbarungsform
3) Evangelischer Religionsunterricht in der Sek.II
 3) Evangelischer Religionsunterricht in der Sek.II Evangelischer Religionsunterricht erschließt die religiöse Dimension der Wirklichkeit und des Lebens und trägt damit zur religiösen Bildung der Schüler/innen
3) Evangelischer Religionsunterricht in der Sek.II Evangelischer Religionsunterricht erschließt die religiöse Dimension der Wirklichkeit und des Lebens und trägt damit zur religiösen Bildung der Schüler/innen
Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaft
 Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaft Begründet von Joseph Höffner Herausgegeben von Marianne Heimbach-Steins Redaktion: Institut für Christliche Sozialwissenschaften NEU ASCHENDORFF VERLAG Ethische
Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaft Begründet von Joseph Höffner Herausgegeben von Marianne Heimbach-Steins Redaktion: Institut für Christliche Sozialwissenschaften NEU ASCHENDORFF VERLAG Ethische
Degrowth Ziele, Visionen und Herausforderungen
 Degrowth Ziele, Visionen und Herausforderungen Judith Kleibs Oikos Germany Meeting 30. Mai 2015 Inhalt 1. Definition Degrowth 2. Geschichte der Degrowth-Bewegung 3. Visionen und Ziele 4. Herausforderungen
Degrowth Ziele, Visionen und Herausforderungen Judith Kleibs Oikos Germany Meeting 30. Mai 2015 Inhalt 1. Definition Degrowth 2. Geschichte der Degrowth-Bewegung 3. Visionen und Ziele 4. Herausforderungen
Didaktischer Aufriss zum Oberstufenlehrplan Katholische Religionslehre: Jgst. 12 im Überblick Stand:
 K 12.1 Ethische Kompetenz aus christlicher Sicht: Orientierung im Wertepluralismus / K 12.2 Ethische Kompetenz aus christlicher Sicht: aktuelle Herausforderungen Kurzkommentierung: An relevanten ethischen
K 12.1 Ethische Kompetenz aus christlicher Sicht: Orientierung im Wertepluralismus / K 12.2 Ethische Kompetenz aus christlicher Sicht: aktuelle Herausforderungen Kurzkommentierung: An relevanten ethischen
Predigt am 3. Sonntag der Osterzeit 2016 Emsbüren Thema: Papst Franziskus und Über die Liebe in der Familie
 Predigt am 3. Sonntag der Osterzeit 2016 Emsbüren Thema: Papst Franziskus und Über die Liebe in der Familie Liebe Schwestern und Brüder, 1. Petrus und Papst Franziskus Im Evangelium geht es um Petrus.
Predigt am 3. Sonntag der Osterzeit 2016 Emsbüren Thema: Papst Franziskus und Über die Liebe in der Familie Liebe Schwestern und Brüder, 1. Petrus und Papst Franziskus Im Evangelium geht es um Petrus.
Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule
 Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule Kompetenzbereiche: Sach-, Methoden-, Urteils-, Handlungskompetenz Synopse aller Kompetenzerwartungen Sachkompetenz
Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule Kompetenzbereiche: Sach-, Methoden-, Urteils-, Handlungskompetenz Synopse aller Kompetenzerwartungen Sachkompetenz
Berufung. Aufbruch. Zukunft. Beiträge des Erzbischofs (13) Hirtenbrief des Erzbischofs zum Diözesanen Forum 2014
 Beiträge des Erzbischofs (13) Berufung. Aufbruch. Zukunft. Hirtenbrief des Erzbischofs zum Diözesanen Forum 2014 Das Zukunftsbild für das Erzbistum Paderborn Berufung. Aufbruch. Zukunft. Das Zukunftsbild
Beiträge des Erzbischofs (13) Berufung. Aufbruch. Zukunft. Hirtenbrief des Erzbischofs zum Diözesanen Forum 2014 Das Zukunftsbild für das Erzbistum Paderborn Berufung. Aufbruch. Zukunft. Das Zukunftsbild
Der Koran. erschlossen und kommentiert von Adel Theodor Khoury. Patmos
 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Der Koran erschlossen und kommentiert von Adel Theodor Khoury Patmos
2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Der Koran erschlossen und kommentiert von Adel Theodor Khoury Patmos
7. Berliner Forum 2013 Kirchliche Immobilieneigentümer in ihrer unternehmerischen Verantwortung Pachtverträge für landwirtschaftliche Flächen
 7. Berliner Forum 2013 Kirchliche Immobilieneigentümer in ihrer unternehmerischen Verantwortung Pachtverträge für landwirtschaftliche Flächen Dr. Clemens Dirscherl Agrarbeauftragter der EKD Evang. Bauernwerk
7. Berliner Forum 2013 Kirchliche Immobilieneigentümer in ihrer unternehmerischen Verantwortung Pachtverträge für landwirtschaftliche Flächen Dr. Clemens Dirscherl Agrarbeauftragter der EKD Evang. Bauernwerk
Ökumenisch Kirche sein. Ein Aufruf aus Anlass des Reformationsgedenkens 2017
 Ökumenisch Kirche sein Ein Aufruf aus Anlass des Reformationsgedenkens 2017 Wir sind dankbar dafür, dass sich zwischen der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und
Ökumenisch Kirche sein Ein Aufruf aus Anlass des Reformationsgedenkens 2017 Wir sind dankbar dafür, dass sich zwischen der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und
Global oder lokal? Alternativen anpacken! Ulrich Brand
 Global oder lokal? Alternativen anpacken! Ulrich Brand Science Event 2014 Transformation! Energie für den Wandel Umweltbundesamt / Radio ORF 1 27.11.2014 Leitfragen Welche Energie braucht Transformation?
Global oder lokal? Alternativen anpacken! Ulrich Brand Science Event 2014 Transformation! Energie für den Wandel Umweltbundesamt / Radio ORF 1 27.11.2014 Leitfragen Welche Energie braucht Transformation?
Religionsunterricht wozu?
 Religionsunterricht wozu? Mensch Fragen Leben Gott Beziehungen Gestalten Arbeit Glaube Zukunft Moral Werte Sinn Kirche Ziele Dialog Erfolg Geld Wissen Hoffnung Kritik??? Kompetenz Liebe Verantwortung Wirtschaft
Religionsunterricht wozu? Mensch Fragen Leben Gott Beziehungen Gestalten Arbeit Glaube Zukunft Moral Werte Sinn Kirche Ziele Dialog Erfolg Geld Wissen Hoffnung Kritik??? Kompetenz Liebe Verantwortung Wirtschaft
Unterrichtsinhalte Religion
 Unterrichtsinhalte Religion Jahrgangsstufe 5 Ankommen im Religionsunterricht/Freundschaft Schöpfung Abraham Mose Jesus Entdecken Verstehen Gestalten Ankommen im Religionsunterricht Schöpfung: Staunen Erkennen
Unterrichtsinhalte Religion Jahrgangsstufe 5 Ankommen im Religionsunterricht/Freundschaft Schöpfung Abraham Mose Jesus Entdecken Verstehen Gestalten Ankommen im Religionsunterricht Schöpfung: Staunen Erkennen
verfügen. Unser Glaube an Gottes Schöpfung zeigt uns Wege auf, die Erde mit andern zu teilen und ihr Sorge zu tragen.
 Leitbild Brot für alle setzt sich dafür ein, dass alle Menschen über Fähigkeiten und Möglichkeiten für ein gutes und menschenwürdiges Leben in einer lebenswerten Umwelt verfügen. Unser Glaube an Gottes
Leitbild Brot für alle setzt sich dafür ein, dass alle Menschen über Fähigkeiten und Möglichkeiten für ein gutes und menschenwürdiges Leben in einer lebenswerten Umwelt verfügen. Unser Glaube an Gottes
KC Evangelische Religion Leitfrage: Nach dem Menschen fragen. Erwartete Kompetenzen. 1./2. Schuljahrgang 3./4 Schuljahrgang
 KC Evangelische Religion Leitfrage: Nach dem Menschen fragen Erwartete Kompetenzen 1./2. Schuljahrgang 3./4 Schuljahrgang nehmen Freude, Trauer, Angst, Wut und Geborgenheit als Erfahrungen menschlichen
KC Evangelische Religion Leitfrage: Nach dem Menschen fragen Erwartete Kompetenzen 1./2. Schuljahrgang 3./4 Schuljahrgang nehmen Freude, Trauer, Angst, Wut und Geborgenheit als Erfahrungen menschlichen
Weltgebetstag für die Bewahrung der Schöpfung
 Weltgebetstag für die Bewahrung der Schöpfung VORSCHALG FÜR EINE EUCHARISTISCHE ANBETUNGSSTUNDE* 1. SEPTEMBER 2015 *Vorbereitet vom Päpstlichen Rat Iustitia et Pax.
Weltgebetstag für die Bewahrung der Schöpfung VORSCHALG FÜR EINE EUCHARISTISCHE ANBETUNGSSTUNDE* 1. SEPTEMBER 2015 *Vorbereitet vom Päpstlichen Rat Iustitia et Pax.
Schulinterner Lehrplan Evangelische Religionslehre am Clara-Schumann-Gymnasium Holzwickede Qualifikationsphase (Q 1)
 Schulinterner Lehrplan Evangelische Religionslehre am Clara-Schumann-Gymnasium Holzwickede Qualifikationsphase (Q 1) Qualifikationsphase (Q1) GRUNDKURS Halbjahresthema 1.Hj.: Als Mensch Orientierung suchen
Schulinterner Lehrplan Evangelische Religionslehre am Clara-Schumann-Gymnasium Holzwickede Qualifikationsphase (Q 1) Qualifikationsphase (Q1) GRUNDKURS Halbjahresthema 1.Hj.: Als Mensch Orientierung suchen
Städtisches Gymnasium Olpe. Schulinternes Curriculum Evangelische Religionslehre
 Städtisches Gymnasium Olpe Schulinternes Curriculum Evangelische Religionslehre Qualifikationsphase 1-1. Halbjahr Halbjahresthema: Gotteslehre / Theologie Unterrichtsvorhaben I: Thema: Wie kann ich mit
Städtisches Gymnasium Olpe Schulinternes Curriculum Evangelische Religionslehre Qualifikationsphase 1-1. Halbjahr Halbjahresthema: Gotteslehre / Theologie Unterrichtsvorhaben I: Thema: Wie kann ich mit
MORALTHEOLOGIE I VORAUSSETZUNGEN UND GRUNDLAGEN
 Inhaltsverzeichnis Seite 1 MORALTHEOLOGIE I VORAUSSETZUNGEN UND GRUNDLAGEN 1 Person als Ausgangspunkt theologisch-ethischen Nachdenkens 2 1.1 Aus Lehm geknetet und zur Freiheit berufen biblische Aussagen
Inhaltsverzeichnis Seite 1 MORALTHEOLOGIE I VORAUSSETZUNGEN UND GRUNDLAGEN 1 Person als Ausgangspunkt theologisch-ethischen Nachdenkens 2 1.1 Aus Lehm geknetet und zur Freiheit berufen biblische Aussagen
Qualifikationsphase 2 Jahresthema: Wie plausibel ist der Glaube? - Theologische, christologische, eschatologische und ekklesiologische Antworten
 Qualifikationsphase 2 Jahresthema: Wie plausibel ist der Glaube? - Theologische, christologische, eschatologische und ekklesiologische Antworten Unterrichtsvorhaben I Thema: Was lässt mich zweifeln? Wie
Qualifikationsphase 2 Jahresthema: Wie plausibel ist der Glaube? - Theologische, christologische, eschatologische und ekklesiologische Antworten Unterrichtsvorhaben I Thema: Was lässt mich zweifeln? Wie
UNSERE WERTE UND GRUNDÜBER- ZEUGUNGEN
 UNSERE WERTE UND GRUNDÜBER- ZEUGUNGEN Wir sind das Hilfswerk der evangelischen Kirchen der Schweiz. Unsere Verankerung in den Kirchen prägt die Grundüberzeugungen, welche für unser Handeln von zentraler
UNSERE WERTE UND GRUNDÜBER- ZEUGUNGEN Wir sind das Hilfswerk der evangelischen Kirchen der Schweiz. Unsere Verankerung in den Kirchen prägt die Grundüberzeugungen, welche für unser Handeln von zentraler
Evangelische Religionspädagogik, Religion
 Lehrplaninhalt Vorbemerkung Die religionspädagogische Ausbildung in der FS Sozialpädagogik ermöglicht es den Studierenden, ihren Glauben zu reflektieren. Sie werden befähigt, an der religiösen Erziehung
Lehrplaninhalt Vorbemerkung Die religionspädagogische Ausbildung in der FS Sozialpädagogik ermöglicht es den Studierenden, ihren Glauben zu reflektieren. Sie werden befähigt, an der religiösen Erziehung
Katholische Religionslehre
 Hinweise für die Abiturientinnen und Abiturienten Abiturprüfung an den allgemein bildenden Gymnasien Prüfungsfach: Bearbeitungszeit: Hilfsmittel: Katholische Religionslehre 270 Minuten einschließlich Auswahlzeit
Hinweise für die Abiturientinnen und Abiturienten Abiturprüfung an den allgemein bildenden Gymnasien Prüfungsfach: Bearbeitungszeit: Hilfsmittel: Katholische Religionslehre 270 Minuten einschließlich Auswahlzeit
Städtisches Gymnasium Olpe. Schulinternes Curriculum Evangelische Religionslehre
 Städtisches Gymnasium Olpe Schulinternes Curriculum Evangelische Religionslehre Einführungsphase 1. Halbjahr Halbjahresthema: Religion eine Einführung Unterrichtsvorhaben I: Thema: Wie hältst du es mit
Städtisches Gymnasium Olpe Schulinternes Curriculum Evangelische Religionslehre Einführungsphase 1. Halbjahr Halbjahresthema: Religion eine Einführung Unterrichtsvorhaben I: Thema: Wie hältst du es mit
CURRICULUM KR Stand:
 E: Eodus: Bilder eines befreienden legen dar, inwiefern Menschen beim Erwachsenwerden einen Spielraum für die verantwortliche Nutzung ihrer Freiheit gewinnen. unterscheiden lebensfördernde Sinnangebote
E: Eodus: Bilder eines befreienden legen dar, inwiefern Menschen beim Erwachsenwerden einen Spielraum für die verantwortliche Nutzung ihrer Freiheit gewinnen. unterscheiden lebensfördernde Sinnangebote
Helene-Lange-Schule Hannover Schulcurriculum Katholische Religion Klasse Sek II
 Helene-Lange-Schule Hannover Schulcurriculum Katholische Religion Klasse 5-10 + Sek II Legende: prozessbezogene Kompetenzbereiche inhaltsbezogene Kompetenzbereiche Hinweise: Zur nachhaltigen Förderung
Helene-Lange-Schule Hannover Schulcurriculum Katholische Religion Klasse 5-10 + Sek II Legende: prozessbezogene Kompetenzbereiche inhaltsbezogene Kompetenzbereiche Hinweise: Zur nachhaltigen Förderung
Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Jahrgangsstufe EF
 Unterrichtsvorhaben A: Woran glaubst du? religiöse Orientierung in unserer pluralen Gesellschaft Inhaltsfeld 1: Der Mensch in christlicher Perspektive Inhaltliche Schwerpunkte: Religiosität in der pluralen
Unterrichtsvorhaben A: Woran glaubst du? religiöse Orientierung in unserer pluralen Gesellschaft Inhaltsfeld 1: Der Mensch in christlicher Perspektive Inhaltliche Schwerpunkte: Religiosität in der pluralen
Kompetenzorientiertes Schulcurriculum für das Fach Evangelische Religionslehre für die Jahrgangsstufen 7 bis 9
 Kompetenzorientiertes Schulcurriculum für das Fach Evangelische Religionslehre für die Jahrgangsstufen 7 bis 9 Inhaltsfelds 1: Entwicklung einer eigenen religiösen Identität Inhaltlicher Schwerpunkt: Luther
Kompetenzorientiertes Schulcurriculum für das Fach Evangelische Religionslehre für die Jahrgangsstufen 7 bis 9 Inhaltsfelds 1: Entwicklung einer eigenen religiösen Identität Inhaltlicher Schwerpunkt: Luther
Ernährung und Gerechtigkeit
 Ernährung und Gerechtigkeit Der Religionsunterricht als Lernort des Widerstands gegen eine verkehrte Welt Folie 1 29.09.2016 Prof. Dr. theol. Andreas Benk Übersicht 1. Christliche Hoffnung: Vision einer
Ernährung und Gerechtigkeit Der Religionsunterricht als Lernort des Widerstands gegen eine verkehrte Welt Folie 1 29.09.2016 Prof. Dr. theol. Andreas Benk Übersicht 1. Christliche Hoffnung: Vision einer
Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Jahrgangsstufe 5 Unterrichtsvorhaben: Könige in Israel Berufung und Versagen
 Unterrichtsvorhaben: Könige in Israel Berufung und Versagen Inhaltliche Schwerpunkte ( Inhaltsfelder): Bildliches Sprechen von Gott (IHF2) Lebensweltliche Relevanz: Nachdenken über das Gottesbild und die
Unterrichtsvorhaben: Könige in Israel Berufung und Versagen Inhaltliche Schwerpunkte ( Inhaltsfelder): Bildliches Sprechen von Gott (IHF2) Lebensweltliche Relevanz: Nachdenken über das Gottesbild und die
Fach: Katholische Religionslehre Klasse 5
 Fach: Katholische Religionslehre Klasse 5 Ich und die Gruppe Menschen leben in Beziehungen und übernehmen verschiedene Rollen Orientierung für den Umgang miteinander die Goldene Regel Einübung in eine
Fach: Katholische Religionslehre Klasse 5 Ich und die Gruppe Menschen leben in Beziehungen und übernehmen verschiedene Rollen Orientierung für den Umgang miteinander die Goldene Regel Einübung in eine
Kirche. Macht. Politik?
 1. Einleitung: Jesuanischer Hintersinn 2. Macht Kirche Politik? 3. Macht Politik Kirche? 4. Kirche, Politik und Macht? 1 1. Einleitung: Jesuanischer Hintersinn 2 1. Einleitung: Jesuanischer Hintersinn
1. Einleitung: Jesuanischer Hintersinn 2. Macht Kirche Politik? 3. Macht Politik Kirche? 4. Kirche, Politik und Macht? 1 1. Einleitung: Jesuanischer Hintersinn 2 1. Einleitung: Jesuanischer Hintersinn
<Evangelische Religionslehre>
 SchulinternerLehrplan zum Kernlehrplan für die Einführungsphase der Oberstufe Inhalt Schulinternes Curriculum Evangelische Religionslehre Sekundarstufe II Stand März 2014
SchulinternerLehrplan zum Kernlehrplan für die Einführungsphase der Oberstufe Inhalt Schulinternes Curriculum Evangelische Religionslehre Sekundarstufe II Stand März 2014
Die soziale Dimension der Umkehr Das Sozialkompendium der katholischen Kirche
 Die soziale Dimension der Umkehr Das Sozialkompendium der katholischen Kirche 1 Am 1. Februar 2006 wurde die deutsche Fassung des Sozialkompendiums der römisch-katholischen Kirche in Deutschland und Österreich
Die soziale Dimension der Umkehr Das Sozialkompendium der katholischen Kirche 1 Am 1. Februar 2006 wurde die deutsche Fassung des Sozialkompendiums der römisch-katholischen Kirche in Deutschland und Österreich
Wenn Jesus kommt, verändert sich alles!
 Wenn Jesus kommt, verändert sich alles! ETG Lindenwiese, 15. Sept. 2013 Michael Girgis Wenn Jesus kommt, verändert sich alles! 1. Wenn Jesus in dein/mein Leben kommt, verändert sich alles! Wenn Jesus kommt,
Wenn Jesus kommt, verändert sich alles! ETG Lindenwiese, 15. Sept. 2013 Michael Girgis Wenn Jesus kommt, verändert sich alles! 1. Wenn Jesus in dein/mein Leben kommt, verändert sich alles! Wenn Jesus kommt,
Thomas-Akademie Jüdische und christliche Leseweisen der Bibel im Dialog Kurt Kardinal Koch EINLADUNG
 Theologische Fakultät EINLADUNG Thomas-Akademie 2016 Jüdische und christliche Leseweisen der Bibel im Dialog Kurt Kardinal Koch MITTWOCH, 16. MÄRZ 2016, 18.15 UHR UNIVERSITÄT LUZERN, FROHBURGSTRASSE 3,
Theologische Fakultät EINLADUNG Thomas-Akademie 2016 Jüdische und christliche Leseweisen der Bibel im Dialog Kurt Kardinal Koch MITTWOCH, 16. MÄRZ 2016, 18.15 UHR UNIVERSITÄT LUZERN, FROHBURGSTRASSE 3,
Klimawandel und Gerechtigkeit
 Klimawandel und Gerechtigkeit Klimapolitik als Baustein einer gerechten Globalisierung und nachhaltigen Armutsbekämpfung Johannes Müller (IGP) Vier Partner vier Expertisen Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR
Klimawandel und Gerechtigkeit Klimapolitik als Baustein einer gerechten Globalisierung und nachhaltigen Armutsbekämpfung Johannes Müller (IGP) Vier Partner vier Expertisen Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR
Christliche Sozialethik und Moraltheologie
 CLEMENS BREUER Christliche Sozialethik und Moraltheologie Eine Auseinandersetzung mit den Grundlagen zweier Disziplinen und die Frage ihrer Eigenständigkeit 2003 Ferdinand Schöningh Paderborn München Wien
CLEMENS BREUER Christliche Sozialethik und Moraltheologie Eine Auseinandersetzung mit den Grundlagen zweier Disziplinen und die Frage ihrer Eigenständigkeit 2003 Ferdinand Schöningh Paderborn München Wien
Es gilt das gesprochene Wort!
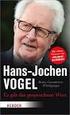 Es gilt das gesprochene Wort! Griechisch-Bayerischer Kulturpreis für Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm am 22.6.2015 in München Laudatio von Frau Barbara Stamm, MdL Präsidentin des Bayerischen
Es gilt das gesprochene Wort! Griechisch-Bayerischer Kulturpreis für Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm am 22.6.2015 in München Laudatio von Frau Barbara Stamm, MdL Präsidentin des Bayerischen
Die Botschaft Jesu in seiner Zeit und Umwelt (IF 4) Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler
 Unterrichtsvorhaben A: Jesus als Jude in seiner Zeit Die Botschaft Jesu in seiner Zeit und Umwelt (IF 4) unterscheiden Religionen und Konfessionen im Hinblick auf grundlegende Merkmale. finden selbstständig
Unterrichtsvorhaben A: Jesus als Jude in seiner Zeit Die Botschaft Jesu in seiner Zeit und Umwelt (IF 4) unterscheiden Religionen und Konfessionen im Hinblick auf grundlegende Merkmale. finden selbstständig
LPE Kernlehrplan Kath. Religionslehre Sek II Einführungsphase
 Unterrichtsvorhaben I: Thema: Mein Leben gehört mir!? Verantwortung für das menschliche Leben in Grenzsituationen aus christlicher Perspektive Inhaltsfelder: IF 1: Der Mensch in christlicher Perspektive
Unterrichtsvorhaben I: Thema: Mein Leben gehört mir!? Verantwortung für das menschliche Leben in Grenzsituationen aus christlicher Perspektive Inhaltsfelder: IF 1: Der Mensch in christlicher Perspektive
zum Beten mit der Liturgie
 Bilder zum Beten mit der Liturgie Fünfter Fastensonntag (B) Joh. 12,20-33 Christusmonogramm, Mausoleum von Gala Placidia Ravenna, VI. Jahrh. Jesus Christus, Richter und Hoher Priester Rheinau-Psalterium,
Bilder zum Beten mit der Liturgie Fünfter Fastensonntag (B) Joh. 12,20-33 Christusmonogramm, Mausoleum von Gala Placidia Ravenna, VI. Jahrh. Jesus Christus, Richter und Hoher Priester Rheinau-Psalterium,
2017 weiter-sehen Initiativen zum Reformationsgedächtnis 2017 in der Erzdiözese München und Freising DR. F. SCHUPPE 1
 2017 weiter-sehen Initiativen zum Reformationsgedächtnis 2017 in der Erzdiözese München und Freising DR. F. SCHUPPE 1 Es stimmt hoffnungsvoll, dass mit dem 500. Jahrestag der Reformation erstmals ein Reformationsgedenken
2017 weiter-sehen Initiativen zum Reformationsgedächtnis 2017 in der Erzdiözese München und Freising DR. F. SCHUPPE 1 Es stimmt hoffnungsvoll, dass mit dem 500. Jahrestag der Reformation erstmals ein Reformationsgedenken
Inhaltsverzeichnis. Vorwort 11
 Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 1. Einleitung 13 1.1 Vorblick 13 1.2 Aufgaben der Ethik als eines Prozesses der Reflexion 13 1.2.1 Ohne Fragestellung kein Zugang zur ethischen Reflexion 13 1.2.2 Was bedeutet
Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 1. Einleitung 13 1.1 Vorblick 13 1.2 Aufgaben der Ethik als eines Prozesses der Reflexion 13 1.2.1 Ohne Fragestellung kein Zugang zur ethischen Reflexion 13 1.2.2 Was bedeutet
Diakonie. Leitbild. Schleswig-Holstein. Diakonisches Werk. Schleswig-Holstein. Landesverband der Inneren Mission e.v.
 Diakonie Schleswig-Holstein Diakonisches Werk Schleswig-Holstein Landesverband der Inneren Mission e.v. Leitbild Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Dieses Leitbild des Diakonischen
Diakonie Schleswig-Holstein Diakonisches Werk Schleswig-Holstein Landesverband der Inneren Mission e.v. Leitbild Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Dieses Leitbild des Diakonischen
Schulinternes Curriculum Evangelische Religionslehre EF/ Juli 2014
 2.1.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben Schulinternes Curriculum Evangelische Religionslehre EF/ Juli 2014 Einführungsphase 1. Halbjahr Halbjahresthema: Auf der Suche nach Identität und gelingendem
2.1.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben Schulinternes Curriculum Evangelische Religionslehre EF/ Juli 2014 Einführungsphase 1. Halbjahr Halbjahresthema: Auf der Suche nach Identität und gelingendem
THEOLOGIE UND MENSCHENRECHTE
 THEOLOGIE UND MENSCHENRECHTE Theologische Berichte XXXI Herausgegeben im Auftrag der Theologischen Hochschule Chur von Michael Durst und der Theologischen Fakultät der Universität Luzern von Hans J. Münk
THEOLOGIE UND MENSCHENRECHTE Theologische Berichte XXXI Herausgegeben im Auftrag der Theologischen Hochschule Chur von Michael Durst und der Theologischen Fakultät der Universität Luzern von Hans J. Münk
VISION FÜR EINE EVANGELISCHE JUGENDARBEIT 2017
 VISION FÜR EINE EVANGELISCHE JUGENDARBEIT 2017 Neuwürschnitz 15.06.2013 Tobias Bilz Glauben auf evangelische Art In der evangelischen Jugendarbeit sind wir überzeugt davon, dass unsere Glaubenspraxis dem
VISION FÜR EINE EVANGELISCHE JUGENDARBEIT 2017 Neuwürschnitz 15.06.2013 Tobias Bilz Glauben auf evangelische Art In der evangelischen Jugendarbeit sind wir überzeugt davon, dass unsere Glaubenspraxis dem
Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft
 Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft Teilband 2 Hans-Georg Gadamer I Heinrich. Fries Mythos und Wissenschaft Alois Halder / Wolf gang Welsch Kunst und Religion Max Seckler I Jakob J. Petuchowski
Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft Teilband 2 Hans-Georg Gadamer I Heinrich. Fries Mythos und Wissenschaft Alois Halder / Wolf gang Welsch Kunst und Religion Max Seckler I Jakob J. Petuchowski
Ethik der Entwicklungspolitik
 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. T h om as Kessel ri n g Ethik der Entwicklungspolitik Gerechtigkeit
2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. T h om as Kessel ri n g Ethik der Entwicklungspolitik Gerechtigkeit
Ist Ethik wichtiger als Religion? Di, , Schlatterhaus, Gespräch mit den Humanisten Tübingen Michael Seibt
 Ist Ethik wichtiger als Religion? Di, 22.03.2016, Schlatterhaus, Gespräch mit den Humanisten Tübingen Michael Seibt 1. Frage: Was ist Religion und warum ist sie wichtig? Was ist Ethik und warum ist sie
Ist Ethik wichtiger als Religion? Di, 22.03.2016, Schlatterhaus, Gespräch mit den Humanisten Tübingen Michael Seibt 1. Frage: Was ist Religion und warum ist sie wichtig? Was ist Ethik und warum ist sie
Lehrplan. Katholische Religion
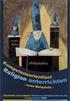 Lehrplan Katholische Religion für die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe Dezember 2009 MBKW G.B10 1.0.30 12/2009 MBKW G.B10 1.0.30 12/2009 Schöpfung und Schöpfungserzählungen unterschiedliche Antworten
Lehrplan Katholische Religion für die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe Dezember 2009 MBKW G.B10 1.0.30 12/2009 MBKW G.B10 1.0.30 12/2009 Schöpfung und Schöpfungserzählungen unterschiedliche Antworten
Leitbild AHS Linz Schulverein der Kreuzschwestern
 Leitbild AHS Linz Schulverein der Kreuzschwestern 1 Wir orientieren uns an Jesus Christus und seiner Botschaft. Wir legen Wert auf eine altersgemäße religiöse Erziehung, in der christliche Inhalte und
Leitbild AHS Linz Schulverein der Kreuzschwestern 1 Wir orientieren uns an Jesus Christus und seiner Botschaft. Wir legen Wert auf eine altersgemäße religiöse Erziehung, in der christliche Inhalte und
Karteikarte Unterrichtsvorhaben Einführungsphase Religion 10.1.
 Unterrichtsvorhaben : Thema: Vernünftig Glauben - ein Widerspruch? Inhaltsfelder: Christliche Antworten auf die Gottesfrage Inhaltliche Schwerpunkte: Das Verhältnis von Vernunft und Glaube Sachkom-petenz
Unterrichtsvorhaben : Thema: Vernünftig Glauben - ein Widerspruch? Inhaltsfelder: Christliche Antworten auf die Gottesfrage Inhaltliche Schwerpunkte: Das Verhältnis von Vernunft und Glaube Sachkom-petenz
Anhang: Modulbeschreibung
 Anhang: Modulbeschreibung Modul 1: Religionsphilosophie und Theoretische Philosophie (Pflichtmodul, 10 CP) - Ansätze aus Geschichte und Gegenwart im Bereich der Epistemologie und Wissenschaftstheorie sowie
Anhang: Modulbeschreibung Modul 1: Religionsphilosophie und Theoretische Philosophie (Pflichtmodul, 10 CP) - Ansätze aus Geschichte und Gegenwart im Bereich der Epistemologie und Wissenschaftstheorie sowie
Mensch 1 3/4 Mensch 2 3/4. Mensch 3 3/4 Mensch 4 3/4. Mensch 5 3/4 Mensch 6 3/4
 Mensch 1 3/4 Mensch 2 3/4 setzen eigene Fragen an das Leben mit Grundfragen des Menschseins in Beziehung. (1) ausgehend von ihren Fähigkeiten und Grenzen Fragen an das Leben formulieren setzen eigene Fragen
Mensch 1 3/4 Mensch 2 3/4 setzen eigene Fragen an das Leben mit Grundfragen des Menschseins in Beziehung. (1) ausgehend von ihren Fähigkeiten und Grenzen Fragen an das Leben formulieren setzen eigene Fragen
Predigt am 6. Sonntag der Osterzeit 2015 Lesung: Apg, Evangelium Joh 15,9-17. Das ist mein Gebot: Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe.
 Predigt am 6. Sonntag der Osterzeit 2015 Lesung: Apg, Evangelium Joh 15,9-17 Das ist mein Gebot: Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Liebe Schwestern und Brüder, irgendwie ahnen wir, dass diese
Predigt am 6. Sonntag der Osterzeit 2015 Lesung: Apg, Evangelium Joh 15,9-17 Das ist mein Gebot: Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Liebe Schwestern und Brüder, irgendwie ahnen wir, dass diese
Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Einführungsphase. Unterrichtsvorhaben: Der Mensch in christlicher Perspektive
 Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Einführungsphase Unterrichtsvorhaben: Der Mensch in christlicher Perspektive Inhaltliche Schwerpunkte Der Mensch als Geschöpf und Ebenbild Gottes (Was
Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Einführungsphase Unterrichtsvorhaben: Der Mensch in christlicher Perspektive Inhaltliche Schwerpunkte Der Mensch als Geschöpf und Ebenbild Gottes (Was
Curriculum Evangelische Religionslehre Qualifikationsphase März 2015
 Qualifikationsphase (Q1) GRUNDKURS Halbjahresthema 1. Hj.: Auf der Suche nach Orientierung im Glauben Unterrichtsvorhaben I: Thema: Gott, Götter, Götzen: Wie Christen im Glauben Orientierung finden und
Qualifikationsphase (Q1) GRUNDKURS Halbjahresthema 1. Hj.: Auf der Suche nach Orientierung im Glauben Unterrichtsvorhaben I: Thema: Gott, Götter, Götzen: Wie Christen im Glauben Orientierung finden und
SuS beschreiben theologische. Verwendung relevanter Fachbegriffe (MK-KR 1). SuS analysieren kriterienorientiert
 SuS identifizieren und deuten Situationen des eigenen Lebens und der Lebenswelt, in denen sich Fragen nach Grund, Sinn und Ziel des Lebens und der eigenen Verantwortung stellen (SK-KR 1). SuS setzen eigene
SuS identifizieren und deuten Situationen des eigenen Lebens und der Lebenswelt, in denen sich Fragen nach Grund, Sinn und Ziel des Lebens und der eigenen Verantwortung stellen (SK-KR 1). SuS setzen eigene
Katholische Religionslehre
 Schulinterner Lehrplan für die gymnasiale Oberstufe am Gymnasium Lechenich Katholische Religionslehre 1 Einführungsphase Jahresthema: Vernünftig glauben und verantwortlich handeln Theologische und anthropologisch-ethische
Schulinterner Lehrplan für die gymnasiale Oberstufe am Gymnasium Lechenich Katholische Religionslehre 1 Einführungsphase Jahresthema: Vernünftig glauben und verantwortlich handeln Theologische und anthropologisch-ethische
ERKLÄRUNG DER DEUTSCHEN BISCHÖFE ZUR PARTEIPOLITISCHEN TÄTIGKEIT DER PRIESTER
 ERKLÄRUNG DER DEUTSCHEN BISCHÖFE ZUR PARTEIPOLITISCHEN TÄTIGKEIT DER PRIESTER Vorwort Aus Sorge um die Schäden, die der Kirche aus der parteipolitischen Betätigung der Priester erwachsen, haben die deutschen
ERKLÄRUNG DER DEUTSCHEN BISCHÖFE ZUR PARTEIPOLITISCHEN TÄTIGKEIT DER PRIESTER Vorwort Aus Sorge um die Schäden, die der Kirche aus der parteipolitischen Betätigung der Priester erwachsen, haben die deutschen
Leitbild HLW Linz Schulverein der Kreuzschwestern
 Leitbild HLW Linz Schulverein der Kreuzschwestern 1 Wir orientieren uns an Jesus Christus und seiner Botschaft. Wir legen Wert auf eine altersgemäße religiöse Erziehung, in der christliche Inhalte und
Leitbild HLW Linz Schulverein der Kreuzschwestern 1 Wir orientieren uns an Jesus Christus und seiner Botschaft. Wir legen Wert auf eine altersgemäße religiöse Erziehung, in der christliche Inhalte und
Modul 7 Theologische Zusatzqualifikation (Soziale Arbeit)
 1 Sinnfragen menschlichen Lebens 1. Kompetenzziele Vertrautheit mit den Sinnfragen des Menschen im Licht des christlichen Glaubens Vertrautheit mit den Sinnfragen des Menschen auf dem Hintergrund unterschiedlicher
1 Sinnfragen menschlichen Lebens 1. Kompetenzziele Vertrautheit mit den Sinnfragen des Menschen im Licht des christlichen Glaubens Vertrautheit mit den Sinnfragen des Menschen auf dem Hintergrund unterschiedlicher
Fasten vor dem Hintergrund der gegenwärtigen sozialen und ökologischen Krisen. in der Gruppe: Mit der Enzyklika Laudato Si in der Fastenzeit arbeiten
 Fasten vor dem Hintergrund der gegenwärtigen sozialen und ökologischen Krisen Mit der Enzyklika Laudato Si in der Fastenzeit arbeiten Von Christian Hofmann Das ist ein Fasten, wie ich es liebe: die Fesseln
Fasten vor dem Hintergrund der gegenwärtigen sozialen und ökologischen Krisen Mit der Enzyklika Laudato Si in der Fastenzeit arbeiten Von Christian Hofmann Das ist ein Fasten, wie ich es liebe: die Fesseln
Ökumenische Rundschau
 Einheit und Vielfalt Ökumenische Rundschau 4/2015 Oktober Dezember 4/2015 64. Jahrgang Ökumenische Rundschau Miteinander Nebeneinander Gegeneinander Einheit und Vielfalt innerhalb der Religionen mit Beiträgen
Einheit und Vielfalt Ökumenische Rundschau 4/2015 Oktober Dezember 4/2015 64. Jahrgang Ökumenische Rundschau Miteinander Nebeneinander Gegeneinander Einheit und Vielfalt innerhalb der Religionen mit Beiträgen
Karteikarte Unterrichtsvorhaben Einführungsphase Religion 10.2
 Thema: Vernünftig Glauben - ein Widerspruch? Christliche Antworten auf die Gottesfrage Das Verhältnis von Vernunft und Glaube Sachkom-petenz Methodenkompetenz Übergeordnete Kompetenzerwartungen: Die SuS
Thema: Vernünftig Glauben - ein Widerspruch? Christliche Antworten auf die Gottesfrage Das Verhältnis von Vernunft und Glaube Sachkom-petenz Methodenkompetenz Übergeordnete Kompetenzerwartungen: Die SuS
AndersOrte Ulrich Brand, St. Virgil Salzburg,
 AndersOrte Ulrich Brand, St. Virgil Salzburg, 1.10.2015 wir benötigen angesichts der Krisen Kooperation AndersOrte sind Orte, die Alternativen zum Status quo aufzeigen; sie sind Experimentierfelder mit
AndersOrte Ulrich Brand, St. Virgil Salzburg, 1.10.2015 wir benötigen angesichts der Krisen Kooperation AndersOrte sind Orte, die Alternativen zum Status quo aufzeigen; sie sind Experimentierfelder mit
GERECHTIGKEIT GEGENÜBER DER NATUR. Kritik und Würdigung nicht-anthropozentrischer Begründungsansätze
 GERECHTIGKEIT GEGENÜBER DER NATUR Kritik und Würdigung nicht-anthropozentrischer Begründungsansätze praxisrelevante Überlegungen zum Eigenwert `der Biodiversität Silke Lachnit philosophisches Seminar Georg-August-Universität
GERECHTIGKEIT GEGENÜBER DER NATUR Kritik und Würdigung nicht-anthropozentrischer Begründungsansätze praxisrelevante Überlegungen zum Eigenwert `der Biodiversität Silke Lachnit philosophisches Seminar Georg-August-Universität
Wie geht Bibel? Sieben Ansätze zum Verständnis
 Ökumenische Vortragsreihe mit Gespräch Wie geht Bibel? Sieben Ansätze zum Verständnis Pastoralverbund Katholische Kirche Marburg und Fronhausen Die Bibel Ist das Alte Testament veraltet? Warum wir Christen
Ökumenische Vortragsreihe mit Gespräch Wie geht Bibel? Sieben Ansätze zum Verständnis Pastoralverbund Katholische Kirche Marburg und Fronhausen Die Bibel Ist das Alte Testament veraltet? Warum wir Christen
Das Projekt Weltethos und die Erd-Charta-Initiative: Zwei verschiedenartige Wege zum gleichen Ziel? von Lutz Röcke
 Das Projekt Weltethos und die Erd-Charta-Initiative: Zwei verschiedenartige Wege zum gleichen Ziel? von Lutz Röcke Unser Ziel war es, die Erklärung zum Weltethos gründlich zu studieren und sie mit der
Das Projekt Weltethos und die Erd-Charta-Initiative: Zwei verschiedenartige Wege zum gleichen Ziel? von Lutz Röcke Unser Ziel war es, die Erklärung zum Weltethos gründlich zu studieren und sie mit der
Arbeitswelt 4.0 Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitswelt und den Menschen. Perspektiven aus Sicht der Christlichen Sozialethik
 Arbeitswelt 4.0 Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitswelt und den Menschen Perspektiven aus Sicht der Christlichen Sozialethik 19.11.2016, Bad Honnef Referent: PD Dr. Udo Lehmann Stichworte
Arbeitswelt 4.0 Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitswelt und den Menschen Perspektiven aus Sicht der Christlichen Sozialethik 19.11.2016, Bad Honnef Referent: PD Dr. Udo Lehmann Stichworte
Inhaltsverzeichnis.
 Inhaltsverzeichnis Seite 1. Allgemeine Aufgabenbeschreibung 9 2. Die didaktische Struktur der Rahmenrichtlinien 12 2.1 Didaktische Konzeption Fünf Lernschwerpunkte als Strukturelemente 13 2.2 Beschreibung
Inhaltsverzeichnis Seite 1. Allgemeine Aufgabenbeschreibung 9 2. Die didaktische Struktur der Rahmenrichtlinien 12 2.1 Didaktische Konzeption Fünf Lernschwerpunkte als Strukturelemente 13 2.2 Beschreibung
Grundbegriffe klären, Themenfeld abstecken. Auseinandersetzng mit Kulturalität in der. Transkulturelle pflegeethische Prinzipien
 Das Fremde verstehen. Interkulturalität und ethische Konflikte in Medizin und Pflege. Grundbegriffe klären, Themenfeld abstecken Auseinandersetzng mit Kulturalität in der Pflege bzw. Pflegeethik Transkulturelle
Das Fremde verstehen. Interkulturalität und ethische Konflikte in Medizin und Pflege. Grundbegriffe klären, Themenfeld abstecken Auseinandersetzng mit Kulturalität in der Pflege bzw. Pflegeethik Transkulturelle
Lehrveranstaltungen zum Modul ro 2-18 (roo 2-18) Orthodoxe Moral- und Sozialtheologie, Schöpfungstheologie
 Lehrveranstaltungen zum Modul ro 2-18 (roo 2-18) Orthodoxe Moral- und Sozialtheologie, Schöpfungstheologie Modulverantwortliche/r: Dura Anzahl der Credits insgesamt: 6 Lehrveranstaltung: Systematische
Lehrveranstaltungen zum Modul ro 2-18 (roo 2-18) Orthodoxe Moral- und Sozialtheologie, Schöpfungstheologie Modulverantwortliche/r: Dura Anzahl der Credits insgesamt: 6 Lehrveranstaltung: Systematische
Leitbild Volksschule und Neue Mittelschule Linz Schulverein der Kreuzschwestern
 Leitbild Volksschule und Neue Mittelschule Linz Schulverein der Kreuzschwestern 1 Wir orientieren uns an Jesus Christus und seiner Botschaft. Wir legen Wert auf eine altersgemäße religiöse Erziehung, in
Leitbild Volksschule und Neue Mittelschule Linz Schulverein der Kreuzschwestern 1 Wir orientieren uns an Jesus Christus und seiner Botschaft. Wir legen Wert auf eine altersgemäße religiöse Erziehung, in
Sequenzplan Abitur 2014 Kompetent in Religion
 Einführungsphase verbindliche Grundbegriffe inhaltsbezogene Kompetenzen Themen in den 5 Arbeitsheften der Reihe Kompetent in Religion historischer Jesus/verkündigter Christus Mythos - Logos Säkularisierung
Einführungsphase verbindliche Grundbegriffe inhaltsbezogene Kompetenzen Themen in den 5 Arbeitsheften der Reihe Kompetent in Religion historischer Jesus/verkündigter Christus Mythos - Logos Säkularisierung
Heinz Eduard Tödt Menschenrechte - Grundrechte
 Heinz Eduard Tödt Menschenrechte - Grundrechte TÃ dt, Heinz Eduard Menschenrechte, Grundrechte 1982 digitalisiert durch: IDS Luzern Menschenrechte - Grundrechte 7. Menschen- und Grundrechte im Rechtsbewußtsein
Heinz Eduard Tödt Menschenrechte - Grundrechte TÃ dt, Heinz Eduard Menschenrechte, Grundrechte 1982 digitalisiert durch: IDS Luzern Menschenrechte - Grundrechte 7. Menschen- und Grundrechte im Rechtsbewußtsein
Leitbild. der Katholischen Landvolkshochschule Petersberg
 Leitbild der Katholischen Landvolkshochschule Petersberg II. Ziele Die Katholische Landvolkshochschule Petersberg gibt mit ihrem eigenen Bildungs programm Impulse und schafft Räume, das Leben angesichts
Leitbild der Katholischen Landvolkshochschule Petersberg II. Ziele Die Katholische Landvolkshochschule Petersberg gibt mit ihrem eigenen Bildungs programm Impulse und schafft Räume, das Leben angesichts
UNTERRICHTSVORHABEN 1
 UNTERRICHTSVORHABEN 1 Kirche als Nachfolgegemeinschaft n lernen verschiedene Erscheinungsformen und Persönlichkeiten der Kirche in Vergangenheit und Gegenwart kennen, verstehen sie in ihrem jeweiligen
UNTERRICHTSVORHABEN 1 Kirche als Nachfolgegemeinschaft n lernen verschiedene Erscheinungsformen und Persönlichkeiten der Kirche in Vergangenheit und Gegenwart kennen, verstehen sie in ihrem jeweiligen
Fachcurriculum Katholische Religion an der Sophienschule Hannover Jg. 7/8!
 Thema 1: Der Mensch auf der Suche nach Identität und Glück => Jg. 7 beschreiben Situationen der Selbstbzw. Fremdbestimmung, von Glück und Leid Sünde/Schuld, Person, Ebenbild, Freiheit, Bund erläutern das
Thema 1: Der Mensch auf der Suche nach Identität und Glück => Jg. 7 beschreiben Situationen der Selbstbzw. Fremdbestimmung, von Glück und Leid Sünde/Schuld, Person, Ebenbild, Freiheit, Bund erläutern das
Begrüßungsrede zum Empfang der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Hanns-Seidel-Stiftung aus Anlass des 2. Ökumenischen Kirchentages
 Hans-Gert Pöttering Begrüßungsrede zum Empfang der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Hanns-Seidel-Stiftung aus Anlass des 2. Ökumenischen Kirchentages Publikation Vorlage: Datei des Autors Eingestellt am
Hans-Gert Pöttering Begrüßungsrede zum Empfang der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Hanns-Seidel-Stiftung aus Anlass des 2. Ökumenischen Kirchentages Publikation Vorlage: Datei des Autors Eingestellt am
Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe Geschichte. Wahrnehmungskompetenz für Kontinuität und Veränderung in der Zeit
 Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe Geschichte Matrix Kompetenzanbahnung Kompetenzbereiche, und Themenfelder Durch die Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Aspekten der Themenfelder in den Kurshalbjahren
Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe Geschichte Matrix Kompetenzanbahnung Kompetenzbereiche, und Themenfelder Durch die Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Aspekten der Themenfelder in den Kurshalbjahren
André Kuper Präsident des Landtags Nordrhein-Westfalen
 André Kuper Präsident des Landtags Nordrhein-Westfalen Begrüßungsworte Eröffnung der Ausstellung Gelebte Reformation Die Barmer Theologische Erklärung 11. Oktober 2017, 9.00 Uhr, Wandelhalle Meine sehr
André Kuper Präsident des Landtags Nordrhein-Westfalen Begrüßungsworte Eröffnung der Ausstellung Gelebte Reformation Die Barmer Theologische Erklärung 11. Oktober 2017, 9.00 Uhr, Wandelhalle Meine sehr
wir zwar ohne Religion geboren, aber nicht ohne das Grundbedürfnis nach Mitgefühl und nicht ohne das Grundbedürfnis nach Wasser.
 wir zwar ohne Religion geboren, aber nicht ohne das Grundbedürfnis nach Mitgefühl und nicht ohne das Grundbedürfnis nach Wasser. Ich sehe immer deutlicher, dass unser spirituelles Wohl nicht von der Religion
wir zwar ohne Religion geboren, aber nicht ohne das Grundbedürfnis nach Mitgefühl und nicht ohne das Grundbedürfnis nach Wasser. Ich sehe immer deutlicher, dass unser spirituelles Wohl nicht von der Religion
Einführung in die Ethik
 Helmut Burkhardt Einführung in die Ethik Teill Grund und Norm sittlichen Handelns (Fundamentalethik) BIRIUININIEIN VERLAG GIESSEN-BASEL Inhalt Vorwort 13 A. Vorfragen der Ethik: Was ist Ethik? 15 I. Klärung
Helmut Burkhardt Einführung in die Ethik Teill Grund und Norm sittlichen Handelns (Fundamentalethik) BIRIUININIEIN VERLAG GIESSEN-BASEL Inhalt Vorwort 13 A. Vorfragen der Ethik: Was ist Ethik? 15 I. Klärung
Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Praxis
 Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Praxis Dr. Barbara Dorn Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände Leiterin Abteilung Bildung Berufliche Bildung Anhörung des Parlamentarischen Beirates
Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Praxis Dr. Barbara Dorn Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände Leiterin Abteilung Bildung Berufliche Bildung Anhörung des Parlamentarischen Beirates
Schulinterner Lehrplan Evangelische Religionslehre (G8)
 Schulinterner Lehrplan Evangelische Religionslehre (G8) Klasse 5 Gott suchen - Gott erfahren Die Bibel Urkunde des Glaubens (Von Gott erzählen) Die Bibel (k)ein Buch wie jedes andere Zweifel und Glaube
Schulinterner Lehrplan Evangelische Religionslehre (G8) Klasse 5 Gott suchen - Gott erfahren Die Bibel Urkunde des Glaubens (Von Gott erzählen) Die Bibel (k)ein Buch wie jedes andere Zweifel und Glaube
Leitsätze der Ehe- und Familienpastoral im Erzbistum Paderborn
 Leitsätze der Ehe- und Familienpastoral im Erzbistum Paderborn Unser Selbstverständnis Der Mensch als Ebenbild Gottes 1. Von Gott und nach seinem Abbild als Mann und Frau erschaffen (Gen 1,27) und durch
Leitsätze der Ehe- und Familienpastoral im Erzbistum Paderborn Unser Selbstverständnis Der Mensch als Ebenbild Gottes 1. Von Gott und nach seinem Abbild als Mann und Frau erschaffen (Gen 1,27) und durch
Walter Kardinal Kasper. Martin Luther. Eine ökumenische Perspektive. Patmos Verlag
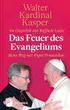 Walter Kardinal Kasper Martin Luther Eine ökumenische Perspektive Patmos Verlag Meiner Schwester Ingeborg von Gott am 28. Januar 2016 heimgerufen Inhalt Die vielen Lutherbilder und der fremde Luther 7
Walter Kardinal Kasper Martin Luther Eine ökumenische Perspektive Patmos Verlag Meiner Schwester Ingeborg von Gott am 28. Januar 2016 heimgerufen Inhalt Die vielen Lutherbilder und der fremde Luther 7
UNIVERSITÄT HOHENHEIM
 UNIVERSITÄT HOHENHEIM Doppelfach Evangelische Theologie im Bachelor-Studiengang Wirtschaftswissenschaften mit wirtschaftspädagogischem Profil Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Institut für
UNIVERSITÄT HOHENHEIM Doppelfach Evangelische Theologie im Bachelor-Studiengang Wirtschaftswissenschaften mit wirtschaftspädagogischem Profil Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Institut für
Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Jahrgangsstufe 7 Unterrichtsvorhaben: Sakramente Lebenszeichen
 Unterrichtsvorhaben: Sakramente Lebenszeichen Inhaltliche Schwerpunkte ( Inhaltsfelder): Kirche als Nachfolgegemeinschaft (IHF5), Menschsein in Freiheit und Verantwortung (IHF1) Lebensweltliche Relevanz:
Unterrichtsvorhaben: Sakramente Lebenszeichen Inhaltliche Schwerpunkte ( Inhaltsfelder): Kirche als Nachfolgegemeinschaft (IHF5), Menschsein in Freiheit und Verantwortung (IHF1) Lebensweltliche Relevanz:
Die Ökumene heute und ökumenische Zielvorstellungen in evangelischer Sicht. Prof. Dr. Hans-Peter Großhans
 Die Ökumene heute und ökumenische Zielvorstellungen in evangelischer Sicht Prof. Dr. Hans-Peter Großhans I. Vielfalt der Kirchen und ihre Einheit Der neutestamentliche Kanon begründet als solcher nicht
Die Ökumene heute und ökumenische Zielvorstellungen in evangelischer Sicht Prof. Dr. Hans-Peter Großhans I. Vielfalt der Kirchen und ihre Einheit Der neutestamentliche Kanon begründet als solcher nicht
Nachhaltigkeitskommunikation Defizite, Neuentwicklungen und soziokulturelle Perspektiven
 Nachhaltigkeitskommunikation Defizite, Neuentwicklungen und soziokulturelle Perspektiven Beitrag zur Tagung: Kulturelle Nachhaltigkeit und Naturschutz (Insel Vilm, 11.12.2008) 1von 8 Als Ausgangspunkt
Nachhaltigkeitskommunikation Defizite, Neuentwicklungen und soziokulturelle Perspektiven Beitrag zur Tagung: Kulturelle Nachhaltigkeit und Naturschutz (Insel Vilm, 11.12.2008) 1von 8 Als Ausgangspunkt
A,4 Persönliches sich Mitteilen in der Gegenwart des Herrn (Schritt 4 und 5)
 A: Bibel teilen A,4 Persönliches sich Mitteilen in der Gegenwart des Herrn (Schritt 4 und 5) Zur Vorbereitung: - Bibeln für alle Teilnehmer - Für alle Teilnehmer Karten mit den 7 Schritten - Geschmückter
A: Bibel teilen A,4 Persönliches sich Mitteilen in der Gegenwart des Herrn (Schritt 4 und 5) Zur Vorbereitung: - Bibeln für alle Teilnehmer - Für alle Teilnehmer Karten mit den 7 Schritten - Geschmückter
