Waldzustandsbericht 2017 Langfassung. Bericht über den ökologischen Zustand des Waldes in NRW.
|
|
|
- Wilfried Althaus
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Waldzustandsbericht 17 Langfassung Bericht über den ökologischen Zustand des Waldes in NRW
2
3 3 Inhalt Vorwort 4 CHRISTINA SCHULZE FÖCKING Die Waldzustandserfassung 17 die wichtigsten Ergebnisse im Überblick 5 LUTZ FALKENRIED LANDESBETRIEB WALD UND HOLZ NORDRHEIN-WESTFALEN Die Vitalität der Baumkronen 17 7 LUTZ FALKENRIED LANDESBETRIEB WALD UND HOLZ NORDRHEIN-WESTFALEN Die Wetterverhältnisse bis zum Sommer LUTZ GENẞLER LANDESAMT FÜR NATUR, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ NORDRHEIN-WESTFALEN Schädlings- und Pilzbefall an den Waldbäumen 31 DR. MATHIAS NIESAR UND NORBERT GEISTHOFF LANDESBETRIEB WALD UND HOLZ NORDRHEIN-WESTFALEN Phänologische Beobachtungen an Waldbäumen im Frühjahr CHRISTOPH ZIEGLER LANDESAMT FÜR NATUR, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ NORDRHEIN-WESTFALEN Tabellen- und Abbildungsverzeichnis 49 Impressum 50
4 4 Vorwort LIEBE LESERINNEN UND LESER, die Wälder Nordrhein-Westfalens sind ein besonders wertvolles Gut. In NRW gibt es rund Hektar Wald, das sind 27 Prozent der Landesfläche. Wälder sind Klimaretter, bedeutender Lebensraum für die Tier- und Pflanzenwelt und nicht zuletzt Erholungsraum für 18 Millionen Menschen. Sie sind die grünen Lungen unseres Landes. Der Wald ist aber auch Produktionsstätte des nachwachsenden Rohstoffs Holz und damit Ausgangspunkt einer Wertschöpfungskette, die angesichts des Klimawandels immer wichtiger wird. Mit dem jährlichen Waldzustandsbericht berichtet die Landesregierung seit mehr als 30 Jahren über den Gesundheitszustand unserer Wälder. Ursprünglicher Anlass war die Sorge in den frühen 1980er-Jahren, dass die Wälder durch Umweltverschmutzung nachhaltig geschädigt werden. Es war die Zeit des sogenannten Sauren Regens und weil die Politik damals schnell und entschlossen mit klaren Gesetzesvorgaben reagierte, konnten die für den Wald schädlichen Emissionen deutlich reduziert werden. Das flächendeckende Absterben von Wäldern wurde verhindert. Im Vergleich zu den ersten beiden Jahrzehnten der Berichterstattung hat sich der Trend einer zunehmenden Kronenverlichtung in den zurückliegenden Jahren deutlich abgeschwächt. Gleichwohl ist der Gesundheitszustand unserer Wälder nach wie vor nicht befriedigend. Ihn zu erhalten und weiter zu verbessern und zugleich Wälder nachhaltig zu bewirtschaften ist eine Gemeinschaftsaufgabe gerade in Zeiten des Klimawandels. Witterungsextreme, wie Trockenzeiten und Stürme, und auch die Belastungen durch einwandernde Schaderreger beeinträchtigen die Vitalität der Bäume. Wir benötigen stabile Waldökosysteme für ein lebenswertes Nordrhein-Westfalen. Ziel der Landesregierung ist es, die Bedingungen für eine gute Pflege und Bewirtschaftung der Wälder weiter zu verbessern. Unsere Wälder sind wichtige Orte der Artenvielfalt, des Naturerlebens und der Erholung. Dieses Naturerbe müssen wir unbedingt erhalten und schützen. Ihre Erfreulicherweise hat sich der Waldzustand in NRW im Jahr 17 insgesamt weiter leicht verbessert. Bei den Laubbäumen haben sich besonders die Buchen im zurückliegenden Jahr wieder erholt. Bei den Eichen hat sich hingegen der Anteil der gut belaubten Bäume im Vergleich zu 16 leicht verringert. Bei den Nadelbäumen haben sich die Nadelverluste bei den Fichten verringert, während die Kiefern eine stärkere Kronenverlichtung zeigen. Christina Schulze Föcking Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen
5 5 Die Waldzustandserfassung 17 die wichtigsten Ergebnisse im Überblick Die Waldzustandserfassung 17 die wichtigsten Ergebnisse im Überblick LUTZ FALKENRIED, LANDESBETRIEB WALD UND HOLZ NORDRHEIN-WESTFALEN Zusammenfassend hat sich 17 der Kronenzustand im Vergleich zum Vorjahr wieder etwas gebessert. Dabei zeigen unsere Hauptbaumarten eine gegenläufige Entwicklung: Buche und Fichte haben sich in ihrem Kronenzustand verbessert, Eiche und Kiefer hingegen verschlechtert. Der diesjährige Raupenfraß im Frühjahr war nicht stark genug, um die EICHE zur Bildung von Regenerationsbelaubung zu bewegen. Die befressenen Blätter waren auch im Sommer noch deutlich zu sehen. Der Eiche-Kronenzustand hat sich deshalb auch in einem verschlechterten Zustand gezeigt. Die Eiche weist in diesem Jahr den schlechtesten Kronenzustand unter den Hauptbaumarten auf. Der BUCHE hat nach dem starken Fruchtanhang im Vorjahr das diesjährige Ausbleiben der Mast gutgetan. Sie konnte sich etwas erholen und hat so ihren Belaubungszustand verbessert. Ähnlich der Buche, konnte sich die FICHTE nach einer stärkeren Fruktifikation im letzten Jahr nun etwas erholen. Ihr Kronenzustand zeigte sich verbessert. Zapfen sind nahezu nicht gebildet worden. Das trocken-warme Frühjahr hat die Fichten nur vereinzelt negativ beeinflusst. Durch das vermehrte Auftreten von Pilzinfektionen wies diesjährig die KIEFER in einigen Regionen vermehrt braune und abgefallene Nadeln auf. Insgesamt hat sich ihr Benadelungszustand verschlechtert. Trotzdem ist die Kiefer in NRW die Baumart mit den geringsten Verlichtungswerten.
6 6 Die Waldzustandserfassung 17 die wichtigsten Ergebnisse im Überblick WETTER Das Winterwetter 16/17 in NRW war trocken und kalt, aber sonnig. Im März 17 blieben die Niederschlagsmengen in NRW zwar unter den langfristigen Mittelwerten ( ), aber die Lufttemperaturen stiegen stark an. Der Monat März 17 wurde als wärmster März, der in NRW je gemessen wurde, eingestuft. Die erhöhten Temperaturen riefen eine frühzeitige Blüte vieler Obstbäume hervor. Der abrupte Temperaturfall im Folgemonat ließ dann häufig die offenen Blüten durch Spätfröste gefrieren. Im Mai 17 stiegen die Temperaturwerte wieder schnell an, sodass in Folge auch die Temperaturen im Juni, Juli und August sommerliche Ausmaße annahmen. Die Niederschläge blieben eine Zeitlang auch im Sommer noch unter den Langzeitmessdaten, bis diese dann im Juli 17 weit überschritten wurden. WALDSCHUTZ Die Dichten von Eichenprozessionsspinnern haben sich in 17, aufgrund der günstigen Klimabedingungen während des Hochzeitsfluges der Schmetterlinge in 16, erhöht. Eichensterben wurde nicht induziert. Bei Douglasien traten Schäden vor allem im Sauerland durch Kupferstecher sowie Nadel- und Stammpilze auf und führten zu sichtbaren Kronenrotverfärbungen. Weißtannen litten im Siegerund Sauerland unter Laus-, Pilz- und Rüsselkäferbefall mit teilweise letalem Ausgang. Schwerwiegende Probleme hat die Kiefer im Niederrheinischen Tiefland mit dem Wurzelschwamm, wodurch sich ganze Bestände auflösen. Im Jahr 17 ist regional durch Buchdruckerbefall der Käferholzanfall in Fichtenbeständen gestiegen. Ein weiteres Insekt, die Rosskastanienminiermotte, führte an weiß blühenden Kastanien zu auffälligen frühzeitigen Blattverbräunungen und -verlusten. Die forstschädlichen Mäuse fanden sich im Winter auf einem relativ geringen Populationsniveau. Aufgrund der vielen, im letzten Herbst abgefallenen Bucheckern, ist anschließend die Rötelmauspopulation im Verlauf des Jahres angestiegen. In der Folge nahmen die Infektionen mit dem von der Maus auf den Menschen übertragbaren Hantavirus zu. PHÄNOLOGIE Auf einen warmen März, einen kalten April und einen am Ende sommerlichen Mai reagierten die Baumarten überwiegend mit einem späten Blattaustrieb. Lediglich bei den Stieleichen in Münster und Warendorf, sowie bei der Traubeneiche in Stadtlohn und der Buche in Duisburg war der mittlere Austriebstermin bereits im April erreicht. Durch den Wärmeimpuls im März war bei der früh austreibenden Stieleiche in Viersen die Blattentfaltung sogar schon Ende März zu 50 Prozent abgeschlossen. Auf allen anderen Flächen lag der mittlere Austriebstermin erst im Mai. Im Trend der untersuchten 17 Jahre neigen Buche und Eiche zu einem früheren, Kiefer und Fichte dagegen zu einem späteren Austrieb. Auch der modernen Technik muss der Wald Raum geben. Borkenkäfer hinterlassen ihre markanten Spuren unter der Rinde. Der Waldrand verschiebt sich und macht den jungen Fichten Platz.
7 7 Die Vitalität der Baumkronen 17 Die Vitalität der Baumkronen 17 LUTZ FALKENRIED, LANDESBETRIEB WALD UND HOLZ NORDRHEIN-WESTFALEN Am Zustand der Baumkronen lässt sich gut der Grad der Lebendigkeit von Waldbäumen detektieren. Zur Einschätzung der Vitalität der Baumkronen wurde im Juli und August 17 eine Zustandserfassung auf der gesamten Waldfläche in Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Neben dem Nadel-/Blattverlust bewertet die Waldzustandserfassung verschiedenste Indikatoren, die Einfluss auf das Erscheinungsbild der Baumkronen haben. Dazu zählen besonders Vergilbung, Fruktifikation sowie weitere biotische und abiotische Faktoren. Für die jährlichen Erhebungen zum Waldzustand sind für den Gesamtwald in NRW seit 1984 Stichprobenpunkte im Raster von 4 x 4 km festgelegt worden. Dabei werden an 560 Stichprobenpunkten mehr als Einzelbäume untersucht. Die Probebäume sind dauerhaft markiert und werden regelmäßig von forstlichen Spezialisten aufgenommen. Durch die kontinuierlichen Untersuchungen sind nicht nur Aussagen zum aktuellen Jahr möglich, sondern es können besonders gut die langjährigen Trends bei den einzelnen Baumarten durch Zeitreihen dargestellt werden. Diese Erhebungen vermögen zudem wichtige Informationen zur aktuellen Diskussion zu den möglichen Auswirkungen des prognostizierten Klimawandels beisteuern. Zudem steht damit über einen 33-jährigen Zeitraum wertvolles Datenmaterial für das forstliche Umweltmonitoring zur Verfügung.
8 8 Die Vitalität der Baumkronen 17 DATEN FÜR DEN BUNDESDEUTSCHEN UND EUROPÄISCHEN WALDZUSTANDSBERICHT Im Raster von 16 x 16 km erfolgt eine zusätzliche Stichprobenerhebung, deren Daten für den bundesweiten Waldzustandsbericht verwendet werden. Alle Bundesländer steuern dazu ihre Erhebungsergebnisse bei. Die deutschen Ergebnisse finden zudem Eingang in europäische und internationale Berichte zum Waldzustand. VERLICHTUNGSSTUFEN Die Klassifizierung der Kronenverlichtung erfolgt gemäß der nachstehenden bundesweit einheitlichen Tabelle (Tab. 1). Unter Einbeziehung von Vergilbungsstufen entstehen daraus die kombinierten Schadstufen. Dabei werden die Stufen 2 bis 4 zur deutlichen Kronenverlichtung zusammengefasst. In den folgenden Grafiken werden die Verlichtungsstufen zur besseren Übersicht gruppiert und in Ampelfarben dargestellt. HAUPTERGEBNISSE Im Vergleich zum Vorjahr hat sich statistisch der Kronenzustand unseres Gesamtwaldes leicht verbessert. Die deutliche Kronenverlichtung hat sich um 4 Prozentpunkte auf 25 % gebessert. In der Warnstufe gab es eine Zunahme um 2 Prozentpunkte. Sie beträgt nun 45 %. Die Bäume ohne Schäden erreichen einen Anteil von 30 % und haben sich damit um 2 Prozentpunkte gesteigert (Abb. 1). Kronenverlichtung in Stufen TABELLE 1 Schadstufe Verlichtung Bezeichnung % ohne Kronenverlichtung % Warnstufe (schwache Kronenverlichtung) % mittelstarke Kronenverlichtung % starke Kronenverlichtung % abgestorben ABBILDUNG 1 Prozentuale Verteilung der Kronenverlichtung für die Summe aller Baumarten und Altersbereiche in NRW deutlich ohne Verlichtungsstufen Waldzustandserhebung 17 in Prozent schwach 45
9 9 Die Vitalität der Baumkronen 17 Bei den Bäumen ohne Verlichtung ist es im letzten Jahr erneut zu einer Verbesserung der Werte gekommen. Wie in Abbildung 2 (S. 10) zu sehen, setzt sich mit diesem Ergebnis eine Reihe der leichten Besserung seit 14 fort. Die deutlichen Schäden zeigen einen stärkeren jährlichen Wechsel. Dabei führen die Mastjahre bei der Buche immer wieder zu Spitzenwerten. Insgesamt bewegen sich auch in 17 die Verlichtungswerte auf einem hohen Niveau. Die Darstellung der mittleren Nadel-/Blattverluste erlaubt einen Blick auf Durchschnittswerte. Sie erfolgt zusätzlich zur Auswertung nach Schadstufen. Abbildung 3 (S. 11) zeigt für dieses Jahr eine leichte Abnahme des mittleren Nadel-/Blattverlustes. Die Abbildung zeigt, dass die Verlustwerte insgesamt über die Jahre prinzipiell stetig zugenommen haben. Die Absterberate ist ein wichtiger Indikator für den Gesundheitszustand des Waldes. In sie gehen die Bäume der Schadstufe 4 ein. Von den ca untersuchten Bäumen waren in diesem Jahr etwa 0,4 % abgestorben. Die Werte der Absterberate bewegen sich in der Zeitreihe in einem engen Fenster zwischen 0,07 % als Minimum und 0,44 % als Maximalwert. Im Mittel über alle Jahre liegt die Absterberate bei 0,21 %. 17 ist es zu einer leichten Erhöhung der Absterberate gekommen (Abb. 4, S. 11). Dabei haben sich die Laubbäume etwas verschlechtert, während sich die Nadelbäume gebessert haben. Ein weiblicher Rothalsbock (Stictoleptura rubra) auf einer Waldwiese Vielfältige Ansprüche an die Waldleistungen erfordern manchmal eine hohe Infrastruktur. Sechs Waldwege münden in eine Wegekreuzung.
10 10 Die Vitalität der Baumkronen 17 Entwicklung des Kronenzustandes aller Baumarten 1984 bis 17 ABBILDUNG 2 Fläche in Prozent deutliche Kronenverlichtung schwache Kronenverlichtung (Warnstufe) ohne Kronenverlichtung 1 Durch Rundungsdifferenzen können in einzelnen Jahren kleine Abweichungen in der Gesamtsumme entstehen; 2 kein Landesergebnis; 3 nur bedingt mit den übrigen Jahren vergleichbar
11 11 Die Vitalität der Baumkronen 17 Mittlerer Nadel-/Blattverlust aller Baumarten ABBILDUNG 3 25 Zeitreihe in Prozent* Absterberaten aller Baumarten ABBILDUNG 4 2,5 Zeitreihe in Prozent* 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Buche Eiche Fichte Kiefer * 1996 keine Erhebung
12 12 Die Vitalität der Baumkronen 17 Der Kronenzustand der einzelnen Baumarten unterscheidet sich häufig von den summarischen Ergebnissen des Gesamtwaldes. Deshalb werden die Hauptbaumarten im Folgenden noch einmal getrennt betrachtet. ERGEBNISSE ZU DEN WICHTIGSTEN BAUMARTEN Tabelle 2 lässt einen differenzierten Blick auf die einzelnen Baumarten zu. Dabei sind die Altersgruppen zusammengefasst. Die folgende Wertung der Ergebnisse bezieht sich auf die Veränderung zu den Zahlen des Vorjahres. Abbildung 5 (S. 13) lässt erkennen, dass bei Eiche und Kiefer das Maximum der Häufigkeit ihrer Verlichtungsprozente bei im gelben Bereich zwischen 10 und 25 % liegt. Die Kiefer ragt dabei mit einer deutlichen Spitze heraus. Bei Buche und Fichte liegen die Spitzenwerte jedoch an der Klassengrenze zwischen dem grünen und gelben Bereich. Damit spiegelt sich wider, dass sich diese beiden Baumarten 17 in einem besseren Zustand befinden. Im Frühjahr 17 konnte ein nur verhaltenes Blühen der Waldbäume beobachtet werden. Die daraus resultierende Samenentwicklung war deshalb weitestgehend auch nur gering ausgeprägt. Besonders die Buche hat nach dem starken Samenjahr im Vorjahr in 17 fast keine Bucheckern gebildet (Abb. 6, S. 13). Schadstufen je Baumartengruppe 17 TABELLE 2 Ergebnisse der Waldzustandserfassung (in Klammern Vergleichsdaten aus 16) Anteile der Schadstufen in Prozent Baumart Baumartenfläche nach Landeswaldinventur in Hektar 0 ohne Kronenverlichtung 1 schwache Kronenverlichtung 2 4 deutliche Kronenverlichtung Fichte (30) 42 (40) 24 (30) Kiefer (22) 68 (65) 19 (13) Sonstige Nadelbäume (45) 39 (37) 13 (18) Summe Nadelbäume (30) 46 (44) 22 (26) Buche (17) 43 (35) 27 (48) Eiche (30) 43 (41) 33 (29) Sonstige Laubbäume (33) 48 (46) 23 (21) Summe Laubbäume (27) 45 (41) 27 (32) Summe NRW (28) 45 (43) 25 (29)
13 13 Die Vitalität der Baumkronen 17 ABBILDUNG 5 Verteilung der Nadel-/Blattverluste bei den Hauptbaumarten Häufigkeitsverteilung der Verlichtungsprozente (farbige Hinterlegung der Verlichtungsstufen) Buche Eiche Fichte Kiefer Anteil der Fruktifikation je Baumart 17 Angaben in Prozent ABBILDUNG 6 0 stark mittel gering nicht vorhanden Buche Eiche Fichte Kiefer
14 14 Die Vitalität der Baumkronen 17 EICHE Seit 13 konnte bei der Eiche eine schrittweise Verbesserung der deutlichen Schäden beobachtet werden. In diesem Jahr ist diese Entwicklung leider nicht weitergegangen. Die deutlichen Schäden sind um 4 Prozentpunkte auf 33 % gestiegen. Bei den Bäumen ohne Kronenverlichtung musste ebenfalls eine Verschlechterung verzeichnet werden. Die Werte haben um 6 Prozentpunkte abgenommen und belaufen sich nun auf 24 % (Abb. 7, S. 15). Die Warnstufe liegt mit nur geringer Steigerung bei 43 %. Damit zeigt die Eiche in diesem Jahr wieder den schlechtesten Kronenzustand bei den Hauptbaumarten. Die Wuchsbedingungen sind für die Eiche recht passabel gewesen. Nach einem generell milden Winter ist das Jahr 17 mit einem trockenen und warmen Frühjahr gestartet. Besonders der März hat hohe Temperaturwerte erbracht. In einigen Regionen sind wegen der Trockenheit Waldbrandwarnungen ausgesprochen worden. Vereinzelt hat es Spätfröste gegeben, die Einfluss auf die diesjährige Blüte gehabt haben. Ab Juni 17 haben die Niederschläge aber deutlich zugenommen, sodass es für den Rest des Jahres zu keiner Trockenheit in den Böden gekommen ist (Foto, S. 16). Das trocken-warme Frühjahr hat auch dazu geführt, dass die Fraßinsekten, wie z. B. die Raupen von Frostspanner und Eichenwickler, sich gut entwickeln konnten. Das Fraßgeschehen im Frühjahr bewegte sich auf einem oberen mittleren Niveau (Abb. 8, S. 16). Für die Baumkronen ist ein mittlerer Insektenfraß jedoch folgenschwerer, als starke Fraßaktivität. Wird die Eiche im Frühjahr stark befressen, besitzt sie die Fähigkeit, die fehlende Blattmasse durch neuen und weiteren Blattaustrieb zu regenerieren, sodass im Sommer vom Insektenfraß meist nichts mehr zu erkennen ist. Bei leichtem und mittlerem Fraß unterbleibt aber die Regeneration des Blattwerks weitestgehend und die Eiche zeigt im Sommer deutliche Fraßspuren und höhere Blattverluste. Dies war in diesem Jahr besonders deutlich ausgeprägt und führte vornehmlich zu den schlechteren Verlichtungsprozenten. Der Mehltaupilz, der insbesondere auf den Eichenblättern der frischen Regenerationsbelaubung, die sich nach Blattfraß bildet, häufig vorkommt, hat in diesem Jahr nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Die Befallsstärke belief sich insgesamt auf eine moderate Höhe. Lokal konnten jedoch einige Befallsspitzen verzeichnet werden. Allerdings konnte beobachtet werden, dass in vielen Eichenkulturen der Mehltaubefall kräftig ausgefallen war. Die Wärme liebenden Eichenprachtkäfer befallen die Eichen in wiederkehrenden Wellen. Sie sind zwar auch in diesem Jahr in den Eichenkronen aktiv gewesen, haben die Bäume aber etwas weniger als in den Vorjahren beeinträchtigt. Die Eichen zeigen in diesem Jahr lichte Kronen. Die Ausbildung von Früchten war sehr verhalten und so haben durchschnittlich weniger Bäume Eicheln angesetzt (Abb. 6, S. 13). Jedoch gab es individuell auch Unterschiede bei der Fruchtentwicklung.
15 15 Die Vitalität der Baumkronen 17 Entwicklung der Kronenverlichtung bei Eichen 1984 bis 17 ABBILDUNG 7 Fläche in Prozent Alte Eichenstubben bleiben für die Holzzersetzer lange erhalten deutliche Kronenverlichtung schwache Kronenverlichtung (Warnstufe) ohne Kronenverlichtung 1 Durch Rundungsdifferenzen können in einzelnen Jahren kleine Abweichungen in der Gesamtsumme entstehen; 2 kein Landesergebnis; 3 nur bedingt mit den übrigen Jahren vergleichbar
16 16 Die Vitalität der Baumkronen 17 Die Frühjahrstrockenheit lässt den Wasserstand der Möhnetalsperre sinken und legt weite Uferbereiche trocken. ABBILDUNG 8 Befall der Eichen mit Schmetterlingsraupen 1989 bis 17 Angaben in Prozent* stark gering * 1996 keine Erhebung
17 17 Die Vitalität der Baumkronen 17 BUCHE Das letzte Jahr war für die Buche wieder ein Mastjahr. Eine heftige Fruktifikation hatte zu einer starken Bildung von Bucheckern in den Baumkronen und damit zu schlechten Belaubungswerten geführt. In diesem Jahr ist die Fruchtbildung bei den Buchen fast vollständig ausgeblieben (Abb. 10, S. 19). Die Buche ist im Erholungsmodus. So konnten wieder größere Blätter und ein dichteres Kronendach gebildet werden. Die deutlichen Schäden haben sich um 21 Prozentpunkte auf 27 % gesenkt. Bei den gesunden Bäumen hat sich eine Verbesserung um 13 Prozentpunkte eingestellt. Sie liegen nun bei 30 %. Die schwachen Schäden der Warnstufe sind um 8 Prozentpunkte auf 43 % geklettert (Abb. 9, S. 18) Der Buchenspringrüssler ist ein Käfer, der als Dauergast in der Buche angesehen werden muss. Aktuell hat sich eine schwache bis durchschnittliche Befallsstärke gezeigt. Die Fraßschäden waren insgesamt gering ausgeprägt. Starker Fraß ist nur unwesentlich aufgetreten (Abb. 11, S. 19). Neben dem Lochfraß des Käfers an den Blättern schädigt zusätzlich seine Larve, die in den Blättern miniert und meist die vorderen Blattbereiche durch Nekrosen zum Absterben bringt. Nekrotische Blätter sind aber nur in einem schwachen Ausmaß vorgekommen.
18 18 Die Vitalität der Baumkronen 17 ABBILDUNG 9 Entwicklung der Kronenverlichtung bei Buchen 1984 bis 17 Fläche in Prozent Eine jüngere Buche versucht erfolglos eine starke Verletzung zu überwallen. Die Stammfäule ist schon fortgeschritten deutliche Kronenverlichtung schwache Kronenverlichtung (Warnstufe) ohne Kronenverlichtung 1 Durch Rundungsdifferenzen können in einzelnen Jahren kleine Abweichungen in der Gesamtsumme entstehen; 2 kein Landesergebnis; 3 nur bedingt mit den übrigen Jahren vergleichbar
19 19 Die Vitalität der Baumkronen 17 Intensität der Fruchtbildung bei Buchen 1989 bis 17 Angaben in Prozent* 100 ABBILDUNG stark mittel gering ABBILDUNG 11 Befall der Buchen mit Buchenspringrüssler 1989 bis 17 Angaben in Prozent* stark gering * 1996 keine Erhebung
20 Die Vitalität der Baumkronen 17 ABBILDUNG 12 Entwicklung der Kronenverlichtung bei Fichten 1984 bis 17 FICHTE Fläche in Prozent 1 In diesem Jahr hat sich die Fichte wieder verbessern können. Die deutliche Kronenverlichtung hat im Vergleich zu den Vorjahreswerten um 6 Prozentpunkte abgenommen und beträgt jetzt 24 %. Der Anteil der gesunden Bäume hat sich um 4 Prozentpunkte gebessert, wohingegen die Warnstufe um 2 Prozentpunkte zugenommen hat (Abb. 12) Im letzten Jahr hatte die Fichte eine erhöhte Fruktifikation zu verzeichnen. Es wurden viele Zapfen gebildet, was durch den damit verbundenen Ausfall von Nadelmasse zu höheren Nadelverlusten insgesamt in den Fichtenkronen führte. In diesem Jahr fand nahezu keine Fruktifikation statt und die Fichten konnten sich wieder etwas erholen (Abb. 13, S. 21) Zudem haben die höheren Niederschläge im Frühsommer sich positiv auf das weitere Wachstum der Waldbäume ausgewirkt, wovon auch die Fichte profitieren konnte. Allerdings ist es zuvor im niederschlagsarmen Frühjahr bei den flachwurzelnden Fichten zu vereinzelten Trocknisschäden gekommen. Borkenkäfer sind für die Fichten eine ständige Bedrohung. Der Borkenkäferbefall war in diesem Jahr erhöht. Insbesondere im trockenen Frühjahr kam es zu höheren Befallswerten. Erst der zunehmende Niederschlag im Sommer brachte mit seinen Folgen die Käferpopulation zum Zusammenbruch. IIn einigen Bereichen in NRW fiel auch eine größere Menge an Käferholz durch abgestorbene Fichten an. Die gute Holznachfrage trug dazu bei, dass befallenes Holz schnell abgefahren und so die weitere Verbreitung von Käfern erschwert wurde Insgesamt hat sich der Borkenkäferbefall in der Waldzustandserfassung aber nur gering bemerkbar gemacht deutliche Kronenverlichtung schwache Kronenverlichtung (Warnstufe) ohne Kronenverlichtung Durch Rundungsdifferenzen können in einzelnen Jahren kleine Abweichungen in der Gesamtsumme entstehen; 2 kein Landesergebnis; 3 nur bedingt mit den übrigen Jahren vergleichbar
21 21 Die Vitalität der Baumkronen 17 Intensität der Fruchtbildung bei Fichten 1989 bis 17 Angaben in Prozent* 100 ABBILDUNG stark mittel gering * 1996 keine Erhebung Auf freien Flächen entsteht natürliche Verjüngung.
22 22 Die Vitalität der Baumkronen 17 KIEFER Die Kiefer hatte sich seit 13 stetig in kleinen Schritten verbessert. In diesem Jahr ist es erstmals wieder zu einer Verschlechterung gekommen. So musste in im Vorjahresvergleich eine Zunahme der deutlichen Schäden um 6 Prozentpunkte auf jetzt 19 % verzeichnet werden. Der Anteil der Bäume ohne Kronenverlichtung ist sogar um 9 Prozentpunkte auf 13 % gefallen. Die Kiefer weist prinzipiell einen verhältnismäßig geringen Anteil an deutlichen Schäden auf, aber gleichzeitig sind auch recht wenige gesund. Daraus ergibt sich ein stark ausgeprägter Bereich der schwachen Kronenverlichtung. Mit 68 % befinden sich damit mehr als zwei Drittel der Kiefern in dieser Warnstufe (Abb. 14, S. 23). In der Regel ist die jährliche Fruktifikation bei der Kiefer oft etwas deutlicher ausgeprägt, als bei den anderen Hauptbaumarten. Blüte und Zapfenanhang haben sich in diesem Jahr gut entwickelt, waren für die Kiefer aber nicht außergewöhnlich hoch (Abb. 6, S. 13). Immer wieder sind Kiefern mit braunen Nadeln beobachtet worden. Ursache ist die Erkrankung mit einem Pilz (Sphaeropsis sapinea), der zum Diplodia-Triebsterben vornehmlich bei Kiefern führt. Dabei verbraunen die Nadeln an den Triebspitzen und können in weiteren Befallsstadien ganz abfallen. Im schlimmsten Fall kann der Baum absterben. Der Pilz ist wärmeliebend und tritt häufig zeitversetzt nach Trockenheit auf. Als weitere Ursache für braune und abfallende Nadeln sind Schütte-Pilze zu sehen. Hauptverursacher der Kiefernschütte ist der Pilz Lophodermium seditiosum. Die Kiefernschütte ist eine Pilzerkrankung, die in den Jahren in unterschiedlicher Intensität auftritt. Insbesondere bei jüngeren Kiefern können dadurch hohe Nadelverluste entstehen. In diesem Jahr sind die Pilzerkrankungen vermehrt aufgetreten und haben einen wichtigen Anteil am verschlechterten Kronenzustand der Kiefer. Wie auch in den Vorjahren, ist die Kiefer in NRW die Hauptbaumart mit der geringsten Kronenverlichtung. Schwache Kronenverlichtung bei der Kiefer
23 23 Die Vitalität der Baumkronen 17 ABBILDUNG 14 Entwicklung der Kronenverlichtung bei Kiefern 1984 bis 17 Fläche in Prozent Da die umgebenden Laubbäume im zeitigen Frühjahr noch ohne Blätter sind, können die Kiefern vom ungehemmten Lichtgenuss profitieren deutliche Kronenverlichtung schwache Kronenverlichtung (Warnstufe) ohne Kronenverlichtung 1 Durch Rundungsdifferenzen können in einzelnen Jahren kleine Abweichungen in der Gesamtsumme entstehen; 2 kein Landesergebnis; 3 nur bedingt mit den übrigen Jahren vergleichbar
24 24 Die Vitalität der Baumkronen 17 ESCHE Die Esche ist eine Baumart, die in unseren Wäldern nicht so häufig vorkommt. Deshalb tritt sie statistisch in der Waldzustandserfassung nicht sonderlich in Erscheinung. Jedoch müssen besorgniserregende Veränderungen in den Baumkronen der Eschen beobachtet werden. Das Eschentriebsterben ist eine relativ neue Erkrankung. Der Erreger ist ein Pilz (Hymenoscyphus fraxineus), der bewirkt, dass Triebe und Blätter welken, schwarz werden und abfallen. Die Kronen der Eschen können dadurch nachhaltig geschädigt werden und verlichten. Beobachtungen zeigen, dass diese Erkrankung sich bei uns zunehmend ausbreitet und den Eschenbestand gravierend beeinträchtigen kann. ROSSKASTANIE Rosskastanien sind als Stadt- und Alleebäume bei uns verbreitet. Im Wald kommen sie nur in geringem Umfang vor. Seit mehreren Jahren leidet die Rosskastanie unter einem Kleinschmetterling, der Rosskastanienminiermotte (Cameraria ohridella), dessen Raupen den Bäumen stark zusetzen. Die Raupen fressen innerhalb der Blätter (minieren) und zerstören dort wichtige Zellbereiche. Sie sorgen so für braunes Laub, welches dann auch vorzeitig im Sommer abfällt. Insbesondere durch mehrjährigen, wiederholten Befall werden die Rosskastanien geschwächt. Kommen noch weitere Stressfaktoren oder Infektionen hinzu, können die Bäume absterben. In diesem Jahr waren die braunen und trockenen Baumkronen besonders auffällig. Der Befall hat momentan in NRW eine weitreichende Verbreitung. Sollte eine Eindämmung der Miniermotte nicht möglich sein, sind die Rosskastanien in ihrem Bestand stark bedroht. Durch das Eschentriebsterben ausgelöste Welke der Triebspitzen Braune Blätter durch die Rosskastanienminiermotte
25 25 Die Vitalität der Baumkronen 17 FAZIT BEI DEN HAUPTBAUMARTEN Unsere Hauptbaumarten zeigen in diesem Jahr eine zweigleisige Entwicklung. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich Buche und Fichte in ihrem Kronenzustand verbessert, Eiche und Kiefer hingegen verschlechtert. Das weitestgehende Ausbleiben der Fruchtbildung hat besonders der Buche gutgetan. Auch die Fichte konnte eine Erholungsphase verzeichnen. Alle Bewertungen des Waldzustandes spielen sich zudem vor der Kulisse von immer noch beeinträchtigten Waldböden ab. Zwar konnten diverse Untersuchungen eine langsame Besserung des Bodenzustandes verzeichnen, jedoch kann von einer Wiederherstellung der Böden noch lange nicht gesprochen werden. Im Mittel über alle Baumarten hinweg hat sich der Waldzustand in diesem Jahr wieder etwas gebessert. Der diesjährige Raupenfraß im Frühjahr war nicht stark genug, um die EICHE zur Bildung von Regenerationsbelaubung zu bewegen. Die befressenen Blätter waren im Sommer noch deutlich zu sehen. Der Eiche-Kronenzustand hat sich deshalb in einem verschlechterten Zustand gezeigt. Die Eiche weist in diesem Jahr den schlechtesten Kronenzustand unter den Hauptbaumarten auf. Der BUCHE hat nach dem starken Fruchtanhang im Vorjahr das diesjährige Ausbleiben der Mast gutgetan. Sie konnte sich etwas erholen und hat so ihren Belaubungszustand verbessert. Ähnlich der Buche, konnte sich die FICHTE nach einer stärkeren Fruktifikation im letzten Jahr nun etwas erholen. Ihr Kronenzustand zeigte sich verbessert. Zapfen sind nahezu nicht gebildet worden. Das trocken-warme Frühjahr hat die Fichten nur vereinzelt negativ beeinflusst. Durch das vermehrte Auftreten von Pilzinfektionen wies diesjährig die KIEFER in einigen Regionen vermehrt braune und abgefallene Nadeln auf. Insgesamt hat sich ihr Benadelungszustand verschlechtert. Trotzdem ist die Kiefer in NRW die Baumart mit den geringsten Verlichtungswerten. Die abgefallenen Fichtenzapfen aus dem letzten Jahr bedecken den Waldboden stellenweise in großer Zahl. Aus ihnen werden viele junge Fichten keimen.
26 26 Die Wetterverhältnisse bis zum Sommer 17 Die Wetterverhältnisse bis zum Sommer 17 LUTZ GENẞLER, LANDESAMT FÜR NATUR, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ NORDRHEIN-WESTFALEN Das Wetter ist ein ebenso wichtiger Faktor für das Wachstum von Pflanzen der Waldökosysteme, wie der Boden und auch die Lichteinstrahlung. Für die drei Faktoren Lufttemperatur, Niederschlagsmenge und Sonnenscheindauer lassen sich entsprechende Daten (wie Landesmittelwerte und die Mittelwerte der Vergleichsperiode ) aus den monatlichen Wetterberichten des DWD herauslesen (Tab. 1, S. 27) und interpretieren. Zusätzliche Daten der ökologischen Dauerbeobachtungsflächen des LANUV/NRW (hier Haard und Schwaney) und der aktiven Schadstoff-Messstationen des LANUV/NRW (EIFE, ROTH, SICK und WESE) ergänzen und erweitern die Sicht auf das Wettergeschehen. 16 fielen in den Monaten nach dem Juni nur noch von den Langzeitmitteln negativ abweichende Niederschläge in NRW, während die Temperaturen bis September 16 einschließlich ein sommerliches Bild vermittelten. Dementsprechend lag in dieser Zeit die Sonnenscheindauer recht hoch. Im Herbst 16 näherten sich weithin die aktuellen Messdaten dem Langzeitdurchschnitt an (Abb. 1 und Abb. 2, S. 27). Im Winter dann zeigte der Dezember 16 mit 25 l/m² Niederschlägen nur 28 % der sonst in NRW üblichen 88 l/m². Dafür war es doppelt so sonnig wie üblich. Im weiteren Winter erhöhten sich die Niederschläge im Januar 17 zwar auf 45 l/m², aber erst im Februar wurden mit 60 l/m² erstmalig seit Juni 16 wieder Niederschlagsmengen leicht über dem Langzeitdurchschnitt von hier 58 ml/m² erreicht. Insgesamt war somit das Winterwetter 16/17 deutlich trocken und kalt, aber recht sonnig.
27 27 Die Wetterverhältnisse bis zum Sommer 17 TABELLE 1 Vergleich der aktuellen Jahresdaten für Temperatur, Niederschlag und Sonnenscheindauer 17 mit der Vergleichsperiode Monat monatliche Durchschnittstemperatur 17 in C mittlere Temperatur der Vergleichsperiode in C monatliche Niederschlagsmenge 17 in l/m² monatliche Niederschlagsmenge der Zeitspanne in l/m² monatliche Sonnenscheindauer 17 in Stunden mittlere Sonnenscheindauer der Vergleichsperiode in Stunden Aug 17 17,4 16, Jul 17 18,2 17, Jun 17 18,1 15, Mai 17 14,8 12, Apr 17 7,6 7, Mrz 17 8,3 4, Feb 17 4,5 1, Jan 17-0,5 1, Dez 16 3,6 2, Nov 16 4,8 5, Okt 16 9,0 9, Sep 16 17,3 13, Aug 16 17,8 16, Jul 16 18,5 17, Jun 16 16,7 15, ABBILDUNG 1 ABBILDUNG 2 Vergleich Niederschlag 17 mit der Niederschlagsperiode Jahresverläufe Temperaturen Niederschlag in l/m² Temperatur in C Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug monatlicher Niederschlag 17 monatlicher Niederschlag der Zeitspanne tatsächliche Durchschnittstemperatur mittlere langfristige Temperatur
28 28 Die Wetterverhältnisse bis zum Sommer 17 Im weiteren Verlauf des Jahres 17 zeigte sich der März ungewöhnlich warm (8,3 C) und war damit der wärmste März in NRW seit dem Beginn regelmäßiger Wetteraufzeichnungen im Jahr Unabhängig davon begann im März schon wieder ein Absinken der Niederschlagswerte unter den langfristigen Durchschnittswert. Der April zeigte dann den niedrigsten Niederschlagswert des Frühjahrs 17 und ab Mitte April durch einen kalten und feuchten Tiefdruckeinfluss gegenüber dem März stark verringerte Temperaturen. In Folge des Tiefdruckeinflusses traten dann verstärkt Spätfröste auf, die z. B. in der Landwirtschaft die Blüten verschiedenster Obstbäume zerstörten. So wurde Mitte April an zwei Tagen im Sauerland noch leichter Schneefall (Kahler Asten) gemeldet. Im Mai stiegen die Temperaturen sprunghaft an. Er war zugleich aber mit nur 69 % der sonst üblichen Niederschläge trockener als der Vormonat. Im Juni wurde dann zum ersten Mal eine gut sommerliche Wärme erreicht und ebenso auch ca. 90 % (= 75 l/m²) der langjährigen Niederschläge. Im Juli 17 setzten sich die sommerlichen Temperaturen fort. Gleichzeitig steigerte sich der Niederschlag auf 130 l/m². Der August zeigte ähnliche Temperaturen und Sonnenscheindauer wie im Juni und Juli 17. Auch wies er recht hohe Niederschläge von 90 l/m² auf. Obwohl in den ersten Monaten der forstlichen Vegetationszeit (Mai August) die Temperaturen und die Sonnenscheindauer deutlich zunahmen, lagen die Niederschlagsmengen meist unter denen des langjährigen Mittels. Sieht man sich die Daten der Dauerbeobachtungsfläche Haard im südlichen Münsterland an, so findet man bei den Tensiometer-Messungen der Bodensaugspannung in allen Messtiefen (15 cm, 35 cm, 75 cm und 150 cm) von Januar bis Juni 17 Saugspannungen unter 100 hpa (Hectopascal) (Abb. 3, S. 29). Diese Werte weisen auf eine geringe Bodensaugspannung hin und zeigen damit an, dass der Waldboden gut mit Wasser gesättigt war. Die Wassersättigung des Bodens ist wichtig für die Nahrungsaufnahme (besonders für Stickstoff, Phosphor und Kalium). Zudem hält sie die Saugspannung des Kapillarsystems (Tracheen, Tracheiden) im Baum aufrecht, durch das Wasser und Nährstoffe in die Blätter und Nadeln der Bäume transportiert werden. Mitte Juni 17 stieg zuerst die Saugspannung der oberen Tensiometer, die in den Tiefen 15 cm und 35 cm stecken, an. Die gemessenen Werte zeigen eine Saugspannung von bis zu 400 hpa im Hauptwurzelbereich an, während die Saugspannung in den beiden unteren Untersuchungstiefen nur knapp über die 100 hpa-linie kommt. Im Jahr 16 lagen die beiden obersten Tensiometer bei 650 bis 750 hpa, die beiden unteren immer noch bei 350 und 0 hpa. So waren die Werte von 17 in allen Tiefen deutlich niedriger. Die kleineren Ausschläge 17 mit höheren hpa-werten oben in der Hauptwurzelzone beeinflussen zumeist nur flachgründige und stark sandige Böden negativ, die sonstigen Böden tragen keine Trocknisschäden davon. Die Wettermessstationen Haard und Schwaney des LANUV/NRW werden seit 03 auch für die Prognose von Ozonschäden genutzt. Hier werden u. a. täglich Temperaturhöchstwerte gemessen, die dann mit den Ozonmesswerten von den 4 in NRW verteilten aktiven Schadstoffmessstationen des LANUV/NRW (EIFE, ROTH, SICK und WESE) verglichen werden. Ozon kann in länger anhaltenden Hitzeperioden gebildet werden. Besonders Temperaturen über 30 C bilden die Grundvoraussetzung für eine Ozonbildung, die den Schwellenwert 8h-MPOC (= 8-Hour-Measure of Processes of Care) von 184 µg/m³ für Schäden an Pflanzen im Wald überschreitet. Es wurden im Jahr 17 nur 5 Tage mit einer Höchsttemperatur über 30 C in der Haard und Schwaney registriert. Entsprechend wurde bei den 4 Ozonmessstationen nur an einer Station (EIFE) der Schwellenwert nur einmal knapp mit 188 µg/m³ (.6.17) überschritten. Ansonsten lagen alle anderen Werte weit darunter zwischen 50 und 150 µg/m³ (Abb. 4, S. 29). Dennoch wurden stark sonnenbeschienene Vorwarnflächen am Bestandesrand (LESS) im August begutachtet, wobei keine Schadsymptome gefunden wurden. Deswegen wurden weitere Untersuchungen unnötig.
29 29 Die Wetterverhältnisse bis zum Sommer 17 ABBILDUNG 3 Jahresverlauf der Bodensaugspannung in verschiedenen Bodentiefen der Dauerbeobachtungsfläche Haard Bodensaugspannung in hpa cm 35 cm 75 cm 150 cm ABBILDUNG 4 Überschreitungen der Temperatur- und Ozonschwellenwerte Lufttemperatur in C Ozonkonzentration µg/m Temperatur-Schwellenwert 30 C Ozon-Schwellenwert 8h-MPOC 184µg/m Tagesmaximaltemperatur, 2 Waldmessstationen EIFE ROTH SICK WESE
30 30 Die Wetterverhältnisse bis zum Sommer 17 ZUSAMMENFASSUNG Das Winterwetter 16/17 in NRW war trocken und kalt, aber sonnig. Im März 17 blieben die Niederschlagsmengen in NRW zwar unter den langfristigen Mittelwerten ( ), aber die Lufttemperaturen stiegen stark an. Der Monat März 17 wurde als wärmster März, der in NRW je gemessen wurde, eingestuft. Die erhöhten Temperaturen riefen eine frühzeitige Blüte vieler Obstbäume hervor. Der abrupte Temperaturfall im Folgemonat ließ dann häufig die offenen Blüten durch Spätfröste gefrieren. Im Mai 17 stiegen die Temperaturwerte wieder schnell an, sodass in Folge auch die Temperaturen im Juni, Juli und August sommerliche Ausmaße annahmen. Die Niederschläge blieben eine Zeitlang auch im Sommer noch unter den Langzeitmessdaten, bis diese dann im Juli 17 mit 130 l/m² weit überschritten wurden. Durch die sommerlichen Temperaturen wurde die Ozonbildung verstärkt. Die gemessenen Werte lagen jedoch zumeist unter 150 µg/m³, sodass der Grenzwert von 184 µg/m³ nur einmal knapp überschritten wurde. Ozonschäden wurden an den Vorwarnflächen draußen vor Ort nicht gefunden, sodass man davon ausgehen kann, dass 17 keine Ozonschäden vorgekommen sind.
31 31 Schädlings- und Pilzbefall an den Waldbäumen Schädlings- und Pilzbefall an den Waldbäumen DR. MATHIAS NIESAR UND NORBERT GEISTHOFF, LANDESBETRIEB WALD UND HOLZ NORDRHEIN-WESTFALEN MEHR BEFALL DURCH EICHENPROZESSIONSSPINNER (EPS) Eichenprozessionsspinner halten ihre Hochzeit stets im August ab. In 16 lief es sehr gut für die Schmetterlinge, die Trockenheit und geringe Niederschläge lieben. In Nordrhein-Westfalen betrug die Mitteltemperatur im August 16 17,8 C (langjähriges Mittel 16,6 C), die Niederschlagsmenge gut 45 l/m² (73 l/m²) und die Sonnenscheindauer fast 215 Stunden (183 Stunden) 1. Wie das im Raum Mönchengladbach durchgeführte EPS-Monitoring zeigt, korreliert die hohe Flugaktivität der Falter mit Zeiten der Trockenheit (Abb. 1 und Abb. 2, S. 32). Aus Sicht der Schmetterlinge war dies eine glänzende Ausgangslage für eine Dichtezunahme in 17, die auch nicht durch die Frühjahreswitterung 17 unterbunden wurde. Aus vielen Teilen des Landes, vor allem aus dem Westen und dem Münsterland, wurden erhebliche Dichteanstiege der EPS-Populationen gemeldet. Betroffen waren und sind, wie in den letzten Jahren, vor allem Eichen im privaten und öffentlichen Grün, wobei sich in Wäldern der Befall auf Waldränder beschränkte. Dies ist nachvollziehbar, weil die Schmetterlinge in den lauen Augustnächten von Lichtquellen im privaten und öffentlichen Grün angelockt werden und vor allem dort die Eiablage in den Oberkronen von Eichen stattfindet. 1 DWD (16): Pressemitteilung: Deutschlandwetter im August 16; Ein viel zu trockener August mit einer Hitzewelle am Monatsende; pressemitteilungen/de/16/160830_deutschlandwetter_august.pdf? blob=publicationfile&v=2
32 32 Schädlings- und Pilzbefall an den Waldbäumen Fangzahlen männlicher EPS-Falter im Raum Mönchengladbach 14 bis 17 ABBILDUNG 1 Stückzahl eps-images eps-images eps-images eps-images ABBILDUNG 2 Niederschlagssummen im Raum Mönchengladbach 16 Niederschlag [mm] Summe = 56,
33 33 Schädlings- und Pilzbefall an den Waldbäumen ALLERGENE WIRKUNG VON EPS-RAUPENHAAREN Von den unscheinbaren Schmetterlingen geht keine Gefahr aus. Ganz anders bei den Raupen, die prozessionsartig in Gruppen krabbelnd, bei Gefahr winzig kleine Brennhaare abschießen können. Eine ausgewachsene Raupe verfügt über mehr als dieser Pfeile. Bei Berührung reagiert die Haut des Menschen zunächst mit roten, juckenden Pusteln. Die Spitzen der Brennhaare bohren sich in die Haut und brechen danach ab, z. B. beim Kratzen an den Pusteln oder beim Waschen. Durch die Bruchstelle wird das Nesselgift Thaumetopoein freigesetzt, was anschließend zu heftigen allergischen Reaktionen führt. Beim Einatmen der feinen Härchen können zudem Atembeschwerden wie Bronchitis und Asthma auftreten. VORKOMMEN VON EICHENPROZESSIONS- SPINNERN IN NORDRHEIN-WESTFALEN Die Karte (Abb. 3) zeigt das EPS- Vorkommen in Kreisen und kreisfreien Städten der letzten Erhebung in 14. Die Befallsstärke (Dichte) schwankt von Jahr zu Jahr und ist hier nicht vermerkt. ABBILDUNG 3 EPS-Verbreitungskarte NRW Schmetterling und Raupen Altraupen in einem Nest an einem Eichenstamm BIONOMIE DES EICHENPROZESSIONSSPINNERS Abbildung 4 zeigt den Jahresverlauf des EPS von der Eiablage über die Raupenstadien und die Puppe bis hin zum fertigen Schmetterling. Bionomie des Eichenprozessionsspinners und evtl. Gegenmaßnahmen ggf. Applikation von Bioziden ABBILDUNG 4 Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Eier Raupen 1 cm Puppen 1 cm Entfernen der Raupen/Puppen und der Raupenhaare durch Absaugen Fertiger Schmetterling 25 mm
34 34 Schädlings- und Pilzbefall an den Waldbäumen ANTWORTEN AUF HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZUM EPS 1. Welche Baumarten werden befallen und welche natürlichen Gegenspieler gibt es? In allererster Linie werden Eichen (Gattung Quercus) befallen. Von den Vögeln ist v. a. der Kuckuck in der Lage, die Raupen in für ihn unschädlicher Weise aufzunehmen. Der Vollständigkeit halber sei hier auch der Wiedehopf angeführt, der bei uns aber leider nur in sehr geringen Dichten vorkommt. Aus dem Reich der Insekten sind insbesondere räuberische Käfer wie der Große Puppenräuber (Calosoma sycophanta), aber auch die Raupenparasiten Raupenfliegen (Tachinidae), Schlupfwespen (Ichneumonidae) und Brackwespen (Braconidae) zu nennen. Aus ökologischer Sicht könnten diese Gegenspieler ggf. in der Lage sein, eine Massenvermehrung zu beeinflussen. Sie sind aber zum Schutz der Menschen vor den Raupenhärchen nicht geeignet, da sie sich erst nach dem Dichteanstieg des EPS vermehren können und dann die Gefahr bereits besteht. 2. Sind die Raupen und die von ihnen ausgehende Gefährdung eine für den Wald typische Gefahr? (wie z. B. der Riesenbärenklau)? Ja! 3. Müssen die Waldbesitzenden zur Gefahrenabwehr selbst tätig werden? In der Regel nein, es sei denn, es bestehen besondere vertragliche Vereinbarungen z. B. zwischen einem Kindergarten und Waldbesitzenden. 4. Kann in einem von EPS befallenen Wald der Betrieb eines Waldkindergartens weiter aufrecht erhalten bleiben? Welcher Abstand zu den Befallsherden sollte eingehalten werden? Das muss mit dem Kindergartenbetreiber abgestimmt werden. Die Kinder dürfen die Nester auf keinen Fall berühren und auch nicht im befallenen Wald spielen oder sich dort bewegen. Ein konkreter Abstand ist justiziabel nur schwer zu nennen, da die Härchen sehr weit verdriftet werden können. 5. Muss die Ordnungsbehörde zur Gefahrenabwehr im privaten Wald tätig werden und welche Ordnungsbehörde ist zuständig? a) Für unmittelbare Gegenmaßnahmen im Sinne der Gefahrenabwehr (Koordination des Biozideinsatzes und des Absammelns der Nester durch Spezialfirmen): Tatsächlich liegt es im Ermessen der Ordnungsämter der Kommunen 1, ob diese tätig werden, denn für die EPS-Gefahrenabwehr innerhalb und außerhalb des Waldes sind nicht die Forstämter, sondern die Ordnungsämter der Kommunen zuständig. Gegebenenfalls kann die Zuständigkeit auch bei den Kreisverwaltungen (Gesundheitsämter) liegen. Das ist im Einzelfall zu prüfen. Die Forstämter bzw. der Landesbetrieb Wald und Holz NRW sind grundsätzlich nur dann zuständig, wenn es sich um eine ökologische Fragestellung handelt (wird Eichensterben induziert?). b) Information von Waldbesuchenden durch Wald und Holz NRW: Da die Härchen erhebliche Irritationen der Haut und/oder der Atemwege oder Allergien bei Menschen und Tieren auslösen können, informiert der Landesbetrieb Wald und Holz NRW (immer in Verbindung mit den Ordnungsämtern) die Bevölkerung in einzelnen Gebieten über die Befallssituation, auch wenn es sich um eine waldtypische Gefahr handelt. 6. Welche Gegenmaßnahmen sind einzuleiten und wer bezahlt diese? a) Absaugen und Kartierung der Befallsstellen im Juli 17 Kommen die kommunalen Ordnungsämter zum Schluss, dass von den befallenen Eichen eine Gefahr für Menschen und Tiere ausgeht, ist aktuell ein Absaugen der Nester durch Spezialfirmen das Mittel der Wahl. Abflämmen kommt wegen der Thermik und des Verwirbelns der Härchen in der Regel nicht infrage. Die Befallsstellen sind in einer Karte zu dokumentieren. b) Biozideinsatz im Frühjahr 18 Beim Absaugen der Nester werden erfahrungsgemäß nicht alle gefunden. Insofern sind im Frühjahr 18 Biozideinsätze in besonderen Bereichen ins Auge zu fassen. Die Einsatzbereiche sollten ggf. durch Eigelegesuchen in den Eichenoberkronen verifiziert werden. c) Kostenträger Die kommunalen Ordnungsämter tragen die Kosten. 7. Ab welchem Zeitpunkt ist die Gefahr vorbei? Wenn die Härchen nach ca. zwei Jahren ihre allergene Wirkung verloren haben. Wenn erneuter Befall auftritt, verlängert sich der Zeitraum entsprechend. 1: MUNLV (04): Erlass: Gefährdung durch den Eichenprozessionsspinner ; AZ III vom ;
35 35 Schädlings- und Pilzbefall an den Waldbäumen AUCH BEI DOUGLASIEN KÖNNEN PROBLEME AUFTRETEN Douglasien bilden ein vergleichsweise intensives Wurzelsystem aus und können dadurch Stürmen besser trotzen als Fichten. Sie kommen mit Sommertrockenheit gut zurecht und weisen auch bei geringen Niederschlägen im Vergleich zur Fichte enorme Holzzuwächse und somit eine hohe CO 2 -Bindung auf. Im geasteten Zustand liefern sie wertvolles Schneide- und Furnierholz und bei normaler Qualität eine der Fichte nicht nachstehende Bau- und Konstruktionsholzqualität. Die Douglasie ist eine klimaplastische Baumart und wird vor allem auf trockenen Standorten der Fichte gegenüber bevorzugt. Werden bei Aufforstungen oder Voranbauten Douglasiensetzlinge aus Samen bestimmter Küstenherkünfte aus Nordamerika oder aus zugelassenen Saatgutbeständen in Nordrhein-Westfalen gewählt, sind diese Nadelbäume auch gegenüber einem gefürchteten Pilz, der die Nadeln befällt und ganze Nadeljahrgänge vernichtet (Rostige Douglasienschütte), immun. In 17 traten vereinzelt bis verbreitet bei Douglasien, mit denen vom Okran Kyrill betroffene Flächen aufgeforstet oder die in Altbeständen vorangebaut wurden, vor allem im Sauerland folgende Krankheitssymptome auf: Teils verfärbten sich einzelne Äste oder ganze Kronen rotbraun oder die Kronen waren auffallend schütter benadelt. Bei durchsichtigen Kronen konnte ein Befall mit der weniger gefährlichen Rußigen Douglasienschütte festgestellt werden. Als Maßnahmen wurden Läuterungshiebe oder Durchforstungen empfohlen, um die Luftzirkulation in den Beständen zu verbessern, die Lebensbedingungen für den Nadelpilz zu verschlechtern und bei mehrschichtigen Beständen Überbestockungen aufzuheben. Vereinzelt war auch in Bereichen, in denen die Douglasie zusammen mit der Sitkafichte in Beständen vorkam, ein Befall mit der Douglasienwolllaus zu finden. Neben den leicht gekrümmten Nadeln war der Befall an winzig kleinen, an den Nadeln haftenden Wollknäueln zu erkennen. Als Maßnahme wäre ein Vermeiden dieser Nadelbaummischung möglich, da der Laus für ihre Entwicklung der Wirtswechsel zwischen diesen beiden Baumarten entgegenkommt. Er ist aber nicht zwingend notwendig. Bei Rotfärbungen von Kronen konnte ein Befall mit Borkenkäfern (Kupferstecher, Pityogenes chalcographus) und Furchenflügeligem Fichtenborkenkäfer (Pityophthorus pityographus) sowie teilweise mit dem in der Rinde vorkommenden Phomopsis-Pilz (Rindenschildkrankheit) festgestellt werden. Als Maßnahme wurde bei Kupferstecherbefall das Entfernen und Verbrennen der befallenen Bäume empfohlen. Als vorschädigende, disponierende Faktoren für den Borkenkäferbefall sind Niederschlagsdefizite im Frühjahr 17 wahrscheinlich. Fazit: Auch bei Douglasien können pilzliche und tierische Schadorganismen Schäden verursachen. In den vorliegenden Fällen blieb das Ausmaß in hinnehmbaren Größenordnungen. Winzig kleine Pilzfruchtkörper der Rußigen Douglasienschütte Fraßbild des Kupferstechers an Douglasie Abgängiger Douglasienvoranbau
36 36 Schädlings- und Pilzbefall an den Waldbäumen WEIẞTANNE: LÄUSE, PILZE UND RÜSSELKÄFER Im späten Frühling traten im Bergischen und im angrenzenden Sauerland an Nordmanntannen in Weihnachtsbaumkulturen verbreitet Nadelschäden durch den Tannennadelsäulenrost (Pucciniastrum epilobii) auf. Die infizierten Nadeln fielen im Laufe des Sommers ab. Starker Befall führt zu erheblichen Zuwachsverlusten. Der Pilz benötigt zur Entwicklung als Zwischenwirt das Schmalblättrige Weidenröschen (Epilobium angustifolium). In Weihnachtsbaumkulturen können Pflanzenstärkungsmittel oder ggf. Pflanzenschutzmittel zur Eindämmung der Erkrankung eingesetzt werden. Da Weidenröschen ein typisches Element von Schlagfloren darstellen, tritt diese Beeinträchtigung in vertikal gestuften, ggf. plenterartig aufgebauten Wäldern mit alten und mittelalten Bäumen und Bäumchen in der Verjüngung kaum auf. Tannennadelsäulenrost Im Raum Berleburg starben in einem Tannenbaumholz vereinzelt Tannen (Abies alba) ab, die einen starken Befall mit Stammläusen (Dreyfusia spp.) aufwiesen. Es ist aber bekannt, dass alleiniger Lausbefall Tannen nicht umbringen kann. Denn befallene Tannen wehren sich gegen die saftsaugenden Tiere, indem sie eine vor Lausbefall schützende Borke ausbilden (induzierte Resistenz). Treten jedoch noch Sekundärschädlinge dem Schadgeschehen bei, führt dies häufig zum Absterben der Bäume. Puppenwiegen des Weißtannenrüsslers Im vorliegenden Fall wurde neben Hallimasch am Stammfuß auch noch am Stamm der als Sekundärschädling gefürchtete Weißtannenrüssler (Pissodes piceae), der 40- bis 80-jährige vorgeschädigte Tannen befällt, gefunden. Der Schaden durch die Imagines ist zwar vernachlässigbar, aber bereits wenige Gangsysteme der Larven genügen, um betroffene Tannen letal zu treffen. Gefährlich sind die Käfer auch wegen ihrer Langlebigkeit (bis dreimaliges Überwintern) und wegen der hohen Reproduktionsfähigkeit. Die Weibchen legen bis zu 0 Eier pro Jahr ab. Es ist nicht auszuschließen, dass im vorliegenden Fall auch Wasserstress eine vorschädigende Wirkung hatte. Als Maßnahme wurden der Einschlag und das Entfernen der betroffenen Bäume aus den Beständen empfohlen. Befall der Rinde mit Tannenstammläusen
37 37 Schädlings- und Pilzbefall an den Waldbäumen SCHÄDEN AN KIEFERN DURCH WURZELSCHWAMM Auf sandigen Böden im Bereich Niederkrüchten verlichten auf ca. 30 ha zunehmend Kiefernbaumhölzer. Die Bestände beginnen sich aufzulösen. Die vorzufindenden Symptome gänzlich verlichteter Kronen und deutlicher Harzfluss vor allem an den unteren Stammabschnitten deuten auf bodenbürtige Ursachen hin. Bei ersten Untersuchungen wurde erheblicher Harzfluss unter der Rinde am Stammanlauf und bei abgestorbenen Starkwurzeln gefunden, wobei diese unter der Wurzelrinde teils sehr feines weißes Mycel aufwiesen, das säuerlich bis terpentinartig roch. Rhizomorphe des Hallimasch fehlten. Insofern deuten diese Untersuchungen, die noch andauern, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit darauf hin, dass es sich um einen massiven Befall mit dem Wurzelschwamm (Heterobasidion annosum) handelt. Vereinzelt wurden Kiefernprachtkäferausbohrlöcher gefunden. Verlichtete Kiefer in Niederkrüchten Kiefernrinde mit Kiefernprachtkäferausbohrloch
38 38 Schädlings- und Pilzbefall an den Waldbäumen VERSTÄRKTER BUCHDRUCKERFLUG IM MAI Vor allem Buchdrucker nutzten im Frühsommer die warmen Temperaturen für höhere Vermehrungsraten aus. Das Borkenkäfermonitoring zeigte im Mai gegenüber dem Vorjahr erhöhte Fangwerte, die allerdings nur regional zu erhöhten Käferholzmengen führten. Im Herbst 16 konnte zunächst vor allem der Kupferstecher begünstigt durch hohe Temperaturen und geringe Niederschläge Äste stehender Fichten befallen. So erschienen im folgenden Frühjahr in den Fichtenbeständen befallene Kronen zunächst aufgelichtet. Aufgrund der guten Flugbedingungen im Mai und Juni kam es anschließend zum vermehrten Befall durch den Buchdrucker. Wie die Abbildung 5 zeigt, sind am Borkenkäfermonitoringstandort Medelon die Borkenkäfer aufgrund des kalten Aprilwetters erst im Mai in erhöhter Anzahl ausgeflogen. Mit dem Einsetzen der hohen Niederschläge und schwülwarmen Witterung Ende Juli verschlechterten sich die Flug- und Brutbedingungen und führten zum Zusammenbruch der Buchdruckerpopulation. Neben der schnellen Aufarbeitung in den Regionalforstämtern half somit das diesjährige schmuddelige Sommerwetter, die Käferholzmengen in Grenzen zu halten. Die Generationsentwicklung des Buchdruckers verlief in Nordrhein-Westfalen sehr unterschiedlich. Während in den wärmeren Regionen drei Generationen vollständig ausgebildet wurden, traten in den Höhenlagen des Sauerlandes nur zwei Generationen auf. ABBILDUNG 5 Borkenkäferwochenfangwerte am Standort Medelon 17 Anzahl Buchdrucker Anzahl Kupferstecher Grenzwerte, oberhalb derer hohe Stehendbefallswahrscheinlichkeiten bestehen; eingefärbte Balken = Warnstufen grün (keine Gefahr) bis rot (hohe Gefahr) Kupferstecher 700 m Buchdrucker 700 m Kupferstecher 800 m Buchdrucker 800 m Borkenkäferbefall am Bestandesrand
39 39 Schädlings- und Pilzbefall an den Waldbäumen DIE ROSSKASTANIENMINIERMOTTE VERMEHRT SICH STARK In diesem Jahr trat eine starke Vermehrung der Rosskastanienminiermotte (Cameraria ohridella) auf, wodurch manche weißblühende Kastanien bereits im Juli komplett in ihrer Krone verbräunten und anschließend im August mit Blattverlust reagierten. Die Raupen dieser seit Jahren in Nordrhein-Westfalen vorkommenden Balkanmotte schädigen aufgrund ihrer Miniertätigkeit die Blätter der weißblühenden Rosskastanie. Der hierdurch entstehende frühzeitige Verlust der Assimilationsfläche führt zu einer hinnehmbaren Vitalitätsschwächung der Bäume. Der Hauptgrund des Massenbefalls ist auf die warmen und niederschlagsarmen Monate Mai und Juni zurückzuführen. Eine vergleichbar frühe Verbräunung und Entlaubung der Rosskastanien war zuletzt im Jahr 03 aufgetreten. Trotz der starken Schwächung konnten diese Bäume im Folgejahr austreiben und sich in der Krone regenerieren. Da auch in diesem Jahr die meisten Rosskastanien vitale Knospen ausbilden konnten, ist im nächsten Jahr zunächst von einem normalen Austrieb auszugehen; die Kastanien können allerdings anfälliger gegenüber pilzlichen Erregern wie Hallimasch und Phytophthora werden. Aufgrund des Miniermottenbefalls ist es im September an Rosskastanien zu einem weiteren auffälligen Phänomen gekommen: Einzelne Bäume haben wieder ausgetrieben und haben eine zweite Blüte ausgebildet. Diese sogenannte Notblüte ist die direkte Reaktion auf den verfrühten Verlust der Assimilationsfläche und mit einem Notfallprogramm der Pflanze vergleichbar, indem sie ihre Energie in die Bildung von Nachkommen setzen will. Es können ggf. geringe Schäden durch Frühfröste auftreten. Rosskastanienminiermottenbefall
40 40 Schädlings- und Pilzbefall an den Waldbäumen FORSTSCHÄDLICHE MÄUSE UND HANTAVIREN Im Winter 15/16 traten verhältnismäßig wenig Mäuseschäden auf, was auf die geringen Mäusedichten zurückzuführen war. Die jeweils im Spätherbst durchgeführten Kontrollfänge ergaben gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang der schädlichen rindenfressenden Mausarten. Besonders deutlich fiel dies bei den Erdund Feldmäusen auf. Mit einem Abfall des Indexwertes von 11 auf 3 je 100 Fallennächte kann hier von einem Zusammenbruch der Population gesprochen werden. Wie die Abbildung 6 zeigt, ist der Rötelmausindex vom Herbst 15 innerhalb eines Jahres von 10 auf 7 gefallen die Dichteentwicklung der Rötelmäuse hatte sich zunächst gegenüber den Erd- und Feldmäusen somit deutlich weniger verringert. Die Hauptnahrungsquelle der Rötelmaus sind Bucheckern, die aufgrund der letztjährigen Vollmast ausreichend zur Verfügung standen. Beobachtungen in den Wäldern ergaben, dass diese gute Nahrungssituation bei der Rötelmaus im Laufe des Jahres zu einer deutlichen Dichteerhöhung geführt hat. Diese hohen Dichten bergen allerdings auch eine Gefahr für den Menschen, da in großen Teilen Nordrhein-Westfalens die Rötelmaus Träger eines Hantavirus ist, der beim Menschen gefährliche Erkrankungen verursachen kann. Aufgrund der hohen Rötelmausdichten und des trocken-warmen Frühjahres kam es zu einer deutlichen Erhöhung der humanen Infektionsfälle. So stieg in Nordrhein-Westfalen die Zahl der gemeldeten Hantavirusinfektionen von 96 (16) auf 172 (Januar bis 17. September 17). Infizierte Rötelmäuse scheiden das Puumalavirus über Kot und Urin aus und sorgen hierüber für weitere Infektionen ihrer Artgenossen. Menschen können sich infizieren, wenn sie den erregerhaltigen Staub einatmen. Dies geschieht beispielsweise beim Reinigen und Aufräumen von Dachböden, Garagen und Schuppen oder bei Arbeiten am Brennholzstapel. Um sich zu schützen, sollte der Staub angefeuchtet oder Staubmasken getragen werden. Die Erkrankungen verlaufen zumeist harmlos und ähneln einer Grippe. In schweren Fällen kann es allerdings zum Nierenversagen kommen. Das plötzliche Auftreten von Fieber, Rücken- und Bauchschmerzen ist ein Hinweis auf eine mögliche Hantavirusinfektion. Von Mensch zu Mensch ist das Virus nicht übertragbar. ABBILDUNG 6 Entwicklung der Mäusedichte Gefangene Mäuse in 100 Fallennächten Kritischer Wert Erd- und Feldmäuse Rötelmaus
41 41 Schädlings- und Pilzbefall an den Waldbäumen ZUSAMMENFASSUNG Die Dichten von EICHENPROZESSIONSSPINNERN haben sich in 17, aufgrund der günstigen Klimabedingungen während des Hochzeitsfluges der Schmetterlinge in 16, erhöht. In erste Linie sind Eichen auf Flächen des öffentlichen und privaten Grüns und Waldränder am Niederrhein und im Münsterland betroffen. Eichensterben wurde nicht induziert. Bei DOUGLASIEN traten Schäden vor allem im Sauerland durch Kupferstecher sowie Nadelund Stammpilze auf. Sie führten zu sichtbaren Kronenrotverfärbungen. WEISSTANNEN litten im Sieger- und Sauerland unter Laus-, Pilz- und Rüsselkäferbefall mit teilweise letalem Ausgang. Schwerwiegende Probleme hat die KIEFER im Niederrheinischen Tiefland mit dem Wurzelschwamm, wodurch sich ganze Bestände auflösen. Die entsprechenden Untersuchungen dauern an. Im Jahr 17 ist regional durch BUCHDRUCKERBEFALL der Käferholzanfall in Fichtenbeständen gestiegen. Nachdem die im Frühsommer befallenen Käferbäume im Sommer aufgearbeitet wurden, hatte sich die Situation allerdings beruhigt. Ein weiteres Insekt, die ROSSKASTANIENMINIERMOTTE, führte an weißblühenden Kastanien zu auffälligen frühzeitigen Blattverbräunungen und -verlusten. Die FORSTSCHÄDLICHEN MÄUSE fanden sich im Winter auf einem relativ geringen Niveau. Aufgrund der vielen, im letzten Herbst abgefallenen Bucheckern stieg anschließend die Rötelmauspopulation im Verlauf des Jahres an. In der Folge nahmen die Infektionen durch den von der Maus auf den Menschen übertragbaren Hantavirus zu.
42 42 Phänologische Beobachtungen an Waldbäumen im Frühjahr 17 Phänologische Beobachtungen an Waldbäumen im Frühjahr 17 CHRISTOPH ZIEGLER, LANDESAMT FÜR NATUR, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ NORDRHEIN-WESTFALEN Der März 17 war in Deutschland der wärmste seit Beginn der flächendeckenden Wetteraufzeichnungen im Jahre Auf ihn folgte der kälteste April seit 16 Jahren, bevor dann in der zweiten Maihälfte die Tagesmaxima auf hochsommerliche Temperaturen anstiegen. Für die Obstbauern hatte diese Wetterentwicklung zum Teil katastrophale Folgen, da durch die hohen Temperaturen im März die Obstblüte sehr früh einsetzte und dann im April erfror. Anhand der phänologischen Aufnahmen, die in NRW auf 16 Dauerbeobachtungsflächen im Wald durchgeführt werden, lässt sich die Reaktion der Bäume auf diesen ungewöhnlichen Wetterverlauf nachzeichnen. An vier Waldmessstationen, die mit sieben Dauerbeobachtungsflächen unmittelbar verknüpft sind, untersucht das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW die Umwelteinflüsse auf den Wald. Die dort erhobenen Wetterdaten können mit dem Austriebsverhalten der Bäume in Bezug gesetzt werden, da dort parallel auch phänologische Aufnahmen zum Untersuchungsprogramm gehören. Die Waldmessstationen befinden sich am Niederrhein im Raum Kleve, im südlichen Münsterland (Haard), im Weserbergland (Schwaney) und im Sauerland bei Hilchenbach (Elberndorf). Die weiteren Dauerbeobachtungsflächen sind relativ gleichmäßig über das Land verteilt (Abb. 1, S. 43). Auf den Dauerbeobachtungsflächen werden die Hauptbaumarten Fichte, Kiefer, Buche, Stiel- und Traubeneiche untersucht. In Schwaney gehören auch Esche und Bergahorn zum Aufnahmekollektiv. Durch das Vorkommen beider Eichenarten auf einigen Flächen können bei Auswertungen 25 Teilkollektive mit insgesamt 636 Einzelbäumen unterschieden werden. Für Zeitreihenuntersuchungen wird für jedes Kollektiv in jedem Jahr ein Austriebstermin berechnet, an dem der Blattaustrieb den Mittelwert von 50 Prozent erreicht hat. Früh austreibende Stieleiche in Viersen
43 43 Phänologische Beobachtungen an Waldbäumen im Frühjahr 17 ABBILDUNG 1 Lage der Waldmessstationen und Dauerbeobachtungsflächen Borken Münster Velmerstot Kleve 183 Kleve Tannenbusch Haard Warendorf Schwaney Duisburg Arnsberg Viersen Fichte Elberndorf Glindfeld Buche Elberndorf Monschau Kiefer Buche Eiche Fichte Waldmessstation mit Streufalltrichtern und Niederschlagssammlern
44 44 Phänologische Beobachtungen an Waldbäumen im Frühjahr 17 Der Austrieb der Blätter und das Blühen der Bäume werden im Frühjahr im Wesentlichen von den Temperaturen gesteuert. Mit zunehmender Tageslänge steigen die Temperaturen mit Schwankungen im Frühjahr normalerweise kontinuierlich an. Im Frühjahr 17 war dies nicht der Fall. So lagen die Monatsmittelwerte im April sowohl bei den Tagesminima als auch bei den Tagesmittelwerten unter denen des März. Lediglich bei den Tagesmaxima war ein leichter Anstieg von 0,7 C zu verzeichnen. Erst im Mai erfolgte dann ein deutlicher Temperaturanstieg von 7,0 C, der auf den meisten Flächen den Impuls zum endgültigen Austrieb brachte (Tab. 1 und Abb. 2, S. 45). Monatsmitteltemperaturen an den vier Waldmessstationen Frühjahr 17 TABELLE 1 Angaben in C Monat Minimum Mittel Maximum März 1,9 6,9 11,8 April 0,6 6,6 12,5 Mai 7,3 13,6 19,7 Im Vergleich mit dem Jahr 12 mit einem durchschnittlichen Austrieb und dem Jahr 14 mit einem sehr frühen Austrieb, zeigt sich die größte Dynamik bei der Blattentwicklung im Jahr 17 erst ab dem 10. Mai. Während im Jahr 12 der mittlere Austrieb über alle Baumarten den Wert von 50 Prozent am 1. Mai und 14 bereits am. April erreicht hatte, stellte sich 17 ein entsprechender Wert erst am 10. Mai ein (Abb. 3, S. 45). Auf das Wärmeangebot im Frühjahr reagieren die Bäume beim Blattaustrieb in Abhängigkeit von Standort, Art und Genetik sehr unterschiedlich. Besonders deutlich wird dies auf der Fläche in Viersen, auf der zwei Provenienzen der Stieleiche und eine kleine Gruppe von Traubeneichen vertreten sind. Bei der früh austreibenden Stieleiche war aufgrund des warmen März der 50-Prozent-Austriebstermin bereits am 31. März erreicht, während die slawonische Späteiche eine spätaustreibende Stieleiche aus Kroatien erst 41 Tage später am 11. Mai ausgetrieben hatte. Der mittlere Austrieb der Traubeneiche war auf gleicher Fläche am 25. April. Ähnliches war auf der Fläche bei Stadtlohn zu beobachten, auf der die Traubeneiche 22 Tage früher als die Stieleiche ausgetrieben hat. In Münster lag der Austriebstermin bei der Stieleiche 13 Tage früher als bei der Traubeneiche, Blattentfaltung bei der Eiche Wintereinbruch nach Austrieb des Bergahorns
45 45 Phänologische Beobachtungen an Waldbäumen im Frühjahr 17 ABBILDUNG 2 Verlauf der mittleren Tagesmitteltemperatur* an den Waldmessstationen und Austriebsverlauf aller Baumarten auf den Dauerbeobachtungsflächen Frühjahr 17 Temperatur in C 25 Mittlerer Austrieb in Prozent Tag (erste Stelle = Monat, zweite und dritte Stelle = Tag) * An den vier Waldmessstationen wird täglich eine mittlere Tagestemperatur errechnet. In der Grafik wurde das Mittel dieser Temperatur aus den Messungen an den vier Stationen verwendet. Austriebsverlauf auf den Dauerbeobachtungsflächen 12, 14 und 17 Mittlerer Austrieb in Prozent ABBILDUNG Tag (erste Stelle = Monat, zweite und dritte Stelle = Tag) Austrieb 12 Austrieb 14 Austrieb 17
46 46 Phänologische Beobachtungen an Waldbäumen im Frühjahr 17 wobei die Stieleiche gegenüber dem Vorjahr früher und die Traubeneiche später ausgetrieben hat. Insgesamt zog sich der Austrieb bei der Eiche über einen Zeitraum vom 31. März bis zum 15. Mai hin (Abb. 4, S. 47). Bei der Buche reagierte lediglich die generell früh austreibende Fläche in Duisburg auf den warmen März. Bereits in den ersten Apriltagen waren hier an einigen Bäumen die ersten Knospen geöffnet. Der weitere Austrieb vollzog sich dann aber im kalten April sehr schleppend, sodass der Austriebstermin am 21. April später als in den Vorjahren lag. Mit zunehmender Wärme im Mai war auf den anderen Buchenflächen fast unabhängig von der Höhenlage der mittlere Austrieb innerhalb eines Zeitraumes von nur sechs Tagen zwischen dem 8. und 14. Mai erreicht. Auf der Fläche in Hilchenbach vollzog sich der Austrieb dabei in rasanter Weise innerhalb einer Woche, während sich der Blattaustrieb in der Haard sehr zögerlich vom 19. April bis zum 16. Mai hinzog. In der Haard sowie in Medebach, Schwaney und Kleve war 17 das Jahr mit dem spätesten Austrieb der Buche seit Beginn der Aufnahmen im Jahr 01. Der Austriebstermin der Kiefer in Kleve schwankt im Untersuchungszeitraum zwischen dem 23. April und 26. Mai und liegt im Mittel am 9. Mai. Sie reagiert in der Regel auf die Temperaturverhältnisse ab der zweiten Aprilhälfte, nicht aber auf hohe Temperaturen im März. Im Jahr 17 lag der Austriebstermin am 12. Mai, also etwas später als im Mittel, jedoch früher als im Vorjahr. Die Fichte treibt von den untersuchten Baumarten in allen Jahren am spätesten aus, wobei der Bestand im Weserbergland (Velmerstot) etwas früher austreibt als der höher gelegene Bestand in Hilchenbach (Elberndorf). Der Austriebstermin am Velmerstot liegt in der Zeitreihe zwischen dem 5. und 30. Mai, in Elberndorf zwischen dem 7. Mai und 5. Juni. Im aktuellen Jahr trieb die Fichte auf der Fläche im Weserbergland am. Mai aus und damit zwei Tage später als im langjährigen Mittel. In Elberndorf war der diesjährige Austriebstermin mit dem 25. Mai vier Tage später als im Mittel. Auf beiden Flächen lag der Austriebstermin jedoch früher als in den beiden Vorjahren. In der Zeitreihenbetrachtung zeigt sich 17 bei Buche und Eiche eine gegenläufige Tendenz gegenüber Fichte und Kiefer. Die Laubbäume haben gegenüber dem Vorjahr später und die Nadelbäume früher ausgetrieben (Abb. 5, S. 47). Letztere haben offensichtlich mehr auf die Wärme des Mai reagiert, die Laubbäume mehr auf die Kälte des April. Im Trend der 17-jährigen Zeitreihe ist bei der Buche trotz des späten Austriebes in diesem Jahr weiterhin eine Tendenz zu einem früheren Austrieb festzustellen. Dieser beträgt ca. 0,4 Tage pro Jahr. Dies ist insbesondere durch den frühen Austrieb in den Jahren 07, 09, 11 und 14 begründet. Auch die Eiche treibt tendenziell früher aus und zwar 0,6 Tage pro Jahr. Bei Fichte und Kiefer ist der aktuelle Trend umgekehrt. Bei der Fichte liegt der entsprechende Wert bei 0,45 Tagen und bei der Kiefer bei 0,25 Tagen pro Jahr, an denen der Austrieb später stattfindet (Abb. 5, S. 47).
47 47 Phänologische Beobachtungen an Waldbäumen im Frühjahr 17 ABBILDUNG 4 Verlauf der mittleren Tagesmitteltemperatur an den Waldmessstationen und mittlerer Austriebstermin der Baumarten auf den Dauerbeobachtungsflächen Frühjahr 17 Mittlere Tagestemperatur in C AUSTRIEBSTERMINE Fichte Kiefer 25 Buche Eiche Tag (erste Stelle = Monat, zweite und dritte Stelle = Tag) Kiefer Kleve Fichte Hilchenbach Fichte Velmerstot Buche Haard Buche Schwaney Buche Hilchenbach Buche Duisburg Buche Kleve und Monschau Buche Medebach (Glindfeld) Traubeneiche Kleve Tannenbusch Stieleiche Kleve Tannenbusch Eiche Arnsberg Stieleiche Münster Traubeneiche Münster Eiche Warendorf, Traubeneiche Viersen Frühe Stieleiche Viersen Stieleiche Stadtlohn, Späteiche Viersen Traubeneiche Stadtlohn Eiche Kleve Rehsohl ABBILDUNG 5 Mittlerer Austriebstermin der Hauptbaumarten auf den Dauerbeobachtungsflächen mit Trendlinien und deren Geradengleichungen 30. Mai. Mai 10. Mai 30. April. April 10. April Buche y = -0,38x + 123,97 Eiche y = -0,61x + 124,95 Fichte y = -0,45x + 135,35 Kiefer y = -0,25x + 127,00 Buche (n=7) Eiche (n=7) Fichte (n=2) Kiefer (n=1) Trend Buche Trend Eiche Trend Fichte Trend Kiefer
48 48 Phänologische Beobachtungen an Waldbäumen im Frühjahr 17 ZUSAMMENFASSUNG Auf einen warmen März, einen kalten April und einen am Ende sommerlichen Mai reagierten die Baumarten überwiegend mit einem späten Blattaustrieb. Lediglich bei den Stieleichen in Münster und Warendorf sowie bei der Traubeneiche in Stadtlohn und der Buche in Duisburg war der mittlere Austriebstermin bereits im April erreicht. Durch den Wärmeimpuls im März war bei der früh austreibenden Stieleiche in Viersen die Blattentfaltung sogar schon Ende März zu 50 Prozent abgeschlossen. Auf allen anderen Flächen lag der mittlere Austriebstermin erst im Mai. Im Trend der untersuchten 17 Jahre neigen Buche und Eiche zu einem früheren, Kiefer und Fichte dagegen zu einem späteren Austrieb. Abschließende Hinweise: Die phänologischen Aufnahmen werden durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) NRW in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Wald und Holz durchgeführt. Die Daten von den Buchenflächen gehen als Indikator Phänologie der Buche in das Klimafolgenmonitoring des Landes Nordrhein-Westfalen ein. Die Aufnahmen an den Waldmessstationen sind Teil des Internationalen Kooperationsprogramms Wälder (ICP Forests), das die Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf den Wald untersucht.
49 49 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis DIE VITALITÄT DER BAUMKRONEN 17 Tab. 1: Kronenverlichtung in Stufen 8 Abb. 1: Prozentuale Verteilung der Kronenverlichtung für die Summe aller Baumarten und Altersbereiche in NRW 8 Abb. 2: Entwicklung des Kronenzustandes aller Baumarten 1984 bis Abb. 3: Mittlerer Nadel-/Blattverlust aller Baumarten 11 Abb. 4: Absterberaten aller Baumarten 11 Tab. 2: Schadstufen je Baumartengruppe Abb. 5: Verteilung der Nadel-/Blattverluste bei den Hauptbaumarten Abb. 6: Anteil der Fruktifikation je Baumart Abb. 7: Entwicklung der Kronenverlichtung bei Eichen 1984 bis Abb. 8: Befall der Eichen mit Schmetterlingsraupen 1989 bis Abb. 9: Entwicklung der Kronenverlichtung bei Buchen 1984 bis Abb. 10: Intensität der Fruchtbildung bei Buchen 1989 bis Abb. 11: Befall der Buchen mit Buchenspringrüssler 1989 bis Abb. 12: Entwicklung der Kronenverlichtung bei Fichten 1984 bis 17 Abb. 13: Intensität der Fruchtbildung bei Fichten 1989 bis Abb. 14: Entwicklung der Kronenverlichtung bei Kiefern 1984 bis DIE WETTERVERHÄLTNISSE BIS ZUM SOMMER 17 SCHÄDLINGS- UND PILZBEFALL AN DEN WALDBÄUMEN Abb. 1: Fangzahlen männlicher EPS-Falter im Raum Mönchengladbach 14 bis Abb. 2: Niederschlagssummen im Raum Mönchengladbach Abb. 3: EPS-Verbreitungskarte NRW 33 Abb. 4: Bionomie des Eichenprozessionsspinners 33 Abb. 5: Borkenkäferwochenfangwerte am Standort Medelon Abb. 6: Entwicklung der Mäusedichte 40 PHÄNOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN AN WALDBÄUMEN IM FRÜHJAHR 17 Abb. 1: Lage der Waldmessstationen und Dauerbeobachtungsflächen 43 Tab. 1: Monatsmitteltemperaturen an den vier Waldmessstationen Frühjahr Abb. 2: Verlauf der mittleren Tagesmitteltemperatur an den Waldmessstationen und Austriebsverlauf aller Baumarten auf den Dauerbeobachtungsflächen Frühjahr Abb. 3: Austriebsverlauf auf den Dauerbeobachtungsflächen 12, 14 und Abb. 4: Verlauf der mittleren Tagesmitteltemperatur an den Waldmessstationen und mittlerer Austriebstermin der Baumarten auf den Dauerbeobachtungsflächen Frühjahr Abb. 5: Mittlerer Austriebstermin der Hauptbaumarten auf den Dauerbeobachtungsflächen mit Trendlinien und deren Geradengleichungen 47 Tab. 1: Vergleich der aktuellen Jahresdaten für Temperatur, Niederschlag und Sonnenscheindauer 17 mit der Vergleichsperiode Abb. 1: Vergleich Niederschlag 17 mit der Niederschlagsperiode Abb. 2: Jahresverläufe Temperaturen 27 Abb. 3: Jahresverlauf der Bodensaugspannung in verschiedenen Bodentiefen der Dauerbeobachtungsfläche Haard 29 Abb. 4: Überschreitungen der Temperaturund Ozonschwellenwerte 29
50 50 Impressum Herausgeber Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MULNV) Referat für Öffentlichkeitsarbeit Düsseldorf Fachredaktion MULNV, Referat III-2 Waldbau, Klimawandel im Wald, Holzwirtschaft Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen Lehr- und Versuchsforstamt Arnsberger Wald Schwerpunktaufgabe Waldplanung, Waldinventuren, Waldbewertung Fachtexte Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen: Lutz Falkenried Norbert Geisthoff Dr. Mathias Niesar Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen: Lutz Genßler Christoph Ziegler Fotonachweis Fotografie Rauss: S. 4; Lutz Falkenried: S. 1, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 52; Norbert Geisthoff: S. 38, 39; Lutz Genßler: S. 26; Manfred Kebbel: S. 36 (Mitte, unten); Dr. Mathias Niesar: S. 31, 35, 37; Herbert Röttger: S. 36 oben; Michael Wießner: S. 33 (unten); Christoph Ziegler: S. 42, 43, 44 Abbildungsnachweis Soweit nicht anders angegeben, liegen die Rechte der Abbildungen bei den jeweiligen Autoren. Gestaltung setz it. Richert GmbH, Sankt Augustin, Stand Oktober 17
51 51
52 52 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MULNV) Schwannstraße Düsseldorf
Waldschäden durch Luftverunreinigungen
 Waldschäden durch Luftverunreinigungen Neuartige Waldschäden, in den Anfangszeiten auch Waldsterben genannt, bezeichnet Waldschadensbilder in Mittel- und Nordeuropa, die seit Mitte der 1970er Jahre festgestellt
Waldschäden durch Luftverunreinigungen Neuartige Waldschäden, in den Anfangszeiten auch Waldsterben genannt, bezeichnet Waldschadensbilder in Mittel- und Nordeuropa, die seit Mitte der 1970er Jahre festgestellt
+++ StMELF aktuell +++ StMELF aktuell +++
 Bayerisches Sttsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Sttsminister Helmut Brunner informiert Ergebnisse der Kronenzustandserhebung 2013 in Bayern November 2013 +++ StMELF aktuell +++ StMELF
Bayerisches Sttsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Sttsminister Helmut Brunner informiert Ergebnisse der Kronenzustandserhebung 2013 in Bayern November 2013 +++ StMELF aktuell +++ StMELF
Das Oltner Wetter im März 2011
 Das Oltner Wetter im März 2011 Frühlingshaft mild mit viel Sonnenschein und anhaltender Trockenheit Auch der erste Frühlingsmonat war, wie schon die Vormonate Januar und Februar, überwiegend von hohem
Das Oltner Wetter im März 2011 Frühlingshaft mild mit viel Sonnenschein und anhaltender Trockenheit Auch der erste Frühlingsmonat war, wie schon die Vormonate Januar und Februar, überwiegend von hohem
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen Pressestelle
 Pressemitteilung Remmel: Unser Wald muss auf den Klimawandel vorbereitet werden Düsseldorf, 14. Dezember 2010 Wilhelm Deitermann Telefon 0211/45 66-719 Telefax 0211/45 66-706 wilhelm.deitermann @mkulnv.nrw.de
Pressemitteilung Remmel: Unser Wald muss auf den Klimawandel vorbereitet werden Düsseldorf, 14. Dezember 2010 Wilhelm Deitermann Telefon 0211/45 66-719 Telefax 0211/45 66-706 wilhelm.deitermann @mkulnv.nrw.de
Das Oltner Wetter im April 2011
 Das Oltner Wetter im April 2011 Ein aussergewöhnlicher April Der Wetterablauf im April 2011 war von einem dominierenden Element geprägt, nämlich Hochdruckgebieten. Von Monatsbeginn bis zum 22. April lagen
Das Oltner Wetter im April 2011 Ein aussergewöhnlicher April Der Wetterablauf im April 2011 war von einem dominierenden Element geprägt, nämlich Hochdruckgebieten. Von Monatsbeginn bis zum 22. April lagen
2 Die Niederschlagsverteilung für Deutschland im Jahr 2004 - Überblick
 2 Die Niederschlagsverteilung für Deutschland im Jahr 2004 - Überblick Das Hauptziel dieser Arbeit ist einen hochaufgelösten Niederschlagsdatensatz für Deutschland, getrennt nach konvektivem und stratiformem
2 Die Niederschlagsverteilung für Deutschland im Jahr 2004 - Überblick Das Hauptziel dieser Arbeit ist einen hochaufgelösten Niederschlagsdatensatz für Deutschland, getrennt nach konvektivem und stratiformem
Faktensammlung zur Dritten Bundeswaldinventur (BWI 3) für Mecklenburg-Vorpommern
 Faktensammlung zur Dritten Bundeswaldinventur (BWI 3) für Mecklenburg-Vorpommern Erhebungsmethodik BWI Großrauminventur auf Stichprobenbasis. Ziel Erfassung der aktuellen Waldverhältnisse und Produktionsmöglichkeiten
Faktensammlung zur Dritten Bundeswaldinventur (BWI 3) für Mecklenburg-Vorpommern Erhebungsmethodik BWI Großrauminventur auf Stichprobenbasis. Ziel Erfassung der aktuellen Waldverhältnisse und Produktionsmöglichkeiten
Klimawandel im Detail Zahlen und Fakten zum Klima in Deutschland
 Zahlen und Fakten zur DWD-Pressekonferenz am 28. April 2009 in Berlin: Klimawandel im Detail Zahlen und Fakten zum Klima in Deutschland Inhalt: Klimadaten zum Jahr 2008 Kurzer Blick auf das Klima in Deutschland
Zahlen und Fakten zur DWD-Pressekonferenz am 28. April 2009 in Berlin: Klimawandel im Detail Zahlen und Fakten zum Klima in Deutschland Inhalt: Klimadaten zum Jahr 2008 Kurzer Blick auf das Klima in Deutschland
Mal winterlich, mal mild, mal feucht - vor allem aber extrem wenig Sonne.
 Witterungsbericht Winter 2012 / 2013 Winter 2012 / 2013: Zwischen Winter und Winterling - mit insgesamt mehr Schnee als Schneeglöckchen Der meteorologische Winter 2012 / 2013 von Anfang Dezember bis Ende
Witterungsbericht Winter 2012 / 2013 Winter 2012 / 2013: Zwischen Winter und Winterling - mit insgesamt mehr Schnee als Schneeglöckchen Der meteorologische Winter 2012 / 2013 von Anfang Dezember bis Ende
HISTALP LANGZEITKLIMAREIHEN ÖSTERREICH SOMMERBERICHT 2013
 HISTALP LANGZEITKLIMAREIHEN ÖSTERREICH SOMMERBERICHT 2013 Der vergangene Sommer machte mit Lufttemperaturen von erstmals über 40 Grad Celsius Schlagzeilen, die ZAMG berichtete ausführlich dazu. Neben den
HISTALP LANGZEITKLIMAREIHEN ÖSTERREICH SOMMERBERICHT 2013 Der vergangene Sommer machte mit Lufttemperaturen von erstmals über 40 Grad Celsius Schlagzeilen, die ZAMG berichtete ausführlich dazu. Neben den
Erfurter Statistik. Halbjahresbericht 1/2015. Hauptamt 1
 Erfurter Statistik Halbjahresbericht 1/2015 Hauptamt 1 Postbezug Landeshauptstadt Erfurt Stadtverwaltung Personal- und Organisationsamt Statistik und Wahlen 99111 Erfurt Quellen: Ämter der Stadtverwaltung
Erfurter Statistik Halbjahresbericht 1/2015 Hauptamt 1 Postbezug Landeshauptstadt Erfurt Stadtverwaltung Personal- und Organisationsamt Statistik und Wahlen 99111 Erfurt Quellen: Ämter der Stadtverwaltung
S. 1. Fernerkundungsanwendungen Teil B Vorlesung Aktuelle Forstschutzprobleme Sommersemster
 Methodische Aspekte zur Vitalitätsansprache von Bäumen H. Fuchs, IWW 2004 IWW Vitalität eines Baumes Gesundheit Krankheit Folgen Zuwachsverluste Absterben Einschätzung a) Indirekt: Visuelle Beurteilung
Methodische Aspekte zur Vitalitätsansprache von Bäumen H. Fuchs, IWW 2004 IWW Vitalität eines Baumes Gesundheit Krankheit Folgen Zuwachsverluste Absterben Einschätzung a) Indirekt: Visuelle Beurteilung
Flächenentwicklung in Nordrhein-Westfalen Berichtsjahr 2013
 Flächenentwicklung in Nordrhein-Westfalen Berichtsjahr 2013 Stand: 26. Juni 2014 Quelle: IT.NRW (Datenbereitstellung am 06.06.2014) Aktualisierte Statistik: 33111-Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen
Flächenentwicklung in Nordrhein-Westfalen Berichtsjahr 2013 Stand: 26. Juni 2014 Quelle: IT.NRW (Datenbereitstellung am 06.06.2014) Aktualisierte Statistik: 33111-Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen
Witterungsbericht. - Sommer
 Witterungsbericht - Sommer 2013 - Witterungsbericht Sommer 2013 Erstellt: September 2013 Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie - Thüringer Klimaagentur - Göschwitzer Str. 41 07745 Jena Email:
Witterungsbericht - Sommer 2013 - Witterungsbericht Sommer 2013 Erstellt: September 2013 Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie - Thüringer Klimaagentur - Göschwitzer Str. 41 07745 Jena Email:
Klimawandel, Baumartenwahl und Wiederbewaldungsstrategie - Chancen und Risiken für den Remscheider Wald -
 Klimawandel, Baumartenwahl und Wiederbewaldungsstrategie - Chancen und Risiken für den Remscheider Wald - Norbert Asche Recklinghausen Vorbemerkungen Klimaentwicklung Waldstandort- und Waldentwicklung
Klimawandel, Baumartenwahl und Wiederbewaldungsstrategie - Chancen und Risiken für den Remscheider Wald - Norbert Asche Recklinghausen Vorbemerkungen Klimaentwicklung Waldstandort- und Waldentwicklung
Witterungsbericht. - Frühjahr
 Witterungsbericht - Frühjahr 2016 - Witterungsbericht Frühjahr 2016 Erstellt: Juni 2016 Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie - Thüringer Klimaagentur - Göschwitzer Str. 41 07745 Jena Email:
Witterungsbericht - Frühjahr 2016 - Witterungsbericht Frühjahr 2016 Erstellt: Juni 2016 Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie - Thüringer Klimaagentur - Göschwitzer Str. 41 07745 Jena Email:
Blüte und Fruktifikation
 Blüte und Fruktifikation Das Jahr 211 war durch eine bei nahezu allen Baumarten über ganz Europa aufgetretene starke Blütenbildung und Fruktifikation gekennzeichnet. Als Vorraussetzung für eine starke
Blüte und Fruktifikation Das Jahr 211 war durch eine bei nahezu allen Baumarten über ganz Europa aufgetretene starke Blütenbildung und Fruktifikation gekennzeichnet. Als Vorraussetzung für eine starke
Zahlen und Fakten zum Klimawandel in Deutschland
 Klima-Pressekonferenz des Deutschen Wetterdienstes am 3. Mai 2012 in Berlin: Zahlen und Fakten zum Klimawandel in Deutschland Inhalt: A) Klimadaten zum Jahr 2011 Ein kurzer Blick auf das Klima in Deutschland
Klima-Pressekonferenz des Deutschen Wetterdienstes am 3. Mai 2012 in Berlin: Zahlen und Fakten zum Klimawandel in Deutschland Inhalt: A) Klimadaten zum Jahr 2011 Ein kurzer Blick auf das Klima in Deutschland
Die Natur in den 4 Jahreszeiten. Julian 2012/13
 Die Natur in den 4 Jahreszeiten Julian 2c 2012/13 Die Natur in den vier Jahreszeiten Ein Jahr hat vier Jahreszeiten, die jeweils 3 Monate dauern. Diese heißen Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Zu jeder
Die Natur in den 4 Jahreszeiten Julian 2c 2012/13 Die Natur in den vier Jahreszeiten Ein Jahr hat vier Jahreszeiten, die jeweils 3 Monate dauern. Diese heißen Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Zu jeder
Kapitel 7. Crossvalidation
 Kapitel 7 Crossvalidation Wie im Kapitel 5 erwähnt wurde, ist die Crossvalidation die beste Technik, womit man die Genauigkeit der verschiedenen Interpolationsmethoden überprüft. In diesem Kapitel wurde
Kapitel 7 Crossvalidation Wie im Kapitel 5 erwähnt wurde, ist die Crossvalidation die beste Technik, womit man die Genauigkeit der verschiedenen Interpolationsmethoden überprüft. In diesem Kapitel wurde
144 8 Zuordnungen und Modelle
 8 Zuordnungen und Modelle Sebastian beobachtet mit großem Interesse das Wetter. Auf dem Balkon hat er einen Regenmesser angebracht. Jeden Morgen liest er den Niederschlag des vergangenen Tages ab. 5Millimeter
8 Zuordnungen und Modelle Sebastian beobachtet mit großem Interesse das Wetter. Auf dem Balkon hat er einen Regenmesser angebracht. Jeden Morgen liest er den Niederschlag des vergangenen Tages ab. 5Millimeter
Eichenprozessionsspinner
 Eichenprozessionsspinner Eichenprozessionsspinner Der Eichenprozessionsspinner ist eine Schmetterlingsart, die in Mitteleuropa nicht nur Eichen Probleme bereitet, sondern auch für Menschen Gesundheitsgefahren
Eichenprozessionsspinner Eichenprozessionsspinner Der Eichenprozessionsspinner ist eine Schmetterlingsart, die in Mitteleuropa nicht nur Eichen Probleme bereitet, sondern auch für Menschen Gesundheitsgefahren
Statistische Randnotizen
 Landkreis /Weser Februar 08 Stabsstelle Regionalentwicklung Az.: 12.01.20 Statistische Randnotizen Geburtenziffern im Landkreis /Weser und den anderen Kreisen im Bezirk Hannover Einleitung Kenntnis über
Landkreis /Weser Februar 08 Stabsstelle Regionalentwicklung Az.: 12.01.20 Statistische Randnotizen Geburtenziffern im Landkreis /Weser und den anderen Kreisen im Bezirk Hannover Einleitung Kenntnis über
Auswirkungen des Klimawandels auf Regionen Ostdeutschlands
 Auswirkungen des Klimawandels auf Regionen Ostdeutschlands Vortrag von Arun Hackenberger im Rahmen von Leuchtpol Fachtag Ost in Berlin am 27.Mai 2010 Einstieg in das Thema Wetter und Klima Ein wenig Statistik
Auswirkungen des Klimawandels auf Regionen Ostdeutschlands Vortrag von Arun Hackenberger im Rahmen von Leuchtpol Fachtag Ost in Berlin am 27.Mai 2010 Einstieg in das Thema Wetter und Klima Ein wenig Statistik
1. Witterung im Winter 1997/98
 1. Witterung im Winter 1997/98 von Dr. Karl Gabl Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Regionalstelle für Tirol und Vorarlberg Wie schon in den vorangegangenen Wintern wurden die Beobachtungen
1. Witterung im Winter 1997/98 von Dr. Karl Gabl Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Regionalstelle für Tirol und Vorarlberg Wie schon in den vorangegangenen Wintern wurden die Beobachtungen
KLIMAWANDEL in Thüringen
 Beobachteter KLIMAWANDEL in Thüringen 15. Fachkolloquium des Forstlichen Forschungs- und Kompetenzzentrums Gotha 14.09.2016 Dr. Kai Pfannschmidt Status Quo Der Juli 2016 war der 15. Monat in Folge, der
Beobachteter KLIMAWANDEL in Thüringen 15. Fachkolloquium des Forstlichen Forschungs- und Kompetenzzentrums Gotha 14.09.2016 Dr. Kai Pfannschmidt Status Quo Der Juli 2016 war der 15. Monat in Folge, der
Der Münchner Hitzesommer 2015 Zweitwärmster seit Messbeginn mit einem Rekord an heißen Tagen (> 30 C)
 Autorin: Monika Lugauer Tabellen und Grafiken: Angelika Kleinz Der Münchner Hitzesommer Zweitwärmster seit Messbeginn mit einem Rekord an heißen n (> 30 C) Der Sommer wird vielen Münchnern sicherlich noch
Autorin: Monika Lugauer Tabellen und Grafiken: Angelika Kleinz Der Münchner Hitzesommer Zweitwärmster seit Messbeginn mit einem Rekord an heißen n (> 30 C) Der Sommer wird vielen Münchnern sicherlich noch
Frühling Klimabulletin Frühling MeteoSchweiz. Sehr milder Frühling. Alpensüdseite trocken. Sonnige Frühlingmitte. 09.
 Frühling 2015 MeteoSchweiz Klimabulletin Frühling 2015 09. Juni 2015 Die Frühlingstemperatur lag über die ganze Schweiz gemittelt 1.1 Grad über der Norm 1981 2010. Auf der Alpensüdseite zeigte sich der
Frühling 2015 MeteoSchweiz Klimabulletin Frühling 2015 09. Juni 2015 Die Frühlingstemperatur lag über die ganze Schweiz gemittelt 1.1 Grad über der Norm 1981 2010. Auf der Alpensüdseite zeigte sich der
WALDZUSTANDSBERICHT 2012 DER LÄNDER BRANDENBURG UND BERLIN. Wald. Berliner Forsten
 WALDZUSTANDSBERICHT 22 DER LÄNDER BRANDENBURG UND BERLIN Wald Berliner Forsten Die Kronenzustandserhebung auf dem 6x6 km EU-Raster und die Intensivuntersuchungen auf einem Teil der Level-II-Flächen wurden
WALDZUSTANDSBERICHT 22 DER LÄNDER BRANDENBURG UND BERLIN Wald Berliner Forsten Die Kronenzustandserhebung auf dem 6x6 km EU-Raster und die Intensivuntersuchungen auf einem Teil der Level-II-Flächen wurden
Klimawandel in Baden-Württemberg
 ZAHL DER SOMMERTAGE +22 +20 +18 +16 Änderung der Anzahl der Sommertage ( 25 C) zwischen 1971-2000 und 2011-2040. +14 +12 +10 +8 5 ZAHL DER FROSTTAGE -7-9 -11-13 Änderung der Anzahl der Frosttage zwischen
ZAHL DER SOMMERTAGE +22 +20 +18 +16 Änderung der Anzahl der Sommertage ( 25 C) zwischen 1971-2000 und 2011-2040. +14 +12 +10 +8 5 ZAHL DER FROSTTAGE -7-9 -11-13 Änderung der Anzahl der Frosttage zwischen
Das Ende der Käfersaison kündigt sich an!
 Fangsumme/ Falle (Mittelwert) 9.9.215 Das Ende der Käfersaison kündigt sich an! Beobachtungszeitraum: 2. bis 8. September 215 Die aktuelle Lage Die Temperaturen der letzten Woche bewegte sich in dem vorhergesagten
Fangsumme/ Falle (Mittelwert) 9.9.215 Das Ende der Käfersaison kündigt sich an! Beobachtungszeitraum: 2. bis 8. September 215 Die aktuelle Lage Die Temperaturen der letzten Woche bewegte sich in dem vorhergesagten
Einflüsse des Klimawandels auf den Niederschlag Subjektive Wahrnehmung vs. Nachweisbare Auswirkungen
 Einflüsse des Klimawandels auf den Niederschlag Subjektive Wahrnehmung vs. Nachweisbare Auswirkungen Dr. Markus Quirmbach dr. papadakis GmbH, Hattingen Subjektive Wahrnehmung Die Intensität von Starkregen
Einflüsse des Klimawandels auf den Niederschlag Subjektive Wahrnehmung vs. Nachweisbare Auswirkungen Dr. Markus Quirmbach dr. papadakis GmbH, Hattingen Subjektive Wahrnehmung Die Intensität von Starkregen
Umweltmedizinische Bedeutung des
 Umweltmedizinische Bedeutung des Eichenprozessionsspinners Retrospektive Analyse von EPS-Erkrankungsfällen in den Jahren 24 und 25 im Kreis Kleve Martina Scherbaum 6.3.212 Kreisverwaltung Kleve, Fachbereich
Umweltmedizinische Bedeutung des Eichenprozessionsspinners Retrospektive Analyse von EPS-Erkrankungsfällen in den Jahren 24 und 25 im Kreis Kleve Martina Scherbaum 6.3.212 Kreisverwaltung Kleve, Fachbereich
Klimawandel in NRW - die Situation in Städten und Ballungsräumen
 Klimawandel in NRW - die Situation in Städten und Ballungsräumen Dr. Barbara Köllner Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz - LANUV Autorenname, Fachbereich Das Klima in NRW (Quelle: DWD) Jahresmitteltemperatur
Klimawandel in NRW - die Situation in Städten und Ballungsräumen Dr. Barbara Köllner Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz - LANUV Autorenname, Fachbereich Das Klima in NRW (Quelle: DWD) Jahresmitteltemperatur
Deutscher Wetterdienst zur klimatologischen Einordnung des Winters 2012/13 Durchschnittlicher Winter und kalter März widerlegen keine Klimatrends
 Deutscher Wetterdienst zur klimatologischen Einordnung des Winters 2012/13 Durchschnittlicher Winter und kalter März widerlegen keine Klimatrends Offenbach, 12. April 2013 Der Winter 2012/2013 erreichte
Deutscher Wetterdienst zur klimatologischen Einordnung des Winters 2012/13 Durchschnittlicher Winter und kalter März widerlegen keine Klimatrends Offenbach, 12. April 2013 Der Winter 2012/2013 erreichte
Der Januar in der 100-jährigen Beobachtungsreihe von Berlin-Dahlem 1909 bis 2008 von Jürgen Heise und Georg Myrcik
 Beiträge des Instituts für Meteorologie der Freien Universität Berlin zur Berliner Wetterkarte Herausgegeben vom Verein BERLINER WETTERKARTE e.v. c/o Carl-Heinrich-Becker-Weg 6-10, 12165 Berlin http://www.berliner-wetterkarte.de
Beiträge des Instituts für Meteorologie der Freien Universität Berlin zur Berliner Wetterkarte Herausgegeben vom Verein BERLINER WETTERKARTE e.v. c/o Carl-Heinrich-Becker-Weg 6-10, 12165 Berlin http://www.berliner-wetterkarte.de
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Gartenakademie. Pilzliche Erkrankungen der. Nadelgehölze
 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Gartenakademie Pilzliche Erkrankungen der Nadelgehölze Autor: Regina Petzoldt Bestellungen: Telefon: 0351 2612-8080 Telefax: 0351 2612-8099
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Gartenakademie Pilzliche Erkrankungen der Nadelgehölze Autor: Regina Petzoldt Bestellungen: Telefon: 0351 2612-8080 Telefax: 0351 2612-8099
Untersuchungen zum Durchmesserzuwachs an den Wald- und Hauptmessstationen (Praktikumsarbeit FSU Jena, Master-Studiengang Geografie)
 Untersuchungen zum Durchmesserzuwachs an den Wald- und Hauptmessstationen (Praktikumsarbeit FSU Jena, Master-Studiengang Geografie) Im Rahmen des Forstlichen Umweltmonitoring werden an den 14 Thüringer
Untersuchungen zum Durchmesserzuwachs an den Wald- und Hauptmessstationen (Praktikumsarbeit FSU Jena, Master-Studiengang Geografie) Im Rahmen des Forstlichen Umweltmonitoring werden an den 14 Thüringer
Forstdienst. Käfersituation in Salzburg
 Käfersituation in Salzburg Winterschäden Winter 2014/2015: Mild mit relativ wenig Schnee bis in höhere Lagen Regenreicher Jänner, trockener Februar Nasser, schwerer Schnee bis in höhere Lagen Relativ wenig
Käfersituation in Salzburg Winterschäden Winter 2014/2015: Mild mit relativ wenig Schnee bis in höhere Lagen Regenreicher Jänner, trockener Februar Nasser, schwerer Schnee bis in höhere Lagen Relativ wenig
DIE NIEDERSCHLAGSVERHÄLTNISSE IN DER STEIERMARK IN DEN LETZTEN 100 JAHREN Hydrographischer Dienst Steiermark
 1 DIE NIEDERSCHLAGSVERHÄLTNISSE IN DER STEIERMARK IN DEN LETZTEN 1 JAHREN Hydrographischer Dienst Steiermark 1. EINLEITUNG Das Jahr 21 war geprägt von extremer Trockenheit vor allem in den südlichen Teilen
1 DIE NIEDERSCHLAGSVERHÄLTNISSE IN DER STEIERMARK IN DEN LETZTEN 1 JAHREN Hydrographischer Dienst Steiermark 1. EINLEITUNG Das Jahr 21 war geprägt von extremer Trockenheit vor allem in den südlichen Teilen
Das Niederschlagsgeschehen in Mitteleuropa in den ersten 12 Tagen des August 2002
 Das Niederschlagsgeschehen in Mitteleuropa in den ersten 12 Tagen des August 2002 In den ersten 12 Tagen des August 2002 kam es in Mitteleuropa zu verschiedenen Starkregenereignissen, die große Schäden
Das Niederschlagsgeschehen in Mitteleuropa in den ersten 12 Tagen des August 2002 In den ersten 12 Tagen des August 2002 kam es in Mitteleuropa zu verschiedenen Starkregenereignissen, die große Schäden
HISTALP LANGZEITKLIMAREIHEN ÖSTERREICH SOMMERBERICHT 2015
 HISTALP LANGZEITKLIMAREIHEN ÖSTERREICH SOMMERBERICHT 2015 Der Sommer 2015 war sowohl im Tiefland als auch auf Österreichs Bergen der zweitwärmste seit Beginn der Temperaturmessungen, lediglich im Jahr
HISTALP LANGZEITKLIMAREIHEN ÖSTERREICH SOMMERBERICHT 2015 Der Sommer 2015 war sowohl im Tiefland als auch auf Österreichs Bergen der zweitwärmste seit Beginn der Temperaturmessungen, lediglich im Jahr
Überblick. Ziele. Unterrichtseinheit
 MODUL 3: Lernblatt D 8/9/10 Artenvielfalt Pflanzen in Gefahr Zeit 3 Stunden ORT Botanischer Garten Überblick Die SchülerInnen erfahren, warum Pflanzen vom Aussterben bedroht sind, indem sie in einem Rollenspiel
MODUL 3: Lernblatt D 8/9/10 Artenvielfalt Pflanzen in Gefahr Zeit 3 Stunden ORT Botanischer Garten Überblick Die SchülerInnen erfahren, warum Pflanzen vom Aussterben bedroht sind, indem sie in einem Rollenspiel
BORKENKÄFER. Gefahr in Verzug!!
 BORKENKÄFER nach Manfred Wolf, Forstdirektion Niederbayern Oberpfalz 2004 Gefahr in Verzug!! Biologie Lebensweise der Fichten-Borkenkäfer Borkenkäfer fliegen ab dem Frühjahr auf geschwächte stehende Bäume
BORKENKÄFER nach Manfred Wolf, Forstdirektion Niederbayern Oberpfalz 2004 Gefahr in Verzug!! Biologie Lebensweise der Fichten-Borkenkäfer Borkenkäfer fliegen ab dem Frühjahr auf geschwächte stehende Bäume
Neue Fakten zur Lohnentwicklung
 DR. WOLFGANG KÜHN LW.Kuehn@t-online.de Neue Fakten zur Lohnentwicklung Die seit Jahren konstant große Lücke in der Entlohnung zwischen den neuen Bundesländern und dem früheren Bundesgebiet bleibt auch
DR. WOLFGANG KÜHN LW.Kuehn@t-online.de Neue Fakten zur Lohnentwicklung Die seit Jahren konstant große Lücke in der Entlohnung zwischen den neuen Bundesländern und dem früheren Bundesgebiet bleibt auch
Vorwort. Dr. Till Backhaus Minister für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern
 Vorwort Die befürchtete drastische Verschlechterung des Waldzustands nach dem Jahrhundertsommer 2003 ist, insgesamt gesehen, in Mecklenburg- Vorpommern glücklicherweise nicht eingetreten. Wohl aber zeigten
Vorwort Die befürchtete drastische Verschlechterung des Waldzustands nach dem Jahrhundertsommer 2003 ist, insgesamt gesehen, in Mecklenburg- Vorpommern glücklicherweise nicht eingetreten. Wohl aber zeigten
Besonders extreme Wetterlagen werden durch Klimawandel am stärksten zunehmen
 Gemeinsame Pressekonferenz des Deutschen Wetterdienstes (DWD), Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), Umweltbundesamtes (UBA), Technischen Hilfswerks (THW) und Bundesamtes für Bevölkerungsschutz
Gemeinsame Pressekonferenz des Deutschen Wetterdienstes (DWD), Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), Umweltbundesamtes (UBA), Technischen Hilfswerks (THW) und Bundesamtes für Bevölkerungsschutz
Das Niederschlagsgeschehen in Deutschland über den Jahreswechsel 2002/2003
 Das Niederschlagsgeschehen in Deutschland über den Jahreswechsel 2002/2003 Udo Schneider, Peter Otto und Bruno Rudolf Weltzentrum für Niederschlagsklimatologie, Deutscher Wetterdienst, Offenbach a.m. Ende
Das Niederschlagsgeschehen in Deutschland über den Jahreswechsel 2002/2003 Udo Schneider, Peter Otto und Bruno Rudolf Weltzentrum für Niederschlagsklimatologie, Deutscher Wetterdienst, Offenbach a.m. Ende
Klimadiagramme lesen und zeichnen Arbeitsblatt
 Lehrerinformation 1/9 Arbeitsauftrag Ziel Material Sozialform Die Sch werden mit den Bestandteilen des Klimadiagramms vertraut und lesen Informationen aus Klimadiagrammen heraus. Sie zeichnen selbst Informationen
Lehrerinformation 1/9 Arbeitsauftrag Ziel Material Sozialform Die Sch werden mit den Bestandteilen des Klimadiagramms vertraut und lesen Informationen aus Klimadiagrammen heraus. Sie zeichnen selbst Informationen
Der April in der 100-jährigen Beobachtungsreihe von Berlin-Dahlem 1908 bis 2007 von Jürgen Heise und Georg Myrcik
 Beiträge des Instituts für Meteorologie der Freien Universität Berlin zur Berliner Wetterkarte Herausgegeben vom Verein BERLINER WETTERKARTE e.v. c/o Carl-Heinrich-Becker-Weg 6-10, 12165 Berlin http://www.berliner-wetterkarte.de
Beiträge des Instituts für Meteorologie der Freien Universität Berlin zur Berliner Wetterkarte Herausgegeben vom Verein BERLINER WETTERKARTE e.v. c/o Carl-Heinrich-Becker-Weg 6-10, 12165 Berlin http://www.berliner-wetterkarte.de
Aktuelles zum Wettergeschehen
 Aktuelles zum Wettergeschehen 16. Juni 2008 / Stephan Bader Die Schafskälte im Juni - eine verschwundene Singularität Der Monat Juni zeigte sich in den letzten Jahren oft von seiner hochsommerlichen Seite.
Aktuelles zum Wettergeschehen 16. Juni 2008 / Stephan Bader Die Schafskälte im Juni - eine verschwundene Singularität Der Monat Juni zeigte sich in den letzten Jahren oft von seiner hochsommerlichen Seite.
STAR: Kostenstrukturen in Anwaltskanzleien 1994 und 1998
 Quelle: BRAK-Mitteilungen 2/2001 (S. 62-65) Seite 1 STAR: Kostenstrukturen in Anwaltskanzleien 1994 und 1998 Alexandra Schmucker, Institut für Freie Berufe, Nürnberg Im Rahmen der STAR-Befragung wurden
Quelle: BRAK-Mitteilungen 2/2001 (S. 62-65) Seite 1 STAR: Kostenstrukturen in Anwaltskanzleien 1994 und 1998 Alexandra Schmucker, Institut für Freie Berufe, Nürnberg Im Rahmen der STAR-Befragung wurden
SWISS Verkehrszahlen Januar September 2004
 SWISS Verkehrszahlen Januar September 2004 Deutlich bessere Auslastung in den ersten neun Monaten In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres steigerte SWISS ihre Auslastung im Vorjahresvergleich um
SWISS Verkehrszahlen Januar September 2004 Deutlich bessere Auslastung in den ersten neun Monaten In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres steigerte SWISS ihre Auslastung im Vorjahresvergleich um
Auswirkungen des KlimawandelsIS
 Auswirkungen des KlimawandelsIS Die Auswirkungen/Folgen des Klimawandels auf die natürlichen System, Wirtschaft und Gesellschaft sind vielfältig. Nachfolgend wird eine nicht abschliessende Zusammenstellung
Auswirkungen des KlimawandelsIS Die Auswirkungen/Folgen des Klimawandels auf die natürlichen System, Wirtschaft und Gesellschaft sind vielfältig. Nachfolgend wird eine nicht abschliessende Zusammenstellung
Erfurter Statistik. Halbjahresbericht 2/2012. Hauptamt 1
 Erfurter Statistik Halbjahresbericht 2/2012 Hauptamt 1 Postbezug Quellen: Landeshauptstadt Erfurt Stadtverwaltung Personal- und Organisationsamt Statistik und Wahlen Fischmarkt 1 99084 Erfurt Ämter der
Erfurter Statistik Halbjahresbericht 2/2012 Hauptamt 1 Postbezug Quellen: Landeshauptstadt Erfurt Stadtverwaltung Personal- und Organisationsamt Statistik und Wahlen Fischmarkt 1 99084 Erfurt Ämter der
Lösung Station 1. Teile des Baumes (a)
 Lösung Station 1 Teile des Baumes (a) Jeder Baum hat einen Stamm mit einer harten Rinde, die ihn schützt. Am Stamm wachsen die dicken Äste, an denen wiederum die dünnen Zweige wachsen. Im Frühjahr sprießen
Lösung Station 1 Teile des Baumes (a) Jeder Baum hat einen Stamm mit einer harten Rinde, die ihn schützt. Am Stamm wachsen die dicken Äste, an denen wiederum die dünnen Zweige wachsen. Im Frühjahr sprießen
Monatlicher Treibstoff-Newsletter 06/2011
 Monatlicher Treibstoff-Newsletter 06/2011 Erscheinungsdatum: 14. Juni 2011 Liebe Leserinnen und Leser, in der Juni-Ausgabe unseres Newsletters möchten wir Ihnen einen Überblick über die Entwicklungen am
Monatlicher Treibstoff-Newsletter 06/2011 Erscheinungsdatum: 14. Juni 2011 Liebe Leserinnen und Leser, in der Juni-Ausgabe unseres Newsletters möchten wir Ihnen einen Überblick über die Entwicklungen am
& ) %*#+( %% * ' ),$-#. '$ # +, //$ ' ' ' ' %0 -. % ( #+$1 $$! / 0# ' $ " ' #) % $# !! # ' +!23!4 * ' ($!#' (! " # $ & - 2$ $' % & " $ ' '( +1 * $ 5
 !"!! # " # $% $ & $$% % & " $ ' '( &% % # ) # $ ' #% $ $$ $ (! ' #%#'$ & ) %*#+( %% * ' ) $-#. '$ # + //$ ' ' ' ' %0 -. % ( #+$1 $$! / 0# ' $ " ' #) % $# 0+ ' +!23!4 * ' ($!#' (! ) ' $1%%$( - 2$ $' +1
!"!! # " # $% $ & $$% % & " $ ' '( &% % # ) # $ ' #% $ $$ $ (! ' #%#'$ & ) %*#+( %% * ' ) $-#. '$ # + //$ ' ' ' ' %0 -. % ( #+$1 $$! / 0# ' $ " ' #) % $# 0+ ' +!23!4 * ' ($!#' (! ) ' $1%%$( - 2$ $' +1
Wald in Leichter Sprache
 Wald in Leichter Sprache Warum müssen wir die Natur schützen? Wir Menschen verändern die Natur. Zum Beispiel: Wir fällen viele Bäume. Aber Bäume sind wichtig für saubere Luft. Wir Menschen brauchen saubere
Wald in Leichter Sprache Warum müssen wir die Natur schützen? Wir Menschen verändern die Natur. Zum Beispiel: Wir fällen viele Bäume. Aber Bäume sind wichtig für saubere Luft. Wir Menschen brauchen saubere
Wie viele Erwerbspersonen hat Nordrhein-Westfalen 2040/2060? Modellrechnung zur Entwicklung der Erwerbspersonen. Statistik kompakt 03/2016
 Statistik kompakt 03/2016 Wie viele Erwerbspersonen hat Nordrhein-Westfalen 2040/2060? Modellrechnung zur Entwicklung der Erwerbspersonen www.it.nrw.de Impressum Herausgegeben von Information und Technik
Statistik kompakt 03/2016 Wie viele Erwerbspersonen hat Nordrhein-Westfalen 2040/2060? Modellrechnung zur Entwicklung der Erwerbspersonen www.it.nrw.de Impressum Herausgegeben von Information und Technik
Lösung: Landwirtschaft Mehr Trockenheit im Mittelmeerraum - Arbeitsblatt 2. Wie kommt es zu einer Dürre/Trockenperiode?
 Lösung: Landwirtschaft Mehr Trockenheit im Mittelmeerraum - Arbeitsblatt 2 Wie kommt es zu einer Dürre/Trockenperiode? 1. Die Satellitenbilder zeigen den NVDI (Normalized Deviation Vegetation Index) des
Lösung: Landwirtschaft Mehr Trockenheit im Mittelmeerraum - Arbeitsblatt 2 Wie kommt es zu einer Dürre/Trockenperiode? 1. Die Satellitenbilder zeigen den NVDI (Normalized Deviation Vegetation Index) des
Apfelmehltau. Bearbeitet von: Wolfgang Essig
 Apfelmehltau Die Blätter sind mit einem weißem mehligen Belag überzogen. Sie rollen sich ein und fallen frühzeitig ab. Rückschnitt von befallenen Triebspitzen im Winter und Frühjahr nach dem Neuaustrieb.
Apfelmehltau Die Blätter sind mit einem weißem mehligen Belag überzogen. Sie rollen sich ein und fallen frühzeitig ab. Rückschnitt von befallenen Triebspitzen im Winter und Frühjahr nach dem Neuaustrieb.
Biologie-Projekt. Saurer Regen ATHENE SAKELLARIOU HEIMBERGER HOLGER INA. -Team LANGLOTZ DANIEL VOLLBRECHT
 Biologie-Projekt Saurer Regen AT INA HO VO -Team ATHENE SAKELLARIOU INA HEIMBERGER HOLGER LANGLOTZ DANIEL VOLLBRECHT Präsentationsgliederung Vorversuch Hauptversuch Auswertung Recherche Ina Daniel Daniel
Biologie-Projekt Saurer Regen AT INA HO VO -Team ATHENE SAKELLARIOU INA HEIMBERGER HOLGER LANGLOTZ DANIEL VOLLBRECHT Präsentationsgliederung Vorversuch Hauptversuch Auswertung Recherche Ina Daniel Daniel
Klimawandel in NRW und Strategien zur. Dr. Barbara Köllner
 Klimawandel in NRW und Strategien zur Anpassung Dr. Barbara Köllner Der Klimawandel ist in NRW angekommen nicht drastisch aber stetig - Anstieg der Durchschnittstemperaturen: seit Beginn des Jahrhunderts
Klimawandel in NRW und Strategien zur Anpassung Dr. Barbara Köllner Der Klimawandel ist in NRW angekommen nicht drastisch aber stetig - Anstieg der Durchschnittstemperaturen: seit Beginn des Jahrhunderts
Die Entwicklung der Pflegebedürftigen in Thüringen bis 2020
 Die Entwicklung der Pflegebedürftigen in Thüringen bis 2020 Die Anzahl alter und hochbetagter Menschen in Thüringen wird immer größer. Diese an sich positive Entwicklung hat jedoch verschiedene Auswirkungen.
Die Entwicklung der Pflegebedürftigen in Thüringen bis 2020 Die Anzahl alter und hochbetagter Menschen in Thüringen wird immer größer. Diese an sich positive Entwicklung hat jedoch verschiedene Auswirkungen.
Station 1 Der Baum. Frucht Blüte Stamm. Wurzeln Blatt Ast
 Station 1 Der Baum Frucht Blüte Stamm Wurzeln Blatt Ast Station 2 Baumsteckbrief Mein Name ist Ahorn. Ich bin ein Bergahorn. Meine gezackten Blätter haben fünf Spitzen. Meine Blüten sind gelb. An einem
Station 1 Der Baum Frucht Blüte Stamm Wurzeln Blatt Ast Station 2 Baumsteckbrief Mein Name ist Ahorn. Ich bin ein Bergahorn. Meine gezackten Blätter haben fünf Spitzen. Meine Blüten sind gelb. An einem
DIE VORAUSSICHTLICHE BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG BIS 2025
 DIE VORAUSSICHTLICHE BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG BIS 2025 Annahmen und Ergebnisse der 5. Regionalisierten Bevölkerungsprognose 2008 bis 2025 für Sachsen-Anhalt Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für
DIE VORAUSSICHTLICHE BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG BIS 2025 Annahmen und Ergebnisse der 5. Regionalisierten Bevölkerungsprognose 2008 bis 2025 für Sachsen-Anhalt Die 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für
Schleswig-Holstein 2008 Leistungskurs Biologie Thema: Entwicklung und Veränderung lebender Systeme. Zur Evolution einer giftigen Form des Weißklees
 Schleswig-Holstein 008 Zur Evolution einer giftigen Form des Weißklees ) Definieren Sie die Begriffe Art, Rasse und Population und diskutieren Sie, inwieweit es sich bei dem ungiftigen und dem Blausäure
Schleswig-Holstein 008 Zur Evolution einer giftigen Form des Weißklees ) Definieren Sie die Begriffe Art, Rasse und Population und diskutieren Sie, inwieweit es sich bei dem ungiftigen und dem Blausäure
Arbeitsblatt: Erstellen von Boxplots. Aufgabe: Frisörbesuch (Lernstandserhebung NRW 2008)
 Arbeitsblatt: Erstellen von Boxplots Aufgabe: Frisörbesuch (Lernstandserhebung NRW 2008) Aufgabe: Klimazonen (Hinweis: Löst die Aufgabe arbeitsteilig in Kleingruppen.) Aus vier en in Europa liegen Durchschnittstemperaturen
Arbeitsblatt: Erstellen von Boxplots Aufgabe: Frisörbesuch (Lernstandserhebung NRW 2008) Aufgabe: Klimazonen (Hinweis: Löst die Aufgabe arbeitsteilig in Kleingruppen.) Aus vier en in Europa liegen Durchschnittstemperaturen
Verhaltener Flug, stetige Entwicklung
 Borkenkäfer-Newsletter Nordschwarzwald 19.05.2016 Verhaltener Flug, stetige Entwicklung Nachdem gestern vereinzelt die 16,5 C erreicht wurden, liegen die Tempearturen heute wieder darunter. Mit örtlich
Borkenkäfer-Newsletter Nordschwarzwald 19.05.2016 Verhaltener Flug, stetige Entwicklung Nachdem gestern vereinzelt die 16,5 C erreicht wurden, liegen die Tempearturen heute wieder darunter. Mit örtlich
Klima- & Umweltmonitoring Daten & Erwartungen der Forstwirtschaft
 Klima- & Umweltmonitoring Daten & Erwartungen der Forstwirtschaft oder Wie kann das seit mehr als 200 Jahren im Aufbau befindliche Klimamonitoring im Wald verbessert & ausgewertet werden? Ingolf Profft
Klima- & Umweltmonitoring Daten & Erwartungen der Forstwirtschaft oder Wie kann das seit mehr als 200 Jahren im Aufbau befindliche Klimamonitoring im Wald verbessert & ausgewertet werden? Ingolf Profft
auf Nachhaltigkeit Forsten Berliner Forsten, Th. Wiehle Waldzustandsbericht 2015 des Landes Berlin
 auf Nachhaltigkeit Forsten Waldzustandsbericht 2015 des Landes Berlin Berliner Forsten, Th. Wiehle Waldzustandsbericht 2015 des Landes Berlin Inhalt Inhalt Hauptergebnisse 3 1. Ergebnisse der Waldzustandserhebung
auf Nachhaltigkeit Forsten Waldzustandsbericht 2015 des Landes Berlin Berliner Forsten, Th. Wiehle Waldzustandsbericht 2015 des Landes Berlin Inhalt Inhalt Hauptergebnisse 3 1. Ergebnisse der Waldzustandserhebung
Entwicklung phänologischer Phasen aller untersuchten Zeigerpflanzen in Hessen
 Entwicklung phänologischer Phasen aller untersuchten Zeigerpflanzen in Beginn des Vorfrühlings Haselnuss (Blüte) Der Blühbeginn der Haselnuss zeigt für ganz einen Trend zur Verfrühung um 0,55 Tage pro
Entwicklung phänologischer Phasen aller untersuchten Zeigerpflanzen in Beginn des Vorfrühlings Haselnuss (Blüte) Der Blühbeginn der Haselnuss zeigt für ganz einen Trend zur Verfrühung um 0,55 Tage pro
Japanischer Staudenknöterich
 Blätter und Blüte Japanischer Staudenknöterich Blatt Japanischer Staudenknöterich Wissenschaftlicher Name: Fallopia japonica Beschreibung: Der japanische Staudenknöterich ist eine schnell wachsende, krautige
Blätter und Blüte Japanischer Staudenknöterich Blatt Japanischer Staudenknöterich Wissenschaftlicher Name: Fallopia japonica Beschreibung: Der japanische Staudenknöterich ist eine schnell wachsende, krautige
Waldrallye Haus Dortmund
 Waldrallye Haus Dortmund Die Waldralle umfasst drei verschiedene Aufgabenformen: a) Stationen: Mit Zahlen markierte Punkte, an denen Fragen beantwortet werden müssen. b) Übungen: Stationen, an denen Aufgaben
Waldrallye Haus Dortmund Die Waldralle umfasst drei verschiedene Aufgabenformen: a) Stationen: Mit Zahlen markierte Punkte, an denen Fragen beantwortet werden müssen. b) Übungen: Stationen, an denen Aufgaben
V. Saisonkomponente bei der Aufnahme von Tieren
 V. Saisonkomponente bei der Aufnahme von Tieren Fr. 11: Gibt es nach Ihren Erfahrungen Monate, in denen Ihr Tierheim überdurchschnittlich viele Tiere aufnimmt? Saisonkomponente nicht vorhanden Saisonkomponente
V. Saisonkomponente bei der Aufnahme von Tieren Fr. 11: Gibt es nach Ihren Erfahrungen Monate, in denen Ihr Tierheim überdurchschnittlich viele Tiere aufnimmt? Saisonkomponente nicht vorhanden Saisonkomponente
Risiken und Chancen. für die heimischen Baumarten im Oberrheingraben am Beispiel Rheinland-Pfalz. Ana C. Vasconcelos & Dr.
 Risiken und Chancen für die heimischen Baumarten im Oberrheingraben am Beispiel Rheinland-Pfalz & Dr. Ulrich Matthes LANDESPFLEGE FREIBURG KlimLandRP Matthes, Ulrich Einleitung I. Zielsetzung und Forschungsfragen
Risiken und Chancen für die heimischen Baumarten im Oberrheingraben am Beispiel Rheinland-Pfalz & Dr. Ulrich Matthes LANDESPFLEGE FREIBURG KlimLandRP Matthes, Ulrich Einleitung I. Zielsetzung und Forschungsfragen
22. Schweizer Phänologie-Tag in Birmensdorf ZH Waldphänologie und waldökologische Beobachtungen
 22. Schweizer Phänologie-Tag in Birmensdorf ZH Waldphänologie und waldökologische Beobachtungen Anne Thimonier, Maria Schmitt, Peter Waldner, Oliver Schramm Einleitung Waldphänologie Erkenntnisse der letzten
22. Schweizer Phänologie-Tag in Birmensdorf ZH Waldphänologie und waldökologische Beobachtungen Anne Thimonier, Maria Schmitt, Peter Waldner, Oliver Schramm Einleitung Waldphänologie Erkenntnisse der letzten
Wetterrückblick 2015
 Wetterrückblick 2015 Januar... 2 Februar... 2 März... 2 April... 2 Mai... 3 Juni... 3 Juli... 3 August... 4 September... 4 Oktober... 4 November... 4 Dezember... 5 Januar Der Januar 2015 war einer der
Wetterrückblick 2015 Januar... 2 Februar... 2 März... 2 April... 2 Mai... 3 Juni... 3 Juli... 3 August... 4 September... 4 Oktober... 4 November... 4 Dezember... 5 Januar Der Januar 2015 war einer der
Land- und forstwirtschaftliche Gesamtrechnung 2014
 Amt der Oö. Landesregierung Direktion Präsidium Information der Abt. Statistik Land- und forstwirtschaftliche Gesamtrechnung 2014 Land- und forstwirtschaftliche Gesamtrechnung 2014 1/2013 2/2016 In dieser
Amt der Oö. Landesregierung Direktion Präsidium Information der Abt. Statistik Land- und forstwirtschaftliche Gesamtrechnung 2014 Land- und forstwirtschaftliche Gesamtrechnung 2014 1/2013 2/2016 In dieser
Pressekonferenz von Hansestadt Hamburg und Deutschem Wetterdienst (DWD) am 20. November 2015 in Hamburg
 Pressekonferenz von Hansestadt Hamburg und Deutschem Wetterdienst (DWD) am 20. November 2015 in Hamburg Hamburg wird durch Klimawandel wärmer und nasser Erfolgreiche Anpassung an die Folgen der Klimaveränderung
Pressekonferenz von Hansestadt Hamburg und Deutschem Wetterdienst (DWD) am 20. November 2015 in Hamburg Hamburg wird durch Klimawandel wärmer und nasser Erfolgreiche Anpassung an die Folgen der Klimaveränderung
Langzeitverhalten der Hochwasserabflüsse Ergebnisse aus KLIWA
 122 KLIWA-Symposium 2000 Langzeitverhalten der Hochwasserabflüsse Ergebnisse aus KLIWA Helmut Straub Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, Karlsruhe In jüngster Vergangenheit traten in verschiedenen
122 KLIWA-Symposium 2000 Langzeitverhalten der Hochwasserabflüsse Ergebnisse aus KLIWA Helmut Straub Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg, Karlsruhe In jüngster Vergangenheit traten in verschiedenen
Waldzustandsbericht Ergebnisse der Waldzustandserhebung
 Ergebnisse der Waldzustandserhebung Impressum Herausgeber: Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern (LU) Paulshöher Weg 1 19061 Schwerin Redaktion: LU, Referat
Ergebnisse der Waldzustandserhebung Impressum Herausgeber: Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern (LU) Paulshöher Weg 1 19061 Schwerin Redaktion: LU, Referat
Problemanalyse zu Berliner Stadtbäumen
 Pflanzenschutzamt Berlin Problemanalyse zu Berliner Stadtbäumen Fragebogenauswertung Stadtgrün 2010 Einleitung Das Pflanzenschutzamt Berlin führte 2011, bezogen auf das Jahr 2010, eine Befragung der Natur-
Pflanzenschutzamt Berlin Problemanalyse zu Berliner Stadtbäumen Fragebogenauswertung Stadtgrün 2010 Einleitung Das Pflanzenschutzamt Berlin führte 2011, bezogen auf das Jahr 2010, eine Befragung der Natur-
Klimadaten für Münsingen-Rietheim 2005
 Klimadaten für Münsingen-Rietheim Jahresdaten Zusammenfassung Mittlere Temperatur (Normal ca. 6,9 C) 7,7 C Höchsttemperatur 32,3 C Tiefsttemperatur -17,7 C Mittlere relative Luftfeuchte 81 % Höchste relative
Klimadaten für Münsingen-Rietheim Jahresdaten Zusammenfassung Mittlere Temperatur (Normal ca. 6,9 C) 7,7 C Höchsttemperatur 32,3 C Tiefsttemperatur -17,7 C Mittlere relative Luftfeuchte 81 % Höchste relative
Südtirol Kalenderjahr Jänner bis 31. Dezember
 Südtirol Kalenderjahr 215 1. Jänner bis 31. Dezember Entwicklung der Ankünfte Jahre 211-215 7 6 5 4 3 5854558 645118 641581 614289 6495949 2 1 211 212 213 214 215 Entwicklung der Übernachtungen Jahre 211-215
Südtirol Kalenderjahr 215 1. Jänner bis 31. Dezember Entwicklung der Ankünfte Jahre 211-215 7 6 5 4 3 5854558 645118 641581 614289 6495949 2 1 211 212 213 214 215 Entwicklung der Übernachtungen Jahre 211-215
Ergebnisse der Stichproben-Messprogramms Rothenburgsort
 Ergebnisse der Stichproben-Messprogramms Rothenburgsort Vom 15.5.2000 bis zum 7.11.2001 wurden mit dem Messfahrzeug der Behörde für Umwelt und Gesundheit Luftschadstoffmessungen im Gebiet Rothenburgsort
Ergebnisse der Stichproben-Messprogramms Rothenburgsort Vom 15.5.2000 bis zum 7.11.2001 wurden mit dem Messfahrzeug der Behörde für Umwelt und Gesundheit Luftschadstoffmessungen im Gebiet Rothenburgsort
Frostresistenz von Nordmannstannen
 Die Ergebnisse kurzgefasst Spätfröste bis -1 C verursachen bei jungen Trieben der Nordmannstanne noch keine Schäden. Etwa 40% der Pflanzen werden bei -2C ohne Luftbewegung geschädigt. Bei -2 C und Windbewegung
Die Ergebnisse kurzgefasst Spätfröste bis -1 C verursachen bei jungen Trieben der Nordmannstanne noch keine Schäden. Etwa 40% der Pflanzen werden bei -2C ohne Luftbewegung geschädigt. Bei -2 C und Windbewegung
Versorgung mit Briefkästen und Paketshops in Deutschland
 Versorgung mit Briefkästen und Paketshops in Deutschland Ein Bericht aus dem Monitoring der Brief- und KEP-Märkte in Deutschland 2 VERSORGUNGSQUALITÄT Den Grad der Servicequalität von Brief- und Paketdienstleistern
Versorgung mit Briefkästen und Paketshops in Deutschland Ein Bericht aus dem Monitoring der Brief- und KEP-Märkte in Deutschland 2 VERSORGUNGSQUALITÄT Den Grad der Servicequalität von Brief- und Paketdienstleistern
Die Landkarte der Angst 2012 bis 2016
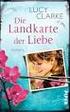 Alle Texte und Grafiken zum Download: www.die-aengste-der-deutschen.de Die Ängste der Deutschen Die Landkarte der Angst 2012 bis 2016 Die Bundesländer im Vergleich 2012 bis 2016 zusammengefasst Von B wie
Alle Texte und Grafiken zum Download: www.die-aengste-der-deutschen.de Die Ängste der Deutschen Die Landkarte der Angst 2012 bis 2016 Die Bundesländer im Vergleich 2012 bis 2016 zusammengefasst Von B wie
1 Einleitung Das Holz der Eberesche Eigenschaften und Aussehen des Holzes Verwendung des Holzes...
 Inhalt: 1 Einleitung... 4 1.1 Die Blätter der Eberesche... 4 1.1.1 Ein Blatt der Eberesche (Zeichnung)... 5 1.1.2 Ein gepresstes Blatt der Eberesche (Mai) mit Beschriftung... 6 1.1.3 Ein gepresstes Blatt
Inhalt: 1 Einleitung... 4 1.1 Die Blätter der Eberesche... 4 1.1.1 Ein Blatt der Eberesche (Zeichnung)... 5 1.1.2 Ein gepresstes Blatt der Eberesche (Mai) mit Beschriftung... 6 1.1.3 Ein gepresstes Blatt
Zentrale Abschlussprüfung 10. Vergleichsarbeit Mathematik (A) Gesamtschule/Gymnasium
 Der Senator für Bildung und Wissenschaft Freie Hansestadt Bremen Zentrale Abschlussprüfung 10 (Gymnasiales Niveau für Gesamtschulen) Vergleichsarbeit 10 2007 Mathematik (A) Gesamtschule/ Teil 2 Taschenrechner
Der Senator für Bildung und Wissenschaft Freie Hansestadt Bremen Zentrale Abschlussprüfung 10 (Gymnasiales Niveau für Gesamtschulen) Vergleichsarbeit 10 2007 Mathematik (A) Gesamtschule/ Teil 2 Taschenrechner
KMU FORSCHUNG AUSTRIA. Austrian Institute for SME Research. Konjunkturbeobachtung. Arbeitskräfteüberlasser OÖ. III. Quartal 2010
 KMU FORSCHUNG AUSTRIA Austrian Institute for SME Research Konjunkturbeobachtung Arbeitskräfteüberlasser OÖ III. Quartal Wien, Dezember KMU FORSCHUNG AUSTRIA Austrian Institute for SME Research Diese Studie
KMU FORSCHUNG AUSTRIA Austrian Institute for SME Research Konjunkturbeobachtung Arbeitskräfteüberlasser OÖ III. Quartal Wien, Dezember KMU FORSCHUNG AUSTRIA Austrian Institute for SME Research Diese Studie
Arbeitsmarkt Münchner Statistik, 2. Quartalsheft, Jahrgang Tabelle und Grafiken: Adriana Kühnl
 Autorin: Adriana Kühnl Tabelle und Grafiken: Adriana Kühnl München hat niedrigste Arbeitslosenquote 2015 unter den zehn größten deutschen Städten Die Münchner Arbeitslosenquoten im Vergleich zu den größten
Autorin: Adriana Kühnl Tabelle und Grafiken: Adriana Kühnl München hat niedrigste Arbeitslosenquote 2015 unter den zehn größten deutschen Städten Die Münchner Arbeitslosenquoten im Vergleich zu den größten
Der Maikäfer. Familie
 Der Maikäfer Ingrid Lorenz Familie Die Maikäfer gehören zur Familie der Blatthornkäfer. Der deutsche Name bezieht sich auf die Gestalt der Fühler, deren letzten Glieder blattförmig verbreiterte Lamellen
Der Maikäfer Ingrid Lorenz Familie Die Maikäfer gehören zur Familie der Blatthornkäfer. Der deutsche Name bezieht sich auf die Gestalt der Fühler, deren letzten Glieder blattförmig verbreiterte Lamellen
Klimawandel in Sachsen
 Klimawandel in Sachsen Informationsveranstaltung am 05.09.2007 Trend der global gemittelten Lufttemperatur 0,8 2005 war wärmstes Jahr seit über einem Jahrhundert US-Raumfahrtorganisation NASA / Referenz
Klimawandel in Sachsen Informationsveranstaltung am 05.09.2007 Trend der global gemittelten Lufttemperatur 0,8 2005 war wärmstes Jahr seit über einem Jahrhundert US-Raumfahrtorganisation NASA / Referenz
Bäume pflanzen in 6 Schritten
 Schritt-für-Schritt- 1 Einleitung Ob Ahorn, Buche, Kastanie, Obstbäume oder exotische Sorten wie Olivenbäume und die Japanische Blütenkirsche lesen Sie in unserem Ratgeber, wie Sie am besten vorgehen,
Schritt-für-Schritt- 1 Einleitung Ob Ahorn, Buche, Kastanie, Obstbäume oder exotische Sorten wie Olivenbäume und die Japanische Blütenkirsche lesen Sie in unserem Ratgeber, wie Sie am besten vorgehen,
Winter 2014/15. Klimabulletin Winter 2014/15. MeteoSchweiz. Milder Winter trotz kaltem Februar
 Winter 2014/15 MeteoSchweiz Klimabulletin Winter 2014/15 10. März 2015 Nach einem sehr milden Dezember im Tessin und im Engadin mit Rekordtemperaturen und einem milden Januar, brachte erst der Februar
Winter 2014/15 MeteoSchweiz Klimabulletin Winter 2014/15 10. März 2015 Nach einem sehr milden Dezember im Tessin und im Engadin mit Rekordtemperaturen und einem milden Januar, brachte erst der Februar
Klimawandel im Offenland und Wald
 Klimawandel im Offenland und Wald Klimawandel Einleitung Deutschland Thüringen und Rhön Ursachen des Klimawandels Ein anthropogener Einfluss wird als gesichert angesehen, da sich der rezente Temperaturanstieg
Klimawandel im Offenland und Wald Klimawandel Einleitung Deutschland Thüringen und Rhön Ursachen des Klimawandels Ein anthropogener Einfluss wird als gesichert angesehen, da sich der rezente Temperaturanstieg
Die Demokratische Republik Kongo
 Aufgabe 1: Die Demokratische Republik (DR) Kongo Du arbeitest für einen großen Verlag und sollst einen kurzen Bericht über die DR Kongo schreiben. Nutze hierzu die Informationen auf der Internetseite Die
Aufgabe 1: Die Demokratische Republik (DR) Kongo Du arbeitest für einen großen Verlag und sollst einen kurzen Bericht über die DR Kongo schreiben. Nutze hierzu die Informationen auf der Internetseite Die
