Click Click! aid-medienshop.de. einfach einkaufen. Medien rund um Landwirtschaft, Lebensmittel und Ernährung
|
|
|
- Hertha Schmid
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Pferdefütterung
2 Medien rund um Landwirtschaft, Lebensmittel und Ernährung Click Click! einfach einkaufen aid-medienshop.de unabhängig praxisorientiert wissenschaftlich fundiert
3 INHALT Begriffe und Abkürzungen... 4 Einleitung... 5 Grundlagen der Verdauung beim Pferd... 7 Geschichtliche Entwicklung...7 Verdauungsphysiologie....9 Nährstoffe....9 Nahrungsaufnahme Verdauungstrakt...14 Empfehlungen zur Versorgung Bewertung von Energie und Eiweiß...19 Erhaltungs- und Leistungsbedarf bei Reitpferden...20 Richtwerte für Zuchtstuten...21 Wachstum der Fohlen und Aufzuchtpferde...22 Richtwerte für die Mineralstoffversorgung...23 Versorgung mit Vitaminen...24 Aufnahme an Futtertrockenmasse...25 Futtermittel Grobfutter (Raufutter) Saftfutter...34 Kraftfutter Mischfutter...41 Wasser...48 Praktische Rationsplanung Futtervorlage und Fütterungstechnik...49 Fütterung von Reitpferden Fütterung der Zuchtstuten und Aufzuchtpferde Fütterung der Ponys und Kleinpferde...62 Fütterung von Hochleistungspferden...62 Fütterung alter Pferde...64 Fütterung auf der Weide...65 Lagerung von Futtermitteln...70 Jahresfutterbedarf...70 Fütterung und Gesundheit Durchfallerkrankungen...72 Koliken...73 Hufrehe Magengeschwüre...76 Atemwegserkrankungen...76 Zahn- und Gebissmängel Neue Tendenzen in der Pferdefütterung Literatur und Links aid-medien
4 BEGRIFFE UND ABKÜRZUNGEN Internationale Einheit (I.E.) Maßeinheit beispielsweise für Vitamine. Sie ist entweder durch Referenzpräparate oder international vereinbarte Standards definiert und wird für eine reproduzierbare Dosierung der Präparate anhand ihrer Wirkung eingesetzt. Elektrolyte Mengenelemente (wie z. B. Natrium, Chlor oder Kalium), die in die Regulation des Wasserhaushaltes eingreifen und mit dem Schweiß ausgeschieden werden. GfE Gesellschaft für Ernährungsphysiologie der Haustiere Güste Stute Gedeckte Stute, die nicht tragend geworden ist. LM Lebendmasse MJ DE Verdauliche Energie in Megajoule Rohasche Besteht aus Mengen- und Spurenelementen und aus unlöslichen Stoffen (z. B. Silikate). Rohfaser Alle schwer löslichen Kohlenhydrate (z. B. Zellulose), aber auch Begleitstoffe der pflanzlichen Gerüstsubstanzen (wie Lignin), die häufig unverdaulich sind und somit wieder ausgeschieden werden. Rohfett Enthält alle ätherlöslichen Substanzen im Futter wie beispielsweise Fette, Fettsäuren, fettlösliche Vitamine, Wachse oder Lipoide. Rohprotein Umfasst neben den Reineiweißen alle stickstoffhaltigen Substanzen nicht eiweißartiger Natur wie beispielsweise Aminosäuren, Peptide und Amide im Futter. TM Trockenmasse: Anteil eines Futtermittels, der nach Trocknung übrig bleibt. Pektin Pflanzlicher Mehrfachzucker aus der Gruppe der löslichen Ballaststoffe, kommt vor allem in den Zellwänden von Pflanzen vor (und übernimmt dort, zusammen mit Zellulose, wichtige Stützfunktionen). 4
5 EINLEITUNG Ob Freizeitreiter oder Profi jeder Pferdehalter wünscht sich fitte und gesunde Pferde. Wie aber sieht eine optimale Fütterung von Pferden aus, damit sie alles für ihr jeweiliges Leistungspensum haben, aber nicht überoder unterversorgt sind? Um diese Frage zu beantworten, muss man sich erst einmal mit den Verdauungsorganen und der Verdauungsphysiologie der Pferde beschäftigen. Sie haben einen Dickdarm, der als große Gärkammer fungiert. Dort verdauen Mikroorganismen rohfaserreiches pflanzliches Futter wie Gras und Heu und sorgen gleichzeitig auch für die notwendigen wasserlöslichen Vitamine. Ein Pferdemagen ist in Relation zum Körpergewicht relativ klein, das liegt an den Vorfahren unserer heutigen Pferde. Ihr Lebensraum war die Steppe und sie verbrachten 16 Stunden am Tag langsam vorwärtsgehend mit der Futteraufnahme. Aus diesem Wissen heraus lassen sich viele Grundregeln der Pferdefütterung ableiten, wie beispielsweise das Füttern mehrerer kleiner Futterportionen am Tag, die Gabe des Raufutters vor dem Kraftfutter oder behutsame Futterumstellungen. In der Praxis ist die Fütterung oft zu sehr getreide- und kraftfutterorientiert und das Raufutterangebot oft knapp bemessen. Und es werden häufig große Futtermengen in nur zwei oder drei Mahlzeiten angeboten. Diese 5
6 Fütterungspraxis und hygienische Mängel des Grobfutters und auch des Krippenfutters können die Gesundheit der Pferde beeinträchtigen. Die Kenntnis über Nährstoffe und deren Funktion im Pferdekörper ist Voraussetzung, um Rationen zu berechnen. Wie werden die in der Pferdefütterung eingesetzten Futtermittel verdaut, welche physiologischen Vorteile haben sie, welche Risiken sind zu beachten und in welchen Höchstmengen können sie eingesetzt werden? Gilt bei Ergänzungsfuttermitteln im Vitamin- und Mineralstoffbereich viel hilft viel? Was ist notwendig, was überflüssig und was sogar schädlich? Der Bedarf und die praktische Rationsgestaltung mit Beispielrationen für Reitpferde, Zuchtstuten, Fohlen und alte Pferde machen einen großen Teil des Heftes aus. Pferde wollen bedarfs- und leistungsgerecht, aber auch individuell gefüttert werden. Eine ausgewogene Futterration soll den Bedarf an Vitaminen, Nähr- und Mineralstoffen abdecken, aber auch durch lange Kauzeiten die Tiere beschäftigen. Fütterungsbedingte Erkrankungen, wie man sie behandelt und viel wichtiger, wie man ihnen vorbeugt, sind ebenso Thema wie Hinweise zur Grobfutterkonservierung und Weidefütterung über die Vegetationszeit. Weitere Tipps zur Fütterungstechnik, Futtervorlage und rund um die Fütterung machen das Heft zu einem unentbehrlichen Ratgeber für jeden Pferdebesitzer und Interessierten. 6
7 GRUNDLAGEN DER VERDAUUNG BEIM PFERD GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG Erste fossile Funde von Pferdeartigen lassen sich auf die Zeit von vor rund 60 Millionen Jahren zurückdatieren. Die Vorfahren des heutigen Pferdes hatten eine Widerristhöhe von 40 bis 50 cm und lebten vorwiegend in den damals verbreiteten Wäldern. Anhand zahlreicher fossiler Funde konnten Rückschlüsse auf Nahrungsgrundlage und Verhalten dieser Tiere geschlossen werden. Die Zahnstrukturen und die Schädelformationen deuten darauf hin, dass Beeren und weiches Laub Hauptnahrungsbestandteile waren. Durch klimatische Veränderungen setzte eine Versteppung der Landschaft ein. Die Futtergrundlage änderte sich von den ehemals weichen und leicht verdaulichen Pflanzenteilen zu hartstängeligen, schwer verdaulichen Gräsern. Aufgrund der spärlichen Futtergrundlage mussten die Tiere ihre Lebensgewohnheiten ändern und wurden so zu Wandertieren, die aufgrund fehlender Versteckmöglichkeiten bei Gefahr fliehen mussten. Diese Entwicklung ging einher mit einer deutlichen Größenzunahme des Schädels und der Zähne, die zudem deutlich an Härte zunahmen, über die Reduktion der vierstrahligen Zehe zum einstrahligen Huf bis hin zu Veränderungen im Verdauungstrakt, der sich auf die neuen Nahrungsbestandteile einstellen musste. 7
8 Nomadische Hirtenvölker im asiatischen Russ land begannen vor etwa Jahren Pferde an menschliche Nähe zu gewöhnen. Doch erst mit zunehmendem Einsatz als Last- und Tragtiere und später auch als Reittiere änderte sich auch die Futtergrundlage und die Fütterungstechnik, da der steigende Energiebedarf durch die ursprünglichen Nahrungsbestandteile nicht mehr gedeckt werden konnte. Der Einsatz von konzentrierten Futtermitteln machte es möglich, dass die Tiere innerhalb kurzer Zeit ihren Nährstoffbedarf aufnehmen konnten und nach kurzer Futterzeit wieder einsatzbereit waren. Besonders in Regionen mit intensiver Pferdehaltung ohne ausreichende Futtergrundlage musste mittels Futterkonservierung haltbar gemachtes Futter aus anderen Regionen herantransportiert werden. So gewannen Pferde im Laufe der Geschichte in vielen Regionen der Erde eine nicht wegzudenkende Bedeutung für die Landwirtschaft, das Transportwesen und das Militär. Der Mensch nutzte Pferde lange Zeit als Fleischlieferanten, Reit-, Last- und Zugtiere sowie als Ackerpferde. Pferde hatten bis vor wenigen Jahrzehnten eine große Bedeutung für die Landwirtschaft. 8
9 GRUNDLAGEN DER VERDAUUNG BEIM PFERD VERDAUUNGSPHYSIOLOGIE Trotz deutlicher Veränderung in der Haltungsform heutiger Pferde im Vergleich zu den frei lebenden Ur- und Wildpferden basiert auch die moderne Pferdefütterung auf rohfaserreichen, strukturierten Futtermitteln (Heu, Silage, Stroh, Weidefutter), die durch konzentrierte Futter (Getreide, Mischfutter) nährstoffseitig ergänzt werden. Dadurch werden die für die Erhaltung der Körpersubstanz, der Gesundheit, Fruchtbarkeit und Leistung notwendigen Nähr- und Wirkstoffe bereitgestellt. Die mit dem Futter aufgenommenen lebenswichtigen, körperaufbauenden oder -erhaltenden Nährstoffe, energiereichen Kraftstoffe und funktionsunterstützende, strukturierte Ballaststoffe (Rohfaser) müssen vom Pferd so verändert werden, dass für den Körper nutzbare Stoffe entstehen und nicht nutzbare Futterreste ausgeschieden werden können. Dies erfolgt durch Kautätigkeit, enzymatische und mikrobielle Aufspaltung und biochemische Umsetzungsprozesse. Die Vorgänge der Verdauungsphysiologie lassen sich in folgende Abläufe unterteilen: 1. Futteraufnahme 2. Zerkleinerung und Aufspaltung 3. Resorption (Aufnahme von Futterinhaltsstoffen über die Darmwand) 4. Ausscheidung NÄHRSTOFFE Nährstoffe sind verschiedene chemische Verbindungen der Nahrung, die von Lebewesen aufgenommen werden und in deren Stoffwechsel verarbeitet werden. Ohne Nährstoffe ist Leben nicht möglich. Die wertbestimmenden Nährstoffe in der Pferdefütterung sind Eiweiße, Kohlenhydrate und Fette. Eiweiße Die Eiweiße (Proteine) sind Baustoffe des Körpers. Aus ihnen werden Muskulatur, Bindegewebe, Organe, Blut und Verdauungssekrete gebildet. Auch Stutenmilch enthält je nach Laktationsmonat bis zu etwa drei Prozent Eiweiß. Ausnahme stellt das kurz nach der Geburt aufgenommene Kolostrum (Biestmilch) dar, das etwa zehn Prozent Rohprotein enthält und die lebensnotwendigen Immuneiweißkörper bereitstellt. Eiweiß setzt sich aus einer Vielzahl von Aminosäuren zusammen, die kettenförmig aneinander gereiht sind. Die unterschiedliche Abfolge (Sequenz) der Aminosäuren und die besondere Struktur der Aminosäurekette charakterisieren die Eiweiße. Einige der zum Aufbau notwendigen Aminosäuren kann der Organismus selber herstellen, andere (essenzielle Aminosäuren) müssen mit der Nahrung aufgenommen werden. Zu den essenziellen Aminosäuren gehören Lysin, Methionin, Trypthophan, Leucin, Isoleucin, Threonin, Valin, Histidin und Phenylalanin. Ist nur eine der essenziellen Aminosäuren nicht ausreichend vorhanden, kann es zu deutlichen Beeinträchtigungen im Aufbau des körpereigenen Eiweißes kommen. Der Hauptresorptionsort des aufgenommenen Eiweißes ist der Dünndarm. Überschüssiges Eiweiß und andere stickstoffhaltige Verbindungen gelangen in den Dickdarm und werden von den dort lebenden Mikroorganismen in Mikrobeneiweiß umgewandelt. Dieses hochwertige Eiweiß steht dem Pferd jedoch nur in sehr begrenztem Maße zur Verfügung und wird größtenteils mit dem Kot ausgeschieden. 9
10 Eine Unterversorgung mit Eiweiß führt besonders bei jungen, wachsenden Pferden zu Gewichtsverlusten, Entwicklungsstörungen und reduziertem Muskelaufbau. In der Praxis sind Unterversorgungslagen jedoch selten zu beobachten. Eine Überversorgung, wie sie häufig durch Aufnahme von jungem Weidegras im Frühjahr auftritt, wird in der Regel bis zum Zwei- bis Dreifachen des Erhaltungsbedarfs toleriert und verursacht bei entsprechender Eingewöhnung kaum gesundheitliche Probleme. Überschüssiges Eiweiß wird vor allem als Energielieferant genutzt. Die bei der Umwandlung entstehenden Abbauprodukte müssen über Leber und Niere verstoffwechselt werden, was zu einer zusätzlichen Belastung führt. Kohlenhydrate Kohlenhydrate sind wichtige Energielieferanten für Pferde. Besondere Bedeutung hat diesbezüglich Stärke als wichtiger Bestandteil vieler Krippenfuttermittel wie Hafer (40 %), Gerste (60 %) und Mais (65 %). Darüber hinaus sind sie Bestandteile von Struktur- und Rohfasern und somit besonders wichtig zur Befriedigung der Kauaktivität. Diese schwer verdaulichen Kohlenhydrate werden überwiegend im Dickdarm abgebaut und dienen den dort lebenden Mikroorganismen als Nahrungsbestandteil. Kohlenhydrate sind aus verschiedenen Zuckermolekülen aufgebaut. Je nach Anzahl der Zuckermoleküle wird zwischen Monosacchariden (Einfachzucker), Disacchariden (Zweifachzucker) und Polysacchariden (Mehrfachzucker) unterschieden. Für die praktische Pferdefütterung sind besonders die Polysaccharide von Bedeutung. Zu ihnen zählen Der erste Grasaufwuchs ist besonders eiweiß- und energiereich. 10
11 GRUNDLAGEN DER VERDAUUNG BEIM PFERD Die Darmbakterien verfügen über Enzyme, um Zellulose aus Heu aufzuspalten und zur Energiegewinnung zu nutzen. unter anderem Stärke (Reservestoff pflanzlicher Zellen) und Zellulose (Strukturbestandteil pflanzlicher Zellwände). Pferde haben für den Abbau von Kohlenhydraten eine relativ geringe Enzymausstattung (Amylase). So enthält der Speichel keine stärkeabbauenden Enzyme und auch im Dünndarm ist nur eine geringe Aktivität zu verzeichnen. Deshalb können eine Überversorgung mit Stärke und auch der Einsatz enzymatisch schwer verdaulicher Stärke zu erheblichen Verdauungsstörungen führen. Während Stärke hauptsächlich von körpereigenen Verdauungsenzymen in Einfachzucker zerlegt und somit für die weitere Verdauung nutzbar gemacht werden kann, ist der Abbau der Zellulose nur durch die Enzyme der Bakterien, die vor allem im Dickdarm leben, möglich. Andere auch durch die Mikroorganismen nicht aufschließbaren Gerüstsubstanzen werden mit dem Kot ausgeschieden. Zu beachten ist eine hohe, vor dem Dickdarm stattfindende Stärkeverdauung. Überschüssige Stärkeanteile werden in den Dickdarm eingespült. Dort werden sie zwar von den Mikroben verstoffwechselt, die Gefahr von Fehlgärungen, die zu Kolikerscheinungen führen können, steigt jedoch massiv an. Für die praktische Pferdefütterung ist zu beachten, dass Futtermittel mit einer hohen präzäkalen (vor dem Blinddarm stattfindenden) Stärkeverdauung eingesetzt werden. Besonders Mais und Gerste sollten aufgrund der sehr geringen präzäkalen Stärkeverdauung nur vorbehandelt verfüttert werden. Die Stärkeverdaulichkeit beim Mischfutter für Pferde ist durch die Aufbereitung in der Regel ausreichend gewährleistet. Neben der Art der Stärke ist auch die Menge wichtig, da die Resorptionsrate im Dünndarm beschränkt ist. Eine Obergrenze von maximal 1 g Stärke pro kg Körpergewicht und Mahlzeit sollte nicht überschritten werden, um Gesundheitsstörungen zu vermeiden. Die Gesamtkraftfuttermenge sollte auch bei Hochleistungspferden möglichst auf maximal 1 kg pro 100 kg Körpermasse und Tag begrenzt werden. Unter ungünstigen Bedingungen können bereits geringere Stärkemengen Stoffwechselerkrankungen verursachen. 11
12 Fette Die Fette, aufgebaut aus Glycerin und Fettsäuren, dienen in der Futterration des Pferdes ebenfalls als Energieträger. Darüber hinaus sind sie Lieferant essenzieller Fettsäuren, die der Organismus für verschiedene Aufgaben benötigt. Obwohl das Pferd keine Gallenblase hat, kann es nicht unerhebliche Mengen an Fett verdauen. Die für die Fettverdauung notwendige Gallenflüssigkeit wird kontinuierlich aus der Leber in den Darm abgesondert. Ein Großteil der Fette wird nach der enzymatischen Zerlegung über die Dünndarmschleimhaut aufgenommen. Aber auch über die Dickdarmschleimhaut können noch Fettsäuren resorbiert werden. Die Gefahr von Verdauungsstörungen bei übermäßigem Einsatz von stärkereichen Futtermitteln kann durch Ölzugabe bei gleichzeitiger Reduktion der Stärketräger reduziert werden, zumal der Energiegehalt von Fetten deutlich höher ist als der von Kohlenhydraten. Die Aufnahme von fettlöslichen Vitaminen wird ebenfalls positiv beeinflusst. Besonders bei Hochleistungspferden eignet sich der Öleinsatz als zusätzlicher Energielieferant. Eine Obergrenze ist bei etwa ein Gramm Öl pro Kilogramm Körpergewicht und Tag anzusetzen. Übermäßige Fettzufuhr kann die Magenentleerung stören und die mikrobielle Aktivität hemmen. Neben Soja-, Sonnenblumen- und Rapsöl sind Lein- und Mariendistelöl empfehlenswert. Mineralstoffe Neben den Hautnährstoffen gehören Mineralstoffe (Mengenelemente und Spurenelemente) zu den bedeutenden Nahrungsbausteinen. Sie können vom Körper nicht selber hergestellt werden und müssen von außen zugeführt werden. Sie haben wichtige Funktionen als Baustoffe beispielsweise für das Skelett und im funktionellen Regelkreis des Organismus. Zu unterscheiden sind zwischen den in Gramm angegebenen Mengenelementen wie Kalzium, Phosphor, Kalium, Natrium, Chlor und Magnesium und den in Milligramm oder Mikrogramm angegebenen Spurenelementen wie Eisen, Kupfer, Kobalt, Zink, Mangan, Jod und Selen. Der Zusatz von Öl im Futter eignet sich als Energielieferant für Pferde, die viel leisten müssen wie dieses Rückepferd bei der Holzernte. 12
13 GRUNDLAGEN DER VERDAUUNG BEIM PFERD Tabelle 1: Aufgaben von Mengenelementen Name Aufgabe im Organismus Hinweise für die Praxis Kalzium Phosphor Magnesium Natrium/Chlor Baustein des Skeletts, Mitwirkung an Reizübertragung, Energiestoffwechsel, Blutgerinnung Baustein des Skeletts, Mitwirkung an Reizübertragung, Energiestoffwechsel, Blutgerinnung Bestandteil von Knochen und Zähnen, Nervenund Muskelfunktionen Regulierung Wasserhaushalt und Säure-Basen- Haushalt, Osmose, Reizleitung Mangel bei Hafer-/Heurationen ohne Mineralstoffergänzungen möglich, Vorkommen u. a. in Klee- oder Luzerneheu u. a. in Kleie enthalten u. a. in Getreide, Kleie, Klee- oder Luzerneheu enthalten Mangelsituation häufig bei starker Belastung mit Schweißverlusten; Lecksteine können vorbeugen Kalium Osmose, Reizleitung, Enzymaktivität Überschuss durch übermäßig gedüngte Weiden bei häufigem Weidegang möglich Vitamine Die als Wirkstoffe des Lebens bezeichneten Vitamine wirken bereits in sehr geringen Konzentrationen und regeln viele Stoffwechselvorgänge im Körper. Sie steuern Wachstum und Entwicklung und sind für Gesundheit und Fruchtbarkeit unverzichtbar. Der Bedarf des Pferdes hängt von Nutzungsrichtung, Alter und Gesundheitsstatus ab. Die Versorgungslage wird durch den Gehalt des Futters bestimmt, der im Sommer bei ausreichendem Weidegang bedarfsdeckend gewährleistet wird. Darüber hinaus haben die Dickdarmbakterien Einfluss auf die Vitaminversorgung. Während die fettlöslichen Vitamine A, D und E und ihre Vorstufen in ausreichenden Mengen über das Futter aufgenommen werden müssen, werden Vitamin K sowie die wasserlöslichen Vitamine in größerem Maße durch die Mikroorganismen im Darm produziert. Bei Verdauungsstörungen kann es dadurch auch zu Engpässen in der Vitaminversorgung kommen. NAHRUNGSAUFNAHME Die pferdegerechte Fütterung wird neben den Anforderungen an die Nährstoffausstattung der Futtermittel durch die Besonderheiten des Verdauungstraktes des Pferdes bestimmt. Der Verdauungsapparat hat sich im Laufe der Entwicklung vom früher freilebenden Steppenpferd, das sich vorwiegend von hartstängeligem Gras ernährt hat, zum heute in Stallhaltung lebenden Pferd, das kraftfutterreich versorgt wird, nur gering verändert. Pferde gehören auch heute noch zu den sogenannten Dauerfressern, die ständig kleine Futtermengen aufnehmen und durch die gut entwickelte Darmflora in der Lage sind, rohfaserreiche Materialien zu verdauen. Darauf muss die Rationsplanung Rücksicht nehmen. Grundlage muss eine ausreichende Raufutterversorgung sein und die Möglichkeit, über den Tag verteilt kleine Futtermengen aufzunehmen. Ähnlich wie beim Menschen wird die Nahrungsaufnahme in Aufnahme und Aufnahmepausen unterteilt. Bei freilebenden Pferden wurden selten Futterpausen von mehr als vier Stunden beobachtet. Einflüsse 13
14 auf das Appetitzentrum im Gehirn, das die Nahrungsaufnahme steuert, sind vermutlich Faktoren wie die gesteigerte Wärmeerzeugung nach der Nahrungsaufnahme, der Blutzuckergehalt, die Konzentration an flüchtigen Fettsäuren und die Anzahl an Kau- und Schluckbewegungen. Dehnung und Füllung des Magen-Darm-Traktes scheinen nur wenig Einfluss auf die Futteraufnahme auszuüben. Dehnungsrezeptoren in der Magenwand, die eine überhöhte Magenfüllung verhindern, fehlen dem Pferd. Außerdem haben der Tag- Nacht-Rhythmus, die Umgebungstemperatur, der Wasserhaushalt des Körpers und mögliche Mangelsituationen (z. B. Mineralstoffmangel) einen direkten Einfluss auf das Nahrungsaufnahmeverhalten. Die innere Uhr des Pferdes funktioniert häufig sehr genau. Besonders der morgendliche Fütterungszeitpunkt wird häufig durch Wiehern und Scharren angezeigt. VERDAUUNGSTRAKT Der Verdauungstrakt des Pferdes gliedert sich in Kopfdarm, Vorderdarm (Schlund, Magen), Dünndarm (Zwölffingerdarm, Leerdarm, Hüftdarm) und Dickdarm (Blinddarm, Grimmdarm, Mastdarm). Kopfdarm Als Kopfdarm wird der Bereich von Maulhöhle und Schlund bezeichnet. Ausgestattet mit einem sehr guten Geruchssinn und beweglichen Lippen, ist das Pferd in der Lage, selektiv zu fressen und zwischen schmackhaften und nährstoffreichen Pflanzen und weniger attraktiven oder giftigen Pflanzen zu unterscheiden. Ausfälle bei Pferden durch Aufnahme von Giftpflanzen treten aber auf und zeigen, dass der natürliche Instinkt zur Vermeidung von Pferde sind in der Lage, selektiv zu fressen. 14
15 Der Verdauungstrakt des Pferdes Magen Dünndarm (16 bis 24 m) Blinddarm (1 m) Kleiner Grimmdarm Mastdarm (0,2 bis 0,3 m) Maulhöhle Schlund Großer Grimmdarm (Gesamtlänge des Grimmdarms 6 bis 8 m) Dickdarm (7 bis 9 m) Giftpflanzen bei einigen Pferden verloren gegangen ist. Die Futteraufnahme erfolgt durch Lippen und Zunge und beim Grasen oder Fressen fester Stoffe werden die Schneidezähne zusätzlich eingesetzt. Die Backenzähne zermahlen das Futter und bereiten die Nahrungsbestandteile für die weitergehende Verdauung vor. Entsprechend der Futterstruktur dauert die Futteraufnahme unterschiedlich lange (1 kg Krippenfutter etwa 10 Minuten, 1 kg Raufutter 40 bis 50 Minuten). Wichtig für die Futteraufnahme und Zerkleinerung des Futters ist ein intaktes Gebiss ohne Zahnanomalien. Eine regelmäßige tierärztliche Zahnkontrolle (mindestens einmal im Jahr) ist daher zu empfehlen. Während der Kautätigkeit wird Speichel in der Ohrspeicheldrüse gebildet und mit dem Futter vermischt. Dadurch wird der Futterbrei gleitfähig und Futter wird mit Lippen und Zunge aufgenommen, beim Grasen werden auch die Schneidezähne gebraucht. 15
16 eingeweicht, die Verdauungssäfte können ihn leichter durchdringen. Je intensiver das Pferd kaut, desto mehr Speichel wird gebildet (bei Raufutter etwa drei bis fünf Liter pro kg Raufutter, bei Krippenfutter etwa 1 bis 1,5 Liter pro kg Krippenfutter). Neben einer deutlich besseren Gleitfähigkeit des Futterbissens bei der Raufutteraufnahme ist das Pferd auch wesentlich länger beschäftigt, was Langeweile vorbeugt. Etwa alle 30 Sekunden werden 50 bis 70 Gramm schwere Futterbissen abgeschluckt, die bis zu 30 Sekunden vor dem Mageneingang liegen bleiben. Bei sehr quellfähigen Komponenten (z. B. nicht eingeweichte Zuckerrübenschnitzel) kann es durch Einfluss des Speichels zum Aufquellen kommen. Der Futterbissen kann nicht in den Magen rutschen und verursacht so eine Schlundverstopfung, die umgehend tierärztlich behandelt werden muss. Auch eine zu hastige Futteraufnahme kann dazu führen, dass zwei oder mehr Bissen vor dem Mageneingang aufeinandertreffen, verklumpen und somit eine Schlundverstopfung auslösen können. Intensives Kauen und langsame Futteraufnahme kann unter anderem durch Zugabe von Häcksel zum Kraftfutter gewährleistet werden. Die in die Magenwand einmündende Speiseröhre verfügt über einen Schließmuskel, der sich, je nach Füllungsdruck des Magens, zusammenzieht. Dadurch ist ein Erbrechen des Futterbreis nahezu unmöglich. Pferde sollten über den Tag verteilt ausreichend Raufutter angeboten bekommen. Aus verdauungsphysiologischer Sicht sollte zunächst Raufutter und anschließend Kraftfutter zugeteilt werden. Verläuft die Fütterung ruhig und geregelt, sinkt auch das Kolikrisiko. 16
17 GRUNDLAGEN DER VERDAUUNG BEIM PFERD Magen Der Magen verfügt über ein im Verhältnis zur Körpergröße sehr geringes Fassungsvermögen von etwa 15 bis 20 Litern. Je besser das Futter eingesaftet wird, desto schneller wird es in den Magenabteilungen weitertransportiert. Nach Aufnahme größerer Mengen Krippenfutter ist der Magen aufgrund geringerer Kautätigkeit verbunden mit einer geringeren Durchsaftung und dadurch verursacht langsameren Entleerung stärker gefüllt als bei Aufnahme von Raufutter. Außerdem können die Verdauungssäfte und die Magensäure den Futterbrei schlechter durchdringen und so schädliche Keime nur unzureichend abtöten. Überdehnungen der Magenwand und Kolikerscheinungen können die Folge sein. Die Futterzuteilung sollte zuerst das Füttern des Raufutters und danach die Kraftfuttergabe vorsehen. Die Kraftfuttermenge sollte 0,4 kg pro 100 kg Lebendmasse und Mahlzeit nicht übersteigen. Die im Magen gebildete Salzsäure (Magensäure) aktiviert die eiweißspaltenden Enzyme und setzt so die Eiweißverdauung in Gang. Dünndarm Im rund 20 Meter langen Dünndarm findet die Verdauung der leicht verdaulichen Anteile der Nahrung statt. Neben den Proteinen werden Fette und leicht lösliche Kohlenhydrate aufgeschlossen. Die Schleimhaut des Dünndarms ist mit zahlreichen Zotten (fingerförmige Erhebungen der Dünndarmschleimhaut) ausgestattet; damit wird die Oberfläche deutlich vergrößert. Die Schleimhaut enthält zahlreiche Drüsen, die Darmsaft produzieren. Mit dem in den Dünndarm einmündenden Sekret der Bauchspeicheldrüse enthält der Darmsaft Verdauungsenzyme, die für die Aufspaltung der Hauptnährstoffe verantwortlich sind. Die Enzymaktivität zur Stärkeverdauung ist beim Pferd relativ gering. Daher ist es wichtig, Beim Pferd als Steppenbewohner ist die Enzymaktivität zur Stärkeverdauung relativ gering ausgeprägt. 17
18 leicht verdauliche Stärketräger in der Fütterung einzusetzen. Haferstärke ist zu etwa 80 Prozent im Dünndarm verdaulich, Gerstenstärke nur zu etwa 25 Prozent und Maisstärke zu weniger als 30 Prozent. Nicht im Dünndarm verdaute Stärke strömt in den Dickdarm ein und wird dort durch die Bakterienflora abgebaut. Durch die dabei frei werdende Milchsäure kommt es zu einem deutlichen Abfall des ph-wertes und dadurch sind Fehlgärungen möglich. Dickdarm Der Blinddarm als erster Abschnitt des Dickdarms ist die sogenannte Gärkammer des Pferdes. Eine vielschichtige Mikroflora ermöglicht eine effektive Verdauungsleistung und versetzt das Pferd in die Lage, rohfaserreiche Futtermittel zu verwerten. Zusätzlich produzieren sie wasserlösliche Vitamine, die das Pferd nahezu unabhängig von einer Zufuhr von außen machen. Die Aktivität im Blinddarm und dem daran anschließenden Grimmdarm ist vergleichbar mit den Vorgängen in den Vormägen der Wiederkäuer. Da die Vormägen der Wiederkäuer im Gegensatz zum Blind- und Grimmdarm des Pferdes dem Dünndarm als wichtigem Organ der Nährstoffaufnahme vorgeschaltet sind, ist die Effektivität der Verdauungsleistung der Wiederkäuer deutlich höher als beim Pferd. Die Mikroben im Blind- und Grimmdarm zersetzen die Überreste des Nahrungsbreies aus dem Dünndarm und die schwer löslichen pflanzlichen Gerüstsubstanzen Cellulose, Hemicellulose und Pektine. Die Abbauprodukte dieser Kohlenhydrate sind flüchtige Fettsäuen, die über die Darmschleimhaut aufgenommen werden. Beim Durchfließen des Dickdarms wird der Verdauungsbrei allmählich eingedickt. Bei Aufnahme rohfaserreicher Futtermittel werden entsprechend deutlich mehr Wasser und Elektrolyte gespeichert als bei kraftfutterreicher Fütterung, die beim Eindickungsprozess wieder freigesetzt werden. Der Dickdarm ist bei entsprechend raufutterreicher Fütterung ein wichtiger Wasser- und Elektrolytspeicher. Das ist besonders bei ausdauerleistenden Pferden (z. B. Distanzpferde) in der Fütterung zu beachten. Im hinteren Teil des Dickdarms, dem kleinen Kolon und dem Mastdarm, setzt neben dem Wasserentzug in den Aussackungen der Dickdarmwand die Kotballenformung ein. Anschließend werden alle Nahrungsbestandteile, die nicht absorbiert wurden, als Kot abgesetzt. Die feste und leicht feuchte Ballenformung ist abhängig von Futtergrundlage, Aktivität und Stress des Tieres. 18
19 EMPFEHLUNGEN ZUR VERSORGUNG Die verbindlichen Empfehlungen zur Energieund Nährstoffversorgung der Pferde wurden 1994 von der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie zusammengestellt und veröffentlicht. Sie gelten bis heute, befinden sich allerdings aktuell in grundlegender Überarbeitung. Bei den Neuerungen geht es hauptsächlich um die Bewertung und Versorgung bezüglich Eiweiß und Energie (siehe Kapitel Neue Tendenzen in der Pferdefütterung Seite 78). Auch zukünftig wird die Fütterung mit dem Auge des Herrn gerade in der Pferdehaltung wichtig sein, denn individuelle Unterschiede hinsichtlich des Nährstoffbedarfs in Abhängigkeit von Rasse, Alter, Gewicht, Leistung, Umwelt und Futterqualität sind bei Pferden besonders stark ausgeprägt. BEWERTUNG VON ENERGIE UND EIWEISS Bestimmungsgröße für die Energiebewertung von Futtermitteln und den Energiebedarf des Pferdes ist die Verdauliche Energie (abgekürzt DE = Digestible Energy). Sie ergibt sich aus der Brutto-Energie, also dem Brennwert des jeweiligen Futtermittels, abzüglich der Energie, die im Kot des Pferdes gemessen wird. Die Energieangabe erfolgt 19
20 in Megajoule (MJ), wobei 4,184 Joule dem Energiewert einer Kalorie entsprechen. Ein kg Hafer enthält beispielsweise 12,15 MJ DE. Der Energiegehalt von Futtermitteln lässt sich anhand einer von der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie der Haustiere (GfE) in 2003 veröffentlichten Schätzformel ermitteln: Mischfutterdeklarationen (Kennzeichnung von Mischfuttermitteln) ermitteln. Der Bedarf an Eiweiß wird derzeit als verdauliches Rohprotein angegeben. Die Mengenanforderungen sind relativ gering und der Erhaltungsbedarf wird oft bereits mit der Raufuttergabe abgedeckt. Verdauliche Energie (MJ DE je kg Trockenmasse) = 3,54 + 0,0209 x g Rohprotein + 0,0420 x g Rohfett + 0,0001 x g Rohfaser + 0,0185 x g N-freie Extraktstoffe Diese Formel wird zur Schätzung der verdaulichen Energie von Einzelfuttermitteln, Mischfuttermitteln und Gesamtrationen verwendet. Die Formel basiert auf den Rohnährstoffgehalten eines Futtermittels oder einer Ration. Diese lassen sich über Futteranalysen, Futterwerttabellen oder ERHALTUNGS- UND LEISTUNGS- BEDARF BEI REITPFERDEN Der Nährstoffbedarf von Pferden setzt sich wie bei anderen Nutztieren aus Erhaltungsund Leistungsbedarf zusammen. Stoffwechselleistungen für die Erhaltung beziehen sich auf die Körperfunktionen wie Kreislauf, Atmung, Futteraufnahme und Verdauung. Der Leistungsbedarf ergibt sich aus Muskelarbeit wie Reiten, Springen, Laufen, Ziehen sowie Trächtigkeit und Milchleistung. Unter üblichen Klimabedingungen benötigen Pferde für den Erhaltungsstoffwechsel rund 0,6 (0,55 Der Leistungsbedarf eines Reitpferdes ergibt sich aus der Addition seines Erhaltungsbedarfes mit seinem Leistungsbedarf. 20
21 EMPFEHLUNGEN ZUR VERSORGUNG bis 0,63) MJ DE je kg metabolischer Körpermasse. Hierunter versteht man die zugrunde gelegte Dreiviertel-Potenz der Lebendmasse (= LM 0,75 ). Ein 600 kg schweres Reitpferd benötigt demnach für die tägliche Erhaltung 73 MJ DE (= 600 kg LM 0,75 x 0,6 MJ DE). Bei richtiger Einschätzung des Körpergewichtes und Anwendung eines Taschenrechners lässt sich der Erhaltungsbedarf so relativ einfach ermitteln. An verdaulichem Eiweiß benötigen Pferde 3 g je kg metabolischer Körpermasse und Tag für den Erhaltungsstoffwechsel. Demnach benötigt ein Pferd mit 600 kg Lebendmasse rund 365 g verdauliches Eiweiß (= 600 kg LM 0,75 x 3 g) pro Tag. Für ein 350 kg schweres Pony errechnen sich 49 MJ DE und 243 g verdauliches Eiweiß als Erhaltungsbedarf pro Tag. Kleinpferderassen (z. B. Islandpferd, Fjordpferd) haben einen um etwa zehn Prozent geringeren Energiebedarf im Erhaltungsstoffwechsel. Sport- und Arbeitspferde benötigen zusätzlich zum Erhaltungsbedarf Energie und Eiweiß als Leistungsbedarf für ihre Muskeltätigkeit. Dabei spielen Dauer und Bewegungsintensität der Belastung eine entscheidende Rolle. Für 20 Minuten Schritt-, 25 Minuten Trabund 15 Minuten Galopparbeit entsteht beispielsweise ein rechnerischer Leistungsbedarf von 21,3 MJ DE, was dem Energiegehalt von 1,75 kg Hafer entspricht. Unter Hinzurechnung des Erhaltungsbedarfes von 73 MJ DE wäre der Tagesenergiebedarf dieses Reitpferdes mit 94,3 MJ DE gedeckt. Auch der Eiweißbedarf erhöht sich in Abhängigkeit von der Arbeitsleistung. Für Sportpferde kalkuliert man einen Bedarf von rund 5 g verdaulichem Rohprotein zu 1 MJ DE, woraus sich ein Protein-Energie-Quotient (abgekürzt = PEQ) von 5 : 1 ergibt. Dabei definiert man für leichte Arbeit einen Energiebedarf, der bis zu 25 Prozent, für mittlere Arbeit etwa zwischen 25 und 50 Prozent und für schwere Arbeit etwa zwischen 50 und 100 Prozent über dem energetischen Erhaltungsbedarf liegt. RICHTWERTE FÜR ZUCHTSTUTEN Der zusätzliche Energie- und Nährstoffbedarf tragender Stuten ist etwa mit Beginn des achten Trächtigkeitsmonats zu berücksichtigen. Erst ab diesem Zeitpunkt ist von einem verstärkten Wachstum von Fötus, Uterus und Gesäuge auszugehen. Üblicherweise sollten tragende Stuten bis zum Ende der Trächtigkeit mindestens 18 Prozent ihres Körpergewichtes zulegen. Im letzten Trächtigkeitsmonat kann sogar mit täglichen Zunahmen zwischen 500 und g gerechnet werden. Mit zunehmender Trächtigkeitsdauer steigt der Bedarf an verdaulichem Eiweiß im Verhältnis zur verdaulichen Energie an. Der Protein-Energie-Quotient verändert sich von 5 : 1 zu Beginn auf etwa 6,5 : 1 am Ende der Tragezeit. In der Laktation verändern sich diese Werte. Entsprechend ihrer Milchleistung benötigen laktierende Stuten zusätzliche Mengen an Eiweiß und Energie. Zu Beginn der Laktation sollten mindestens 9 g verdauliches Eiweiß je 1 MJ DE zugeführt werden. Aber nicht die Eiweißmenge allein ist ausschlaggebend für die Milchleistung, sondern auch die Proteinqualität des Futters. Das Futtereiweiß sollte aus möglichst hohen Anteilen präzäkal (vor dem Blinddarm) verdaulicher Aminosäuren bestehen. In der Hochlaktation sind deshalb 21
22 Mit Beginn des achten Trächtigkeitsmonats ist der zusätzliche Energieund Nährstoffbedarf zu berücksichtigen. Neben einer ausgeglichenen Fütterung ist bei Fohlen auch auf ausreichend Auslauf und Bewegung zu achten. hochwertige Eiweißträger wie beispielsweise Sojaextraktionsschrot oder spezielle Zuchtstutenfutter vorzusehen. Lysin ist die essenzielle Aminosäure, die bei den üblichen Pferderationen als erste in Mangel gerät (erstlimitierend). In der Futterration werden mindestens 0,5 g Lysin je 1 MJ DE gefordert. Hafer enthält beispielsweise nur 0,4, Gerste nur 0,29 g Lysin je MJ DE, Sojaextraktionsschrot hingegen 2,2 g Lysin je MJ DE. Bei guter und reichlicher Weide ist von einer ausreichenden Versorgung mit den wichtigsten Aminosäuren auszugehen. WACHSTUM DER FOHLEN UND AUFZUCHTPFERDE Spätere Nutzungsdauer und Leistungsfähigkeit der Fohlen und Jungpferde hängen stark von der Aufzuchtintensität ab. Eine extensive Eiweiß-Energieversorgung verzögert die Entwicklung und die Zucht- oder Sportnutzung erfolgen später. Eine intensivere Fütterung ermöglicht eine frühere Nutzung der Pferde, birgt aber auch Risiken bezüglich der Skelett- und Fundamententwicklung. Wenn das Wachstum von Körpergewebe und Knochen nicht parallel verläuft, leiden so getriebene Fohlen unter ihrem zu hohen Eigengewicht. Neben jederzeit ausreichend Auslauf und Bewegung sollten das Energie- und Nährstoffangebot in der gesamten Aufzuchtphase dem jeweiligen Bedarf angepasst werden. Bereits nach zwei Lebensmonaten erreichen Fohlen 25 bis 30 Prozent 22
23 EMPFEHLUNGEN ZUR VERSORGUNG ihres späteren Lebendgewichtes, nach sechs Monaten bereits bis zu 50 Prozent. In der Widerristhöhe erreichen Jährlinge oft über 90 Prozent ausgewachsener Pferde. Im zweiten Aufzuchtjahr verringern sich Zunahme und Wachstum entsprechend. Ausgewachsen sind Pferde in der Regel mit etwa sechs Jahren. Das rasche Wachstum im ersten Lebensjahr stellt hohe Anforderungen an die Proteinversorgung. Es sind mindestens 8 bis 9 g verdauliches Eiweiß je 1 MJ DE vorzusehen. Stutenmilch weist in den ersten Laktationswochen beispielsweise zwischen 1,4 und 0,8 g Lysin je MJ DE auf. Später reichen 6 g verdauliches Eiweiß je 1 MJ DE. Auf die Eiweißqualität des Futters ist besonders zu achten: Für Absetzer sind mindestens 0,55 bis 0,60, für Jährlinge 0,45 g Lysin je MJ DE anzusetzen. Je nach Grundfutterangebot sind geeignete Eiweißkomponenten oder spezielle Fohlenaufzuchtfutter zu ergänzen. Bekanntestes Beispiel ist das anzustrebende optimale Ca : P-Verhältnis von 2 : 1 in der Futterration. Längerfristiger Kalzium-Mangel und Phosphor-Überschuss können beispielsweise Störungen in der Skelettentwicklung in Form einer Knochenentkalkung verursachen. Bei üblichen Heu-Hafer-Rationen ist die Kalzium-Versorgung der Pferde oft nicht gesichert, jedoch bei der Verwendung von Leguminosenheu (z. B. Luzerne). Besonders phosphorreich sind Getreide (z. B. Hafer, Gers te), Getreidenachprodukte (z. B. Kleie) und vor allem Bierhefe. Reichlich Kalzium enthalten Komponenten wie Grünmehle, melassierte Trockenschnitzel, Leinsamen, Sojaschrot und Luzerneheu. Die Empfehlungen für die Mineralstoffversorgung sind abhängig von Alter, Gewicht und Leistung des Pferdes. Bei tragenden RICHTWERTE FÜR DIE MINERALSTOFFVERSORGUNG Jeder Mineralstoff hat eigene Körperfunktionen zu erfüllen. Letztlich optimal wirksam werden sie aber erst im Zusammenspiel miteinander. So bestehen zwischen einzelnen Elementen teils enge Wechselwirkungen. Für den Stoffwechsel positive Wechselwirkungen sind nur zu erwarten, wenn das Mineralstoffangebot ausgewogen ist und stets dem Bedarf des Pferdes angepasst wird. Sowohl Mängel als auch Überschüsse einzelner Mineralstoffe können zu Beeinträchtigungen in der Verwertung anderer Mineralstoffe führen. Das Angebotsspektrum von Ergänzungsfutter für Pferde ist breit. Unterschieden wird dabei zwischen Mineralfutter und Futter zur Energie- und Eiweißversorgung. 23
24 Stuten steigt der Kalzium-Phosphor-Bedarf besonders im letzten Drittel der Trächtigkeit stark an, resultierend aus dem steigenden Bedarf für die Skelettmineralisierung des im Mutterleib wachsenden Fohlens. Auch laktierende Stuten haben einen stark erhöhten Kalzium-Phosphor-Bedarf: Mit jedem Liter Stutenmilch werden etwa 1 g Kalzium und 0,6 g Phosphor abgegeben. Für eine gesunde Entwicklung der Fohlen sind diese Mengen unerlässlich, zumal gerade die stark wachsenden jungen Fohlen sehr viel Kalzium und Phosphor zum Knochenaufbau benötigen. In den ersten sechs Lebensmonaten liegt dieser tägliche Bedarf sogar über dem von schwer arbeitenden, ausgewachsenen Großpferden. Unter großer Beanspruchung stehende Reitpferde sind besonders auf Ergänzungen von Natrium, Kalium und Chlor angewiesen, denn diese Elemente werden vermehrt über den Schweiß abgegeben. Bereits bei leichter täglicher Arbeit verliert ein Großpferd im Mittel 4 bis 5 Liter Schweiß, bei hohen Außentemperaturen auch deutlich mehr, und damit etwa 10 bis 15 g Natrium, 6 bis 9 g Kalium und 20 bis 25 g Chlor. Derartige Mengen sind nur über zusätzliche Kochsalzgaben (Viehsalz, Salzlecksteine) auszugleichen, zumal unsere Futtermittel für Pferde nur wenig Natrium und Chlor enthalten. Kaliumreich hingegen sind Grasprodukte, Bierhefe, melassierte Trockenschnitzel und Sojaschrot. Die Magnesiumversorgung ist in aller Regel mit praxisüblichen Rationen sichergestellt. Zu Mängeln in der Versorgung mit Mineralstoffen kann es kommen, wenn kein zusätzliches Mineralfutter oder Fertigfutter eingesetzt wird. Auf ausreichende Zufuhren ist deshalb zu achten, zumal zum Teil von großen Schwankungen der Mineralstoffgehalte in den Futtermitteln auszugehen ist. Der Bedarf an Spurenelementen ist bei wachsenden Pferden und Zuchtstuten besonders stark ausgeprägt. VERSORGUNG MIT VITAMINEN Vitamine sind maßgeblich an zahlreichen Stoffwechselfunktionen beteiligt und deshalb in der Ernährung unentbehrlich. Der Bedarf hängt wie bei den anderen Nähr- und Wirkstoffen vom Alter und der Leistung des Pferdes ab. Während die wichtigen fettlöslichen Vitamine A, D und E in der Regel über geeignete Ergänzungsfutter verab reicht werden müssen, können die wasserlöslichen B-Vitamine, Vitamin C und das fettlösliche Tabelle 2: Empfehlungen für die Versorgung mit den wichtigsten Vitaminen (GfE, 1994) (Angaben in I.E. Internationale Einheiten oder mg je kg Lebendmasse bzw. je kg Futter-Trockenmasse) Name Erhaltung und Arbeit Wachstum hochtragende und laktierende Stuten Vitamin A I.E./kg Lebendmasse Vitamin D I.E./kg Lebendmasse Vitamin E mg/kg Lebendmasse 1 2* 1 1 Vitamin B1 mg/kg Futter-Trockenmasse 3** 3 3 Vitamin B2 mg/kg Futter-Trockenmasse 2,5 2,5 2,5 Biotin mg/kg Futter-Trockenmasse 0,05 0,1 0,2 * Hochleistungspferde bis 4, ** Hochleistungspferde bis 5 24
25 EMPFEHLUNGEN ZUR VERSORGUNG Vitamin K von gesunden Pferden überwiegend im Darm selbst synthetisiert werden. Empfehlungen zur Vitaminversorgung enthält Tabelle 2. AUFNAHME AN FUTTERTROCKENMASSE Grundlage gezielter Rationsberechnungen sind Kenntnisse zum möglichen Futteraufnahmevermögen der Pferde. Dieses hängt von verschiedenen Faktoren ab wie Größe der Tiere, Alter, Leistung, Haltung, Wasserversorgung, Gesundheitszustand (z. B. Zähne) und Futterzubereitung. Die Energiedichte der Ration ist auch von Bedeutung. Die Futteraufnahme steigt, wenn die Energiekonzentration abnimmt und umgekehrt. Steigerungen der Futteraufnahme werden mit süß schmeckenden Komponenten (Melasse, melassierte Trockenschnitzel) erreicht. Hinsichtlich der Futterstruktur werden stängelreiche Grasprodukte einem weichen, blattreichen Material vorgezogen. Zu einem Rückgang der Futteraufnahme kann es auch aus dem Mangel einzelner Nährstoffe kommen, beispielsweise wenn B-Vitamine infolge gestörter Dickdarmaktivität fehlen. Ein mit 600 kg Körpergewicht ausgewachsenes Pferd nimmt zur Erhaltung durchschnittlich etwa 7,2 kg Futtertrockenmasse pro Tag auf. Kleinere, leichtere Pferde wie Ponys haben im Verhältnis zur Lebendmasse ein etwas höheres, sehr große, schwere Pferde ein etwas geringeres Futteraufnahmevermögen. Das Futteraufnahmevermögen von Pferden hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab. Stängelreiches Raufutter wird weichem, blattreichem Material vorgezogen. 25
26 FUTTERMITTEL GROBFUTTER (RAUFUTTER) Pferde sind Pflanzenfresser. Zur Regulierung ihrer Verdauung benötigen sie ausreichend gut strukturiertes, rohfaserreiches Grobfutter. Dazu rechnet man Heu, Heulage, Grassilage, Stroh und Maissilage. Getrocknete, stark vorzerkleinerte Grasprodukte (z. B. Cobs, Würfel, Grünmehle) enthalten ebenfalls viel Rohfaser, haben aber nicht die gewünschte Strukturwirkung für das Pferd. Das strukturierte Grobfutter dient der langsamen Futteraufnahme, intensiven Kauvorgängen und damit der für die gesamte Verdauung wichtigen Speichelbildung: Speichel bewirkt die erforderliche Durchsaftung des Mageninhaltes und sorgt für den geregelten Ablauf der Mikrobentätigkeit (keine Übersäuerung) im Dickdarm. Langes Kauen von Strukturfutter mindert auch das Risiko der Hakenbildung an den Backenzähnen. Zur Vorbeugung von Verdauungsstörungen sind für Arbeitspferde deshalb täglich mindestens 1 kg und für laktierende Stuten und Fohlen mindestens 1 bis 1,5 kg Grobfutter (Heu oder Stroh) je 100 kg Körpergewicht vorzusehen. (z. B. Pferd 600 kg 4 kg Heu und 2 kg Stroh). Der Anteil strukturierter, unzerkleinerter Rohfaser (mindestens 3 bis 6 cm lang) muss in der Gesamtration mindes tens 18 Prozent betragen. Bei Pferden mit geringer Futtermengenaufnahme sollte 26
27 FUTTERMITTEL der Anteil strukturierter Rohfaser 20 bis 22 Prozent betragen (bezogen auf die Trockenmasse). Stroh sollte grundsätzlich mit Heu bzw. Silage kombiniert und nicht ausschließlich verfüttert werden. Überhöhte Strohgaben können Verstopfungskoliken verursachen. Heulage erfüllt nahezu die Funktion von Heu. Schließlich dient gutes Grobfutter den Pferden als Beschäftigungsmaterial. Verhaltensstörungen wie Benagen der Stalleinrichtungen und Koppen kann mit der Vorlage von genügend Grobfutter vorgebeugt werden. Vor- und Nachteile von Heu und Silage/Heulage In der Praxis wird häufig diskutiert, ob Heu oder Silage das geeignetere Grobfutter ist. Wobei unter Silage meist Heulage, also stark angewelkte Grassilage verstanden wird. Bei der Silage wird das Futtermittel durch Milchsäuregärung haltbar gemacht (wie bei der Sauerkrautherstellung), beim Heu erfolgt die Konservierung durch Trocknung. Grundsätzlich kann beides in der Pferdefütterung verwendet werden. Entscheidend ist die Qualität des erzeugten Futters. Hochwertige Silage wird ebenso gern gefressen wie gutes Heu. Auch kann Silage das Heu ersetzen oder mit Heu zusammen gefüttert werden. Dennoch besitzen beide Futterarten für sich betrachtet einige wesentliche Vor- und Nachteile. Im Vergleich zur Heuwerbung besteht bei der Silagegewinnung durch die kürzere Erntedauer ein geringeres Wetterrisiko. Durch den deutlich höheren Wasseranteil kommt es im Stall beim Verfüttern der Silage zu einer verminderten oder keiner Staubentwicklung. Staub enthält nicht nur kleine Futterpartikel, sondern auch erhebliche Konzentrationen von Pilzkeimen, Mikroorganismen und Milben. Die Gefahren von Atemwegserkrankungen und Allergien der Pferde sind dadurch deutlich reduziert. Sind die Qualitätsanforderungen einer guten Silage erfüllt, erfreut sich dieses Futter einer hohen Akzeptanz bei den Pferden. Die möglichen Verzehrsmengen stehen denen von Heu in nichts nach. Aus Beobachtungen in der Praxis nehmen Pferde hochwertige Silage sogar lieber auf als Heu. Die Gewinnung von Silage verursacht durch geringere Bröckel- und Auswaschungsverluste weniger Nährstoffverluste als die Heuwerbung. Da Silage zeitlich vor dem Heu gewonnen wird, ist dieses Futter in der Regel rohfaserärmer, dafür aber auf die Trockenmasse bezogen energiereicher. Bei gut durchdachter Rationsgestaltung kann aus diesem Vorteil eine Kosteneinsparung auf der Kraftfutterseite realisiert werden. In der Regel weisen Silagen bedingt durch den Luftabschluss auch eine höhere Vitaminbeständigkeit auf. Im Heu hingegen wird die Vitaminkonzentration mit zunehmender Lagerdauer erheblich verringert. Bei einer zu starken Selbsterhitzung des Heus durch unzureichende Trocknung kann es zu Nährstoffverlusten kommen. Ein weiteres Problem ist Milbenbefall, der fast nur im Heu vorkommt. Besondere Vorzüge einwandfreien Heus ergeben sich aus der rohfaserreichen, guten Futterstruktur. Heu liefert nicht nur wertvolle Nährstoffe, sondern dient dem Pferd besonders auch als Sättigungsund Beschäftigungsfutter. Den Vorteilen der Silagefütterung stehen auch einige Nachteile gegenüber. So sind bei Silagefütterung Durchfallrisiken nicht auszuschließen. Als Ursache in Betracht zu ziehen sind zu feuchte und damit zu säurehaltige Silagen, verdorbene Silagen, stressbedingte immunologische Reaktionen und möglicherweise Vorschädigungen der Darmschleimhaut. 27
28 Um die Staubentwicklung bei Heu zu vermindern, wird es von Pferdehaltern oft gewässert. Eine Alternative ist die Verfütterung von Silage. Heu eignet sich als Beschäftigungsmaterial für Pferde und kann so helfen, Stereotypien vorzubeugen. Bei unsachgemäßer Gewinnung und Lagerung von Silage kann es in der Praxis leicht zu erhöhten Futter- und Nährstoffverlusten und Schimmelbefall kommen. Futterwert von Silage/Heulage und Heu Welche Qualitäten im Einzelnen angestrebt werden sollten, verdeutlichen die in Tabelle 3 dargestellten Kennzahlen. Gras für die Silagegewinnung wird etwa zu Beginn bis Mitte der Blüte gemäht. In diesem Stadium enthalten die Gräser etwa 27 Prozent Rohfaser in der Trockenmasse. Die optimale Schnitthöhe beträgt sieben bis zehn Zentimeter. Wird zu tief gemäht, kann es zu Verunreinigungen mit Erde kommen, die womöglich zu Fehlgärungen führen können. Schmutzeintrag lässt sich minimieren, wenn die Flächen rechtzeitig abgeschleppt werden. Verunreinigungen mit Erde bergen auch das Risiko von Botulismus. Botulismus bezeichnet eine Futtermittelvergiftung, die durch die Aufnahme eines 28
29 FUTTERMITTEL Giftstoffes mit dem Futter hervorgerufen wird, den anaerobe Fäulnisbakterien (Clostridium botulinum) ausscheiden. Um gute Silierbedingungen zu schaffen, sollte das geschnittene Gras auf etwa 50 Prozent Trockenmasse angewelkt werden. Bei diesem Feuchtegehalt können sich die notwendigen Gärsäuren, überwiegend Milchsäure und etwas Essigund Propionsäure, bilden, um die gewünschte Gärqualität und -stabilität zu erreichen. Die übliche Anwelkzeit beträgt ein bis maximal zwei Tage. Sofort nach dem Mähen soll der Schwad zum Trocknen breit verstreut werden. Nach ein- bis zweimaligem Wenden kann man mit dem Schwaden beginnen, wenn die Hände bei der Wringprobe gerade trocken bleiben. Wird das Schnittgut weiter getrocknet, entstehen Heulagen mit TM-Gehalten von häufig um die 70 Prozent. Bei derartig trockenem Futter unterbleibt die gewünschte intensive Vergärung. Als Folge leiden Stabilität und Haltbarkeit des Futters, da den für die Silierung verantwortlichen Gärsäurebakterien die notwendige Feuchtigkeit zur Vermehrung fehlt. Im Gegensatz zu Heu weisen Grassilagen, vor allem Heulagen, noch hohe Restzuckergehalte auf. Zuckergehalte von deutlich mehr als 80 g pro kg TM bergen ein erhöhtes Nachgär- und damit Verderbnisrisiko. Heulagen haben grundsätzlich ein höheres Botulismusrisiko: Unter anaeroben Bedingungen können sich über Erde oder Tierkadaver eingeschleppte Botulismuserreger umso besser entwickeln, je weniger sauer das sie umgebende Milieu ist. Gelangen Tierkadaver bei der Ernte mit in die Silage, besteht ein großes Gefahrenpotenzial. Derartig kontaminiertes Futter darf auf keinen Fall verfüttert werden. Obwohl einiges gegen Heulagen spricht, bevorzugen viele Pferdehalter dennoch diese Futterform. Ganz gleich ob Heulagen oder andere Silagen erzeugt werden, die siliertechnischen Anforderungen sollten in jedem Falle voll erfüllt werden. So müssen die gepressten Rund- bzw. Quaderballen möglichst innerhalb von zwei Stunden absolut luftdicht mit geeigneten Stretchfolien umwickelt werden. Im Hinblick auf die Lagerstabilität spielt die erforderliche Verdichtung des Futters eine ganz entscheidende Rolle. Um nahezu anaerobe Bedingungen zu gewährleisten, sollten darüber hinaus sowohl Rund- als auch Quaderballen mindestens 220 kg Futtertrockenmasse pro Kubikmeter aufweisen. Tabelle 3: Orientierungswerte für Heu und Silage/Heulage Silage Heulage Heu Trockenmasse (TM), % > 84 je kg TM: Rohasche, % < 10 < 10 < 10 Rohfaser, % Zucker, % < 8 ph-wert 4,7 4,9 Energie, MJ verdauliche Energie (DE) 9, ,5 8,5 10 Verdichtung, kg TM/m 3 > 220 >
30 Schimmelbildung, Veränderungen von Farbe und Struktur oder starke Verschmutzungen sind Indikatoren für verdorbene Silage. Silageballen sollen vor dem Verfüttern etwa sechs bis acht Wochen stirnseitig gelagert werden, um eine ausreichende Durchsäuerung zu erreichen. Wer die Verdichtung von Futterballen selbst überprüfen möchte, kann folgendermaßen vorgehen: Zunächst wird das Gewicht des Ballens ermittelt. Beispielsweise bei einer Genossenschaft oder beim Landhandel, wo entsprechende Wiegeeinrichtungen zur Verfügung stehen. Danach wird der Rauminhalt des Ballens bestimmt und eine Futterprobe entnommen. Der Ballen muss anschließend sorgfältig mit Klebeband verschlossen werden. Die Futterprobe wird in einem Labor (z. B. Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalten) auf den Trockenmassegehalt untersucht. Dann wird das gesamte Trockenmassegewicht des Ballens ermittelt, indem der analysierte Trockenmasse-Gehalt mit dem Ballengewicht multipliziert wird. Mittels Dreisatzrechnung erfolgt dann die Umrechnung von Gesamttrockenmasse auf einen Kubikmeter des Ballens. Beispiel: Ein Quaderballen misst 1,1 x 0,8 x 1,6 m, sein Volumen beträgt dann 1,408 m 3. Er wiegt 550 kg und enthält analysierte 60 % TM. Resultat für die Verdichtung: 550 kg x 60 % : 1,408 m 3 = rund 234 kg TM/m 3. Kommt es bei der Herstellung oder dem Transport der Grasballen zu Löchern in der Folie, müssen diese sofort mit festem Klebeband verschlossen werden. Die Lagerung der Ballen sollte stirnseitig auf einer für Nagetiere nicht zugänglichen Unterlage am besten unter Dach erfolgen. Bei Lagerung im Freien sind Abdeckplanen gegen Vögel und Niederschläge zu verwenden. Üblicherweise sollten die Ballen zunächst etwa sechs bis acht Wochen gelagert werden, bevor man mit der Verfütterung beginnt, um so eine ausreichende 30
31 FUTTERMITTEL Durchsäuerung zu gewährleisten. Nach dem Öffnen der Ballen muss die Silage zügig verfüttert werden, da es sonst infolge von Luftzutritt zu einem mit Nacherwärmungen und Verschimmelungen verbundenen Futterverderb kommen kann. Eine Futteranalyse unter Laborbedingungen sollte mindestens die wichtigen Merkmale Trockenmasse- und Rohproteingehalt umfassen. Darüber hinaus liefern Kriterien wie Energiegehalt, Mineralstoffgehalt und hygienische Beschaffenheit des Futters wichtige Informationen für die Rationsgestaltung. Zusätzlich kann eine sensorische Beurteilung des Futters erfolgen. Dabei spielen die Merkmale Geruch, Griff, Farbe und Verunreinigungen eine besondere Rolle. Ballensilagen sollten einen angenehm säuerlich-brotartigen Geruch aufweisen, frei von Sand- und Erdbeimengungen sein, eine produkttypische Farbe haben, sauber sein oder nur wenige Unkräuter bzw. Fremdbestandteile enthalten. Eine Verfütterung verbietet sich bei schimmelig-muffigem, fauligem oder alkoholischem Geruch und bei deutlicher Erwärmung infolge Nachgärung, bei weiß-grauen bis schwärzlichen Farbabweichungen durch Schimmelbeläge und bei hohen Anteilen an Unkräutern, Sand oder Erde sowie bei Belastung mit Tierkadavern. Treten nur leichte Nacherwärmungen auf, sollten die betroffenen Stellen vor dem Verfüttern großräumig aussortiert werden, um gesundheitliche Risiken auszuschließen. Informationen zur Gewinnung und Lagerung von hochwertigen Silagen finden Sie in dem aid-heft 1563/2011 Qualitäts-Grassilage vom Feld bis in den Trog. Heugewinnung Grasbestände für die Heugewinnung werden in der Regel zwei bis drei Wochen später geschnitten als die Bestände zur Silageerzeugung. Das Heu soll ein vergleichsweise rohfaser- und strukturreiches Sättigungs- und Beschäftigungsfutter abgeben, andererseits aber noch eine ausreichend hohe Verdaulichkeit für hochleistende Stuten und Fohlen besitzen. Mit zunehmender Verlagerung des Schnittzeitpunktes bekommt das Gras mehr Rohfaser und Struktur. Parallel hierzu verringern sich der Eiweiß- und Energiegehalt. Für Sportpferde eignet sich eher später geerntetes Heu. Frühe Heuschnitte sind gegebenenfalls mit Stroh zu kombinieren. Sinn und Zweck der Heugewinnung ist eine möglichst schnelle Absenkung des Wassergehaltes auf 15 bis 20 Prozent. Unter günstigen Witterungsbedingungen wird dieses Trocknungsstadium nach drei- bis fünfmaligem Wenden des breit gezetteten Schwades in Abhängigkeit von Sonnenscheindauer und Windeinfluss in etwa drei bis fünf Tagen erreicht. In den ersten Wochen nach dem Pressen durchläuft das Heu eine Schwitzphase. In dieser Zeit kommt es zu einer Keimvermehrung, wodurch sich das Heu erhitzt. Diese Erwärmung dient der Nachtrocknung. Dauer und Intensität der Erwärmung hängen vom Feuchtgehalt beim Einfahren ab. Wird zu feucht, das heißt mit weniger als 80 Prozent TM eingelagert, kann die Heutemperatur bis zur Selbstentzündung ansteigen. Diese Gefahr ist bei Pressballen größer als bei loser Einlagerung. Je nach Beschaffenheit des Heus dauert die normale Schwitzphase etwa sechs bis acht Wochen. Vor Ablauf dieser Fermentationsphase darf das frische Heu nicht 31
32 verfüttert werden, da die Keimaktivität noch nicht abgeschlossen ist und dieses frische Heu zu Verdauungsstörungen und Koliken führen kann. Bei 85 Prozent Trockenmasse ist das Heu normalerweise gut lagerfähig. Bleibt es zu feucht, können sich Bakterien und vor allem Schimmelpilze bilden. Auch Milben lieben ein feuchtes Milieu. Die Stoffwechselprodukte dieser unerwünschten Begleiter sind teils hoch toxisch und können massive Verdauungsstörungen, Koliken, Allergien und Atembeschwerden (Dämpfigkeit) hervorrufen. Vor dem Verfüttern sollte das Heu sensorisch auf Eignung überprüft werden. Kritisch ist vor allem Ballenheu, bei dem sich durch das dichte Pressen und möglichen Feuchtigkeitsstau Schimmelpilze entwickeln können. Welche Kriterien dieser Überprüfung dienen, ist Tabelle 4 zu entnehmen. Eignung von Stroh Stroh wird als Futter und zur Einstreu verwendet. Hauptvertreter sind Weizen-, Gersten- und Haferstroh. In der Nährstoffzusammensetzung unterscheiden sich diese Stroharten nur geringfügig. Die Eiweiß- und Energiegehalte sind niedrig, die Vitamin- und Mineralstoffgehalte unbedeutend für die Pferdefütterung. Ausgenommen ist Kalium, das in hoher Konzentration vorliegt. Stroh enthält sehr viel Rohfaser (über 40 % in der Trockenmasse) mit hohem Verholzungsanteil. Deshalb dient die Verfütterung in erster Linie der Förderung der Kautätigkeit, der Regulierung der Futteraufnahme und als Beschäftigungsmaterial. Aber auch zur Unterstützung der Dickdarmfunktion und als Sättigungskomponente spielt es eine Rolle. In der Praxis kommt überwiegend Weizenstroh zum Tabelle 4: Qualitätsmerkmale von Heu (Meyer und Coenen, 2014, geändert) Merkmal Eigenschaft Bemerkungen Farbe und Aussehen frisch, grün blass, bleich braun bis schwarz schmutzig-grau bis nesterweise grau-weiß günstige Erntebedingungen, geringe Nährstoffverluste spät geerntet, verregnet, lange gelagert während der Lagerung überhitzt, hohe Nährstoffverluste erhöhter Schimmelbefall nicht verfüttern Geruch frisch, angenehm, aromatisch gute Ernte-, Silier- und Lagerungsbedingungen brandig muffig, dumpf, faulig überhitzt, Nährstoffverluste Schimmelbefall, Nährstoffverluste, Gesundheitsrisiko nicht verfüttern Griff weich, zart blattreiches Material, relativ hoher Eiweiß-/niedriger Rohfasergehalt Verunreinigungen rau sperrig klamm Erde, Stallmistreste, Steine, Sand, Staub, Unkräuter usw. blattärmer, stängelreicher blattarm, stängelreich, viel Rohfaser, verringerte Verdaulichkeit weniger als 80 % Trockenmasse, möglicherweise noch in Schwitzphase, Risiko für Verderb, nicht verfüttern je nach Art und Umfang qualitätsmindernd und gesundheitsgefährdend 32
33 Pferdeheu sollte mindestens 80 Prozent Trockenmasse enthalten. Futterstroh dient vorrangig der Regulierung der Futteraufnahme und der Beschäftigung von Pferden, aber auch zur Erhaltung physiologischer Bedingungen im Dickdarm. Einsatz, zumal es sich auch gut als Einstreu eignet. Verwendung finden auch Gersten-, Roggen- und Triticalestroh. Gerstenstroh ist wegen seiner langen Grannen weniger beliebt. Vorbehalte wegen möglicher Schleimhautreizungen oder Ähnlichem sind aber unbegründet, zumal die Grannen beim Mähdrusch nahezu entfernt werden. Die Verfütterung von Stroh nach Einsatz von Kurzspritzmitteln ist ebenfalls möglich. Es gibt keine wissenschaftlichen Belege auf Unverträglichkeiten (Koliken) bei Pferden. Unzureichend getrocknetes Stroh kann leicht verschimmeln und zu gesundheitlichen Problemen führen. Nicht geeignet ist auch mit Pilzen befallenes Stroh. Einwandfreies Stroh kann gut in die Fütterung integriert werden. Es dient als teilweiser Ersatz von Heu, Grassilage oder Heulage. Übermäßiger Strohverzehr kann jedoch zu Verdauungsstörungen (Verstopfungskoliken) führen. Deshalb sollten täglich nicht mehr als etwa 0,8 kg Stroh je 100 kg Körpergewicht angeboten werden. Gebräuchlich ist auch gehäckseltes Stroh (3 bis 5 cm lang). Anderen Futtermitteln untergemischt verlangsamt Häckselstroh die Futteraufnahme 33
34 Gesundheit und Wohlbefinden der Tiere hängen in hohem Maße von Sinnenprüfung und Qualitätsbeurteilung des Futtermittels ab. und fördert dadurch das Kauen und die Speichelbildung. Verwendung von Maissilage Maissilage enthält im Durchschnitt über 30 Prozent Trockenmasse, ist proteinarm, energiereich und verhältnismäßig preisgünstig. Die Verwendung von Maissilage (empfohlen wird eine Menge von maximal 2 kg pro 100 kg Körpergewicht) sollte unter Rücknahme des Heu- und Kraftfutteranteils der Futterration erfolgen, um Verfettungen vorzubeugen. Der niedrige Vitamin- und Mineralstoffgehalt von Maissilage kann zudem, je nach Zusammensetzung der Gesamtration, eine Vitaminbzw. Mineralfutterergänzung nötig machen. Hauptenergieträger von Maissilage ist Stärke, die 30 bis 35 Prozent der Trockenmasse ausmacht. Maisstärke besitzt nur eine geringe Dünndarmverdaulichkeit. Beim Grünmais ist jedoch davon auszugehen, dass die Stärkeverdaulichkeit im Dünndarm bereits durch den Zerkleinerungs- und Silierprozess stark angehoben ist. Auch Corn-Cob-Mix (CCM), ein speziell für Schweine produziertes Maiskolbenschrot kann an Pferde verfüttert werden. Das im Mittel trockensubstanzreiche (60 % in TM), sehr rohfaserarme (3,5 % in TM) CCM enthält aufgrund seines hohen Stärkeanteils (65 % der TM) sehr viel Energie. Für Großpferde können 1 bis 1,5 kg CCM pro Mahlzeit empfohlen werden. Bei durch Hufrehe gefährdete Pferde sollten keine Maisprodukte verwendet werden. SAFTFUTTER Typische Saftfutter sind Mohrrüben, Rüben und Rote Bete. Merkmale dieser Komponenten sind hoher Wassergehalt, niedriger Rohfasergehalt, hoher Kohlenhydratanteil (Zucker oder Stärke) und geringer Proteingehalt. Die Nährstoffverdaulichkeit ist hoch. Nachteile hinsichtlich des hohen Arbeitsaufwandes, der geringen Lagerfähigkeit, des hohen 34
35 FUTTERMITTEL Verderbrisikos und der hohen Kosten machen diese Futtermittel allerdings nur zu Nebenprodukten in der Pferdefütterung. Qualitativ einwandfreie Saftfuttermittel erfreuen sich großer Beliebtheit, werden gierig gefressen und regen den Appetit der Pferde an. Verschmutzte, angefrorene, ausgekeimte, verfaul te oder verschimmelte Produkte bewirken das Gegenteil und sind eine Gefahr für die Gesundheit (Verdauungsstörungen, Aborte bei tragenden Stuten). Möhren zeichnen sich vor allem durch ihre hohen ß-Carotingehalte (eine Vorstufe von Vitamin A) aus. Zu unterscheiden sind gelbe und rote Möhren: Frische rote Futtermöhren enthalten mit durchschnittlich 60 mg ß-Carotin je kg (bei elf Prozent Trockenmasse) etwa dreimal so viel wie die gelben. Möhren sind besonders wertvoll in der Zuchtstutenhaltung. Zur Sicherung der ß-Carotin-Versorgung können Zuchtstuten täglich bis fünf kg und ältere Fohlen bis drei kg rote Möhren erhalten. Hin und wieder kommen auch zucker- oder gehaltreiche Futterrüben und Rote Bete zum Einsatz. Zucker- oder Gehaltsrüben werden wegen ihres hohen Zuckergehaltes gern gefressen und von erwachsenen Pferden gut verwertet. Sie können wesentlich zur Energieversorgung beitragen. An schwer arbeitende Pferde können täglich bis 15 kg Zuckerrüben oder etwa 20 kg Gehaltsrüben bei ausreichender Grobfutterergänzung verabreicht werden. Rote Bete (Rote Rüben) sind von unter geordneter Bedeutung. Sie sind relativ wasserreich und enthalten wenig ß-Carotin. KRAFTFUTTER Der Einsatz von fertig hergestellten Mischfuttermitteln ist die Regel. Es gibt aber auch eine Reihe von Betrieben, die neben dem Grobfutter wirtschaftseigenes Getreide und/ oder andere Einzelkomponenten allein oder kombiniert mit Mischfutter einsetzen. In der Praxis bewährt hat sich beispielsweise die sogenannte Kraftfuttermischung 60/30/10, bestehend aus 60 Prozent Hafer, 30 Prozent Gerste und 10 Prozent Mais oder Weizen. Ergänzt werden muss dann noch Mineralfutter, gegebenenfalls zur Staubbindung etwas Pflanzenöl. Die in der Pferdefütterung gebräuchlichsten Kraft- und auch Saft- und Aufgrund ihres hohen Zuckergehaltes sind Möhren für Pferde sehr schmackhaft. 35
36 Tabelle 5: Wertbestimmende Inhaltsstoffe verschiedener Kraft-, Saft- und Grobfuttermittel für Pferde pro kg Futtermittel (DLG Futterwerttabellen, 1995 ergänzt) Futtermittel TM DE* verd. RP** Rohfaser Kalzium Phosphor Natrium Kalium Kupfer Zink Selen g g MJ g g g g g mg mg mg Kraftfutter Hafer Gerste Körnermais Weizen Melasseschnitzel Luzernegrünmehl Weizenkleie Leinsamen Sojaex.schrot Bierhefe Pflanzenöl ,2 12,6 13,6 13,1 10,1 8,2 11,1 (19,3) 12,4 13,3 (38,4) ,1 0,6 0,4 0,4 5,6 16,9 1,3 2,6 3,0 2,8 3,2 3,4 2,8 3,3 0,8 2,9 11,8 5,5 6,4 14,7 0,2 0,2 0,1 0,1 2,2 0,5 0,4 0,8 0,3 1,4 0,7 0,7 0,6 4,4 11,0 21,6 13,2 21,5 18, ,19 0,15 0,09 0,09 0,25 0,54 0,18 0,10 0,25 0,36 Raufutter Wiesenheu Anwelksilage Heulage Weidegras Maissilage Weizenstroh ,3 4,4 6,2 1,9 4,0 (5,2) ,3 2,9 4,1 1,9 1,1 2,6 2,6 2,5 2,6 0,7 0,8 0,8 0,5 0,5 0,7 0,2 0,1 0,8 17,2 10,0 14,0 3,8 4,9 11, ,03 0,02 0,03 0,01 0,06 Saftfutter Mohrrüben Gehaltsrüben Rote Bete ,3 1,8 1, ,4 0,4 0,3 0,3 0,6 0,4 0,3 0,6 0,4 3,7 4,5 3, ,4 0,01 *DE = verdauliche Energie, Energiewert berechnet nach Schätzformel (GfE, 2003) **verd. RP = verdauliches Rohprotein Grobfuttermittel sind in Tabelle 5 mit ihren Inhaltsstoffen detailliert aufgelistet. Hafer Wegen seines hohen Spelzenanteiles und der hohen Stärkeverdaulichkeit im Magen- Dünndarm-Bereich (deutlich über 80 Prozent) besitzt Hafer gegenüber den anderen Getreidesorten wesentliche Vorteile. Günstig wirken auch die hohen Anteile an Schleimstoffen. Besitzen Pferde ein intaktes, gut entwickeltes Gebiss, kann Hafer problemlos ohne vorheriges Quetschen verfüttert werden; die Verdaulichkeit im Dünndarm verringert sich dadurch nicht. Geschroteter oder gequetschter Hafer sollte für Fohlen, Jungpferde, hastige Fresser und vor allem alte Pferde verwendet werden. Er darf nicht lange gelagert werden, weil die in größeren Anteilen vorliegenden ungesättigten Fettsäuren nach wenigen Tagen oxidieren können und den Hafer muffig und ranzig werden lassen. Bei einseitig hoher Haferfütterung reagieren Pferde mitunter temperamentvoller ( es sticht der Hafer ). Ob hierfür bestimmte Wirkstoffe des Hafers oder bei einseitiger Fütterung in der Nährstoffbilanz fehlende Stoffe ursächlich sind, bleibt bis heute ungeklärt. 36
37 FUTTERMITTEL Wie anderes Getreide auch ist Hafer nährstoff- und qualitätsmäßig starken Schwankungen unterworfen. Vollkörniger, schwerer Hafer ist in der Regel energiereicher als flachkörniger, leichter oder mit Schmachtkorn besetzter Hafer. Hafergewicht und Qualität lassen sich nach herkömmlicher Weise über das Hektoliter-Gewicht (HLG) bestimmen. Partien mit mehr als 550 g Hafer je Liter gelten im Handel schlechthin als schwer und damit besonders energiereich. Es wurde jedoch analytisch nachgewiesen, dass zwischen der Höhe des HLG und der Konzentration an verdaulicher Energie (DE) nur selten enge Beziehungen bestehen, sodass dieses Maß im Grunde für die exakte Energiewertermittlung unzureichend ist und die genaue Bestimmung des Energiewertes eine Futteranalyse notwendig macht. Vor dem Kauf oder Verfüttern sollte unbedingt die hygienische Beschaffenheit des Hafers überprüft werden. Aufgrund der hohen Spelzenanteile neigt Hafer nämlich leicht zu hohen Belastungen an Bakterien, Schimmelpilzen und Hefen. In der Praxis wird Hafer selbst von Experten als eiweißreiches Futter eingestuft, was natürlich nicht richtig ist. Hafer enthält nur etwa 110 g Rohprotein pro kg, wovon etwa 80 Prozent für das Pferd verdaulich sind. Sojaextraktionsschrot als Eiweißfutter weist beispielsweise einen Rohproteingehalt von etwa 440 g je kg auf. Gerste und Körnermais In der Mischfutterindustrie wird Hafer mehr und mehr durch Gerste verdrängt. Auch Körnermais hat in der Pferdefütterung an Bedeutung gewonnen. Gerste und Mais enthalten deutlich mehr Stärke als Hafer, wobei diese Stärke im Magen-Dünndarm-Bereich nur schwer verdaulich ist. Deshalb sollte Gerste und Körnermais vor dem Verfüttern zerkleinert werden (Quetschen oder Schroten). Dadurch lässt sich die Dünndarmverdaulichkeit etwas verbessern. Die Gerste- und Gerste Hafer 37
38 Maismenge pro Mahlzeit sollten in der Summe nicht mehr als etwa 0,3 kg Gerste/Mais pro 100 kg Lebendmasse und Mahlzeit betragen. Körnermais enthält im Mittel 13,6 MJ DE je kg und ist damit das energiereichste Getreide. Weizen, Roggen und Triticale Diese Getreidesorten spielen in der Pferdefütterung nur eine untergeordnete Rolle. Aufgrund der hohen Anteile an Klebereiweiß (vor allem Weizen) kann es bei einseitiger Fütterung zu Verkleisterungen im Magen und gesundheitlichen Problemen wie Magenentzündungen und auch Hufrehe kommen. Getreidekleien Diese Nachprodukte aus der Müllerei bestehen vorwiegend aus den äußeren Schichten des Getreidekornes und geringen Mehlanteilen. Weizenkleie hat die größte Bedeutung: Sie enthält höhere Mengen an Rohprotein (über 14 Prozent) und Rohfaser (etwa 12 Prozent). In qualitativ einwandfreiem Zustand wird Weizenkleie gern gefressen. Sie wirkt leicht abführend und kann die Verdauung unterstützen. Weizenkleie kann bis etwa 200 g pro 100 kg Körpergewicht und Tag verfüttert werden. Weizen- und auch Roggenkleie enthalten viel Phosphor (zwischen 10 und 12 g pro kg), aber wenig Kalzium, was bei der Rationsgestaltung zu berücksichtigen ist. Da Kleie viel Wasser bindet, muss stets ausreichend Tränkwasser zur Verfügung stehen. Zur Staubbindung sollte Kleie eingeweicht werden. Verwendung findet auch Haferschälkleie. Dieses Futter enthält viel mehr Rohfaser (über 20 Prozent) sowie deutlich weniger Protein, Energie und Phosphor als Weizenkleie. Grünmehle Hauptvertreter sind die in der Regel schonend getrockneten Produkte aus Gras, Klee oder Luzerne, die entweder in gemahlener oder pelletierter Form angeboten werden. Die Nährstoffgehalte entsprechen nahezu Trockenschnitzel Weizen 38
39 FUTTERMITTEL denen des ursprünglichen Materials (bezogen auf die Trockenmasse). Die Rohproteingehalte liegen zwischen 18 und 20 Prozent und die Rohfasergehalte zwischen 22 und 26 Prozent (jeweils bezogen auf die Trockenmasse). Aufgrund der starken Zerkleinerung und damit fehlenden Struktur sind diese Trockengrünfutter nicht als Grobfutterersatz zu betrachten. Im Vergleich zur Heuwerbung bleiben durch das schonende Trocknen wesentlich mehr Vitamine, insbesondere ß-Carotin und Vitamin E erhalten. Grünmehle lassen sich speziell in der weidefreien Zeit gut bei hochtragenden und laktierenden Stuten (1 bis 2 kg pro Tag) und bei Fohlen (0,5 kg pro Tag) verwenden. Pelletiertes Grünmehl sollte aufgrund seiner Quelleigenschaften dem Krippenfutter beigemischt werden. Bei Alleinverfütterung empfiehlt sich das vorherige Einweichen. Trockenschnitzel/Melasseschnitzel Diese aus der Zuckerrübenverarbeitung stammenden Nebenprodukte sind beliebte Pferdefutter. Trockenschnitzel enthalten vorwiegend Pektine. Dabei handelt es sich um pflanzliche Polysaccharide, die überwiegend im Dickdarm des Pferdes verdaut werden. Produktionsbedingt können Trockenschnitzel sehr unterschiedliche Melassegehalte aufweisen. Für Pferde eignen sich am besten unmelassierte oder nur schwach melassierte Schnitzel, die aber seltener angeboten werden. Melasse enthält etwa 50 Prozent Zucker und ist sehr kalium- und natrium reich. In begrenzten Mengen wirken Trockenschnitzel verdauungsfördernd. Wegen ihres hohen Quellvermögens müssen sie zur Vermeidung von Schlundverstopfungen vor dem Verfüttern gründlich eingeweicht werden. Üblicherweise reichen 60 Minuten bei einem Schnitzel-Wasser-Verhältnis von 1 zu 3 bis 4. Aufgrund des erhöhten Zuckergehaltes sollten melassierte, eingeweichte Trockenschnitzel besonders an warmen Tagen zügig verfüttert werden, da sie sonst vergären können. Um dem Risiko von Schlundverstopfungen vorzubeugen, dürfen Trockenschnitzel in Pelletform nur bis zu zehn Prozent ins Misch- oder Krippenfutter eingemischt werden. Bierhefe Bei der Bierherstellung anfallende Bierhefe zeichnet sich durch hohe Aminosäuren- und Vitamin-B-Gehalte aus. Bierhefe wirkt sich günstig auf die Dickdarmflora aus. Einsätze empfehlen sich vor allem bei Pferden mit permanenten Verdauungsstörungen, bei allgemeiner Leistungsschwäche und bei schlechten Fressern. Auch bei stark beanspruchten Turnierpferden, die in der Regel kraftfutterreicher und grobfutterärmer gefüttert werden, kann getrocknete Bierhefe die Dickdarmtätigkeit verbessern. An ausgewachsene Pferde können pro Tag bis zu 50 g Bierhefe pro 100 kg Körpergewicht verabreicht werden, an Absatzfohlen bis zu 100 g pro Tag. Leinsamen Leinsamen sind fettreich (über 30 Prozent) und eiweißreich (über 20 Prozent). Ernährungsphysiologisch besonders wertvoll sind die in Leinsamen enthaltenen ungesättigten Fettsäuren, Schleimstoffe und das Selen. Leinsamen haben günstige Wirkungen auf die Magen-Darm-Funktionen (vor allem bei Erkrankungen) sowie auf Haarkleid und Haut. Bei Fohlen führen 50 bis 80 g und bei älteren Pferden 100 bis 120 g zu positiven Effekten. Vor einer Trockenfütterung sollte Leinsamen geschrotet oder gequetscht werden. Zerkleinerte Partien sind wegen des schnellen Oxidierens (Ranzigwerden) der ungesättigten Fettsäuren nur begrenzt lagerfähig. Größere 39
40 Leinsamen Sojaextraktionsschrot Mengen Leinsamen sollten zur Vermeidung der Freisetzung der enthaltenen Blausäure vor dem Füttern fünf bis zehn Minuten gekocht werden. Sojaextraktionsschrot Dieser Eiweißträger hat in der Ernährung landwirtschaftlicher Nutztiere eine große Bedeutung. Aufgrund seines hohen Rohproteingehaltes (44 bis 48 Prozent) und seines hohen Anteils essenzieller Aminosäuren (z. B. Lysin, Methionin) spielt Sojaschrot auch in der Pferdefütterung eine Rolle, vorrangig bei wachsenden Fohlen und laktierenden Stuten. Sojaschrot ist häufig Bestandteil von fertig hergestellten Mischfuttermitteln, lässt sich aber auch aufgrund seiner guten Lagerfähigkeit problemlos als Einzelkomponente verwenden. Pflanzenöl Als protein- und stärkefreier Energielieferant können Pflanzenöle speziell in der Fütterung von Sportpferden eine sinnvolle Ergänzung sein. Sie entlasten den Eiweiß- und Pflanzenöl Kohlenhydratstoffwechsel. Der Energiegehalt beträgt etwa das Dreifache von Hafer. Geeignet sind Maisöl, Sojaöl, Sonnenblumenöl und andere. Hervorzuheben ist Leinöl, das sogar mit entzündungshemmenden Wirkungen in Verbindung gebracht wird. Pflanzenfette enthalten teils hohe Mengen an wertvollem Vitamin E. Bei der Fettfütterung wird andererseits aufgrund der reichlich vorhandenen mehrfach ungesättigten Fettsäuren vermehrt Vitamin E verbraucht, was wieder zu ergänzen ist. Bei sorgfältiger Lagerung sind frische Pflanzenöle über Monate haltbar. Zur 40
41 FUTTERMITTEL Staubbindung bei Kraftfuttermischungen genügen 0,5 bis 1 Prozent Öl. Als reiner Energielieferant können etwa 0,5 g bis maximal 1 g je kg Körpergewicht und Tag über das Krippenfutter eingesetzt werden. Übermäßige Mengen können zu Störungen in der Rohfaserverdauung und Kalziumverwertung (Seifenbildung) führen. Um die Akzeptanz zu erhöhen, sollte die Anfütterung mit Pflanzenöl behutsam erfolgen. Die täglich einzuhaltenden Höchstmengen verschiedener Futtermittel resultieren aus ihrer Schmackhaftigkeit, Verträglichkeit und aus den besonderen Inhaltsstoffen. Tabelle 6 zeigt dazu einige Beispiele. MISCHFUTTER Die Pferdefütterung soll den Ansprüchen der Tiere in allen Bereichen genügen. Die Protein- und Energieversorgung muss ebenso abgesichert sein wie die Mineralstoff- und Vitaminzufuhr. Zur Vereinfachung der Fütterung werden für die unterschiedlichen Ansprüche Mischungen von mehreren Einzelkomponenten angeboten, die die Versorgungsansprüche der Pferde abdecken und zudem eine einfache Handhabung in Lagerung und Fütterung gewährleisten. Mischfutter sind häufig Gemenge aus Getreide und Nachprodukten aus der Getreideverarbeitung (z. B. Kleien), Grünmehle aus Luzerne oder Gras, Nachprodukte aus der Zuckerverarbeitung (z. B. Trockenschnitzel und Melasse), pflanzliche Öle, Mineralstoffe und Vitamine. Diese Gemenge können auch durch den Pferdebesitzer selber hergestellt werden. Dafür muss die Vorratslagerung der einzelnen Produkte gewährleistet sein. Mischungen von Futtermittelherstellern zeichnen sich durch kontrollierte Zusammensetzung, gute Lagerfähigkeit und hohe hygienische Qualität aus. Bei Mischfuttermitteln wird zwischen Alleinfuttern und Ergänzungsfuttern unterschieden. Alleinfutter müssen bei ausschließlicher Tabelle 6: Tägliche Höchstmengen verschiedener Futtermittel für Pferde (nach Meyer und Coenen, geändert) Futtermittel Höchstmenge kg/100 kg Körpergewicht Futtermittel Höchstmenge im Kraftfutter in % Grassilage 2 Hafer 95 Heu beliebig Körnermais, gemahlen 40 Futterstroh 0,8 Gerste, gequetscht 40 Maissilage 2 Weizen, gequetscht 15 Futtermöhren 1 2 Leinsamen, erhitzt 10 Gehaltsrüben 2 3 Weizenkleie 10 20* Trockenschnitzel 0,5 Trockenschnitzel 5 10* Bierhefe 5 Sojaextraktionsschrot * Unterer Wert gilt bei Verwendung weiterer quellfähiger Komponenten 41
42 Verwendung alle Bedürfnisse der Tiere erfüllen. Da Pferde einen sehr hohen Bedarf an strukturierter Rohfaser haben, wird in der Regel Grobfutter in Form von Heu, Silage oder Stroh eingesetzt. Der Kraftfutteranteil ergänzt das Grobfutter. Somit handelt es sich bei Krippenfutter für Pferde vorwiegend um Ergänzungsfutter. Bei den Ergänzungsfuttern wird unterschieden nach der jeweiligen Ausrichtung der Produkte. So gibt es Mischungen, die primär zur Eiweiß- und Energieergänzung gedacht sind (meistens auch mineralisiert und vitaminiert) und in größeren Mengen (mehr als ein kg pro Tag) gefüttert werden und Mischungen, die primär die Mineralstoff- und Vitaminergänzung erfüllen und in kleinen Mengen (weniger als 200 g pro Tag) verabreicht werden. Eine weitere Unterscheidung von Ergänzungsfuttern richtet sich nach dem Einsatzbereich der Produkte, der sich am Bedarf der zu versorgenden Tiere orientiert. So werden energie- und proteinreiche Ergänzungsfutter für Fohlen, Zuchtstuten und Deckhengste angeboten oder energiereiche, aber proteinreduzierte Sportpferdefutter. Wichtig bei der Auswahl des geeigneten Ergänzungsfutters ist die Kenntnis des Besitzers über den Bedarf der Pferde und die Nährstoffgehalte der zu ergänzenden Grundfutter. Daher ist es ratsam, die Nährstoffgehalte der zu ergänzenden Grobfutter und Kraftfutter (Getreide) untersuchen zu lassen (z. B. bei den Landwirtschaftlichen Untersuchungs- und Forschungsanstalten), da die Gehalte teilweise deutliche Schwankungen aufweisen. Mineralfutter Zu den Ergänzungsfuttern gehören auch die voll mineralisierten und vitaminierten Zusatzprodukte, die zur Deckung des Mengen- und Spurenelementbedarfs eingesetzt werden und in der Regel auch die Vitaminanforderungen der Pferde gewährleisten. Die Auswahl des geeigneten Mineralfutters muss sich an der Grundfuttersituation orientieren. Häufig werden Mineralfutter als Ergänzung zu Getreide und Grobfutter eingesetzt. Aufgrund der in diesen Komponenten vorherrschenden Defizite von Kalzium und Vitamin A sollte besonderes Augenmerk auf diese Stoffe gelegt werden. Schwierig gestaltet sich die Mineralstoffversorgung von Weidepferden, da in der Regel auf eine Zufütterung verzichtet wird. Angeboten werden Leckmassen für Weidepferde, die neben einem relativ hohen Salzgehalt alle Mengen- und Spurenelemente vorhalten. Die Natrium- und Chlorversorgung der Pferde sollte über Salzlecksteine abgedeckt werden, die zur freien Aufnahme bereit stehen. Die Pferde bedienen sich dort entsprechend ihrem Bedarf. Saugfohlen dürfen keinen Mischfutter 42
43 FUTTERMITTEL Mash Zu den verdauungsunterstützenden Futtermitteln mit leicht abführender Wirkung gehört Mash. Der Begriff Mash stammt aus dem Englischen und bedeutet Brei, was darauf hinweist, dass es eingeweicht verfüttert wird. Hauptbestandteile sind Weizenkleie, Leinsaat und leicht verdauliche Flocken. Besonders bei Verdauungsproblemen, in Stresssituationen und beim Fellwechsel eignet sich der Einsatz. Mash wird von Pferden sehr gerne gefressen und eignet sich besonders in der kalten Jahreszeit als warme Zwischenmahlzeit beispielsweise nach dem Reiten. Zu beachten ist das ausreichende Einweichen mit heißem Wasser, da die Komponenten sehr quellfähig sind. Ein Salzleckstein sollte immer zur freien Verfügung stehen. freien Zugang zum Salzleckstein haben, da die Gefahr von Durchfallerscheinungen aufgrund vermehrter Wasseraufnahme deutlich zunimmt. Diätfuttermittel Die ebenfalls zu den Ergänzungsfuttermitteln zählenden Diätfutter dienen einem besonderen Ernährungszweck. Umgangssprachlich wird Diät häufig mit Abnehmen und Kalorienreduzierung gleichgesetzt. Tatsächlich sind Diätfuttermittel jedoch auf die Bedürfnisse von Pferden mit speziellen Ernährungsbedürfnissen ausgerichtet und sollen insbesondere den Ernährungsbedarf von Pferden decken, bei denen Verdauungs-, Resorptions- oder Stoffwechselstörungen vorliegen oder zu erwarten sind. Spezialitäten, Kräuter, Zusatzprodukte Neben den bereits aufgeführten Futtermitteln gibt es eine Reihe von Spezialfuttermitteln für Pferde, die ebenfalls als Ergänzungsfutter ausgelobt werden. Dazu gehören zum Beispiel hoch dosierte Mineralfutter und Vitaminpräparate, Einzelkräuter, Kräutermischungen oder Algenprodukte. Diese Produkte weisen häufig einen besonderen Einsatzschwerpunkt auf. Der Einsatz sollte zielgerichtet erfolgen und möglicherweise sollte ein Tierarzt zu Rate gezogen werden. Auf die prophylaktische Gabe derartiger Zusatzprodukte sollte verzichtet werden, denn eine Überversorgung kann, ähnlich wie eine Unterversorgung mit Nähr- und Wirkstoffen, zu Ungleichgewichten in der Ration führen, die gesundheitliche Probleme nach sich ziehen kann. Eine den Einsatz von Zusatzprodukten begleitende Rationsberechnung kann diesbezüglich Hinweise auf Fehlversorgungslagen aufzeigen. Die dafür notwendigen Angaben der Inhaltsstoffe und Zusatzstoffe der 43
44 Produkte sind auf den beiliegenden Futtermitteldeklarationen aufgeführt. Für Pferde im Wettkampfeinsatz ist wichtig zu wissen, ob die Produkte eine Dopingrelevanz haben und somit nur unter Beachtung der Karenzzeit gefüttert werden dürfen. Die Gabe von zusätzlichem Lein-, Soja- oder Sonnenblumenöl ist dagegen unbedenklich, sofern man sie nicht im Übermaß zum Krippenfutter dazugibt. Sie eignen sich besonders im Fellwechsel bzw. bei stumpfem und mattem Haarkleid. Mengen von 100 bis 250 ml pro Pferd und Tag sind unproblematisch. Aufgrund des hohen Energiegehaltes von Ölen sollte gegebenenfalls die Krippenfuttermenge entsprechend reduziert werden. Findige Futtermittelhersteller bieten Pferdebesitzern heutzutage eine nahezu unüberschaubare Anzahl an Zusatzfuttermitteln unterschiedlichster Wirkweise, Zusammensetzung und Dosierung. Eine Reihe von Spezialprodukten wird mit blumigen Attributen wie stresssenkend oder vitalitätsfördernd beworben meist konnte ihre pharmakologische Wirksamkeit bisher jedoch nicht wissenschaftlich nachgewiesen werden. Vernünftig versorgte und gesunde Pferde sind im Normalfall nicht unbedingt auf die Gabe von solchen Zusatzstoffen angewiesen und oft entstehen größere Gesundheitsschäden beim Pferd eher durch eine Über- als durch eine Unterversorgung mit Nährstoffen. Daher sollte die Verabreichung von Zusatzstoffen beim Pferd immer gut überlegt erfolgen. Konfektionierung von Pferdefuttermittel Mischfutter für Pferde werden in verschiedenen Darreichungsformen angeboten. Sie sollten möglichst staubarm, homogen in der Zusammensetzung sein und ein Entmischen der Bestandteile verhindern. Die Struktur des Futters muss ein Mindestmaß an Kautätigkeit der Pferde ermöglichen; Mehlfutter Die Fütterung von Kräutern kann Geruch und Geschmack von Futtermitteln positiv beeinflussen. Pelletfutter 44
45 FUTTERMITTEL sind deshalb für Pferde ungeeignet. Bei der Auswahl der Konfektionierung sollte sich der Pferdebesitzer an den betrieblichen Einrichtungen und an der Lagerdauer orientieren. Pelletfutter entsteht durch die Formung der Futtermasse in der Pelletpresse unter Temperatureinfluss und Wasserdampfzugabe mit Ring- oder Lochmatrizen. Pelletierte Ergänzungsfutter haben eine gute Transport- und Lagerfähigkeit und sind als Siloware auch für große Reitställe gut geeignet. Pelletfutter weisen durch den Bearbeitungsprozess eine gute Stärkeverdaulichkeit auf. Müslifutter: Der Begriff Müsli ist in der Pferdefütterung nicht näher definiert. Deshalb gibt es eine Vielzahl verschiedener Ausrichtungen. Müslimischungen bestehen in der Regel aus für den Betrachter sichtbaren Komponenten. Vielfach handelt es sich um flockiertes Getreide (unter Einfluss von feuchter Wärme gewalztes Getreide). Außerdem werden je nach Ausrichtung beispielsweise fettreiche Saaten, proteinreiche Bestandteile wie getoastete Sojabohne oder Kräuter zugemischt. Zusätzlich werden pelletierte Ergänzungsfutter oder Mineralfutter zur Mineralstoff- und Vitaminergänzung zugesetzt. Durch Zugabe von Melasse oder Öl entsteht ein relativ feuchtes Müslifutter. Aufgrund der offenen Struktur und des erhöhten Feuchtigkeitsgehaltes finden Mikroorganismen ideale Lebensbedingungen, was die Haltbarkeit von Müslimischungen deutlich beeinträchtigt. Als Siloware für große Reitställe eignen sich Müslimischungen nur bedingt, da die aufgebrachten Melasse- oder Ölzugaben Verklebungen in den Transportleitungen verursachen können und ein Entmischen der Komponenten durch den Transport zu erwarten ist. Extrudate sind in der Pferdefütterung besonders als Leckerli bekannt, aber auch Ergänzungsfutter zum Grundfutter werden in Extrudate Müslifutter 45
46 Der Einsatz von Sackware eignet sich besonders für kleine Betriebe. betrieblichen Begebenheiten ausrichten. Als Richtschnur gilt, dass das Futter nach spätestens sechs bis acht Wochen verbraucht sein sollte, um hygienischen Problemen vorzubeugen. Extrudatform angeboten. Nach dem Mischen und Mahlen der eingesetzten Komponenten (zumeist Getreide) wird das Mehl im Extruder mittels Schneckenförderung gegen ein Druckgefälle bei gleichzeitiger Einleitung von heißem Wasserdampf gefördert. Die anschließende Formgebung erfolgt durch Pressen des Futterbreis durch Ring- oder Flachmatrizen. Diese hydrothermisch-mechanische Bearbeitung der Komponenten (Temperatur etwa 130 bis 160 C und 60 bar Druck) bewirkt eine deutliche Verbesserung des Stärkeaufschlussgrades und der Verdaulichkeit. Gleichzeitig werden Keime nahezu vollständig abgetötet. Verpackung Ergänzungsfutter werden als Sackware, als big-bags (Kunststoff-Verpackungen) oder big-packs (Pappkartons) in 500 bis kg- Gebinden oder als lose Ware für das Silo geeignet angeboten. Die Auswahl der Gebinde sollte der Pferdebesitzer entsprechend der zu fütternden Pferde und nach den Pferdefutter in Sackware zeichnet sich dadurch aus, dass es gegenüber Einflüssen von außen gut abgeschirmt ist und Schadnager und Vögel keinen Zugriff haben. Nachteilig sind die relativ aufwendige Handhabung und die Entsorgung der Leersäcke. Darüber hinaus ist Sackware im Einkauf teurer als lose Ware. Bei der Lagerung der Ware sollte darauf geachtet werden, dass der Lagerraum sauber, kühl und trocken ist. Die Säcke sollten nicht direkt auf dem Boden gelagert werden, sondern auf Paletten, um den Feuchtigkeitseintritt über den Boden zu vermeiden. Für Pferdebetriebe mit bis zu kg Futterbedarf alle sechs bis acht Wochen eignen sich big-bags oder big-packs. Hierbei handelt es sich um Kunststoffverpackungen oder um Pappkartons, die in der Regel oben offen sind. Häufig sind diese Gebinde im Einkauf günstiger als Sackware. Sie sind aber nicht gegen Schadorganismen geschützt. Leere bigpacks oder big-bags sollten nur einmal verwendet werden, um hygienischen Problemen vorzubeugen. Siloware: Für größere Reitbetriebe bieten sich der lose Futterbezug und die Lagerung im Unterdachsilo oder im wetterbeständigen Außensilo aus Kunststoff an. Im Vergleich zu verpacktem Futter ist lose Ware deutlich preiswerter im Einkauf. Wichtig ist eine regelmäßige und gründliche Reinigung des Silos (vor jeder Futterbefüllung), um den Reststaub 46
47 FUTTERMITTEL zu entsorgen. Eine intensive Siloreinigung (spätestens alle drei bis sechs Monate) gewährleistet zudem einen guten Hygienestatus des Futters. Außensilos sollten möglichst keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein, um Schwitzwasserbildung im Silo zu vermeiden. Futtermittelkennzeichnung (Deklaration) Es ist gesetzlich vorgeschrieben Futtermittel zu kennzeichnen. Die sogenannte Deklaration gibt Hinweise zur Zusammensetzung, zu den Nähr- und Wirkstoffen, zur Zweckbestimmung und zum Mindesthaltsbarkeitsdatum des Futters. Der Aufbau einer Deklaration gliedert sich wie folgt: Namensgebung des Produktes: Produktname und Ausrichtung (z.b. Ergänzungsfutter für Pferde und Ponys). Pferdeglück Ergänzungsfuttermittel für Pferde, pelletiert Inhaltsstoffe: Rohprotein 11,0 %; Kalzium 1,10 %; Phosphor 0,45 %; Natrium 0,23 %; Rohfett 1,9 %; Rohfaser 19,0 %; Rohasche 8,0 % Zusatzstoffe je kg: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: I.E. Vitamin A (E 672), I.E. Vitamin D (E 671) als Vitamin D3, 70 mg Vitamin E als DL-a-Tocopherolacetat, 50 mg Eisen (E 1) aus Eisencarbonat, 0,6 mg Jod (E 2) aus Calciumjodat, wasserfrei 0,3 mg Kobalt (E 3) aus Basischem Kobalt-(II)-Carbonat, Monohydrat, 3 mg Kupfer (E 4) aus Aminosäure-Kupferchelat, Hydrat, 8 mg Kupfer (E 4) als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat, 60 mg Mangan (E 5) aus Mangan-(II)-oxid 50 mg Zink (E 6) aus Zinksulfat, Monohydrat 0,4 mg Selen (E 8) aus Natriumselenit Zusammensetzung: Luzernegrünmehl, Haferschälkleie, Weizenkleie, Gerste, ZR-Melasse, Melasseschnitzel, Kalziumcarbonat, Sonnenblumenextr.schrot, Natriumchlorid, Pflanzenfett (Palm, Raps, Kokos, Sonne), Monodikalziumphosphat (anorganisch) Hinweis: Futtermittel enthält Zusatzstoffvormischung Deutsche Mühle Mühlenstraße 20, Musterhausen Inhaltsstoffe: Chemische Zusammensetzung des Futters (nach Weender Futtermittelanalyse bestimmt); Obligatorische Inhaltsstoffwerte sind: Rohprotein, Rohfett, Rohasche und Rohfaser. Außerdem werden häufig der Kalzium-, Natrium- und Phosphorgehalt angegeben. Die Energiegehaltsdeklaration ist derzeit gesetzlich nicht vorgeschrieben, kann aber freiwillig erfolgen. Bei der Angabe der Inhaltsstoffe werden die Gesamtmengen der Inhaltsstoffe pro kg Futtermittel aufgeführt. Zusatzstoffe: Dem Produkt zugesetzte Stoffe wie Spurenelemente und Vitamine, für die ein Höchstgehalt bei Pferden festgelegt wurde. Genannt werden Bezeichnung, Kennnummer, zugesetzte Menge je kg Futtermittel und entsprechende Bezeichnung der Funktionsgruppe. Nicht beachtet werden natürliche Mengen, die aus den Komponenten des jeweiligen Futtermittels stammen. So gibt der Wert von Kupfer nur den Gehalt an, der dem Produkt zugesetzt wurde und nicht den tatsächlichen Gehalt, der durch den Gehalt aus den Futtermittelkomponenten höher ausfällt. Zusammensetzung: Die im Futtermittel enthaltenen Einzelkomponenten oder Komponentengruppen in absteigender Reihenfolge der prozentualen Anteile. 47
48 An erster Stelle steht demnach die Komponente, die den höchsten prozentualen Anteil im Produkt aufweist. Darüber hinaus sind aufgeführt: Name und Anschrift des für die Kennzeichnung verantwortlichen Futtermittelunternehmers, die Zulassungsnummer des herstellenden Betriebes (muss nicht zwangsläufig Inverkehrbringer sein) und die Nettomasse (Gewicht des enthaltenen Futtermittels). Zur Rückverfolgbarkeit dient die Kennnummer der Partie. WASSER Wassermangel führt schnell zu Leistungsminderungen, Verdauungsstörungen und Erkrankungen (Nierenkolik, Verstopfungskolik). Pferde nehmen je nach Leistung und Witterung bis zu zehn Liter je 100 kg Körpermasse auf. Von einem starken Anstieg des Wasserbedarfes ist bei unter hoher Beanspruchung stehenden Pferden (Vielseitigkeit, Distanzreiten, Waldarbeit, allgemein intensiver Turniersport) auszugehen. Dabei ist auf eine jederzeit ausreichende Wasserversorgung zu achten. Dazu gehört nicht nur die sorgfältige Tränkenkontrolle im Stall im Winter, sondern auch im Sommer. Bei sehr starkem Schweißverlust kann die Verabreichung spezieller Salzlösungen sinnvoll sein. Auch bei Weidehaltung muss jederzeit ausreichend einwandfreies Tränkwasser über spezielle Weidetränken oder geeignete Wasserbehälter sichergestellt werden. Um bakteriellen Verunreinigungen vorzubeugen, ist es ratsam, Kübeltränken täglich zu säubern und mit frischem Wasser zu befüllen. 48
49 PRAKTISCHE RATIONSPLANUNG FUTTERVORLAGE UND FÜTTERUNGSTECHNIK Pferde sind von Natur aus 16 Stunden pro Tag mit der Futtersuche und -aufnahme beschäftigt. Darüber hinaus basierte die ursprüngliche Nahrung auf rohfaserreichen, nährstoffarmen Pflanzen. Der Verdauungstrakt hat sich im Laufe der Evolution auf diese Futtersituation eingestellt und hat sich bis heute nur wenig verändert. Der Magen ist bei einem 500 kg Pferd mit etwa 20 Litern Fassungsvermögen relativ klein. Trotz veränderter Lebens- und Futterbedingungen sind diese Anforderungen auch heute bei der Fütterung zu beachten. So sollten Pferde ausreichend Grobfutter über den Tag verteilt angeboten bekommen. Das führt zu längerfris tiger Beschäftigung der Pferde. Verhaltensanomalien wie Weben, Koppen oder Boxenlaufen treten dadurch seltener auf. Auch die Kraftfuttergabe sollte mehrfach während des Tages erfolgen, um den Verdauungstrakt nicht zu überlasten. Besonders der kleine Magen reagiert auf übergroße Futtermengen sehr empfindlich, aber auch die Nährstoffaufnahmekapazität der Dünndarmschleimhaut ist begrenzt. Faustformel: Nicht mehr als 0,4 kg Krippenfutter pro 100 kg Lebendgewicht und Mahlzeit. 49
50 Gute Fütterungstechnik sollte sich möglichst an den ursprünglichen Fressgewohnheiten, also der kontinuierlichen Aufnahme kleiner Futtermengen orientieren. Bei einem Pferd mit 500 kg sollte das Gewicht einer Krippenfutter-Mahlzeit 2,0 kg nicht überschreiten. Daraus folgt, dass Sportpferde mit einem erhöhten Nährstoffbedarf mindestens drei Futterrationen pro Tag bekommen sollten. Verteilung der Krippenfutter-Rationen: Bis 4,0 kg Krippenfutter pro Tag mindestens zwei Futtermahlzeiten, 4,5 bis 7,0 kg Krippenfutter pro Tag mindes tens drei Futtermahlzeiten und über 7,0 kg Krippenfutter pro Tag mindestens vier Futtermahlzeiten. Eine anschließende Ruhepause von mindestens einer Stunde ist für eine ungestörte Verdauung zu empfehlen. Die Verteilung des Krippenfutters sollte gleichmäßig erfolgen. Bei der Grobfuttervorlage sollte bis zu 50 Prozent der Gesamtmenge am Abend vorgelegt werden, um das Intervall bis zur Morgenfütterung zu überbrücken. Zur genauen Futterbemessung ist das Krippenfutter und auch das Raufuttergewicht abzuwiegen und auszulitern. Neigen Pferde zur hastigen Krippenfutteraufnahme, sollte durch Fresshindernisse im Futtertrog (Steine oder Holzstücke) die Aufnahmegeschwindigkeit gesenkt werden. Auch Heu- oder Strohhäcksel mit einer Schnittgutlänge von etwa fünf Zentimeter eignen sich, die Kauintensität der Pferde deutlich anzuregen. Das Krippenfutter sollte nach einer halben Stunde verzehrt sein. Dauert die Aufnahme länger, sollten die Zähne auf Haken überprüft werden. Viele kleine Portionen über den Tag verteilt sind zu empfehlen, doch spricht häufig die Arbeitswirtschaft dagegen. Diesbezüglich hat sich der Einsatz von Kraftfutterautomaten in der Pferdefütterung bewährt. Neben Einzelplatzstationen gibt es automatische Fütterungsanlagen, die über Rohrleitungen die Futtertröge der Pferde mit Krippenfutter versorgen. In Lauf- und Bewegungsställen sind Futterstationen mit tierindividueller Erkennung anzutreffen. Allen Systemen gleich ist die Möglichkeit, viele kleine Futterportionen über den Tag verteilt anzubieten. 50
51 Mit feinmaschigen Heunetzen können sich Pferde gut beschäftigen und die Futteraufnahmezeit verlängern. Anders als auf diesem Foto sollten die Netze möglichst bodennah angeboten werden. Grobfutterautomaten kommen der natürlichen Fresshaltung sehr nahe und können im Gegensatz zu höher angebrachten Raufen der Senkrückenbildung vorbeugen. Auch Grobfutter kann über Futterautomaten angeboten werden. Neben der mengenmäßigen und zeitgesteuerten Portionierung ist der Raufutterverlust durch Zertreten deutlich geringer. Unter natürlichen Verhältnissen nehmen Pferde das Gras vom Boden auf. Sinnvoll ist, diese natürliche Fresshaltung auch in der Boxenhaltung bei der Raufuttergabe anzubieten. Die früher üblichen Raufen oberhalb der Krippen sind nicht zu empfehlen. Staubbildung während der Beschickung und Futteraufnahme können zu Reizungen der Augen und des Atmungsapparates führen. Außerdem ist die Fresshaltung unnatürlich. Aufgrund der Gefahr von Verunreinigung wird Krippenfutter aus Trögen in einer Höhe von 50 bis 60 cm gefüttert. Pferdekrippen sollten ausreichend groß sein (mindestens 50 Liter Fassungsvermögen, bei einer Länge von etwa 70 cm, einer Breite von etwa 35 cm und einer Tiefe von etwa 20 cm). Das Futter soll in dünner Schicht verteilt werden, um die hastige Futteraufnahme zu verhindern. Der Trog sollte so beschaffen sein, dass er dem Pferd selektives Fressen ermöglicht. Durch Querwülste im Boden des Troges kann die Futteraufnahmegeschwindigkeit zusätzlich reduziert werden. Der obere Rand sollte gewulstet sein, damit das Futter nicht aus dem Trog geblasen oder geschoben werden kann. Güns tig sind Tröge aus Steinzeug, da sie gut zu reinigen und stabil sind, aber auch robuste Plastiktröge haben sich bewährt. Die Tröge sollten zur Stallgasse ausgerichtet sein, da Pferde in der Regel zur Stallgasse stehen und somit die Verunreinigungsgefahr durch Einkoten geringer ist. Zudem ist das Beschicken mit Krippenfutter einfacher zu handhaben. Die Tränke sollte dem Futtertrog gegenüber seitlich versetzt angebracht sein, 51
52 Ein Pferdetrog sollte selektives Fressen ermöglichen und zur Stallgasse ausgerichtet sein. Leichter Arbeit: Erhaltungsbedarf + 25 Prozent Leistungszulage Mittlere Arbeit: Erhaltungsbedarf + 25 bis 50 Prozent Leistungszulage Schwere Arbeit: Erhaltungsbedarf + > 50 Prozent Leistungszulage Voraussetzung für die dem Anspruch angemessene Rationsgestaltung ist die angepasste Leistungseinschätzung, die abhängt von der Dauer der Intensität der Leistung, dem zu tragenden oder zu ziehenden Gewicht und der Wärme- und Schweißproduktion des Pferdes während der Arbeit. um die häufige Wasseraufnahme während des Fressvorgangs zu erschweren und Verunreinigungen durch Futterreste aus dem Maul des Pferdes zu verhindern. Die Tränke sollte in einer Höhe von 60 cm angebracht sein und durch Rundeisen vor Schlag oder Verunreinigungen durch Einkoten geschützt sein. FÜTTERUNG VON REITPFERDEN Pferde, egal ob Freizeitpferd, Therapiepferd, Schulpferd, Arbeitspferd, Sportpferd, Fahrpferd oder Rennpferd, müssen Muskelarbeit leisten. Die genaue Beschreibung der ausgeführten Arbeit nach Zeitdauer der Belastung, Strecke, Zeit, Gewicht oder äußeren Bedingungen ist nur begrenzt möglich. Üblich ist die pauschale Einteilung der Arbeitsleistung nach leichter, mittlerer und schwerer Arbeit. Der jeweilige, den Erhaltungsbedarf übersteigende Mehrbedarf an verdaulicher Energie liegt grob eingeteilt bei: Beispiele für die Leistungseinteilung bei Reitpferden: Leichte Arbeit: z. B. 30 Minuten Schritt, 20 Minuten Trab, 10 Minuten Galopp Mittlere Arbeit: z. B. Verlängerung der Gesamtarbeitszeit auf etwa zwei Stunden oder Intensivierung der Trab- und Galoppeinheiten Schwere Arbeit: kurzfristige Höchstleistungen, z. B. über Renndistanzen, lang anhaltende Ausdauerleistungen wie z. B. Distanzritte, Zugleistungen im Wald oder intensives Training verbunden mit sehr hoher Schweißproduktion Bei der Auswahl geeigneter Rationskomponenten sollte die Arbeitsbelastung im Fokus stehen. Pferde mit einer geringen Leistungsbeanspruchung haben nur einen geringen Mengenbedarf an Krippenfutter. Sinnvoll ist 52
53 Der Energie- und Nährstoffbedarf eines Pferdes hängt stark von der Intensität dessen sportlicher Beanspruchung ab. Pferdehalter überschätzen oft den Leistungsbedarf ihrer Pferde. der Einsatz energieschwächerer Krippenfuttermittel. Neben der ausreichenden Grobfutterration eignen sich pelletierte Ergänzungsfutter mit einem erhöhten Rohfaseranteil. Dadurch wird der Energieanteil reduziert. Eine Kombination mit Hafer oder einer Hafer-Gerste-Mischung ist möglich. Wird eine Getreide-Grobfutter-Ration angestrebt, muss ein ergänzendes Mineralfutter zugefüttert werden. Einige Beispielrationen sind in Tabelle 7 aufgeführt. Bei Pferden mit mittlerer Arbeitsbelastung steigt der Energiebedarf entsprechend der Mehrbelastung an. Hier empfiehlt sich eine Krippenfutterration mit energiereicheren Komponenten. Zur Vereinfachung der Fütterung in größeren Reitställen ist auch eine Standardration für alle Pferde, zuzüglich einer Ergänzung von energiereicheren Futtermitteln für höher leistende Pferde, möglich. Die genaue Leistungseinschätzung ist von zentraler Bedeutung, da eine Energieunterversorgung nicht die notwendigen Reserven zur Verfügung stellt, eine Überversorgung aber einen Masteffekt mit häufig einhergehender Leistungsminderung verursacht. Auf die vielfach in der Praxis beobachtete Überschätzung der Beanspruchung sei in diesem Zusammenhang hingewiesen. Dies führt dazu, dass Pferde häufig zu fett werden. Eine zusätzliche Versorgung mit Mineralstoffen ist besonders bei den mit dem Schweiß abgegebenen Mengenelementen Natrium, Chlor und Kalium zu beachten. 53
54 Tabelle 7: Rationsbeispiele für Reitpferde mit 600 kg Körpergewicht (kg Futtermittel pro Pferd und Tag) Futtermittel Erhaltung Leichte Arbeit Mittlere Arbeit Heu kg Stroh kg 3 2 1,5 Hafer kg 1 1,25 Gerste, gequetscht kg Ergänzungsfutter kg 1,75 4,0 Mineralfutter g 0,1 0,05 Möhren kg 1 1 Gesamtration enthält etwa: Trockenmasse kg 8,8 8,6 10,1 verdauliches Rohprotein g verdauliche Energie MJ Freier Zugang zum Salzleckstein Bei jungen Pferden im beginnenden Training (z. B. Anreiten, Vorbereitung zur Körung und Stutenleistungsprüfung) geht es unter anderem um den Zuwachs an Muskelmasse. Hinzu kommt die Stärkung des Bandapparates, der Sehnen und der Gelenke. Muskelaufbau benötigt neben der Zulage an Energie auch eine leicht erhöhte Proteinzufuhr. Dies sollte in der Rationsplanung beachtet werden. Eine übertriebene Mast der jungen Pferde sollte jedoch unbedingt vermieden werden. Der vermeintlich gute optische Eindruck getriebener Pferde kann aufgrund deutlich erhöhter Belastung des Bewegungsapparates zu negativen gesundheitlichen Auswirkungen führen. Bei überfütterten Pferden ist zudem eine Bewertung der Körperproportionen nur schwer möglich. FÜTTERUNG DER ZUCHTSTUTEN UND AUFZUCHTPFERDE Fütterung der Zuchtstuten Eine bedarfsgerechte Fütterung in jeder Leistungsphase ist die Voraussetzung für fruchtbare und langlebige Zuchtstuten. Sowohl Über- als auch Unterversorgungen an Energie, Eiweiß, Mineralstoffen und Vitaminen können die Fruchtbarkeitsleistung negativ beeinflussen. Keim- bzw. toxinbelastetes Futter kann für Infektionen, Fehlgeburten und Missbildungen verantwortlich sein. Hinsichtlich der leistungsbezogenen Ernährung der Zuchtstuten ist zwischen der nicht tragenden und niedertragenden Phase bis einschließlich 7. Trächtigkeitsmonat, der hochtragenden Phase vom 8. bis 11. Monat und der Laktation bis zum 5. Monat zu unterscheiden. Nicht tragende und niedertragende Stuten sind grundsätzlich auf Erhaltungsbedarf zu füttern. Wird mit ihnen gearbeitet, muss die Nährstoffversorgung der Leistung angepasst werden. Vor und während der Decksaison ist der Futterzustand von besonderer Bedeutung. Zu üppig ernährte Stuten oft in Verbindung mit mangelnder Bewegung neigen zu Fruchtbarkeitsstörungen wie Beeinträchtigung der Eierstocksfunktion und Erhöhung des Resorptionsrisikos. Zu fette Stuten sollten deshalb rechtzeitig vor der Decksaison 54
55 PRAKTISCHE RATIONSPLANUNG abspecken, entweder durch Kraftfutterabzug und/oder durch zusätzliches Arbeiten. Erfolgt die Gewichtsreduzierung erst während der Decksaison, kann die Mobilisierung der Fettreserven die Zyklusanzeichen abschwächen. Andererseits kann ein zu starkes Abspecken auch ins Gegenteil umschlagen und das Rosseverhalten deutlich verzögern. Bei Stuten mit Fohlen bei Fuß ist die Ernährung der Stute auf die Milchproduktion auszurichten. Unterversorgungen können Zyklusstörungen und ein erhöhtes Risiko für frühen embryonalen Fruchttod bei bereits erneut bestehender Trächtigkeit hervorrufen. Unter normalen Bedingungen sollte bereits ab Herbst ein ausgewogener Futterzustand Ziel der Fütterung der zu deckenden Stute sein. Etwa zwei Wochen vor dem geplanten Decktermin hat es sich zur Verbesserung der Eierstockfunktion bewährt, die übliche Energieversorgung um etwa 20 Prozent durch 1,5 kg Kraftfutter pro Tag anzuheben. Einige Wochen vor der Belegung ist eine ausreichende Versorgung mit den Vitaminen A und E sicherzustellen. Von Januar bis April können tägliche Zulagen von I.E. Vitamin A und 18 mg Vitamin E je 100 kg Körpermasse sinnvoll sein. Eine gute natürliche Vitamin-A-Quelle ist auch das in Möhren und Grünmehlen als Vorstufe von Vitamin A reichlich enthaltene ß-Carotin. Nach vorliegenden Erfahrungen gelten 40 mg ß-Carotin je 100 kg Körpergewicht und Tag als ausreichend. Während der Stallperiode bilden gutes Heu, Stroh und Grassilage die Basis der Rationen für nicht tragende und niedertragende Stuten. Der Kraftfutteranspruch ist sehr gering. Tabelle 8: Beispielsrationen für nicht tragende und niedertragende Stuten mit etwa 600 kg Körpergewicht (kg Futtermittel pro Stute und Tag) Ration Futtermittel Heu 8 8 Grassilage (50 % TM) 12 Heulage (70 % TM) 9 Weidegras (19 % TM) 35 Futterstroh 1 1,5 1,5 1 1,5 Hafer 0,5 0,5 Gerste (zerkleinert) 0,75 Ergänzungsfutter 0,5 Möhren Mineralfutter (vitaminiert) 0, ,08 0,06 0,05 Gesamtration enthält etwa: Trockenmasse, kg 8,4 8,3 8,3 8,5 7,9 verdauliches Eiweiß, g verdauliche Energie (DE), MJ Freier Zugang zum Salzleckstein 55
56 Für nicht tragende und niedertragende Stuten kann die Weide die alleinige Futtergrundlage sein, für Stuten mit Fohlen bei Fuß jedoch nicht. Die praktischen Rationsbeispiele in Tabelle 8 dienen als Orientierung. In den Rationen 1 bis 4 sollte das Mineralfutter ein Ca : P-Verhältnis von 1,5 : 1 aufweisen, in Ration 5 ein Verhältnis von 1 : 1 und darunter. Um embryonale Verluste zu vermeiden, sollten in den ersten sechs bis acht Wochen der Trächtigkeit keine Veränderungen in der Energieversorgung erfolgen. Energiedefizite können beispielsweise beim Wechsel vom Stall zur Weide entstehen, vor allem wenn dieser Übergang mit Verdauungsstörungen (z. B. Durchfall) einhergeht. Sind die ersten Trächtigkeitswochen überstanden, schließt sich bis zum Beginn des achten Monats eine relativ problemlose Fütterungsphase an. Da das Wachstum des Fohlens in dieser Phase nur gering ist, kann eine gute Weide alleinige Ernährungsgrundlage sein. Zu empfehlen ist aber die ständige Bereitstellung eines ausgewogenen Mineralfutters. In der hochtragenden Phase ( Monat) steigen die Anforderungen an die Nähr stoff- versorgung, zumal in dieser Zeit etwa 70 Prozent des späteren Geburtsgewichtes des Fohlens aufgebaut werden und die Stute Reserven für die bevorstehende Laktation bilden muss. In diesem Abschnitt sollte die Nährstoffkonzentration je kg Futtertrockenmasse erhöht werden, da sich mit dem Wachstum des Fohlens der Verdauungstrakt verengt und sich dadurch das tägliche Futteraufnahmevermögen verringert. Ab dem achten Monat steigt der tägliche Bedarf an verdaulichem Eiweiß um das 1,4- bis 1,8-Fache des Erhaltungsbedarfes und der tägliche Energiebedarf um durchschnittlich 30 Prozent. Eine den Bedarf überschreitende Versorgung an Eiweiß und Energie führt jedoch zu einer übermäßigen Körperfettbildung mit der Folge möglicher Geburtsschwierigkeiten. Genauso sind Mangelsituationen vor allem hinsichtlich der Kalzium- und Phosphor-, aber auch der Kupfer-, Zink- und Selenversorgung sowie der Vitamin-A- und Vitamin-D-Versorgung zu vermeiden, da sie die Entwicklung von Knochen, Sehnen und Bändern des ungeborenen 56
57 PRAKTISCHE RATIONSPLANUNG Fohlens beeinträchtigen. Die Rationsplanung ist im Grunde für die Hochträchtigkeit neu vorzunehmen. Als Futter können aber die gleichen Komponenten wie in der niedertragenden Zeit verwendet werden. Etwa zwei Wochen vor dem Geburtstermin sollte das Ergänzungsfutter umgestellt und in Vorbereitung und zur Umgewöhnung auf die Laktation ein spezielles, hochwertiges Zuchtstutenfutter verwendet werden. Abrupte Kraftfutterumstellungen erst nach dem Abfohlen sind von Nachteil. In den letzten Tagen vor der Geburt sollte man auch den Raufutterverzehr etwas reduzieren und vermehrt einwandfreies Saftfutter anbieten, um so die Verdauung anzuregen und möglichen Verstopfungen zu begegnen. Auch Weizenkleie, Melasse, Leinkuchen und Mash können bei Darmträgheit die Verdauung unterstützen. Einige Beispielsrationen für hochtragende Stuten sind in Tabelle 9 aufgeführt. Die Rationen 1 bis 3 beziehen sich auf die Trächtigkeitsmonate 8 bis 10, die Rationen 4 bis 6 auf den 11. Monat. Die für das Grobfutter unterstellten Trockenmassegehalte und Futterqualitäten können in der Praxis natürlich erheblich abweichen. Zur richtigen Einschätzung der Grobfutterqualität sind Futteruntersuchungen zu empfehlen. Auch der in Ration 6 kalkulierte Weidefutterverzehr ist unter Praxisbedingungen nur schwer zu erfassen. Grasaufnahme und -qualität können starken Schwankungen unterliegen. In der Hochträchtigkeit kommt der Mineralstoff- und Vitaminversorgung besondere Bedeutung zu. Die Mineralien werden vermehrt in das embryonale Skelett eingelagert. Für Kalzium und Phosphor besteht ein hoher Bedarf. Unter den Spurenelementen sind Kupfer, Zink und Selen hervorzuheben. Tabelle 9: Beispielsrationen für hochtragende Stuten mit kg Körpergewicht (kg Futtermittel pro Stute und Tag) Ration Futtermittel 1* 2* 3* 4** 5** 6** Heu 8 8 Grassilage (50 % TM) 12 Heulage (70 % TM) Weidegras (19 % TM) 35 Futterstroh 1,5 1,5 1, Hafer 2 1,5 1, Gerste (zerkleinert) 1 1 0,5 Ergänzungsfutter 0, Möhren Mineralfutter (vitaminiert) 0,1 0,1 0,08 0,05 0,05 0,05 Gesamtration enthält etwa: Trockenmasse, kg 10,3 9,9 10,1 9,4 9 9 verdauliches Eiweiß, g verdauliche Energie (DE), MJ *8. bis 10. Monat, **11. Monat; freier Zugang zum Salzleckstein 57
58 Übermäßiges Körperfett kann Geburtsschwierigkeiten zur Folge haben. Die ausschließliche Weidehaltung laktierender Stuten verlangt ein vielseitig zusammengesetztes und ausgewogenes Grünfutterangebot mit einer teilweise notwendigen Energie-, Protein- und Mineralstoffergänzung. Hinsichtlich der Fohlenentwicklung haben sie wichtige Funktionen zu erfüllen. Da vor allem Grobfuttermittel nur geringe Mengen an Kupfer, Zink und Selen aufweisen, sind zur Bedarfsdeckung gezielte Ergänzungen über geeignete Mineralfutter oder Zuchtstutenfutter notwendig. In der Hochträchtigkeit ist der Bedarf an Vitamin A und D etwa doppelt so hoch wie in der niedertragenden Zeit. Bei Weidegang ist die Stute in der Regel ausreichend versorgt. Bei Stallfütterung müssen die Vitamine über vitaminierte Mineralfutter oder das fertige Kraftfutter ergänzt werden. Der über die gesamte Trächtigkeit gleich bleibende Vitamin-E-Bedarf ist ebenfalls am besten über entsprechende Ergänzungsfutter abzudecken. Gute Vitamin-E-Träger sind Pflanzenöle und Grünmehle. Laktierende Stuten stellen sehr hohe Anforderungen an die Nährstoffversorgung. Beispielsweise entspricht der tägliche Energiebedarf in den ersten Laktationsmonaten dem eines Sportpferdes mit höchster Leistung. Der tägliche Eiweißbedarf beträgt sogar das Doppelte von dem eines Hochleistungspferdes, 58
59 PRAKTISCHE RATIONSPLANUNG denn eine Milchleistung von 15 oder 20 Litern pro Tag ist keine Seltenheit in dieser Phase. Die notwendigen Nährstoffmengen sind nur über hohe Kraftfuttergaben, die über mehrere Mahlzeiten am Tag verteilt werden müssen, zu erreichen. Als hochwertige Eiweißfutter eignen sich industriell hergestellte, hochwertige Zuchtstutenfutter mit mehr als 14 Prozent Rohprotein und 12,0 MJ DE pro kg Futter oder Sojaextraktionsschrot. Entstehen bei dieser großen Stoffwechselleistung Mängel in der Nährstoffversorgung, kann es zu Fruchtbarkeitsstörungen wie schwacher oder fehlender Fohlenrosse kommen. Die gezielte Zufütterung mit Kraftfutter ist besonders in den Monaten wichtig, in denen die laktierenden Stuten noch keinen Weidegang haben. Ist der Wechsel vom Stall zur Weide schonend und erfolgreich vollzogen, können die täglichen Kraftfuttergaben reduziert werden. Aber je nach Qualität der Weide und Höhe des täglichen Grasverzehrs muss weiterhin zusätzlich Kraftfutter und Mineralfutter ergänzt werden. Dies gilt erst recht, wenn nur Halbtagsweiden zur Verfügung stehen. Welche Ergänzungen bei Weidegang notwendig sein können, verdeutlichen die Beispielsrationen Nummer 4 bis 7 von Tabelle 10. Generell kann die Zusammensetzung des Kraftfutters im Frühjahr und Frühsommer etwas eiweißärmer ausfallen. Mit fortschreitender Vegetation und bei überständigem Weidegras sind eiweißreichere Ergänzungen notwendig. Tabelle 10: Beispielsrationen für laktierende Stuten mit etwa 600 kg Körpergewicht (kg Futtermittel pro Stute und Tag) Ration Futtermittel 1* 2* 3* 4* 5* 6** 7** Heu Grassilage (50 % TM) 12 Heulage (70 % TM) 8 Weidegras (19 % TM) 30*** 50 30*** 40 Futterstroh Hafer 6, ,5 1 1,5 2,5 Gerste (zerkleinert) 2,5 Sojaextraktionsschrot 1 0,5 Ergänzungsfutter für Zuchtstuten 4 4,5 1,5 Möhren 2 2 Mineralfutter (vitaminiert) 0,1 0,1 0,05 0,05 0, ,1 Gesamtration enthält etwa: Trockenmasse, kg 13,0 13,4 12,8 12,8 14,3 12,3 11,6 verdauliches Eiweiß, g verdauliche Energie (DE), MJ *1. bis 3. Laktationsmonat, **4. und 5. Laktationsmonat, ***Beispiel für Halbtagsweide 59
60 Grundsätzlich sollten die ersten Kraftfuttergaben nach dem Abfohlen noch knapp bemessen sein und erst nach ein paar Tagen allmählich gesteigert werden, sodass nach zehn bis 14 Tagen die erforderliche Höchstmenge erreicht wird. Neben Ergänzungsfutter und Sojaschrot eignen sich als Kraftfutter Hafer und auch zerkleinerte Gerste. Je höher die Anteile an Getreide und Sojaschrot sind und je weniger fertiges Zuchtstutenfutter eingesetzt wird, desto höher muss die jeweilige Mineralfutterergänzung sein, um vor allem Defizite in der Spurenelement- und Vitaminversorgung zu vermeiden. Im Futtermittelhandel werden die unterschiedlichsten Mineralfuttertypen angeboten, was die richtige Auswahl oft erschwert. Zu beachten sind beispielsweise die unterschiedlichen Kalzium- und Phosphoranteile der Mineralfutter, zumal die Gesamtration für laktierende Stuten, unabhängig von der Futtergrundlage, ein Ca : P-Verhältnis von etwa 1,3 : 1 aufweisen sollte. In den Beispielsrationen Nummer 2, 4, 5, 6 und 7 wurde jeweils ein Mineralfutter mit einem sehr engen Ca : P-Verhältnis eingerechnet. Das Mineralfutter in Ration Nummer 4 sollte ein möglichst weites Ca : P-Verhältnis (3-4 : 1), das Mineralfutter in Ration Nummer 3 ein engeres von 2 : 1 aufweisen. Um eine ausreichende Natrium- und Chlorversorgung zu gewährleisten, sollten immer zusätzlich Salzlecksteine bereitgestellt werden. Zu Beginn der Weideperiode stehen mit dem Grünfutter genügend ß-Carotin (Vorstufe von Vitamin A) und Vitamin E zur Verfügung. Vitamin D wird bei Weidegang ausreichend über die Haut durch Sonneneinstrahlung gebildet. Knapp ist die Zufuhr an den Spurenelementen Kupfer, Zink und Selen. Auf ausreichende Ergänzungen ist deshalb gerade bei Weidegang zu achten. Laktierende Stuten mit 15 bis 20 Litern Milchleistung haben den doppelten Eiweißbedarf wie ein Hochleistungspferd. 60
61 In den ersten Lebenswochen stellt die Mutterstute die Fohlennahrung in passender Zusammensetzung und Dosierung. Wenn die Milchmenge der Stute abnimmt, nehmen die Fohlen auch Weidegras auf. hochaufgeschlossen und leicht verdaulich sein. Besonders wichtig ist die frühzeitige Futteraufnahme der Fohlen bei geringer Milchleistung der Stute. Fohlenfutter sollten einen Proteingehalt von mindestens 14 Prozent, besser 18 Prozent aufweisen und einen hohen Anteil biologisch wertvollen Eiweißes enthalten. In der Säugezeit wird bis zu einem kg Fohlenfutter pro Tag gefüttert. Der zusätzliche Bedarf an Energie wird gegebenenfalls durch gequetschten Hafer und Zulage sehr guten Grobfutters abgesichert. Nach dem dritten Monat nimmt die gebildete Milchmenge allmählich ab, entsprechend ist das gesamte Nährstoffangebot zu reduzieren (siehe Rationen Nummer 6 und 7) Fohlen beginnen bereits in der 2. bis 3. Lebenswoche spielerisch mit der Kraftfutteraufnahme. Fohlenfutter müssen schmackhaft und attraktiv und die Komponenten Die Futtermenge für Fohlen muss sich am Entwicklungsstand orientieren, das heißt ein Treiben (übermäßige Energiezufuhr) ist genauso zu vermeiden wie eine Unterversorgung, um Entwicklungsstörungen zu vermeiden. Als Richtschnur kann eine Gesamtkrippenfuttermenge von etwa einem kg pro 100 kg Körpergewicht und Tag angenommen werden. 61
62 Viele Ponys und Kleinpferde unterscheiden sich gegenüber Großpferden im Futteranspruch. FÜTTERUNG DER PONYS UND KLEINPFERDE Ponys und Kleinpferde sind im Allgemeinen genügsamer und leichtfuttriger als Großpferde. Dies gilt insbesondere für Extensiv- bzw. Robustrassen (z. B. Islandpferde, Shetlandponys, Fjordpferde). Die üblichen Energie- und Eiweißmengen für den Erhaltungsstoffwechsel können bei diesen Herkünften deshalb um etwa zehn Prozent reduziert werden. Der Schwerpunkt der Versorgung liegt hauptsächlich auf Raufutter. Mit Kraftfutter, vornehmlich getreidehaltigem, ist äußerst sparsam umzugehen. Häufig kann ganz auf Kraftfutter verzichtet werden. Wichtig ist jedoch eine regelmäßige, gesicherte Mineralstoff- und Vitaminergänzung. Inwieweit Zusammenhänge zwischen den oft bei Isländern auftretenden Sommerekzemen und der Fütterung bestehen, ist nach wie vor umstritten. Vielmehr ist hier der Befall durch Gnitzen oder Kriebelmücken als Ursache anzunehmen. So lassen sich wie bei den Großpferden Grassilage, Getreide und Mohrrüben ergänzen. Das mit täglich 30 g pro Tier zu verabreichende Mineralfutter sollte gut vitaminiert und ausreichend mit Spurenelementen angereichert sein und ein Ca : P-Verhältnis von etwa 1,5 : 1 aufweisen. FÜTTERUNG VON HOCHLEISTUNGSPFERDEN Rennpferde, Distanzpferde, Vielseitigkeitspferde oder Arbeitspferde müssen hohe Leistungen erbringen. In Abhängigkeit von der Geschwindigkeit, des Zug- oder Tragegewichtes und auch der Dauer der Belastung steigt der Energiebedarf deutlich an. Die Anforderungen an die Rationen dieser schwerleistenden Pferde sind jedoch unterschiedlich. Bei Rennpferden muss die Energie schnell verfügbar sein; das Gewicht des Magen- Darm-Traktes soll jedoch so niedrig wie möglich gehalten werden, um das Pferd im Rennen nicht unnötig zu belasten. Die Schweißverluste von Elektrolyten (Natrium, Chlor und Kalium) müssen ausgeglichen 62
63 Hochleistungspferde benötigen zusätzliche Energie und, bei starker Schweißbildung, zusätzliches Wasser und Elektrolyte. Tabelle 11: Rationsbeispiele für Hochleistungspferde mit 600 kg Körpergewicht (kg Futtermittel pro Pferd und Tag) Futtermittel Rennpferde Distanzpferde Heu kg 5 8 Hafer kg 2 2,5 Mais, aufgeschlossen kg 1 1,5 Pflanzenöl L 0,5 Ergänzungsfutter für Sportpferde kg 3,5 2 Gesamtration enthält etwa: Trockenmasse kg 10,5 12,1 verdauliches Eiweiß g verdauliche Energie MJ Freier Zugang zum Salzleckstein werden. Die Futterrationen basieren auf leicht verdaulichen, kohlenhydratreichen Futtermitteln bei einem leicht reduzierten Grobfutterangebot (etwa 0,7 kg pro 100 kg Lebendmasse). Hier eignen sich besonders hochenergetische Ergänzungsfutter in Müsliform zusätzlich zu Getreide. Bei der Fütterung von Distanz- oder aber auch Arbeitspferden ist im Gegensatz zu den Rennpferden eine langfristige Hochleistung gefordert. Die für gleichmäßig lange Belastung notwendige Energie kann nicht über kurzfristige Bereitstellung leicht verfügbarer Energie aus dem Futter abgedeckt werden, sondern muss über die Verbrennung von Depotfett aus dem Körper erzeugt werden. Darüber hinaus ist eine ausreichende Versorgung mit Elektrolyten wichtig, die auch in den Wettkampfpausen appliziert werden müssen. Um Flüssigkeitsmangel bedingt durch die extremen Schweißverluste vorzubeugen, 63
64 sollte Grobfutter (Heu) in bester Qualität zur freien Aufnahme angeboten werden (bis etwa vier Stunden vor Wettkampfbeginn). Dadurch wird im Dickdarm der Pferde ein Flüssigkeitsreservoir gebildet. FÜTTERUNG ALTER PFERDE Eine Alterszuordnung für Seniorenpferde ist pauschal nicht möglich. Grundsätzlich gilt jedoch, dass alte, gesunde Pferde ähnliche Ansprüche haben wie junge Pferde. Pferde mit über 20 Jahren können fit und einsatzbereit sein, wenn sie pferdegerecht gehalten, bewegt und gefüttert werden. Andere Pferde sind bereits in jüngeren Jahren durch Krankheiten wie Stoffwechselstörungen oder Zahnanomalien auf eine besondere Ernährung angewiesen. Eine Fütterungsempfehlung sollte sich daher am Gesundheitszustand und der Gewichtsentwicklung der Pferde orientieren und nicht am tatsächlichen Alter. Bei Zahnschäden, die auch altersbedingt auftreten, oder verminderter Stoffwechselleis tung sollte durch eine entsprechende Komponentenauswahl, die auf leicht verdaulichen Rohstoffen und leicht zu kauenden Rohfaserträgern basiert, begegnet werden. Getreide sollte nur gequetscht oder als Getreideflocken gefüttert werden. Grundsätzlich eignen sich für alte Pferde mit reduzierter Stoffwechselleistung hochaufgeschlossene Getreidekomponenten zu gut verdaulichem Heu und Mineralfutter. Auch Mischfutter aus Grünmehl, Getreide, Leinschrot und Bierhefe sind einsetzbar. Der Zielwert bei der Krippenfutterration liegt bei etwa 13 bis 14 Prozent Rohprotein. Die Mineralstoffversorgung muss bedarfsdeckend abgesichert sein. Überversorgungen sind jedoch wegen möglicher Harnsteinbildung zu vermeiden. Ein Anfeuchten oder Einweichen der Rationsbestandteile kann zur Vermeidung von Schlundverstopfungen und zur Erleichterung der Passage durch den Verdauungstrakt sinnvoll sein. Im Sommer sollten alte Pferde viel Weidegang haben. Der Übergang vom Da zwischen errechneter zugeführter und tatsächlich verdauter Energie große Abweichungen vorliegen können, sollte sich die Energiezuteilung alter Pferde in erster Linie am Futterzustand orientieren. 64
65 Tabelle 12: Rationsbeispiel für alte Pferde mit 600 kg Körpergewicht (kg Futtermittel pro Pferd und Tag) Futtermittel Sportpferd zum Pensionär muss schonend vollzogen werden. Neben dem Abtrainieren und der langsamen Futterumstellung ist eine entsprechende Betreuung der Pferde wichtig. Eine abrupte Umstellung kann zu einem schnellen Verfall der Tiere führen. FÜTTERUNG AUF DER WEIDE Altes Pferd Heu kg 6 Hafer, gequetscht kg 0,6 Mais, aufgeschlossen kg 1 Bierhefe + Leinschrot kg 0,2 Möhren kg 2 Mineralfutter kg 0,11 Gesamtration enthält etwa: Trockenmasse kg 8,8 verdauliches Eiweiß g 659 verdauliche Energie MJ 74 Freier Zugang zum Salzleckstein Bei Weidehaltung ist eine in allen Belangen ausgewogene Nährstoffversorgung der Pferde kaum möglich. Dafür variiert Weidegras zu stark in seinem Nährstoffgehalt, und zwar in Abhängigkeit von zahlreichen Faktoren wie Standort, Bodenbeschaffenheit, Witterung, Jahreszeit, Nutzungsart, Bewirtschaftungsintensität, Düngung, Vegetationsstadium und botanischer Zusammensetzung. Hinzu kommen Unwägbarkeiten hinsichtlich Fressverhalten und täglichem Weidegrasverzehr der Pferde. Trotz dieser vielen meist nur unzureichend einzuschätzenden Einflussfaktoren sollten notwendige Maßnahmen der Zufütterung differenziert betrachtet und leistungsbezogen angegangen werden. Für alte Pferde, die nicht mehr so gut kauen können, bietet der Handel spezielle Futtermittel als Heuersatz an. Dauergrünland besteht aus mannigfachen Pflanzenarten. Verbreitete Gräser auf Pferdeweiden sind Welsches und Deutsches Weidelgras, Wiesenlieschgras, Wiesenrispe und Wiesenschwingel. Hauptvertreter der Kleepflanzen sind Weiß- und Rotklee. An Kräutern finden sich häufig Löwenzahn, Sauerampfer, Schafgabe und Spitzwegerich. Ein Gefährdungspotenzial und deshalb unerwünscht sind Giftpflanzen. Unter normalem Vegetationsverlauf ist zu Beginn der Weidezeit im Frühjahr (vor dem Schossen) von relativ hohen Protein- und Energiegehalten sowie von niedrigen Rohfasergehalten auszugehen. Im weiteren Verlauf (Blühbeginn bis überständig) verringern sich die Protein- und Energiegehalte bei gleichzeitigem Anstieg der Rohfaserkonzentrationen (unabhängig von all diesen Einflussfaktoren). Am üppigsten ist das Nährstoffangebot normalerweise im Frühjahr und Frühsommer und bei ausreichend Niederschlag und entsprechender Bewirtschaftung noch einmal im Spätsommer oder frühem Herbst. In Relation zur Energie liefert Weidegras in jedem 65
66 Die Nährstoffzusammensetzung und der Geschmack des frischen Grases hängen stark von den Pflanzenarten, aber auch von Klima, Boden und Düngung ab. Gute Pferdeweiden haben einen trockenen, festen und möglichst kalkhaltigen Boden mit fester Grasnarbe und vielseitigem Pflanzenbestand. Vegetationsstadium überproportional viel Protein. Der Protein-Energie-Quotient (PEQ) ändert sich im Laufe des Wachstums von etwa 15 : 1 auf 11 : 1 (für Reitpferde sollte der PEQ nur 5 : 1 und für laktierende Stuten etwa 9 : 1 betragen). Stark ausgeprägt sind auch die Schwankungen bei Mineralstoffen, insbesondere bei den Mengenelementen. Das Vorkommen an Kalzium und Magnesium steigt beispielsweise mit zunehmendem Anteil an Kräutern und Kleepflanzen. Relativ viel Phosphor ist in sehr jungem, eiweißreichem Weidegras enthalten. Die Natriumgehalte dagegen sind in der Regel konstant niedrig, während die Kaliumkonzentrationen in Abhängigkeit von Bodenart und Düngung wiederum stark schwanken können. Auch die Spurenelementvorkommen hängen im Wesentlichen von Bodenart, Düngung und botanischer Zusammensetzung der Weide ab. Im Mangel sind häufig Kupfer, Mangan und vor allem Selen, was besonders in der Fohlenaufzucht zu beachten ist. 66
67 PRAKTISCHE RATIONSPLANUNG Wechsel vom Stall zur Weide Um schwere Fütterungsfehler (z. B. Durchfall, Koliken, Hufrehe) zu vermeiden, gilt es, unabhängig von allen anderen Faktoren, im Frühjahr einen möglichst schonenden Wechsel vom Stall zur Weide vorzunehmen. Die Umstellung darf auf keinen Fall von einem auf den anderen Tag erfolgen, da junges Weidegras ausgesprochen wasserreich, proteinreich und rohfaserarm ist und eine derart plötzliche Futterumstellung das Magen-Darm- System überfordern würde. Bei hofnahen Weiden sollte deshalb in den ersten Tagen nur stundenweise ausgetrieben werden. Ist dies aus technischen oder arbeitswirtschaftlichen Gründen nicht möglich beispielsweise weil die Weideflächen zu weit entfernt liegen sollte vorher über mehrere Tage frisch geschnittenes Gras im Stall verabreicht werden. Wegen des Mangels an strukturierter Rohfaser sollte während der Übergangsphase zusätzlich ausreichend Heu oder Stroh angeboten werden, um so die Rohfaserdefizite der Weide auszugleichen. Bleiben die Pferde dann länger auf der Koppel, reicht es aus, Stroh auf der Weide bereitzustellen. Nach reibungsloser Umstellung und ganztägigem Weidegang können ausgewachsene Großpferde ohne Weiteres über 50 kg Gras am Tag verzehren. Damit können im Frühjahr durchaus mehr als g verdauliches Eiweiß und mehr als 100 MJ an verdaulicher Energie pro Tag aufgenommen werden. Dieses Angebot würde den Bedarf eines Reitpferdes weit übersteigen und sogar den Eiweißbedarf einer laktierenden Stute abdecken. Wird das Gras zunehmend älter und damit trockensubstanzreicher, verringert sich die Futteraufnahme. Entsprechend sinkt das Nährstoffangebot im Verlauf der Vegetation. Die exakte Beantwortung der Frage, wie hoch der Weidegrasverzehr eines Pferdes pro Stunde oder pro Tag sein kann, ist schwierig, da verschiedene Einflussfaktoren zu beachten sind (z. B. Vegetationsstadium, Grasangebot, Tierbesatz, Dauer der Beweidung, Witterung, botanische Zusammensetzung, Beifütterung, Pferderasse, Leistungsbeanspruchung). Nach Literaturangaben nehmen Pferde ohne Eine Fressbremse kann helfen, die Futterumstellung vom Stall auf die Weide schonender zu gestalten. 67
68 besondere Belastungen im Mittel auf der Weide täglich bis zu zwei kg Trockenmasse je 100 kg Körpergewicht auf. Bei einem TM- Gehalt von 20 Prozent wären das 10 kg frisches Weidegras, entsprechend durchschnittlich etwa 280 g verdauliches Eiweiß und 22 MJ DE. Beispiel: Ein heranwachsendes Aufzuchtpferd mit einem Körpergewicht von 350 kg könnte demnach bis zu 7 kg TM oder 35 kg frisches Weidegras pro Tag aufnehmen, woraus sich beispielsweise ein Nährstoffangebot von rund 950 g verdaulichem Rohprotein und rund 75 MJ DE ergäbe. Hiermit wäre der gesamte tägliche Energiebedarf dieses jungen Pferdes abgedeckt, das Eiweißangebot läge weit über dem Tagesbedarf. Die TM-Aufnahme von Zuchtstuten ist noch höher zu veranschlagen, in der Regel muss (entweder im Stall oder auf der Weide) gezielt beigefüttert werden. Bei Zufütterung im Stall sollte man das Grobfutter vor dem Austrieb und das Kraftfutter nach dem Eintrieb verabreichen, um so Risiken von Koliken und/oder Fehlgärungen vorzubeugen. Während der Weidehaltung müssen zusätzlich ausreichend Mineralstoffe angeboten werden. Dies geschieht entweder mit einem gut mineralisierten Krippenfutter oder in Form von Lecksteinen, Leckschalen oder speziellen Mineralfuttermitteln. Der erhöhte Mengen- und Spurenelementbedarf von Fohlen ist über geeignete Fohlenaufzuchtfutter abzudecken. Jährlinge und Zweijährige sollten ständigen Zugang zu Mineralleckschalen haben. Wechsel von der Weide zur Stallfütterung Auch wenn die Weideperiode zu Ende geht, muss ein schonender Übergang auf die Stallfütterung erfolgen. Bei nachlassendem Weidegrasangebot sollten die Pferde rechtzeitig und allmählich mit Kraftfutter und Grobfutter zugefüttert werden. Die Kraftfuttermengen sind langsam über mehrere Tage zu erhöhen, das Raufutterangebot ebenso schrittweise zu steigern. Durch Zufütterung von Saftfutter kann der Übergang im Herbst reibungsloser gestaltet werden. Bei nachlassendem Weidegrasangebot sollte rechtzeitig zugefüttert werden. 68
69 PRAKTISCHE RATIONSPLANUNG Gefahren durch Giftpflanzen Während sich die Verbreitung von Giftpflanzen auf Reitanlagen vermeiden lässt, indem man die typischen Vertreter (z. B. Akazie, Buchsbaum, Eibe, Ginster, Goldregen, Kirschlorbeer, Lebensbaum, Oleander, Pfaffenhütchen, Rhododendron, Robinie, Tollkirsche) bewusst von einer Bepflanzung ausschließt oder sie entfernt, sind Auftreten und Verbreitung von Giftpflanzen auf Wiesen und Weiden kaum zu vermeiden oder nur schwer unter Kontrolle zu halten. Frische Giftpflanzen werden von Pferden zwar eher gemieden oder nur ungern gefressen, Risiken sind aber nie ganz auszuschließen. Das gilt vor allem beim Verzehr von Futterkonserven, wenn nicht alle vorhandenen Giftstoffe durch das Trocknen oder Silieren abgebaut wurden. Stilllegungsflächen, Extensivgrünlandflächen, insbesondere extensiv genutzten Pferdeweiden auf. Die giftigen Alkaloide werden auch nach Heu- oder Silagebereitung nicht inaktiviert. Wichtigste Bekämpfungsmaßnahmen sind, je nach Verbreitung, Ausstechen der Pflanzen, Nachmahd der Weideflächen bei Blühbeginn, regelmäßiger Wechsel von Mahd und Weidenutzung und gegebenenfalls Herbizidbehandlung. Auf Wiesen und Weiden häufig anzutreffen sind die artenreichen Hahnenfußgewächse, die für Pferde giftig sind, allerdings bei Trocknung und Silierung abgebaut werden. Die häufiger im süddeutschen Raum vorkommende Herbstzeit lose enthält etwa 20 verschiedene Alkaloide, In den letzten Jahren stellt die Ausbreitung der Giftpflanze Jakobskreuzkraut ein besonderes Problem dar. Die für Wegränder, Böschungen und Schuttplätze typische, gelb blühende Pflanze tritt immer häufiger auf Die Toxizität der Herbstzeitlosen geht durch Trocknung nicht verloren und kann daher mit gemähtem oder konserviertem Grünfutter noch vorhanden sein. Das Jakobskreuzkraut zählt zu den gefährlichsten Giftpflanzen für Pferde. 69
70 deren Giftwirkung auch bei der Heubereitung erhalten bleibt. Höchst giftig sind auch Fingerhutgewächse und Eisenhutarten. Das gelb blühende Johanniskraut kann bei Tieren fotosensibilisierende Wirkungen hervorrufen, indem es an nicht pigmentierten Hautstellen bei Sonneneinstrahlung Sonnenbrand auslösen kann. Besonders auf extensiv genutzten, vernachlässigten Weiden kann der grüne Adlerfarn auftreten. Weitere auf Wiesen und Weiden anzutreffende Giftpflanzen sind zum Beispiel Sumpfschachtelhalm, Wasserschierling, Goldhafer und Adonisröschen. Wer sich ausführlicher über Vorkommen, giftige Inhaltsstoffe, Verzehrsobergrenzen, gesundheitliche Gefahren oder Krankheitssymptome, Gegenmaßnahmen und Heilbehandlungen bei Vergiftungen durch Pflanzen informieren möchte, kann die umfangreichen, seitens der Universität Zürich wissenschaftlich verfassten Internetinformationen unter nutzen. LAGERUNG VON FUTTERMITTELN Pferdebetriebe brauchen umfangreiche Lagerkapazitäten, um Einstreu, Grobfutter und Kraftfutter zu lagern. Ausreichend Lagerraum bedeutet eine gewisse Unabhängigkeit im Einkauf. So kann der Betriebsleiter den aus seiner Sicht günstigsten Zeitraum wählen, um preisgünstig Einstreumaterialien, Raufutter oder auch Kraftfutter zu kaufen. In alten Gebäuden ist vielfach eine deckenlastige Lagermöglichkeit (Heu- und Strohboden) vorhanden, die den Platzbedarf auf dem Betrieb deutlich reduziert. Eine erdlastige Lagerung von Heu, Silage und Stroh bietet dagegen günstige Mechanisierungsmöglichkeiten und ermöglicht die einfache Handhabung von Großballen. Die Trennung von Vorratslager und Pferdestall bietet außerdem hygienische Vorteile. Die Außenlagerung von Heu, Silage oder Stroh ist kritisch zu sehen und nur bei ausreichendem Schutz vor Witterungseinflüssen sinnvoll. JAHRESFUTTERBEDARF Zur Ermittlung des Jahresbedarfs an Heu und Stroh (inklusive Einstreu) müssen der Pferdebestand und das durchschnittliche Gewicht der Pferde geschätzt werden. Strohmengen von fünf bis sechs kg pro Pferd und Tag reichen aus, sofern die Pferde mehrere Stunden pro Tag nicht im Stall sind. Ansonsten sollte mit zehn kg pro Pferd und Tag kalkuliert werden. Für die zu berechnende Raufuttermenge ist von einem kg pro 100 kg Lebendmasse und Tag auszugehen. Bei einem Pferdebestand von 15 Warmblutpferden (Gewicht etwa 600 kg) kann bei ganzjähriger Stallhaltung die Strohmenge pro Jahr (365 Tage) wie folgt errechnet werden: (15 Pferde x 10 kg Stroh/Tag) x 365 = kg. Der Heubedarf pro Jahr für diesen Pferdebestand beträgt (15 Pferde x 6 kg Heu/Tag) x 365 = kg. Vor der Kalkulation der Kraftfuttermenge muss die Komponentenauswahl getroffen werden. Soll nur ein alleiniges Krippenfutter 70
71 Bei allen Futtermitteln empfiehlt sich eine trockene, luftige und schadgasfreie Lagerung, nach Möglichkeit ohne direkte Sonneneinstrahlung. Stroh ist zur Erntezeit meist kostengüns tig, daher kann bei ausreichend Lagerfläche auf Vorrat gekauft werden. gefüttert werden (z. B. pelletiertes Ergänzungsfutter zu Grobfutter) kann davon ausgegangen werden, dass ein 500 kg Pferd bei leichter Arbeitsbelastung etwa drei kg Krippenfutter pro Tag benötigt; kleinere Pferde benötigen weniger, größere entsprechend mehr. Ähnlich schätzt man den Bedarf bei veränderter Arbeitsbelastung ein. Bei einem Pferdebestand mit 15 Warmblutpferden werden unter obiger Annahme 45 kg Krippenfutter pro Tag verbraucht. Der Jahresbedarf Kraftfutter liegt somit bei (15 Pferde x 3 kg Krippenf./Tag) x 365 Tage= kg. Bei solch einem Bestand ist der Futterbezug als lose Ware und die Futterlagerung in einem Futtersilo unter Umständen möglich, sofern der Futterlieferant auch Kleinmengen zu güns tigen Preisen anliefert (der Monatsverbrauch liegt bei kg). Vorteil eines losen Kraftfutterbezugs ist die gute Mechanisierbarkeit der Futterlogistik und der deutlich günstigere Preis im Vergleich zu verpackten Kraftfuttergebinden. Setzt der Betrieb auf eine Mehrkomponenten-Fütterung, muss der Betriebsleiter die Einzelmengen kalkulieren, abschätzen und prüfen, ob ein Losebezug in Frage kommt. Bei kleineren Bezugsmengen sollte trotz höherer Kosten auf verpacktes Futter zurückgegriffen werden. 71
72 FÜTTERUNG UND GESUNDHEIT DURCHFALLERKRANKUNGEN Die Entstehung von Durchfallerkrankungen (Diarrhöen) kann viele Ursachen haben: ernährungs- und stressbedingte Faktoren (Überfütterung, Futterwechsel, Futterhygienemängel, Aufregung), Parasiten (z. B. Bandwürmer), Bakterien und Viren. Stark gefährdet sind vor allem Fohlen in den ersten Lebensmonaten. Ältere Pferde sind seltener betroffen. Derartige Symptome resultieren ernährungsphysiologisch beispielsweise aus einem rapiden Wechsel vom Stall zur Weide, aus einem erhöhten Angebot sehr jungen, rohfaserarmen und eiweißreichen Futters, aus mangelndem Grobfutterverzehr sowie auch aus einer zu hohen Aufnahme an Saftfutter, Trockenschnitzeln und Kleien. Auch die übermäßige Aufnahme von kaltem Tränkwasser nach körperlichen Anstrengungen kann Durchfälle hervorrufen. Weniger bedenklich ist der Fohlenrosse- Durchfall, der etwa ein bis zwei Wochen nach der Geburt als Folge der üblichen Gewöhnung des Fohlenmagens an Milch und erstes Raufutter auftritt. Der Kot ist dann klebrig. Bei guten Hygienestandards im Stall und in der Fütterung regulieren sich diese Anzeichen. 72
73 FÜTTERUNG UND GESUNDHEIT KOLIKEN Ein fast alltägliches Problem in der Pferdehaltung sind Koliken. Unter Kolik versteht man im Allgemeinen die mit Schmerzen einhergehenden Erkrankungen des Magen-Darm- Traktes. Äußere Symptome sind beispielsweise Fressunlust, Unruhe, Flehmen, Hinlegen, Wälzen, Schwitzen, Darmkrämpfe, Blähungen und Verstopfungen. Begünstigend wirken Stressfaktoren, Überanstrengung, Haltungsfehler, Infektionen, Darmschädigungen, Parasitenbefall und Vergiftungen. Selbst ein krasser Wetterumschwung mit zunehmendem Tiefdruckeinfluss kann auf empfindliche Pferde kolikfördernd wirken. Bei entsprechenden Symptomen ist umgehend der Tierarzt zu benachrichtigen und das betroffene Pferd zunächst in Ruhe zu führen. In der Regel haben Koliken fütterungsbedingte Ursachen. Zu unterscheiden sind Verstopfungskoliken und durch Fehlgärungen hervorgerufene Gaskoliken. Verstopfungskoliken (Obstipationen) können sowohl durch zu sperriges, faseriges und unzerkleinertes als auch durch zu stark vorzerkleinertes Grün- und Grobfutter entstehen. Von Nachteil sind zu kurz gehäckseltes Stroh und Weidegras sowie Gräser mit sehr feiner Halmstruktur (Windhalm); auch zu hohe Verzehrsmengen an rohfaserreichem, stängeligem Raufutter wie Getreidestroh können zu Verstopfungen führen. Zu große Futterpausen, krasse Futterwechsel (besonders im Frühjahr), Mängel in der Wasserversorgung und mit Pilzen und Parasiten belastetes Futter begünstigen die Entstehung. Tierseitig bedingte Kolikrisiken resultieren aus einer zu hastigen, unkontrollierten Futteraufnahme mit unzureichend gekautem und eingespeicheltem Futter. Mängel in der Kauaktivität können zudem mit Zahnproblemen (Haken, Zahnwechsel, Fehlstellungen, Altersgebiss) zusammenhängen. Außerdem können sowohl Überanstrengung des Pferdes als auch Bewegungsmangel und übermäßige Unruhe und Flehmen können Anzeichen für eine Kolik sein. 73
74 Wälzen kann ein Anzeichen für eine Kolik sein, denn betroffene Pferde versuchen sich dadurch Erleichterung zu verschaffen. Sandaufnahme (sandige Flächen mit wenig Bewuchs) Koliken hervorrufen. Bei Neigung zu Verstopfungskoliken sollte der Verzehr von sehr rohfaserreichem, stängeligem und verholztem Grobfutter reduziert, gegebenenfalls auf Stroheinstreu verzichtet und der Einsatz hochverdaulichen, früh geschnittenen Heues ( Kälberheu ) bevorzugt werden. Anstelle von Stroh sollten bei gefährdeten Pferden Sägespäne eingestreut und ein Raufutterausgleich über mehr Heu vorgenommen werden. Günstig zu beurteilen ist der Einsatz pektinreicher Komponenten wie eingeweichte Trockenschnitzel und zerkleinerte Äpfel sowie anderes Saftfutter. Zur Anregung der Dickdarmaktivität hat sich die Ergänzung von B-Vitaminen über getrocknete Bierhefe bewährt. Ganz wichtig ist der ständige Zugang zu Tränkwasser. Gaskoliken (Dysbiosen) sind durch Veränderungen in der Zusammensetzung und Funktion der Mikroorganismen des Darms gekennzeichnet. Fehlgärungen entstehen zum einen durch hoch mit Keimen (Bakterien, Pilze, Hefen) belastete Futtermittel, zum anderen Hochverdauliche Futtermittel wie Klee können zu Fehlgärungen und damit zu Gaskoliken führen. durch die Aufnahme übermäßiger Kraftfuttermengen pro Mahlzeit und die Verwendung ungeeigneter Futterkomponenten. Frisches, nicht abgelagertes Getreide und in der Schwitzphase verwendetes Heu und Stroh können ebenso ursächlich sein wie gefrorenes, verdorbenes Futter. Futtermittel mit einer hohen präzäkalen (vor dem Blinddarm stattfindenden) Stärkeverdauung wie Mais und Gerste sollten nur vorbehandelt verfüttert werden, denn sie können im Dickdarm zu Fehlgärungen führen. Allgemein können zur 74
75 FÜTTERUNG UND GESUNDHEIT Vorbeuge und Abwehr fütterungsbedingter Koliken folgende Empfehlungen gegeben werden: Grundsätzlich sind nur einwandfreie, wenig keimbelastete, unverdorbene Futtermittel zu verwenden. Wichtig ist die Aufrechterhaltung und Sicherung der normalen Verdauungsabläufe: Hierzu zählen Aspekte wie genügend Ruhe und genügend Zeit beim Fressen, Verteilung des Futters auf mehrere kleine Mahlzeiten, Einsatz des Grobfutters vor dem Kraftfutter, Raufuttervorlage vor dem Weideaustrieb und Kraftfutter einsatz erst nach dem Weideabtrieb sowie eine jederzeit gesicherte und geregelte Tränkwasserversorgung. Bei zu Gaskoliken neigenden Pferden sind die täglichen Kraftfuttermengen und die Mengen pro Mahlzeit zu reduzieren und eine ausreichende Versorgung mit rohfaserreichem, spät geschnittenem Wiesenheu sicherzustellen. Hierzu zählt auch eine gute Einstreu. Bei Weidehaltung sollte das Grobfutter vor dem Austrieb und das Kraftfutter erst nach dem Abtrieb verabreicht werden. Schwer verdauliche Komponenten wie Gerste und Mais sollten mittels Druck, hoher Temperatur und Wasserdampf aufgeschlossen sein, um die Dünndarmverdaulichkeit der Stärke zu erhöhen. Auf verkleisternde Komponenten (z. B. Weizen, Roggen, Triticale) sollte man ganz verzichten. Fehlgärungen können sich des Weiteren durch übermäßigen Verzehr sehr hochverdaulicher Futtermittel wie beispielsweise jungem Gras und Klee, Äpfeln und Rüben ergeben. Günstig ist der Einsatz von aufgeschlossenen Getreideflocken und Mash. Durch kleine, kurzfristige Pflanzenölgaben von 100 bis 200 g pro Tag auf mehrere Mahlzeiten verteilt können Fehlgärungen abgemildert werden. HUFREHE Hufrehe ist eine mit Schmerzen verbundene diffuse Entzündung der Huflederhaut, die im Extrem zum Ablösen des Hufhorns führen kann. Typische Anzeichen sind beispielsweise die sägebockartige Stellung des Pferdes, Bewegungseinschränkung und Lahmheit sowie starke Erwärmung der Hufe. Direkte Ursache dieser Erkrankung ist eine übermäßig hohe Milchsäurebildung im Dickdarmbereich, die zu einer Übersäuerung bis zu einer starken ph-wert-absenkung auf 4 und damit zu einer Darmschleimhautschädigung führt. Bei dieser durch Kohlenhydratüberfütterung bedingten starken Bakterienaktivität werden Endotoxine (Gifte der abgestorbenen Bakterien) freigesetzt, die in den Blutkreislauf gelangen und zur Bildung von Histamin (Botenstoff bei Entzündungsreaktionen) führen. Im weiteren Verlauf entstehen Entzündungen, die letztlich einen Reheschub verursachen können. Für Hufrehe anfällige und erkrankte Pferde sind häufig auf Dauer nicht belastbar. Die Heilungsaussichten sind oft ungewiss. Hufrehe kann durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden: Neben einer möglichen genetischen Anfälligkeit Ponys sind beispielsweise stärker betroffen als Großpferde können Überanstrengungen, Gebärmutterentzündungen, Verdauungsstörungen, Koliken, verdorbenes Futter und auch falscher Hufbeschlag ursächlich sein. Im Vordergrund stehen allerdings Aspekte der Fütterung. Unmittelbarer Auslöser von Hufrehe sind Überangebote von im Dünndarm nur schwer verdaulichen bzw. unverdaulichen Kohlenhydraten, beispielsweise die Stärke von Gers te und Maisprodukten, die dann nach Passage des Dünndarms im Dickdarm 75
76 zu den beschriebenen Problemen führen. Bei Neigung zu Hufrehe sollten auch alle zuckerreichen Futtermittel wie Melasse, Futterzucker und melassierte Trockenschnitzel vermieden werden. Ein besonderes Gefahrenpotenzial trägt frisches Weidegras, weshalb diese Erkrankung auch häufig im Frühjahr und bei entsprechendem Aufwuchs im Herbst auftritt. Um das Hufreherisiko zu senken, sind zusammenfassend folgende Maßnahmen zu ergreifen: nur hygienisch einwandfreies Rauund Krippenfutter verwenden, immer reichlich bestes Heu und Stroh anbieten, zuckerund stärkereiche Komponenten reduzieren oder ganz vermeiden, Kraftfutter auf mehrere Mahlzeiten verteilen, im Frühjahr einen schonenden Wechsel vom Stall zur Weide vornehmen, Weidegang gegebenenfalls einschränken, nachwachsendes, stängeliges Gras nicht beweiden lassen, zu frühes Austreiben nach kalten Nächten vermeiden und gegebenenfalls fruktanarme Gräsersorten zur Neuansaat oder Nachsaat verwenden. Bei akuter Erkrankung sind die Pferde einzustallen und nicht mehr viel zu bewegen. Als Futter bestenfalls etwas Stroh anbieten, Hufe kühlen und den Tierarzt benachrichtigen. MAGENGESCHWÜRE Mit steigender Intensität der Pferdehaltung und -nutzung treten immer häufiger Magengeschwüre auf. Die Ursache von Magengeschwüren ist eine vermehrte Magensaftkonzentration und Schädigung der Magenschleimhaut durch Übersäuerung. Betroffen sind alle Altersgruppen der Pferde. Neben Haltungsmängeln (z. B. geringe Fresszeiten, fehlende Ruhezeit) und Stressfaktoren (Absetzen des Fohlens, Erkrankungen, Körungen und Auktionen, Training, schlechter Umgang) stehen Fehler in der Ernährung und Fütterungstechnik im Vordergrund. Risikofaktoren sind zu kraftfutterreiche Rationen und zu hohe Kraftmengen pro Mahlzeit auf der einen und zu geringe Grobfutterangebote auf der anderen Seite. Das Kraftfutter sollte deshalb bei ausreichend hohem Raufutterangebot (mindestens 1 kg Heu pro 100 kg Körpergewicht und Tag) auf mehrere Mahlzeiten pro Tag verteilt und auf das notwendige Maß reduziert werden. Dabei ist Heu ist vor dem Kraftfutter zu verabreichen, um eine gesunde Grundlage für geregelte Verdauungsabläufe zu schaffen. ATEMWEGSERKRANKUNGEN Auf in der Stallluft schwebende Partikel reagieren manche Pferde mit Atemwegserkrankungen. Betroffen sind Atemwege, mitunter die Bronchien und die Lunge. Auslöser können Staubbestandteile, kleinste Futterpartikel, Bakterien, Schimmelpilze und Milben Reheringe an beiden Vorderhufen bei chronischer Hufrehe (das Horn wächst nicht mehr gleichmäßig). 76
77 Holzspäne sind eine gute Alternative zur Stroheinstreu bei Pferden, die zu Atemwegserkrankungen neigen. Zähne und Gebiss müssen regelmäßig untersucht werden. sein. Diese verschiedenen Teilchen stammen aus dem Futter und der Einstreu. Luftverunreinigungen entstehen häufig beim Einstreuen der Ställe und beim Aufschütteln von Heu. Beides sollte deshalb mit möglichst wenig Aufwand betrieben werden. Bei ständig zu Atemwegsproblemen neigenden Pferden empfiehlt es sich, anstelle von Stroh staubarme Holzspäne einzustreuen und die Heugaben zu erhöhen. Das Heu sollte vor dem Verfüttern etwa 20 Minuten in sauberem Wasser eingeweicht werden, um den Staub zu binden. Eine andere Möglichkeit besteht im Zukauf von Minisilagesäcken oder -ballen, die speziell für Halter mit wenigen Pferden im Futtermittelhandel angeboten werden. Für größere Pferdebestände empfiehlt sich der Einsatz von Ballensilage, um so den Belastungen durch Luftpartikel wirksam zu begegnen. Um eine staubarme Umgebung zu gewährleisten, sollten extrem empfindliche Pferde möglichst in Offenställen oder zumindest in Außenboxen oder im Sommerhalbjahr ausgiebig auf der Weide gehalten werden. ZAHN- UND GEBISSMÄNGEL In der ersten Stufe der Verdauung muss das Futter ausgiebig zerkleinert und mit Speichel durchmischt werden. Liegen Zahn- und Gebissmängel vor, werden diese Verdauungsvorgänge unter Umständen mit der Folge von Erkrankungen und Problemen im Magen- Darm-Bereich (z. B. Koliken) gestört. Bei fehlerhafter Zahn- und Gebissstellung können durch ungleiche Abnutzung der Zähne unterschiedliche Gebissveränderungen entstehen. Um Zahn- und Gebissprobleme möglichst frühzeitig zu erkennen, sollten regelmäßige Zahn- und Gebisskontrollen (mindestens einmal jährlich) auch schon bei jungen Pferden erfolgen. 77
78 NEUE TENDENZEN IN DER PFERDEFÜTTERUNG Die Vorgaben für die Bewertung und Versorgung mit Energie und Eiweiß ändern sich: Zurzeit wird die verdauliche Energie als Energiemaß verwendet. Dabei bleiben wichtige Verlustquellen wie die im Dickdarm gebildete Methanenergie und Harnenergie unberücksichtigt. Die verdauliche Energie kann (daher) nur teilweise für die Erhaltung der Körperfunktionen und für Leistungsanforderungen genutzt werden. Neuere Untersuchungen ermöglichen es, die Energieverluste durch Harn- und Darmgasabgabe zu schätzen. Deshalb hat sich der Ausschuss für Bedarfsnormen der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie 2013 für die Energiestufe der umsetzbaren Energie (abgekürzt ME = Metabolizable Energy) entschieden. Die Schätzgleichung für den Gehalt an umsetzbarer Energie in Einzelfuttermitteln, Mischfuttermitteln und Rationen für Pferde lautet: ME (MJ/kg TM) = 3,54 + 0,0129 x XP + 0,0420 x XL 0,0019 x XF + 0,0185 NfE. (Nährstoffe in g/kg TM; nicht anwendbar bei weniger als 10 % Fett pro kg TM) 78
79 NEUE TENDENZEN IN DER PFERDEFÜTTERUNG Der Bedarf an Eiweiß wird derzeit als verdauliches Rohprotein angegeben. Die Mengenanforderungen sind relativ gering und der Erhaltungsbedarf wird oft bereits mit der Raufuttergabe abgedeckt. Die Menge an verdaulichem Rohprotein in den Futtermitteln gibt jedoch keinen Hinweis über den Gehalt an lebenswichtigen Aminosäuren (essenziellen Aminosäuren). So können beispielsweise Futtermittel mit einem relativ hohen Gehalt an Rohprotein nur einen geringen Anteil an essenziellen Aminosäuren bereitstellen. Die enzymatische Verdauung des Proteins und Aufspaltung in Aminosäuren erfolgt beim Pferd hauptsächlich bis zum Ende des Dünndarms und durch Fermentation von Mikroorganismen im Dickdarm. Die Aufnahme von mikrobiell gebildeten hochwertigen Aminosäuren über die Dickdarmschleimhaut scheint jedoch sehr gering zu sein, sodass die Nutzung zu vernachlässigen ist. Deshalb hat der Ausschuss für Bedarfsnormen 2013 beschlossen, dass die Angabe des gesamtverdaulichen Rohproteins von Futtermitteln als Maßstab abzulösen ist. Als neuer Maßstab soll der Anteil des im Dünndarm aufgenommenen und verdauten Rohproteins gelten. Auch der Anteil der im Dünndarm aufgenommenen Aminosäuren sollen berücksichtigt werden, denn sie sind für das Pferd lebensnotwendig. Zukünftig wird bei Futtermitteln für Pferde das Protein als präzäkal verdauliches Rohprotein (das über die Dünndarmschleimhaut aufgenommene Rohprotein) dargestellt bzw. die präzäkal verdaulichen Aminosäuren. Gleiches wird auch für die Darstellung der Bedarfswerte für Pferde gelten. Beides ist noch nicht (Juli 2014) durch die Gesellschaft für Ernährungsphysiologie veröffentlicht worden. Außerdem fehlt die Bewertung der Einzelfuttermittel (DLG Futterwerttabellen) und noch weitere Untersuchungen zur Umsetzung. Deshalb wurden in diesem Heft die derzeit gültigen, durchaus praxisbewährten Versorgungs- und Fütterungsempfehlungen verwendet. Zukünftig werden analog der Neubewertung von Energie und Proteinen auch die Bedarfswerte für Mineralstoffe und Vitamine überarbeitet werden. Zukünftig löst die umsetzbare Energie die verdauliche Energie ab. 79
80 LITERATUR UND LINKS Pferdefütterung. 5., vollständig überarbeitete Auflage Helmut Meyer, Manfred Coenen Enke Verlag Stuttgart, 2014 Praxishandbuch Pferdefütterung 4., aktualisierte Auflage Ingolf Bender Kosmos Verlag Stuttgart, 2009 Richtlinien für Reiten und Fahren, Band 4 Haltung Fütterung, Gesundheit und Zucht 16. Auflage Hrsg.: Deutsche Reiterliche Vereinigung e.v. (FN) Bereich Sport FN Verlag der deutschen Reiterlichen Vereinigung GmbH, Warendorf, Homepage des deutschen Verbandes Tiernahrung, Informationen über Bestimmungen zum Futtermittelrecht Internetportal der DLG mit umfangreichen Fachinformationen zum Thema Futter und Fütterung Institut für Veterinärpharmakologie und -toxikologie, Universität Zürich Management von Vergiftungsfällen; Gifte und Giftpflanzen Tierernährung 13., neu überarbeitete Auflage Manfred Kirchgeßner DLG-Verlag Frankfurt/Main, 2011 Rechenmeister für Pferdefütterung 5. Auflage Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, 2011 Ernährung landwirtschaftlicher Nutztiere 2. Auflage Heinz Jeroch, Winfried Drochner, Ortwin Simon UTB Stuttgart,
81 aid-medien Gruppenhaltung von Pferden Damit sich Pferde in Gruppenhaltung wohlfühlen und gesund bleiben, ist ein durchdachtes Haltungskonzept die erste Voraussetzung. Die DVD zeigt mit dem Film Tiergerechte Pensionspferdehaltung aus dem Jahr 2002 verschiedene Haltungssysteme in ihrer idealen Umsetzung, von der Einzelboxhaltung über die Gruppenhaltung im Laufstall bis zur ganzjährigen Weidehaltung. Vorteile und Besonderheiten der einzelnen Systeme werden dargestellt und Maßnahmen für eine artgerechte Haltung und eine kostengünstige Betreuung aufgezeigt. Als Zusatzmaterial enthält die DVD sieben Kurzfilme und Kurzdarstellungen (als PDF) zu den Preisträgern des Bundeswettbewerbs Landwirtschaftliches Bauen 2007/2008 Gruppenhaltung von Pferden im landwirtschaftlichen Betrieb. Video auf DVD, 25 Minuten, Bestell-Nr. 7604, ISBN , Erstauflage 2008, 30,00 Das deutsche Warmblutpferd Dieser Film gibt einen Überblick sowohl über den Stand der deutschen Warmblutzuchten vor etwa 60 Jahren als auch über die historische Entwicklung der deutschen Pferdezucht im Laufe der Jahrhunderte. Vom edlen Trakehner aus ostpreußischer Zucht über den Holsteiner bis zum Hannoveraner aus dem Zuchtzentrum Celle werden alle wichtigen Warmblutrassen vorgestellt. Der Film ist eine unterhaltsame Rundreise durch das deutsche Zuchtgeschehen zwischen den Jahren 1939 und Video auf DVD, 47 Minuten, Bestell-Nr. 7542, ISBN , Erstauflage 2006, 15,00 Berufsbildung in der Pferdewirtschaft Für viele junge Menschen ist der Beruf des Pferdewirts ein Traumberuf. Damit aus dem Traum kein Albtraum wird, bietet das Heft eine Orientierungshilfe bei der Berufswahl. Ausgehend von den Einstiegsvoraussetzungen werden die fünf Fachrichtungen des Berufs vorgestellt. Jugendliche erhalten Informationen über Ausbildungsinhalte, Aufgaben und spätere Berufschancen. Wie diese Chancen durch eine Fortbildung zum Pferdewirtschaftsmeister, zur Fachkraft für Therapeutisches Reiten oder ein Studium in der Pferdewirtschaft vergrößert werden können, wird ebenfalls dargestellt. Drei Pferdewirtinnen und drei Pferdewirte beschreiben ihre Beweggründe für die Berufswahl und die besonderen Reize des Berufs. Heft, DIN A5, 64 Seiten, Bestell-Nr. 1178, ISBN , 9. Auflage 2011, 3,00 81
82 aid-medien Sichere Weidezäune Weidezäune haben in erster Linie sicherheitstechnischen Erfordernissen zu genügen. Diese sind je nach Lage der Weideflächen und Sensibilität der Tiere unterschiedlich. Das Heft informiert über die möglichen Weidezaunarten und -varianten für Rinder, Pferde, Schafe, Wild, Schweine und Geflügel. Es werden Grundlagen und Neuerungen zur Technik von Elektrozäunen, vom richtigen Zaunmaterial über die Wahl der Isolatoren bis zur sicheren Stromführung vermittelt und mögliche Schwachpunkte aufgezeigt. Elementar ist das Kapitel zu den rechtlichen Grundlagen der Tierhalterhaftung und zu aktuellen Gerichtsentscheidungen. Die Kombination der Inhalte macht das Heft zu einem Muss für alle Nutztierhalter, aber auch für Sachverständige und Juristen. Heft, DIN A5, 76 Seiten, Bestell-Nr. 1132, ISBN , 5. Auflage 2013, 3,00 Qualitäts-Grassilage vom Feld bis in den Trog Hochwertige Grassilage ist eine wichtige Säule in der intensiven Milchviehhaltung. Das Heft zeigt von der Gräserzusammensetzung bis zum Trog, wie man die Qualität von Grassilage steuern kann. Besonders ausführlich wird der Einfluss der Produktionstechnik beschrieben. Dazu gehört z. B. die Flächenpflege, das richtige Anwelken, Tipps zu Bergung und Transport und die optimale Verdichtung im Fahrsilo. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Vergleich der Kosten sowie der Vor- und Nachteile unterschiedlicher Ernte- und Konservierungsverfahren. Auch der richtige Einsatz von Silierzusätzen wird angesprochen. Zehn Goldene Regeln zur Silagebereitung bringen die wichtigsten Maßnahmen für eine optimale Grassilage abschließend auf den Punkt. Heft, DIN A5, 84 Seiten, Bestell-Nr. 1563, ISBN , 2. Auflage 2011, 4,50 Anzeigepflichtige Tierseuchen Ob Afrikanische Schweinepest oder Maul- und Klauenseuche nur eine schnelle Erkennung von Tierseuchen kann ihre Verbreitung verhindern und zur erfolgreichen Bekämpfung beitragen. Deshalb besteht die gesetzliche Pflicht zur Anzeige gefährlicher Tierkrankheiten. Das Heft informiert Tierhalter, welche Seuchen bereits bei Befallsverdacht der zuständigen Behörde mitgeteilt werden müssen. Ursachen, Verbreitungswege, Merkmale und Maßnahmen gegen die Weiterverbreitung aller anzeigepflichtigen Tierseuchen werden beschrieben. Fotos zeigen wichtige Krankheitssymptome. Die alphabetische Gliederung des Heftes ermöglicht ein schnelles Auffinden der Krankheitsbeschreibungen. Die Neuauflage berücksichtigt das Tiergesundheitsgesetz, das seit Mai 2014 das Tierseuchengesetz abgelöst hat. Heft, DIN A5, 112 Seiten, Bestell-Nr. 1046, ISBN , Erscheinungsjahr 2014, Preis 4,50 82
83 Umweltfreundlich Impressum 1592/2014 Herausgegeben vom aid infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e. V. Heilsbachstraße Bonn Foto: Matthias Gschwendner Fotolia.com produziert! Text Dr. Wolfgang Sommer, Nottuln Prof. Dr. Dirk Winter, Dekan Studiengang Pferdewirtschaft, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt, Nürtingen Redaktion Dr. Elisabeth Roesicke, aid unter Mitarbeit von Claudia Wester, aid Bilder Agrarfoto.com: 16, 66 o.; aid-archiv: 8 Michael Ebersoll, aid: 44 r., 45 r.; Dr. Florian Geburek: 76; Fotolia.com: anakondasp: 60; Gerd Baumgartner: 7; Beta-Artworks: 58 o.; Ilka Burkhardt: 77 l.; byrdyak: 56; Composer: 25 o.; Sven Cramer: 48; Fahrah Diba: 11; ferkelraggae: 6; Kathrin Hemkendreis: 73; Eric Isselée: 15 o.; Alexia Khruscheva: Titelbild; Christian Müller: 74 o.; NovoPics: 63; pholidito: 51 r.; Olga Popova: 40 l.; Cornelia Pretzsch: 20; Corola Schubbel: 28 u.; Jan Webb: 61 u.; yongkiet: 58 u.; Friederike Heidenhof: 15 u., 18, 25 u., 43, 52, 79; istock.com: orava: 22 u.; johnrich: 61 o.; Guido Marx: 62; Peter Meyer, aid: 12, 33, 34, 37, 38, 40 u., 42, 45 l., 65, 71 r., 74 u.; Astrid Neikes: 17; Dr. Elisabeth Roesicke: 5, 14, 19, 23, 26, 28 o., 30 u., 35, 44 l. 46, 49, 64, 66 u. 67, 68, 69, 71 l., 72, 77 r., 78; Fotoagentur Schröder: 53 o.; Christiane Slawik: 50; Dr. Johannes Thaysen: 30 o.; Arnout van Son: 10, 22 o., 80, 83; Verband der ölsaatverarbeitenden Industrie in Deutschland e. V. (OVID): 40 r.; Werkfoto Turbo-Heuautomat: 51 l.; Paula Wolff: 53 u. Grafik Arnout van Son, Alfter Druck Druckerei Lokay e. K. Königsberger Str Reinheim Dieses Heft wurde in einem klimaneutralen Druckprozess mit Farben aus nachwachsenden Rohstoffen bei einer EMAS-zertifizierten Druckerei hergestellt. Das Papier besteht zu 100 Prozent aus Recyclingpapier. Nachdruck und Vervielfältigung auch auszugsweise sowie Weitergabe mit Zusätzen, Aufdrucken oder Aufklebern nur mit Genehmigung des aid gestattet. Erstauflage ISBN
84 Foto: Emmanuelle Guillou Fotolia.com Foto: Subbotina Anna Fotolia.com aid infodienst Wissen in Bestform Ihr Informationsanbieter rund um Landwirtschaft, Lebensmittel und Ernährung. Wir bereiten Fakten verständlich auf und bieten für jeden den passenden Service. Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung. unabhängig praxisorientiert wissenschaftlich fundiert Foto: Tatyana Gladskih - Fotolia.com Bestell-Nr.: 1592, Preis: 4,00
Bedarfsnormen für Milchvieh
 Bedarfsnormen für Milchvieh Nährstoffe, Mineralstoffe, Vitamine Beratungsstelle Rinderproduktion OÖ. Stand: 2016- Inhaltsverzeichnis Energie (NEL) und nutzbares Rohprotein (nxp)... 2 Erhaltungsbedarf...
Bedarfsnormen für Milchvieh Nährstoffe, Mineralstoffe, Vitamine Beratungsstelle Rinderproduktion OÖ. Stand: 2016- Inhaltsverzeichnis Energie (NEL) und nutzbares Rohprotein (nxp)... 2 Erhaltungsbedarf...
Dr. Kai Kreling, Tierärztliche Klinik Binger Wald, Waldalgesheim
 Pferdefütterung Dr. Kai Kreling, Tierärztliche Klinik Binger Wald, Waldalgesheim Die Ernährung unserer Reitpferde unterscheidet sich wesentlich von der seiner wildlebenden Vorfahren. Nicht nur die Stallhaltung,
Pferdefütterung Dr. Kai Kreling, Tierärztliche Klinik Binger Wald, Waldalgesheim Die Ernährung unserer Reitpferde unterscheidet sich wesentlich von der seiner wildlebenden Vorfahren. Nicht nur die Stallhaltung,
Fütterung von Hochleistungskühen unter ökologischen Bedingungen. Silke Dunkel Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft
 Fütterung von Hochleistungskühen unter ökologischen Bedingungen Silke Dunkel Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft ÖKO-Verordnung Verordnung (EWG) NR. 2092/91 des Rates vom 2. Juni 1991 über den ökologischen
Fütterung von Hochleistungskühen unter ökologischen Bedingungen Silke Dunkel Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft ÖKO-Verordnung Verordnung (EWG) NR. 2092/91 des Rates vom 2. Juni 1991 über den ökologischen
P r o f e s s i o n e l l e E r n ä h r u n g f ü r T i e r e. fyto dogpremium gepresstes Alleinfutter für alle Hunde
 P r o f e s s i o n e l l e E r n ä h r u n g f ü r T i e r e fyto dogpremium gepresstes Alleinfutter für alle Hunde fyto dog Es gibt nichts schöners, als ein verspielter, aufmerksamer und aktiver Hund.
P r o f e s s i o n e l l e E r n ä h r u n g f ü r T i e r e fyto dogpremium gepresstes Alleinfutter für alle Hunde fyto dog Es gibt nichts schöners, als ein verspielter, aufmerksamer und aktiver Hund.
DIE VERDAUUNG DES PFERDES
 DIE VERDAUUNG DES PFERDES Die Verdauungsprozesse beim Pferd werden wesentlich von der Menge und Zusammensetzung des aufgenommenen Futters beeinflusst. Hierbei ist besonders der positive Einfluss hoher
DIE VERDAUUNG DES PFERDES Die Verdauungsprozesse beim Pferd werden wesentlich von der Menge und Zusammensetzung des aufgenommenen Futters beeinflusst. Hierbei ist besonders der positive Einfluss hoher
JA NEIN? Kann man Hunde vegetarisch ernähren?
 Kann man Hunde vegetarisch ernähren? Christine Iben Department für Nutztiere und öffentliches Gesundheitswesen Veterinärmedizinische Universität Kann man Hunde vegetarisch ernähren? JA NEIN? 1 Vegetarisch,
Kann man Hunde vegetarisch ernähren? Christine Iben Department für Nutztiere und öffentliches Gesundheitswesen Veterinärmedizinische Universität Kann man Hunde vegetarisch ernähren? JA NEIN? 1 Vegetarisch,
FÜR IHR ISLANDPFERD NUR DAS BESTE!
 FÜR IHR ISLANDPFERD NUR DAS BESTE! des heit Neu es für Jahr pferde d Islan F16038_ES_IslaenderFolder_A5_8s_TY_JUNI.indd 1 27-06-2016 10:18:23 ICELAND 15 KG, BIGBAG Der Bestseller unter den Alleinfuttermischungen.
FÜR IHR ISLANDPFERD NUR DAS BESTE! des heit Neu es für Jahr pferde d Islan F16038_ES_IslaenderFolder_A5_8s_TY_JUNI.indd 1 27-06-2016 10:18:23 ICELAND 15 KG, BIGBAG Der Bestseller unter den Alleinfuttermischungen.
Musteraufgaben. Welche Nahrungsbestandteile zählen zu den nicht-energieliefernden Nahrungsmitteln?
 Fach: PKA - 34001_PKA-Ernährung und Verdauung Anzahl Aufgaben: 40 Musteraufgaben Diese Aufgabensammlung wurde mit KlasseDozent erstellt. Sie haben diese Aufgaben zusätzlich als KlasseDozent-Importdatei
Fach: PKA - 34001_PKA-Ernährung und Verdauung Anzahl Aufgaben: 40 Musteraufgaben Diese Aufgabensammlung wurde mit KlasseDozent erstellt. Sie haben diese Aufgaben zusätzlich als KlasseDozent-Importdatei
Mineralstoffgehalte in Silagen Michael Egert LUFA Nord-West, Institut für Futtermittel, Oldenburg
 Mineralstoffgehalte in Silagen Michael Egert LUFA Nord-West, Institut für Futtermittel, Oldenburg Einleitung Die Grassilage ist neben der Maissilage das wichtigste Grundfutter in der Rindviehhaltung. Aus
Mineralstoffgehalte in Silagen Michael Egert LUFA Nord-West, Institut für Futtermittel, Oldenburg Einleitung Die Grassilage ist neben der Maissilage das wichtigste Grundfutter in der Rindviehhaltung. Aus
Brandon Pferdefutter neu definiert
 Brandon Pferdefutter neu definiert Brandon eine Synergie aus altem und neuem Wissen Die Domestikation vor rund 6000 Jahren durch nomadisierende Hirtenvölker, beeinflusste die Ernährung des Pferdes zunächst
Brandon Pferdefutter neu definiert Brandon eine Synergie aus altem und neuem Wissen Die Domestikation vor rund 6000 Jahren durch nomadisierende Hirtenvölker, beeinflusste die Ernährung des Pferdes zunächst
Sach~ und Fachkundenachweis des Verbandes Bayerischer Rassegeflügelzüchter e.v.
 Sach~ und Fachkundenachweis des Verbandes Bayerischer Rassegeflügelzüchter e.v. Ernährung nach Dipl. Biologe Alfred Berger Vortrag Helmut Sachsenhauser Gliederung Verdauung Nährstoffbedarf Fütterung Fütterungshinweise
Sach~ und Fachkundenachweis des Verbandes Bayerischer Rassegeflügelzüchter e.v. Ernährung nach Dipl. Biologe Alfred Berger Vortrag Helmut Sachsenhauser Gliederung Verdauung Nährstoffbedarf Fütterung Fütterungshinweise
Zu dieser Folie: Im Rahmen der Durchführungsverantwortung tragen die Pflegefachkräfte die Verantwortung für eine sach- und fachgerechte Durchführung
 1 2 Im Rahmen der Durchführungsverantwortung tragen die Pflegefachkräfte die Verantwortung für eine sach- und fachgerechte Durchführung der Pflege. Sie sind zur Fortbildung entsprechend dem aktuellen Stand
1 2 Im Rahmen der Durchführungsverantwortung tragen die Pflegefachkräfte die Verantwortung für eine sach- und fachgerechte Durchführung der Pflege. Sie sind zur Fortbildung entsprechend dem aktuellen Stand
DOWNLOAD. Lineare Texte verstehen: Die Verdauung. Ulrike Neumann-Riedel. Downloadauszug aus dem Originaltitel: Sachtexte verstehen kein Problem!
 DOWNLOAD Ulrike Neumann-Riedel Lineare Texte verstehen: Die Verdauung Sachtexte verstehen kein Problem! Klasse 3 4 auszug aus dem Originaltitel: Vielseitig abwechslungsreich differenziert Was geschieht
DOWNLOAD Ulrike Neumann-Riedel Lineare Texte verstehen: Die Verdauung Sachtexte verstehen kein Problem! Klasse 3 4 auszug aus dem Originaltitel: Vielseitig abwechslungsreich differenziert Was geschieht
Formative Lernkontrolle
 Formative Lernkontrolle LZ: Ich weiss was man unter Stoffwechsel versteht und kenne die sechs Punkte, welche zum Stoffwechsel gehören! 1) Ergänze den Satz! Stoffwechsel ist die Gesamtheit der biochemischen
Formative Lernkontrolle LZ: Ich weiss was man unter Stoffwechsel versteht und kenne die sechs Punkte, welche zum Stoffwechsel gehören! 1) Ergänze den Satz! Stoffwechsel ist die Gesamtheit der biochemischen
BUNDESENTSCHEID AGRAROLYMPIADE 2016
 BUNDESENTSCHEID AGRAROLYMPIADE 2016 Station 6: TIERHALTUNG: WIEDERKÄUER - LÖSUNG Punkteanzahl: max. 20 Punkte Zeit: max. 20 Minuten Team Punkte JurorIn 1 JurorIn 2 Löst die unten stehenden Aufgaben! Ablauf
BUNDESENTSCHEID AGRAROLYMPIADE 2016 Station 6: TIERHALTUNG: WIEDERKÄUER - LÖSUNG Punkteanzahl: max. 20 Punkte Zeit: max. 20 Minuten Team Punkte JurorIn 1 JurorIn 2 Löst die unten stehenden Aufgaben! Ablauf
BIORACING Ergänzungsfuttermittel
 BIORACING Ergänzungsfuttermittel...für Pferde Der natürlich Weg zur optimaler Gesundheit und Leistungsfähigkeit Einführung Was ist BIORACING? Die einzigartige Nahrungsergänzung enthält die Grundbausteine
BIORACING Ergänzungsfuttermittel...für Pferde Der natürlich Weg zur optimaler Gesundheit und Leistungsfähigkeit Einführung Was ist BIORACING? Die einzigartige Nahrungsergänzung enthält die Grundbausteine
Auf den Mix kommt es an!
 Auf den Mix kommt es an! Ergänzungsfutter in der Kälberaufzucht Gewicht in kg Bullenmast 23/3 200 Fresser Mix Kälber Mix 100 Effizient KF Mais-MIX Effizient MMP 35 Eff.-Cow-PowerHerb Effizient Elektrolyt
Auf den Mix kommt es an! Ergänzungsfutter in der Kälberaufzucht Gewicht in kg Bullenmast 23/3 200 Fresser Mix Kälber Mix 100 Effizient KF Mais-MIX Effizient MMP 35 Eff.-Cow-PowerHerb Effizient Elektrolyt
Das Nahrungsmittel Ei Lehrerinformation
 Lehrerinformation 1/7 Arbeitsauftrag Die Sch erhalten eine umfassende Betrachtung der Inhaltsstoffe inkl. intensiver Befassung mit der Nahrungsmittelpyramide und der Wichtigkeit des Eis in diesem Zusammenhang.
Lehrerinformation 1/7 Arbeitsauftrag Die Sch erhalten eine umfassende Betrachtung der Inhaltsstoffe inkl. intensiver Befassung mit der Nahrungsmittelpyramide und der Wichtigkeit des Eis in diesem Zusammenhang.
Musteraufgaben. [A] - Restverdauung [B] - Wasserentzug [C] - Kohlenhydratverdauung
![Musteraufgaben. [A] - Restverdauung [B] - Wasserentzug [C] - Kohlenhydratverdauung Musteraufgaben. [A] - Restverdauung [B] - Wasserentzug [C] - Kohlenhydratverdauung](/thumbs/50/26346541.jpg) Musteraufgaben Fach: PKA - 34002_PKA-Ernaehrung2 Anzahl Aufgaben: 43 Diese Aufgabensammlung wurde mit KlasseDozent erstellt. Sie haben diese Aufgaben zusätzlich als KlasseDozent-Importdatei (.xml) erhalten,
Musteraufgaben Fach: PKA - 34002_PKA-Ernaehrung2 Anzahl Aufgaben: 43 Diese Aufgabensammlung wurde mit KlasseDozent erstellt. Sie haben diese Aufgaben zusätzlich als KlasseDozent-Importdatei (.xml) erhalten,
Gut gekaut ist halb verdaut
 Gut gekaut ist halb verdaut Das Verdauungssystem hat die Aufgabe, aus der aufgenommenen Futtermenge dem Körper die nötige Energie bereitzustellen, einerseits für die Aufrechterhaltung der Körperfunktionen
Gut gekaut ist halb verdaut Das Verdauungssystem hat die Aufgabe, aus der aufgenommenen Futtermenge dem Körper die nötige Energie bereitzustellen, einerseits für die Aufrechterhaltung der Körperfunktionen
10.1 Was bedeutet Stoffwechsel? 10.2 Was sind Enzyme? 10.3 Welche Aufgabe erfüllen die Organe des Verdauungsapparats?
 10.1 Was bedeutet Stoffwechsel? Stoffwechsel Gesamtheit der Vorgänge der Stoffaufnahme, Stoffumwandlung und Stoffabgabe in lebenden Zellen (immer auch mit Energiewechsel verbunden) Energiestoffwechsel:
10.1 Was bedeutet Stoffwechsel? Stoffwechsel Gesamtheit der Vorgänge der Stoffaufnahme, Stoffumwandlung und Stoffabgabe in lebenden Zellen (immer auch mit Energiewechsel verbunden) Energiestoffwechsel:
Der Hund ist ein Karnivor!
 Der Hund ist ein Karnivor! Wie sein Vorfahr, der Wolf, gehört der Hund zur Ordnung der Karnivoren, wobei der Wolf kein reiner Fleischfresser ist. Außer Beutetieren frisst der Wolf Obst, Kräuter, Beeren,
Der Hund ist ein Karnivor! Wie sein Vorfahr, der Wolf, gehört der Hund zur Ordnung der Karnivoren, wobei der Wolf kein reiner Fleischfresser ist. Außer Beutetieren frisst der Wolf Obst, Kräuter, Beeren,
Das größte Organ des Menschen
 2 Das größte Organ des Menschen Mit etwa acht Metern Länge ist unser Darm das größte Organ des Menschen und wichtigster Teil des Verdauungssystems. Im Darm wird täglich Höchstleistung erbracht im Laufe
2 Das größte Organ des Menschen Mit etwa acht Metern Länge ist unser Darm das größte Organ des Menschen und wichtigster Teil des Verdauungssystems. Im Darm wird täglich Höchstleistung erbracht im Laufe
Hundefutter. Energie- und nährstoffreiches Welpenfutter für alle Rassen. Vorteile: Verpackungseinheit: 7,5 kg
 Champ Dog Junior Verpackungseinheit: 7,5 kg Champ Dog Junior ist auch sehr gut für tragende und säugende Hündinnen geeignet. Bitte immer frisches Wasser bereitstellen. 5 Energie- und nährstoffreiches Welpenfutter
Champ Dog Junior Verpackungseinheit: 7,5 kg Champ Dog Junior ist auch sehr gut für tragende und säugende Hündinnen geeignet. Bitte immer frisches Wasser bereitstellen. 5 Energie- und nährstoffreiches Welpenfutter
DIE ERNÄHRUNG. Die Nährstoffe. 1. Was versteht man unter den Nährstoffen?
 DIE ERNÄHRUNG Die Nährstoffe 1. Was versteht man unter den Nährstoffen? * a) Jeder Mensch hat von Beginn seines Lebens an Hunger und Durst. b) Deshalb muss er seinen Körper regelmäßig ernähren, um leben
DIE ERNÄHRUNG Die Nährstoffe 1. Was versteht man unter den Nährstoffen? * a) Jeder Mensch hat von Beginn seines Lebens an Hunger und Durst. b) Deshalb muss er seinen Körper regelmäßig ernähren, um leben
WELLNESS CATFOOD DOG & CAT WELLNESS DOGFOOD HI-TEC BALANCED NUTRITION
 WELLNESS CATFOOD DOG & CAT WELLNESS DOGFOOD HI-TEC BALANCED NUTRITION D 2 WELLNESS CATFOOD Wellness Catfood WELLNESS KITTEN WELLNESS ADULT WELLNESS SENSITIVE King Qualifood ist eine Tochterfirma von Natural
WELLNESS CATFOOD DOG & CAT WELLNESS DOGFOOD HI-TEC BALANCED NUTRITION D 2 WELLNESS CATFOOD Wellness Catfood WELLNESS KITTEN WELLNESS ADULT WELLNESS SENSITIVE King Qualifood ist eine Tochterfirma von Natural
KOTWASSER ein Symptom, viele Ursachen - eine Lösung!?
 KOTWASSER ein Symptom, viele Ursachen - eine Lösung!? Kotwasser bedeutet für betroffene Pferde und auch für deren Besitzer einen enormen Leidensdruck. Man kann den Pferden ihr unwohles Gefühl wahrlich
KOTWASSER ein Symptom, viele Ursachen - eine Lösung!? Kotwasser bedeutet für betroffene Pferde und auch für deren Besitzer einen enormen Leidensdruck. Man kann den Pferden ihr unwohles Gefühl wahrlich
Anbau von Luzerne und Einsatz der Luzerneballen in der Fütterung
 Anbau von Luzerne und Einsatz der Luzerneballen in der Fütterung Christian Scheuerlein, Trocknungsgenossenschaft Windsbach eg WB Qualitätsfutterwerk GmbH Übersicht 1. Luzerneanbau 2. Einsatz in der Fütterung
Anbau von Luzerne und Einsatz der Luzerneballen in der Fütterung Christian Scheuerlein, Trocknungsgenossenschaft Windsbach eg WB Qualitätsfutterwerk GmbH Übersicht 1. Luzerneanbau 2. Einsatz in der Fütterung
I. Empfehlungen für die Nähr- und Mineralstoffversorgung von Milchkühen
 I. Empfehlungen für die Nähr- und Mineralstoffversorgung von Milchkühen Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein Lebend- Trocken- Energie- und Proteinversorgung Mineralstoffversorgung masse masseauf- NEL
I. Empfehlungen für die Nähr- und Mineralstoffversorgung von Milchkühen Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein Lebend- Trocken- Energie- und Proteinversorgung Mineralstoffversorgung masse masseauf- NEL
Kohlenhydrate. Diese Abbildung zeigt Strukturformeln von Zellulose und Stärke.
 Lerntext Ernährung Bisher haben sich fast alle Empfehlungen der Ernährungswissenschaftler als falsch erwiesen. Gültig blieben zwei Regeln, die Menschen schon lange vor den Wissenschaftlern kannten. Man
Lerntext Ernährung Bisher haben sich fast alle Empfehlungen der Ernährungswissenschaftler als falsch erwiesen. Gültig blieben zwei Regeln, die Menschen schon lange vor den Wissenschaftlern kannten. Man
Zeitgemässe Milchviehfütterung
 Zeitgemässe Milchviehfütterung Erfolgreiche Kühe wachsen nicht über Nacht! Ueli Rothenbühler Dipl. Ing. Agr. ETH Inhalt Ziele der Milchviehfütterung Das Geheimnis der Milchvieh-Fütterung Wie erreicht man
Zeitgemässe Milchviehfütterung Erfolgreiche Kühe wachsen nicht über Nacht! Ueli Rothenbühler Dipl. Ing. Agr. ETH Inhalt Ziele der Milchviehfütterung Das Geheimnis der Milchvieh-Fütterung Wie erreicht man
Grundfutter - Starthilfe für den Pansen
 BILDUNGS- UND WISSENSZENTRUM AULENDORF - Viehhaltung, Grünlandwirtschaft, Wild, Fischerei - Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung und Grünlandwirtschaft LVVG Briefadresse: Postfach 1252
BILDUNGS- UND WISSENSZENTRUM AULENDORF - Viehhaltung, Grünlandwirtschaft, Wild, Fischerei - Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung und Grünlandwirtschaft LVVG Briefadresse: Postfach 1252
Berechnung der Weideleistung
 Berechnung der Weideleistung Bearbeitung: Dr. Clara Berendonk und Anne Verhoeven Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen Versuchs- und Bildungszentrum Landwirtschaft Haus Riswick Elsenpaß 5, 47533 Kleve
Berechnung der Weideleistung Bearbeitung: Dr. Clara Berendonk und Anne Verhoeven Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen Versuchs- und Bildungszentrum Landwirtschaft Haus Riswick Elsenpaß 5, 47533 Kleve
08. Oktober 2014, 7. Thüringisch-Sächsisches Kolloquium zur Fütterung. Stefanie Muche und Dr. Wolfram Richardt
 08. Oktober 2014, 7. Thüringisch-Sächsisches Kolloquium zur Fütterung Stefanie Muche und Dr. Wolfram Richardt 1. Kennzahlen der Futterqualität 2. Fütterungsversuche 3. Darstellung der in vitro- Methode
08. Oktober 2014, 7. Thüringisch-Sächsisches Kolloquium zur Fütterung Stefanie Muche und Dr. Wolfram Richardt 1. Kennzahlen der Futterqualität 2. Fütterungsversuche 3. Darstellung der in vitro- Methode
Artgerechte Ernährung von Rassekaninchen
 Artgerechte Ernährung von Rassekaninchen Was ist und was bedeutet eigentlich dieser in der heutigen Zeit so viel und so oft beschriebene und benannte Begriff artgerechte Ernährung. Dieser Begriff wir auch
Artgerechte Ernährung von Rassekaninchen Was ist und was bedeutet eigentlich dieser in der heutigen Zeit so viel und so oft beschriebene und benannte Begriff artgerechte Ernährung. Dieser Begriff wir auch
Die Beeinflussung der Milchinhaltsstoffe bei Milchschafen durch die Fütterung
 Die Beeinflussung der Milchinhaltsstoffe bei Milchschafen durch die Fütterung Prof. Dr. Gerhard Bellof Fachhochschule Weihenstephan 1. Einleitung Der Betriebszweig Milchschafhaltung kann interessante Einkommensperspektiven
Die Beeinflussung der Milchinhaltsstoffe bei Milchschafen durch die Fütterung Prof. Dr. Gerhard Bellof Fachhochschule Weihenstephan 1. Einleitung Der Betriebszweig Milchschafhaltung kann interessante Einkommensperspektiven
«www.die-fruchtbare-kuh.ch»
 Die Die von Milchkühen ist eine hochanspruchsvolle Tätigkeit, die in regelmässigen Abständen hinterfragt und neu beurteilt werden muss. Unzählige Faktoren müssen berücksichtigt werden, um eine wiederkäuer-
Die Die von Milchkühen ist eine hochanspruchsvolle Tätigkeit, die in regelmässigen Abständen hinterfragt und neu beurteilt werden muss. Unzählige Faktoren müssen berücksichtigt werden, um eine wiederkäuer-
VERDAUUNG. Der lange Weg durch den Verdauungstrakt
 VERDAUUNG Der lange Weg durch den Verdauungstrakt Sonja Zankl SS 2002 DEFINITION Abbau der Nahrungsstoffe im Verdauungstrakt in resorptionsfähige Bestandteile & Aufnahme in Blut bzw. Lymphe Wozu Verdauung?
VERDAUUNG Der lange Weg durch den Verdauungstrakt Sonja Zankl SS 2002 DEFINITION Abbau der Nahrungsstoffe im Verdauungstrakt in resorptionsfähige Bestandteile & Aufnahme in Blut bzw. Lymphe Wozu Verdauung?
p r e m i u m e r g ä n z u n g s f u t t e r f ü r p f e r d e EquiForcE
 p r e m i u m e r g ä n z u n g s f u t t e r f ü r p f e r d e EquiForce EquiForce - Premium Ergänzungs futter für Pferde powered by HAVENS P r e m i u m e r g ä n z u n g s f u t t e r f ü r p f e r
p r e m i u m e r g ä n z u n g s f u t t e r f ü r p f e r d e EquiForce EquiForce - Premium Ergänzungs futter für Pferde powered by HAVENS P r e m i u m e r g ä n z u n g s f u t t e r f ü r p f e r
Nährstoffversorgung für Sportler. Logo Apotheke
 Nährstoffversorgung für Sportler Logo Apotheke 0 Mehrbedarf im Sport Durch Steigerung des Stoffwechsels beim Sport hat der Körper einen erhöhten Bedarf an Mineralstoffen Spurenelementen Vitaminen Energie
Nährstoffversorgung für Sportler Logo Apotheke 0 Mehrbedarf im Sport Durch Steigerung des Stoffwechsels beim Sport hat der Körper einen erhöhten Bedarf an Mineralstoffen Spurenelementen Vitaminen Energie
Zellen. Biologie. Kennzeichen des Lebens. Das Skelett des Menschen. Zellen sind die kleinste Einheit aller Lebewesen.
 1. 3. Biologie Zellen Zellen sind die kleinste Einheit aller Lebewesen. Ist die Naturwissenschaft, die sich mit dem Bau und Funktion der Lebewesen beschäftigt. Dazu zählen Bakterien, Pflanzen, Pilze und
1. 3. Biologie Zellen Zellen sind die kleinste Einheit aller Lebewesen. Ist die Naturwissenschaft, die sich mit dem Bau und Funktion der Lebewesen beschäftigt. Dazu zählen Bakterien, Pflanzen, Pilze und
Dr. Jung und Dr. Mansfeld informieren: Ernährung in der Schwangerschaft
 Dr. Jung und Dr. Mansfeld informieren: Ernährung in der Schwangerschaft Ernähren Sie sich richtig? Gerade während der Schwangerschaft stellen sich viele werdende Mütter die Frage, was im Sinne einer richtigen
Dr. Jung und Dr. Mansfeld informieren: Ernährung in der Schwangerschaft Ernähren Sie sich richtig? Gerade während der Schwangerschaft stellen sich viele werdende Mütter die Frage, was im Sinne einer richtigen
Getreide-Mineralstoffe
 II-5 II-5 Was sind Mineralstoffe? Mineralstoffe sind für den Organismus unentbehrliche anorganische Stoffe (essentielle Nährstoffe). Einige sind für den Aufbau des Körpers notwendig, andere regulieren
II-5 II-5 Was sind Mineralstoffe? Mineralstoffe sind für den Organismus unentbehrliche anorganische Stoffe (essentielle Nährstoffe). Einige sind für den Aufbau des Körpers notwendig, andere regulieren
Lamm & Reis. vollwertig. omega 3 + 6 aus Geflügelfett. Hergestellt in Deutschland. mit wertvollem. unterstützt knorpelbildung in den gelenken Gelatine
 unterstützt knorpelbildung in den gelenken Gelatine voll vitaminiert und mineralisiert Vollwertig vollwertig für glänzendes fell Omega omega 3 + 6 aus Geflügelfett Hergestellt in Deutschland. mit wertvollem
unterstützt knorpelbildung in den gelenken Gelatine voll vitaminiert und mineralisiert Vollwertig vollwertig für glänzendes fell Omega omega 3 + 6 aus Geflügelfett Hergestellt in Deutschland. mit wertvollem
Raufutter in der Verdauung des Pferdes
 Institut für Tierernährung Direktion: Prof. Dr. Annette Liesegang Raufutter in der Verdauung des Pferdes Institut für Tierernährung Vetsuisse Fakultät Universität Zürich Brigitta Wichert PD Dr. Foto: B.Wichert
Institut für Tierernährung Direktion: Prof. Dr. Annette Liesegang Raufutter in der Verdauung des Pferdes Institut für Tierernährung Vetsuisse Fakultät Universität Zürich Brigitta Wichert PD Dr. Foto: B.Wichert
Orthomolekulare Therapie mit Mineralien Messmöglichkeiten mit der EAV
 Orthomolekulare Therapie mit Mineralien Messmöglichkeiten mit der EAV Dr. med. dent. Jürgen Pedersen Celler Tagung Februar 2007 Orthomolekulare Therapie Orthomolekulare Medizin = Erhaltung guter Gesundheitszustand
Orthomolekulare Therapie mit Mineralien Messmöglichkeiten mit der EAV Dr. med. dent. Jürgen Pedersen Celler Tagung Februar 2007 Orthomolekulare Therapie Orthomolekulare Medizin = Erhaltung guter Gesundheitszustand
Gesund genießen. Essen und Trinken für mehr Wohlbefinden. Welche Nährstoffe brauchen wir? Ernährungspyramide wie viel wovon?
 Gesund genießen Essen und Trinken für mehr Wohlbefinden Welche Nährstoffe brauchen wir? Ernährungspyramide wie viel wovon? Mahlzeiten regelmäßig & abwechslungsreich Vorwort Liebe Leser, wir vom Nestlé
Gesund genießen Essen und Trinken für mehr Wohlbefinden Welche Nährstoffe brauchen wir? Ernährungspyramide wie viel wovon? Mahlzeiten regelmäßig & abwechslungsreich Vorwort Liebe Leser, wir vom Nestlé
Bellfor Premium Pur. Weitere Informationen unter: www.bellfor.info
 Klare Wildbäche, ursprüngliche Heideflächen und stattliche Gutshöfe prägen das Bild des Münsterlands. Ein wahres Paradies für jeden Hund und seinen menschlichen Begleiter. Die wunderschöne Natur und die
Klare Wildbäche, ursprüngliche Heideflächen und stattliche Gutshöfe prägen das Bild des Münsterlands. Ein wahres Paradies für jeden Hund und seinen menschlichen Begleiter. Die wunderschöne Natur und die
... für ein glückliches Katzenleben!
 ... für ein glückliches Katzenleben! Ernährung mit System Artgerechte Fütterung und ein glückliches Katzenleben sind unser ständiges Anliegen. All unsere Erzeugnisse werden nach den neuesten ernährungswissenschaftlichen
... für ein glückliches Katzenleben! Ernährung mit System Artgerechte Fütterung und ein glückliches Katzenleben sind unser ständiges Anliegen. All unsere Erzeugnisse werden nach den neuesten ernährungswissenschaftlichen
Was ist die FODMAP-Diät?
 4 Was ist die FODMAP-Diät? Die FODMAP-Diät, oder besser gesagt, die FODMAP-reduzierte Diät, basiert auf einem neuen Diätprinzip, das speziell zur Vermeidung und Behandlung von Verdauungsbeschwerden entwickelt
4 Was ist die FODMAP-Diät? Die FODMAP-Diät, oder besser gesagt, die FODMAP-reduzierte Diät, basiert auf einem neuen Diätprinzip, das speziell zur Vermeidung und Behandlung von Verdauungsbeschwerden entwickelt
Stress-Schutz durch Phytamine. Für Stress-Resistenz. Für körperliche Belastbarkeit Für Stress-Resistenz Für die Säuren/Basen-Balance
 Stress-Schutz durch Phytamine Für Stress-Resistenz Für körperliche Belastbarkeit Für Stress-Resistenz Für die Säuren/Basen-Balance EIN AUSGEWOGENER SÄUREN/BASEN-HAUSHALT...... ist die Basis für einen normalen
Stress-Schutz durch Phytamine Für Stress-Resistenz Für körperliche Belastbarkeit Für Stress-Resistenz Für die Säuren/Basen-Balance EIN AUSGEWOGENER SÄUREN/BASEN-HAUSHALT...... ist die Basis für einen normalen
Nährstoffe Lehrerinformation
 Lehrerinformation 1/6 Arbeitsauftrag Die LP gibt den Sch den Auftrag, einen Kreis zu zeichnen. Aus diesem sollen sie ein Kreisdiagramm erstellen, indem sie die prozentualen Anteile der Wasser, Fett, Eiweiss,
Lehrerinformation 1/6 Arbeitsauftrag Die LP gibt den Sch den Auftrag, einen Kreis zu zeichnen. Aus diesem sollen sie ein Kreisdiagramm erstellen, indem sie die prozentualen Anteile der Wasser, Fett, Eiweiss,
Kyäni Sunrise - eine Quelle aus folgenden Vitaminen:
 Die Bestandteile des Kyäni Gesundheitsdreiecks: Kyäni Sunrise - eine Quelle aus folgenden Vitaminen: Vitamin A ist wichtig für: die Bildung neuer Blutkörperchen und erleichtert den Einbau des Eisens stärkt
Die Bestandteile des Kyäni Gesundheitsdreiecks: Kyäni Sunrise - eine Quelle aus folgenden Vitaminen: Vitamin A ist wichtig für: die Bildung neuer Blutkörperchen und erleichtert den Einbau des Eisens stärkt
G es el ls ch af t fü r V er su ch st ie rk un de G V S O L A S. Ausschuss für Ernährung der Versuchstiere
 G es el ls ch af t fü r V er su ch st ie rk un de So ci et y fo r La bo ra to ry An im al S ci en ce G V S O L A S Ausschuss für Ernährung der Versuchstiere Fütterungskonzepte und -methoden in der Versuchstierkunde
G es el ls ch af t fü r V er su ch st ie rk un de So ci et y fo r La bo ra to ry An im al S ci en ce G V S O L A S Ausschuss für Ernährung der Versuchstiere Fütterungskonzepte und -methoden in der Versuchstierkunde
Mineralstoffversorgung in der praktischen Schaffütterung
 Mineralstoffversorgung in der praktischen Schaffütterung Dr. Claus-Dieter Jahn Spezialfutter Neuruppin T. 03521 45 12 01 / H. 0160 96 86 48 33 email Dr.Claus-Dieter-Jahn@t-online.de Spezialfutter Neuruppin
Mineralstoffversorgung in der praktischen Schaffütterung Dr. Claus-Dieter Jahn Spezialfutter Neuruppin T. 03521 45 12 01 / H. 0160 96 86 48 33 email Dr.Claus-Dieter-Jahn@t-online.de Spezialfutter Neuruppin
Zusatzinformationen Kohlenhydrate Monosaccharide
 Zusatzinformationen Kohlenhydrate Monosaccharide Monosaccharide Sind die einfachsten Kohlenhydrate. Müssen nicht enzymatisch gespalten werden und können deshalb vom Verdauungstrakt direkt ins Blut aufgenommen
Zusatzinformationen Kohlenhydrate Monosaccharide Monosaccharide Sind die einfachsten Kohlenhydrate. Müssen nicht enzymatisch gespalten werden und können deshalb vom Verdauungstrakt direkt ins Blut aufgenommen
Prof. Dr. Manfred Rietz, Peter Weffers. Grundkurs Ernährung. Arbeitsheft. 1. Auflage. Bestellnummer 91477
 Prof. Dr. Manfred Rietz, Peter Weffers Grundkurs Ernährung Arbeitsheft 1. Auflage Bestellnummer 91477 Haben Sie Anregungen oder Kritikpunkte zu diesem Produkt? Dann senden Sie eine E-Mail an 91477_001@bv-1.de
Prof. Dr. Manfred Rietz, Peter Weffers Grundkurs Ernährung Arbeitsheft 1. Auflage Bestellnummer 91477 Haben Sie Anregungen oder Kritikpunkte zu diesem Produkt? Dann senden Sie eine E-Mail an 91477_001@bv-1.de
Ernährungs-und Stoffwechsel-Analyse
 Ernährungs-und Stoffwechsel-Analyse von Maria Muster beyou Abnehm-Club So haben Sie gegessen! Ausgewertet nach ernährungswissenschaftlichen Richtlinien von PEP Food Consulting- Institut für Ernährung,
Ernährungs-und Stoffwechsel-Analyse von Maria Muster beyou Abnehm-Club So haben Sie gegessen! Ausgewertet nach ernährungswissenschaftlichen Richtlinien von PEP Food Consulting- Institut für Ernährung,
Vollmilch in der Kälberaufzucht - wie funktioniert das?
 BILDUNGS- UND WISSENSZENTRUM AULENDORF - Viehhaltung, Grünlandwirtschaft, Wild, Fischerei - Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung und Grünlandwirtschaft LVVG Briefadresse: Postfach 1252
BILDUNGS- UND WISSENSZENTRUM AULENDORF - Viehhaltung, Grünlandwirtschaft, Wild, Fischerei - Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung und Grünlandwirtschaft LVVG Briefadresse: Postfach 1252
Getreidearten und deren Anwendung
 Erbsen Erbsen Linsen Soja (getostet) Katjang Idjoe Wicken Popcorn Mais Cribbs Mais Merano Mais Reis Buchweizen Weizen Haferkerne Gerste Silberhirse 1 Gelbe Hirse Dari Milo Kanariensaat Hanfsaat Leinsaat
Erbsen Erbsen Linsen Soja (getostet) Katjang Idjoe Wicken Popcorn Mais Cribbs Mais Merano Mais Reis Buchweizen Weizen Haferkerne Gerste Silberhirse 1 Gelbe Hirse Dari Milo Kanariensaat Hanfsaat Leinsaat
Zellen brauchen Sauerstoff Information
 Zellen brauchen Sauerstoff Information Tauchregel: Suche mit deiner schweren Tauchausrüstung einen direkten Weg zum Einstieg ins Wasser. Tauchen ist wie jede andere Sportart geprägt von körperlicher Anstrengung.
Zellen brauchen Sauerstoff Information Tauchregel: Suche mit deiner schweren Tauchausrüstung einen direkten Weg zum Einstieg ins Wasser. Tauchen ist wie jede andere Sportart geprägt von körperlicher Anstrengung.
gesunde ernährung BALLASTSTOFFE arbeitsblatt
 BALLASTSTOFFE Ballaststoffe sind unverdauliche Nahrungsbestandteile, das heißt sie können weder im Dünndarm noch im Dickdarm abgebaut oder aufgenommen werden, sondern werden ausgeschieden. Aufgrund dieser
BALLASTSTOFFE Ballaststoffe sind unverdauliche Nahrungsbestandteile, das heißt sie können weder im Dünndarm noch im Dickdarm abgebaut oder aufgenommen werden, sondern werden ausgeschieden. Aufgrund dieser
Empfehlungen zur Fütterung von Mutterkühen und deren Nachzucht
 DLG-Fütterungsempfehlungen September 2009 Empfehlungen zur Fütterung von Mutterkühen und deren Nachzucht DLG-Arbeitskreises Futter und Fütterung www.futtermittel.net www.dlg.org 1. Einleitung In Deutschland
DLG-Fütterungsempfehlungen September 2009 Empfehlungen zur Fütterung von Mutterkühen und deren Nachzucht DLG-Arbeitskreises Futter und Fütterung www.futtermittel.net www.dlg.org 1. Einleitung In Deutschland
KLASSE: 8TE NAME: Vorname: Datum:
 Kapitel V - 1 - Kapitel V : Mein Körper meine Gesundheit (S. 226 - ) V.1) Das Skelett der Wirbeltiere (Buch S. 228) V.1.1. Versuch 4 Seite 228 Notiere deine Antwort auf die Rückseite dieses Blatts V.1.2.
Kapitel V - 1 - Kapitel V : Mein Körper meine Gesundheit (S. 226 - ) V.1) Das Skelett der Wirbeltiere (Buch S. 228) V.1.1. Versuch 4 Seite 228 Notiere deine Antwort auf die Rückseite dieses Blatts V.1.2.
Die neue Trockennahrung für Katzen
 NEU Die neue Trockennahrung für Katzen Vom Kitten bis zum rüstigen Schrer bietet die neue MultiFit Trockennahrung allen Katzen unwiderstehlichen Genuss in jeder Lebensphase. Junior Wachstum Besonders im
NEU Die neue Trockennahrung für Katzen Vom Kitten bis zum rüstigen Schrer bietet die neue MultiFit Trockennahrung allen Katzen unwiderstehlichen Genuss in jeder Lebensphase. Junior Wachstum Besonders im
Mineralstoffe Arbeitsblatt
 Lehrerinformation 1/6 Arbeitsauftrag Ziel Material Die Sch lesen den Informationstext und recherchieren eigenständig Informationen zu einem Mineralstoff. Sie erstellen einen Steckbrief und ein inkl. Lösung.
Lehrerinformation 1/6 Arbeitsauftrag Ziel Material Die Sch lesen den Informationstext und recherchieren eigenständig Informationen zu einem Mineralstoff. Sie erstellen einen Steckbrief und ein inkl. Lösung.
Mineralstoffe (Michael Büchel & Julian Appel)
 Mineralstoffe (Michael Büchel & Julian Appel) Funktion & Vorkommen Kalzium ist beteiligt am Aufbau von Knochen und Zähnen. Wichtig für die Blutgerinnung und die Muskelarbeit. Hilft Nervensignale zu übermitteln.
Mineralstoffe (Michael Büchel & Julian Appel) Funktion & Vorkommen Kalzium ist beteiligt am Aufbau von Knochen und Zähnen. Wichtig für die Blutgerinnung und die Muskelarbeit. Hilft Nervensignale zu übermitteln.
Ernährung und Chemie Thema: Präventive Ernährung Datum:
 Vitamine: Die Vitamine E, C und Beta-Carotin (Vorstufe des Vitamin A) werden als Antioxidantien bezeichnet. Antioxidantien haben die Eigenschaft so genannte freie Radikale unschädlich zu machen. Freie
Vitamine: Die Vitamine E, C und Beta-Carotin (Vorstufe des Vitamin A) werden als Antioxidantien bezeichnet. Antioxidantien haben die Eigenschaft so genannte freie Radikale unschädlich zu machen. Freie
Fütterung und Futtermittel in der Milchviehhaltung. Detlef May
 Fütterung und Futtermittel in der Milchviehhaltung Detlef May Übersicht 1-1: Die chemische Zusammensetzung von Tier und Nahrung Tier oder Nahrung Rohwasser Trockenmasse Rohasche (Anorganische Stoffe) Reinasche
Fütterung und Futtermittel in der Milchviehhaltung Detlef May Übersicht 1-1: Die chemische Zusammensetzung von Tier und Nahrung Tier oder Nahrung Rohwasser Trockenmasse Rohasche (Anorganische Stoffe) Reinasche
Verdauung beim Menschen
 Verdauung beim Menschen Unterrichtsfach Themenbereich/e Schulstufe (Klasse) Fachliche Vorkenntnisse Fachliche Kompetenzen Sprachliche Kompetenzen Zeitbedarf Material- & Medienbedarf Sozialform/en Methodische
Verdauung beim Menschen Unterrichtsfach Themenbereich/e Schulstufe (Klasse) Fachliche Vorkenntnisse Fachliche Kompetenzen Sprachliche Kompetenzen Zeitbedarf Material- & Medienbedarf Sozialform/en Methodische
Grundlegende Zusammenhänge. Ing. Thomas Guggenberger, BAL Gumpenstein
 Grundlegende Zusammenhänge Mastrinder Ing. Thomas Guggenberger, BAL Gumpenstein Fütterung & Fütterungstechnik STANDORTBESTIMMUNG PRODUKTIONSFAKTOREN Genetische Leistungsfähigkeit Haltung & Tiergesundheit
Grundlegende Zusammenhänge Mastrinder Ing. Thomas Guggenberger, BAL Gumpenstein Fütterung & Fütterungstechnik STANDORTBESTIMMUNG PRODUKTIONSFAKTOREN Genetische Leistungsfähigkeit Haltung & Tiergesundheit
Zusätzliche Informationen
 MILCHSÄUREKULTUREN MINERALSTOFFE 6 Milchsäure Anleitung LP Die Lernenden wissen, dass im Körper und in Nahrungsmitteln verschiedene Bakterien vorkommen und dass Nahrungsmittel damit angereichert werden.
MILCHSÄUREKULTUREN MINERALSTOFFE 6 Milchsäure Anleitung LP Die Lernenden wissen, dass im Körper und in Nahrungsmitteln verschiedene Bakterien vorkommen und dass Nahrungsmittel damit angereichert werden.
Gesundheit vor Augen!
 Gesundheit vor Augen! Über gesunde Ernährung für die Augen! Ratgeber für Patienten mit Uveitis + So viele gute Gründe für etwas Neues Vorwort Das Essen soll zuerst das Auge erfreuen und dann den Magen,
Gesundheit vor Augen! Über gesunde Ernährung für die Augen! Ratgeber für Patienten mit Uveitis + So viele gute Gründe für etwas Neues Vorwort Das Essen soll zuerst das Auge erfreuen und dann den Magen,
 Grundlagen der Ernährung Gesunde Ernährung in der heutigen Gesellschaft Nahrungsbestandteile: Kohlenhydrate Sind der größte Bestandteil unserer Nahrung Sind die wichtigsten Energielieferanten für unseren
Grundlagen der Ernährung Gesunde Ernährung in der heutigen Gesellschaft Nahrungsbestandteile: Kohlenhydrate Sind der größte Bestandteil unserer Nahrung Sind die wichtigsten Energielieferanten für unseren
Effizienz und Nachhaltigkeit Hohe Herdenleistung bei geringerer Belastung für Tier und Umwelt
 Effizienz und Nachhaltigkeit Hohe Herdenleistung bei geringerer Belastung für Tier und Umwelt Markus Wagner, Tierarzt Alltech (Deutschland) GmbH Hannover, 12.11.2014 Definition Effizienz Wirksamkeit Wirtschaftlichkeit
Effizienz und Nachhaltigkeit Hohe Herdenleistung bei geringerer Belastung für Tier und Umwelt Markus Wagner, Tierarzt Alltech (Deutschland) GmbH Hannover, 12.11.2014 Definition Effizienz Wirksamkeit Wirtschaftlichkeit
 ! einer der drei wichtigsten Bestandteile unserer Ernährung (neben Fetten und Proteinen)! früher wurde ihre Bedeutung, vor allem von Leuten die abnehmen wollten, falsch verstanden! dienen zur Verhinderung
! einer der drei wichtigsten Bestandteile unserer Ernährung (neben Fetten und Proteinen)! früher wurde ihre Bedeutung, vor allem von Leuten die abnehmen wollten, falsch verstanden! dienen zur Verhinderung
Fütterungsfehler vermeiden
 Fütterungsfehler vermeiden Die moderne Schafhaltung verfolgt das Ziel, das genetisch vorhandene Potenzial der Mutterschafe sowie der erzeugten Lämmer bestmöglich auszuschöpfen. Konkret gilt es die Mutterschafe
Fütterungsfehler vermeiden Die moderne Schafhaltung verfolgt das Ziel, das genetisch vorhandene Potenzial der Mutterschafe sowie der erzeugten Lämmer bestmöglich auszuschöpfen. Konkret gilt es die Mutterschafe
Schmackhafte Qualitätsnahrung für Kaninchen, Meerschweinchen und Hamster. Neu, lecker & gesund, für glückliche Nagetiere.
 Schmackhafte Qualitätsnahrung für Kaninchen, Meerschweinchen und Hamster Neu, lecker & gesund, für glückliche Nagetiere. Mineral Wichtige minerale Bausteine für das Skelett. Fibres Ballaststoffe für eine
Schmackhafte Qualitätsnahrung für Kaninchen, Meerschweinchen und Hamster Neu, lecker & gesund, für glückliche Nagetiere. Mineral Wichtige minerale Bausteine für das Skelett. Fibres Ballaststoffe für eine
DIE ERNÄHRUNG DES ALTEN HUNDES EINE HERAUSFORDERUNG?
 DIE ERNÄHRUNG DES ALTEN HUNDES EINE HERAUSFORDERUNG? Dr. med. vet. Annette Liesegang, Dr. med. vet. Brigitta Wichert, Institut für Tierernährung, Vetsuisse-Fakultät Universität Zürich Veröffentlicht in
DIE ERNÄHRUNG DES ALTEN HUNDES EINE HERAUSFORDERUNG? Dr. med. vet. Annette Liesegang, Dr. med. vet. Brigitta Wichert, Institut für Tierernährung, Vetsuisse-Fakultät Universität Zürich Veröffentlicht in
Die häufigsten Gründe, Abnehmen. warum das. nicht funktioniert!
 3 Die häufigsten Gründe, Abnehmen warum das nicht funktioniert! Die drei häufigsten Gründe, warum das Abnehmen nicht funktioniert 1. Der Körper ist übersäuert Wenn man stoffwechselsenkende Medikamente
3 Die häufigsten Gründe, Abnehmen warum das nicht funktioniert! Die drei häufigsten Gründe, warum das Abnehmen nicht funktioniert 1. Der Körper ist übersäuert Wenn man stoffwechselsenkende Medikamente
Mehr Milch aus dem Grundfutter
 Mehr Milch aus dem Grundfutter Tom Dusseldorf CONVIS Mehr Milch aus dem Grundfutter Wirtschaftliche Aspekte Physiologische Aspekte Qualität der Gras- und Maissilagen 2015 Hohe Grundfutteraufnahmen gewährleisten!
Mehr Milch aus dem Grundfutter Tom Dusseldorf CONVIS Mehr Milch aus dem Grundfutter Wirtschaftliche Aspekte Physiologische Aspekte Qualität der Gras- und Maissilagen 2015 Hohe Grundfutteraufnahmen gewährleisten!
Qualität/Preis/Auswahl
 2013 Qualität/Preis/Auswahl www.landi.ch Für den besten Freund nur das Beste! bitsdog Hundefutter sind qualitativ hochstehende Produkte die ihrem treuen Freund und Begleiter eine artgerechte und ausgewogene
2013 Qualität/Preis/Auswahl www.landi.ch Für den besten Freund nur das Beste! bitsdog Hundefutter sind qualitativ hochstehende Produkte die ihrem treuen Freund und Begleiter eine artgerechte und ausgewogene
Inhaltsverzeichnis. Das Warnecke-Konzept Mein Weg zum Ziel Ausgeglichene Energiezufuhr Sport als Ergänzung
 Inhaltsverzeichnis Das Warnecke-Konzept Mein Weg zum Ziel Ausgeglichene Energiezufuhr Sport als Ergänzung Powerstoff Eiweiß In einer Studie aus dem Jahr 2004 wurde gezeigt, dass Aminosäuren, die kleinen
Inhaltsverzeichnis Das Warnecke-Konzept Mein Weg zum Ziel Ausgeglichene Energiezufuhr Sport als Ergänzung Powerstoff Eiweiß In einer Studie aus dem Jahr 2004 wurde gezeigt, dass Aminosäuren, die kleinen
Ernährung des Pferdes
 w w w. a c a d e m y o f s p o r t s. d e w w w. c a m p u s. a c a d e m y o f s p o r t s. d e Ernährung des Pferdes L E SEPROBE online-campus Auf dem Online Campus der Academy of Sports erleben Sie
w w w. a c a d e m y o f s p o r t s. d e w w w. c a m p u s. a c a d e m y o f s p o r t s. d e Ernährung des Pferdes L E SEPROBE online-campus Auf dem Online Campus der Academy of Sports erleben Sie
Maisprodukte in der Schweinefütterung (Körnermais, Ganzkörnersilage, CCM)
 Maisprodukte in der Schweinefütterung (Körnermais, Ganzkörnersilage, CCM) Dr. H. Lindermayer, G. Propstmeier-LfL-ITE Grub Etwa 40 % der Schweine, v.a. Mastschweine, werden mit Maisrationen gefüttert. Dabei
Maisprodukte in der Schweinefütterung (Körnermais, Ganzkörnersilage, CCM) Dr. H. Lindermayer, G. Propstmeier-LfL-ITE Grub Etwa 40 % der Schweine, v.a. Mastschweine, werden mit Maisrationen gefüttert. Dabei
Toast "Hawaii" (Zubereitungsart: Nebenkomponente, Haushalt)
 Toast "Hawaii" (Zubereitungsart: Nebenkomponente, Haushalt) Graphics-Soft Beispielstr. 123 35444 Biebertal http://www.graphics-soft.de info@graphics-soft.de Tel.: (01234) 56789 Fax.: (03232) 54545 Hauptgruppe:
Toast "Hawaii" (Zubereitungsart: Nebenkomponente, Haushalt) Graphics-Soft Beispielstr. 123 35444 Biebertal http://www.graphics-soft.de info@graphics-soft.de Tel.: (01234) 56789 Fax.: (03232) 54545 Hauptgruppe:
Ernährung bei Gastritis
 maudrich.gesund essen Ernährung bei Gastritis Bearbeitet von Irmgard Fortis, Johanna Kriehuber, Ernst Kriehuber 2., akt. Aufl. 2012. Taschenbuch. 152 S. Paperback ISBN 978 3 85175 947 1 Format (B x L):
maudrich.gesund essen Ernährung bei Gastritis Bearbeitet von Irmgard Fortis, Johanna Kriehuber, Ernst Kriehuber 2., akt. Aufl. 2012. Taschenbuch. 152 S. Paperback ISBN 978 3 85175 947 1 Format (B x L):
GEMEINDEWERKE KIEFERSFELDEN
 GEMEINDEWERKE KIEFERSFELDEN Strom - Gas - Wasser Allgemeine Informationen zum Trinkwasser Ernährungsphysiologische Bedeutung Funktionen von Wasser im Körper Jede chemische Reaktion und jeder Vorgang im
GEMEINDEWERKE KIEFERSFELDEN Strom - Gas - Wasser Allgemeine Informationen zum Trinkwasser Ernährungsphysiologische Bedeutung Funktionen von Wasser im Körper Jede chemische Reaktion und jeder Vorgang im
Mineralstoffversorgung bei Rindern und Kühen
 Mineralstoffversorgung bei Rindern und Kühen Einleitung Mineralstoffgehalte von Silagen aus ökologischem Landbau der letzten 7 Jahre haben gezeigt, dass Grünland und Kleegras aus Sicht der Tierernährung
Mineralstoffversorgung bei Rindern und Kühen Einleitung Mineralstoffgehalte von Silagen aus ökologischem Landbau der letzten 7 Jahre haben gezeigt, dass Grünland und Kleegras aus Sicht der Tierernährung
Veggie. Depot. 1 x einnehmen. 10-fach versorgt. Avitale. Vegan, vegetarisch, gut versorgt! Jod B12. Vitamine + Mineralstoffe.
 Avitale Veggie Depot Ca C 1 x einnehmen. 10-fach versorgt. Fe Zn B2 B6 B1 Jod D2 nur 1x täglich B12 Vitamine + Mineralstoffe Nahrungsergänzung für eine vegane und vegetarische Ernährung Vegan, vegetarisch,
Avitale Veggie Depot Ca C 1 x einnehmen. 10-fach versorgt. Fe Zn B2 B6 B1 Jod D2 nur 1x täglich B12 Vitamine + Mineralstoffe Nahrungsergänzung für eine vegane und vegetarische Ernährung Vegan, vegetarisch,
Vergleichender Mischfuttertest Nr. 94/08 Milchleistungsfutter II, III und IV aus Baden-Württemberg
 Vergleichender Mischfuttertest Nr. 94/08 Milchleistungsfutter II, III und IV aus Baden-Württemberg Im vorliegenden VFT-Test wurden fünfzehn Milchleistungsfutter von neun Werken geprüft. Die Proben wurden
Vergleichender Mischfuttertest Nr. 94/08 Milchleistungsfutter II, III und IV aus Baden-Württemberg Im vorliegenden VFT-Test wurden fünfzehn Milchleistungsfutter von neun Werken geprüft. Die Proben wurden
Einsatz von NaOH behandeltem Getreide in der Milchkuhfütterung
 Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft Fachbereich 6 Tierische Erzeugung Referat 62 Tierhaltung, Fütterung 04886 Köllitsch, Am Park 3 Internet: http://www.smul.sachsen.de/lfl Bearbeiter: Dr. Joachim
Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft Fachbereich 6 Tierische Erzeugung Referat 62 Tierhaltung, Fütterung 04886 Köllitsch, Am Park 3 Internet: http://www.smul.sachsen.de/lfl Bearbeiter: Dr. Joachim
Neue Entwicklungen in der Pferdefütterung Janina Schmid Palzer, Prof. Dr. Mechthild Freitag, Fachbereich Agrarwirtschaft, Fachhochschule Südwestfalen.
 Rund ums Pferd Informationsveranstaltung für Pferdefreunde Neue Entwicklungen in der Pferdefütterung Janina SchmidPalzer, Prof. Dr. Mechthild Freitag, Fachbereich Agrarwirtschaft, Fachhochschule Südwestfalen.
Rund ums Pferd Informationsveranstaltung für Pferdefreunde Neue Entwicklungen in der Pferdefütterung Janina SchmidPalzer, Prof. Dr. Mechthild Freitag, Fachbereich Agrarwirtschaft, Fachhochschule Südwestfalen.
«Also Brot oder Spaghetti oder Haferflocken?», fragt Mira. Pharaoides nickt. «Da sind Kohlenhydrate drin, und die geben jede Menge Kraft.
 Durch die geheime Tür, die Mira entdeckt hat, kommen sie in die nächste Pyramiden-Abteilung. Pharaoides muss hier erst einmal etwas essen. Irgendetwas, das aus Körnern, Reis oder Kartoffeln gemacht ist.»
Durch die geheime Tür, die Mira entdeckt hat, kommen sie in die nächste Pyramiden-Abteilung. Pharaoides muss hier erst einmal etwas essen. Irgendetwas, das aus Körnern, Reis oder Kartoffeln gemacht ist.»
Ackerbohnen oder Lupinen zur Eiweißversorgung von Milchkühen
 n oder n zur Eiweißversorgung von Milchkühen In einem Fütterungsversuch mit Milchkühen in Haus Riswick, Kleve, wurde die Wirksamkeit von n und n zur Proteinversorgung vergleichend geprüft. Über die Versuchsergebnisse
n oder n zur Eiweißversorgung von Milchkühen In einem Fütterungsversuch mit Milchkühen in Haus Riswick, Kleve, wurde die Wirksamkeit von n und n zur Proteinversorgung vergleichend geprüft. Über die Versuchsergebnisse
kagfreiland Milch gibt starke Knochen Info
 Bild: Schweizer Milchproduzenten SMP kagfreiland Milch gibt starke Knochen Info Milch F.A.Q. & F.H.C. (frequently asked question & frequently heard claims) Pastmilch enthält weniger Vitamine als Rohmilch!
Bild: Schweizer Milchproduzenten SMP kagfreiland Milch gibt starke Knochen Info Milch F.A.Q. & F.H.C. (frequently asked question & frequently heard claims) Pastmilch enthält weniger Vitamine als Rohmilch!
Pure Whey Protein Natural
 Wie Ihnen das Pure Whey Protein Natural dabei hilft, sich um Ihr Wohlbefinden zu kümmern. Proteine sind essentiell für den reibungslosen Ablauf der Funktionen im menschlichen Körper. Sie werden beim Wachstum,
Wie Ihnen das Pure Whey Protein Natural dabei hilft, sich um Ihr Wohlbefinden zu kümmern. Proteine sind essentiell für den reibungslosen Ablauf der Funktionen im menschlichen Körper. Sie werden beim Wachstum,
Was versteht man unter Vergärung?
 Was versteht man unter Vergärung? Unter dem Begriff Vergärung versteht man den Abbau von biogenem Material durch Mikroorganismen in Abwesenheit von Sauerstoff, d.h. unter anaeroben Bedingungen. Mehrere
Was versteht man unter Vergärung? Unter dem Begriff Vergärung versteht man den Abbau von biogenem Material durch Mikroorganismen in Abwesenheit von Sauerstoff, d.h. unter anaeroben Bedingungen. Mehrere
EM Einsatz in der Tierernährung, Kotwasser und Koliken bei Pferden
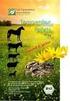 EM Einsatz in der Tierernährung, Kotwasser und Koliken bei Pferden Ablauf Was ist EM? Was macht EM? Wirkungsweise von EM im Boden Analogie zum Darm EM in der Verdauung Einsatz in der Tierernährung EM Einsatz
EM Einsatz in der Tierernährung, Kotwasser und Koliken bei Pferden Ablauf Was ist EM? Was macht EM? Wirkungsweise von EM im Boden Analogie zum Darm EM in der Verdauung Einsatz in der Tierernährung EM Einsatz
Gesunde Ernährung. Eine ausgewogene Ernährung soll alle Bestandteile liefern, die wir benötigen, um gesund zu bleiben.
 Gesunde Ernährung Eine ausgewogene Ernährung soll alle Bestandteile liefern, die wir benötigen, um gesund zu bleiben. Was essen wir? Essen ist viel mehr als nur Nahrungsaufnahme! Essverhalten durch verschiedene
Gesunde Ernährung Eine ausgewogene Ernährung soll alle Bestandteile liefern, die wir benötigen, um gesund zu bleiben. Was essen wir? Essen ist viel mehr als nur Nahrungsaufnahme! Essverhalten durch verschiedene
