Europa Krise Gewerkschaft DDS. Zeitschrift der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Landesverband Bayern
|
|
|
- Busso Dresdner
- vor 4 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Europa Krise Gewerkschaft DDS Zeitschrift der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Landesverband Bayern November 2013
2 2 DDS November 2013 Europa Krise Gewerkschaften 3 Die Troika und der Flächentarifvertrag EU-Druck zerstört nationale Tarifvertragssysteme von Dr. Thorsten Schulten 5 Das Bildungssystem in Griechenland wird zerstört Ein Bericht von Nikos Kalogeros 7 Rechnen für die Zukunft Der DGB hat einen»marshallplan für Europa«vorgelegt Ein Interview mit Dr. Mehrdad Payandeh 9 Für den Export nur bedingt geeignet von Matthias Anbuhl 10 Das duale System als ein Teil des Ausbildungsgeschehens von Ansgar Klinger 12 Gewerkschaftliche Solidarität über die EU-Grenzen hinaus Keine Entwarnung nach der Brandkatastrophe in Bangladesch von Wolfgang Häberle Was es sonst noch gibt 14 Revitalisierung des politischen Streiks! GEW beschließt auf ihrem Gewerkschaftstag einen Antrag zur Ausweitung des Streikrechts von Sven Lehmann und Mike Niederstraßer 15 Wie wir einen schmackhaften Buchstabensalat zaubern von Irmgard Schreiber-Buhl 16 aus der GEW - Am letzten Arbeitstag. Ein Gespräch mit Hans Schuster, Katharina Harrer und Brigitte Gallner von der GEW-Rechtsstelle -»Wenn Professionelle sich fremdgesteuert fühlen«bericht über eine Veranstaltung des Arbeitskreises Kritische Sozialarbeit, der GEW München und ver.di - Fachtagung der GEW Bayern:»Demokratie in der Schule«20 Lesetipps - Nationalismus, Terror und Vertreibungsschicksal Deutsche und tschechische Schüler*innen dokumentieren gemeinsam die Geschichte der Iglauer Sprachinsel vor und nach 1945 Um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, so wird es stets kolportiert, müssen die von der Krise am meisten betroffenen Länder vor allem im Süden Europas ihre öffentlichen Ausgaben und die sozialen Leistungen radikal reduzieren sowie öffentliches Eigentum bis hin zum Totalausverkauf privatisieren, also verscherbeln. Zum weiteren Verständnis ist Wikipedia hilfreich, das erklärt:»wettbewerb bezeichnet in der Wirtschaftswissenschaft das Streben von mindestens zwei Akteuren (Wirtschaftssubjekten) nach einem Ziel, wobei der höhere Zielerreichungsgrad eines Akteurs einen niedrigeren Zielerreichungsgrad des anderen bedingt.«man könnte es auch so ausdrücken: Wo die einen gewinnen, müssen die anderen verlieren. Unsere hochgeschätzte wie die Wahlen gerade wieder bewiesen haben Kanzlerin Angela Merkel ist bekanntermaßen die energischste Verfechterin der Wettbewerbsfähigkeitsthese, wenn es darum geht, die anderen europäischen Länder an die Kandare zu nehmen. Nicht zuletzt dafür wurde sie vom deutschen Wahlvolk so belohnt. Dass es ihr allerdings nur verbal um die Wettbewerbsfähigkeit der anderen Länder geht, und auch nur dann, wenn sie für die Forderung nach radikalstem Sozialabbau in diesen Staaten argumentieren muss, hat sie gerade wieder bewiesen. Die Verabschiedung der bereits fertig ausgehandelten neuen EU-Abgasnorm, nach welcher der CO 2 -Ausstoß von PKWs reduziert werden sollte, wurde dank ihres tatkräftigen Einsatzes verhindert. Ihr Argument: Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Autoindustrie würde darunter leiden. Klartext: Die Wettbewerbsfähigkeit der anderen Länder, die diese durch ihre Sparmaßnahmen erhöhen sollen, gilt nicht gegenüber Deutschland.»Wir«müssen immer Gewinner bleiben. Dafür, dass die Wettbewerbsfähigkeit der CDU erhalten bleibt, um solche Politik auch schamlos weiter betreiben zu können, haben dann die Hauptaktionär*innen von BMW mit ihrer Euro-Spende auch gleich gesorgt. Karin Just Kleiner Nachtrag zur Aktion»Umfairteilen«des DGB Bayern am 7. September 2013 in München Rubriken 21 Dies & Das 22 Veranstaltungen 23 Glückwünsche und Dank 24 Kontakte Telefonische Sprechzeiten der GEW-Rechtsstelle mit Beratung für GEW-Mitglieder: Mo und Do von Uhr Tel.: Bitte Mitgliedsnummer bereithalten! Ab gilt folgende Änderung (meiner Adresse, Bankverbindung, Eingruppierung, Beschäftigungsart, Teilzeit, Erziehungsurlaub, Arbeitsstelle, GEW-Funktion...) Name: Mitgliedsnummer: Änderung: Bitte zurück an GEW Bayern, Schwanthalerstr. 64, München Grundsatz aller Gewerkschaften: Wer weniger verdient, zahlt weniger Beitrag (wenn es uns mitgeteilt wird!). Wer unter dem satzungsgemäßen Beitrag liegt, verliert seinen gewerkschaftlichen Rechtsschutz! Foto:Otmar Eholzer Folgende Themen (Arbeitstitel) für die DDS sind in Planung. Beiträge dazu und weitere Vorschläge sind erwünscht: Dezember: Tarifrunde TVöD; Januar/Februar: Tarifrunde, LVV, BR-Wahlen; März: Frauen/Gender; April: Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge; Mai: Demokratie in der Schule Impressum: DDS Herausgeber: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) im DGB, Landesverband Bayern Geschäftsstelle: Schwanthalerstr. 64, München, Fax: info@gew-bayern.de Redaktionsleiterin: Karin Just, Kidlerstr. 41, München oder über die Geschäftsstelle der GEW erreichbar Fax: Karin.Just@gew-bayern.de Redaktionelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Jan Bundesmann, Verena Escherich, Wolfgang Häberle, Hannes Henjes, Petra Nalenz, Gele Neubäcker, Ute Schmitt, Dorothea Weniger, Wolfram Witte Gestaltung: Karin Just Bildnachweis: (soweit nicht beim Foto berücksichtigt); Titel: imago/seeliger Druck: Druckwerk GmbH, Schwanthalerstr. 139, München Anzeigenannahme: nur über die Redaktionsleitung Anzeigenverwaltung: Druckwerk GmbH, Schwanthalerstr. 139, München , team@druckwerk-muenchen.de Zur Zeit ist die Anzeigenpreisliste Nr. 13 vom gültig. Mit Namen oder Namenszeichen gekennzeichnete Beiträge stellen die Meinung der betreffenden VerfasserInnen dar und bedeuten nicht ohne Weiteres eine Stellungnahme der GEW Bayern oder der Redaktion. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Druckschriften wird keine Gewähr übernommen. Bei allen Veröffentlichungen behält sich die Redaktion Kürzungen vor. Der Bezugspreis ist für GEW-Mitglieder des Landesverbandes Bayern im Mitgliedsbeitrag inbegriffen. Der Bezugspreis für Nichtmitglieder beträgt jährlich 21 EUR zuzüglich Porto, der Preis der Einzelnummer 2,50 EUR zuzüglich Porto. Die DDS erscheint monatlich mit Ausnahme der Monate Januar und August. Adressenänderung: Ummeldungen bitte an die Landesgeschäftsstelle der GEW. Redaktions- und Anzeigenschluss: jeweils am 6. des Vormonats.
3 DDS November Die Troika und der Flächentarifvertrag EU-Druck zerstört nationale Tarifvertragssysteme Der Flächentarifvertrag ist eine wesentliche Institution des europäischen Sozialmodells. Nirgendwo existieren derart starke Tarifvertragssysteme mit überbetrieblichen Tarifvereinbarungen auf sektoraler oder sogar nationaler Ebene. Er sorgt dafür, dass in Europa immer noch die meisten Beschäftigten durch tarifvertragliche Regelungen geschützt sind. Obwohl es seit mehr als 20 Jahren in Europa Tendenzen zu einer stärkeren Dezentralisierung der Tarifpolitik gibt, sind in den meisten EU-Ländern die Flächentarifvertragssysteme erstaunlich stabil geblieben, abgesehen von Großbritannien und einigen osteuropäischen Ländern. Aufgrund der aktuellen ökonomischen Krise ändert sich dies gerade. Immer mehr EU-Länder bauen ihre Tarifvertragssysteme um, Flächentarifvertragsstrukturen werden zerstört. Als treibende Kraft hat sich v. a. die sogenannte Troika aus Europäischer Kommission, Europäischer Zentralbank (EZB) und Internationalem Währungsfond (IWF) erwiesen. EU-Krisenmanagement und Bedeutung der Tarifpolitik Das EU-Krisenmanagement begreift die aktuelle Krise v. a. als Verschuldungsund Wettbewerbskrise, für die v. a. zwei Therapien formuliert werden: Zum einen sollen durch eine harte Spar- und Austeritätspolitik die öffentlichen Haushalte konsolidiert werden. Zum anderen soll mit Hilfe grundlegender Strukturreformen die nationale Wettbewerbsfähigkeit verbessert werden. In dem auf Initiative von Merkel und Sarkozy 2011 verabschiedeten Euro-Plus- Pakt wird der Lohn- und Tarifpolitik eine zentrale Bedeutung zugewiesen. Bei der Konsolidierung der öffentlichen Haushalte geht es um Lohnstopps und -kürzungen im öffentlichen Dienst, die mittlerweile in den meisten EU-Ländern vollzogen wurden. Bei der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit wird ebenfalls eine kurzfristige Reduzierung der Lohn- und Lohnstückkosten propagiert. Darüber hinaus sollen die nationalen Tarifvertragssysteme so reformiert werden, dass sie den Unternehmen flexible Anpassungen an veränderte ökonomische Rahmenbedingungen ermöglichen. In einem Bericht der Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen der Europäischen Kommission (DG ECFIN) werden unter der Überschrift»beschäftigungsfreundliche Reformen«u. a. folgende Maßnahmen aufgelistet: Allgemeine Dezentralisierung des Tarifvertragssystems Einführung/Ausdehnung von Öffnungsklauseln für betriebliche Abweichungen von Flächentarifverträgen Begrenzung/Abschaffung des»günstigkeitsprinzips«beschränkung/reduzierung von Allgemeinverbindlicherklärungen Außerdem wird wörtlich die»reduzierung der Tarifbindung«sowie die»allgemeine Reduzierung der Lohnsetzungsmacht der Gewerkschaften«als»beschäftigungsfreundliche Reform«bezeichnet. Damit ist die politische Stoßrichtung klar. Die Strategie zielt nicht nur auf eine Abschaffung von Flächentarifverträgen, sondern will bewusst das Tarifvertragssystem und die Gewerkschaften insgesamt schwächen. Auch wenn in der Europäischen Kommission diese Position nicht einhellig geteilt und mittlerweile v. a. von der Generaldirektion für Beschäftigung, Soziales und Integration (DG EMPL) offen kritisiert wird, ist es innerhalb der Troika jedoch gerade die DG EC- FIN, die zusammen mit der EZB und dem IWF die Vorgaben für die nationalen»reformprogramme«formuliert. Hinter dieser Strategie steht eine krude Version der neoklassischen Arbeitsmarkttheorie, derzufolge Tarifverträge unter Generalverdacht stehen, das freie Marktgleichgewicht zu behindern und damit Arbeitslosigkeit zu produzieren, obwohl dies die internationale em-
4 4 DDS November 2013 pirische Arbeitsmarktforschung überwiegend widerlegt. Der Umbau der Tarifvertragssysteme in den EU-Krisenstaaten Seit jeher müssen sich Länder, die vom IWF Kredite erhalten, im Gegenzug in sogenannten»memoranden«zu umfangreichen politischen Reformen verpflichten. Im Zuge der Eurokrise ist dieses Verfahren auch für Kredite aus dem EU-Rettungsfond übernommen worden, wobei nun die Troika der»wächter«ist. Lettland, Rumänien und Ungarn unterzeichneten 2008 noch IWF-Memoranden. Danach folgten unter Troika-Ägide Griechenland, Irland, Portugal und Spanien. Beim»Sonderfall«Italien machte die EZB den Kauf von italienischen Staatsanleihen von weitreichenden Strukturreformen abhängig. In allen Memoranden spielen Strukturreformen auf dem Arbeitsmarkt eine zentrale Rolle. Die von der Troika verfolgte Strategie einer radikalen Dezentralisierung der Tarifpolitik umfasst vor allem vier Ansatzpunkte: Den ersten bildet die Abschaffung von Tarifverträgen auf nationaler Ebene. So wurden z. B. in Griechenland und Rumänien bis zur Krise nationale Rahmentarifvereinbarungen getroffen, u. a. auch zum Mindestlohn. Mittlerweile haben die beiden Regierungen auf Druck der Troika die Mindestlohnverhandlungen suspendiert und im Falle Griechenlands sogar eine Mindestlohnkürzung um mehr als 20 % durchgesetzt, was gemäß Internationaler Arbeitsorganisation (ILO) gegen die Tarifautonomie verstößt. Zum Abbruch der Tarifverhandlungen kam es auch in Irland. Die Arbeitgeber meinten, im Rahmen dezentraler Tarifverhandlungen könnten Lohnkürzungen leichter durchgesetzt werden. Der zweite Ansatzpunkt liegt in der Erweiterung betrieblicher Abweichungsmöglichkeiten von sektoralen Flächentarifverträgen. In Italien und Spanien z. B. hatten sich die Gewerkschaften zunächst mit den Arbeitgebern noch auf tarifliche Öffnungsklauseln verständigt, die ähnlich wie in Deutschland die Konditionen betrieblicher Abweichungen festlegten. In beiden Ländern haben sich die Regierungen jedoch über diese Vereinbarungen hinweggesetzt und auf gesetzlichem Wege die Dezentralisierung radikalisiert, indem das Günstigkeitsprinzip abgeschafft und damit der uneingeschränkte Vorrang betrieblicher Vereinbarungen festgeschrieben wurde. Der dritte Ansatzpunkt liegt in der Einführung deutlich strikterer Regeln für die Allgemeinverbindlicherklärung (AVE) von Tarifverträgen. In vielen EU-Ländern bildet die AVE ein zentrales Instrument für die Stabilität des Tarifvertragssystems und die Absicherung einer hohen Tarifbindung. Dies galt z. B. für Portugal, wo traditionell alle wichtigen Branchentarifverträge für allgemeinverbindlich erklärt wurden. Auf Druck der Troika wurden nun ähnlich wie in Deutschland hohe Hürden für eine AVE eingeführt, sodass in Zukunft nur noch wenige Tarifverträge für allgemeinverbindlich erklärt werden dürften. Veränderungen in den nationalen Tarifvertragssystemen unter dem Druck der Troika Beendigung/Abschaffung nationaler Tarifverhandlungen Griechenland, Irland, Rumänien Gesetzliche Öffnungsklauseln für betriebliche Abweichungen von sektoralen Tarifverträgen Priorität für betriebliche Tarifverträge; Abschaffung des Günstigkeitsprinzips Striktere Regeln für die Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen Reduzierung der Nachwirkung von Tarifverträgen Betriebliche Tarifverträge auch durch nichtgewerkschaftliche Arbeitnehmergruppen Griechenland, Italien, Portugal, Spanien Griechenland, Italien, Spanien Griechenland, Portugal, Rumänien Griechenland, Spanien Griechenland, Portugal, Spanien, Rumänien, Ungarn Schulten Th./Müller T. (2013): A new European Interventionism? The impact of the New European Economic Governance on Wages and Collective Bargaining. In: Natali, D./Vanhercke, B. (Hg.): Social Developments in the EU 2012, European Trade Union Institute and the European Social. Der vierte Ansatzpunkt liegt schließlich darin, das gewerkschaftliche Verhandlungsmonopol aufzulösen und auch nichtgewerkschaftlichen Arbeitnehmergruppen das Recht zu betrieblichen Tarifvereinbarungen einzuräumen. Gerade die Klein- und Mittelbetriebe stellt die Dezentralisierung der Tarifverhandlungen nämlich vor das Problem, dass oft gar kein gewerkschaftlicher Verhandlungspartner auf betrieblicher Ebene vorhanden ist. In einigen Ländern wie z. B. Griechenland, Spanien oder Portugal wurde deshalb nun nichtgewerkschaftlichen Arbeitnehmergruppen ein Verhandlungsrecht eingeräumt. Die Folgen sind bereits heute unübersehbar. Ehemals starke Flächentarifvertragssysteme werden systematisch zerstört. Mehr noch: Der Tarifvertrag als Instrument einer kollektiven Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen verliert deutlich an Bedeutung. So hat sich z. B. in Spanien die Anzahl der im Jahr 2012 gültigen Tarifverträge gegenüber 2010 fast halbiert. In vielen Ländern mündet der Umbau der Tarifvertragssysteme in einen dramatischen Rückgang der Tarifbindung. Schließlich kommt es zu einem massiven Machtverlust der Gewerkschaften. Troika für alle? Einiges deutet darauf hin, dass sich die mit der Troika gemachten Erfahrungen bald auf die gesamte EU übertragen könnten. Obwohl der EU-Vertrag Kompetenzen im Bereich der Lohn- und Tarifpolitik explizit ausschließt, ist letztere heute ein fester Bestandteil der bislang etablierten Verfahren für eine engere europäische Koordinierung der Wirtschaftspolitik. So enthalten z. B. die im Rahmen des Europäischen Semesters formulierten Empfehlungen für die meisten EU-Staaten auch Forderungen zur Reform der Tarifpolitik. Eine stärkere Dezentralisierung wird inzwischen auch Ländern wie Belgien und Frankreich empfohlen. Eine dauerhafte Nichtbeachtung der EU-Empfehlungen könnte perspektivisch sogar mit Sanktionen belegt werden. Schließlich gehen die neuen Vorschläge zur Weiterentwicklung der Europäischen Wirtschaftsunion dahin, dass die EU nach dem Vorbild der Troika-Memoranden mit allen Nationalstaaten verbindliche Verträge über durchzuführende Strukturreformen abschließt. Auf diese Weise könnten auch die heute noch relativ gefestigten Flächentarifvertragssysteme in West- und Nordeuropa ins Schussfeld geraten. von Dr. Thorsten Schulten Leiter des Referats Arbeits- und Tarifvertragspolitik in Europa im WSI der Hans-Böckler-Stiftung Die Langfassung des Textes mit Literaturliste gibt es unter:
5 Das Bildungssystem in Griechenland wird zerstört Ein Bericht von Nikos Kalogeros DDS November Das Land, in dem die Troika bisher die größten sozialen Verwüstungen hervorgerufen hat, ist Griechenland. Wie sich das auf das Bildungssystem auswirkt, berichtete Nikos Kalogeros auf einer Veranstaltung der GEW in Kassel. Das öffentliche Erziehungswesen befindet sich in einem Zustand der Auflösung. Faktisch steht das Erziehungsministerium und damit das staatliche Bildungssystem unter der Aufsicht der Troika. Entscheidungen, die das Erziehungswesen auf allen Ebenen betreffen, werden nun ausschließlich nach finanziellen Abwägungen getroffen und zielen direkt darauf ab, eine»billige Schule«zu schaffen. Einsparungen, Rationalisierungen und die Suche nach den billigsten Lösungen sind die Ziele der»neuen Schule des Marktes«, wobei pädagogische und soziale Fragen keine Rolle mehr spielen. Die beispiellose Ausgabenkürzung im Erziehungswesen gefährdet selbst elementarste Aufgaben der Schulen, wenn man nicht die Last auf die Eltern verlagern will. Außerdem hat die Drei-Parteien-Koalition zusammen mit der Troika beschlossen, die Ausgaben bis 2015 auf 2,23 % des Bruttosozialprodukts zu reduzieren. Die Konsequenz dieser Politik ist die Umwandlung der Erziehung von einer sozialen Leistung und staatlichen Aufgabe in eine Ware. Studierende, Schülerinnen und Schüler werden zu Kunden auf dem Erziehungsmarkt. Für das Personal bedeutet dies eine Verschlechterung bezüglich Löhnen und Arbeitsbedingungen. Viele dieser Veränderungen wurden bereits vor Jahren als Ausdruck neoliberaler Ideen begonnen, die darauf abzielen, Bildung und Erziehung von einem Menschenrecht in eine betriebswirtschaftliche Größe umzuwandeln. Diese Politik wurde nicht nur in Griechenland implementiert, sondern als Teil des Lissabon-Vertrags und anderer europäischer Vereinbarungen überall in Europa. Konsequenzen für die Bildung Die Ausgaben im Erziehungsbereich sind von 2009 bis 2013 um 33 % gekürzt worden mit dramatischen Folgen für die öffentlichen Schulen und die sowieso dürftigen Lehrer*innengehälter. Wenn wir die bis 2016 vorgesehene weitere Kürzung von 14 % einbeziehen, werden sich die Ausgaben für den Erziehungsbereich innerhalb von sieben Jahren um 47 % verringert haben! Im letzten Schuljahr wurden Grundschulen und 410 Sekundarschulen zu neuen Einheiten zusammengelegt. Dies hat zu Schließungen geführt: 851 von Grundschulen (7,8 %) und 205 von Sekundarschulen (6,5 %). Aktuell wird die nächste Runde von Schließungen und Zusammenlegungen erwartet. Darüber hinaus gab es die Auflösung von ausgleichenden Erziehungsprogrammen und von unterstütztem Lernen (für lernbehinderte Kinder), von Sportklassen und Sportschulen sowie verschiedenen Ganztagsschulen. Auch der Fremdsprachenunterricht wurde zusammengestrichen, sowohl im Grundschul- wie im Sekundarschulbereich. Es wurden 22 von 28 Umwelterziehungszentren geschlossen, 800 Schulbibliotheken werden allmählich abgebaut und geschlossen. Diese Bibliotheken wurden unter Kofinanzierung der EU und des griechischen Staates eingerichtet. Außerdem legte die Regierung per Gesetz fest, dass alle Grundschulklassen mindestens 25 und die Sekundarschulklassen ohne Ausnahme mindestens 28 bis 30 Schüler*innen haben müssen. Kleinere Klassen mit weniger Schüler*innen sind verboten, was Schulen in kleinen Dörfern oder auf Inseln zur Schließung verurteilt. Was das für ein Land wie Griechenland mit seiner Vielzahl kleiner Inseln bedeutet, kann man sich vorstellen! Das Ministerium plant, Schulleiter*innen in Manager*innen umzuwandeln,
6 6 DDS November 2013 die alles mittels eines noch einzuführenden Evaluationssystems kontrollieren und bestimmen werden. Das hat das Ziel, die demokratische Entscheidungsfindung durch Lehrer*innenkonferenzen abzuschaffen. Seit 2009 betragen die jährlichen Gehaltseinbußen bei Lehrer*innen Euro bei verheirateten Lehrkräften mit 33 Dienstjahren, für neu eingestellte Kolleg*innen sogar bis zu Euro. Die prozentualen Verluste liegen zwischen 21 und 45 %. In den Jahren 2010 bis 2012 gingen Lehrkräfte in den Ruhestand. Für sie wurden nur Vollzeitlehrer*innen eingestellt. Gewerkschaft ohne Streikrecht? Vor einigen Wochen beschlossen Lehrkräfte der Sekundarstufe einen Generalstreik, der mit den Abiturprüfungen zusammengefallen wäre. Die OLME (Gewerkschaftsverband für die Sekundarschullehrer*innen) traf diese Entscheidung, weil die Regierung zwei Gesetze erlassen hatte, die das Erziehungswesen massiv betreffen werden: Erhöhung der Pflichtstundenzahl Mögliche Zwangsversetzung des Lehrpersonals in jede Region Griechenlands Wenn diese Gesetze angewandt werden, werden mehr als befristet angestellte Lehrkräfte gekündigt. Darüber hinaus werden mehr als Lehrer*innen zwangsversetzt. Zu der ohnehin schlechten Bezahlung für Berufsanfänger*innen zwischen 640 und 750 Euro käme die für ihre Familien außerordentliche Belastung durch mögliche Zwangsversetzungen. Um den Streik zu verhindern, griff die Drei-Parteien-Regierung zur politischen Dienstverpflichtung der Lehrer*innen, Nicos Kalogeros einem Mittel, das die Regierung in diesem Jahr nun zum vierten Mal anwendet. Außer den Lehrkräften hat die Regierung Schiffsbesatzungen, Gemeindeangestellte und Bedienstete von öffentlichen Verkehrsmitteln dienstverpflichtet. Damit wurde den Beschäftigten ihr Recht auf Streik genommen. Es ist offensichtlich, dass die Sparbeschlüsse von einem massiven Demokratieabbau begleitet sind. Das zeigt sich auch an der vorbeugenden Zwangsrekrutierung von Lehrer*innen, bevor der Streik offiziell ausgerufen wurde. Die Vernichtung von sozialen Leistungen, die Privatisierungen, der Verkauf öffentlichen Eigentums, die Steuerraubzüge, die Kürzung von Löhnen und Renten, der Angriff auf die Rechte der Versicherten und Rentner*innen, die Rezession, die Einschränkung der demokratischen Rechte, Rassismus, Nationalismus und die offene Aktivität neofaschistischer Organisationen führen unser Land zurück in die Vergangenheit. Diese Sparpolitik, die die Rechte und Bedürfnisse der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung opfert und die eine immer kleinere Minderheit reicher und reicher macht, ist eine katastrophale Politik, die gestoppt werden muss. Schließlich müssen wir von der Selbstzerstörung der Demokratie sprechen, wenn diese harten Maßnahmen ohne und gegen die Bevölkerung in Europa ergriffen werden. Allerdings wird diese Politik nicht von alleine aufhören. Gemeinsamer Widerstand ist nötig. Zurzeit durchleben Griechenland, Portugal, Spanien und andere Länder ein Experiment, in dem sie die Versuchskaninchen sind. Tempo und Brutalität des Sozialabbaus sind beispiellos in der Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir glauben, dass die praktische Zusammenarbeit aller Organisationen der Beschäftigten und Erwerbslosen, der Jugend und der sozialen Bewegungen in den Ländern Europas notwendig ist. Nur durch unseren gemeinsamen Widerstand können wir die neoliberale Politik in Europa aufhalten! In Griechenland entstehen zurzeit viele Selbsthilfeorganisationen, um den schwierigen Alltag zu meistern. Diese Initiativen verstehen sich als politisch und sind über»solidarity- 4all«vernetzt. Wer sie finanziell unterstützen möchte, kann eine Spende auf das folgende Konto überweisen: Manfred Klingele-Pape, Konto: , Hamburger Sparkasse, BLZ , Verwendungszweck: Griechenland-Soli. Weitere Informationen unter: > Suche: Solidaritätsreise Griechenland Wir danken der»hlz«, der Zeitschrift der GEW Hessen, für die Nachdruckgenehmigung. Die hier abgedruckten Fotos dokumentieren den Lehrer*innenstreik im September 2013 und wurden von OLME, der Gewerkschaft der Sekundarschullehrer*innen, zur Verfügung gestellt.
7 Rechnen für die Zukunft Der DGB hat einen»marshallplan für Europa«vorgelegt DDS November Das folgende Interview führten Redakteure der Zeitschrift»Luxemburg Gesellschaftsanalyse und linke Praxis«mit Dr. Mehrdad Payandeh, Leiter der Abteilung Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik beim DGB-Bundesvorstand und Autor des»marshallplan für Europa«. Wir danken beiden für die Nachdruckgenehmigung. Den»Marshallplan für Europa«mit vielen zusätzlichen Informationen gibt es unter: themen/++co++985b632e-407e-11e2- b b4dc422 Dr. Mehrdad Payandeh Der DGB hat einen»marshallplan für Europa«vorgelegt worum geht es dabei? Er soll eine Diskussion über die Zukunft Europas und die Alternativen zur Austeritätspolitik anstoßen. Der»Marshallplan für Europa«ist bis heute das einzige gesamteuropäische Zukunftsprogramm gegen die Krise und für eine langfristige Modernisierung Europas, das konkrete Maßnahmen enthält und vollständig durchgerechnet ist. Keine Partei, kein Wirtschaftsinstitut, niemand aus der ökonomischen Zunft in Deutschland und Europa hat dergleichen vorgelegt. Er zeigt, dass statt Arbeitslosigkeit mindestens neun Millionen zukunftsfähige Vollzeitstellen in Europa möglich sind und damit auch ökonomische Grundlagen für den Schuldenabbau und für die Handlungsfähigkeit der Staaten in Europa bestehen. Integration muss nicht mehr Armut bedeuten. Wir diskutieren den Plan derzeit auf diversen Veranstaltungen in verschiedenen europäischen Ländern, insbesondere mit unseren Schwesterorganisationen er ist inzwischen in fünf Sprachen übersetzt und stößt auf breites Interesse. Wie sieht diese Rechnung im Einzelnen aus? Die makroökonomischen Effekte könnten sich sehen lassen: Durch zusätzliches Wachstum entstehende Steuereinnahmen würden sich für 27 EU-Staaten auf rund 104 Mrd. Euro belaufen. Damit lässt sich die öffentliche Verschuldung besser zurückfahren. Die Staaten könnten außerdem 56 Mrd. Euro zusätzliche Sozialversicherungsbeiträge einnehmen und damit unsere sozialen Sicherungssysteme zukunftsfest machen. 150 Mrd. Euro jährliche Investitionen in eine europaweite Energiewende würden uns langfristig von Brennstoffimporten unabhängig machen und für die Senkung des CO 2 - Ausstoßes sorgen. Der Plan geht von 300 Mrd. Euro jährlichen Einsparungen an Brennstoffimporten aus das wäre ökologisch, aber auch ökonomisch beachtlich. Auch die deutsche Energiewende wäre damit finanzierbar, ohne Verbraucher und kleine sowie mittelständische Unternehmen in den Ruin zu treiben. Wie kann die Handlungsfähigkeit des Staates gestärkt werden? Angesichts der immer knapperen natürlichen Ressourcen, der dramatischen sozialen Schieflage, der Massenarbeitslosigkeit in vielen europäischen Staaten, der demografischen Herausforderungen und steigenden Wissens- und Technologieintensität des Wirtschaftens sowie der öffentlichen und privaten Verschuldung muss dringend die Handlungsfähigkeit des Staates wiederhergestellt werden. Dies bedarf jedoch eines prosperierenden Umfelds und einer gerechten Verteilung von Einkommen und Vermögen. Die heutige Politik in Europa ist in diesem Sinne fahrlässig, weil sie gebetsmühlenartig ausschließlich von Sparen und Schuldenabbau redet, ohne das ökonomische Fundament hierfür bereitzustellen. Unsere Vorschläge sorgen gerade für eine nachhaltige Prosperität und damit für ein Volkseinkommen, das dann auch dem Staat wieder Milliarden Steuereinnahmen beschert so kann Handlungsfähigkeit auch finanziell wiederhergestellt werden. Vorausgesetzt, die Politik sorgt mit einem gerechten Steuersystem für mehr Steuereinnahmen und verteilt diese nicht wie die FDP wieder als Geschenke an ihre Klientel. Der Plan wird von allen DGB-Gewerkschaften unterstützt das ist beachtlich. Wie ist der Diskussionsprozess verlaufen? Gab es Vorbehalte? Alle DGB-Gewerkschaften kritisieren die Politik des sozialen Kahlschlags in Europa. Insofern gab es keine Vorbehalte. Der Marshallplan wurde auch einstimmig vom Bundesvorstand beschlossen. Damit zeigen Gewerkschaften, dass sie eine Vorreiterrolle spielen, wenn es darum geht, Europa zukunftsfest zu machen. Allerdings ist das eine andere Zu-
8 8 DDS November 2013 kunft, als sie sich Bundeskanzlerin Merkel oder der britische Premierminister Cameron vorstellen. Der»Europäische Zukunftsfonds«basiert unter anderem auf einer einmaligen Sonderabgabe auf große Vermögen. Welche anderen Finanzierungsquellen sind geplant? Wenn Sie in den nächsten zehn Jahren Mrd. Euro Zukunftsinvestitionen vornehmen wollen, reicht eine einmalige Vermögensabgabe natürlich nicht aus. Diese würde europaweit auf einen Betrag zwischen 200 und 250 Mrd. Euro hinauslaufen. Damit können Sie keine zehnjährige Modernisierungsoffensive aufstellen. Die Vermögensabgabe ist also nicht die Quelle zur Finanzierung des Marshallplans. Mit diesem Geld finanzieren wir lediglich das Eigenkapital des»europäischen Zukunftsfonds«, das jedes Unternehmen am Anfang benötigt, wenn es am Markt aktiv sein will. Das Geld wird nicht einmal investiv verwendet, sondern dient lediglich als Polster zur Bonitätssicherung des Zukunftsfonds. Eigentlich etwas, was wir für ein robustes europäisches Bankensystem fordern. Und die Finanzierung geschieht dann wie? Finanziert wird der ganze Marshallplan über die Emission einer festverzinslichen zehnjährigen»new-deal- Anleihe«, die ähnlich wie eine Unternehmens- oder Staatsanleihe funktioniert. Sie wird vom»europäischen Zukunftsfonds«ausgegeben und kann dann von Anlegern wie Versicherungen erworben werden. Mit der»new- Deal-Anleihe«bietet der Zukunftsfonds den Versicherungen und anderen nicht spekulativen Anlegern sichere Anlagemöglichkeiten, die zurzeit rar sind. Davon profitieren vor allem Beschäftigte und einfache Sparer, die für ihre Zukunft oder private Altersvorsorge Geld zurückgelegt haben. Sie bekommen mit den»new-deal-anleihen«, die ähnlich sicher sind wie die deutschen Bundesanleihen, anständige Zinsen für ihre Ersparnisse. So bekommen wir das Kapital zur Finanzierung des Marshallplans. Um die anfallenden Zinsen und nach zehn Jahren die Tilgung zu finanzieren, wollen wir die Einnahmen aus der Finanztransaktionssteuer einsetzen, die vor allem spekulative Finanztransaktionen trifft. Im Zentrum des Investitions- und Konjunkturprogramms steht eine Stärkung öffentlicher Infrastrukturen und der Gemeingüter. Wie verhält sich das zu Schuldenbremse und Fiskalpakt? Die Förderung von Zukunftsinvestitionen läuft über den»europäischen Zukunftsfonds«, nicht über nationale Haushalte, die den Bestimmungen des Fiskalpaktes unterliegen. Es kostet die Staaten keinen Steuer-Cent. Sie müssen lediglich die Finanztransaktionssteuer in ihrem Land einführen, dann erhielten sie alle Vorzüge dieses Marshallplans. Die Vorteile wären beachtlich: Sie würden von zusätzlichen Steuereinnahmen profitieren, vom Wegfall der Kosten für Arbeitslosigkeit, von neuen und zukunftsfähigen Jobs und von einer besseren Konjunktur, von einem stabilen Arbeitsmarkt und nicht zuletzt vom sozialen Frieden. Sie würden aber auch als Standort von besserer Infrastruktur profitieren, einem besseren Bildungssystem, besserer Ausstattung mit modernen Industrie- und Dienstleistungen, von energiearmen und ressourcenschonenden Wirtschaften und von emissionsarmen Städten und Gemeinden. Der Clou dieses Plans ist, dass ein Dritter, nämlich der»europäische Zukunftsfonds«, zusätzlich zur öffentlichen Hand für den Modernisierungsschub in Europa sorgt. Das ist vor allem für die Länder, die gegenwärtig kaum in der Lage sind, finanziell über die Runden zu kommen, ein Meilenstein. Aber gucken Sie sich mal die erbärmliche Debatte um die deutsche Energiewende an. Sie kommt kaum voran. Wir machen mit unserem Programm den Weg auch für die Umsetzung der deutschen Energiewende frei. Eine»Europäische Energiewende«gehört zu den wesentlichen Elementen des Plans. Wie kann die sozial-ökologische Perspektive mit Beschäftigungsentwicklung verbunden werden? Die Substitution der mit wenigen inländischen Arbeitsplätzen einhergehenden Öl- und Gasimporte durch eine CO 2 - arme Energieversorgung, die eine wesentlich höhere Beschäftigungsquote aufweist, wird langfristig die Arbeitslosenzahlen senken und damit die Haushalte der EU-Länder entlasten. Die langfristigen Beschäftigungseffekte von Investitionen in eine CO 2 -arme Energieversorgung sind sechs- bis siebenfach höher als die Ausgaben für Öl- und Gasimporte. Vor allem Infrastrukturmaßnahmen und energetische Gebäudesanierung bzw. energieeffiziente Bauten sind besonders beschäftigungsintensiv. Stichwort»Konjunktur«keine»Grenzen des Wachstums«also? Unser Stichwort ist»qualitatives Wachstum«. Alle vorgeschlagenen Maßnahmen sollen den Ressourcen- und Energieverbrauch reduzieren und einen flächendeckenden Umbau der Gesellschaft in Gang setzen. Die Stichworte hier sind»alters- und behindertengerechte Gesellschaft«,»Zukunftsbildung und -jobs für die Jugend«,»Stabilisierung der sozialen Sicherungssysteme«. Und hier sehe ich keine Grenzen des Wachstums. Ganz im Gegenteil. Es gibt sehr viel Handlungsbedarf, sogar weltweit. Die Alternative ist nicht kein Wachstum, sondern ein anderes, ein qualitatives Wachstum, das die Lebensbedingungen der Menschen verbessert und nicht im Namen der Umwelt sogar verschlechtert. Wenn man sich die soziale Lage von Millionen Arbeitslosen, sozial Benachteiligten und Jugendlichen ohne jegliche Perspektive vor Augen führt hier noch mehr Verzicht draufzupacken, ist genauso fahrlässig wie das Versprechen von Frau Merkel, dass der Wohlstand von morgen das Leiden von heute voraussetzt. Trotz der auf gesellschaftlichen Umbau gerichteten Perspektive operiert der Plan mit einer fordistischen Vorstellung von Vollzeitarbeit. Was ist mit der Umverteilung von Arbeit und Zeit? Der Marshallplan ist kein Generalplan für alle erdenklichen Lebensbereiche. Die offenen Fragen der Arbeitsgesellschaft und deren Ausgestaltung hätten den Rahmen gesprengt und zu einer thematischen Überfrachtung geführt. Uns lag in erster Linie daran, zukunftsfähige Jobs für 26 Mio. Arbeitslose in Europa zu schaffen und zugleich eine energetische und altersgerechte Grundsanierung unserer Volkswirtschaften vorzunehmen. Aber zur Klarstellung: Wir haben die erwarteten Beschäftigungseffekte als Vollzeitstellen deshalb berechnet, um das eigentliche Potenzial des Marshallplans für den europäischen Arbeitsmarkt aufzuzeigen. Vollzeitstellen sind deshalb wichtig, weil sich aus den Vollzeitstellen noch mehr Teilzeitjobs abschöpfen lassen. Gut entlohnte selbstverständlich!
9 DDS November Foto:imago/CommonLense Für den Export nur bedingt geeignet Bessere Berufsbildung soll die Jugendarbeitslosigkeit in Europa bekämpfen. Schon wird die duale Ausbildung aus Deutschland als Vorbild gefeiert doch lässt sie sich einfach exportieren? Es war ein hoher Anspruch, den Annette Schavan erhob:»wir geben den Startschuss für eine europäische Ausbildungsallianz. Es ist ein unhaltbarer Zustand, dass so viele junge Menschen in Europa arbeitslos sind. Es gibt deshalb großes Interesse an unserem erfolgreichen System der dualen Ausbildung«, erklärte die damalige Bundesbildungsministerin im Rahmen eines»europäischen Bildungsgipfels«im Dezember 2012 in Berlin. Mit Griechenland, Portugal, Spanien, Italien, Lettland und der Slowakei unterschrieben gleich sechs Staaten das»berliner Memorandum«, in dem sie vereinbarten, durch eine betriebsnahe Ausbildung einen Beitrag für eine geringere Jugendarbeitslosigkeit zu leisten. Als»Exportschlager«bewerben deutsche Botschaften mittlerweile das duale System im Ausland. Fakt ist: Das duale System der Berufsausbildung hat sich auch nach Auffassung des DGB bewährt. Es sichert eine enge Verknüpfung zwischen Bildungssystem und Arbeitsmarkt und bietet den Jugendlichen eine breit angelegte hochwertige berufliche Qualifikation. Die Übernahme dualer Elemente kann für andere Staaten eine sinnvolle Alternative sein. Deshalb engagiert sich der DGB in diversen Arbeitsgruppen zur internationalen Berufsbildungskooperation. Erfolgsvoraussetzung: Kooperation aller Beteiligten Der DGB warnt aber vor zu hohen Erwartungen bei der Übertragung dualer Elemente in andere Ausbildungssysteme. Der Erfolg des dualen Systems ist mit besonderen Voraussetzungen verknüpft. Das duale System ist kein rein staatliches Bildungssystem, sondern lebt vom Engagement der Gewerkschaften und der Arbeitgeber. Durch die Ausbildung im Betrieb werden die Jugendlichen zu Insidern in den Unternehmen. Die Perspektive der Arbeitgeber ist einfach: Sie sichern durch die Ausbildung den künftigen Fachkräftenachwuchs und zahlen deshalb auch eine Vergütung an die Auszubildenden. Für die Gewerkschaften sind die Jugendlichen akzeptierter Teil der Belegschaften. Betriebs- und Personalräte sowie Jugend- und Auszubildendenvertretungen streiten für die Rechte der Auszubildenden. In den Tarifverhandlungen setzen sich die Gewerkschaften ebenfalls für die Azubis ein. Nicht zuletzt zum Beispiel im Rahmen der»operation Übernahme«, als die IG Metall für sichere Perspektiven der Jugendlichen nach dem Ende der Ausbildung kämpfte. Auch an der Steuerung des Berufsbildungssystems sind Gewerkschaften, Arbeitgeber und der Staat trotz aller Konflikte gemeinsam beteiligt. Sie entwickeln die Ausbildungsberufe mit ihren Expertinnen und Experten aus der Praxis. Dies sichert eine hohe Akzeptanz der Ausbildungsberufe in der Arbeitswelt. Eine Übernahme einzelner Elemente der dualen Berufsausbildung wird nur gelingen, wenn Gewerkschaften und Arbeitgeber die berufliche Bildung als ein strategisches Handlungsfeld für sich begreifen und wenn sie zu einer gemeinsamen Steuerung dieses Systems bereit sind. Insbesondere in den Krisenländern im Süden Europas ist dies kaum der Fall. Zu groß sind die Spannungen zwischen Gewerkschaften, Arbeitgebern und Regierungen wegen des Spardiktats der Troika. Schon ein kurzer Blick in die anderen Staaten Europas zeigt, dass es um den vermeintlichen Export des dualen Systems schlecht steht.»die duale Ausbildung gut zu finden, ist einfach. Sie einzuführen, aber schwierig«, schrieb folgerichtig die Tageszeitung»Die Welt«. Beispiel Griechenland: Den griechischen Ministerien bereitet es große Schwierigkeiten, mit den Sozialpartnern auf Augenhöhe zu kooperieren. Berufsbildung war in Griechenland bisher immer Sache des Staates. Der aktuelle Gesetzentwurf zur Reform der Berufsbildung
10 10 DDS November 2013 Bei allen Reformbemühungen kommt hinzu, dass auch die beste Jugendgarantie erst nachhaltige Perspektiven für junge Menschen schaffen kann, wenn es ausreichend Arbeitsplätze gibt. Das Spardiksieht vor, dass junge Menschen drei Jahre eine schulische Ausbildung durchlaufen und anschließend freiwillig ein Jahr Praktikum im Betrieb machen sollen. Die Inhalte der Ausbildung sind Teil des Gesetzentwurfs und somit vom Ministerium festgelegt. Die Folge: Der aktuelle Gesetzentwurf erschwert alle Bemühungen, Elemente einer dualen Ausbildung in Griechenland einzuführen. Beispiel Portugal: Zwar hat sich in diesem Sommer eine deutsch-portugiesische Arbeitsgruppe gegründet. Doch gleich in der ersten Sitzung verdeutlichten die Arbeitgeber: Sie werden kein Geld in eine duale Ausbildung investieren, da sie nach ihrer Auffassung genug Steuern zahlten und nicht auch noch in Ausbildungsvergütungen investieren wollten. Beispiel Spanien: Zurzeit bremst das spanische Ministerium den Prozess aus. Insbesondere die Kontaktaufnahme mit Regionalregierungen, Betrieben und Sozialpartnern durch das Bundesinstitut für Berufsbildung wird kritisch gesehen, wichtige Treffen wurden von spanischer Seite abgesagt. Auch die Zusammenarbeit mit Italien, Lettland oder der Slowakei steckt noch in den Kinderschuhen. Kurzum: Außer Absichtserklärungen und gut gemeinten Projekten ist bisher nicht viel herausgekommen. Vollmundige Ankündigungen über den Exportschlager duale Berufsausbildung werden der Herausforderung und der Wirklichkeit in den Ländern nicht gerecht. Modell Deutschland? zeitig gibt es auch Abwehrhaltungen gegen die Einflussnahme Deutschlands auf die Bildungssysteme der Mitgliedsstaaten. Wichtig wäre die Klarstellung, dass es nicht um einen schlichten Export der dualen Berufsausbildung geht. Das duale System ist kein Instrument, um die Jugendarbeitslosigkeit in Europa kurzfristig zu bekämpfen. Der Aufbau dualer Strukturen in der beruflichen Bildung ist ein mittelbis langfristiges Projekt. Auch ist es nicht sinnvoll, das duale System eins zu eins in andere Länder zu übertragen. Notwendig ist eine Verständigung über Mindeststandards einer modernen Berufsausbildung. Diese müssen die Ausbildungsdauer, den Ausbildungsvertrag, ein nationales Regelwerk sowie die gemeinsame Steuerung durch Regierung und Sozialpartner umfassen. Zudem darf nicht vergessen werden, dass es auch auf dem deutschen Ausbildungsmarkt erhebliche Probleme gibt. Fast Jugendliche befinden sich in Warteschleifen ohne Aussicht auf eine abgeschlossene Ausbildung. Mehr als 1,4 Millionen junge Menschen im Alter von 20 bis 29 Jahren haben keinen Berufsabschluss. Sie werden kaum in der Lage sein, später ihren eigenen Lebensunterhalt zu finanzieren. Junge Menschen mit höchstens einem Hauptschulabschluss schaffen immer seltener den direkten Sprung von der Schule in die Ausbildung. Derweil sinkt die Ausbildungsbereitschaft der deutschen Betriebe auf ein Rekordtief. Die Ausbildungsbetriebsquote liegt jetzt bei nur noch 21,7 Prozent. Jugendgarantie kostet Geld! tat der Europäischen Union wirkt in den Krisenstaaten wie ein Brandbeschleuniger. Arbeitslosenzahlen und Haushaltsdefizite wachsen weiter. Auch die Regierungen in den Krisenländern haben Fehler gemacht. Doch die strikte Austeritätspolitik und die damit verbundenen Lohnsenkungen und Massenentlassungen von der deutschen Regierung federführend durchgesetzt haben die Krise drastisch verschärft. Europas Jugend braucht Ausbildung und Arbeit. Kurzfristig müssen wir ihr helfen, Beschäftigung zu finden über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Lohnkostenzuschüsse für junge Beschäftigte oder Hilfen bei Kreditklemmen gerade für kleine Unternehmen. Mittelfristig brauchen Krisenstaaten statt radikaler Kürzungen ein Zukunfts- und Investitionsprogramm in Bildung, Infrastruktur und Wirtschaft. Der Marshallplan des DGB bietet konkrete Vorschläge 30 Milliarden Euro für Bildung und Ausbildung inklusive. Die Europäische Kommission verspricht eine Jugendgarantie. Junge Menschen brauchen Angebote, die sie zu einem qualifizierten Berufsabschluss oder einer Arbeit führen. Sechs Milliarden Euro verteilt auf zwei Jahre stehen bereit. Das sind für jeden arbeitslosen Jugendlichen nicht einmal zehn Euro pro Woche. Die Jugendgarantie braucht mehr Geld. Niemand soll behaupten, dafür seien keine Mittel da. Binnen kürzester Frist standen dreistellige Milliardensummen für die Rettung der Banken bereit. Wenn jetzt beim Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit gespart wird, ist das ein fatales Signal. Die Jugend ist systemrelevant! Darüber hinaus wird die Rolle Deutschlands zwiespältig wahrgenommen; dies zeigen auch Gespräche mit anderen europäischen Gewerkschaften. Deutschland repräsentiert ein starkes und weltweit anerkanntes Berufsbildungssystem, gleichvon Matthias Anbuhl Leiter der Abteilung Bildungspolitik und Bildungsarbeit beim DGB-Bundesvorstand Das duale System als ein Teil des Ausbildungsgeschehens In der öffentlichen Diskussion wird das»duale System«häufig mit»der Berufsausbildung«gleichgesetzt. Zahlreiche Ausbildungen jedoch finden weder in Industrie oder Handwerk noch in der dualen Form Betrieb-Schule statt. Dass wir über ein Mischsystem der beruflichen Ausbildung wenn auch nicht so ausgeprägt wie in Österreich oder der Schweiz verfügen, wird oftmals ignoriert. Dabei ermöglicht gerade diese Vielfalt, alle Jugendlichen in Ausbildung, Beruf und letztlich gesellschaftliche Teilhabe zu integrieren. Ohne Frage ist das duale System nach wie vor bedeutsam und zukunftsfähig, es bleibt aber ein Teil des gesamten Ausbildungsgeschehens. Dies kann im Folgenden anhand eines Auszuges der Ausbildungsdaten für Bayern in den Jahren 2005 bis 2012 aufgezeigt werden (s. Schaubild/Tabelle auf der nächsten Seite). Traten im Jahr 2005 in Bayern noch knapp junge Menschen in den»übergangsbereich«ein, so waren es im jüngst referierten Jahr noch gut Hierzu gehören vor allem Programme der Berufsvorbereitung und -grundbildung, auch der Bundesagentur für Arbeit einschließlich der Einstiegsqualifizierung. Ihnen ist gemeinsam, dass sie nicht zu einem qualifizierenden Berufsabschluss führen. Die Eintrittszahlen der Berufsausbildung im dualen System haben im Jahr 2007 mit knapp einen Höhepunkt erreicht und lagen im Jahr 2011 als Folge der gut erkennbaren doppelten Abiturient*innenjahrgänge deutlich unter denen der Studienanfänger*innen. Unabhängig von der Schulzeitverkürzung (G8) hat die Anzahl der Studienanfänger*innen im Berichtszeitraum den deutlichsten Zuwachs von 42 % im Jahr 2012 gegenüber dem Jahr 2005 erfahren! Häufig in der öffentlichen Diskussion vernachlässigt und mit in Bayern knapp Anfänger*innen quantitativ bedeutsam sind
11 DDS November die hier unter der Rubrik»Übrige Berufsausbildung«zusammengefassten Ausbildungen: Dahinter verbergen sich vor allem die landesoder bundesrechtlich geregelten Ausbildungen in Berufen des Gesundheits-, Erziehungs- und Sozialwesens mit einem überdurchschnittlich hohen Frauenanteil und die vollqualifizierenden Berufsausbildungen an Berufsfachschulen. Die GEW setzt sich für eine Stärkung der dualen Ausbildung ebenso wie der übrigen anerkannten pluralen Ausbildungswege ein; der letztlich fragwürdige Übergangbereich ist zu ersetzen. Generell sind die Hochschulkapazitäten dem Bedarf angemessen anzupassen und die Arbeits- und Lernbedingungen in sämtlichen Ausbildungsbereichen zu verbessern. Anfänger*innen im Ausbildungsgeschehen in Bayern Studium Übrige Berufsausbildung Ausbildung im dualen System Übergangsbereich von Ansgar Klinger Leiter des Bereichs berufliche Bildung, GEW-Hauptvorstand Quellen: Statistisches Bundesamt: Integrierte Ausbildungsberichterstattung Wiesbaden 2013 (a). Statistisches Bundesamt: Schnellmeldung Integrierte Ausbildungsberichterstattung Wiesbaden 2013 (b) Studium Übrige Berufsausbildung Ausbildung im dualen System Übergangsbereich Die GEW fordert: Eine Ausbildungsgarantie für alle Jugendlichen in Deutschland Eine gute Ausbildung, Arbeit und ein auskömmliches Einkommen sind Grundvoraussetzungen für die individuelle Entwicklung, für die eigenständige Existenzsicherung und die gesellschaftliche Teilhabe eines jeden Menschen. Daher sollen alle jungen Menschen nach Beendigung ihrer Schulzeit ein Recht auf einen Ausbildungsplatz mit einem anerkannten Berufsbildungsabschluss haben. Der Rechtsanspruch auf Bildung soll sich nicht nur auf den Besuch einer allgemeinbildenden Schule und neuerdings auch einer Kindertageseinrichtung beschränken, sondern auch für die berufliche Erstausbildung gelten. Die schon seit mehreren Jahren hohe Zahl von jungen Menschen im Übergangsbereich und die mangelnde Perspektive auf einen Ausbildungsplatz sind ein zentrales gesellschaftliches Problem. Eine»abgehängte Generation«, die keinen Einstieg in den Arbeitsmarkt findet, kann sich Deutschland vor allem aus sozialen Gründen, aber auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der drohenden Fachkräfteknappheit nicht erlauben. Warum ist eine Ausbildungsgarantie aus Sicht der GEW dringend notwendig? Trotz guter Konjunktur und sinkender Bewerber*innenzahlen finden viele Jugendliche nach ihrem Schulabschluss keinen betrieblichen Ausbildungsplatz und bleiben oft in zahlreichen Übergangsmaßnahmen ohne anerkannten Berufsausbildungsabschluss hängen. Der demografische Wandel und der drohende Fachkräftemangel bringen zwar leichte Entspannung auf dem Ausbildungsmarkt, doch die Hoffnung, dass dadurch gerade Jugendlichen mit einem Hauptschulabschluss der Einstieg in eine betriebliche Ausbildung erleichtert wird, hat sich nicht erfüllt. Zwar steht eine betriebliche Ausbildung formal allen Jugendlichen unabhängig vom individuellen Schulabschluss offen, in der Realität aber entscheiden die Betriebe über den Einstieg in das duale System. Sie konnten in den vergangenen Jahrzehnten aufgrund des Ausbildungsplatzmangels und der vielen Bewerber*innen eine»bestenauslese«vornehmen. So kommt der jüngste Nationale Bildungsbericht zu dem Ergebnis, dass es eine»faktische Abschottung«von annähernd der Hälfte der Ausbildungsberufe für Jugendliche mit»niedrigem«schulabschluss gegeben hat. Konkrete Ausgangslage in Zahlen: Jeder Dritte von institutionell erfassten ausbildungsinteressierten Jugendlichen, die sich im Jahr 2012 beworben haben, hat keinen Ausbildungsplatz erhalten Jugendliche konnten 2012 nicht mit einer Ausbildung beginnen und befinden sich deshalb im sogenannten»übergangssystem«. Nur 21,7 Prozent der Betriebe bilden in Deutschland überhaupt noch aus. 1,39 Millionen Jugendliche im Alter zwischen 20 und 29 Jahren und somit 14,1 Prozent dieser Altersgruppe sind ohne Berufsausbildung. 70 Prozent der Jugendlichen mit Migrationshintergrund bekamen im Jahr 2012 keinen betrieblichen Ausbildungsplatz. Über zwei Drittel aller Jugendlichen mit maximal Hauptschulabschluss landen im sogenannten»übergangssystem«und nicht in einer anerkannten Berufsausbildung. Die durchschnittliche Wartezeit nach der Beendigung der allgemeinbildenden Schule bis zum Beginn einer Berufsausbildung liegt aktuell bei durchschnittlich zwei Jahren. Gute Gründe für eine Ausbildungsgarantie: Eine Ausbildungsgarantie stärkt das Recht jedes jungen Menschen auf eine angemessene Förderung und Bildung, unabhängig von individueller Beeinträchtigung oder sozialer Benachteiligung; setzt den Bund sowie die Länder in die Pflicht, allen Jugendlichen einen vollwertigen und anerkannten Berufsausbildungsabschluss direkt nach Beendigung der Schulzeit anzubieten. Der Übergang von der Schule in eine Berufsausbildung muss für alle Jugendlichen ohne unnötige Warteschleife möglich sein; verweist deutlich auf die Aufgaben und Pflichten der Betriebe, ein auswahlfähiges Angebot betrieblicher Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen; vermeidet in der Zukunft die hohen Zahlen an Jugendlichen ohne Berufsausbildungsabschluss; strukturiert den Übergang zwischen Schule und Beruf mit entsprechender Förderung; trägt maßgeblich dazu bei, den von den Unternehmen beklagten Fachkräftemangel auf der Grundlage der demografischen Entwicklung zu beheben; leistet einen entscheidenden Beitrag zur Gestaltung eines inklusiven Bildungssystems in Deutschland; schafft Voraussetzungen dafür, dass kein*e Jugendliche*r zwischen Schule und Arbeitswelt»verloren«geht. Online-Petition für eine Ausbildungsgarantie: Die GEW unterstützt mit ihrem Gewerkschaftstagsbeschluss vom 15. Juni 2013 neben der Landesschülervertretung Thüringen, der DGB-Jugend, dem Landeselternbeirat Hessen und dem Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit die Online-Petition der Landesschülervertretung Hessen zum Thema»Ausbildungsgarantie jetzt!«und fordert alle gesellschaftlichen Kräfte in Deutschland auf, sich für die Einführung einer Ausbildungsgarantie einzusetzen. Zur Petition: petition/online/ausbildungsgarantie-jetzt/
12 12 DDS November 2013 Protestierende Textilarbeiterinnen in Dhaka. Foto:imago/Xinhua Gewerkschaftliche Solidarität über die EU-Grenzen hinaus Keine Entwarung nach der Brandkatastrophe in Bangladesch Längst sind die verstörenden Bilder und Berichte zu den Arbeitsbedingungen der Textilarbeiter*innen in Bangladesch, die erst durch die Brandkatastrophe vom 24. April 2013 mit ca Toten wieder in den Blick der Öffentlichkeit gerückt sind, durch andere ersetzt. Aber was hat sich seitdem geändert? Hat sich überhaupt etwas geändert? Und wie kann sich etwas ändern? Fakten zur Textilindustrie in Bangladesch Die bisher schlimmste Brandkatastrophe in Bangladesch ereignete sich in einer Fabrik in Savar, einem Vorort von Dhaka. Savar ist der größte Textilherstellungsort in Bangladesch. Schon ein halbes Jahr zuvor waren in Savar in einer Fabrik 112 Menschen bei einem Feuer ums Leben gekommen. Savar ist eine Sonderwirtschaftszone für den Export. Wer dort produziert, ist fünf Jahre von Steuern befreit (Wirtschaftswoche vom ). Die internationale Textilindustrie und die lokalen Fabrikbesitzer zahlen in Bangladesch Löhne, die zu den niedrigsten in der Welt zählen. Die Beschäftigten bekommen zumeist nur einen Hungerlohn (»Mindestlohn«) von nunmehr rund 34 Euro im Monat (Spiegel Online vom ). Arbeitszeiten von elf und zwölf Stunden am Tag gelten als»normal«, nicht selten wird aber auch bis zu 16 Stunden geschuftet. Bangladesch ist nach China weltweit größter Produzent von Textilien. Nach inoffiziellen Schätzungen gibt es ca Textilfabriken mit ca. drei bis vier Millionen Beschäftigten, zumeist Frauen. 80 Prozent der Exporte im Wert von rund 19 Milliarden Euro im Jahr sind Kleidung und Schuhe. 60 Prozent der Exporte gehen in die EU, ein großer Teil davon wiederum nach Deutschland. In Bangladesch lassen unter anderem produzieren: Puma, C&A, H&M, KiK, Tschibo, Adidas, die Otto-Gruppe und Hugo Boss. Proteste in Bangladesch und die Reaktionen der Textilunternehmen Unmittelbar nach der Brandkatastrophe im April 2013 kam es in Bangladesch zu massiven Protesten. In Dhaka und anderen Städten demonstrierten Hunderttausende Textilarbeiter*innen. Dabei kam es zu heftigen Zusammenstößen mit der Polizei, die brutal gegen die für ihre legitimen Rechte und Forderungen Demonstrierenden vorging. Die»Wirtschaftswoche«schrieb Ende August 2013:»Die Hauptstadt steht unter Spannung, seit den Katastrophen gibt es fast täglich Proteste. Mal fordern Demonstranten eine Erhöhung der Mindestlöhne, die inzwischen von 29 auf 34 Euro im Monat angehoben wurden, mal prangern sie Sicherheitsmängel an. Genauso
13 DDS November In der Tat sind die Textilexporte nach der Brandkatastrophe bis Ende Juni 2013 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 13 Prozent gestiegen, im Mai um 15 Prozent (Wirtschaftswoche vom ). häufig gehen Menschen auf die Straße, die ihren Job verloren haben, weil unsichere Fabriken dichtgemacht wurden«(wirtschaftswoche vom ). Ein Erfolg dieser Kämpfe ist die Durchsetzung des Rechts auf unabhängige Gewerkschaften in den Fabriken. Mit Beteiligung von Gewerkschaften wurde kurz nach der Brandkatastrophe im April 2013 auch ein internationales Abkommen über Brandschutz und Gebäudesicherheit abgeschlossen. Die Modekette H&M bezeichnete das Abkommen als»bahnbrechend«. Die Otto-Gruppe behauptete, der Branche ginge es damit darum, in Bangladesch Verbesserungen voranzutreiben. Ist das tatsächlich so? Was die europäischen Textilhandelsunternehmen nach den mehrmaligen Brandkatastrophen wirklich umtreibt, hat das Unternehmer-Blatt»Wirtschaftswoche«durchaus treffend beschrieben:»seitdem sorgen sich europäische Textilhandelsketten, die Bilder der Tragödien könnten ihren Marken schaden oder Bangladesch als Billigwerkbank der westlichen Modeindustrie disqualifizieren. Für sie wäre beides ein Riesenproblem. Darum hat sich die Branche für die Flucht nach vorn entschieden. [ ] Dem temporär schockierten Verbraucher soll suggeriert werden, dass sich die Modelabel um die Sicherheit der Arbeiter kümmern. Tatsächlich geht es den Unterzeichnern um die Absicherung einer fragwürdigen Beschaffungspolitik, die ohne Alternative ist: Nirgendwo wird Mode so billig und in solchen Mengen produziert wie in Bangladesch. Wer sich auf den Wettbewerb um die Geiz ist geil -Kundschaft eingelassen hat, kann auf die Näherinnen und Näher aus Bangladesch nicht verzichten«(wirtschaftswoche vom ) 1. Das Brandschutzabkommen hat möglicherweise dazu geführt, dass diese oder jene allzu baufällige Fabrik geschlossen wurde. Da und dort werden nun wohl auch Fluchtwege ausgeschildert und offen gehalten. Der Absatz von Pulverlöschern sei schätzungsweise um etwa zehn Prozent gestiegen (Wirtschaftswoche vom ). Mit Feuerlöschern ist aber bei Großbränden nicht viel zu erreichen. Nötig wären mindestens Sprinkleranlagen und elektronische Warnsysteme. Die gibt es aber aus Rentabilitätsgründen meistens nach wie vor nicht. Völlig berechtigt beharren daher die in diesen Fabriken Beschäftigten auf ihren Forderungen und gehen dafür weiterhin auch auf die Straße. Was folgt für uns hier in Deutschland daraus? Für uns als GEW-Kolleg*innen ergeben sich meiner Meinung nach gewerkschaftliche Aufgaben und Verpflichtungen auf zwei Ebenen. Erstens ist es im Rahmen unserer pädagogischen Berufsarbeit und unserer gewerkschaftlichen Bildungsarbeit wichtig, die Fakten und Zusammenhänge aufzuzeigen: Unter welchen ausbeuterischen Bedingungen werden denn die»billighemden«oder»markenhosen«hergestellt, die wir in Europa, konkret hier in Deutschland so»selbstverständlich«kaufen können und auch kaufen? 2 Darüber gibt es durchaus brauchbares Material, z. B. Filmdokumentationen, die am Beispiel der Textilproduktion, der IT-Branche oder auch der Landwirtschaft Ausschnitte der bitteren Realität beleuchten. Zweitens, und das halte ich aus gewerkschaftlicher Sicht für die Hauptsache, geht es um die reale Unterstützung der Kolleg*innen in Bangladesch, um den Zusammenschluss mit ihnen. Die Unterstützung kann vielfältig sein und auch von uns als GEW- Gewerkschafter*innen unterstützend geleistet werden: Aufklärungskampagnen, Druck auf die Unternehmen, welche unter wahrhaft mörderischen Bedingungen produzieren lassen, Einladung von Gewerkschafter*innen aus Bangladesch zu Rundreisen in Deutschland, durchaus auch mit Aktionen bei den entsprechenden Unternehmen. Wie, wenn nicht durch Zusammenschluss der Beschäftigten und deren entschiedene Gegenwehr, können die menschenunwürdigen Beschäftigungsbedingungen verändert werden? Das gilt in Bangladesch wie anderswo auf der Welt. 2 Tatsache ist, dass die»vorteile«der Billigproduktion in Bangladesch in einem großen Umfang und auf eine direkte, wenn auch komplexe Weise auch die Kolleg*innen betreffen, die hier in Deutschland selbst abhängig beschäftigt sind und sich am unteren Ende der Einkommensskala befinden. Da geht es einerseits um die reale Lage (riesiges Lohngefälle zwischen hier und dort, Auswirkungen auf die Reproduktionskosten hier), andererseits um die subjektive Sicht (bis hin zur national-egoistischen Meinung»ist doch gut für uns«). Heute, am 9. Oktober 2013, soll vorliegender Artikel an unsere Redaktionsleiterin gehen. Ich mache den Fernseher an, während ich auf die Rückmeldung einer Redaktionskollegin warte, die den Artikel gegengelesen hat. Die Nachricht: Bei einem Brand in einer Textilfabrik in der Nähe von Bangladeschs Hauptstadt Dhaka sind vor wenigen Stunden mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen von Wolfgang Häberle Lehrer an der FOS/BOS Aschaffenburg Mitglied der DDS-Redaktion
14 14 DDS November 2013 Revitalisierung des politischen Streiks! GEW beschließt auf dem Gewerkschaftstag einen Antrag zur Ausweitung des Streikrechts Das Streikrecht in der Bundesrepublik Deutschland ist seit jeher ausgesprochen restriktiv. Nicht nur dass es Beamt*innen vom Streik auszuschließen versucht, auch werden die Möglichkeiten von Streik als politischer Interessenvertretung in einer Art und Weise politisch beschränkt, die im internationalen Vergleich an Rückständigkeit ihresgleichen sucht. Indem die Rechtsprechung das Streikrecht auf die bloße tarifliche Auseinandersetzung beschränkte, wurde ein Streik, der über diese hinausgehende politische Forderungen stellt, ausgeschlossen. Eine ähnlich restriktive Auslegung bis hin zur Illegalisierung des politischen Streiks findet sich EU-weit ansonsten nur in England und Österreich. In den anderen Ländern sind politische Streiks erlaubt und werden praktiziert. Betrachtet man einmal die Auseinandersetzungen, um die es dabei geht, so wird deutlich, dass es sich bei der Option auf politischen Streik nicht lediglich um schmückendes Beiwerk handelt, sondern sie ganz wesentliche Auseinandersetzungen betreffen. So sind etwa die Einführung der Rente mit 67, die Arbeitsmarktreform oder die Einschränkung demokratischer Grundrechte wesentliche Bausteine eines neoliberalen Umbauprojekts, mit dem der im Grundgesetz verankerte Sozialstaatsauftrag revidiert wurde. In Streiks um Tarifergebnisse sind sie nicht unmittelbar Thema und betreffen dennoch die sozialen Grundrechte von Arbeitnehmer*innen ganz wesentlich. Im Zuge der derzeitigen Krise werden EU-weit weitere Sparmaßnahmen in der gesamten sozialen Infrastruktur durchgesetzt. Sie betreffen auch und gerade den Bildungsbereich. In den sozialen Kämpfen gegen diese haben Gewerkschaften in Ländern wie z. B. der Türkei und Griechenland Generalstreikaktionen ausgerufen, an denen sich mehr Menschen als nur langjährige Gewerkschaftsmitglieder beteiligten. Rechtliche Grundlage Als ein allgemeines Menschenrecht ist das Streikrecht übrigens in Artikel 23 der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte garantiert. Ebenso findet sich das Streikrecht in Artikel 6, Absatz 4 der Europäischen Menschenrechts- und Sozialcharta, die von der Bundesrepublik Deutschland auch unterschrieben wurde. Die allgemeine Rechtsprechung ist nicht derart auf das Verbot verbrieft, wie sich viele Leute dies vorstellen, sie folgt eher einer bestimmten Praxis der Rechtsauslegung. Ihren Start nahm diese in der noch jungen Bundesrepublik mit einer Urteilssprechung zu einem politischen Streik, mit dem die IG Druck und Papier in den 50er- Jahren die Zeitungslandschaft für zwei Tage lahmgelegt hatte. In Reaktion darauf hielt ein Gerichtsurteil eine verstärkte Haftbarkeit der Streik führenden Gewerkschaft fest, die in solchen Fällen für Einbußen der Unternehmen aufkommen sollten. An diesem Urteil aus der Bundesrepublik der 50er-Jahre orientierte sich die darauf folgende Diskussion immer wieder. Statt der Anpassung des Rechts an die Rechtsauffassung auf europäischer Ebene wurde die restriktive Auffassung des Streikrechts in der Folge wieder und wieder bestärkt. Nun ist diese restriktive Praxis keineswegs durch eine eindeutige Debatte auf allen Ebenen abgesichert. Neben der erwähnten Garantie des Streikrechts auf EU-Ebene findet sich darüber auch in einigen Landesverfassungen die Feststellung, dass die Interessenvertretung der Menschen nicht durch einen bestimmten Arbeitsvertrag eingeschränkt werden darf. Die Rechtsauslegung in dieser (wie auch vielen anderen Auseinandersetzungen) ist nicht in Stein gemeißelt, sondern abhängig auch von der gesellschaftlichen Diskussion und der politischen Praxis. Einschränkungen des Streikrechts hat es historisch immer wieder gegeben ebenso aber auch die Rückeroberung desselben. Im Rahmen des neoliberalen Umbaus des Sozialstaats und einer faktisch aufgekündigten Sozialpartnerschaft ist diese Rückeroberung heute dringender denn je. Wiesbadener Appell Mit dem 2012 gestarteten Wiesbadener Appell 1 hat sich mittlerweile eine Vielzahl von Menschen aus Parlamenten, aus außerparlamentarischen sozialen Bewegungen, Wissenschaftler*innen, Gewerkschafter*innen für ein umfassendes Streikrecht starkgemacht. Neben diesem Appell gibt es auch einzelne Gewerkschaftsbeschlüsse, mit denen die Gewerkschaften sich eine Ausweitung des Streikrechts auf die Fahnen geschrieben haben. Auf ihrem Gewerkschaftstag in Düsseldorf hat sich die GEW diesem Anliegen angeschlossen und einen Beschluss gefasst. Sie bekennt sich nach diesem zum politischen Streik und zum Generalstreik als gewerkschaftlichem Kampfmittel und strebt an, eine weiterführende Diskussion über dieses Thema in ihren gewerkschaftlichen Gremien zu führen. So wurde es im Beschluss»Jenseits des Tarifkonflikts Politischer Streik und Generalstreik als gewerkschaftliches Kampfmittel und ein umfassendes Streikrecht!«festgehalten, der online 2 einsehbar ist. Entgegen der gängigen Befürchtung, dass die Streikfähigkeit zum politischen Streik noch viel weniger als zum Streik im Tarifkampf gegeben ist, könnte auch das Gegenteil der Fall sein: Sofern es nämlich gelingt, hierbei Themen aufzunehmen, die soziale Grundrechte und demokratische Mitbestimmungsmöglichkeiten betreffen und damit für unser aller Lebensbedingungen von Bedeutung sind, wäre auch eine Revitalisierung der Streikbewegung denkbar. Um diese leisten zu können, könnten die Gewerkschaften sich in gesellschaftlichen Bündnissen mit sozialen Bewegungen für eine gemeinsame solidarische Praxis organisieren und das Thema politischer Streik damit auch als Baustein ihrer eigenen Organisationsentwicklung nutzen. Fragen bezüglich Gewerkschaftssatzungen ebenso wie die skizzierte juristische Diskussion sind übrigens eher sekundär relevant. Wie Mag Wompel von labournet.de in der Zeitschrift»Prager Frühling«treffend festgehalten hat:»politische Streiks werden nicht bei der Regierung erbettelt, sie werden einfach geführt.«von Sven Lehmann GEW Baden-Württemberg und Mike Niederstraßer GEW Thüringen Unterstützer des Antrags des Bundesausschusses der Studentinnen und Studenten (BASS) an den Gewerkschaftstag der GEW zur Verankerung des politischen Streiks in der Satzung
15 Wie wir einen schmackhaften Buchstabensalat zaubern An unserer Grundschule gibt es seit dem Jahr 2002 eine Schülerzeitung. Sie heißt»buchstabensalat«. Der Name wurde in einem schulinternen Wettbewerb gefunden. Die Schülerin interpretierte ihre Idee so:»zuerst lernt man als Grundschülerin ja die Buchstaben, dann zaubert man daraus Wörter und Texte. Das Ganze wird zum Schluss noch schmackhaft angerichtet, fertig ist der Buchstabensalat.«Kleine Redakteur*innen treffen große Redakteurinnen Zu Beginn eines jeden Schuljahres erhält jede Grundschüler*in einen Wahlzettel mit einer Auflistung der angebotenen Arbeitsgemeinschaften (AGs). Für die Schülerzeitung-AG können sich alle Drittund Viertklässler*innen melden, die daran teilnehmen möchten. Die AG Schülerzeitung findet wöchentlich an einem Nachmittag statt und umfasst zwei Unterrichtsstunden. Die, die sich anmelden, erklären verbindlich, dass sie die AG regelmäßig besuchen werden. Da alle Kinder von mir als AG-Leiterin zugelassen werden, gibt es Redaktionsstärken zwischen sechs und 15 Teilnehmer*innen. Unser»Buchstabensalat«ist eine Schülerzeitung (Ssz), die von Schüler*innen für Schüler*innen erstellt wird. Die Leser*innen-Zielgruppe sind Schüler*innen, ehemalige Schüler*innen, Lehrer*innen und manchmal auch Eltern. In der Schülerzeitung können unsere Grundschüler*innen im Sinne des Grundgesetzes ihre Meinung frei äußern. Der»Buchstabensalat«erscheint in der Regel zweimal im Jahr, zum Halbjahreszeugnis und zum Jahreszeugnis. Er hat eine Auflagenhöhe von 200 Exemplaren. Er kostet nur einen Euro, ganz egal, ob er nur 20 Seiten hat oder 64 Seiten stark ist. Beim ersten Treffen der AG-Teilnehmer*innen gibt es ein Brainstorming. Auf einen großen Plakatkarton schreiben wir unsere Artikel-Ideen und klammern dazu die Namen der Redakteur*innen, die zum Artikel recherchieren wollen etc. Die Ssz-Redakteur*innen tippen im Laufe der Wochen ihre Artikel selbstständig in den Computer; gleich danach werden diese in einer Konferenz überarbeitet. Anschließend wird die Seite»für das Auge angerichtet«: Gemeinsam legen wir den Titel, die Schriftgröße, die Hervorhebungen, das Bildmaterial usw. fest. Die in der Regel von den Schüler*innen selbst gestalteten authentischen Zeichnungen an Stelle von Fertiglayoutmaterial sind ein Markenzeichen unseres»buchstabensalates«. Ganz bewusst verzichten wir auf die Vergabe des Drucks: Unsere Grundschüler*innen erfahren nämlich nur so, wie eine Zeitung von A bis Z entsteht. Wir kopieren alle fertig gelayouteten Seiten in unserer Schule. Danach wird die Zeitung von uns allen zusammengetragen, geklammert und an den Seitenrändern geschnitten. Unser»Buchstabensalat«entsteht also in echter Handarbeit! Wir finanzieren zudem unsere Ssz ausschließlich durch den Etat, den uns die Schule zur Verfügung stellt, und durch die Einnahmen aus dem Verkauf unserer Schülerzeitung. Deshalb sind wir nicht auf Sponsoren und/oder Werbeanzeigen angewiesen. So kann der»buchstabensalat«eine absolut»werbefreie Zone«bleiben. Unsere Ssz hat eine klare Struktur: In jeder Ausgabe gibt es eine feste Rubrik mit Schulthemen. Unsere Redakteur*innen berichten z. B. über Wander- und Basteltage, Fußballturniere, Projekttage oder das Schulfest. Die Leser*innen erfahren in jedem»buchstabensalat«auch Interessantes über unseren Heimatort (z. B. die Maibaumaufstellung, den Stadtbus, das Krankenhaus). Interkulturelle Themen sind für unsere Redakteur*innen ebenfalls wichtig: In der Ausgabe Nr. 22 berichteten türkischstämmige Schüler*innen über Oruc, das Fasten der Muslime. Ein weiterer Artikel informierte parallel über die Fastenzeit bei den Christen. In demokratischen Entscheidungen beschließen die Redakteur*innen, welche Themen behandelt werden sollen. In DDS November der letzten Ausgabe beschäftigten sich die acht- bis zehnjährigen Schüler*innen auf eigenen Wunsch mit einem schwierigen Kapitel der deutschen Geschichte, mit Adolf Hitler. Hier ein Auszug aus diesem Artikel:»... Ein Diktator ist ein Mensch, der über ein Land regiert und alle anderen nicht mitbestimmen lässt. Hitler bekämpfte alle Menschen, die gegen ihn waren und eine andere Meinung als er hatten. Er verbot Zeitungen, die gegen ihn schrieben, und redete den Menschen ein, dass sie nur das tun sollten, was er sagte. Damals glaubten ihm viele Leute und taten das, was er von ihnen verlangte...«es gibt aber auch Seiten, die einfach nur Spaß machen und die Schülerzeitung auflockern: Auf der letzten Seite gibt es die obligatorischen Witze zu einem selbst gewählten Thema (z. B. Pferde-, Häschen-, Fritzchen-Witze). Viele der jüngeren Leser*innen freuen sich schon beim Kauf der Zeitung über die Ausmal-Seiten, Rätsel oder Bastelanleitungen. Preisverleihung in Berlin. Die zweite von rechts ist unsere Autorin. Die Tatsache, dass unsere Schülerzeitung immer schnell ausverkauft ist, ist das beste Feedback für die Redaktion. Aber auch persönliche Rückmeldungen in der Pause oder auf dem Schulweg bestärken uns in unserer Arbeit. Ein großes Lob erfuhren wir im Juli 2012: Da gewann unsere Ssz-Redaktion beim bayernweiten»blattmacher«-wettbeweb einen dritten Preis. Im Juni 2013 durfte eine Delegation sogar nach Berlin reisen. Dort erhielten wir einen bundesweiten Förderpreis in der Kategorie Grundschulen durch den Bundesratspräsidenten überreicht. von Irmgard Schreiber-Buhl i.schreiber-buhl@online.de
16 16 DDS November 2013 aus der GEW... aus der GEW... aus der GEW... aus der GEW... aus der GEW Am letzten Arbeitstag Hans Schuster tritt am 16. Oktober in die Freistellungsphase der Altersteilzeit ein, seine Nachfolgerin Katharina Harrer arbeitet schon seit dem 2. September bei uns. Brigitte Gallner gestaltet den Übergang mit. Anlass für ein Gespräch mit der Rechtsstelle der GEW Bayern. Das Gespräch führte für die DDS Gele Neubäcker, Vorsitzende der GEW Bayern und Mitglied der Redaktion. Die Drei von der Rechtsstelle: v.l.n.r.: Hans Schuster, Brigitte Gallner, Katharina Harrer Gele Neubäcker: Vom 1. September bis heute konnte die Rechtsschutzabteilung unter besten Bedingungen arbeiten. Sie war mit drei Personen besetzt. Katharina, Du hast am 1.9. bei uns angefangen, und Hans, Du bist bis heute noch bei uns und ab morgen in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Katharina, wie ist Dir bei dem Gedanken zumute, dass Du ab sofort keinen erfahrenen»alten Hasen«mehr fragen kannst? Katharina Harrer: Natürlich bedauere ich es sehr, dass Hans ab sofort nicht mehr da ist und ich ihn nicht mehr mit Fragen löchern kann. Ich denke aber auch, dass wir die Einarbeitungsphase gut genutzt haben, und ich bin dankbar, dass ich in den ersten Wochen von seiner Kompetenz und Erfahrung profitieren konnte. Darüber hinaus stehe ich in Kontakt zu den Juristen aus den anderen Landesverbänden und werde von den Kollegen und Kolleginnen der GEW Bayern tatkräftig unterstützt. Hans, bei Dir meine ich, schon eine ganze Weile etwas Wehmut zu spüren. Stimmt das? Hans Schuster: Ich habe jetzt fast mein gesamtes Berufsleben bei der GEW verbracht, was heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist. Ich habe dabei sehr viele freundliche, nette und liebe Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, die mir das Gefühl gegeben haben, dass ich hier den richtigen Platz für meine berufliche Tätigkeit gefunden habe. Sie haben mir bestätigt, dass ich sie immer auf der»richtigen«seite für die meist»richtige«sache unterstützen konnte. Insofern konnte ich immer von der Sinnhaftigkeit meiner Tätigkeit und meines Engagements überzeugt sein. Die Zusammenarbeit mit den hauptberuflichen und jeweiligen ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen und die Wertschätzung, die sie mir und meiner Tätigkeit entgegengebracht haben, waren ein weiterer Grund, weshalb ich mich in der GEW Bayern rundum wohlgefühlt habe. Dass dies in vielen Beschäftigungsverhältnissen keine Selbstverständlichkeit ist, habe ich in meiner beruflichen Tätigkeit hier täglich erfahren können. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass mit dem Ausscheiden auch eine gewisse Wehmut verbunden ist. Erinnerst Du Dich noch an Deinen ersten Arbeitstag bei der GEW? Hans: Dies war insofern spannend, als weder die dort arbeitenden Kolleginnen als auch der Geschäftsführer noch ich eine genauere Vorstellung hatten, wie meine Tätigkeit aussehen sollte. Zwar hat die GEW Bayern natürlich auch schon vor meiner Zeit ihren Mitgliedern Rechtsschutz gewährt. Inhaltlich wurde er jedoch überwiegend von den Rechtsstellen des DGB und Anwaltskanzleien durchgeführt. Die Stelle war neu geschaffen worden, sodass ich nicht auf ein bewährtes, eingespieltes System zurückgreifen konnte. Darüber hinaus war nicht vorhersehbar, mit welchen Erwartungen die Mitglieder und Funktionäre auf mich zukämen. Diese Situation eröffnete einerseits einen erfreulich weiten Gestaltungsspielraum, der aber neben der Einbringung der Rechtskenntnisse und Betreuung des einzelnen Mitglieds möglichst effizient auszufüllen war. Eine große Hilfe und Unterstützung habe ich dabei von den Kolleginnen und Kollegen in den Rechtsstellen aus anderen GEW-Landesverbänden erhalten. Wer waren damals Deine Kolleginnen und Kollegen? Hans: Neben dem Geschäftsführer gab es drei weitere Kolleginnen als Verwaltungsangestellte, die für die Bereiche Mitgliederverwaltung, Buchhaltung und allmählich auch für die Zuarbeit im Rechtsschutzbereich zuständig waren. In diesen vielen Jahren gab es Höhen und Tiefen in der GEW-Arbeit. Du musstest Vieles erkämpfen, was heute»läuft«. Hans: Eine bedeutende Rolle spielten damals noch die Berufsverbotsfälle, die Auswirkungen des Radikalenerlasses vom Januar 1972 waren. Wer in Bayern verbeamtet werden wollte was bei Lehrkräften regelmäßig Voraussetzung war und die von der Staatsregierung, die auch damals schon von der CSU gestellt wurde, vorgegebene Auslegung des Grundgesetzes in Zweifel zog, wurde sehr schnell als Verfassungsfeind abgestempelt, dem der Zutritt in den öffentlichen Dienst verwehrt werden musste. Es wurde von ihm verlangt, dass er im Rahmen eines persönlichen Anhörungsverfahrens die entstandenen Zweifel an seiner Verfassungstreue ausräumt und nachweist, dass er jederzeit für die so vorgegebene freiheitlich-demokratische Grundordnung eintritt. Bei Sympathieäußerungen für oder gar Mitgliedschaft in angeblich verfassungsfeindlichen Organisationen und Parteien war dies ein äußerst schwieriges, aussichtsloses Unterfangen, zumal die Vorwürfe häufig auf Ermittlungen des Verfassungsschutzes gestützt wurden und damit nicht hinterfragt werden konnten. Unwürdig war die Prozedur allemal. Daneben mussten gerade im Schulbereich in dieser Zeit in zahlreichen gerichtlichen Verfahren Rechte durchgesetzt werden, die außerhalb schon damals als selbstverständlich angesehen wurden. Hier ist insbesondere das in Artikel 9 Abs. 3 Grundgesetz geschützte Betätigungsrecht der Gewerkschaften in den Betrieben zu nennen. Die Information und Werbung von Mitgliedern in Schulen, z. B. durch Aushang von Plakaten der GEW, wurde vielfach untersagt, wenn sich darin mit den Arbeitsbedingungen kritisch auseinandergesetzt wurde. Nachdem wir mit unseren Klagen reihenweise erfolgreich waren und der Freistaat verurteilt wurde, unsere Plakataushänge zu dulden, ist dort ein gewisser Sinneswandel eingetreten, sodass hier weitgehend Ruhe eingekehrt ist. Letztendlich erfolgreich sind auch die Auseinandersetzungen wegen Diskriminierung von Teilzeitbeschäftigten gewesen. Hier ging es zunächst überwiegend darum, dass unterhälftig Beschäftigte er-
17 DDS November heblich schlechter bezahlt wurden, als es ihrem Teilzeitanteil entsprach. Diese Rechtsprechung hat auch dazu geführt, dass nicht nur diskriminierende Entgeltregelungen bei Teilzeit, sondern auch andere Diskriminierungstatbestände, wie sie jetzt im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz enthalten sind, beseitigt wurden. Dass es dazu immer wieder gerichtlicher Auseinandersetzungen bedurfte, haben in jüngerer Zeit die höchstrichterlichen Entscheidungen bei Entgelt, Besoldung und Urlaub gezeigt. Nicht gelungen ist es uns zu verhindern, dass für Lehrkräfte ein verpflichtendes Arbeitszeitkonto eingeführt worden ist oder je nach Haushaltslage die Lehrerarbeitszeit generell verlängert wurde. Ein Highlight in Deiner Karriere? Hans: Neben den eben genannten Erfolgen, die wir errungen haben, ist mir der Fall der Kollegin Maria Chiara Spotti gegen den Freistaat Bayern in Erinnerung. Die Kollegin war an der Universität Passau befristet angestellt und erteilte als Muttersprachlerin Studenten Italienischunterricht. Die Befristung von Fremdsprachenlektorinnen auf längstens fünf Jahre war im Bayerischen Hochschullehrergesetz vorgeschrieben, weil der Gesetzgeber davon ausging, dass bei längerer Abwesenheit von ihrem Heimatland kein aktualitätsbezogener Unterricht mehr erteilt werden könne. Bei vergleichbar tätigen deutschen Lehrkräften war eine Befristung nicht zwingend vorgesehen. Nach der Vorlage des Arbeitsgerichts Passau an den Europäischen Gerichtshof hat dieser im Oktober 1993 entschieden, dass diese Regelung wegen Verstoßes gegen den damaligen Artikel 48 Abs. 2 EWG-Vertrag (jetzt Art. 39 Abs. 2 EG-Vertrag) Verbot der Diskriminierung von EU-Ausländerinnen nicht zur Anwendung kommen darf. Diese Entscheidung geht weit über den Einzelfall hinaus. Darauf wird heute noch in einschlägigen Verfahren Bezug genommen. Eine Anekdote aus der Geschäftsstelle? Hans: So wie es einem auch oft geht, hatte ein Mitglied für einen Brief an die Geschäftsstelle wohl keine ausreichende Briefmarke zur Hand. In seiner Not ergänzte es den fehlenden Wert dadurch, dass es mit viel Tesa neben der Briefmarke ein Zehnerl befestigte und darunter schrieb:»liebe Post sei doch so gut und stelle den Brief auch so zu!«damals kam der Brief an. Heute undenkbar. Brigitte, wie lange hast Du mit Hans zusammengearbeitet? Brigitte Gallner: Das waren nun über 22 Jahre. Der Großteil meiner beruflichen Tätigkeit. Auch bei Dir vermute ich etwas Wehmut! Brigitte: Zu Recht. Ich habe sehr gerne mit Hans zusammengearbeitet. Dadurch dass die Landesrechtsstelle nur mit einer Juristenstelle und einer Teilzeitstelle fürs Sekretariat besetzt ist, ergibt sich eine enge Zusammenarbeit und im Lauf der Jahre lernte ich Hans kennen und schätzen. Du kennst Hans am besten von uns allen. Verrätst Du uns, was du ganz besonders an ihm schätzt? Brigitte: Hans ist sehr vielseitig interessiert. Er kann zu jedem Thema etwas beitragen, seine Kenntnisse sind keineswegs auf das Juristische begrenzt. Auch seine handwerklichen Fähigkeiten sind immer wieder zum Einsatz gekommen, sobald im Büro etwas kaputtgegangen war. Darüber hinaus schätzte ich ihn als zuverlässigen, ermutigenden Kollegen, der den Menschen vor den Vorschriften sieht. Ich weiß, dass Katharina auch Deine Wunschnachfolgerin für Hans ist. Mit welchen Gefühlen bist Du an Katharinas erstem Arbeitstag hierher gekommen? Brigitte: Ich habe mich auf die Zusammenarbeit mit ihr gefreut. Es war der Abschied von Hans noch in weiter Ferne und insofern der Beginn ungetrübt. Beeindruckt hat mich Katharinas große Sachkenntnis und ich freue mich, dass die Rechtsstelle nun in gewohnt freundlicher, kollegialer Weise weitergeführt wird. Katharina, Brigitte hat auf juristischem Gebiet und nicht nur dort umfassende Kenntnisse und Kompetenzen erworben, die sie aber nicht offen zur Schau stellt. Du hast das wahrscheinlich schon selbst bemerkt. Wie würdest Du Eure Zusammenarbeit beschreiben? Katharina: Ich schätze Brigitte sehr, weil sie sehr engagiert und hilfsbereit sowie eine große Unterstützung für mich ist. Gerade aufgrund ihrer umfassenden Kenntnisse auch im juristischen Bereich ist ein fachlicher Austausch möglich, was ich als sehr gewinnbringend empfinde. Von daher schätze ich die Gespräche mit Brigitte sehr. Unsere GEW-Mitglieder sind zu Recht neugierig, wer»du denn bist«. Bitte stelle Dich kurz vor. Katharina: Vor meiner Tätigkeit bei der GEW Bayern war ich als Rechtssekretärin bei der DGB Rechtsschutz GmbH in Weiden tätig und habe mich bereits engagiert für die Interessen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen eingesetzt. Das Studium der Rechtswissenschaften absolvierte ich in Würzburg. Die Referendarausbildung habe ich dann in Nürnberg und München gemacht. Hierbei legte ich meinen Schwerpunkt auf Arbeit- und Sozialrecht. Du bist schon voll drin und hast auch schon Erfolgserlebnisse. Bist Du schon in Deiner Tätigkeit»angekommen«? Katharina: Persönlich fiel mir das Ankommen hier nicht schwer, weil ich herzlich aufgenommen wurde und mich schon sehr wohl fühle. In fachlicher Hinsicht würde ich nicht sinngemäß von»ankommen«sprechen, weil man mit Ankommen zugleich ein Stehenbleiben verbinden könnte. Denn ich möchte mich vor allem fachlich und persönlich weiterentwickeln und mit der Tätigkeit und den damit verbundenen Aufgaben wachsen. Ein erfahrener Anwalt erzählte mir kürzlich, es brauche drei bis vier Jahre, bis eine Juristin oder ein Jurist im eigenen Spezialgebiet»zu Hause«ist. Wie schätzt Du das ein? Katharina: Ich bin der Meinung, dass man das so pauschal nicht sagen kann. Es kommt schon auch darauf an, ob man sich in der Ausbildung auf ein bestimmtes Rechtsgebiet spezialisiert hat. Wichtig ist außerdem, dass man das juristische Handwerkszeug beherrscht. Jedoch ist die Juristerei auch ein Beruf, den man quasi nie auslernt. Hierbei spielt natürlich die ständige Entwicklung durch die Rechtsprechung eine große Rolle. Ich denke, selbst in 20 Jahren kommt ein Fall, den man noch nicht hatte. Zugleich macht diese Herausforderung für mich persönlich den Beruf gerade besonders spannend. Gele: Liebe Katharina, im Namen des ganzen Landesvorstands sage ich: Herzlich willkommen bei uns. Wir wollen, dass Du Dich wohlfühlst, denn das ist eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiches Arbeiten! Lieber Hans, ich kann mir noch gar nicht vorstellen, wie es ohne Dich in der Geschäftsstelle sein wird. Stets hast Du Dir Zeit genommen, wenn ich vor Deinem Schreibtisch stand und ganz schnell und plötzlich eine erste Einschätzung eines Problems brauchte, und oft genug fand ich ein offenes Ohr, wenn mir mal nach Jammern war. Am liebsten wäre mir, Dich zu behalten, zusammen mit Katharina. Für Dich ist der Abschied mit einem Neuanfang verbunden, mit ganz neuen Möglichkeiten. Wir wünschen Dir alles Gute. Möge sich Dein Ruhestand so entwickeln, wie Du ihn Dir wünschst. Wir werden Deinen Abschied auch noch feiern! Nun noch die unvermeidbare Frage: Was wünschst Du der Rechtsstelle, was wünschst Du der GEW Bayern? Hans: Ich fände es schön, wenn die Bedingungen dort so erhalten bleiben, dass die Beschäftigten keinen Grund sehen, ihr vorzeitig den Rücken zu kehren, und sich die Mitglieder ebenso gut wie bisher, wenn nicht sogar besser, dort aufgehoben fühlen. Die GEW Bayern möge ihr Potenzial weiterhin ausschöpfen und durch den Zuwachs an Mitgliedern erweitern. Herzlichen Dank Euch Dreien für das Gespräch.
18 18 DDS November 2013 Berichte... Berichte... Berichte... Berichte... Berichte... Berichte»Wenn Professionelle sich fremdgesteuert fühlen«bericht über eine Veranstaltung des Arbeitskreises Kritische Sozialarbeit, der GEW München und ver.di Weit über 200 Menschen drängten sich am 8. Oktober 2013 in den großen Saal des Münchner Gewerkschaftshauses. Der Arbeitskreis Kritische Sozialarbeit (aks), unterstützt von GEW und ver.di, hatte zu einer Podiumsdiskussion zur Wirkungsorientierten Steuerung der Hilfen zur Erziehung (WSE) eingeladen, ein Thema, das offenbar vielen auf den Nägeln brennt. Das Thema WSE ist seit Langem virulent Im Juni 2013 ging die fast zweijährige Projektphase zu Ende, während der in fünf ausgewählten Münchner Regionen das neue Steuerungsmodell erprobt wurde. In dem Versuch, Ergebnisqualität zu sichern, wurden Teile des Hilfeplanverfahrens verändert. Kinder und Jugendliche sollen bessere, d. h. passgenauere und wirksamere Hilfen erhalten, gleichzeitig sollen Daten gewonnen werden, um die Entgeltverhandlungen mit den Anbietern von Erziehungshilfen leistungsorientiert führen zu können so weit das Stadtjugendamt München in seiner Projektbeschreibung. Ganz andere Einschätzungen kommen aus der Praxis. Bereits im Januar 2013 setzte sich die Mitgliederversammlung der GEW München kritisch mit dem Thema auseinander, ebenso wie die DDS in ihrer Juni-Ausgabe. Zwei Monate vorher hatte der aks seine Bedenken in einem offenen Brief an die verantwortlichen Stellen bei Stadt und freien Trägern formuliert. Befürchtet wird u. a., dass sich erhöhter Verwaltungsaufwand und stärkerer Konkurrenz- und Kostendruck bei den Anbietern negativ auf die Qualität der geleisteten sozialen Arbeit auswirken. Der Arbeitskreis forderte die Verantwortlichen aus Politik und Steuerung in seinem Brief auf, eine öffentliche Diskussion mit der gesamten betroffenen Fachbasis zu initiieren. Mit der Veranstaltung im DGB-Haus nahm der aks sein Anliegen schließlich selbst in die Hand. Immerhin stellten sich jenseits der gewohnten Kooperationsstrukturen Sozialreferentin Brigitte Meier und die Jugendamtsleiterin Maria Kurz-Adam den Fragen des Auditoriums, vorrangig bestehend aus Fachbasis von Jugendamt und freien Trägern der Hilfen zur Erziehung (HzE), darunter auch viele gewerkschaftlich organisierte Kolleginnen und Kollegen. Trotz der engagierten Moderation von Juliane Sagebiel, Professorin für Soziale Arbeit an der Hochschule München, blieben am Ende viele Fragen offen. Die kritische Sicht der Fachpraxis vertraten auf dem Podium Thomas Rey und Wolfgang Rudolf, zwei bei freien Jugendhilfeträgern beschäftigte Kollegen, sowie Philipp Heinze von der Bezirkssozialarbeit (BSA), gleichzeitig Mitorganisator der Veranstaltung. Foto: Nic Grießmeier Controlling-Ziele stehen oft im Gegensatz zu pädagogischen Zielen Mit Andreas Polutta von der Uni Duisburg-Essen, der sich nicht nur in seiner Dissertation mit Wirkungsorientierter Steuerung in der Jugendhilfe befasst hat, hatten sich die Veranstalter*innen einen ausgewiesenen Experten aufs Podium geholt. In seinem Eingangsreferat ging er auf Chancen und Notwendigkeit von Steuerung, aber auch auf die Gefahren von zu viel Steuerung ein. Polutta problematisierte Wirkungsorientierte Steuerung (WOS) und bezog sich dabei auf die Ergebnisse einer empirischen Studie, wonach pädagogische und Controlling-Ziele oft nicht deckungsgleich seien. Während beispielsweise ein Scheitern aus pädagogischer Sicht auch Teil eines Lernerfolgs sein kann, führt Scheitern aus Controlling- Sicht zwangsläufig zu einer schlechten Bewertung. Auch seien Steuerungsansätze oft verkürzt, etwa wenn ihnen Prinzipien zugrunde liegen wie: ambulant vor stationär, die zeitliche Begrenzung von Hilfen oder die Reduzierung von Fallzahlen. Dass diese Prinzipien auch für das Münchner Jugendamt bisher grundlegend waren, wurde leider in der Diskussion nicht mehr aufgegriffen und problematisiert. Zentraler Streitpunkt: Zielvereinbarung mit den Adressat*innen Eine der wesentlichen Änderungen, die das neue Steuerungsmodell mit sich bringt, betrifft den Beginn des Hilfeplanverfahrens. Verkürzt formuliert sollen schon vor Beginn der Hilfe zwischen BSA und Adressat*innen ganz konkrete und überprüfbare Ziele einschließlich Zeitrahmen formuliert werden. Bisher war es so, dass im Vorfeld der Hilfe im multiprofessionell besetzten Regionalen Fachteam (RFT) der erzieherische Bedarf beraten und eine grobe Zielrichtung entworfen wurde, konkrete operationalisierbare Ziele wurden erst während oder am Ende einer in der Regel dreimonatigen sogenannten Orientierungsphase zwischen Einrichtung und Kind/Eltern entwickelt. Das Anliegen, RFT und Orientierungsphase und damit eine»kultur der konsensorientierten Zielfindung«beizubehalten, wurde während der Veranstaltung sowohl von den Fachkräften der öffentlichen wie der freien Träger vorgebracht. Die Erfahrung der Praktiker*innen, dass Kinder, Jugendliche und Eltern oft damit überfordert sind, bereits zu Beginn einer Maßnahme konkrete Ziele zu formulieren, bestätigte auch Polutta in seinen Ausführungen. Um die Adressat*innen in solchen Überforderungssituationen zu schützen, seien die Einrichtung von Ombudsstellen und ein Beschwerdemanagement notwendig, eine Forderung, die bei allen Beteiligten auf Zustimmung traf. Steuerung braucht gleichberechtigte Partner Auch mit seiner These, dass Steuerungsprozesse zwischen öffentlichen und freien Trägern auf Augenhöhe stattfinden müssen, was eben nicht bedeuten kann:»a steuert B«, traf der Referent offenbar einen wunden Punkt. Sowohl vonseiten der freien Träger, von denen sich leider nur ein einziger Vertreter äußerte, als auch von der Fachbasis wurde bemängelt, dass der Dialog zu WSE zwischen Öffentlichen und Freien Trägern bisher wenig partizipativ verlief. Rey erinnerte aus der Perspektive einer Heilpädagogischen Tagesstätte (HPT) daran, dass in den letzten Jahren viel darin investiert wurde, Zugänge eher zu erschweren. Ein Beispiel dafür ist die Kontrolle der von Kinder- und Jugendpsychiater*innen erstellten Gutachten zur Aufnahme in einer HPT durch eigens dafür eingestellte Psycholog*innen. Wird hier unterstellt, dass Hilfen ohne Bedarf oder Problembelastungen geleistet wer-
19 DDS November Berichte... Berichte... Berichte... Berichte... Berichte... Berichte den bzw. sich im Hilfeverlauf verselbstständigen? Dass WSE wie andere wirkungsorientierte Steuerung solche Annahmen impliziert, fand sich auch in den Ausführungen von Andreas Pulotta: Die Fachkräfte fühlen sich in ihrer fachlichen Kompetenz hinterfragt und»fremdgesteuert«. Untermauert wurde diese Annahme letztlich durch die Äußerung der Jugendamtsleitung: Man wolle jetzt weg vom Prinzip»Trial and Errorwir wollen mal probieren, was geht«. Es bleibt noch viel nachzubessern Zu Beginn seines Vortrags lobte Polutta die transparente fachliche und fachpolitische Gestaltung des Münchner WSE-Prozesses, die auch verglichen mit dem Vorgehen anderer Kommunen zunächst in die richtige Richtung weise. Am Ende der Veranstaltung konstatierte er allerdings die Notwendigkeit, noch das eine oder andere»feintuning, an manchen Stellen auch Grobtuning«vorzunehmen. Auch Stadträtin Demirel von den Grünen sah nach der Veranstaltung noch viel Diskussionsbedarf im Rathaus, in der öffentlichen Verwaltung, aber auch mit den betroffenen Fachkräften und Verbänden vor Ort. Philipp Heinze vom aks appellierte an die Jugendamtsleitung, den WSE-Prozess nicht hinter verschlossenen Türen abzuhandeln. Die Veranstaltung habe die Tür einen Spalt weit geöffnet, dieser Weg sollte weiter beschritten werden. In der Tat ist es Zeit für einen wirklichen Dialog, denn der»echtbetrieb«oder die»rollout-phase«, wie es in den Projektunterlagen heißt, soll bereits am 1. Januar 2014 beginnen. von Verena Escherich Fachtagung der GEW Bayern:»Demokratie in der Schule«Mit der Änderung des BayEUG vom kann an rund 120 Schulen in Bayern eine»erweiterte Schulleitung«(Mittlere Führungsebene) fest eingerichtet werden. Damit wird eine weitere Hierarchieebene installiert. Die neuen Vorgesetzten sollen zwar auch beraten. Im bestehenden System ist jedoch zu befürchten, dass in erster Linie die Kontrolle der Lehrkräfte verstärkt wird. Auf der Fachtagung stellten sich ca. 60 Kolleg*innen aus ganz Bayern den Fragen: Wie können wir mit dieser Situation umgehen? Was für eine Beteiligungskultur ist stattdessen vorstellbar? Wie kann mehr Demokratie/demokratische Mitbestimmung in die Schulen getragen werden? Daniela Schieder referierte die aktuellen gesetzlichen Neuerungen. Angela Scheffels berichtete von den hessischen Erfahrungen und den daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen. Dr. Klaus Schröck präsentierte seine Vorstellungen von Leistungskultur. In intensiven Diskussionen wurden anschließend im Rahmen von fünf Arbeitsgruppen viele Anregungen zusammengetragen. Dabei ging es u. a. um den Vorschlag, Schulleiter*innen dadurch zu entlasten, dass die Regelbeurteilung abgeschafft wird, um die Stärkung der Schulkonferenz und um die Frage, wie die Methoden indirekter Steuerung die Gesundheit der Kolleg*innen beeinträchtigen. Es wurden Vorstellungen einer demokratischen Beteiligungskultur zusammengetragen und die für Demokratieprozesse nötige Qualifikation von Führungskräften diskutiert. An den in den Arbeitsgruppen entwickelten Vorstellungen wollen interessierte Kolleg*innen konzeptionell weiterarbeiten. Die DDS-Redaktion plant für nächstes Jahr ein Schwerpunktheft zum Thema, in welches die Ergebnisse dieses Diskussionsprozesses einfließen und damit allen Kolleg*innen zugänglich gemacht werden sollen. K.J. In den Arbeitsgruppen wurde intensiv weiterdiskutiert, wie hier in der AG zu einer demokratischen Beteiligungskultur. Die drei Hauptreferent*innen (v. l. n. r.): Daniela Schieder, PR-Vorsitzende an einer Städtischen Berufsschule in Nürnberg, Angela Scheffels, Referentin für Mitbestimmung bei der GEW Hessen und Mitglied im Hauptpersonalrat (HPRLL), Dr. Klaus Schröck, Professor für Schulpädagogik an der Universität Erlangen-Nürnberg. Die AG zur Qualifikation von Führungskräften beleuchtete ein interessantes Qualifizierungskonzept aus dem kommunalen Verwaltungsbereich. Im abschließenden Plenum konnten nochmal alle Arbeitsergebnisse diskutiert und ergänzt werden.
20 20 DDS November 2013 Lesetipps... Lesetipps... Lesetipps... Lesetipps... Lesetipps... Lesetipps Nationalismus, Terror und Vertreibungsschicksal Deutsche und tschechische Schüler*innen dokumentieren gemeinsam die Geschichte der Iglauer Sprachinsel vor und nach 1945 Besonders erschütternd ist das Schicksal der»zigeuner«-familie Kraus aus Schrittenz: 1939,»nach dem deutschen Einmarsch«in ihren Wohnort, zunächst als Deutsche registriert (!), wurden sie bald massiv diskriminiert und schließlich Mitte März 1943 nach Auschwitz deportiert. Dort wurden die Frauen der Familie ermordet (darunter zwei Mädchen von vier und sechs Jahren), während die Männer nach Buchenwald und von dort in das berüchtigte Lager Mittelbau-Dora»verlagert«wurden (welch passender Ausdruck!), wo sie höchstwahrscheinlich ebenfalls ums Leben gekommen sind. Diese und viele weitere tragische Lebens- und Leidensgeschichten, von Deutschen, Tschech*innen, Jüdinnen und Juden sowie Romnija und Roma, dokumentiert ein neues Buch, das von tschechischen und deutschen Schüler*innen gemeinsam erarbeitet wurde. Drei Jahre lang haben sich die Schüler*innen des Gymnáziums Jihlava und des Nikolaus-Kopernikus-Gymnasiums Weißenhorn bei ihrem Austausch intensiv mit der Geschichte der Bevölkerung in Iglau/Jihlava vor und nach 1945 auseinandergesetzt. Die»Iglauer Sprachinsel«war bis 1945 ein überwiegend deutschsprachiges Gebiet rings um die Stadt Iglau/Jihlava, die in der Tschechischen Republik zwischen Prag und Brünn auf der Grenze zwischen Böhmen und Mähren liegt. Die Okkupation durch die nationalsozialistischen Truppen im März 1939 und die Vertreibung der Deutschen nach 1945 bestimmten diese Region in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und entwickelten dort aufgrund des Sprachinselcharakters in ganz besonderem Maß eine für die deutsch-tschechischen Beziehungen exemplarische Explosivkraft. Die Ergebnisse dieser Zeitzeug*innengespräche, Zeitungsanalysen und historischen Recherchen liegen nunmehr in einem umfangreichen, durchgehend zweisprachigen und reich illustrierten Band vor. Er wurde am 10. Oktober 2013 im Tschechischen Zentrum München der Öffentlichkeit vorgestellt und veranschaulicht mit zahlreichen, von den Schüler*innen übertragenen und kommentierten geschichtlichen Zeugnissen und in einer Reihe von kurzen Abhandlungen zu einzelnen Themen, wie die erbitterte Konfrontation (»Volkstumskampf«) zwischen fanatischen Vertreter*innen der deutschen wie der tschechischen Seite von den deutschen Nationalsozialist*innen benutzt wurde, um die Okkupation der Tschechoslowakei vorzubereiten. Die überzogenen Hoffnungen der Iglauer Deutschen auf den vermeintlichen»heilsbringer«adolf Hitler scheiterten aber letztlich, weil die Iglauer stets Deutsche zweiter Klasse blieben. Viele von ihnen wurden auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs als Kanonenfutter eingesetzt, während das Rasse- und Siedlungshauptamt der SS in Prag gleichzeitig die deutschen Bewohner*innen der Sprachinsel nach ihrer»rassischen«qualität bewerten ließ. In der Zeit nach dem»endsieg«sollte»das deutsche Blut weitgehend erneuert«,»die Folgen einer schädlichen Inzucht (bei der Iglauer Stadtbevölkerung) ausgemerzt«und»gesundes deutsches Blut an ihre Stelle gesetzt werden«. Diese Sortierung der»volksdeutschen«der Sprachinsel in»rassisch Wertvolle«und»rassisch Minderwertige«hätte nach einem Sieg der Nazis dazu geführt, die»ungeeigneten Kräfte von den bewährten zu scheiden«, sprich, zumindest Teile der Bevölkerung umzusiedeln und durch Einwander*innen aus dem Reich (oder auch beispielsweise aus Südtirol) zu ersetzen. Neben dem»bildbericht«der SS von März 1945 (!), in dem diese Ideen entwickelt werden und der hier erstmals vollständig dokumentiert wird, bietet der Band aufschlussreiche Akten aus dem Nationalarchiv Prag sowie Erinnerungsberichte von Heimatvertriebenen und von Heimatverbliebenen, in denen nicht zuletzt auch das Schicksal der Iglauer Jüdinnen und Juden sowie der Romnija und Roma ins Blickfeld rückt. Darüber hinaus haben die Schüler*innen Artikel des»mährischen Grenzboten«, der deutschen Iglauer Zeitung, und tschechische Zeitungstexte aus den Jahren nach 1945 transkribiert und ausgewertet. Beiträge von Lehrer*ìnnen und Schüler*innen der beiden Gymnasien versuchen zudem, die tschechischen wie die (sudeten-) deutschen Geschichtsmythen über die Okkupations- und Vertreibungszeit durch präzise Detailbetrachtungen zu korrigieren. Den Gegensatz zu den geschichtlichen Entwicklungen, die in die tragische Vertreibung der Iglauer Deutschen und in die Neubesiedlung von Teilen der Stadt Jihlava münden, bilden in diesem Band Eindrücke von den drei Austauschjahren der beiden Schulen und den Begegnungen der Schüler*innen. Sie illustrieren beispielhaft, wie eine unbefangene europäische Zusammenarbeit zwischen Jugendlichen nicht nur zum gegenseitigen Kennenlernen, zum Abbau von Vorurteilen und zu intensiven Freundschaften beitragen, sondern auch zu fundierten und für die beiden Völker interessanten und höchst aufschlussreichen Forschungsergebnissen führen kann. von Ulrich Scheinhammer-Schmid»In Iglau war alles schlimmer...«. Transformationen einer tschechisch-deutschen Stadt vor und nach Eine Dokumentation.»V Jihlavӗ bylo všechno horší...«. Promӗny česko-nӗmeckého mӗsta před rokem 1945 a po skončení války. Sborník dokumentů. Herausgegeben für das Gymnázium Jihlava und das Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium Weißenhorn von Ulrich Scheinhammer-Schmid. Landsberg am Lech, BALAENA Verlag, 2013, 469 S., brosch., 63 Abb., 29,80 EUR; ISBN Der LesePeter ist eine Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM) der GEW für ein herausragendes, aktuelles Buch der Kinder- und Jugendliteratur. Die ausführliche Rezension (mit pädagogischen Hinweisen) ist im Internet unter (LesePeter) abrufbar. Im November 2013 erhält den LesePeter das Sachbuch Manfred Mai und Dorothea Tust: Die Geschichte Deutschlands Carlsen-Verlag Hamburg Seiten 8,99 EUR ab 10 Jahren ISBN Jahre deutsche Geschichte präsentiert der Autor Manfred Mai in seinem Buch. Diese sehr komplexe und vielschichtige Materie hat er in einfacher, verständlicher Form für Kinder aufbereitet. Das Buch ist ein spannender Ausflug in unsere Vergangenheit. Das umfassende Kindersachbuch über die deutsche Geschichte ist in sechs Zeitetappen gegliedert: Altertum, Mittelalter, Aufbruch in eine neue Zeit, das Deutsche Reich und die Weltkriege, Nachkriegszeit und deutsche Teilung, Vereintes Deutschland seit 1990, wobei der Autor der neueren Geschichte einen größeren Part einräumt.
21 DDS November Münchner Aktionswochen gegen Gewalt an Frauen, Mädchen und Jungen Gewalt an Frauen hat viele Gesichter: erniedrigen, demütigen, beleidigen, missachten, benutzen, kontrollieren, einsperren, belästigen, missbrauchen, vergewaltigen, schlagen, ermorden. Gewaltige Zahlen und Fakten: Alle zwei bis drei Tage wird in Deutschland eine Frau laut BKA von ihrem (Ex-)Partner/Ehemann getötet. Jede vierte Frau in Deutschland erlebt Gewalt durch den aktuellen oder früheren Beziehungspartner. 58 % der Frauen in Deutschland erleiden sexuelle Belästigung. 70 % der Frauen werden im Rahmen des Umgangsrechtes der Kinder erneut vom Expartner misshandelt. Beim Polizeipräsidium München wurden Fälle von Partner*innengewalt angezeigt; die Täter*innen sind meist Männer. Ein Aktionsbündnis zahlreicher Organisationen veranstaltet in München vom 18. bis zum 30. November ein Programm mit vielen Veranstaltungen für ein gewaltfreies und selbstbestimmtes Leben für alle Frauen, Mädchen und Jungen weltweit. Mehr Infos und das Veranstaltungsprogramm gibt es unter: Burn-out eine Folge der neuen Organisation der Arbeit Burn-out ist zum Volksleiden Nummer eins geworden. Eine Ursache sind die tiefgreifenden Umbrüche in der Arbeitswelt. Durch Umstrukturierungen und Neuordnungen sind die Beschäftigten zunehmend der maximalen Gewinnorientierung ausgeliefert. Stephan Siemens und Martina Frenzel analysieren in ihrer Publikation Ursachen und Folgen des Burn-outs. Sie stellen fest, dass den meisten Erkrankten nicht bewusst ist, welche Faktoren auf ihre Psyche einwirken. Diese Unbewusstheit ermöglicht den Prozess des Burn-outs. Der Rat der Autor*innen: Um dem»ausbrennen«der Beschäftigten entgegen- Dies & Das zuwirken, müssen ihnen die neuen Formen der Arbeitsorganisation bewusst gemacht werden. Dann können sie sich schützen und Betriebsräte können wirksame Gegenmaßnahmen ergreifen. Der Leitfaden umfasst 100 Seiten, kostet 6,50 EUR und kann bestellt werden unter: Gleichstellung: Selbstbestimmt arbeiten Die Rollenbilder von Frauen und Männern in Familie und Beruf ändern sich zunehmend. In der Gleichstellungspolitik der letzten Jahre spiegelt sich das nicht wider. Viele Frauen arbeiten unfreiwillig in Teilzeit, Männer wünschen sich hingegen mehr Zeit für Familie und Privatleben. Der DGB liefert mit der Broschüre»Selbst. Bestimmt. Sicher«Argumente für eine moderne Gleichstellungspolitik, die den Weg in eine geschlechtergerechte Zukunft ebnet. Dafür braucht es mehr Arbeitszeitsouveränität, Entgeltgleichheit für gleiche Arbeit, eine gerechte Besteuerung ohne Ehegattensplitting und eine gute Rente für Frauen. Die Broschüre ist kostenlos beim DGB-Bestellservice erhältlich, es fallen nur Versandkosten an. Download: Zivilklausel verankern Kooperationsvereinbarung kündigen Kritisch beobachten die GEW Bayern und ver.di Bayern die zunehmende Einflussnahme der Bundeswehr an Schulen und die Kriegsforschung an Hochschulen. Gemeinsam wurde dazu eine Veranstaltung in München durchgeführt. Auf der Homepage der GEW Bayern gibt es nun die Dokumentation der Veranstaltung vom »Zivilklausel verankern Kooperationsvereinbarung kündigen«. Sie ist zu finden unter: Filmtipp: Bottled Life Das Geschäft mit dem Wasser Große Konzerne sichern sich weltweit Zugriff auf Quellen und verkaufen Wasser als teures Lifestyleprodukt. Auch die EU hat Ambitionen, den Wassermarkt zu liberalisieren. Erst kürzlich haben sich knapp zwei Millionen Menschen in Europa gegen die Privatisierung von Wasser ausgesprochen. Der Film»Bottled Life«zeigt, wie große Konzerne vorgehen, um sich Vorteile am Wassermarkt zu sichern. Gewalt von rechts Die Zahl ist erschreckend: Im Juni 2013 registrierte das Bundesinnenministerium insgesamt 865 Straftaten»politisch motivierter Kriminalität«aus der rechten Szene. Und diese Zahl ist nur ein erster Blick auf die Aktivitäten Rechter. Sie könne sich, so das Ministerium, aufgrund von Nachmeldungen noch»teilweise erheblich«verändern. Abgeordnete der Fraktion Die Linke wollten wissen, welche rechtsextremistischen Aktivitäten im Juni der Bundesregierung bekannt waren. Von den 865 Straftaten zählen 45 zu»gewalttaten«. Auch die Frage nach»festnahmen«wurde beantwortet: Es gab 461 Tatverdächtige, drei Personen wurden vorläufig festgenommen, Haftbefehle wurden keine erlassen. Als»Teilmenge«der Gesamtstatistik weist die Bundesregierung noch»hasskriminialität«aus. Taten, deren»umstände auf die Einstellung des Täters schließen lassen«. Hier lauten die vorläufigen Zahlen: 223 Taten, darunter 29 Gewalttaten. Die Antwort auf die Anfrage der Fraktion Die Linke findet man unter: Das Fürther Bündnis gegen Rechtsextremismus und Rassismus veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Stadt Fürth alljährlich das Gedenken zum 9. November zur Reichspogromnacht. In diesem Jahr gibt es ein Begleitprogramm, das u. a. von der GEW Mittelfranken mitgetragen wird. Es handelt sich um die Ausstellung»Opfer rechter Gewalt«, welche vom 10. bis zum 30. November 2013 im Fürther Sozialrathaus zu sehen sein wird. Die Ausstellung portraitiert 169 Menschen, die seit 1990 rechter Gewalt zum Opfer fielen. Viele wurden getötet, weil für sie im Weltbild der extremen Rechten kein Platz ist, manche, weil sie den Mut hatten, Naziparolen zu widersprechen. Einige Schicksale bewegten die Öffentlichkeit. Viele wurden kaum zur Kenntnis genommen. Vergessen sind die meisten. Die Ausstellung ruft diese Menschen in Erinnerung. Sie ist ein Projekt von Rebecca Forner und der Opferperspektive e. V. in Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung. Die GEW Mittelfranken bietet Lehrkräften an, die Ausstellung mit ihren Klassen ab 7. oder 8. Klasse zu besuchen. Führungen für Schulklassen und Gruppen werden von erfahrenen Pädagog*innen durchgeführt. Eintritt und Führungen sind kostenfrei. Sie finden immer werktags von 8.30 Uhr bis Uhr statt auf Wunsch auch nachmittags. Dauer: 1,5 Stunden. Bei der Anmeldung bitte einen Wunsch- und einen Ausweichtermin angeben sowie das Alter der Schüler*innen. Anmeldung unter: gewmittelfranken.info@yahoo.de
22 22 DDS November 2013 Interessante Veranstaltungen ab November 2013 Die Übersicht wird ständig aktualisiert, entsprechende Hinweise bitte an Susanne Glas in der GEW-Landesgeschäftsstelle: Arbeitnehmer*in 60 plus Schaff ich die Arbeit oder schafft sie mich?* Mit Barbara Haas (GEW Baden-Württemberg) und Maria Koppold (GEW Bayern). TN-Beitrag: 30 Euro, GEW-Mitglieder: 10 Euro. Anmeldeschluss war bereits. Bei Interesse nach freien Plätzen fragen Neoliberaler Kapitalismus versus Demokratie. * Mit Prof. Dr. W. Elsner, Universität Bremen. Anmeldeschluss war bereits. Bei Interesse nach freien Plätzen fragen bei Susanne Glas: Politischer Streik auch in Deutschland. Wie wir das politische Streikrecht verloren haben und warum wir es gerade jetzt brauchen, auch als Beamt*innen. Mit Veit Wilhelmy. (Näheres siehe unten.) Testfall Syrien? Mit Karin Leukefeld, Auslandskorrespondentin, Islamund Politikwissenschaftlerin. Eine Veranstaltung der GEW Aschaffenburg-Miltenberg in Kooperation mit Attac. (Näheres siehe unten.) Schreib doch schnell mal was dazu! Journalistische Grundregeln, Textformen kennenlernen u. a. Mit Dagmar Thiel, Journalistin. Anmeldeschluss war bereits. Bei Interesse nach freien Plätzen fragen. Zwei-Tages-Seminar Zwei-Tages-Seminar Info-Veranstaltung Vortrags- und Diskussionsabend Zwei-Tages-Seminar Bad Endorf Hotel Seeblick, Pelham Fr Sa Uhr Nürnberg Caritas-Pirckheimer-Haus Fr Sa Uhr Fürth GEW-Büro, Luisenstr Uhr Aschaffenburg Volkshaus Halkevi Uhr Nürnberg Caritas-Pirckheimer-Haus Fr Sa Uhr Für München siehe immer auch: Weitere Informationen über die Mailinglist, Eintrag jederzeit widerruflich! Bitte per anfordern. * Anmeldung erbeten, falls nicht anders angegeben: GEW-Geschäftsstelle, Susanne Glas, susanne.glas@gew-bayern.de, Tel.: , Fax: ** Teilnahmegebühr Die Landesfachgruppe Berufliche Schulen der GEW Bayern trifft sich zu ihrer Fachgruppen-Klausur am 15./16. November 2013 in Nürnberg von Freitag Uhr bis Samstag Uhr im DGB-Haus Nürnberg, Kornmarkt 5-7, 7. Stock, Raum 2a Übergangsmanagement mit Martin Neumann, Landesfachgruppe der GEW Hamburg Martin Neumann begleitet Jugendliche beim Übergang von der allgemein bildenden Schule in die Berufsausbildung und berichtet von seinen Erfahrungen mit dem Hamburger Übergangsmanagement. Weitere Themen: Neuordnung der Büroberufe Neue Schulordnung FOS/BOS Neues Schulministerium für Schule und Wissenschaft: Neuwahlen zum HPR? Künftige Arbeit der Landesfachgruppe Fachgruppe auf der LVV Berichte aus den Betrieben Wegen der Übernachtung und des Essens bitten wir um Anmeldung bei: Erwin Saint Paul, Pfeuferstr. 20, München Tel. 0 89/ esaintpaul@mnet-online.de Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Bayern Einladung an alle Interessierten zur Jahrestagung Angestellte Lehrkräfte in Bayern: Tarifliche Eingruppierung und Arbeitssituation am Samstag, , Uhr bis Uhr in Nürnberg, DGB-Haus, Kornmarkt 5-7 Tarifrunde TV-L 2013 und Eingruppierung der Lehrkräfte wie weiter? Mit Ilona Deckwerth, Mitglied im GEW-Landesvorstand Tarifrunde TVöD 2014 und Betriebsratswahlen 2014 Mit Anton Salzbrunn, Stellvertretender GEW-Landesvorsitzender Arbeitsverträge: Befristungen und wechselnde Stundenzahlen Mit Erwin Denzler, Gewerkschaftssekretär für Weiterbildung und Privatschulen nachmittags Arbeitsgruppen: - Aktiv Tarifpolitik gestalten: TVöD 2014/Betriebsratswahlen 2014 mit Anton Salzbrunn und Ilona Deckwerth - TVöD- oder TV-L-Vertrag oder was? Privat oder staatlich beschäftigt? Persönliche Fragen und Fragen zu Eingruppierung, Burn-out, Mobbing und Betriebsklima beantworten Max Hufnagl (Mitglied BTK TV-L), Bernhard Baudler (GEW-Sekretär für Schulen), Erwin Denzler (Gewerkschaftssekretär u. a. für Privatschulen), Peter Weiß und Joachim Peter Graf (GEW München) anschließend Plenum: Zusammenfassung, Austausch und Diskussion Zur besseren Planung bitten wir um Anmeldung bis an die GEW-Landesgeschäftsstelle: GEW Bayern Tel. 0 89/ Fax: 0 89/ susanne.glas@gew-bayern.de Die GEW Mittelfranken lädt ein: Politischer Streik auch in Deutschland Mit Veit Wilhelmy, Gewerkschaftssekretär der IG BAU Das politische Streikrecht wie wir es verloren haben und warum wir es gerade jetzt brauchen auch als Beamt*innen am Mittwoch, in Fürth Uhr GEW-Büro Fürth, Luisenstr. 2, U-Bahn Jakobinerstraße Sind politische Streiks in Deutschland»verboten«? Warum verzichteten die Gewerkschaften in den Kämpfen der vergangenen Jahre auf das Kampfmittel des politischen Streiks? Wie können wir ein kämpferisches Streikrecht und den politischen Streik als Kampfmaßnahme durchsetzen? Diese und viele andere Fragen sollen im Rahmen eines offenen Meinungsaustausches diskutiert werden. Die GEW Aschaffenburg-Miltenberg in Kooperation mit Attac lädt ein zu einem Vortrags- und Diskussionsabend: Testfall Syrien? Die nationale, regionale und internationale Ebene des Syrien-Konflikts und die Perspektiven für einen Frieden in der Region Mit Karin Leukefeld Auslandskorrespondentin, Islam- und Politikwissenschaftlerin, u. a. tätig für ARD, Schweizer Hörfunk und Junge Welt am Mittwoch, in Aschaffenburg Uhr, Volkshaus Halkevi, Aschaffenburg, Sandgasse 2
23 DDS November Herzlichen Glückwunsch! Wir gratulieren allen Kolleginnen und Kollegen, die im November Geburtstag feiern, ganz besonders Helmut Rößle, Neuried, zum 88. Konrad Maurer, Burghausen, zum 79. Karin Turkowski, Garching, Silvia Waldmann, München, Walter Hundhammer, Füssen, und Klaus Peter König, Germering, zum 76. Elisabeth Gottmann, München, Gudrun Schmidt, München, Jürgen Berghoff, Alerheim, Dr. Karl Esselborn, München, Dr. Hermann Patsch, München, Theodor Schmitz, Reimlingen, und Wieland Sternagel, München, zum 75. Günter Leitzgen, Erlangen, zum 74. Gertrud Federschmidt, Nürnberg, Barbara Schoener, München, Eduard Jäger, Türkheim, Hermann Mewald, Durach, und Volker Roloff, München, zum 73. Karin Blumöhr, München, Christiane Busl, Lappersdorf, Gritli Erhardt-Gschosmann, München, Barbara Krämer-Kubas, Lindau, Theodor Denninger, Nürnberg, Dietmar Gschrey, Zorneding, Herbert Langen, Landsberg, Paul Stürzer, München, und Dr. Hajo Wachsmann, München, zum 72. Bernd Seeberger, Mühldorf, zum 71. Christa Norville, München, Peter Johannes Appelt, München, Balazs Gachal-Eölvedy, Bodenkirchen, Martin Müller-Aenis, Wertingen, Ulrich Schendera, Hafenlohr, und Eckart Wangerin, Erlangen, zum 70. sowie zum 65. Sylvia Amelung, München, Elisabeth Claus, Aschaffenburg, Petra Krämer, Fürth, Evelyn Lewandowski-Serve, Bamberg, Ursula Manlik, München, Annemarie Müller-Janton, Augsburg, Gerdi Pöllinger, Regensburg, Elisabeth Schneider, Erlangen, Marianne Walther, München, Brigitte Weislmeier, Landsberg, Wolfgang Anzinger, Freising, Edwin Auer, Kempten, Wolfgang Dechant, Schweinfurt, Peter Feulner, Ingolstadt, Salih Hasani, Augsburg, Joachim Kaiser, Hammelburg, John King, München, Franz Konzen, Bad Honnef, Dieter Pohl, Schwabach, Herbert Stahl, Feucht, Erich Turtl, München, und Rainer Wendl, Großaitingen. Herzlichen Dank sagen wir allen, die der Gewerkschaft seit vielen Jahren die Treue halten. Im November gilt unser Dank ganz besonders Helmut Rößle, Neuried, für 55 Jahre Mitgliedschaft, Gertrud Gräbner, Kirchberg, und Karl-Heinz Bachmann, Seehausen, für 51 Jahre Mitgliedschaft, Karl-Heinz Dorschner, Nürnberg, für 50 Jahre Mitgliedschaft, Katrin Huber, Dießen, Eva-Maria Mick, München, Christine Schmid, München, Erika Werthner, Nürnberg, Alfons Balthesen, München, Wilfried Christel, Nürnberg, Rudolf Müller, Crailsheim, und Lothar Strogies, Nürnberg, für 40 Jahre Mitgliedschaft, sowie Ingrid Ecker-Rose, Augsburg, Angelika Franzisi, Nürnberg, Mechthild Hageböck-Rachinsky, München, Daniela Karle, Augsburg, Hanna Poharnok, München, Astrid Popp, Bamberg, Michael Ettel, Bobingen, Georg Fleischmann, Veitsbronn, Christian Huber, Kaufbeuren, Peter Kowa, Kalchreuth, Walter Lang, Erlangen, Peter Libossek, Erding, Burkhard Preiß, Nürnberg, Norbert Stadler, Burghausen, Robert Stein, Gundelsheim, und Gerhard Weiherer, Roding, für 35 Jahre Mitgliedschaft. Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Stadtverband München - die münchner bildungsgewerkschaft - Wahlmitgliederversammlung Montag, Uhr Gewerkschaftshaus Tagesordnung: Eröffnung Grußwort von Stefanie Krammer, DGB Wahlen: Präsidium, Mandatsprüfungskommission, Wahlkommission, Landesdelegierte Generaldebatte Anträge (Antragsschluss: , Anträge werden auf Anfrage zugestellt) Verschiedenes Ende: Uhr Hauptthema: Generaldebatte... Rund um die GEW
Für eine europäische Investitionsoffensive
 Für eine europäische Investitionsoffensive Gewerkschaftliche Vorschläge für mehr Investitionen und deren Finanzierung FES-DGB-Konferenz Zukunft braucht Investitionen: Wie schließen wir die Investitionslücke
Für eine europäische Investitionsoffensive Gewerkschaftliche Vorschläge für mehr Investitionen und deren Finanzierung FES-DGB-Konferenz Zukunft braucht Investitionen: Wie schließen wir die Investitionslücke
Nr. 142 Informationen für Lehrerinnen und Lehrer
 ISSN 2194-5098 (Print) ISSN 2194-5101 (Internet) Nr. 142 Informationen für Lehrerinnen und Lehrer In dieser Ausgabe Der Arbeitsmarkt für Jugendliche in Europa Seite 4 Der Arbeitsmarkt für junge Leute in
ISSN 2194-5098 (Print) ISSN 2194-5101 (Internet) Nr. 142 Informationen für Lehrerinnen und Lehrer In dieser Ausgabe Der Arbeitsmarkt für Jugendliche in Europa Seite 4 Der Arbeitsmarkt für junge Leute in
Ein Marshallplan für Europa Konjunktur-, Investitions- und Aufbauprogramm
 Ein Marshallplan für Europa Konjunktur-, Investitions- und Aufbauprogramm [November 14] Dr. Patrick Schreiner, Abteilung Wirtschaft Umwelt Europa, DGB Bezirk Niedersachsen Bremen Sachsen-Anhalt, Mail:
Ein Marshallplan für Europa Konjunktur-, Investitions- und Aufbauprogramm [November 14] Dr. Patrick Schreiner, Abteilung Wirtschaft Umwelt Europa, DGB Bezirk Niedersachsen Bremen Sachsen-Anhalt, Mail:
Stärkung der Tarifbindung
 Stärkung der Tarifpolitik in Europa Stärkung der Tarifbindung 12. Workshop Europäische Tarifpolitik WSI / Ver.di Berlin, 15./16. Mai 2017 Dr. Torsten Müller European Trade Union Institute - ETUI Struktur
Stärkung der Tarifpolitik in Europa Stärkung der Tarifbindung 12. Workshop Europäische Tarifpolitik WSI / Ver.di Berlin, 15./16. Mai 2017 Dr. Torsten Müller European Trade Union Institute - ETUI Struktur
Tarif- und Sozialpolitische Konferenz. Wien, Juni 2014 Unsere Zukunft verhandeln! Gewerkschaftliche Strategien in Zeiten der Wirtschaftskrise
 Tarif- und Sozialpolitische Konferenz Wien, 12.-13. Juni 2014 Unsere Zukunft verhandeln! Gewerkschaftliche Strategien in Zeiten der Wirtschaftskrise Dokument 2 Gute Arbeit sichern: Tarifbindung in Europa
Tarif- und Sozialpolitische Konferenz Wien, 12.-13. Juni 2014 Unsere Zukunft verhandeln! Gewerkschaftliche Strategien in Zeiten der Wirtschaftskrise Dokument 2 Gute Arbeit sichern: Tarifbindung in Europa
Die Krise der Eurozone und die Zukunft der EU. Vortrag auf der Tagung des Projekts Nestor Osnabrück, Klaus Busch
 Die Krise der Eurozone und die Zukunft der EU Vortrag auf der Tagung des Projekts Nestor Osnabrück, 30.11.2012 Klaus Busch Thesen des Vortrages 1. Die Defekte des Maastrichter Vertrages und die Schuldenexplosion
Die Krise der Eurozone und die Zukunft der EU Vortrag auf der Tagung des Projekts Nestor Osnabrück, 30.11.2012 Klaus Busch Thesen des Vortrages 1. Die Defekte des Maastrichter Vertrages und die Schuldenexplosion
GRUSSWORT DER EUROPÄ ISCHEN KOMMISSION
 GRUSSWORT DER EUROPÄ ISCHEN KOMMISSION Cristina Asturias, stv. Referatsleiterin Generaldirektion Beschäftigung Europäische Kommission ESF Jahresveranstaltung 2016 17. Februar 2016 (Es gilt das gesprochene
GRUSSWORT DER EUROPÄ ISCHEN KOMMISSION Cristina Asturias, stv. Referatsleiterin Generaldirektion Beschäftigung Europäische Kommission ESF Jahresveranstaltung 2016 17. Februar 2016 (Es gilt das gesprochene
Rede der Stellvertretenden Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbunds. Ingrid Sehrbrock. anlässlich der Pressekonferenz am 13. März 2013 in Berlin
 Rede der Stellvertretenden Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbunds Ingrid Sehrbrock anlässlich der Pressekonferenz am 13. März 2013 in Berlin Thema: Jugendarbeitslosigkeit in Europa und Tag der Ansage
Rede der Stellvertretenden Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbunds Ingrid Sehrbrock anlässlich der Pressekonferenz am 13. März 2013 in Berlin Thema: Jugendarbeitslosigkeit in Europa und Tag der Ansage
Gesundheit und Pflege gerecht finanzieren
 Gesundheit und Pflege gerecht finanzieren Eine Studie zu einer neuen Versicherung für alle Bürger und Bürgerinnen Hier lesen Sie einen Beschluss von der Fraktion DIE LINKE im Bundestag. Der Beschluss ist
Gesundheit und Pflege gerecht finanzieren Eine Studie zu einer neuen Versicherung für alle Bürger und Bürgerinnen Hier lesen Sie einen Beschluss von der Fraktion DIE LINKE im Bundestag. Der Beschluss ist
Tarifpolitik in Europa unter dem Druck von Krise und Austeritätspolitik Die Herausbildung eines neuen europäischen Interventionismus
 Tarifpolitik in Europa unter dem Druck von Krise und Austeritätspolitik Die Herausbildung eines neuen europäischen Interventionismus WSI Tarifpolitische Tagung 2012 Faire Löhne und Gute Arbeit Düsseldorf,
Tarifpolitik in Europa unter dem Druck von Krise und Austeritätspolitik Die Herausbildung eines neuen europäischen Interventionismus WSI Tarifpolitische Tagung 2012 Faire Löhne und Gute Arbeit Düsseldorf,
Bundestagswahl 2013: Das erwarten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 Foto: istockphoto / TommL Bundestagswahl 2013: Das erwarten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1 Foto: Bosch Neue Ordnung auf dem Arbeitsmarkt 2 Neue Ordnung auf dem Arbeitsmarkt Das erwarten Arbeitnehmerinnen
Foto: istockphoto / TommL Bundestagswahl 2013: Das erwarten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1 Foto: Bosch Neue Ordnung auf dem Arbeitsmarkt 2 Neue Ordnung auf dem Arbeitsmarkt Das erwarten Arbeitnehmerinnen
Ein Marshallplan für Europa
 Ein Marshallplan für Europa Vorschlag des Deutschen Gewerkschaftsbundes für ein Konjunktur-, Investitions- und Aufbauprogramm für Europa Workshop mit Raoul Didier, Martin Stuber Umverteilen. Macht. Gerechtigkeit
Ein Marshallplan für Europa Vorschlag des Deutschen Gewerkschaftsbundes für ein Konjunktur-, Investitions- und Aufbauprogramm für Europa Workshop mit Raoul Didier, Martin Stuber Umverteilen. Macht. Gerechtigkeit
IST DIE DEMOKRATIE IN EUROPA NOCH ZU RETTEN?
 IST DIE DEMOKRATIE IN EUROPA NOCH ZU RETTEN? Dr. Thorsten Schulten IG Metall Schweinfurt/Bamberg Denkfabrik Main 4. November 2015, Schweinfurt Inhalt 1. Europa Aktuelle Krisendiagnosen 2. Konstruktionsfehler
IST DIE DEMOKRATIE IN EUROPA NOCH ZU RETTEN? Dr. Thorsten Schulten IG Metall Schweinfurt/Bamberg Denkfabrik Main 4. November 2015, Schweinfurt Inhalt 1. Europa Aktuelle Krisendiagnosen 2. Konstruktionsfehler
Spaltende Integration Krisenbewältigung auf Europäisch
 Spaltende Integration Krisenbewältigung auf Europäisch Kooperationsstelle Hochschulen und Gewerkschaften Osnabrück 14. März 2014 Steffen Lehndorff Institut Arbeit und Qualifikation Universität Duisburg-Essen
Spaltende Integration Krisenbewältigung auf Europäisch Kooperationsstelle Hochschulen und Gewerkschaften Osnabrück 14. März 2014 Steffen Lehndorff Institut Arbeit und Qualifikation Universität Duisburg-Essen
Statement zur Pressekonferenz Kampagnenstart Revolution Bildung
 Detlef Wetzel Zweiter Vorsitzender der IG Metall Statement zur Pressekonferenz Kampagnenstart Revolution Bildung Frankfurt, 9. März 2013 Sperrfrist Redebeginn Es gilt das gesprochene Wort! Detlef Wetzel,
Detlef Wetzel Zweiter Vorsitzender der IG Metall Statement zur Pressekonferenz Kampagnenstart Revolution Bildung Frankfurt, 9. März 2013 Sperrfrist Redebeginn Es gilt das gesprochene Wort! Detlef Wetzel,
Sicherheit Für gesicherte Beschäftigung in jedem Alter
 Sicherheit Für gesicherte Beschäftigung in jedem Alter 95 PROZENT aller Befragten finden es gut, dass Beschäftigte mit Unterstützung der Gewerkschaften für einen Tarifvertrag streiken, wenn das Unternehmen
Sicherheit Für gesicherte Beschäftigung in jedem Alter 95 PROZENT aller Befragten finden es gut, dass Beschäftigte mit Unterstützung der Gewerkschaften für einen Tarifvertrag streiken, wenn das Unternehmen
Allgemeinverbindlicherklärungen Erfahrungen aus Europa
 Allgemeinverbindlicherklärungen Erfahrungen aus Europa Thorsten Schulten WSI Tarifpolitische Tagung 2011 Stabilisierung des Flächentarifvertrages Reform der AVE Düsseldorf, 27-28 September 2011 www.wsi.de
Allgemeinverbindlicherklärungen Erfahrungen aus Europa Thorsten Schulten WSI Tarifpolitische Tagung 2011 Stabilisierung des Flächentarifvertrages Reform der AVE Düsseldorf, 27-28 September 2011 www.wsi.de
Internationaler Workshop Förderung von Qualifikation und Beschäftigung junger Menschen Warschau Okt. 2012
 Christoph Kusche, email: christoph.kusche@esan.eu Vice-président de ESAN Aisbl - wwww.esan.eu Internationaler Workshop Förderung von Qualifikation und Beschäftigung junger Menschen Warschau 11. - 12. Okt.
Christoph Kusche, email: christoph.kusche@esan.eu Vice-président de ESAN Aisbl - wwww.esan.eu Internationaler Workshop Förderung von Qualifikation und Beschäftigung junger Menschen Warschau 11. - 12. Okt.
Gewerkschaftliche Strategien für ein «anderes Europa»
 Gewerkschaftliche Strategien für ein «anderes Europa» Vasco Pedrina, Unia/SGB, Vize-Präsident BHI (Bau und Holzarbeiter Internationale) Seminar ver.di/wsi Berlin, 13./14.05.2013 2 Euro-Krise und Austeritätspolitik:
Gewerkschaftliche Strategien für ein «anderes Europa» Vasco Pedrina, Unia/SGB, Vize-Präsident BHI (Bau und Holzarbeiter Internationale) Seminar ver.di/wsi Berlin, 13./14.05.2013 2 Euro-Krise und Austeritätspolitik:
ANPACKEN: dgb.de/rente
 dgb.de/rente ANPACKEN: Rente muss für ein gutes Leben reichen Kaum ein anderes Industrieland senkt das gesetzlich garantierte Rentenniveau so stark wie Deutschland. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB)
dgb.de/rente ANPACKEN: Rente muss für ein gutes Leben reichen Kaum ein anderes Industrieland senkt das gesetzlich garantierte Rentenniveau so stark wie Deutschland. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB)
Delegiertenversammlung der IGM Pforzheim am 27. Oktober 2005
 Delegiertenversammlung der IGM Pforzheim am 27. Oktober 2005 D O K U M E N T A T I O N Christel Bässler 1 Inhalt: Einladung und Ablauf... Seite 2 Momentaufnahmen (1)... Seite 3 Kommentare zu den Textstellen...
Delegiertenversammlung der IGM Pforzheim am 27. Oktober 2005 D O K U M E N T A T I O N Christel Bässler 1 Inhalt: Einladung und Ablauf... Seite 2 Momentaufnahmen (1)... Seite 3 Kommentare zu den Textstellen...
Für eine gemeinsame Vision der Berufsausbildung
 Für eine gemeinsame Vision der Berufsausbildung Für eine gemeinsame Vision der Ausbildung Engagement für Kenntniszuwachs und Kapazitätsaufbau Lobbyarbeit in Politik und Bündnisse eingehen Entwicklung eines
Für eine gemeinsame Vision der Berufsausbildung Für eine gemeinsame Vision der Ausbildung Engagement für Kenntniszuwachs und Kapazitätsaufbau Lobbyarbeit in Politik und Bündnisse eingehen Entwicklung eines
DER EU VON 2014 BIS in NUR 3 JAHREN NEUE GRÜNE JOBS
 EIN "NEW DEAL" EIN NACHHALTIGES EUROPA 582 MILLIARDEN EURO Für GRÜNE INVESTITIONEN, DIE 5 MILLIONEN JOBS IN DEN ERSTEN 3 JAHREN SCHAFFEN EIN INVESTITIONSPLAN VON 194 MILLIARDEN EURO JÄHRLICH VERKEHRSINFRASTRUKTUR
EIN "NEW DEAL" EIN NACHHALTIGES EUROPA 582 MILLIARDEN EURO Für GRÜNE INVESTITIONEN, DIE 5 MILLIONEN JOBS IN DEN ERSTEN 3 JAHREN SCHAFFEN EIN INVESTITIONSPLAN VON 194 MILLIARDEN EURO JÄHRLICH VERKEHRSINFRASTRUKTUR
Der Ausbildungsreport der DGB-Jugend Bayern 2013 Ergebnisse und Forderungen
 Der Ausbildungsreport der DGB-Jugend Bayern 2013 Ergebnisse und Forderungen Sitzung des LAB Bayern am 27. Februar 2014 Astrid Backmann, DGB- Bezirksjugendsekretärin Ausbildungsreport Bayern 2013 Ergebnisse
Der Ausbildungsreport der DGB-Jugend Bayern 2013 Ergebnisse und Forderungen Sitzung des LAB Bayern am 27. Februar 2014 Astrid Backmann, DGB- Bezirksjugendsekretärin Ausbildungsreport Bayern 2013 Ergebnisse
Wettbewerbsfähigkeit als Tugendlehre und Totengräber für Löhne und Tarifsystem. Maskenfall.de
 Wettbewerbsfähigkeit als Tugendlehre und Totengräber für Löhne und Tarifsystem Maskenfall.de Prozent des BIP 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Staatsverschuldung (brutto) Finanzkrise Belgien Deutschland
Wettbewerbsfähigkeit als Tugendlehre und Totengräber für Löhne und Tarifsystem Maskenfall.de Prozent des BIP 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Staatsverschuldung (brutto) Finanzkrise Belgien Deutschland
Der Ausbildungsbonus: In Zukunft Arbeit.
 Der Ausbildungsbonus: In Zukunft Arbeit. Der Ausbildungsbonus: Neue Chancen für Jugendliche Die Unternehmen in Deutschland werden von der Wirtschaftskrise schwer getroffen. Die Krise wirkt sich inzwischen
Der Ausbildungsbonus: In Zukunft Arbeit. Der Ausbildungsbonus: Neue Chancen für Jugendliche Die Unternehmen in Deutschland werden von der Wirtschaftskrise schwer getroffen. Die Krise wirkt sich inzwischen
Hochwertige und chancengerechte Bildung für alle. Katja Römer Pressesprecherin Deutsche UNESCO-Kommission
 Hochwertige und chancengerechte Bildung für alle Katja Römer Pressesprecherin Deutsche UNESCO-Kommission Bildung o Bildung befähigt Menschen dazu, ein erfülltes Leben zu führen und ihre Persönlichkeit
Hochwertige und chancengerechte Bildung für alle Katja Römer Pressesprecherin Deutsche UNESCO-Kommission Bildung o Bildung befähigt Menschen dazu, ein erfülltes Leben zu führen und ihre Persönlichkeit
DGB-Jugend Index Gute Arbeit Ergebnisse einer repräsentativen Befragung von Jugendlichen zur Arbeitsqualität in Deutschland
 DGB-Jugend Index Gute Arbeit 2014 Ergebnisse einer repräsentativen Befragung von 1.136 Jugendlichen zur Arbeitsqualität in Deutschland Der Index Gute Arbeit der DGB-Jugend Ziel des DGB-Jugend Index ist
DGB-Jugend Index Gute Arbeit 2014 Ergebnisse einer repräsentativen Befragung von 1.136 Jugendlichen zur Arbeitsqualität in Deutschland Der Index Gute Arbeit der DGB-Jugend Ziel des DGB-Jugend Index ist
Zahlen-Daten-Fakten zum Thema
 Informationen zur Leiharbeit Zahlen-Daten-Fakten zum Thema Lohndumping Herausgeber Deutscher Gewerkschaftsbund Bundesvorstand Abteilung Grundsatzangelegenheiten und Gesellschaftspolitik Henriette-Herz-Platz
Informationen zur Leiharbeit Zahlen-Daten-Fakten zum Thema Lohndumping Herausgeber Deutscher Gewerkschaftsbund Bundesvorstand Abteilung Grundsatzangelegenheiten und Gesellschaftspolitik Henriette-Herz-Platz
fakten zum thema arbeitsmarkt
 fakten zum thema arbeitsmarkt Bessere Jobs, steigende Löhne So profitieren die Menschen von der Politik der CDU. Bessere Jobs, steigende Löhne So profitieren die Menschen von der Politik der CDU Die deutsche
fakten zum thema arbeitsmarkt Bessere Jobs, steigende Löhne So profitieren die Menschen von der Politik der CDU. Bessere Jobs, steigende Löhne So profitieren die Menschen von der Politik der CDU Die deutsche
Strukturreformen in Europa: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft
 AK Tagung: Europas Weg in die Zukunft Austeritätskurs beenden, Investitionen starten 17. April 2015 Strukturreformen in Europa: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft Prof. Jörg Flecker Universität Wien und
AK Tagung: Europas Weg in die Zukunft Austeritätskurs beenden, Investitionen starten 17. April 2015 Strukturreformen in Europa: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft Prof. Jörg Flecker Universität Wien und
LOHNPOLITIK UNTER EUROPÄISCHER ECONOMIC GOVERNANCE
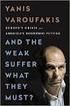 LOHNPOLITIK UNTER EUROPÄISCHER ECONOMIC GOVERNANCE Dr. Thorsten Schulten Arbeitnehmerkammer Chambre des Salariés 19. April 2016, Luxemburg Inhalt 1. Der neue Interventionismus: Europäische Economic Governance
LOHNPOLITIK UNTER EUROPÄISCHER ECONOMIC GOVERNANCE Dr. Thorsten Schulten Arbeitnehmerkammer Chambre des Salariés 19. April 2016, Luxemburg Inhalt 1. Der neue Interventionismus: Europäische Economic Governance
Europäische Koordinierung der Lohnpolitik
 Europäische Koordinierung der Lohnpolitik Wettbewerbsorientiert oder solidarisch? Dr. Thorsten Schulten WSI/ver.di 10. Workshop Europäische Tarifpolitik Berlin, 8. Mai 2014 Ausgangsthesen: 1. Angesichts
Europäische Koordinierung der Lohnpolitik Wettbewerbsorientiert oder solidarisch? Dr. Thorsten Schulten WSI/ver.di 10. Workshop Europäische Tarifpolitik Berlin, 8. Mai 2014 Ausgangsthesen: 1. Angesichts
10 gute Gründe, warum wir den Euro, die Währungsunion und den gemeinsamen europäischen Markt brauchen.
 Foto: Dreamstime.com / Orcea David 10 gute Gründe, warum wir den Euro, die Währungsunion 1. Der Euroraum ist für Deutschland die wichtigste Exportregion 41 Prozent aller in Deutschland produzierten Waren
Foto: Dreamstime.com / Orcea David 10 gute Gründe, warum wir den Euro, die Währungsunion 1. Der Euroraum ist für Deutschland die wichtigste Exportregion 41 Prozent aller in Deutschland produzierten Waren
Fakten zum Thema. Arbeitsmarkt. Bessere Jobs, steigende Löhne So profitieren die Menschen von der Politik der CDU.
 Fakten zum Thema Arbeitsmarkt Bessere Jobs, steigende Löhne So profitieren die Menschen von der Politik der CDU. Bessere Jobs, steigende Löhne So profitieren die Menschen von der Politik der CDU Die deutsche
Fakten zum Thema Arbeitsmarkt Bessere Jobs, steigende Löhne So profitieren die Menschen von der Politik der CDU. Bessere Jobs, steigende Löhne So profitieren die Menschen von der Politik der CDU Die deutsche
Bessere Bildung trotz Haushaltskonsolidierung Die Chancen des demografischen Wandels nutzen
 Pressekonferenz, 19. August 2010 Bildungsmonitor 2010 Bessere Bildung trotz Haushaltskonsolidierung Die Chancen des demografischen Wandels nutzen Statement Hubertus Pellengahr Geschäftsführer Initiative
Pressekonferenz, 19. August 2010 Bildungsmonitor 2010 Bessere Bildung trotz Haushaltskonsolidierung Die Chancen des demografischen Wandels nutzen Statement Hubertus Pellengahr Geschäftsführer Initiative
Erwerbslosigkeit Jugendlicher in Europa im Jahr 2014
 Aktuelle Berichte Erwerbslosigkeit Jugendlicher in Europa im Jahr 2014 4/2016 In aller Kürze Das Erwerbslosigkeitsrisiko Jugendlicher in Europa bewegt sich weiterhin auf hohem Niveau. Insbesondere die
Aktuelle Berichte Erwerbslosigkeit Jugendlicher in Europa im Jahr 2014 4/2016 In aller Kürze Das Erwerbslosigkeitsrisiko Jugendlicher in Europa bewegt sich weiterhin auf hohem Niveau. Insbesondere die
Gute Arbeit braucht betriebliche Promotoren
 Gute Arbeit braucht betriebliche Promotoren Schöneberger Forum 28./29. November 2012 Achim Meerkamp, ver.di-bundesvorstand Warum steht das Thema Gute Arbeit auf unserer Agenda? Leitbild einer modernen,
Gute Arbeit braucht betriebliche Promotoren Schöneberger Forum 28./29. November 2012 Achim Meerkamp, ver.di-bundesvorstand Warum steht das Thema Gute Arbeit auf unserer Agenda? Leitbild einer modernen,
Mindestlohn, Tarifpolitik, Gesundheitsschutz - aktuelle gewerkschaftliche Herausforderungen
 Mindestlohn, Tarifpolitik, Gesundheitsschutz - aktuelle gewerkschaftliche Herausforderungen Fachtagung Gute Arbeit im Call Center und im Kundenservice durchsetzen, 27.Oktober 2014, Essen Dr. Martin Beckmann
Mindestlohn, Tarifpolitik, Gesundheitsschutz - aktuelle gewerkschaftliche Herausforderungen Fachtagung Gute Arbeit im Call Center und im Kundenservice durchsetzen, 27.Oktober 2014, Essen Dr. Martin Beckmann
Staatsschuldenquote (brutto)
 Staatsschuldenquote (brutto) 180 160 140 % BIP 120 100 80 GR ES IT PT IE 60 40 20 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Datenquelle: AMECO Wirtschaftseinbruch,
Staatsschuldenquote (brutto) 180 160 140 % BIP 120 100 80 GR ES IT PT IE 60 40 20 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Datenquelle: AMECO Wirtschaftseinbruch,
Allianz für Aus- und Weiterbildung
 Allianz für Aus- und Weiterbildung Was steht im Koalitionsvertrag der Bundesregierung? Wir werden den Ausbildungspakt gemeinsam mit Sozialpartnern und Ländern zur Allianz für Aus- und Weiterbildung weiterentwickeln
Allianz für Aus- und Weiterbildung Was steht im Koalitionsvertrag der Bundesregierung? Wir werden den Ausbildungspakt gemeinsam mit Sozialpartnern und Ländern zur Allianz für Aus- und Weiterbildung weiterentwickeln
Qualifizierung Für sichere Ausbildung und gesicherte Jobs
 Qualifizierung Für sichere Ausbildung und gesicherte Jobs 7,3 MILLIONEN Arbeitnehmer/innen haben 2015 an einer beruflichen Weiterbildung teilgenommen. Statistisches Bundesamt 2016 Infolge des branchen-
Qualifizierung Für sichere Ausbildung und gesicherte Jobs 7,3 MILLIONEN Arbeitnehmer/innen haben 2015 an einer beruflichen Weiterbildung teilgenommen. Statistisches Bundesamt 2016 Infolge des branchen-
Für Integration und gleichberechtigtes Zusammenleben
 4 Thema Ausländische Arbeitnehmer Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie Für Integration und gleichberechtigtes Zusammenleben Mehr als 7,3 Millionen Menschen ausländischer Nationalität leben in
4 Thema Ausländische Arbeitnehmer Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie Für Integration und gleichberechtigtes Zusammenleben Mehr als 7,3 Millionen Menschen ausländischer Nationalität leben in
Alle jungen Menschen während der. Berufsausbildung angemessen finanziell ausstatten!
 Alle jungen Menschen während der Berufsausbildung angemessen finanziell ausstatten! Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung und Stärkung der beruflichen Bildung (BBiMoG) 1 Der Referentenentwurf
Alle jungen Menschen während der Berufsausbildung angemessen finanziell ausstatten! Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung und Stärkung der beruflichen Bildung (BBiMoG) 1 Der Referentenentwurf
POLITIK FÜR ALLE SICHER, GERECHT UND SELBSTBESTIMMT. Betrieb Siemens AG Standort Amberg
 POLITIK FÜR ALLE SICHER, GERECHT UND SELBSTBESTIMMT Betrieb Siemens AG Standort Amberg BEFRAGUNG 2017 DIE BETEILIGUNG Hohe Beteiligung Mehr als 680.000 Beschäftigte in rund 7000 Betrieben haben mitgemacht
POLITIK FÜR ALLE SICHER, GERECHT UND SELBSTBESTIMMT Betrieb Siemens AG Standort Amberg BEFRAGUNG 2017 DIE BETEILIGUNG Hohe Beteiligung Mehr als 680.000 Beschäftigte in rund 7000 Betrieben haben mitgemacht
Die Renten steigen jedes Jahr wo ist das Problem? Rente muss für ein gutes Leben reichen. Was passiert, wenn nichts passiert?
 Rente muss für ein gutes Leben reichen Kaum ein anderes Industrieland senkt das gesetzlich garantierte Rentenniveau so stark wie Deutschland. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und seine acht Mitgliedsgewerkschaften
Rente muss für ein gutes Leben reichen Kaum ein anderes Industrieland senkt das gesetzlich garantierte Rentenniveau so stark wie Deutschland. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und seine acht Mitgliedsgewerkschaften
Rente muss für ein gutes Leben reichen
 Rente muss für ein gutes Leben reichen Kaum ein anderes Industrieland senkt das gesetzlich garantierte Rentenniveau so stark wie Deutschland. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und seine acht Mitgliedsgewerkschaften
Rente muss für ein gutes Leben reichen Kaum ein anderes Industrieland senkt das gesetzlich garantierte Rentenniveau so stark wie Deutschland. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und seine acht Mitgliedsgewerkschaften
Jugendarbeitslosigkeit
 dbb jugend Bund) Tel: 030. 40 81 57 57 Fax: 030. 40 81 57 99 E-Mail: info_dbbj@dbb.de Internet: www.dbbj.de www.facebook.com/dbbjugend Jugendarbeitslosigkeit Im Jahr 2014 waren in Deutschland 330.000 Jugendliche
dbb jugend Bund) Tel: 030. 40 81 57 57 Fax: 030. 40 81 57 99 E-Mail: info_dbbj@dbb.de Internet: www.dbbj.de www.facebook.com/dbbjugend Jugendarbeitslosigkeit Im Jahr 2014 waren in Deutschland 330.000 Jugendliche
Die Rolle der Tarifparteien bei der Reform europäischer Wohlfahrtsstaaten Wohlfahrtsstaaten. Anke Hassel März 2004
 Die Rolle der Tarifparteien bei der Reform europäischer Wohlfahrtsstaaten Wohlfahrtsstaaten Anke Hassel März 2004 Ziele und Instrumente der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik > Vermeidung von Lohninflation
Die Rolle der Tarifparteien bei der Reform europäischer Wohlfahrtsstaaten Wohlfahrtsstaaten Anke Hassel März 2004 Ziele und Instrumente der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik > Vermeidung von Lohninflation
Der Mindestlohn kommt Mehr Lohngerechtigkeit schaffen
 Der Mindestlohn kommt Mehr Lohngerechtigkeit schaffen So sieht es aus ohne Mindestlohn. 06.06.2014 2 Wie wird der Mindestlohn eingeführt? 06.06.2014 3 Den Mindestlohn soll das Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie
Der Mindestlohn kommt Mehr Lohngerechtigkeit schaffen So sieht es aus ohne Mindestlohn. 06.06.2014 2 Wie wird der Mindestlohn eingeführt? 06.06.2014 3 Den Mindestlohn soll das Gesetz zur Stärkung der Tarifautonomie
Zur Bedeutung der dualen Berufsausbildung
 Berlin 08. Juni 2018 Zur Bedeutung der dualen Berufsausbildung Berufliche Orientierung und Berufsberatung heute: Herausforderungen in Zeiten gesellschaftlichen Wandels und tiefgreifender Veränderungen
Berlin 08. Juni 2018 Zur Bedeutung der dualen Berufsausbildung Berufliche Orientierung und Berufsberatung heute: Herausforderungen in Zeiten gesellschaftlichen Wandels und tiefgreifender Veränderungen
Zudem muss unsere Gesellschaft das Menschenrecht auf Bildung auch für eine wachsende Zahl von Flüchtlingen garantieren.
 19. Oktober 2015 Seite 2 Es gilt das gesprochene Wort! Sehr geehrte Damen und Herren, vor sieben Jahren am 22. Oktober 2008 haben die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder die Bildungsrepublik
19. Oktober 2015 Seite 2 Es gilt das gesprochene Wort! Sehr geehrte Damen und Herren, vor sieben Jahren am 22. Oktober 2008 haben die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder die Bildungsrepublik
Parteien wollen Europa reformieren
 Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Bundestagswahl 12.09.2017 Lesezeit 4 Min. Parteien wollen Europa reformieren Unabhängig vom Ausgang der Bundestagswahl steht eines schon jetzt
Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Bundestagswahl 12.09.2017 Lesezeit 4 Min. Parteien wollen Europa reformieren Unabhängig vom Ausgang der Bundestagswahl steht eines schon jetzt
ab abend Abend aber Aber acht AG Aktien alle Alle allein allen aller allerdings Allerdings alles als Als also alt alte alten am Am amerikanische
 ab abend Abend aber Aber acht AG Aktien alle Alle allein allen aller allerdings Allerdings alles als Als also alt alte alten am Am amerikanische amerikanischen Amt an An andere anderen anderer anderes
ab abend Abend aber Aber acht AG Aktien alle Alle allein allen aller allerdings Allerdings alles als Als also alt alte alten am Am amerikanische amerikanischen Amt an An andere anderen anderer anderes
15949/14 kar/ds/kr 1 DG B 4A
 Rat der Europäischen Union Brüssel, den 1. Dezember 2014 (OR. en) 15949/14 EMPL 172 SOC 815 ECOFIN 1081 EDUC 332 JEUN 112 VERMERK des für den Betr.: Vorsitzes Ausschuss der Ständigen Vertreter (1. Teil)
Rat der Europäischen Union Brüssel, den 1. Dezember 2014 (OR. en) 15949/14 EMPL 172 SOC 815 ECOFIN 1081 EDUC 332 JEUN 112 VERMERK des für den Betr.: Vorsitzes Ausschuss der Ständigen Vertreter (1. Teil)
Europäischer Fiskalpakt Auswirkungen
 Europäischer Fiskalpakt Auswirkungen Mitgliederversammlung SPD Lichtenrade-Marienfelde am 19.6.2012 Mechthild Rawert, MdB EU in der Krise Mechthild Rawert, MdB 20.06.2012 2 derzeitige Krise ist Folge der
Europäischer Fiskalpakt Auswirkungen Mitgliederversammlung SPD Lichtenrade-Marienfelde am 19.6.2012 Mechthild Rawert, MdB EU in der Krise Mechthild Rawert, MdB 20.06.2012 2 derzeitige Krise ist Folge der
KOMMUNEN DER ZUKUNFT WÄHLEN! STARK, SOZIAL, SOLIDARISCH!
 KOMMUNEN DER ZUKUNFT WÄHLEN! STARK, SOZIAL, SOLIDARISCH! Kommunen der Zukunft wählen! Am 11. September 2016 stellen die Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen die Weichen dafür, wie Städte, Gemeinden
KOMMUNEN DER ZUKUNFT WÄHLEN! STARK, SOZIAL, SOLIDARISCH! Kommunen der Zukunft wählen! Am 11. September 2016 stellen die Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen die Weichen dafür, wie Städte, Gemeinden
Gesetze, damit Sie wichtige Entscheidungen selbst treffen können
 Gesetze, damit Sie wichtige Entscheidungen selbst treffen können Inhalt dieses Buches In diesem Buch finden Sie: Worum es in diesem Buch geht Wichtiges, was Sie sich merken sollten Ihr Recht, selbst zu
Gesetze, damit Sie wichtige Entscheidungen selbst treffen können Inhalt dieses Buches In diesem Buch finden Sie: Worum es in diesem Buch geht Wichtiges, was Sie sich merken sollten Ihr Recht, selbst zu
Entschließung des Bundesrates "Jugendarbeitslosigkeit in der EU wirksam bekämpfen"
 Bundesrat Drucksache 554/13 (Beschluss) 05.07.13 Beschluss des Bundesrates Entschließung des Bundesrates "Jugendarbeitslosigkeit in der EU wirksam bekämpfen" Der Bundesrat hat in seiner 912. Sitzung am
Bundesrat Drucksache 554/13 (Beschluss) 05.07.13 Beschluss des Bundesrates Entschließung des Bundesrates "Jugendarbeitslosigkeit in der EU wirksam bekämpfen" Der Bundesrat hat in seiner 912. Sitzung am
Lohnbildung und Lohnentwicklung in Deutschland und ihr Beitrag zur Herstellung der Ungleichgewichte in Europa
 Lohnbildung und Lohnentwicklung in Deutschland und ihr Beitrag zur Herstellung der Ungleichgewichte in Europa Hans-Böckler-Stiftung, FATK, Universität Tübingen Symposium: Die Euro-Krise und das deutsche
Lohnbildung und Lohnentwicklung in Deutschland und ihr Beitrag zur Herstellung der Ungleichgewichte in Europa Hans-Böckler-Stiftung, FATK, Universität Tübingen Symposium: Die Euro-Krise und das deutsche
Generation Praktikum 2011 Es gilt das gesprochene Wort!
 Ingrid Sehrbrock Stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Generation Praktikum 2011 Es gilt das gesprochene Wort! Berlin, 04. Mai 2011 1 Sehr geehrte Damen und Herren, ohne Praktikantinnen
Ingrid Sehrbrock Stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Generation Praktikum 2011 Es gilt das gesprochene Wort! Berlin, 04. Mai 2011 1 Sehr geehrte Damen und Herren, ohne Praktikantinnen
Die Währungsunion ist krisenfester, als viele denken
 Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Eurozone 28.02.2017 Lesezeit 4 Min. Die Währungsunion ist krisenfester, als viele denken Die Schuldenkrise der Euroländer ist zwar noch nicht
Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Eurozone 28.02.2017 Lesezeit 4 Min. Die Währungsunion ist krisenfester, als viele denken Die Schuldenkrise der Euroländer ist zwar noch nicht
Mehrheit der Baden-Württemberger vermisst Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel
 Mehrheit der er vermisst Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel Die Mehrheit der Menschen in blickt zwar optimistisch in die Zukunft. Gleichzeit herrscht jedoch unter weiten Teilen der Bevölkerung der Eindruck
Mehrheit der er vermisst Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel Die Mehrheit der Menschen in blickt zwar optimistisch in die Zukunft. Gleichzeit herrscht jedoch unter weiten Teilen der Bevölkerung der Eindruck
Zahlen Daten Fakten zum 1. Mai 2013
 Herausgeber Deutscher Gewerkschaftsbund Bundesvorstand Abteilung Grundsatzangelegenheiten und Gesellschaftspolitik Henriette-Herz-Platz 2, 10178 Berlin Redaktion: Dr. Sigrid Bachler, Bianca Webler Redaktionsschluss:
Herausgeber Deutscher Gewerkschaftsbund Bundesvorstand Abteilung Grundsatzangelegenheiten und Gesellschaftspolitik Henriette-Herz-Platz 2, 10178 Berlin Redaktion: Dr. Sigrid Bachler, Bianca Webler Redaktionsschluss:
Europäisches Krisenmanagement und die Folgen für die Lohn- und Tarifpolitik in Europa
 Europäisches Krisenmanagement und die Folgen für die Lohn- und Tarifpolitik in Europa Thorsten Schulten IG Metall / Wissentransfer Debattenforum Steinbach, 20.-21. März 2015 Inhalt 1. Wirtschaftswachstum
Europäisches Krisenmanagement und die Folgen für die Lohn- und Tarifpolitik in Europa Thorsten Schulten IG Metall / Wissentransfer Debattenforum Steinbach, 20.-21. März 2015 Inhalt 1. Wirtschaftswachstum
WSI TARIFTAGUNG 2018
 EINLADUNG 10. 11. Dezember 2018, Düsseldorf WSI TARIFTAGUNG 2018 Tarifrunde 2018 neue tarifliche Regelungen zur Arbeitszeit flächendeckender Tarifvertrag in der Altenpflege 100 Jahre Tarifvertragsordnung
EINLADUNG 10. 11. Dezember 2018, Düsseldorf WSI TARIFTAGUNG 2018 Tarifrunde 2018 neue tarifliche Regelungen zur Arbeitszeit flächendeckender Tarifvertrag in der Altenpflege 100 Jahre Tarifvertragsordnung
Die Ausbildungsplatzsituation in Niedersachsen. DGB-Bezirk Niedersachsen Bremen Sachsen-Anhalt
 Die Ausbildungsplatzsituation in Niedersachsen DGB-Bezirk Niedersachsen Bremen Sachsen-Anhalt Ausbildungsjahr 2016 in der BA-Statistik Am 2.11. veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit die Zahlen für
Die Ausbildungsplatzsituation in Niedersachsen DGB-Bezirk Niedersachsen Bremen Sachsen-Anhalt Ausbildungsjahr 2016 in der BA-Statistik Am 2.11. veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit die Zahlen für
Die Ausbildungsplatzsituation. Analyse der Zahlen der BA im September 2011
 Die Ausbildungsplatzsituation Analyse der Zahlen der BA im September 2011 Die Situation im September 2011 70.000 Ausbildungsplätze fehlen 538.245 junge Menschen suchen einen Ausbildungsplatz und haben
Die Ausbildungsplatzsituation Analyse der Zahlen der BA im September 2011 Die Situation im September 2011 70.000 Ausbildungsplätze fehlen 538.245 junge Menschen suchen einen Ausbildungsplatz und haben
EUROBAROMETER 71 Die öffentliche Meinung in der Europäischen Union
 Standard Eurobarometer Europäische Kommission EUROBAROMETER 71 Die öffentliche Meinung in der Europäischen Union Frühjahr 2009 Standard Eurobarometer 71 / Frühjahr 2009 TNS Opinion & Social ZUSAMMENFASSUNG
Standard Eurobarometer Europäische Kommission EUROBAROMETER 71 Die öffentliche Meinung in der Europäischen Union Frühjahr 2009 Standard Eurobarometer 71 / Frühjahr 2009 TNS Opinion & Social ZUSAMMENFASSUNG
Wortformen des Deutschen nach fallender Häufigkeit:
 der die und in den 5 von zu das mit sich 10 des auf für ist im 15 dem nicht ein Die eine 20 als auch es an werden 25 aus er hat daß sie 30 nach wird bei einer Der 35 um am sind noch wie 40 einem über einen
der die und in den 5 von zu das mit sich 10 des auf für ist im 15 dem nicht ein Die eine 20 als auch es an werden 25 aus er hat daß sie 30 nach wird bei einer Der 35 um am sind noch wie 40 einem über einen
Öffentlich ist wesentlich. Die Zukunft kommunaler Dienstleistungen
 Öffentlich ist wesentlich Die Zukunft kommunaler Dienstleistungen Pakt für den Euro Schuldenbremse in nationales Recht Kontrolle der nationalen Budgets Anpassung Renteneintrittsalter Abschaffung Vorruhestandsregelungen
Öffentlich ist wesentlich Die Zukunft kommunaler Dienstleistungen Pakt für den Euro Schuldenbremse in nationales Recht Kontrolle der nationalen Budgets Anpassung Renteneintrittsalter Abschaffung Vorruhestandsregelungen
Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes zu den 27. Verbändekonsultationen der Monitoring-Stelle UN-BRK mit den behindertenpolitischen
 stellungnahme Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes zu den 27. Verbändekonsultationen der Monitoring-Stelle UN-BRK mit den behindertenpolitischen Verbänden Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
stellungnahme Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes zu den 27. Verbändekonsultationen der Monitoring-Stelle UN-BRK mit den behindertenpolitischen Verbänden Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
Zukunft in Bayern Europäischer Sozialfonds. Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung
 Zukunft in Bayern Europäischer Sozialfonds Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 2007-2013 Inhalt 1. Hintergründe und Fakten zum ESF 2. Das bayerische ESF Programm 3. So funktioniert der ESF
Zukunft in Bayern Europäischer Sozialfonds Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 2007-2013 Inhalt 1. Hintergründe und Fakten zum ESF 2. Das bayerische ESF Programm 3. So funktioniert der ESF
Mit Hilfe der Finanzkrise soll der europäische Sozialstaat abgebaut werden.
 Für ein solidarisches Europa - Kurswechsel jetzt! Demo am Freitag, 27.02., 17:00 Uhr - Bielefelder Rathausplatz Am 25. Januar haben die Menschen in Griechenland als erste mit SYRIZA eine Partei an die
Für ein solidarisches Europa - Kurswechsel jetzt! Demo am Freitag, 27.02., 17:00 Uhr - Bielefelder Rathausplatz Am 25. Januar haben die Menschen in Griechenland als erste mit SYRIZA eine Partei an die
Faire Bezahlung Für Gerechtigkeit im Job
 Faire Bezahlung Für Gerechtigkeit im Job 171 MAL mehr als ein durchschnittlicher Arbeitnehmer verdient ein VW-Topmanager. RUND 15,7 MILLIARDEN EURO Um diese Summe sollen neunzig Prozent der Beschäftigten
Faire Bezahlung Für Gerechtigkeit im Job 171 MAL mehr als ein durchschnittlicher Arbeitnehmer verdient ein VW-Topmanager. RUND 15,7 MILLIARDEN EURO Um diese Summe sollen neunzig Prozent der Beschäftigten
von Hermann Nehls, Thomas Gießler und Matthias Anbuhl
 Deutscher Gewerkschaftsbund Bundesvorstand stand Abteilung Bildungspolitik und Bildungsarbeit 09.09.2013 Duale Ausbildung als Exportschlager? Statusbericht zu Anspruch und Wirklichkeit der europäischen
Deutscher Gewerkschaftsbund Bundesvorstand stand Abteilung Bildungspolitik und Bildungsarbeit 09.09.2013 Duale Ausbildung als Exportschlager? Statusbericht zu Anspruch und Wirklichkeit der europäischen
ver.di Themen 1. Tarifrunde Rentenkampagne 3. Veranstaltungshinweis
 ver.di Themen 1. Tarifrunde 2017 2. Rentenkampagne 3. Veranstaltungshinweis Tarif- und Besoldungsrunde Länder 2017 Ergebnis Tarifpolitik öffentlicher Dienst Entgelterhöhungen: 1. Anhebung der Tabellenentgelte
ver.di Themen 1. Tarifrunde 2017 2. Rentenkampagne 3. Veranstaltungshinweis Tarif- und Besoldungsrunde Länder 2017 Ergebnis Tarifpolitik öffentlicher Dienst Entgelterhöhungen: 1. Anhebung der Tabellenentgelte
Entschließung des Bundesrates "Jugendarbeitslosigkeit in der EU wirksam bekämpfen"
 Bundesrat Drucksache 554/13 28.06.13 Antrag der Länder Baden-Württemberg, Hamburg Entschließung des Bundesrates "Jugendarbeitslosigkeit in der EU wirksam bekämpfen" Staatsministerium Baden-Württemberg
Bundesrat Drucksache 554/13 28.06.13 Antrag der Länder Baden-Württemberg, Hamburg Entschließung des Bundesrates "Jugendarbeitslosigkeit in der EU wirksam bekämpfen" Staatsministerium Baden-Württemberg
Die Europäische Union
 Die Europäische Union Die Mitgliedsländer der Europäischen Union Im Jahr 1957 schlossen sich die sechs Länder Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und das Königreich der Niederlande unter
Die Europäische Union Die Mitgliedsländer der Europäischen Union Im Jahr 1957 schlossen sich die sechs Länder Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und das Königreich der Niederlande unter
WO BLEIBEN DIE FRAUEN? Partizipation und Repräsentation von Frauen auf europäischer Ebene. PD Dr. Beate Hoecker
 WO BLEIBEN DIE FRAUEN? Partizipation und Repräsentation von Frauen auf europäischer Ebene PD Dr. Beate Hoecker Drei Fragen: Wie sind Frauen auf der europäischen Ebene repräsentiert? In welcher Weise beteiligen
WO BLEIBEN DIE FRAUEN? Partizipation und Repräsentation von Frauen auf europäischer Ebene PD Dr. Beate Hoecker Drei Fragen: Wie sind Frauen auf der europäischen Ebene repräsentiert? In welcher Weise beteiligen
Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik MEMORANDUM Europa am Scheideweg Solidarische Integration oder deutsches Spardiktat
 Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik MEMORANDUM 2012 Europa am Scheideweg Solidarische Integration oder deutsches Spardiktat PapyRossa Verlag 2012 by PapyRossa Verlags GmbH & Co. KG, Köln Luxemburger
Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik MEMORANDUM 2012 Europa am Scheideweg Solidarische Integration oder deutsches Spardiktat PapyRossa Verlag 2012 by PapyRossa Verlags GmbH & Co. KG, Köln Luxemburger
Lissabonner Erklärung zur Gesundheit am Arbeitsplatz in kleinen und mittleren Unternehmen KMU (2001)
 Lissabonner Erklärung zur Gesundheit am Arbeitsplatz in kleinen und mittleren Unternehmen KMU (2001) Diese Erklärung wurde vom ENBGF auf dem Netzwerktreffen am 16. Juni 2001 verabschiedet und auf der anschließenden
Lissabonner Erklärung zur Gesundheit am Arbeitsplatz in kleinen und mittleren Unternehmen KMU (2001) Diese Erklärung wurde vom ENBGF auf dem Netzwerktreffen am 16. Juni 2001 verabschiedet und auf der anschließenden
Auf dem Weg zu einem Referenzmodell? Thomas Mayr
 Auf dem Weg zu einem Referenzmodell? Thomas Mayr 07.06.2018 Anteil der Jugendlichen im Sekundarbereich II in berufsbildenden und allgemeinbildenden Bildungsgängen Bildungsbeteiligung im Sekundarbereich
Auf dem Weg zu einem Referenzmodell? Thomas Mayr 07.06.2018 Anteil der Jugendlichen im Sekundarbereich II in berufsbildenden und allgemeinbildenden Bildungsgängen Bildungsbeteiligung im Sekundarbereich
Ergebnisse der Betriebsrätebefragung Junge Generation Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 Detlef Wetzel Zweiter Vorsitzender der IG Metall Zukunft und Perspektiven für die junge Generation Ergebnisse der Betriebsrätebefragung Junge Generation Vereinbarkeit von Familie und Beruf Repräsentative
Detlef Wetzel Zweiter Vorsitzender der IG Metall Zukunft und Perspektiven für die junge Generation Ergebnisse der Betriebsrätebefragung Junge Generation Vereinbarkeit von Familie und Beruf Repräsentative
BULLETIN DER BUNDESREGIERUNG
 BULLETIN DER BUNDESREGIERUNG Nr. 128-2 vom 14. Dezember 2006 Rede des Bundesministers für Arbeit und Soziales, Franz Müntefering, zum RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz vor dem Deutschen Bundestag am 14.
BULLETIN DER BUNDESREGIERUNG Nr. 128-2 vom 14. Dezember 2006 Rede des Bundesministers für Arbeit und Soziales, Franz Müntefering, zum RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz vor dem Deutschen Bundestag am 14.
Rede der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Annette Schavan, MdB, anlässlich der Debatte zum Berufsbildungsbericht 2012
 Rede der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Annette Schavan, MdB, anlässlich der Debatte zum Berufsbildungsbericht 2012 am 18. Oktober 2012 im Deutschen Bundestag Es gilt das gesprochene
Rede der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Annette Schavan, MdB, anlässlich der Debatte zum Berufsbildungsbericht 2012 am 18. Oktober 2012 im Deutschen Bundestag Es gilt das gesprochene
Übergänge Neue Chancen Neue Wege?
 Übergänge Neue Chancen Neue Wege? clement@uni-kassel.de Übergangssystem in der Kritik Weder Übergang Diffuse Zielsetzungen Keine Verbesserung Einstellungschancen Verzögerter Übergang in Ausbildung Cooling
Übergänge Neue Chancen Neue Wege? clement@uni-kassel.de Übergangssystem in der Kritik Weder Übergang Diffuse Zielsetzungen Keine Verbesserung Einstellungschancen Verzögerter Übergang in Ausbildung Cooling
Strategie zum Kurswechsel in Europa
 Strategie zum Kurswechsel in Europa - Wachstum fördern, Beschäftigung sichern, Europe stabilisieren- Tagung der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik Ver.di Bildungsstätte Das Bunte Haus, Bielefeld-Sennestadt,
Strategie zum Kurswechsel in Europa - Wachstum fördern, Beschäftigung sichern, Europe stabilisieren- Tagung der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik Ver.di Bildungsstätte Das Bunte Haus, Bielefeld-Sennestadt,
Ein soziales Europa EIN SOZIALES EUROPA. 1 #SocialRights. #SocialRights
 EIN SOZIALES EUROPA 1 #SocialRights #SocialRights Ich möchte ein Europa mit einem sozialen Triple-A. Ein soziales Triple-A ist genauso wichtig wie ein wirtschaftliches und finanzielles Triple-A. Jean-Claude
EIN SOZIALES EUROPA 1 #SocialRights #SocialRights Ich möchte ein Europa mit einem sozialen Triple-A. Ein soziales Triple-A ist genauso wichtig wie ein wirtschaftliches und finanzielles Triple-A. Jean-Claude
Der Rettungsschirm funktioniert
 Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Eurokrise 04.06.2015 Lesezeit 4 Min Der Rettungsschirm funktioniert Die Medizin hilft, aber der Patient muss sie auch schlucken, so lautet das
Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Eurokrise 04.06.2015 Lesezeit 4 Min Der Rettungsschirm funktioniert Die Medizin hilft, aber der Patient muss sie auch schlucken, so lautet das
ANSÄTZE ZUR STÄRKUNG DER TARIFBINDUNG IN DEUTSCHLAND
 ANSÄTZE ZUR STÄRKUNG DER TARIFBINDUNG IN DEUTSCHLAND Dr. Thorsten Schulten ver.di Wahlangestelltenklausur 16. Juni 2016, Berlin Inhalt 1. Tarifverträge in Deutschland: Anhaltende Erosion der Tarifbindung
ANSÄTZE ZUR STÄRKUNG DER TARIFBINDUNG IN DEUTSCHLAND Dr. Thorsten Schulten ver.di Wahlangestelltenklausur 16. Juni 2016, Berlin Inhalt 1. Tarifverträge in Deutschland: Anhaltende Erosion der Tarifbindung
// Berufsausbildung für Europas Jugend
 // Berufsausbildung für Europas Jugend Voneinander lernen, miteinander gestalten Fachtagung Mehr Chancen für Europas Jugend Der Beitrag der Berufsausbildung, 21. Oktober 2015, Berlin Dirk Werner Stimmen
// Berufsausbildung für Europas Jugend Voneinander lernen, miteinander gestalten Fachtagung Mehr Chancen für Europas Jugend Der Beitrag der Berufsausbildung, 21. Oktober 2015, Berlin Dirk Werner Stimmen
Starkes Bayern starkes Europa Deutschlands Rolle in der Europäischen Union
 Starkes Bayern starkes Europa Deutschlands Rolle in der Europäischen Union Freitag, 22.09.2017 um 15:00 Uhr hbw Haus der Bayerischen Wirtschaft, Conference Area, Europasaal Max-Joseph-Straße 5, 80333 München
Starkes Bayern starkes Europa Deutschlands Rolle in der Europäischen Union Freitag, 22.09.2017 um 15:00 Uhr hbw Haus der Bayerischen Wirtschaft, Conference Area, Europasaal Max-Joseph-Straße 5, 80333 München
Berufliche Bildung im europäischen Vergleich
 Berufliche Bildung im europäischen Vergleich Wer kann von wem lernen? Würzburg, 14.11.2018 / Dr. Regina Flake Agenda 1 2 3 International vergleichende Berufsbildungsforschung Wie vergleicht man Äpfel und
Berufliche Bildung im europäischen Vergleich Wer kann von wem lernen? Würzburg, 14.11.2018 / Dr. Regina Flake Agenda 1 2 3 International vergleichende Berufsbildungsforschung Wie vergleicht man Äpfel und
Jugendarbeitslosigkeit in Europa Handlungsbedarfe für die deutsche Kinderund Jugendhilfe
 1. Einführung Jugendarbeitslosigkeit in Europa 2. Ausgangslage und Problemstellung Jugendarbeitslosigkeit in Europa Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland Duales System für Europa? 3. Aktuelle Situation
1. Einführung Jugendarbeitslosigkeit in Europa 2. Ausgangslage und Problemstellung Jugendarbeitslosigkeit in Europa Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland Duales System für Europa? 3. Aktuelle Situation
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Hauptvorstand GEW Positionen zur Schulsozialarbeit
 Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Hauptvorstand GEW Positionen zur Schulsozialarbeit Ausbau und dauerhafte Absicherung Qualifikation, Arbeitsbedingungen und Bezahlung Beschlüsse des GEW Gewerkschaftstages
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Hauptvorstand GEW Positionen zur Schulsozialarbeit Ausbau und dauerhafte Absicherung Qualifikation, Arbeitsbedingungen und Bezahlung Beschlüsse des GEW Gewerkschaftstages
WELCHEN EINFLUSS HAT DIE TARIFPOLITIK AUF DIE EINKOMMENSVERTEILUNG?
 WELCHEN EINFLUSS HAT DIE TARIFPOLITIK AUF DIE EINKOMMENSVERTEILUNG? Prof. Dr. Thorsten Schulten IAW DGB Arbeitnehmerkammer Tarifpolitik gegen soziale Ungleichheit Potenziale und Herausforderungen 18./19.
WELCHEN EINFLUSS HAT DIE TARIFPOLITIK AUF DIE EINKOMMENSVERTEILUNG? Prof. Dr. Thorsten Schulten IAW DGB Arbeitnehmerkammer Tarifpolitik gegen soziale Ungleichheit Potenziale und Herausforderungen 18./19.
