Rupprecht Karls-Universität Heidelberg
|
|
|
- Ilse Friedrich
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Rupprecht Karls-Universität Heidelberg Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Institut für Politsche Wissenschaft Entstehungs- und Eskalationsfaktoren politischer Konflikte Eine Untersuchung des globalen Konfliktpanoramas Eingereicht von Nicolas Schwank, Heidelberg Betreuer: Prof. Dr. Uwe Wagschal Prof. Dr. Frank Pfetsch Dissertation zur Erlangung des Grades eines Dr. rer.pol eingereicht an der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Ruprecht Karls-Universität Heidelberg Heidelberg, im Juli 2008
2 Bei der hier vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine sprachlich überarbeitete und inhaltlich gestraffte Version der im Juli 2008 eingereichten Dissertation. 2
3 Inhalt 1 Einleitung: Wie entstehen Kriege? Aufbau der Arbeit Daten und Datenerhebung Danksagung Was sind Kriege? Wie werden Kriege gemessen? Kriegsdefinitionen über Schwellenwerte Kritik an der Verwendung von Todesopferdaten Sind quantitative Schwellenwertansätze übertragbar auf Raum und Zeit? Was sind relevante Todesopfer? Qualitative Konfliktbewertung Die Event Daten Analyse Einstufung in Konfliktintensitäten Kritik an der Data Event-Analyse Forschungsüberblick: Quantitative Konfliktdatensätze im Vergleich Das Correlates of War Projekt Das International Crises Behaviour Projekt (ICB) Das KOSIMO Projekt Die State Failure Political Instability Task Force Zusammenfassung : Abwägung zwischen quantitativen und qualitativen Ansätzen Defizite des aktuellen Kriegsbegriffs Verschwindet der zwischenstaatliche Krieg? Die anhaltende Brisanz des zwischenstaatlichen Krieges Die Ausdifferenzierung des Militärwesens Die Revolution in Military Affairs und der Information Warfare Die Ausbreitung der Demokratie und die Veränderung der Kriegsführung Internationaler Terrorismus Zusammenfassung: Innerstaatliche Kriege Die Diskussion um Neue Kriege Entstaatlichung des Krieges und die Bedeutung nichtstaatlicher Akteure 53 3
4 Die Ökonomisierung der Kriege Konfliktaustrag Komplexe Konfliktsituationen Gegenrede zu den Neuen Kriegen: Gleichzeitigkeit unterschiedlichen Konfliktaustrags Clausewitz als Ausgangspunkt eines modernen Kriegsverständnisses Person und Werk Historischer Hintergrund Schriften Die Natur des Krieges bei Clausewitz Wechselwirkungen zum absoluten Krieg Die Modifikation der Wirklichkeit: die Ausdifferenzierung des Krieges Die Bedeutung der Politik im Krieg Die Unterschiede des Kriegsbegriffs: Absolute und begrenzte Kriege Der Krieg als Chamäleon Die wunderliche Dreifaltigkeit Kritik am Clausewitzschen Kriegsbegriff Der Beitrag Clausewitz für ein modernes Kriegsverständnis Wie entstehen Kriege? Analysen der klassischen Kriegsursachenforschung Erklärungsansätze für zwischenstaatliche Kriege Erklärungsansätze auf der ersten Ebene: Das Internationale System als Einflussfaktor für das Entstehen von Kriegen Realismus / Neorealismus Liberale Ansätze Idealismus Soziologische Aspekte / Soziologischer Liberalismus Interdependenz / ökonomische Ansätze Veränderung des Internationalen Systems - Bedeutung nicht-staatlicher Akteure Verbindung der liberalen Ansätze: The Triangulating Peace Ansätze auf der zweiten Ebene: Der Staat als Bezugsrahmen Regimeanalyse: Der demokratische Friede Geografische Lage Ansätze auf der dritten Ebene: die Entscheider Erklärungsansätze für innerstaatliche Kriege Das internationale System als Erklärungsebene 101 4
5 Innerstaatliche Kriegsursachenansätze auf der zweiten Ebene Heterogenität des Staatsvolks Ökonomische Ansätze Politisches Regime Schwache Staatlichkeit Die dritte Ebene in innerstaatlichen Kriegsursachenanalysen: Individuen und Elite Erweiterung der Analyseebene: Konfliktbezogene Ansätze Konfliktthemen und Konfliktgüter Ansteckung und Verbreitung von Kriegen Regionale Konfliktaustragungsmuster Konflikterbe: Enduring Rivalry Multiparty Ansätze Das Verhalten von Konflikten Dynamiken des Konfliktgeschehens Ansätze der Konfliktfrühwarnung Ziele der Konfliktfrühwarnung Modelle der Konfliktfrühwarnung Strukturelle Modelle Ereignismodelle Conjunctural Models Zusammenfassung: Der Stand der Kriegsursachenforschung Folgerung: Risikoabschätzung statt Ursachenforschung Einsatzmöglichkeiten der Risikoforschung Möglichkeiten eines Ereignis-basierten Konfliktrisikomodells Entwicklungsdynamik als Ziel der Risikoanalyse Einflussfaktoren im Ereignisdaten-Modell Formulierung der Untersuchungshypothesen: Der CONIS-Ansatz Ziele und Bestandteile von CONIS Das CONIS-Konfliktmodell Politische Konflikte als soziale Systeme Theoretische Verortung Prozesse und Struktur im Konfliktsystem Die Prozess-Ebene des Konfliktes: Kommunikation Die Struktur-Ebene des Konfliktes Die Bestimmung politischer Konflikte Abgrenzung politscher Konflikte von alltäglichen Konflikten Definition politischer Konflikte 149 5
6 Bestimmung einzelner Konflikte in komplexen Konfliktsituationen Beginn und Ende von Konflikten und Konfliktphasen Transformation von Konflikten und deren Fortführung Das empirische Konfliktmodell Konstante und eindeutige Zuschreibungen ID und Konfliktname Konfliktbeginn, Konfliktende Region Inner- oder zwischenstaatlicher Charakter eines Konfliktes Dynamische Komponenten politischer Konflikte Bestimmung von Konfliktmaßnahmen Informationsquellen Systematisierung der Konfliktmaßnahmen Vergleichbarkeit und Definition der erfassten Maßnahmen Struktur des Maßnahmencodes Die Intensität von Konflikten Die zwei Spielarten des Krieges Krisensituationen in Konflikten Das dynamische Intensitäten-Modell Definitionen der einzelnen Intensitätsstufen Bestimmung der Konfliktstufen über Schlüsselereignisse Die umstrittenen Güter eines Konfliktes Politische Konflikte und die Dimensionen des Staatsbegriffes Der Staatsgebietkonflikt Der Staatsgewaltkonflikt Der Staatsvolkkonflikt Akteure Staatliche und nichtstaatliche Akteure in politischen Konflikten Direkt beteiligte Parteien Unterstützende Parteien Einmischung von Dritter Seite: Interventionskräfte Geografische Ausdehnung eines Konfliktes Politische, Militärische, Territoriale Ergebnisse eines Konfliktes Todesopfer und Flüchtlinge Zusammenfassung und Bewertung 182
7 4.3 Informationen in CONIS Die Systemkomponente in CONIS Empirische Auswertungen zum Konfliktgeschehen Globale Konfliktübersicht Strukturen Das Konfliktgeschehen im Überblick: Veränderungen während des Untersuchungszeitraums Entwicklung der globalen Konfliktkennziffern Verlauf gewaltloser Konflikte Verlauf von gewaltsamen Konflikten Entwicklung inner- und zwischenstaatlicher kriegerischer Konflikte Zwischenstaatliche Konflikte Zwischenstaatliche Konflikte - Begriffsbestimmung Analyse des zwischenstaatlichen Konfliktgeschehens Globale Entwicklung zwischenstaatlicher Konflikte Innerstaatliche Konflikte Begriffsbestimmung Analyse des innerstaatlichen Konfliktgeschehens Globale Entwicklung innerstaatlicher Konflikte Konflikte mit Adjektiven Subtypen politischer Konflikte Regionale Konfliktentwicklung Einfache oder komplexe Konstellationen in Konflikten Akteurskonstellation in innerstaatlichen Konflikten Akteurskonstellation in innerstaatlichen kriegerischen Konflikten Akteurskonstellation in zwischenstaatlichen Konflikten Kurze und lange politische Konflikte Gesamtdauer innerstaatlicher Konflikte Gesamtdauer zwischenstaatlicher Konflikte Gewaltsame Konfliktphasen Dauer der Gewaltphasen innerstaatlicher Konflikte Verlaufsanalyse der Gewaltphase innerstaatlicher Konflikte Dauer der Gewaltphasen zwischenstaatlicher Konflikte Verlaufsanalyse der Gewaltphase innerstaatlicher Konflikte Zusammenfassung die Dauer von Konflikten 236 7
8 5.4.5 Umstrittene Gegenstände in Konflikten Konfliktgegenstände in zwischenstaatlichen Konflikten Konfliktgegenstände in innerstaatlichen Konflikten Zusammenfassung: Bedeutung der Konfliktgegenstände Politische Konflikte und betroffene Staaten Entwicklung des Staatensystems Das Paradoxon des Neo-Realismus: Entwicklung des Staatensystems und Konfliktgeschehens im regionalen Vergleich Konfliktbelastung der Staaten Anzahl der Staaten mit Kriegsbelastung im Verlauf Einfluss des politischen Systems Kriegsanfälligkeit von Staaten nach Regierungssystemen Zusammenfassung: Staaten und Kriege Risikoanalyse: Die Gefahr der Eskalation neuer Kriege Ereignisdatenanalyse als Instrument der Konfliktfrühwarnung Häufigkeit von Kriegsausbrüchen Neu eskalierte kriegerische Konflikte im Beobachtungszeitraum Wie beginnen kriegerische Konflikte? Eskalationswege: Die Intensitätsstufe vor Ausbruch des Krieges Das Eskalationsrisiko eines neuen politischen Konflikts Verwendete Methode Die Eskalationswahrscheinlichkeit politischer Konflikte Vorbereitende Veränderungen des Datensatzes: Zensierung der Daten Vom Disput zum Krieg: Durchschnittliche Eskalationszeiten aller erfassten Konflikte Die Eskalationszeit von Kriegen Risikofaktoren für die Eskalationszeiten innerstaatlicher Konflikte Das Erklärungsmodell Bestimmung des Konfliktanreizes Bestimmung der Konfliktbewältigungskapazität Demokratisierungsgrad des betroffenen Staates Kriegsbelastung der Staaten Ansteckungseffekte innerhalb von Regionen Veränderung innerhalb der Untersuchungsperiode Anwendung der Cox-Regressionsanalyse Ergebnisse der Cox Regressiom Der Konfliktimpuls Analyse des Konfliktbewältigungspotenzials Konflikte als selbstreferentielle Rahmen Regionen als Bezugsgröße 303 8
9 6.5.5 Historische Umstände Zusammenfassung der Ergebnisse Supplement: Eskalationsanfälligkeit nach Gewaltausbruch Fazit Theorie Empirische Ergebnisse Risikoanalyse Zukünftige / verbleibende Arbeiten Zusammenfassung und Ausblick 315 Anhang 318 Staatenliste in CONIS mit Zuteilung der Region 318 Länder in Europa 318 Länder in Afrika 320 Länder in Amerika 321 Länder in Asien 323 Länder in der Region Vorderer und Mittlerer Orient 325 Liste der durch die Zensierung herausgefallenen Konfliktfälle 326 Literaturverzeichnis 329 9
10 Verzechnis der Tabellen und Abbildungen Tabelle 1: Akteurskonstellation und Typologisierung Tabelle 2: Bestimmung von Intensitätsklassen Tabelle 3: Beispiele für notwendige Schlüsselereignisse zur Bestimmung von Konfliktintensitäten Tabelle 4: Übersicht über die in CONIS codierbaren Konfliktgegenstände Tabelle 5: CONIS - Globale Konfliktzahlen nach Intensitätsstufen Tabelle 6: Dauer der Gewaltphasen in innerstaatlichen Konflikten Tabelle 7: Dauer gewaltsamer Phasen in innerstaatlichen Konflikten auf mittlerer Intensität nach Dekaden Tabelle 8: Dauer gewaltsamer Phasen in innerstaatlichen Konflikten auf kriegerischer Intensität nach Dekaden Tabelle 9: Dauer der Gewaltphasen in zwischenstaatlichem Konflikten Tabelle 10: Dauer zwischenstaatlicher Konflikte mittlerer Intensität nach Dekaden Tabelle 11: Dauer zwischenstaatlicher kriegerischer Konfliktphasen nach Dekaden Tabelle 12: Eskalationsanfälligkeit von Konfliktgegenständen - Gesamtüberblick für inner- und zwischenstaatliche Konflikte. Angaben in Prozent Tabelle 13: Kriegsbelastungsindikator nach Regierungssystem Tabelle 14: Erste erfasste Intensitätsstufe kriegerischer Konflikte Tabelle 15: Eskalationssprünge nicht gewaltsamer Konflikte auf Kriegsniveau Tabelle 16: Überblick Fallauswahl für Kaplan-Meier-Analyse (Konflikte ohne Vorwarnzeit ausgeschlossen) Tabelle 17: Eskalierte und beendete innerstaatliche Konflikte Tabelle 18: Eskalierte und beendete zwischenstaatliche Konflikte Tabelle 19: Schätzwerte für die Dauer bis zum Ausbruch kriegerischer Gewalt für inner- und zwischenstaatliche Konflikte Tabelle 20: Log-rank Test für alle erfassten inner- und zwischenstaatlichen Konflikte mit Vorlaufzeit Tabelle 21: Überblick Fallauswahl für Kaplan-Meier Analyse der kriegerisch eskalierten Konflikte (Konflikte ohne Vorwarnzeit ausgeschlossen). 286 Tabelle 22: Eskalationszeiten aller kriegerischen inner- und zwischenstaatlichen Konflikte im Vergleich Tabelle 23: Mittelwerte und Mediane zur Eskalationszeit (nur Kriege) Tabelle 24: Log-rank Test für alle erfassten inner- und zwischenstaatlichen Konflikte mit Vorlaufzeit Tabelle 25: Klassifikation der Polity IV Werte Tabelle 26: Wegen fehlender Polity IV Daten aus Cox Regression entfernte Konflikte Tabelle 27: Werte der Clusterwerte für Staaten mit Konfliktbelastung Tabelle 28: Anzahl, Unterscheidung und Häufigkeiten der Kovariaten in der Cox-Analyse (innerhalb der 325 untersuchten innerstaatlichen Konflikte)
11 Tabelle 29: Signifikanzwerte der Kovariablen für die Eskalationszeiten kriegerischer Konflikte Tabelle 30: Einfluss auf das Eskalationsrisiko der Konfliktimpuls Tabelle 31: Einfluss auf das Eskalationsrisiko - Konfliktrahmen I: Regimetyp Tabelle 32: Einfluss auf das Eskalationsrisiko - Konfliktbelastung des Staates Tabelle 33: Einfluss auf das Eskalationsrisiko - Konfliktrahmen II: Konfliktregion Tabelle 34: Einfluss auf das Eskalationsrisiko Der Konfliktbeginn Tabelle 35: Anzahl der Eskalationen auf kriegerisches Konfliktniveau unterschieden nach inner- und zwischenstaatlichen Konfliktjahren und Konfliktphasen Abbildungen Abbildung 1: Kontext der Konfliktkommunikation Abbildung 2: Einfaches Kommunikationsmodell Abbildung 3: Muster zur Analyse komplexer Konfliktsysteme Abbildung 4: Das dynamische Konfliktmodell Abbildung 5 Schematischer Aufbau der CONIS Datenbank Abbildung 6: Verteilung aller CONIS Konflikte nach der höchsten gemessen Intensität Abbildung 7: Gesamtüberblick Konfliktpanorama Abbildung 8: Globale Entwicklung gewaltloser Konflikte (Stufe 1+2) Abbildung 9: Globale Entwicklung gewaltsamer Konflikte (Stufe 3+4+5) Abbildung 10: Entwicklung inner- und zwischenstaatlicher gewaltsamer Konflikte Abbildung 11: Höchste erreichte Eskalationsstufe zwischenstaatlicher Konflikte 202 Abbildung 12: Globale Entwicklung zwischenstaatlicher Konflitke Abbildung 13: Zwischenstaatliche Konflikte - Entwicklung der gewaltsamen Intensitätsstufen (3, 4 und 5) Abbildung 14: Höchste erreichte Intensität innerstaatlicher Konflikte Abbildung 15: Globale Entwicklung innerstaatlicher Konflikte Abbildung 16: Entwicklungslinien der gewaltsamen innerstaatlichen Konflikte nach einzelnen Stufen 1945 bis Abbildung 17: Anzahl inner- und zwischenstaatlicher gewaltsamer Konflikte nach Regionen Abbildung 18: Kriegerische Konflikte zwischen 1945 und 2005 nach Regionen Abbildung 19: Anzahl der beteiligten staatlichen und nichtstaatlichen Akteure an inner- und zwischenstaatlichen gewaltsamen Konflikten Abbildung 20: Durchschnittliche Anzahl von Akteursdyaden in innerstaatlichen kriegerischen Konflikten Abbildung 21: Durchschnittliche Anzahl von Akteurskonstellationen in zwischenstaatlichen kriegerischen Konflikten
12 Abbildung 22: Durchschnittliche Gesamtdauer von Konflikten nach höchster erreichter Intensität Abbildung 23: Konfliktdauer innerstaatlicher Konflikte unterschieden nach beendeten und laufenden Konflikten Abbildung 24: Konfliktdauer zwischenstaatlicher Konflikte unterschieden nach beendeten und laufenden Konflikten Abbildung 25: Durchschnittliche Konfliktdauer innerstaatlicher kriegerischer Konflikte und innerstaatlicher Konflikte auf mittlerer Intensität nach Dekaden Abbildung 26: Konfliktdauer (Durchschnitt) zwischenstaatlicher kriegerischer Konflikte und zwischenstaatlicher Konflikte auf mittlerer Intensität nach Dekaden Abbildung 27: Anteil der Gewaltphasen an der Gesamtkonfliktdauer für innerund zwischenstaatliche Konflikte Abbildung 28: Häufigkeiten und Eskalationsanfälligkeit von Konfliktgütern in der Gesamtübersicht für inner- und zwischenstaatliche Konflikte. 240 Abbildung 29: Häufigkeiten und Eskalationsanfälligkeit von Konfliktgütern in der Gesamtübersicht für zwischenstaatliche Konflikte Abbildung 30: Konfliktgegenstände in kriegerischen zwischenstaatlichen Konflikten Abbildung 31: Häufigkeit und Eskalationsanfälligkeit von Konfliktgegenständen in innerstaatlichen Konflikten Abbildung 32: Entwicklung ausgewählter Konfliktgüter in innerstaatlichen kriegerischen Konflikten Abbildung 33: Entwicklung des Staatensystems Abbildung 34: Entwicklung des Staatensystems nach Regionen Abbildung 35: Staatensystem, inner- und zwischenstaatliche Kriege ( ) Abbildung 36: Verteilung der Kriegslast auf Staaten Abbildung 37: Verteilung der Gesamtkriegsbelastung auf Ländergruppen Abbildung 38: Anzahl innerstaatlicher kriegerischer Konflikte und Anzahl der betroffenen Staaten Abbildung 39: Entwicklung der Regierungssysteme nach Polity IV (160 Staaten) Abbildung 40: Verteilung der Gesamt-Kriegsbelastung von Staaten nach Polity IV Werten Abbildung 41: Kriegsanfälligkeit von Staaten nach Regierungssystemen Abbildung 42: Anzahl der von Kriegen betroffenen Staaten nach Regierungssystem Abbildung 43: Altersstruktur inner- und zwischenstaatlicher kriegerischer Konflikte Abbildung 44: Anzahl der neu eskalierten Kriege pro Jahr Abbildung 45: Intensitätsstufen unmittelbar vor Ausbruch kriegerischer Gewalt. 272 Abbildung 46: Wahrscheinlichkeit einer nicht-kriegerischen Fortführung aller in CONIS erfassten Konflikte
13 Abbildung 47: Wahrscheinlichkeit einer nicht-kriegerischen Fortführung aller in CONIS erfassten Kriege Abbildung 48: Anfälligkeit inner- und zwischenstaatlicher kriegerischer Konflikte für erneute Eskalation in Nachkriegssituationen Analyse von Konfliktphasendaten
14 14
15 1 Einleitung: Wie entstehen Kriege? Die Frage nach den Gründen und Ursachen die zum Entstehen von Kriegen führen ist die zentrale Frage der quantitativen empirischen Konfliktforschung. Doch trotz jahrzehntelanger Forschung zu Kriegen und Kriegsursachen sind die bisherigen Ergebnisse der Forschungsdisziplin noch immer unbefriedigend: Die Ergebnisse gelten als ideenloses Zahlenwerk (Schlichte 2002) oder als Theorieinseln, die jeweils nur eng begrenzte Fälle erklären können, die aber bisher von niemanden zu einer Gesamttheorie vernetzet werden konnten (Singer 2000). Hegre / Sambanis (2006) weisen zudem darauf hin, dass bei Replikationsstudien zur Ursache innerstaatlicher Kriege kaum eines der Ergebnisse bestätigt werden könne. Somit stellt sich die Frage nach den zu Grunde liegenden Ursachen dieser schwachen Performanz der quantitativen Ansätze. Einige Forscher (Dessler 1991; Hoffmann 1987; Schlichte 2002) sehen in den zu einfachen Erklärungsmodellen den Hauptgrund für die geringe Erklärungskraft quantitativer Ansätze. Immer wieder werde versucht, mit überwiegend dem politischen Realismus entlehnten Ansätzen die komplexe Ursachenstruktur von Kriegen zu erklären (kritisch hierzu: Hasenclever 2002). Andere Autoren (Sofsky 1996; Kaldor 1999) melden Zweifel an, ob sich die derzeit beobachtbaren innerstaatlichen Kriege über Modelle, die auf Nutzenmaximierung und rationale Handlungsweisen der Akteure rekurrieren, sinnvoll zu erklären seien. Doch der Vorwurf einfacher Erklärungsansätze tritt für einige Arbeiten der letzten Jahre nicht mehr zu. Verschiedene Autoren, darunter besonders die Arbeiten der Forschungsgruppe um Collier (Collier, et al. 2003; Collier / Hoeffler 2004b; Collier / Sambanis 2005), Fearon / Laitin (James D. Fearon / David D. Laitin 2003; Fearon 2005; Fearon, et al. 2007) und Hegre (Hegre 2003; Hegre, et al. 2001; Hegre / Gledditsch 2001) haben in aufwendigen Untersuchungen verschiedene Erklärungsansätze mit Hilfe von Regresssionsverfahren gegeneinander getestet und einzelne Variablen als signifikant erkannt. Allerdings besteht hierbei das bereits oben angeführte Problem, dass sich diese Ergebnisse in Vergleichsstudien meist nicht bestätigen lassen, sich teilweise sogar widersprechen (Hegre / Sambanis 2006). Der Grund für die unterschiedlichen Ergebnisse liegt an den unterschiedlichen Datensätzen, die die Autoren ihren Auswertungen zugrunde legen. Das primäre Problem der quantitativen Konfliktforschung, dies ist die grundlegende These dieser Arbeit, ist deshalb nicht der Mangel an Erklärungsmodellen, sondern die unzureichende Antwort auf die Frage nach der abhängigen Var- 15
16 iable: Was sind Kriege? Hier herrscht innerhalb der großen Breite der quantitativen Konfliktforschung merkwürdigerweise nur ein selten offen vorgetragenes Problembewusstsein vor: Die in den Theorien der Internationalen Beziehungen geführten Debatten über Bestimmungsmerkmale und Veränderungen des Krieges (Van Crefeld 1991; Kaldor 1999; Münkler 2002; Duyvesteyn / Angstrom 2005; Geis 2006) werden in der quantitativen Konfliktforschung eher beiläufig wahrgenommen (Brzoska 2004). Die Bedenken quantitativer Forscher gegen die Zuverlässigkeit der veröffentlichten Daten äußern sich vor allem in der ständigen Zusammenstellung immer neuerer speziellerer Datensätze, die für einzelne Untersuchungen verwendet werden (vgl. hierzu auch Eck 2005). Allerdings ist die Beobachtung, dass der Grund für die Mängel und Schwierigkeiten der quantitativen Konflikt- und Kriegsursachenforschung vor allem in der Qualität der Verfügung stehenden Daten zu suchen ist, nicht neu. Bereits Rummel (1979:19) gibt zu Bedenken, dass die angesprochenen Probleme und Widersprüche der quantitativen empirischen Konfliktforschung inhärent sind, weil diese selbst eine Vielzahl unterschiedlicher Methoden bei der Messung von Größe oder Auswirkung von Konflikten verwendet. Rummel gibt sich überzeugt, dass quantitative Konfliktforschung niemals ohne einen philosophischen und analytischen Bezugsrahmen auskommt. Fakten, Ereignisse, und Geschichte könnten nicht einfach quantitativ erfasst werden (Rummel 1979:18), es bedürfe der Interpretation eines analytischen Sachverstandes, der die jeweiligen Ereignisse in ihrer Bedeutung bemessen und bewerten kann. Es fehlt also eines methodischen Bezugsrahmen, der hilft, wichtige von unwichtigen Ereignissen und Konflikten zu unterscheiden (vgl. hierzu auch Daase 1999; Sambanis 2001b). Deshalb verfolgt die vorliegende Arbeit zwei Ziele. 1.) Mit Hilfe eines neuen Konfliktmodells und seiner Umsetzung als Datenbankmodell soll die Kluft zwischen empirischem Konfliktbegriff und der Konfliktwirklichkeit (Daase 2003:164) überwunden werden. Bei der Entwicklung des Modells gilt es, die entsprechenden Rahmenbedingungen, unter denen ein Konflikt ausgetragen wird zu beachten und in die Bewertung mit einzubeziehen. 2) Es soll ein Erklärungsrahmen für das Entstehen von Kriegen angeboten werden, der weitreichender als die bisherigen ist. Statt auf kausale Erklärungsmodelle zurückzugreifen, soll dieser neue Ansatz stärker auf die verstehende Perspektive der Analyse setzen (Pfetsch 1993). Das Ziel dieses hier vorgestellten Ansatzes soll es jedoch nicht sein, deterministische Kausalketten zu formulieren. Stattdessen sollen auf Grundlage des neuen Konfliktmodells die Strukturen und Dynamiken von zwischenstaatlichen und innerstaatlichen Kriegen analysiert werden können und somit letztlich zur Risikoabschätzung von Kriegen führen. Die Frage nach dem Risiko einer bestehenden Konfliktsituation ist trotz der großen Relevanz und starker Anstrengungen im bereich der Konfliktfrüherkennung bisher nur wenig bearbeitet worden. Viele 16
17 der früheren Arbeiten beziehen sich fast ausschließlich auf zwischenstaatliche Konflikte (Raknerud / Hegre 1997; Bremer 1992; Green, et al. 2001). Die erzielten Ergebnisse gelten insgesamt jedoch als unbefriedigend. Auch deshalb, weil eine Vielzahl dieser Studien unter erheblichen methodischen Defiziten leiden. Bremer (1992) kritisiert beispielsweise die geringe Fallanzahl in den Untersuchungen und das oftmals monokausal angelegte Forschungsdesign. 1.1 Aufbau der Arbeit Die beiden übergeordneten Zielsetzungen der Arbeit werden in fünf Teilen verfolgt. Der erste Teil wendet sich der Frage nach dem globalen Konfliktgeschehen und seiner Erfass- oder Messbarkeit zu. Untersucht wird zunächst, wie in der bisherigen Forschung Kriege empirisch erfasst wurden und welche Methodiken und Messverfahren vorliegen. Dabei wird als Ergebnis festgehalten, dass es der quantitativen Konfliktforschung bisher nicht gelungen ist, sich auf inhaltlicher Ebene mit dem Phänomen Krieg auseinanderzusetzen und die unterschiedlichen und neuen Formen von Kriegen adäquat abzubilden. Deshalb wird im nachfolgenden zweiten Teil versucht, sich dem Wesen und Charakter des sozialen Phänomens Krieg anzunähern und ein neues Konfliktmodell zu entwickeln. Dies geschieht durch die Bezugnahme auf den Referenztheoretiker Carl von Clausewitz ( ), der lange Zeit fälschlicherweise nur mit dem klassischen zwischenstaatlichen Krieg in Verbindung gebracht wurde. Sein Hauptwerk Vom Kriege (1832, posthum erschienen) ist jedoch nicht als politische Handlungsanleitung zur Kriegsführung zu verstehen, vielmehr liegt Clausewitzs Hauptaugenmerk auf einem Verständnis des Wesen des Krieges. Das entscheidende der Clausewitzschen Analyse ist die Herausarbeitung einer doppelten Trias von Zweck, Ziel und Mittel des Krieges in Verbindung mit Gewalt, Militär und Politik, die sich auch für die Untersuchung heutiger Kriege heranziehen und auf alle modernen Kriegsformen übertragen lässt. Clausewitz fokussiert sich vor allem auf (Gewalt)handlungen, d.h. Krieg wird von ihm in erster Linie als Gewalthandlung verstanden, die durch das Militär diszipliniert und durch die Politik gesteuert wird. Diese Perspektive dient als Vorlage für das neue Konfliktmodell, das unter Bezugnahme auf systemtheoretische Modelle entwickelt wird. Anders als bei Clausewitz wird demnach das Handeln durch Kommunikation ersetzt und in den Mittelpunkt gerückt. Krieg wird somit als gewalttätigste Form der Kommunikation verstanden; gleichzeitig können durch diesen Begriff auch die nicht-gewaltsamen Phasen politischer Konflikte erfasst werden. Auf Basis dieser theoretischen Entwicklung wird das neue Konfliktmodell für die bisherigen Erklärungsansätze zugänglich gemacht, die gleichzeitig auf ihre Erklärungsrelevanz hin- 17
18 sichtlich des Entstehens und der Eskalationswahrscheinlichkeit von Kriegen hin überprüft werden. Dabei wird der Einflussreich der am häufigsten zitierten Datenbanken, Correlates of War (Singer / Small 1972; Small / Singer 1982) und das schwedische Uppsala Conflict Data Project überprüft und der von ihnen verwendete Todesopferansatz systematisch dem auf den ungarischen Friedens- und Konfliktforscher Istvan Kende (1971; 1972) zurückgehenden qualitativen Forschungsansatz gegenüber gestellt. Der letztgenannte Forschungsansatz findet sich bisher in weiterentwickelter Form in den deutschen Konfliktdatenbanken der Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung (AKUF) (Gantzel 1986; Siegelberg 1990; 1991; Jung 1995) und dem Heidelberger KOSIMO Ansatz (Pfetsch 1991b; Pfetsch 1991h; Pfetsch / Billing 1994; Pfetsch / Rohloff 2000a; Pfetsch / Rohloff 2000b) wieder. Nachdem im dritten Teil die genaue Methodik und der Aufbau der Datenbank Conflict Information System (CONIS) vorgestellt werden, erfolgt im vierten Teil der Arbeit die empirische Auswertung des neuen Konfliktmodells anhand der CONIS-Daten. Das globale Konfliktgeschehen wird für den Untersuchungszeitraum sowohl im Längs- als auch im Querschnitt untersucht. Zwei grundlegend neue Einblicke werden hier im Vergleich zu den älteren Konfliktdatenbanken sichtbar: 1) innerstaatliche kriegerische Konflikte dominieren von Beginn der Untersuchungsperiode an das weltweite Konfliktgeschehen und 2) Kriege stellen die Ausnahme unter den gewaltsamen Formen politischer Konflikte dar, d.h. die Sicherheit wird sehr viel stärker von bisher nicht im Fokus stehenden Konflikten auf mittlerem Intensitätsniveau bedroht. Entsprechend der Fragestellung Wie entstehen Kriege? Werden im abschließenden fünften Teil werden die Faktoren die das Entstehen und Eskalieren von kriegerischen Konflikten untersucht und mittels CONIS und eines in der Konfliktforschung bisher nur selten angewandten Ereignisdatenanalyse (Cox-Regression) ausgewertet. 1.2 Daten und Datenerhebung Für die empirischen Auswertungen dieser Arbeit wurden komplett neue Daten erhoben. Dies erfolgte innerhalb von zwei, von der EU co-finanzierten Forschungsprojekte im Zeitraum von 2002 bis 2004 und einer von der EU im Auftrag gegeben Aktualisierung im Jahre Die Daten wurden dabei von insgesamt mehr als 60 freiwilligen Mitarbeitern und unter Mitwirkung des Heidelberger Instituts für Internationale Konfliktforschung (HIIK) mit Hilfe eines eigens entwickelten elektronischer Datensheets erhoben. Als Quellen dienten dabei ausschließlich öffentlich zugängliche Informationen wie Tageszeitungen, Nachrich- 18
19 tendienste, Fachpublikationen und Internetquellen (public sources). Vor und während des Erhebungsprozesses wurden die Mitarbeiter in der neu entwickelten Methodik und der Verwendung der Eingabemasken geschult. In den Jahren 2002 bis 2004 fanden unter Mitwirkung der Landeszentrale für Politische Bildung Baden-Württemberg mehrtägige Workshop-Wochenenden statt. Während der Datenerhebungsphasen wurden die Mitarbeiter in Arbeitsgruppen organisiert, die sich an den unterschiedlichen Weltregionen orientieren: Afrika, Amerika, Asien, Europa, Vorderer und Mittlerer Orient. Geleitet wurden die Regionalgruppen von mindestens einem langjährigen Mitarbeiter der Heidelberger Konfliktbarometer Redaktion, der als wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für Politische Wissenschaft beschäftigt war. Innerhalb der Regional-Arbeitsgruppen wurden auftretende Datenerhebungs- oder methodische Probleme diskutiert und allgemein verbindliche Entscheidungen getroffen. Darüber hinaus fanden während der Projektlaufzeit wöchentliche Treffen aller Regionalgruppenleiter oder deren Stellvertreter statt. Dort wurden solche Probleme diskutiert, die innerhalb der Regionalgruppe nicht gelöst werden konnten oder deren Lösungen eine über die Regionalgruppe hinausgehende Koordinierung notwendig machte. Die Sicherung der Datenqualität wurde zusätzlich durch technische Lösungen gewährleistet. Die vorliegende Arbeit versteht sich somit als Beitrag, die grundlegenden Strukturen, Prozesse und Dynamiken des internationalen Konfliktgeschehens besser zu verstehen und einen ersten Schritt in Richtung der Risikoabschätzung kriegerischer Konflikte zu gehen. Zudem stellt sie einen Datensatz zur Verfügung, der weiterführende Analysen und vertiefende Untersuchungen ermöglichen kann. 1.3 Danksagung Diese Arbeit hat eine sehr lange Entstehungsgeschichte, an deren Anfänge ich mich inzwischen nur noch schemenhaft erinnern kann. Dementsprechend ist die Liste derer, denen ich zu Dank verpflichtet bin, weil sie diese Arbeit in irgendeiner Weise beeinflusst oder durch ihre Mitarbeit in verschiedenenen Forschungsprojekten oder auf andere Weise erst ermöglicht haben, so lange, dass es unmöglich ist, ihre Namen hier zu nortieren ohne nicht doch Andere zu vergessen, denen ich mich ebenfalls zu Dank verpflichtet fühle. Deshalb möchte ich mich zuerst bei den Personen bedanken, die durch ihre sorgfältige Datenrecherche und ihre Codierungen in macnh nächtelanger Arbeit die Datenbank gefüttert und so die neuen Einblicke in das Konfliktgeschehen erst ermöglicht haben. Seit der ersten CONIS Version im Jahre 2003 dürften dies inzwischen mehrere hundert Personen sein, die ich, anders als früher, nur noch zu einem kleinen Bruchteil 19
20 persönlich kenne. Auch wenn klar ist, dass sie diese Arbeit nicht für mich, sondern die viele Stunden ihrer Freizeit dem hehren Ziel geopfert haben, der Wissenschaft korrekte Daten zur Verfügung zu stellen, bin ich der Erste, der diese Daten in diesen breiten Umfang analysieren darf. Ich wünsche mir in ihrem Sinne, dass eine Vielzahl von Forschern in Zukunft in gleicher Wiese vom Heidelberger Ansatz fasziniert sind und die Daten besser auswerten und auf größere Erkenntnisse stoßen, als mir es gelungen ist. CONIS wurde im Rahmen verschiedener Forschungsprojekte entwickelt und während diese Arbeit abgeschlossen wurde, sind bereits weitere Neuerungen implementiert worden, die eine Fortentwicklung des CONIS Ansatzes bedeuten. Doch der wissenschaftliche Kern, wie er hier auch im Abschnitt über CONIS formuliert und vorgestellt wird, ist gleich geblieben. Bei diesen früheren Forschungsprojekten, in denen die Grundlage dieser Arbeit liegen, waren viele inhaltliche Diskussionen enorm wichtig für mich und mein wissenschaftliches Denken. All diesen Projektteams einschließlich aller wissenschaftlichen Hilfskräfte ein herzliches Dankeschön. Ganz besonderen Dank schulde ich all jenen Kollegen, die sich in diesen Jahren mit mir zusammen auf den Weg der technsichen Umsetzung des CONIS Gedankens gemacht haben: Angel Jiimenez Sanchez und Dirk Weißmann, Julian Albert und Lars Scheithauer. Sie haben mit viel Geduld meinen bisweil sehr kryptisch vorgetragenen und stets von profunden Programmierer-Viertelwissen geprägtzen Ideen zur technischen Umsetzung des CONIS Ansatzes zugehört und sind dann glücklicherweise ihren eigenen Kenntnissen gefolgt. Ohne ihre Arbeit wäre das CONIS Projekt nicht umsetzbar gewesen. Neben den Diskussionen in den Forschungsprojekten waren für meine wissenschaftliche Weiterentwicklung auch die inzwischen einige Jahre zurück liegenden privaten Forschungskolloquien wichtig, bei denen ich dankenswerter Weise als Exot aus der internationalen Konfliktforschung im Kreise sehr profunder Policy Forscher Aufnahme fand und sehr gutes, oftmals sehr kritisches Feedback zu meinen Überlegungen bekam. Christoph Egle, Tobias Ostheim, Sandra Detzer und Reimut Zohlnhöfer gehörten diesen engeren Kreis an und sie waren und sind solche Freunde, ohne die man einen solchen Zeitraum der Arbeit an der gleichen wissenschaftlichen Qualifikationsschrift nicht übersteht. Mein ganz persönlicher Dank an Euch! Mindestens genauso wichtig für den Erkenntnisfortschritt waren die vielen kleinen Gespräche, die sich mit den Zimmerkollegen oftmals nebenbei ergeben. Sie sind aber die Ersten, die den Redebedarf bei einer, leider oftmals nur vermeintlichen bandbrechenden Erkenntnis zum Pfer fallen und helfen, dieses falsche, neue Ei des Columbus dann doch als zwar schönes, aber einfaches Hühnerei zu enttarnen, das leider oft schon nach kurzem theoretischen Beschuss doch zur Seite fällt. Christian Bauckhage, Christoph Trinn, Stefan Wurster, Maximilian Grasl und David Kuhn habe ich neben einer sehr 20
21 angenehmen Arbeitsatmosphäre auch diese vielen kleinen Erkenntnisse zu verdanken. Ganz besonders Christoph Trinn hat mit seinen vielen klugen Kommentaren vielleicht mehr zu dieser Arbeit beigetragen, als ihm bewusst ist. Viel zu verdanken habe ich auch meinen über die Jahre hinweg wechselnden wissenschaftlichen Vorgesetzten Prof. Frank Pfetsch, Prof Tanja Börzel, Prof. Uwe Wagschal und Prof. Aurel Croissant. Sie haben mich stets sehr großzügig unterstützt und alle Freiheiten gelassen, die zur Entwicklung des CONIS Ansatzes und zum Schreiben dieser Arbeit notwendig waren. Ganz besonderer Dank geht an meine beiden Doktorväter Prof. Uwe Wagschal und Prof. Frank Pfetsch. Prof. Pfetsch ist der Gründer der Heidelberger Konfliktforschung. Viele seiner ursprünglichen Ideen zu Aufbau und Struktur politischer Konflikte prägen auch diese Arbeit. Prof Wagschal hat mich in seiner Heidelberger Zeit und darüber hinaus stets sehr, sehr tatkräftig unterstützt und mir ein wissenschaftliches Umfeld geboten, in dem ich gelernt habe, mich noch stärker mit der Analyse der Daten auseinander zu setzen. Neben der Unterstützung durch Kollegen, Freunden und den wissenschaftlichen Förderern ist eine solche Arbeit nur mit einem großen familiären Rückhalt zu bewältigen. Auch wenn der Zweifel mit den Jahren gewachsen ist, dass man für eine solche Arbeit wirklich so viel Zeit benötigen kann, und ich habe ausführlich bewiesen, dass es geht, habe ich dort stets ein warmes Nest und trotz der vielen Jahre, in denen ich nun nicht mehr in Nürnberg wohne, ein Zuhause gefunden. Die in all den Jahren gewährte großzügige Unterstützung und das stets ausgesprochene Vertrauen wünsche ich Allen, die an großen Unternehmungen basteln, und bei denen ein glücklicher Ausgang ebenfalls ungewiss ist. Es ist vermutlich ganz natürlich, dass man die größte Dankbarkeit gegenüber jenen empfindet, die einen bei den allerletzten Schritten dieser Arbeit, also bei Abgabe und vor der Drucklegung eng begleiten. Wenn Männern ganz allgemein eine gewisse Schwierigkeit in der Bewältigung parallel stattfindender Arbeitsabläufe nachgesagt wird, dann kann ich mich davon leider nicht ausnehmen. Gerade in dieser letzten Phase vor den Abgabeterminen wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr erkennen kann, schwindet auch der professionelle Bezug, auch der Abstand zur eigenen Arbeit. Dann sind es Freunde, die aus naher Entfernung die Arbeit gegenlesen, auf Ungenauigkeiten in der Sprache oder Inkonsistenzen im Text aufmerksam machen, Korrekturvorschläge machen, Rechtschreibfehler markieren und auch noch einmal helfen, die Gedanken klar zu strukturieren Sie erscheinen nicht nur unverzichtbar, sie sind es auch. Mein ganz großer, herzlicher Dank gilt dabei zunächst an Ariane Hellinger, die im Sommer 2008 durch ihre zupackende und fröhliche Art und ihre genialen Einfälle einen sehr müden Promotionskandidaten kurz vor der Abgabe die Motivation für die letzten Stunden wieder brachte. Hab noch einmal herzlichen Dank, Ariane! Den zeitlichen Abstand zwischen Disputation und Drucklegung 21
22 habe ich genutzt, um einige Stellen sprachlich zu glätten, wissenschaftlich deutlicher zu formulieren. Auch die Gliederung habe ich überarbeitet und verstreute Absätze zum gleichen Gedanken an eine Stelle gepackt. Diese Arbeiten waren zeitaufwändiger, als ich es befürchtet hatte und erforderten auch hier noch erhebliche Korrekturen, um einen halbwegs lesbaren Text aus meinen Gedanken formen zu können. Drei Personen haben mich in dieser Phase derart unterstützt, dass man solche Freunde nur jeden anderen wünschen kann, der sich in ähnlicher Lage befindet. Natalie Hoffmann hat die Arbeit unmittelbar nach der Abgabe Korrektur gelesen und mir in vielen kritischen Anmerkungen weitergeholfen. Insbesondere im Kapitel das die Ergebnisse der Ereignisdatenanalyse aufzeigt, hat sie mich durch ihren sehr klugen, stets sehr freundlichen Hinweisen vor größeren Unsinn bewahrt und mir geholfen, die methodisch minimal notwendigen Formeln, fehlerfrei auf das Papier zu bringen. Jan Deuter hat trotz seiner erst kürzlich neu begonnenen Arbeit viele Stunden seiner Freizeit geschenkt und Teile der Arbeit noch einmal Korrektur gelesen. Mareike Erhardt hat die Arbeit fast komplett durchgelesen und hat mir dank ihres großes sprachlichen Talents und einer sehr klugen Auffassungsgabe meine sprachlichen Ungenauigkeiten aufgespürt und mir stets sehr kluge Verbesserungshinweise gegeben. Ihr und allen anderen bin ich zu großen Dank verpflichtet. Oft fällt an dieser Stelle der Satz, aber für mich ist es mehr als eine Floskel: alle verbliebenen Fehler gehen selbstverständlich allein zu meinen Lasten. Mein aller letzter Dank geht an Ricarda Stegmann. Jeder, der einmal eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben hat, weiß, dass die Stunden am Schreibtisch einsam sein können und umso schwerer fällt es, sich auch in schwierigen Phasen zum Gang an den Rechner zu motivieren. Dank der gemeinsamen Arbeitssitzungen, meist leider nur über Skype verbunden, wurden die Motivationsschwankungen in den letzten Monaten deutlich weniger! Ohne die vielen netten Aufforderungen und Verabredungen für die nächste Pause und ohne die vielen interessanten, tollen und manchmal auch nur sehr witzigen Gesprächen in den Pausen wäre ein Abschluss der Arbeiten noch viel schwerer gefallen. In diesem Sinne: die letzte Klappe ist gefallen! Danke! Los! 22
23 2. Was sind Kriege? Die Frage nach dem Wesen von Kriegen gehört zu den ungelösten Problemen der Sozialwissenschaften (Dinstein 1994, Daase 2002, Duyvesteyn / Angstrom 2005, Geis 2006a). In den Jahren des Kalten Krieges waren fast ausschließlich zwischenstaatliche Großmachtkonflikte Gegenstand der quantitativen Konfliktforschung (Richardson 1960, Singer / Small 1972, Levy 1981). Mit den humanitären Katastrophen in Somalia (ab 1992 mit der UN gestützten US- Militärintervention, vgl. Mayall 1996) und Ruanda (Stahel 1998, Prunier 1999) rückte jedoch ein komplett neues Konfliktbild in das Bewusstsein der Öffentlichkeit. Schließlich führten die Ereignisse des 11. September 2001 nochmalig zu einer grundlegenden Veränderung der Wahrnehmung politisch motivierter Gewalt (Risse 2004). Seitdem konnte die empirische Konfliktforschung das Bedürfnis nach Informationen über Anzahl, Art und Wesen gewaltsamer Konflikte kaum mehr befriedigen (Schlichte 2002, Daase 2003, Chojnacki 2004b). Insbesondere der Wandel des Konfliktaustrags ist mit den etablierten Konfliktdatenbanken empirisch kaum nachzuzeichnen (Eck 2005). Bis heute mangelt es an einer zuverlässigen Methode und einem überzeugenden Konzept, um die gesamte Bandbreite politischer Konflikte erfassen und typologisieren zu können. Dies verwundert, da Kriege als eine Form der politischen Gewalt zu den einschneidendsten und bedeutendsten Sicherheitsbedrohungen eines Staates zählen. Zudem sind Kriege mit enormen humanitären und monetären Kosten verbunden. Dabei können selbst nicht direkt beteiligte Staaten durch Flüchtlingsströme und den Wegfall von Bezugsquellen und Transportmöglichkeiten betroffen sein. Ausgerechnet diesem Bereich soll sich die Forschung nicht ausreichend gewidmet haben? Um die Defizite der Konfliktforschung zu verdeutlichen, sollen im Folgenden bisher verwendete Konzepte und Ansätze dargestellt und hinterfragt werden. Dies geschieht auf zwei unterschiedliche Wege. Zunächst werden verschiedene methodische Ansätze der quantitativen empirischen Konfliktforschung vorgestellt, die allerdings unterschiedliche Konfliktstatistiken erfassen. Im nachfolgenden Teilabschnitt werden deshalb der aktuelle Stand der Kriegs- und Konflikttheorie durchleuchtet und kritisch dargestellt. 23
24 2.1 Wie werden Kriege gemessen? Wie in der Einleitung dargestellt, zählt die kritische Datenlage zu den zentralen Problemen der quantitativen Konfliktforschung. Durch die Verschiedenheit der Datensätze herrscht häufig bereits hinsichtlich der grundsätzlichen Konfliktentwicklung, also in der Frage, wie viele Konflikte es zu einem bestimmten Zeitpunkt gab und welche Zu- oder Abnahmen in der Folge zu verzeichnen waren, Uneinigkeit (Eberwein 2001, Schlichte 2002). Diese unterschiedlichen Tendenzaussagen der quantitativen Datensätze haben zur Folge, dass Forschungsergebnisse zu den Kausalitäten von Kriegen nicht reproduziert werden können und sie daher nur geringe Aussagekraft besitzen (Collier / Hoeffler 2001a, Hegre / Sambanis 2006). Als Ursache der unterschiedlichen Ergebnisse gilt das Fehlen eines gemeinsamen Bezugsrahmens, also eines einheitlichen Grundverständnisses, was unter Krieg verstanden werden kann. Gelingt es, ein allgemein anerkanntes Konzept der verschiedenen Konfliktformen und Ereignisse zu entwickeln, kann das globale Konfliktgeschehen sinnvoll erfasst und für die quantitative Konfliktforschung aufbereitet werden (vgl. Rummel 1979: 18, Daase 2003). Im Folgenden werden die bisher verwendeten Methoden der Konfliktmessung dargestellt und ihre Vor- und Nachteile diskutiert. Am Ende der Analyse steht eine Bewertung der bisherigen Ansätze im Hinblick auf ihre Verwertbarkeit für die Zwecke dieser Studie. Grundsätzlich lassen sich drei unterschiedliche Möglichkeiten einer Kriegsund Konfliktdefinition unterscheiden (vgl. auch Most / Starr 1983): Die Bestimmung von Krieg durch gegen- oder einseitige Erklärung. Dies ist die klassische oder historische Abgrenzung des Krieges vom Frieden bzw. vom Nicht-Krieg. Einer, mehrere oder alle beteiligten Akteure erklären einander den Krieg. In der empirischen Konfliktforschung legte vor allem Richardson (1960) seinen Studien einen solchen Kriegsbegriff zugrunde. Die Bestimmung von Kriegen durch die Wirkung, die sie erzielen. Hierbei lassen sich zwei Forschungsrichtungen voneinander unterscheiden (vgl. Most / Starr 1983: 139): Erstens Ansätze, die auf die zerstörerische Wirkung von Kriegen zielen und dabei Indikatoren wie die Anzahl der Todesopfer, zerstörte Gebäude oder Flüchtlingsbewegungen verwenden. Zweitens Ansätze, die auf die Auswirkungen von Kriegen auf das internationale System fokussieren, wie Grenzverschiebungen oder Staatseingliederung. Dabei dominiert die erst genannte Gruppe bei Weitem. Derartige Ansätze findet bei den derzeit noch immer am häufigsten zitierten Konfliktdatensätzen des Correlates of War (COW) Projektes (Singer / Small 1972) oder der jüngeren Uppsala Conflict Datenprojektes Anwendung. Einen Sonderweg geht das Forschungsprojekt Minorities at Risk von Ted Gurr (1993a), der einen aus Todesopfer- und Flüchtlingszahlen kombinierten Indikator verwendet. 24
25 Eine dritte Forschungsrichtung betont den prozesshaften Charakter von Krieg. Krieg wird als Endpunkt einer Dynamik betrachtet, an deren Beginn die Anwendung von Zwang steht, auf die die Androhung von Gewalt und schließlich die Anwendung von Gewalt folgt. Im Mittelpunkt steht daher die Art und Dauer der Gewaltanwendung. Dieses Kriegsverständnis findet sich bei Pfetsch (Pfetsch / Billing 1994, Pfetsch / Rohloff 2000b), Kende (1982), in Ansätzen bei Rummel (1969) und Gantzel (1986). Die quantitative Forschung weist in der Frage der Unterscheidung von Kriegsund Friedenszuständen eine bemerkenswerte Entwicklung auf: Den geringsten Zuspruch findet dabei heute der Ansatz, der auf die formale Erklärung oder Feststellungen von Kriegen abstellt. Obwohl Kriegserklärungen bereits in der Antike und später auch im Mittelalter üblich waren, und sie sogar noch auf der Zweiten Haager Friedenskonferenz völkerrechtlich verankert wurde, verlor die formale Kriegserklärung im 20. Jahrhundert zunehmend an Bedeutung. Mit der Verabschiedung der UN Charta und der darin enthaltenen Ächtung des Angriffskrieges käme eine Kriegserklärung auch dem Eingeständnis eines Völkerrechtsbruches nahe. So begannen selbst die USA und die Sowjetunion einen Großteil ihrer Kriege zwischen 1945 und 1990 ohne formale Kriegserklärungen (Tischer 2005). Am einflussreichsten waren bisher jene Kriegsdefinitionen, die auf die Anzahl der Todesopfer als Abgrenzungskriterium zwischen Krieg und Nicht- Krieg zielen und jene, die den Prozesscharakter von Kriegen betonen. Diese sollen im Folgenden näher erläutert werden. 2.2 Kriegsdefinitionen über Schwellenwerte Obwohl Richardson (1960) nur wenige Jahre zuvor in seiner Studie Statistics of Deadly Quarrels Krieg über formale Kriterien wie Kriegserklärungen und Friedensschlüsse definierte, entscheiden sich Singer und Small bei der Erstellung ihres Correlates of War Datensatzes für die Verwendung von Todesopferschwellenwerten (Singer / Small 1972, Small / Singer 1982). Die Correlates of War Datenbank bestimmt die Anzahl von 1000 Kriegstoten als Kriterium für die Erfassung als Krieg. Bei der Darstellung der COW Kriterien bleibt häufig unberücksichtigt, dass das Projekt mehrere Konflikttypen mit jeweils unterschiedlichen Kriterien kennt. So gelten zwischenstaatliche Konflikte dann als Kriege, wenn sie mehr als Kriegstote während des gesamten Konfliktzeitraums kosten (Small / Singer 1982: 55). In extra-systemischen Kriegen (Extra Systemic Wars) hingegen, die im Grunde Dekolonialisierungskriege beschreiben, müssen Kriegstote innerhalb eines Jahres gezählt werden. Dabei werden nur die Kriegsopfer berücksichtigt, die auf Seiten des Systemmitgliedes, also der Kolonialmacht anfallen (Small / Singer 1982: 56). Die beiden Autoren begründen die besonderen Anforderungen mit dem Ziel, jene Konflikte auszuschließen, die 25
Konflikte, Krisen, Kriege
 SUB Hamburg A2012/7656 Nicolas Schwank Konflikte, Krisen, Kriege Die Entwicklungsdynamiken politischer Konflikte seit 1945 F^ Nomos Inhalt 1 Einleitung 23 2. Was sind Kriege? 30 2.1 Messkonzepte in der
SUB Hamburg A2012/7656 Nicolas Schwank Konflikte, Krisen, Kriege Die Entwicklungsdynamiken politischer Konflikte seit 1945 F^ Nomos Inhalt 1 Einleitung 23 2. Was sind Kriege? 30 2.1 Messkonzepte in der
Konfliktforschung I Kriegsursachen im historischen Kontext
 Konfliktforschung I Kriegsursachen im historischen Kontext Woche 8: Auf der Suche nach Kausalität: Quantitative Kriegsursachenforschung Prof. Dr. Lars-Erik Cederman Eidgenössische Technische Hochschule
Konfliktforschung I Kriegsursachen im historischen Kontext Woche 8: Auf der Suche nach Kausalität: Quantitative Kriegsursachenforschung Prof. Dr. Lars-Erik Cederman Eidgenössische Technische Hochschule
Sozialwissenschaftliche Konflikttheorien
 Sozialwissenschaftliche Konflikttheorien Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung Wintersemester 2006/07 Kernbereich der Friedens- und Konfliktforschung K o n f l i k t a n a l y s e & K o n f
Sozialwissenschaftliche Konflikttheorien Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung Wintersemester 2006/07 Kernbereich der Friedens- und Konfliktforschung K o n f l i k t a n a l y s e & K o n f
Digitale Demokratie: Chancen und Herausforderungen von sozialen Netzwerken. Bachelorarbeit
 Digitale Demokratie: Chancen und Herausforderungen von sozialen Netzwerken Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B.Sc.) im Studiengang Wirtschaftswissenschaft der Wirtschaftswissenschaftlichen
Digitale Demokratie: Chancen und Herausforderungen von sozialen Netzwerken Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B.Sc.) im Studiengang Wirtschaftswissenschaft der Wirtschaftswissenschaftlichen
Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Michael Schefczyk
 Gerlinde Brinkel Erfolgreiches Franchise- System-Management Eine empirische Untersuchung anhand der deutschen Franchise-Wirtschaft Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Michael Schefczyk 4^ Springer Gabler
Gerlinde Brinkel Erfolgreiches Franchise- System-Management Eine empirische Untersuchung anhand der deutschen Franchise-Wirtschaft Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Michael Schefczyk 4^ Springer Gabler
Freundschaft am Arbeitsplatz - Spezifika einer persönlichen Beziehung im beruflichen Umfeld
 Geisteswissenschaft Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz - Spezifika einer persönlichen Beziehung im beruflichen Umfeld Bachelorarbeit Bakkalaureatsarbeit Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz
Geisteswissenschaft Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz - Spezifika einer persönlichen Beziehung im beruflichen Umfeld Bachelorarbeit Bakkalaureatsarbeit Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz
Einführung in die Argumente der Konfliktökonomie
 Einführung in die Argumente der Konfliktökonomie Uni im Dorf 2018: Konflikt Forschung - Frieden Andreas Exenberger Institut für Wirtschaftstheorie, -politik und -geschichte Leopold-Franzens-Universität
Einführung in die Argumente der Konfliktökonomie Uni im Dorf 2018: Konflikt Forschung - Frieden Andreas Exenberger Institut für Wirtschaftstheorie, -politik und -geschichte Leopold-Franzens-Universität
Wie Kriege geführt werden
 Wie Kriege geführt werden Wolfgang Schreiber, AKUF, Universität Hamburg Wolfgang Schreiber für Ringvorlesung 1 3 Vorträge Wie Kriege beginnen Kriegsursachen Wie Kriege geführt werden Neue Kriege? Wie Kriege
Wie Kriege geführt werden Wolfgang Schreiber, AKUF, Universität Hamburg Wolfgang Schreiber für Ringvorlesung 1 3 Vorträge Wie Kriege beginnen Kriegsursachen Wie Kriege geführt werden Neue Kriege? Wie Kriege
Zum Wandel der Fremd- und Selbstdarstellung in Heirats- und Kontaktanzeigen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Eine empirische Untersuchung
 Zum Wandel der Fremd- und Selbstdarstellung in Heirats- und Kontaktanzeigen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Eine empirische Untersuchung Schriftliche Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung
Zum Wandel der Fremd- und Selbstdarstellung in Heirats- und Kontaktanzeigen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Eine empirische Untersuchung Schriftliche Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung
Konfliktforschung II Herausforderungen und Lösungen gegenwärtiger Konflikte Woche 4: Bürgerkriege aus polit-ökonomischer Sicht
 Konfliktforschung II Herausforderungen und Lösungen gegenwärtiger Konflikte Woche 4: Bürgerkriege aus polit-ökonomischer Sicht Lutz F. Krebs Eidgenössische Technische Hochschule Zürich International Conflict
Konfliktforschung II Herausforderungen und Lösungen gegenwärtiger Konflikte Woche 4: Bürgerkriege aus polit-ökonomischer Sicht Lutz F. Krebs Eidgenössische Technische Hochschule Zürich International Conflict
Begriffe der Friedens- und Konfliktforschung : Konflikt & Gewalt
 Begriffe der Friedens- und Konfliktforschung : Konflikt & Gewalt Vorlesung zur Einführung in die Friedensund Konfliktforschung Prof. Dr. Inhalt der Vorlesung Gewaltbegriff Bedeutungsgehalt Debatte um den
Begriffe der Friedens- und Konfliktforschung : Konflikt & Gewalt Vorlesung zur Einführung in die Friedensund Konfliktforschung Prof. Dr. Inhalt der Vorlesung Gewaltbegriff Bedeutungsgehalt Debatte um den
Vorgehensweise bei der Erstellung. von Hausarbeiten (Bachelorarbeiten)
 Leuphana Universität Lüneburg Institut für Bank-, Finanz- und Rechnungswesen Abt. Rechnungswesen und Steuerlehre Vorgehensweise bei der Erstellung von Hausarbeiten (Bachelorarbeiten) I. Arbeitsschritte
Leuphana Universität Lüneburg Institut für Bank-, Finanz- und Rechnungswesen Abt. Rechnungswesen und Steuerlehre Vorgehensweise bei der Erstellung von Hausarbeiten (Bachelorarbeiten) I. Arbeitsschritte
Bachelorarbeit. Was ist zu tun?
 Bachelorarbeit Was ist zu tun? Titelseite Zusammenfassung/Summary Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Einleitung Material und Methoden Ergebnisse Diskussion Ausblick Literaturverzeichnis Danksagung
Bachelorarbeit Was ist zu tun? Titelseite Zusammenfassung/Summary Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Einleitung Material und Methoden Ergebnisse Diskussion Ausblick Literaturverzeichnis Danksagung
Friedemann J. Schirrmeister
 Konflikte, Konfliktprävention und Konfliktursachen am Beispiel Lateinamerika Das Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung stellt sich vor Friedemann J. Schirrmeister Das Heidelberger
Konflikte, Konfliktprävention und Konfliktursachen am Beispiel Lateinamerika Das Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung stellt sich vor Friedemann J. Schirrmeister Das Heidelberger
Woche 9: Second Image - Der Staat
 Woche 9: Second Image - Der Staat Internationale Konfliktforschung I: Kriegsursachen im historischen Kontext Guy Schvitz guyschvitz@gessethzch 16112016 Guy Schvitz Konfliktforschung I: Woche 1 16112016
Woche 9: Second Image - Der Staat Internationale Konfliktforschung I: Kriegsursachen im historischen Kontext Guy Schvitz guyschvitz@gessethzch 16112016 Guy Schvitz Konfliktforschung I: Woche 1 16112016
Konfliktforschung I Kriegsursachen im historischen Kontext
 Konfliktforschung I Kriegsursachen im historischen Kontext Woche 8: Second image Der Staat Prof. Dr. Lars-Erik Cederman Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Center for Comparative and International
Konfliktforschung I Kriegsursachen im historischen Kontext Woche 8: Second image Der Staat Prof. Dr. Lars-Erik Cederman Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Center for Comparative and International
NGOs - normatives und utilitaristisches Potenzial für das Legitimitätsdefizit transnationaler Politik?
 Politik Sandra Markert NGOs - normatives und utilitaristisches Potenzial für das Legitimitätsdefizit transnationaler Politik? Studienarbeit Universität Stuttgart Institut für Sozialwissenschaften Abteilung
Politik Sandra Markert NGOs - normatives und utilitaristisches Potenzial für das Legitimitätsdefizit transnationaler Politik? Studienarbeit Universität Stuttgart Institut für Sozialwissenschaften Abteilung
Detlef Jahn. Einführung in die vergleichende Politikwissenschaft III VS VERLAG FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN
 Detlef Jahn Einführung in die vergleichende Politikwissenschaft III VS VERLAG FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN Abkürzungsverzeichnis 11 Verzeichnis der Tabellen 14 Verzeichnis der Abbildungen 16 Verzeichnis der
Detlef Jahn Einführung in die vergleichende Politikwissenschaft III VS VERLAG FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN Abkürzungsverzeichnis 11 Verzeichnis der Tabellen 14 Verzeichnis der Abbildungen 16 Verzeichnis der
Konfliktforschung II: Herausforderungen und Lösungen gegenwärtiger Konflikte 4. Woche: Bürgerkriege
 Konfliktforschung II: Herausforderungen und Lösungen gegenwärtiger Konflikte 4. Woche: Bürgerkriege Prof. Dr. Lars-Erik Cederman Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Center for Comparative and International
Konfliktforschung II: Herausforderungen und Lösungen gegenwärtiger Konflikte 4. Woche: Bürgerkriege Prof. Dr. Lars-Erik Cederman Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Center for Comparative and International
Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie der Freien Universität Berlin
 Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie der Freien Universität Berlin Vertrauensvolle Verständigung herstellen: Ein Modell interdisziplinärer Projektarbeit Dissertation zur Erlangung des akademischen
Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie der Freien Universität Berlin Vertrauensvolle Verständigung herstellen: Ein Modell interdisziplinärer Projektarbeit Dissertation zur Erlangung des akademischen
1 Einleitung. Heute weiß man von allem den Preis, von nichts den Wert. Oscar Wilde
 1 Heute weiß man von allem den Preis, von nichts den Wert. Oscar Wilde 1 Einleitung 1.1 Zielsetzung und Vorgehensweise der Untersuchung Unternehmensbewertungen sind für verschiedene Anlässe im Leben eines
1 Heute weiß man von allem den Preis, von nichts den Wert. Oscar Wilde 1 Einleitung 1.1 Zielsetzung und Vorgehensweise der Untersuchung Unternehmensbewertungen sind für verschiedene Anlässe im Leben eines
Abkürzungsverzeichnis Einleitung 17
 Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis 13 1 Einleitung 17 1.1 Stand der F orschung 19 1.2 Relevanz der Arbeit 23 1.3 Der theoretische Ansatz und die methodische Vorgehensweise 27 1.3.1 Theoretischer
Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis 13 1 Einleitung 17 1.1 Stand der F orschung 19 1.2 Relevanz der Arbeit 23 1.3 Der theoretische Ansatz und die methodische Vorgehensweise 27 1.3.1 Theoretischer
Design eines Vorgehensmodells zur Entwicklung komplexer Dashboards
 Design eines Vorgehensmodells zur Entwicklung komplexer Dashboards Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B. Sc.) im Studiengang Wirtschaftswissenschaft der Wirtschaftswissenschaftlichen
Design eines Vorgehensmodells zur Entwicklung komplexer Dashboards Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B. Sc.) im Studiengang Wirtschaftswissenschaft der Wirtschaftswissenschaftlichen
DIESES MAL IST ALLES ANDERS
 CARMEN M. REINHART & KENNETH S. ROGOFF DIESES MAL IST ALLES ANDERS Acht Jahrhunderte Finanzkrisen FinanzBuch Verlag Tabellen 12 Abbildungen 16 Infoboxen 22 Vorwort 23 Danksagung 35 Einleitung: Einige erste
CARMEN M. REINHART & KENNETH S. ROGOFF DIESES MAL IST ALLES ANDERS Acht Jahrhunderte Finanzkrisen FinanzBuch Verlag Tabellen 12 Abbildungen 16 Infoboxen 22 Vorwort 23 Danksagung 35 Einleitung: Einige erste
Analysen zur Globalisierung in der Eier- und Fleischerzeugung
 WING Beiträge zur Geflügelwirtschaft Heft 1 August 2013 Hans-Wilhelm Windhorst und Anna Wilke Analysen zur Globalisierung in der Eier- und Fleischerzeugung Vorwort Vorwort Der Begriff Globalisierung ist
WING Beiträge zur Geflügelwirtschaft Heft 1 August 2013 Hans-Wilhelm Windhorst und Anna Wilke Analysen zur Globalisierung in der Eier- und Fleischerzeugung Vorwort Vorwort Der Begriff Globalisierung ist
Definition von Krieg
 Schrank der Vielfalt Definition von Krieg Dateiname: HVR_II_Material_Arbeitsblatt_Kriegsdefinition Abstract: Vorbereitungszeit: - Durchführungszeit: - GL-Bedarf: - Materialien: - Rahmenbedingungen: - Geeignet
Schrank der Vielfalt Definition von Krieg Dateiname: HVR_II_Material_Arbeitsblatt_Kriegsdefinition Abstract: Vorbereitungszeit: - Durchführungszeit: - GL-Bedarf: - Materialien: - Rahmenbedingungen: - Geeignet
Internationale Konfliktforschung I. Tutorat W04_ Kriege im Zeitalter des Nationalismus
 Internationale Konfliktforschung I Tutorat W04_10.10.2012 Kriege im Zeitalter des Nationalismus Plan Rückblick Souveränität Prüfungsaufgabe Literaturbesprechung Diskussion 2 Souveränität 1 Jean Bodin (1529-1596)
Internationale Konfliktforschung I Tutorat W04_10.10.2012 Kriege im Zeitalter des Nationalismus Plan Rückblick Souveränität Prüfungsaufgabe Literaturbesprechung Diskussion 2 Souveränität 1 Jean Bodin (1529-1596)
Einleitung: Die Öffentlichkeiten der Erziehung Zum Begriff der Öffentlichkeit... 23
 Inhaltsverzeichnis Vorwort. 5 Einleitung: Die Öffentlichkeiten der Erziehung... 11 1. Zum Begriff der Öffentlichkeit... 23 1.1 Politik- und sozialwissenschaftliche Diskussionen I Eine diachrone Beschreibung...
Inhaltsverzeichnis Vorwort. 5 Einleitung: Die Öffentlichkeiten der Erziehung... 11 1. Zum Begriff der Öffentlichkeit... 23 1.1 Politik- und sozialwissenschaftliche Diskussionen I Eine diachrone Beschreibung...
Teil Methodische Überlegungen Zur Dysgrammatismus-Forschung... 17
 Inhaltsverzeichnis Dysgrammatismus EINLEITUNG Teil 1... 9 A Phänomen des Dysgrammatismus... 13 Methodische Überlegungen... 15 Zur Dysgrammatismus-Forschung... 17 B Die Sprachstörung Dysgrammatismus...
Inhaltsverzeichnis Dysgrammatismus EINLEITUNG Teil 1... 9 A Phänomen des Dysgrammatismus... 13 Methodische Überlegungen... 15 Zur Dysgrammatismus-Forschung... 17 B Die Sprachstörung Dysgrammatismus...
Forschungsfrage Forschungsseminar-Unterlagen
 Forschungsfrage Forschungsseminar-Unterlagen Christian Seubert Arbeitsgruppe Angewandte Psychologie 2017 Christian Seubert Forschungsfrage 1 Die Bedeutung der Forschungsfrage Die Forschungsfrage ist der
Forschungsfrage Forschungsseminar-Unterlagen Christian Seubert Arbeitsgruppe Angewandte Psychologie 2017 Christian Seubert Forschungsfrage 1 Die Bedeutung der Forschungsfrage Die Forschungsfrage ist der
Fördert oder beeinträchtigt die Globalisierung die Entwicklungschancen der Entwicklungsländer?
 Politik Christian Blume Fördert oder beeinträchtigt die Globalisierung die Entwicklungschancen der Entwicklungsländer? Essay Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung S.03 2. Definition der Begriffe Globalisierung
Politik Christian Blume Fördert oder beeinträchtigt die Globalisierung die Entwicklungschancen der Entwicklungsländer? Essay Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung S.03 2. Definition der Begriffe Globalisierung
Humanitäre Interventionen - Die Friedenssicherung der Vereinten Nationen
 Politik Danilo Schmidt Humanitäre Interventionen - Die Friedenssicherung der Vereinten Nationen Studienarbeit FREIE UNIVERSITÄT BERLIN Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft Wintersemester 2006/2007
Politik Danilo Schmidt Humanitäre Interventionen - Die Friedenssicherung der Vereinten Nationen Studienarbeit FREIE UNIVERSITÄT BERLIN Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft Wintersemester 2006/2007
Konfliktforschung I Kriegsursachen im historischen Kontext
 Konfliktforschung I Kriegsursachen im historischen Kontext Woche 9: Second Image Der Staat Prof. Dr. Lars-Erik Cederman Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Center for Comparative and International
Konfliktforschung I Kriegsursachen im historischen Kontext Woche 9: Second Image Der Staat Prof. Dr. Lars-Erik Cederman Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Center for Comparative and International
Markteintrittsstrategien von Data-Mining- Unternehmen in chinesische Märkte
 Markteintrittsstrategien von Data-Mining- Unternehmen in chinesische Märkte freie wissenschaftliche Arbeit zur Erlangung des akademischen Grads Dr. rer. pol. an der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Markteintrittsstrategien von Data-Mining- Unternehmen in chinesische Märkte freie wissenschaftliche Arbeit zur Erlangung des akademischen Grads Dr. rer. pol. an der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Analyseebenen Kausalmodel 2nd image Eigenschaften des Staates
 Analyseebenen Kausalmodel Unabhängige Variablen Abhängige Variable 3 rd image Kriege 2 nd image 1 st image Eigenschaften des Staates: politisches System wirtschaftliches System Stabilität Agenda Der demokratische
Analyseebenen Kausalmodel Unabhängige Variablen Abhängige Variable 3 rd image Kriege 2 nd image 1 st image Eigenschaften des Staates: politisches System wirtschaftliches System Stabilität Agenda Der demokratische
Auf der Suche nach dem Praktischen im Urteilen.
 Geisteswissenschaft Thomas Grunewald Auf der Suche nach dem Praktischen im Urteilen. Hannah Arendt und Kants Politische Philosophie. Studienarbeit Gliederung Seite 1. Einleitung 2 2. Eine politische Theorie
Geisteswissenschaft Thomas Grunewald Auf der Suche nach dem Praktischen im Urteilen. Hannah Arendt und Kants Politische Philosophie. Studienarbeit Gliederung Seite 1. Einleitung 2 2. Eine politische Theorie
Konfliktforschung I Kriegsursachen im historischen Kontext
 Konfliktforschung I Kriegsursachen im historischen Kontext Woche 9: Third image Die internationale Ebene Prof. Dr. Lars-Erik Cederman Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Center for Comparative
Konfliktforschung I Kriegsursachen im historischen Kontext Woche 9: Third image Die internationale Ebene Prof. Dr. Lars-Erik Cederman Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Center for Comparative
Soziale Kompetenzen als strategischer Erfolgsfaktor für Führungskräfte
 Europäische Hochschulschriften 3132 Soziale Kompetenzen als strategischer Erfolgsfaktor für Führungskräfte von Christine Scheitler 1. Auflage Soziale Kompetenzen als strategischer Erfolgsfaktor für Führungskräfte
Europäische Hochschulschriften 3132 Soziale Kompetenzen als strategischer Erfolgsfaktor für Führungskräfte von Christine Scheitler 1. Auflage Soziale Kompetenzen als strategischer Erfolgsfaktor für Führungskräfte
Zyklisch evaluieren 1 (Auszug aus dem Leitfaden zur Selbstevaluation )
 Zyklisch evaluieren 1 (Auszug aus dem Leitfaden zur Selbstevaluation ) Auf Basis des Qualitätsrahmens für Schulen in Baden-Württemberg lassen sich die unterschiedlichen Bereiche mit dem hier dargestellten
Zyklisch evaluieren 1 (Auszug aus dem Leitfaden zur Selbstevaluation ) Auf Basis des Qualitätsrahmens für Schulen in Baden-Württemberg lassen sich die unterschiedlichen Bereiche mit dem hier dargestellten
Dynamische Modelle für chronische psychische Störungen
 Zeno Kupper Dynamische Modelle für chronische psychische Störungen PABST SCIENCE PUBLISHERS Lengerich, Berlin, Düsseldorf, Leipzig, Riga, Scottsdale (USA), Wien, Zagreb Inhaltsverzeichnis Einleitung und
Zeno Kupper Dynamische Modelle für chronische psychische Störungen PABST SCIENCE PUBLISHERS Lengerich, Berlin, Düsseldorf, Leipzig, Riga, Scottsdale (USA), Wien, Zagreb Inhaltsverzeichnis Einleitung und
DIE ÖKONOMISCHE BEDEUTUNG DES BANKENSEKTORS UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER TOO-BIG-TO-FAIL"-DOKTRIN THEORETISCHE ZUSAMMENHÄNGE,
 Julius-Maximilians-Universität Würzburg Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Wirtschaftsordnung und Sozialpolitik Erstgutachter: Prof. Dr. Norbert Berthold DIE ÖKONOMISCHE BEDEUTUNG DES BANKENSEKTORS
Julius-Maximilians-Universität Würzburg Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Wirtschaftsordnung und Sozialpolitik Erstgutachter: Prof. Dr. Norbert Berthold DIE ÖKONOMISCHE BEDEUTUNG DES BANKENSEKTORS
Der Neorealismus von K.Waltz zur Erklärung der Geschehnisse des Kalten Krieges
 Politik Manuel Stein Der Neorealismus von K.Waltz zur Erklärung der Geschehnisse des Kalten Krieges Studienarbeit Inhalt 1. Einleitung 1 2. Der Neorealismus nach Kenneth Waltz 2 3. Der Kalte Krieg 4 3.1
Politik Manuel Stein Der Neorealismus von K.Waltz zur Erklärung der Geschehnisse des Kalten Krieges Studienarbeit Inhalt 1. Einleitung 1 2. Der Neorealismus nach Kenneth Waltz 2 3. Der Kalte Krieg 4 3.1
PETER LANG Internationaler Verlag der Wissenschaften
 Tina Püthe Mittelständische Unternehmen und Genossenschaftsbanken Eine empirische Analyse der Wirkung ökonomischer und verhaltenswissenschaftlicher Faktoren PETER LANG Internationaler Verlag der Wissenschaften
Tina Püthe Mittelständische Unternehmen und Genossenschaftsbanken Eine empirische Analyse der Wirkung ökonomischer und verhaltenswissenschaftlicher Faktoren PETER LANG Internationaler Verlag der Wissenschaften
kultur- und sozialwissenschaften
 Thorsten Bonacker/Lars Schmitt (überarbeitet und aktualisiert von Sascha Bark) Sozialwissenschaftliche Theorien der Konfliktforschung kultur- und sozialwissenschaften Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Thorsten Bonacker/Lars Schmitt (überarbeitet und aktualisiert von Sascha Bark) Sozialwissenschaftliche Theorien der Konfliktforschung kultur- und sozialwissenschaften Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Konfliktforschung II
 Konfliktforschung II Herausforderungen und Lösungen gegenwärtiger Konflikte Woche 4: Bürgerkriege Prof. Dr. Lars-Erik Cederman Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Center for Comparative and International
Konfliktforschung II Herausforderungen und Lösungen gegenwärtiger Konflikte Woche 4: Bürgerkriege Prof. Dr. Lars-Erik Cederman Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Center for Comparative and International
Konfliktforschung I Kriegsursachen im historischen Kontext
 Konfliktforschung I Kriegsursachen im historischen Kontext Woche 11: Analysenebenen der internationalen Beziehungen: third image Prof. Dr. Lars-Erik Cederman Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Konfliktforschung I Kriegsursachen im historischen Kontext Woche 11: Analysenebenen der internationalen Beziehungen: third image Prof. Dr. Lars-Erik Cederman Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Handbuch Wahlforschung
 Jürgen W. Falter Harald Schoen (Hrsg.) Handbuch Wahlforschung in VS VERLAG FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN Inhaltsübersicht Vorwort xxiii Einleitung und Grundlagen 1 Die Rolle von Wahlen in der Demokratie 3 1.1
Jürgen W. Falter Harald Schoen (Hrsg.) Handbuch Wahlforschung in VS VERLAG FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN Inhaltsübersicht Vorwort xxiii Einleitung und Grundlagen 1 Die Rolle von Wahlen in der Demokratie 3 1.1
Kapitel 3 Konsequenzen von Divided Government in Deutschland... 95
 Inhalt Danksagung... 11 Kapitel 1 Der Bundesrat als Blockadeinstrument... 13 Kapitel 2 Divided Government in Deutschland: Eine Ursachenanalyse... 21 2.1 Landtagswahlen im Schatten der Bundespolitik: Erklärungsansätze...
Inhalt Danksagung... 11 Kapitel 1 Der Bundesrat als Blockadeinstrument... 13 Kapitel 2 Divided Government in Deutschland: Eine Ursachenanalyse... 21 2.1 Landtagswahlen im Schatten der Bundespolitik: Erklärungsansätze...
Modulkatalog. Philosophische Fakultät. Grundlagen der Moralphilosophie. Programmformat: Minor 30. Studienstufe: Master. Gültig ab: Herbstsemester 2019
 Modulkatalog Grundlagen der Moralphilosophie Programmformat: Minor 30 Studienstufe: Master Gültig ab: Herbstsemester 2019 [Erstellt am 01.04.2019] Modulgruppen des Programms Allgemeine Ethik Moral und
Modulkatalog Grundlagen der Moralphilosophie Programmformat: Minor 30 Studienstufe: Master Gültig ab: Herbstsemester 2019 [Erstellt am 01.04.2019] Modulgruppen des Programms Allgemeine Ethik Moral und
Selbstgesteuertes Lernen bei Studierenden
 Pädagogik Tanja Greiner Selbstgesteuertes Lernen bei Studierenden Eine empirische Studie mit qualitativer Inhaltsanalyse von Lerntagebüchern Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Pädagogik Tanja Greiner Selbstgesteuertes Lernen bei Studierenden Eine empirische Studie mit qualitativer Inhaltsanalyse von Lerntagebüchern Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Rapoport: Eine Klassifikation der Konflikte
 Rapoport: Eine Klassifikation der Konflikte Das grundlegende Kennzeichen des menschlichen Konflikts ist das Bewußtsein von ihm bei den Teilnehmern. S. 222 Erste Klassifikation Teilnehmer Streitpunkte Mittel
Rapoport: Eine Klassifikation der Konflikte Das grundlegende Kennzeichen des menschlichen Konflikts ist das Bewußtsein von ihm bei den Teilnehmern. S. 222 Erste Klassifikation Teilnehmer Streitpunkte Mittel
Prof. Dr. Jürgen Neyer. Einführung in die Politikwissenschaft. - Was ist Wissenschaft? Di
 Prof. Dr. Jürgen Neyer Einführung in die Politikwissenschaft - 25.4.2008 Di 11-15-12.45 Wissenschaft ist die Tätigkeit des Erwerbs von Wissen durch Forschung, seine Weitergabe durch Lehre, der gesellschaftliche,
Prof. Dr. Jürgen Neyer Einführung in die Politikwissenschaft - 25.4.2008 Di 11-15-12.45 Wissenschaft ist die Tätigkeit des Erwerbs von Wissen durch Forschung, seine Weitergabe durch Lehre, der gesellschaftliche,
https://cuvillier.de/de/shop/publications/6765
 Jan Weitzel (Autor) Die ökonomische Bedeutung des Bankensektors unter Berücksichtigung der Too-Big-to-Fail -Doktrin Theoretische Zusammenhänge, empirische Erkenntnisse und ordnungspolitische Lösungsansätze
Jan Weitzel (Autor) Die ökonomische Bedeutung des Bankensektors unter Berücksichtigung der Too-Big-to-Fail -Doktrin Theoretische Zusammenhänge, empirische Erkenntnisse und ordnungspolitische Lösungsansätze
WESTLICHE DEMOKRATIEN UND HUMANITÄRE MILITÄRISCHE INTERVENTION
 2004 U 635 WESTLICHE DEMOKRATIEN UND HUMANITÄRE MILITÄRISCHE INTERVENTION EINE ANALYSE DER NATO-INTERVENTION IM KONFLIKT UM DEN KOSOVO Abhandlung zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät
2004 U 635 WESTLICHE DEMOKRATIEN UND HUMANITÄRE MILITÄRISCHE INTERVENTION EINE ANALYSE DER NATO-INTERVENTION IM KONFLIKT UM DEN KOSOVO Abhandlung zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät
Die Absorptionsfähigkeit externen technologischen Wissens Konzeptionalisierung, Einflussfaktoren und Erfolgswirkung
 Die Absorptionsfähigkeit externen technologischen Wissens Konzeptionalisierung, Einflussfaktoren und Erfolgswirkung Von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Rheinisch-Westfälischen Technischen
Die Absorptionsfähigkeit externen technologischen Wissens Konzeptionalisierung, Einflussfaktoren und Erfolgswirkung Von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Rheinisch-Westfälischen Technischen
Rationalität und ökonomische Methode
 Thies Clausen Rationalität und ökonomische Methode mentis PADERBORN ÜBERBLICK I. Einleitung: Rationalität, Entscheidungstheorie und Sozialwissenschaften 1. Die ökonomische Methode in den Sozialwissenschaften
Thies Clausen Rationalität und ökonomische Methode mentis PADERBORN ÜBERBLICK I. Einleitung: Rationalität, Entscheidungstheorie und Sozialwissenschaften 1. Die ökonomische Methode in den Sozialwissenschaften
Inhalt. Vorwort 15. I. Theorien und Methoden
 Vorwort 15 I. Theorien und Methoden 1 Einführung 21 1.1 Einleitung 21 1.2 Theorien der vergleichenden Staatstätigkeitsforschung im Überblick 22 Literatur 26 2 Die Sozioökonomische Schule 29 2.1 Einleitung
Vorwort 15 I. Theorien und Methoden 1 Einführung 21 1.1 Einleitung 21 1.2 Theorien der vergleichenden Staatstätigkeitsforschung im Überblick 22 Literatur 26 2 Die Sozioökonomische Schule 29 2.1 Einleitung
Ein Hauch von Jasmin
 Janis Brinkmann Ein Hauch von Jasmin Die deutsche Islamberichterstattung vor, während und nach der Arabischen Revolution eine quantitative und qualitative Medieninhaltsanalyse HERBERT VON HALEM VERLAG
Janis Brinkmann Ein Hauch von Jasmin Die deutsche Islamberichterstattung vor, während und nach der Arabischen Revolution eine quantitative und qualitative Medieninhaltsanalyse HERBERT VON HALEM VERLAG
Internationale Politik und Internationale Beziehungen: Einführung
 Anne Faber Internationale Politik und Internationale Beziehungen: Einführung Macht in der internationalen Politik: Realismus und Neo-Realismus 28.11.2011 Organisation Begrüßung TN-Liste Fragen? Veranstaltungsplan
Anne Faber Internationale Politik und Internationale Beziehungen: Einführung Macht in der internationalen Politik: Realismus und Neo-Realismus 28.11.2011 Organisation Begrüßung TN-Liste Fragen? Veranstaltungsplan
Krieg und Flucht im Unterricht. Biographische Zugänge und didaktische Materialien. Verena Brenner
 Krieg und Flucht im Unterricht Biographische Zugänge und didaktische Materialien Verena Brenner Diese Publikation ist das Ergebnis des seitens des Staatsministeriums Baden-Württembergs geförderten Projektes
Krieg und Flucht im Unterricht Biographische Zugänge und didaktische Materialien Verena Brenner Diese Publikation ist das Ergebnis des seitens des Staatsministeriums Baden-Württembergs geförderten Projektes
Grundzüge der Internationalen Beziehungen
 Grundzüge der Internationalen Beziehungen Einführung in die Außenpolitik Grundbegriffe I Gliederung der Vorlesung Datum Nr. Thema Leitung Literatur Lehreinheit 18.10. 1 Die Entscheider Thomas Jäger 1 25.10.
Grundzüge der Internationalen Beziehungen Einführung in die Außenpolitik Grundbegriffe I Gliederung der Vorlesung Datum Nr. Thema Leitung Literatur Lehreinheit 18.10. 1 Die Entscheider Thomas Jäger 1 25.10.
politisch umstrittenen Begriff geworden.
 Ist es unter solchen (?) Bedingungen überhaupt noch sinnvoll, am Begriff des Krieges als einer zusammenfassenden Bezeichnung großräumig organisierter Gewalt festzuhalten? Tatsächlich hat mit dem Ende des
Ist es unter solchen (?) Bedingungen überhaupt noch sinnvoll, am Begriff des Krieges als einer zusammenfassenden Bezeichnung großräumig organisierter Gewalt festzuhalten? Tatsächlich hat mit dem Ende des
Grundsätze zum wissenschaftlichen Arbeiten Prof. Thomas Dreiskämper Wissenschaftliches Arbeiten
 Grundsätze zum wissenschaftlichen Arbeiten 2010 1 Formale Kriterien (1) 1. Literaturbasis Qualität der Quellen Wissenschaftliche Arbeiten brauchen wissenschaftliche Quellen. Das Internet ist nur zu verwenden,
Grundsätze zum wissenschaftlichen Arbeiten 2010 1 Formale Kriterien (1) 1. Literaturbasis Qualität der Quellen Wissenschaftliche Arbeiten brauchen wissenschaftliche Quellen. Das Internet ist nur zu verwenden,
Krieg und Frieden. Vorlesung Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung
 Krieg und Frieden Vorlesung Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung Wintersemester 2007/2008 Krieg und Frieden Überblick Krieg Drei klassische Kriegsbegriffe: Kant, Clausewitz, Völkerrecht Probleme
Krieg und Frieden Vorlesung Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung Wintersemester 2007/2008 Krieg und Frieden Überblick Krieg Drei klassische Kriegsbegriffe: Kant, Clausewitz, Völkerrecht Probleme
Thema: Friedensschlüsse und Ordnungen des Friedens in der Moderne
 Qualifikationsphase 2: Unterrichtsvorhaben V Thema: Friedensschlüsse und Ordnungen des Friedens in der Moderne I Übergeordnete Kompetenzen en ordnen historische Ereignisse, Personen, Prozesse und Strukturen
Qualifikationsphase 2: Unterrichtsvorhaben V Thema: Friedensschlüsse und Ordnungen des Friedens in der Moderne I Übergeordnete Kompetenzen en ordnen historische Ereignisse, Personen, Prozesse und Strukturen
Stabilität und Wandel von Parteien und Parteiensystemen
 «JMS - Andreas Ladner Stabilität und Wandel von Parteien und Parteiensystemen Eine vergleichende Analyse von Konfliktlinien, Parteien und Parteiensystemen in den Schweizer Kantonen VS VERLAG FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN
«JMS - Andreas Ladner Stabilität und Wandel von Parteien und Parteiensystemen Eine vergleichende Analyse von Konfliktlinien, Parteien und Parteiensystemen in den Schweizer Kantonen VS VERLAG FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN
Bewertung der Bachelorarbeit von Frau/Herrn:
 PrüferIn: Bewertung der Bachelorarbeit von Frau/Herrn: Thema: Die Arbeit wurde mit der Note bewertet. Heidenheim, den 1 PrüferIn Bewertet wurden die im folgenden dargestellten Dimensionen und Aspekte:
PrüferIn: Bewertung der Bachelorarbeit von Frau/Herrn: Thema: Die Arbeit wurde mit der Note bewertet. Heidenheim, den 1 PrüferIn Bewertet wurden die im folgenden dargestellten Dimensionen und Aspekte:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Ich muss wissen, was ich machen will... - Ethik lernen und lehren in der Schule Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Ich muss wissen, was ich machen will... - Ethik lernen und lehren in der Schule Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Verknüpfung Luhmann Kant zum Thema Weltrepublik
 Verknüpfung Luhmann Kant zum Thema Weltrepublik Gliederung Autor: Kristian Dressler, 24.4.2008 1. Einleitung 2. Kleinigkeiten zu Luhmanns Systemtheorie 3. Das Politiksystem 4. Der Staat im Politiksystem
Verknüpfung Luhmann Kant zum Thema Weltrepublik Gliederung Autor: Kristian Dressler, 24.4.2008 1. Einleitung 2. Kleinigkeiten zu Luhmanns Systemtheorie 3. Das Politiksystem 4. Der Staat im Politiksystem
Universität Passau. Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Internationales Management. Eingereicht bei: Prof. Dr. Carola Jungwirth.
 Universität Passau Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Internationales Management Eingereicht bei: Prof. Dr. Carola Jungwirth Masterarbeit Die Region Passau ein attraktiver Arbeitsplatz für junge
Universität Passau Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Internationales Management Eingereicht bei: Prof. Dr. Carola Jungwirth Masterarbeit Die Region Passau ein attraktiver Arbeitsplatz für junge
Methodologie der Sozialwissenschaften
 Karl-Dieter Opp Methodologie der Sozialwissenschaften Einführung in Probleme ihrer Theorienbildung und praktischen Anwendung 6. Auflage VS VERLAG FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN Inhaltsverzeichnis Vorwort 10
Karl-Dieter Opp Methodologie der Sozialwissenschaften Einführung in Probleme ihrer Theorienbildung und praktischen Anwendung 6. Auflage VS VERLAG FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN Inhaltsverzeichnis Vorwort 10
Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen
 Geisteswissenschaft Marian Berginz Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen Studienarbeit Marian Berginz WS 04/05 Soziologische Theorien Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen
Geisteswissenschaft Marian Berginz Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen Studienarbeit Marian Berginz WS 04/05 Soziologische Theorien Georg Simmel, Rembrandt und das italienische Fernsehen
Carl von Clausewitz: Vom Kriege. 1. Buch: Über die Natur des Krieges
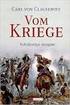 Carl von Clausewitz: Vom Kriege 1. Buch: Über die Natur des Krieges Gliederung: Einleitung Handlungstheorie Restrektionen Außenpolitik Einleitung Carl von Clausewitz geb. 1780 in Berg Sohn bürgerlicher
Carl von Clausewitz: Vom Kriege 1. Buch: Über die Natur des Krieges Gliederung: Einleitung Handlungstheorie Restrektionen Außenpolitik Einleitung Carl von Clausewitz geb. 1780 in Berg Sohn bürgerlicher
Johannes Christian Panitz
 Johannes Christian Panitz Compliance-Management Anforderungen, Herausforderungen und Scorecard-basierte Ansätze für eine integrierte Compliance-Steuerung Verlag Dr. Kovac Hamburg 2012 VORWORT ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Johannes Christian Panitz Compliance-Management Anforderungen, Herausforderungen und Scorecard-basierte Ansätze für eine integrierte Compliance-Steuerung Verlag Dr. Kovac Hamburg 2012 VORWORT ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Wissenschaftstheorie und Ethik
 Wissenschaftstheorie und Ethik Kritischer Rationalismus (KR) Doz. Dr. Georg Quaas: Wissenschaftstheorie und Ethik, SoSe 2012 1 3.4 Kritik des Psychologismus in der Erkenntnistheorie Gegenstand: Erkenntnis
Wissenschaftstheorie und Ethik Kritischer Rationalismus (KR) Doz. Dr. Georg Quaas: Wissenschaftstheorie und Ethik, SoSe 2012 1 3.4 Kritik des Psychologismus in der Erkenntnistheorie Gegenstand: Erkenntnis
Masterarbeit. Indikatoren für die Landwirtschaftliche Planung
 Masterarbeit Indikatoren für die Landwirtschaftliche Planung Autor: Pascal Senn Leitung: Prof. Dr. Adrienne Grêt-Regamey Betreuung: Sven-Erik Rabe Zürich, Februar 2017 I Quelle Titelbild: PLUS Pascal Senn
Masterarbeit Indikatoren für die Landwirtschaftliche Planung Autor: Pascal Senn Leitung: Prof. Dr. Adrienne Grêt-Regamey Betreuung: Sven-Erik Rabe Zürich, Februar 2017 I Quelle Titelbild: PLUS Pascal Senn
Aufgabenbezogene Diversität. in interdisziplinären Teams: Messung und Konsequenzen. für die Zusammenarbeit
 Tobias Feising Aufgabenbezogene Diversität in interdisziplinären Teams: Messung und Konsequenzen für die Zusammenarbeit Inhaltsverzeichnis A. ABBILDUNGSVERZEICHNIS XI B. TABELLENVERZEICHNIS XIII C. ZUSAMMENFASSUNG
Tobias Feising Aufgabenbezogene Diversität in interdisziplinären Teams: Messung und Konsequenzen für die Zusammenarbeit Inhaltsverzeichnis A. ABBILDUNGSVERZEICHNIS XI B. TABELLENVERZEICHNIS XIII C. ZUSAMMENFASSUNG
Entwicklung des Hannoveraner Referenzmodells. für Sicherheit. und Evaluation an Fallbeispielen. Diplomarbeit
 Entwicklung des Hannoveraner Referenzmodells für Sicherheit und Evaluation an Fallbeispielen Diplomarbeit zur Erlangung des Grades eines Diplom-Ökonomen der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Leibniz
Entwicklung des Hannoveraner Referenzmodells für Sicherheit und Evaluation an Fallbeispielen Diplomarbeit zur Erlangung des Grades eines Diplom-Ökonomen der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Leibniz
UNIVERSITÄT DER BUNDESWEHR MÜNCHEN FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTS- UND ORGANISATIONSWISSENSCHAFTEN
 UNIVERSITÄT DER BUNDESWEHR MÜNCHEN FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTS- UND ORGANISATIONSWISSENSCHAFTEN Der Einfluss angstinduzierter Denk- und Verhaltensmuster auf die potenzialorientierte Führung - dargestellt
UNIVERSITÄT DER BUNDESWEHR MÜNCHEN FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTS- UND ORGANISATIONSWISSENSCHAFTEN Der Einfluss angstinduzierter Denk- und Verhaltensmuster auf die potenzialorientierte Führung - dargestellt
Rezeption der Umweltproblematik in der Betriebswirtschaftslehre
 Roswitha Wöllenstein Rezeption der Umweltproblematik in der Betriebswirtschaftslehre Eine empirische Rekonstruktion und strukturationstheoretische Analyse der ökologieorientierten Forschung in der Betriebswirtschaftslehre
Roswitha Wöllenstein Rezeption der Umweltproblematik in der Betriebswirtschaftslehre Eine empirische Rekonstruktion und strukturationstheoretische Analyse der ökologieorientierten Forschung in der Betriebswirtschaftslehre
SOZIALWISSENSCHAFTEN
 SOZIALWISSENSCHAFTEN Lisa Eckhardt, Annika Funke, Christina Pautzke Bergische Universität Wuppertal WiSe 17/18 Sichtweisen der Sozialwissenschaften Dr. Bongardt Sozialwissenschaften Bereiche Politikwissenschaften
SOZIALWISSENSCHAFTEN Lisa Eckhardt, Annika Funke, Christina Pautzke Bergische Universität Wuppertal WiSe 17/18 Sichtweisen der Sozialwissenschaften Dr. Bongardt Sozialwissenschaften Bereiche Politikwissenschaften
Konflikte in Organisationen
 Konflikte in Organisationen Formen, Funktionen und Bewältigung von Erika Regnet 2., überarbeitete Auflage Verlag für Angewandte Psychologie Göttingen Inhalt Einleitung 5 1. Was versteht man unter einem
Konflikte in Organisationen Formen, Funktionen und Bewältigung von Erika Regnet 2., überarbeitete Auflage Verlag für Angewandte Psychologie Göttingen Inhalt Einleitung 5 1. Was versteht man unter einem
Zur Entstehungsgeschichte von Thomas Morus' Utopia und Niccolo Machiavelli's Der Fürst
 Politik Frank Hoffmann Zur Entstehungsgeschichte von Thomas Morus' Utopia und Niccolo Machiavelli's Der Fürst Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1.Einleitung...S. 2 2.Die Renaissance... S. 3 3. Das Leben
Politik Frank Hoffmann Zur Entstehungsgeschichte von Thomas Morus' Utopia und Niccolo Machiavelli's Der Fürst Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1.Einleitung...S. 2 2.Die Renaissance... S. 3 3. Das Leben
Sanktionen der Vereinten Nationen in Afrika, 1990 bis 2004: Übersicht / Aufteilung nach Ländern (alphabetisch)
 Sanktionen der Vereinten Nationen in Afrika, 1990 bis : Übersicht / Aufteilung nach Ländern (alphabetisch) Land Sanktionsziel Sanktionstyp Zielsetzung 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 Sicherheitspolitischer Kontext
Sanktionen der Vereinten Nationen in Afrika, 1990 bis : Übersicht / Aufteilung nach Ländern (alphabetisch) Land Sanktionsziel Sanktionstyp Zielsetzung 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 Sicherheitspolitischer Kontext
Konfliktforschung II Herausforderungen und Lösungen gegenwärtiger Konflikte
 Konfliktforschung II Herausforderungen und Lösungen gegenwärtiger Konflikte Woche 3: Polit-Ökonomische Motivationen Prof. Dr. Lars-Erik Cederman Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Center for Comparative
Konfliktforschung II Herausforderungen und Lösungen gegenwärtiger Konflikte Woche 3: Polit-Ökonomische Motivationen Prof. Dr. Lars-Erik Cederman Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Center for Comparative
Einfluss von Industrie 4.0 auf die Organisation eines Industrieunternehmens
 Einfluss von Industrie 4.0 auf die Organisation eines Industrieunternehmens Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B. Sc.) im Studiengang Wirtschaftswissenschaft der
Einfluss von Industrie 4.0 auf die Organisation eines Industrieunternehmens Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Bachelor of Science (B. Sc.) im Studiengang Wirtschaftswissenschaft der
Amerikanisierung deutscher Unternehmen in den 50er Jahren
 Geschichte Julia Arndt Amerikanisierung deutscher Unternehmen in den 50er Jahren Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 2 2. Begriff Amerikanisierung... 2 3. Durchbruch der Amerikanisierung
Geschichte Julia Arndt Amerikanisierung deutscher Unternehmen in den 50er Jahren Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 2 2. Begriff Amerikanisierung... 2 3. Durchbruch der Amerikanisierung
Politik begreifen. Schriften zu theoretischen und empirischen Problemen der Politikwissenschaft. Band 16
 Politik begreifen Schriften zu theoretischen und empirischen Problemen der Politikwissenschaft Band 16 Können sozialpolitische Dienstleistungen Armut lindern? Eine empirische Analyse wirtschaftlich entwickelter
Politik begreifen Schriften zu theoretischen und empirischen Problemen der Politikwissenschaft Band 16 Können sozialpolitische Dienstleistungen Armut lindern? Eine empirische Analyse wirtschaftlich entwickelter
Konfliktforschung II Herausforderungen und Lösungen gegenwärtiger Konflikte: Woche 2: Neue und alte Kriege
 Konfliktforschung II Herausforderungen und Lösungen gegenwärtiger Konflikte: Woche 2: Neue und alte Kriege Prof. Dr. Lars-Erik Cederman Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Center for Comparative
Konfliktforschung II Herausforderungen und Lösungen gegenwärtiger Konflikte: Woche 2: Neue und alte Kriege Prof. Dr. Lars-Erik Cederman Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Center for Comparative
Inhaltsverzeichnis. Danksagung Abkürzungsverzeichnis... 13
 Inhaltsverzeichnis Danksagung.................................................... 5 Abkürzungsverzeichnis........................................... 13 1 Einleitung...................................................
Inhaltsverzeichnis Danksagung.................................................... 5 Abkürzungsverzeichnis........................................... 13 1 Einleitung...................................................
Wahrnehmung, Bewertung und Bewältigung von subjektiven schwierigen Sprachhandlungssituationen im Einzelhandel
 Wahrnehmung, Bewertung und Bewältigung von subjektiven schwierigen Sprachhandlungssituationen im Einzelhandel Situationsbezogene Rekonstruktion der Perspektive der Auszubildenden über Critical Incidents
Wahrnehmung, Bewertung und Bewältigung von subjektiven schwierigen Sprachhandlungssituationen im Einzelhandel Situationsbezogene Rekonstruktion der Perspektive der Auszubildenden über Critical Incidents
Zivile Konfliktbearbeitung
 Zivile Konfliktbearbeitung Vorlesung Gdfkgsd#älfeüroktg#üpflgsdhfkgsfkhsäedlrfäd#ögs#dög#sdöfg#ödfg#ö Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung Wintersemester 2007/08 Marburg, 29. Januar 2008 Zivile
Zivile Konfliktbearbeitung Vorlesung Gdfkgsd#älfeüroktg#üpflgsdhfkgsfkhsäedlrfäd#ögs#dög#sdöfg#ödfg#ö Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung Wintersemester 2007/08 Marburg, 29. Januar 2008 Zivile
Wie schreibe ich eine Bachelorarbeit Beispiel: Prosekretorische Wirkung von STW 5 (Iberogast ) in der humanen Darmepithelzelllinie T84
 Wie schreibe ich eine Bachelorarbeit Beispiel: Prosekretorische Wirkung von STW 5 (Iberogast ) in der humanen Darmepithelzelllinie T84 Allgemeine Bemerkungen Seitenzahl korreliert nicht mit Qualität. Eine
Wie schreibe ich eine Bachelorarbeit Beispiel: Prosekretorische Wirkung von STW 5 (Iberogast ) in der humanen Darmepithelzelllinie T84 Allgemeine Bemerkungen Seitenzahl korreliert nicht mit Qualität. Eine
Wortschatz 200+ Nomen
 Wortschatz 200+ Nomen Diese Liste enthält 200+ themenunabhängige Nomen/Substantive, die wichtig sind für o die Beschreibung von Statistiken o die Interpretation von Texten o Diskussionen über kontroverse
Wortschatz 200+ Nomen Diese Liste enthält 200+ themenunabhängige Nomen/Substantive, die wichtig sind für o die Beschreibung von Statistiken o die Interpretation von Texten o Diskussionen über kontroverse
Junge, Christian. Sozialdemokratische Union Deutschlands? Die Identitätskrise deutscher Volksparteien aus Sicht ihrer Mitglieder
 Name: Junge, Christian Titel der Dissertation: Parteien ohne Eigenschaften. Eine explorative Studie zu Ausprägungen und möglichen Effekten von Diffusion organisationaler Identität im Erscheinungsbild der
Name: Junge, Christian Titel der Dissertation: Parteien ohne Eigenschaften. Eine explorative Studie zu Ausprägungen und möglichen Effekten von Diffusion organisationaler Identität im Erscheinungsbild der
