Jörg Krappmann, Marie Krappmann, Karsten Rinas Sprachphilosophie
|
|
|
- Elke Adler
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1
2 Modul Philosophie Jörg Krappmann, Marie Krappmann, Karsten Rinas Sprachphilosophie Vorwort Einleitung: Die Stellung der Sprachphilosophie innerhalb der Philosophie... 4 Text 1 Johannes Haag: Sprachphilosophie. Die Flüchtigkeit der Bedeutung...4 Text 2 Johannes Hirschberger: Analytische Philosophie Historische Etappen der Sprachphilosophie Überblicksdarstellungen... 6 Text 3 Herbert Schnädelbach: Philosophie...6 Text 4 Ernst Tugendhat / Ursula Wolf: Logik und moderne Sprachphilosophie Sprachphilosophie in der Antike...21 Text 5 Platon: Kratylos Text 6 Jürgen Trabant: Platon Sprachphilosophie in der Spätscholastik...44 Text 7 Jürgen Villers: Nominalistischer Aristotelismus und die Sprache (Ockham) Text 8 Johann Huizinga: Herbst des Mittelalters Sprache in Aufklärung und deutschem Idealismus Sprachphilosophie im 19. Jahrhundert...49 Text 9 Wilhelm von Humboldt: Zum Ursprung der Sprache Text 10 Adolf Stöhr: Über den Unsinn Die Sprachkrise am Ende des 19. Jahrhunderts Text 11 Friedrich Nietzsche: Sprache und Wahrheit Der linguistic turn Text 12 Wittgenstein: Die Hauptsätze aus dem Tractatus-logico philosophicus.. 52 Text 13 Wittgenstein: Von der Logik zur Philosophie Philosophie der idealen Sprache vs. Philosophie der normalen Sprache Text 14 Gottlob Frege: Über die wissenschaftliche Berichtigung einer Begriffsschrift Text 15 Eike von Savigny: Das Normalsprachenprogramm in der Analytischen Philosophie Ausblick: Sprache und Kulturwissenschaft...62 Text 16 Claudia Fahrenwald: Vom Ende der großen Erzählungen Bibliografie zu Texten
3 Modul Philosophie 3 Vorwort Dieser Reader wurde im Rahmen des von der VolkswagenStiftung geförderten Projekts Deutsch als Sprache der Geisteswissenschaften an der Germanistik der Palacký-Universität Olmütz erarbeitet. Er wendet sich insbesondere an Studenten dieses Studiengangs, die Philosophie als Schwerpunktfach gewählt haben. Grundsätzlich dürfte er jedoch generell für interessierte Germanistik- oder Philosophie-Studenten geeignet sein. Unser Ziel war es, durch die Präsentation ausgewählter Texte ein Verständnis für Grund probleme der Sprachphilosophie zu wecken. Die Präsentation erfolgt primär chrono logisch, integriert jedoch auch systematisierende Darstellungen. Unser besonderer Dank gilt der Organisatorin des Projekts Deutsch als Sprache der Geisteswissenschaften, Ingeborg Fiala-Fürst, sowie der VolkswagenStiftung. Olmütz, im Juli 2013 Jörg Krappmann Marie Krappmann Karsten Rinas
4 Modul Philosophie 4 1. Einleitung: Die Stellung der Sprachphilosophie innerhalb der Philosophie Die Sprache wird gemeinhin als wichtigstes Unterscheidungsmerkmal des Menschen zur Tierund Pflanzenwelt anerkannt. Daran haben auch die Forschungen der Biologen und Zoologen, die in den letzten Jahrzehnten auch Sprachsysteme bei höher entwickelten Tieren nachweisen konnten, nichts geändert. Keine der bisher entschlüsselten Tiersprachen erreicht den Grad an Komplexität und Differenziertheit wie die der menschlichen Sprache. Sie gehört zum menschlichen Leben ebenso wie zum menschlichen Denken und es ist damit leicht verständlich, dass sie auch früh zum Gegenstand philosophischer Betrachtung wurde. Gerade innerhalb der Philosophie, müsste man ergänzen, denn nach allgemeiner Auffassung zeichnen sich Philosophen eben siehe Sokrates dadurch aus, dass sie mit sprachlichen Argumenten in Dialoge eingreifen, um diese zu einem für sie erfolgreichen Abschluss zu führen. Und es sind neben handgreiflichen auch sprachliche Äußerungen siehe Xanthippe die sie wieder ins Alltagsleben zurückholen, wenn sie sich in den Gesprächen verloren haben. Letztlich ist alles, was wir von der Philosophie wissen, sprachlich. Es wurde sprachlich gedacht, in sprachlicher Form (in Texten) festgehalten und mittels sprachlicher Erkennungsverfahren rezipiert, tradiert, übersetzt und weitergedacht. Trotzdem ist eine eigenständige philosophische Disziplin unter dem Namen Sprach philosophie erst sehr spät entstanden. Während Ethik, Ontologie oder Metaphysik als Disziplinen bereits in der Antike von den Vorsokratikern begründet und späterhin von den Philosophen der klassischen Zeit (Sokrates, Platon, Aristoteles) systematisiert wurden, datieren zahlreiche neuere Publikationen den Beginn der Sprachphilosophie auf die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Verantwortlich für diese Diskrepanz ist die Beurteilung dessen, was Sprachphilosophie eigentlich ist. Text 1 Johannes Haag: Sprachphilosophie. Die Flüchtigkeit der Bedeutung Philosophen aller Epochen haben Sprache als Gegenstand der Philosophie betrachtet. Doch die Beschäftigung mit sprachphilosophischen Problemen hat gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine qualitative Veränderung erfahren. Diese Veränderung war die Voraussetzung für die Wende zum Sprachlichen in der Philosophie, den sog. linguistic turn, die sich dann in den ersten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts vollzog und deren Wirkung bis heute fortdauert. Systematische Philosophie ohne Einbeziehung sprachphilosophischer Fragestellungen ist heute kaum noch denkbar. Anhand der Frage, wie das Verhältnis zwischen den Begriffen Sprache, Denken und Welt zu denken ist, soll diese Wende im folgenden veranschaulicht werden. Denn die Bemühungen der Philosophie des vergangenen Jahrhunderts unterscheiden sich von vorangegangenen philosophi schen Entwürfen dadurch, dass die Rolle der Sprache in dieser Begriffstrias entscheidend aufgewertet wurde. An der traditionellen Auffassung der Funktion von Sprache in dem genannten Begriffsverhältnis ändert sich zunächst und teilweise bis heute nicht viel: Sprache wird weiterhin als Werkzeug betrachtet, das dem Ausdruck und dem Austausch von Gedanken dient. Allerdings werden einige wesentliche Fragen, die mit dieser Auffassung verbunden sind, nun erst als problematisch wahrgenommen. Was heißt es Gedanken auszudrücken? Welche Eigenschaften muß eine Sprache haben, damit sie dazu in der Lage ist, geistige Inhalte zu transportieren? Was heißt es, einen Satz zu verstehen? Fragen wie diese beschäftigen die Sprachphilosophie bis heute, und keine von ihnen hat eine unumstrittene Antwort erhalten. Aber im Laufe der vielfältigen Versuche, diese Probleme zu lösen, rückte Sprache von der Peripherie philosophischen Interesses zusehends in dessen Mittelpunkt.
5 Modul Philosophie 5 Im Zuge unserer Auseinandersetzung mit diesen Fragen werden im folgenden Probleme und Methoden herausgearbeitet, die für die moderne Sprachphilosophie charakteristisch sind. Aus: Eugen Fischer / Wilhelm Vossenkuhl (Hg.): Die Fragen der Philosophie. Eine Einführung in Disziplinen und Epochen. München: Beck 2003, S. 89. Fragen 1. Haag zufolge hat die Beschäftigung mit sprachphilosophischen Problemen [...] gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine qualitative Veränderung erfahren. Was ist der Gegensatz zu einer qualitativen Veränderung? 2. Finden sich im zitierten Auszug Begründungen oder Erläuterungen der These, dass es in der (Sprach-)Philosophie zu einer qualitativen Veränderung gekommen ist? 3. Laut Haag ist ein wichtiges philosophisches Problem die Klärung der Verhältnisse zwischen Sprache, Denken und Welt. Wie ließen sich diese Verhältnisse nach unserer naiven, alltäglichen Auffassung bestimmen? Text 2 Johannes Hirschberger: Analytische Philosophie Daß alle Philosophie Sprachanalyse sein soll, ist nun eine Ansicht, die selbst wieder verschieden verstanden werden kann. Die englischen Analytiker [gemeint sind Russell u. a.] berufen sich darauf, dass alle Philosophie immer schon Sprachanalyse gewesen sei. Wenn Platon etwa Begriffe wie gut und wahr aufgreift, tue er nichts anderes, als dass er die Sprache in ihre Gehalte zerlege. Das wird man nicht bestreiten können, genauer, man wird nicht bestreiten können, dass er davon ausgeht. Das hat die Philosophie tatsächlich immer getan und muß sie immer tun, weil viele philosophische Theorien nur auf Missverständnissen des Gesehenen und Gesagten beruhen. Man wird allerdings nicht zugeben, dass die Philosophie keine eigenen Wahrheiten finden und nur wiedergeben könne, was schon in der Sprache enthalten sei. Aber Sprachanalyse überhaupt ist ein unerlässliches philosophisches Denkmittel und war es immer. [ ] Nur hat man darüber nicht viel Aufhebens gemacht und das handwerkliche Rüstzeug nicht zur Philosophie im Ganzen aufgeblasen. Aus: Johannes Hirschberger: Geschichte der Philosophie. Band 2. Frankfurt/Main: Zweitausendeins 2001, S Fragen 1. Nach Hirschberger war die Philosophie in einem gewissen Sinne immer schon Sprachanalyse. Erläutern Sie dies. 2. Welche Einstellung zur Sprachphilosophie haben die englischen Analytiker (= die Vertreter der Analytischen Philosophie)? 3. Welche Bedeutung für die Philosophie weist Hirschberger der Sprachanalyse zu? Inwiefern unterscheidet sich seine Position von der der Analytischen Philosophie? 4. Erklären Sie die Bedeutung von etwas zu etwas aufblasen. Erläutern Sie, wie Hirschberger diese pejorative Wendung verwendet, um die Analytische Philosophie zu kritisieren.
6 Modul Philosophie 6 2. Historische Etappen der Sprachphilosophie Im Folgenden sollen ausgewählte wichtige Beiträge zur Sprachphilosophie in Auszügen präsentiert werden. Die Anordnung ist grundsätzlich chronologisch. Um die Einordnung und Interpretation der folgenden Texte zu erleichtern, werden der Darstellung zunächst zwei fachhistorische Überblicksdarstellungen vorausgeschickt. 2.1 Überblicksdarstellungen Text 3 Herbert Schnädelbach: Philosophie Einleitung [...] Unabhängig von bestimmten Philosophiekonzepten [kann man] nicht definieren [...], was Philosophie sei. Man kann deswegen auch nicht in die Philosophie einführen, ohne zumindest implizit das Phi lo so phieverständnis ins Spiel zu bringen, das man als Einführender selber besitzt. Man kann somit auch nicht kontextfrei in das Philosophieren einführen; denn auch das Methoden verständnis wandelt sich mit dem allgemeinen Bild von Philosophie. Dies ist übrigens der wahre Grund für die vielbeklagte Uneinigkeit der Philosophen untereinander. Es trifft nicht zu, daß sie so viel zerstrittener seien als etwa die Psychologen oder Sozialwissenschaftler, sondern ihr Problem ist, daß die Ansichten darüber, was Philosophie sei und wie ihre Gegen stände und Methoden zu bestimmen seien, immer schon auf eine philosophische Gesamt kon zeption verweisen. Für eine Darstellung des Philosophiebegriffs ergeben sich daraus zwei Folgerungen. Wegen des Wandels dieses Begriffs kann man ihn nur mit begriffsgeschichtlichen Mitteln fassen. Dann aber genügt es nicht, nur aufzulisten, was jeweils als Philosophie definiert wurde, sondern man muß den jeweiligen Kontext solcher Definitionen mit berücksichtigen, d. h. man muß zumindest in Umrissen die Geschichte jener Gesamtkonzeptionen von Philosophie vor Augen stellen, von der die Geschichte des Philosophiebegriffs selbst nur ein Aspekt ist. [...] Im folgenden soll versucht werden, nach einigen Bemerkungen über die Anfänge die drei großen Konzep tionen von Philosophie, die sich in unserer Tradition unterscheiden lassen, dadurch zu beschrei ben, daß immer vom jeweiligen expliziten Philosophiebegriff ausgegangen wird, um dann zu dem überzu gehen, was jeweils als der Gegenstand, die Methode und die richtige Einteilung der Philosophie ange sehen wurde. Die dadurch skizzierten Konzeptionen von Philosophie werden mit Thomas S. Kuhn Para digma genannt werden (Kuhn 1967). Ein Paradigma umfaßt immer Vor stellungen vom Gegen stands gebiet, von einschlägigen Problem stellungen und vorbildlichen Pro blem lösungen einer Disziplin [...]. [In der folgenden Darstellung sollen] ein ontologisches [griech. tò ón das Seiende], ein mentalistisches (lat. mens das Bewußtsein) und ein linguistisches Paradigma unterschieden werden. [...] Die paradig men geschichtliche Darstellung des Philosophiebegriffs ist [...] nur eine ideale Rekonstruktion seiner Geschichte, die ohne starke Typisierung und Vereinfachung nicht aus kommt. Ihr methodischer Vorteil aber besteht darin, daß man aus ihr erst einmal ein struktu riertes Gesamtmodell gewinnen kann, das sich dann im Lichte von historischen Detailunter suchungen präzisieren und kritisieren läßt. [...] Eine [...] Grundthese des folgenden ist nun, daß die Philosophie als Wissenschaft immer durch Auf klä rungs schritte von dem einen Paradigma zum anderen übergegangen ist wenn man nur den argumen tati ven Gehalt solcher Übergänge berücksichtigt. Es wäre eine Vereinfachung, hier von Ent wick lung zu spre chen, weil jeder Fortschritt immer auch einen Preis hat und man nicht aus schließen kann, daß das, was auf der einen Seite wie ein Fortschritt aussieht, aus anderer Perspektive als Rück schritt, als ein Ver gessen oder als Verlust von Wesentlichem erscheint. Dies ist übrigens der Grund für die Neigung der Philosophie zu Renaissancen: Nimmt man den Aristo
7 Modul Philosophie 7 telismus des Mittelalters, den Platonismus der Renaissance [...], aber auch den Neukan tianismus, Neuthomismus, Neuhegelianismus und andere Neu...ismen als Beispiel, wird deutlich, daß die produktive Erinnerung an das vermeintlich Veraltete zum philosophischen Fortschritt offenbar notwendig hinzugehört; in kaum einer anderen Disziplin ist dies der Fall. Daraus folgt auch, daß die Philosophie ein anderes Verhältnis zu ihrer Geschichte unterhalten muß als die Einzelwissenschaften. Weil es zu ihren Aufgaben gehört, die Fort schrittsidee selbst kritisch zu diskutieren, kann sie sich in ihrem eigenen wissenschaftstheoretischen Selbstver ständnis dieser Idee nicht kritiklos einfach überlassen; sie muß also immer zugleich über einen Begriff von Philosophie und einen Begriff von der Geschichte dieses Begriffs verfügen. [...] Das ontologische Paradigma Was ontologische Philosophie ist, soll in diesem Abschnitt an Platon und Aristoteles verdeutlicht werden: durch Hinweise auf Begriff, Gegenstand, Methode und Einteilung von Philosophie in ihrem Sinne. Das platonisch-aristotelische Modell ist das der klassischen Metaphysik, das bis zum Beginn der Neuzeit alles Philosophieren bestimmte. [...] Die Ausdrücke Metaphysik und Ontologie freilich kommen bei Platon und Aristoteles selbst nicht vor. Während das Wort Metaphysik schon im 1. Jahrhundert v. Chr. geprägt wurde, ist Ontologie ein Kunstwort aus dem 16. Jahrhundert. Es bedeutet in der Spätscholastik die allgemeine Metaphysik als Lehre vom Seienden als solchen und im allgemeinen. [...] Bei Platon lassen sich zwei Grundbedeutungen von Philosophie unterscheiden. Einmal ist damit jede syste matisch betriebene theoretische Erkenntnis gemeint so die Geometrie (vgl. Theätet 143d); auch der Besitz einer solchen Erkenntnis wird von Platon Philosophie genannt (vgl. Euthydem 288 d). An solchen Stellen ist Philosophie gleichbedeutend mit Wissenschaft. [...] Die andere Bedeutung von Philoso phie [...] ist Liebe zur Weisheit. Somit ist hier die Philosophie] von der Weisheit (sophía) her bestimmt [...], auch wenn sie sich von ihr unter scheidet; erst wenn sie am Ziel ist, fällt die philosophía mit der sophía zusammen [...] Fragt man nun, warum die Philosophie gerade so und nicht anders bestimmt wird, verweist einen das ontologische Paradigma auf den Gegenstand; ontologisches Philosophieren ist immer Philoso phie ren vom Gegenstand her. Dies ist zunächst auch plausibel; denn wie sollte man Erkenntnis auf andere Weise näher qualifizieren als dadurch, daß man fragt, wovon die Erkenntnis ist? [...] Erkenntnis muß Erkenntnis von etwas sein, und dieses Etwas muß sein und kann nicht nicht sein; Erkenntnis von nichts wäre nichts. Erkenntnis aber des Seienden (tò ón) ist ontologische Er kenntnis. Sie wird vom Seienden selbst auf den Weg gebracht; darum liegt ihr Anfang im Staunen (thaumázein). Die Grundfrage der Philosophie als On to logie lautet: Was ist? Bemerkenswert ist nun, daß Platon von Vollkommenheitsgraden des Seines des Sei enden ausgeht: Was ist, kann vollkommener oder unvollkommener sein, wobei die vollkommene Erkenntnis die sophía also als Erkenntnis des vollkommen Seienden bestimmt wird. [...] Wenn sich im ontologischen Modell die Philosophie selbst von ihrem Gegenstand her begreift, dann ist dies auch für ihr Methodenverständnis zu erwarten. Methode gehört wortkundlich gesehen zu griech. hodós (der Weg) und bedeutet wörtlich das Nachgehen (eines Weges). Für die Ontologie ist in der Tat Methodologie nichts anderes als das Aufzeigen des Weges zur Wahrheit, der dem Erkennen im Seienden selbst schon gebahnt ist. [...] Platon hat in seinem berühmten Höhlen-Gleichnis im VII. Buch des Staat diesen Weg [...] in vier Stadien bildlich charakterisiert. Er führt das Erkennen von den Schatten an der Höhlenrückwand, die die in der Höhle Gefesselten wahrnehmen, zur Beobachtung dessen, was in der Höhle die Schatten wirft ein Feuer und Menschen, die sich bewegen und Gegenstände hin- und hertragen, dann zur Erfahrung der wirklichen Welt außerhalb der Höhle und schließlich zum Anblick der Sonne, die alles bescheint und von der alles Wärme und Leben hat. Das Sonnen- und das Liniengleichnis vervollständigen Platons Methodologie in Bildern und Gleichnissen, die eben nicht nur eine Verfahrensregel für die Wissenschaft meint, sondern der Seele den Weg aus der Welt der Schatten zur Sonne als der Idee des Guten weisen will. So wie der Weg aus der Höhle Erkenntnis und Befreiung der Seele zugleich bedeutet, ist Platons philosophische Methode primär als ein Bildungsweg der Seele mit dem Ziel ihrer Vergöttlichung zu verstehen. [...]
8 Modul Philosophie 8 Das mentalistische Paradigma Daß die Philosophie erkennen will, was ist, scheint eine Selbstverständlichkeit zu sein. Darum ist ontolo gisches Philosophieren auch so attraktiv, denn da erfährt man etwas über die Welt. Daß die Philosophie seit Descartes mentalistisch wurde und sich in das Innere des Bewußtseins zurückzog, muß demgegen über als ein großer Verlust, ja als Deformation eines ursprünglich gesunden Verhältnisses von Subjekt und Objekt erscheinen. [...] Die Schwierigkeit ist, daß der, der erkennen will, was ist, voraussetzen muß, daß das, was ist, sich auch erkennen läßt. Für den Ontologen ist wahre Erkenntnis nur als Erkenntnis des Wahren möglich; woher weiß er aber, daß das Wahre [...] überhaupt erkennbar ist? Wie kann er sicher sein, daß das, was er zu erkennen meint, wirklich das Wahre ist? Durch Erkenntnis selbst kann er dies nicht feststellen; denn die ist hier ja gerade problematisiert: Man kann nicht erkennen, daß man erkennt. Ontologisches Philoso phie ren wird unmöglich, wenn erst einmal fundamental be zweifelt ist, daß Erkenntnis des wahren Seins gelin gen kann. Diesen Zweifel muß man zuerst ausräumen, wenn man weiter an der Erkenntnis des Seins inter essiert ist. Die Philosophie kann also nicht mehr mit dem Staunen beginnen und sich der Faszination durch die Objektwelt einfach überlassen, sondern sie muß jenen Zweifel, nachdem er einmal in der Welt ist, ernst nehmen, zu ihrer eigenen Sache machen und dann versuchen, ihn so zu bewältigen, daß Philosophie als Wissenschaft der Wahrheit möglich bleibt. Die Anfangsfrage kann nicht mehr sein: Was ist?, sondern sie muß lauten: Was können wir erkennen? oder Was kann ich wissen? (vgl. Kant, KdrV B 833). Historisch gesehen ist diese Veränderung [bereits...] in der antiken Skepsis (von griech. sképtomai ich spähe, blicke umher, überlege) vollzogen worden; die Argumente der beiden skeptischen Schulen, von denen eine zeitweilig die platonische Akademie beherrschte, haben seitdem das Philosophieren immer be gleitet und es gezwungen, sich mit ihnen auseinanderzu setzen. Ihre Einwände gegen die Möglichkeit, das Sein selbst zu erkennen, sind in ihrer Gründ lichkeit und Schlüssigkeit auch in der Moderne nie mehr überboten worden. Selbst Descartes, der Virtuose des methodischen Zweifels (vgl. Descartes, Med. 11ff.), hat die skeptischen Argu mente nur als alten Kohl bezeichnen können, den er nur mit Widerwillen wieder aufwärme (Med. 118), und ihnen nur ein einziges Argument hinzugefügt. Zu fragen ist nun, warum der Beginn des Philosophierens mit dem Zweifel zum Paradigmenwechsel von der ontologischen zur mentalistischen Philosophie nötigt. Hier muß man an die klassische Definition der Wahrheit als Übereinstimmung von Gegenstand und erkennendem Bewußtsein [...] erinnern. Ist diese Adä quation erst ein mal in Frage gestellt, dann können wir uns nicht mehr unmittelbar auf die res (lat. das Ding, die Sache, der Gegenstand) beziehen; denn wir haben zunächst nur unseren intellectus und müssen versuchen, den Skeptiker dadurch zu widerlegen, daß wir vom Boden des Bewußt seins aus die Wahrheit als adaequatio rekonstruieren und sichern. So wird deutlich, daß der Weg nach innen nicht bloß eine subjektive Vorliebe für die Innerlichkeit repräsentiert, sondern unter dem Druck der Skepsis und ihrer Zweifelsargumente erzwungen wird. Seit der antiken Skepsis beginnt alles gründliche Philosophieren mit dem Zweifel, und wenn dies auch kein sehr attraktiver Anfang ist wer läßt sich schon gern in solche Unsicherheit stürzen?, haben doch alle Philosophen samt den Ontologen darauf reagieren müssen und sich stets bemüht, zunächst die Erkenn barkeit des Wahren darzutun. [...] Einen solchen Weg aus der Skepsis gefunden zu haben, ist Augustinus zu verdanken. Nachdem er selbst lange den Skeptizismus vertreten hatte, erkannte er, daß es etwas gibt, was der Zweifelnde nicht bezwei feln kann, und dies ist die Tatsache, daß er zweifelt und daß er, um zweifeln zu können, existieren muß: Ich zweifle, also bin ich (dubito ergo sum) lautet das Argument (De trinitate, X; vgl. auch Augustinus, De libero arbitrio (Über den freien Willen), Kap. 3). Die Existenz des Bewußtseins des Zweifelnden kann von ihm nicht bezweifelt werden und ist für ihn somit die erste unbezweifelbare Tatsache. So kann man den Skeptizismus mit seinen eigenen Waffen schlagen, was aber bedeutet, daß man mit dem Bewußtsein beginnen und zunächst mentalistisch philosophieren muß. Dubito, ergo sum ist das nicht schon das cogito, ergo sum (Ich denke, also bin ich) des Descartes? [...] Das Neue bei Descartes ist nicht das Argument als solches, nicht einmal die Aus weitung des dubito auf alle Bewußtseinsakte cogito heißt nicht nur ich denke, sondern meint alles, was mir bewußt sein kann: also auch Wahrnehmungen, Empfindungen, Gefühle usf., sondern be
9 Modul Philosophie 9 trifft das, was derjenige, der Ich bin denkt, unter seinem Ich begreift. Augustinus versteht sich von vornherein theologisch als Gottes Geschöpf und ist darum sicher, in dem, was er in sich vorfindet, die Spuren Gottes, Anzeichen seiner Schöp fungsgedanken und seines Han delns erkennen zu können. [...] Auf diesem Wege wird dann nicht nur Philosophie insgesamt, sondern sogar noch die antike Skepsis zur Magd der Theologie (ancilla theologiae). Descartes hingegen unterscheidet sich von Augustinus [...] dadurch, daß dieser theolo gische Rahmen wegfällt und das cogito darauf besteht, ganz auf sich selbst zu stehen und ohne weitere Anleihen auszukommen. Die Abhandlung über die Methode zeigt auch autobiographisch, was dahinter steht: das Bedürfnis des neuzeitlichen Subjekts nach Autonomie, nach vernünftiger Selbständig keit, nach Gewißheit im selbst erworbenem Wissen das Prinzip der bürgerlichen Aufklärungsphilo so phie (vgl. Krüger 1962). Dies alles ist gerade im Widerstand gegen die Auto rität der theologisch legi timier ten Tra di tion überhaupt erst zu erringen und zu sichern. Darum fügt Descartes dem Kohl der Zweifels argu mente den Täuscher-Gott hinzu. Es könnte ja sein, daß selbst das, was der christliche Neu plato nismus und Augustinismus auf dem Weg nach innen als Unbezweifelbares vorzufinden glaubt [...], Einge bun gen eine genius malignus (miß güns tiger, boshafter Geist) sind. Aber selbst dann, wenn ein sol cher Genius mich täuscht, sagt Descartes, kann er mich nicht darüber täuschen, daß ich bin, wenn ich denke, daß ich sei (Med. 17ff.) so weit reicht seine Macht nicht. Der Preis hierfür ist, daß der Denkende zunächst nichts anderes in Anspruch nehmen kann als das, was im cogito, ergo sum gedacht und impli ziert ist; nach der Skepsis und nach der Theologie muß die Philosophie als reine Bewußtseinsphilosophie beginnen. Der Paradigmenwechsel vom Sein zum Bewußtsein verändert notwendig auch den Philosophiebegriff. [...] Nach der Skepsis kann die Erste Philosophie nicht mehr Ontologie sein. Meta physik bedeutet nach Descartes nicht mehr die Lehre vom Seiendem als solchem und im allge meinen, sondern sie enthält als erster Systemteil der Philosophie die Prinzipien der mensch lichen Erkenntnis (XLIII). Daß man mit der Untersuchung nicht der Gegenstände, sondern der Möglichkeiten und Grenzen unserer Erkenntnis der Gegen stände philosophisch zu beginnen habe, ist auch Kants Ausgangspunkt, und darin bleibt er Cartesianer. Was man dann im 19. Jahrhundert Erkenntnistheorie nannte, tritt somit an die Stelle der Ersten Philosophie. [...] Die Neubestimmung der Ersten Philosophie als Wissenschaft von den Prinzipien der menschlichen Erkenntnis [...] hat erhebliche Folgen für die Bestimmung des Gegenstandes der Philosophie. [... Kant zufolge ist es] nicht so, wie die Ontologie behauptet, daß sich unsere Weise zu erkennen nach den Gegen ständen richten müsse, sondern unsere Erkenntnisweisen und möglichkeiten legen a priori fest, was Gegenstand unserer Erkenntnis sein kann und was nicht. Damit kehrt sich auch im Verhältnis von Gegenstand und Methode die traditionelle Rang ordnung um; denn die Methode kann sich ja nicht einem Objekt anmessen, das man erst durch das Befolgen einer Methode konstituieren kann. Die Methode gehört schon bei Descartes zu den Prinzipien der menschlichen Erkenntnis und geht aller Gegenstandserkenntnis voraus. In der Abhandlung über die Methode bestimmt sie Descartes in vier Regeln: (1) Nichts soll als wahr angenommen werden, was sich nicht so klar und deutlich dem Geiste dar bietet, daß man es nicht mehr bezweifeln kann; (2) alle Probleme sind in elementare Teilprobleme zu zerlegen; (3) die Lösung ist im geordneten Aufstieg vom Ein fachen zum Komplexen zu suchen; (4) durch vollständige Aufzählung und Übersichten soll man sich versichern, nichts vergessen zu haben (vgl. Abh. II, 14 17). [...] Fragt man nun, wo Descartes diese Regeln her hat, wird man von ihm nicht auf die Natur der Gegenstände ver wiesen dies wäre zirkelhaft, sondern auf die euklidische Geometrie, deren Verfahren und Ergebnisse ihn im Lichte seiner Forderung nach Klarheit und Deutlichkeit der Erkenntnis allein überzeugt hatten; keine andere Wissenschaft konnte damit konkurrieren (vgl. Abh. I, insbes. 10). [... Eine solchermaßen konzipierte Philosophie muß] ein System bilden; denn nur wenn das Wissen vollständig ist, kann man sicher sein, den Zweifel vollständig entkräftet zu haben. Daß die Philosophie nur als System möglich sei, ist eine Vorstellung, die die Philosophie der Neuzeit von der der Antike unterscheidet; darin waren alle Philosophen bis Hegel Cartesianer. [...] So darf die neuere Philosophie seit Descartes nur das als ihren Gegenstand betrachten, was bestimm ten, der Gegenstandserkenntnis vorausliegenden und sie schon bestimmenden methodologischen Forderungen entspricht. Weil Descartes seine Methodologie der Geometrie entlehnt, ist es nicht verwunderlich, daß das einzige, was mit Klarheit und Deutlichkeit von den Gegen
10 Modul Philosophie 10 ständen in der Welt erkannt werden kann, außer ihrer Existenz ihre geometrischen Eigenschaften sein können; die Natur ist res extensa, ausgedehnte Körper welt, und sonst nichts. Auch Kant behauptet, daß in jeder besonderen Naturlehre nur so viel eigentliche Wissenschaft angetroffen werden könne, als darin Mathematik anzutreffen sei (Kant, MAN A VIII). Die Verkehrung des traditionellen und unmittelbar plausiblen Bestimmungsverhältnisses von Begriffsbildung und Gegenstand ist das, was man im Anschluß an Kants eigene Charakterisierung seiner Vorgehensweise kopernikanische Wende nennt. [...] Der Preis für diese Wendung und für die Vorteile, die sie für eine Metaphysik als Wissenschaft bedeuten kann, ist hoch; denn daß sich die Natur, wie sie unabhängig von uns besteht, nicht von uns Gesetze vorschreiben läßt, ist selbstverständlich. Man muß also unterscheiden zwischen den Dingen, wie sie an sich sind, und den Dingen, wie sie uns erscheinen oder wie wir sie erfahren. Also sind Metaphysik [...] und auch Wissenschaft überhaupt nur möglich im Bereich möglicher Erfahrung, d. h. von Gegenständen als Erscheinung. Damit entfallen alle metaphysischen Aussagen als unbeweisbar, die sich nicht auf Erfah rung stützen können: über die Seele und ihre Unsterblichkeit, über das Weltganze und die menschliche Freiheit, vor allem aber über Gott und seine Existenz. [...] Das linguistische Paradigma Es sollte deutlich werden, daß der Übergang vom ontologischen zum mentalistischen Paradigma der Phi lo sophie wenn man nur auf die argumentativen Gründe sieht durch einen Aufklärungsschritt erzwun gen wurde. Skepsis zeigt den Verlust von naivem Vertrauen an; sie ist das Resultat von Selbstbesinnung, von erneutem Nachdenken über das, was man bisher für selbstverständlich gehalten hatte. Skepsis ist Reflexion, weil sich in ihr das Denken und Erkennen auf sich und seine Möglichkeiten bezieht, und so ist in der antiken Skepsis und im Cartesianismus genau das problematisiert worden, von dem man sich im ontologischen Paradigma die Lösung aller Probleme erhoffte: die Erkenntnis des Seins selbst. Seit Descartes wurde dann der Zweifel methodisch institutionalisiert und galt als der selbstverständliche Anfang eines jeden vernünftigen Philosophierens [...] Wie nachhaltig die Wirkungen der Skepsis als Aufklärungsschritt sind, kann man daran ermessen, daß bis heute viele Philosophen mit dem Skeptizismus kokettieren, niemand aber als dogmatisch gelten will. Mit dem Namen Ludwig Wittgensteins ( ) verbindet sich das dritte hier zu skizzierende Paradigma der Philosophie: das linguistische. Es entsteht dadurch, daß die Aufklärungsdynamik, die im mentalistischen Modell eine neue Konstellation von Wissenschaft und Aufklärung not wendig machte, nun auch noch über den Mentalismus hinaustreibt und neue Reflexionsleistungen vom Philosophieren er for dert [...] Bei Kant ist kritische Philosophie Erkenntniskritik im Medium des Bewußtseins Vernunft kritik; bei Wittgenstein hingegen tritt kritisches Philosophieren als Sinnkritik im Medium der Sprache auf: Alle Philosophie ist Sprachkritik (Wittgenstein, T ). Kants Ausgangsfrage war: Was kann ich wissen? ; Wittgenstein hingegen sucht die Grenze zwischen dem klar Sagbaren und dem Unsinn (vgl. Wittgenstein, T Vorw.), und so ist sein Problem: Was kann ich verstehen?. Beginnt im Mentalismus die Philosophie mit dem Zweifel, so ist die Ausgangserfahrung des linguistischen Philosophierens der Zusammen bruch des Verständnisses, die Konfusion: Ein philosophisches Problem hat die Form: Ich kenne mich nicht aus (Wittgenstein, PU 123). Der Übersicht kann das folgende Schema dienen: Paradigma ontologisch mentalistisch linguistisch Bereich Sein Bewußtsein Sprache Gegenstand Seiendes Vorstellungen Sätze/Äußerungen Anfang Staunen Zweifel Konfusion Anfangsfrage Was ist? Was kann ich wissen? Was kann ich verstehen?
11 Modul Philosophie 11 Wittgenstein sagt: Der Zweck der Philosophie ist die logische Klärung der Gedanken. Die Philosophie ist keine Lehre, sondern eine Tätigkeit. Ein philosophisches Werk besteht wesentlich aus Erläuterungen. Das Resultat der Philosophie sind nicht philosophische Sätze, sondern das Klarwerden von Sätzen. Die Philosophie soll die Gedanken, die sonst, gleichsam, trübe und verschwommen sind, klar machen und scharf abgrenzen (T 4.112). Es wird also das carte sianische Ideal der Klarheit und Deutlichkeit fest gehalten; aber bezogen wird es nicht auf Erkenntnisse, sondern auf Gedanken. Gedanken werden klar und deutlich im Klarwerden von Sätzen, das seinerseits das Resultat der Erläuterungstätigkeit der Philosophie sein soll. An dieser Charakterisierung der Philosophie, die Wittgenstein trotz der großen Unterschiede zwischen dem Tractatus und dem späteren Werk nicht verändert hat, fällt zweierlei auf: daß es keine eigenständigen philosophischen Sätze geben soll und daß die Klärung der Gedanken mit der Klärung von Sätzen identifiziert wird. Die Begründung für die erste These steht im Tractatus unmittelbar vor dem zitierten Abschnitt: Die Gesamtheit der wahren Sätze ist die gesamte Naturwissenschaft (oder die Gesamtheit der Naturwissen schaften). Die Philosophie ist keine der Naturwissenschaften. (Das Wort Philosophie muß etwas bedeuten, was über oder unter, aber nicht neben den Naturwissenschaften steht.) (Wittgenstein, T 4.11 und 4.111). Wittgenstein philosophiert in einer wissenschaftsgeschicht lichen Situation, in der die alte Einheit von Philosophie und Wissenschaft zerbrochen ist. Die Welt die Welt ist alles, was der Fall ist (T 1) ist den Wissenschaften zugefallen, die sich aus der philosophischen Vormundschaft gelöst haben; dabei ist die Philosophie leer ausgegangen, und in der Tat ist das 19. Jahrhundert nach Hegel philo sophiegeschichtlich gesehen die Periode einer tiefgreifenden Identitätskrise der Philosophie, die bis heute andauert. In welchem Sinne ist Philosophie auch Wissenschaft? Was ist ihr eigener, von den Wissen schaften nicht schon okkupierter Gegenstandsbereich? Kann sie vielleicht als Geisteswissenschaft sich neu etablieren und so mindestens Reste ihres alten Renommees retten? [...] Diese Fragen werden von Wittgenstein radikal beantwortet: Es gibt nicht einmal Geisteswissenschaft, denn alle wahren Sätze der Wissenschaft sind naturwissenschaftliche Sätze, und da die Philosophie keine der Naturwissenschaften ist, kann sie keine wahrheitsfähigen Sätze aufstellen wollen. Als Tätig keit der Gedankenklärung hingegen kann sie über oder unter den Naturwissenschaften stehen: als Vorbereitung oder Ergänzung, aber eben nicht in Konkurrenz mit ihnen. Die Begründung der zweiten These macht den Paradigmenwechsel deutlich, der sich zwischen Kant und Wittgenstein ereignet. Gedankenklärung im Vorfeld oder im Nachhinein der Wissenschaft so kann man Kants Kritik der reinen Vernunft auch verstehen, die ja als Erläuterung der Bedingungen der Möglich keit metaphysischer und wissenschaftlicher Urteile nicht in demselben Sinn einen Wahrheits anspruch erheben konnte wie diese Urteile selbst. Das Neue ist, daß Wittgenstein in der Gedankenklärung vom Bewußtsein in die Sprache als Erläuterungsmedium über wechselt. Über seinen Tractatus sagt er: Man könnte den ganzen Sinn des Buches etwa in die Worte fassen: Was sich überhaupt sagen läßt, läßt sich klar sagen, und wovon man nicht reden kann, darüber muß man schweigen. Das Buch will also dem Denken eine Grenze ziehen, oder vielmehr nicht dem Denken, sondern dem Ausdruck der Gedanken: Denn um dem Denken eine Grenze zu ziehen, müßten wir beide Seiten dieser Grenze denken können (wir müßten also denken können, was sich nicht denken läßt.) Die Grenze wird also nur in der Sprache gezogen werden können und was jenseits der Grenze liegt, wird einfach Unsinn sein (Wittgenstein, T Vorw.). Kants Grenzziehung zwischen dem, was wir erkennen können, und dem Unerkennbaren wird hier wiederholt, aber im Felde des Denkbaren und Undenkbaren; und weil wir nicht denken können, was sich nicht denken läßt, müssen wir in das Feld der Sprache als des Ausdrucks der Gedanken hinübergehen und dort, in der Sprache, die Grenze ziehen zwischen dem sinnvoll Sagbaren und dem Unsinn. Freilich können auch wir nicht sagen, was sich nicht sagen läßt, denn wovon man nicht reden kann, darüber muß man schweigen ; aber die Sprache als Ausdruck des Gedankens bietet doch die Möglichkeit, Unsinn als Unsinn aufzuweisen. Die richtige Methode der Philosophie wäre eigentlich die: Nichts zu sagen, als was sich sagen läßt, also Sätze der Naturwissenschaft also etwas, was mit Philosophie nichts zu tun hat, und dann immer, wenn ein anderer etwas Metaphysisches sagen wollte, ihm nachzu weisen, daß er gewissen Zeichen in seinen Sätzen keine Bedeutung gegeben hat. Diese Methode wäre für den anderen unbefrie digend er hätte nicht das Gefühl, daß wir ihn Philosophie lehrten aber sie wäre die einzig streng richtige
12 Modul Philosophie 12 (Wittgenstein, T 6.53). Wenn alles, was sich sagen läßt, Sätze der Naturwissen schaft sind und die Philosophie demzufolge keine eigenen sagbaren Sätze besitzt, kann das Phi lo sophieren nur noch in solchen klärenden, erläuternden Zeigehand lungen bestehen und in nichts anderem. Damit ist die viel weiter reichende These verbunden, daß alle diejenigen, die etwas Metaphysisches sagen wollten, immer in der Situation waren, die der korrekt Philosophierende kritisch behebt: Das Buch behandelt die philosophischen Probleme und zeigt wie ich glaube, daß die Fragestellung dieser Probleme auf dem Mißverständnis der Logik unserer Sprache beruhen (T Vorw.). Die meisten Sätze und Fragen, die über philosophische Dinge geschrieben worden sind, sind nicht falsch, sondern unsinnig. Wir können daher Fragen dieser Art überhaupt nicht beantworten, sondern nur ihre Unsinnigkeit feststellen. Die meisten Fragen und Sätze der Philosophie beruhen darauf, daß wir unsere Sprachlogik nicht verstehen. (Sie sind von der Art der Frage, ob das Gute mehr oder weniger identisch sei als das Schöne.) Und es ist nicht verwunderlich, daß die tiefsten Probleme eigentlich keine Probleme sind (Wittgenstein, T 4.003). Wenn Kant meta phy sische Fragen wie die nach der Existenz Gottes als unentscheidbar und unsere Erkenntniskräfte übersteigend erklärte, hatte der damit nicht behauptet, solche Fragen seien unsinnig und schon deshalb unentscheidbar. Wittgenstein hingegen stellt die Philosophie insgesamt unter Sinn losigkeitsverdacht: Wir brauchen uns in der Regel erst gar nicht mit der erkenntnis kritischen Frage aufzuhalten; denn wir können schon zuvor die Unsinnigkeit ihrer Fragestellungen und Behauptungen feststellen, und wenn wir die festgestellt haben, dann zeigt sich, daß die tiefsten Probleme eigentlich keine Probleme sind. So schaltet Wittgenstein systematisch der Erkenntniskritik die Sinnkritik vor, und diese wiederum braucht nicht auf die Welt oder die Erkenntnisvermögen unseres Bewußtseins einzugehen. Es genügt, die Mißverständnisse der Logik unserer Sprache aufzuklären, um die meisten unserer philosophischen Probleme oder was wir dafür halten zum Verschwinden zu bringen. Das Aufzeigen der Grenze zwischen dem sinnvoll Sagbaren und dem Unsinn und die Korrektur des Verständnisses unserer Sprachlogik sind für Wittgenstein dasselbe. Noch immer aber könnte das alles mentalistisch verstanden werden: so, als wäre die Sprachkritik nur ein Hilfsmittel der Gedankenklärung, weil Wittgenstein ja selbst von der Sprache als dem Ausdruck der Gedanken spricht. Die vollständige Abkehr von der Bewußtseinsphilosophie vollzieht der Satz 4 des Tractatus : Der Gedanke ist der sinnvolle Satz. Sprache und Bewußtsein stehen also nicht in einer äußerlichen Ausdrucksbeziehung zuein ander, sondern Denken ist Sprechen, und was wir nicht sagen können, können wir auch nicht denken, sondern darüber müssen wir schweigen. Die sinnkritische Wende der Philosophie ist somit zugleich eine sprachkritische Wendung der linguistic turn. Die Frage, ob Denken immer und notwendig Sprechen ist, kann hier nicht weiter verfolgt werden [...]; es ist aber auch nicht notwendig, dies hier zu entscheiden. Wichtig ist nur, daß in dem Augenblick, in dem der sprachkritische Sinnlosigkeitsverdacht gegenüber der Philosophie erst einmal in der Welt ist, wir es mit einer neuen und viel radikaleren als der antiken und neuzeit lichen Skepsis zu tun haben und damit mit einer neuen Qualität von Aufklärung. Alle Skeptiker bisher hatten immerhin noch der Sprache selbst vertraut; kaum jemand von ihnen hatte ernsthaft bezweifelt, daß wir uns mit unseren Zweifeln verständ lich machen können, denn der Zweifel selbst bezog sich ja nur auf die Erkennbarkeit der Gegenstände. Erstreckt er sich aber nicht mehr nur auf die Wahrheitsfähigkeit, sondern auch noch auf die Verständ lichkeit unserer philosophi schen Sätze selber, muß die Philosophie als Sprachkritik beginnen und versuchen, die sinn kritische Skepsis dadurch zu entkräften, daß sie die Bedingungen angibt, unter denen Sätze Sinn und Bedeutung haben können. Erst wenn wir sicher sein können, daß Sätze sinnvoll sind, können wir über ihre Wahrheit oder Falschheit entscheiden; nach Wittgenstein geschieht dies aber nicht mehr in der Philosophie, sondern in den Wissenschaften. Wittgenstein ist der Begründer der modernen Analytischen Philosophie; man sollte, um Mißverständnisse auszuschließen, lieber von sprachanalytischer Philosophie sprechen. Das Wort Analyse hat sich an dieser Stelle eingebürgert, weil Wittgenstein im Tractatus die Erläu terun gen, aus denen ja ein philo so phisches Werk wesentlich bestehen soll, mit den Mitteln der Ana lyse der Logik unserer Sprache zu gewinnen hoffte; das methodische Muster hierfür war das große Werk von Russell und Whitehead Principia mathematica ( ), das eine logische Begründung
13 Modul Philosophie 13 der Mathematik und zu diesem Zweck auch eine Neufassung der gesamten formalen Logik enthält. [...] Man hat die sprachanalytische Philosophie häufig mit dem Argument zu kritisieren versucht, sie reduziere alle philosophischen Probleme auf Sprachprobleme und mache aus der Philosophie einen Zweig der Linguistik. [...] Der Vorwurf der Philosophiezerstörung hätte aber mit eben soviel Berech tigung schon von den Ontologen gegen die Mentalisten erhoben werden können: Sie reduzierten alle Seinsfragen auf Be wußt seinsprobleme, und die Philosophie sei doch nicht bloß Psychologie. Wie Descartes und Kant in ihrer Wendung zum Bewußtsein niemals das Erkennt nisund Wahrheits problem aus den Augen verloren denn sie wollten es ja gerade dadurch lösen, so geht es auch Wittgenstein im Tractatus und später um das Erkennen der Welt und letztlich um die Welt selber. Er sagt sogar von den Sätzen des Tractatus : Meine Sätze erläutern dadurch, daß sie der, welcher mich versteht, am Ende als unsinnig erkennt, wenn er durch sie auf ihnen über sie hinaufgestiegen ist. (Er muß sozusagen die Leiter wegwerfen, nachdem er auf ihr hinaufgestiegen ist.) Er muß diese Sätze überwinden, dann sieht er die Welt richtig (T 6.54). Die Sprachkritik ist eben nicht Selbstzweck, sondern die notwendige Leiter hinauf zu dem, wo nach seit Parmenides alle Philosophie strebte: das richtige Sehen der Welt. Was Wittgenstein er kannte, war die Tatsache, daß wir ohne Sprachkritik nicht sicher sein können, die Welt richtig zu sehen, und daß wir uns deswegen, wenn wir an Philosophie im Ernst interessiert sind, darauf einlassen müssen. So ist die sprachanalytische Philosophie keine Position, die man einnehmen könnte oder auch nicht; wer sie so sieht, sei daran erinnert, daß im linguistischen Paradigma alle klassischen philoso phischen Stand punkte Platonismus, Aristotelismus, Skeptizismus, Kritizismus usf. widerauf getaucht und ver treten worden sind. Dies gilt auch für die traditionelle Einteilung der Philosophie in Spezialdisziplinen oder Bindestrich-Philosophien, die im 19. Jahrhundert außeror dentlich verstärkt und weitergetrieben wurde; sie wird nicht wesentlich verändert, sondern nur transformiert. Was zuvor Erkenntnistheorie hieß, tritt nach Wittgenstein auf als logische Ana lyse der Wissenschafts sprache (Carnap) [...] Seit G. E. Moore wird es üblich, moralphiloso phischen Erörterungen eine Analyse der Sprache der Ethik (Hare) vorauszu schicken, die bald [...] Meta-Ethik genannt wird [...] Die Ästhetik konzentriert sich auf die Sprachen der Kunst (Goodman) und wird zu einer Theorie des ästhetischen Diskurses (Zimmermann) ausgebaut. (Die Reihe der Beispiele ließe sich lange fortsetzen.) Die sprachanalytische Philosophie will die Seins- und Erkenntnisfragen nicht einfach zugunsten der Sprachanalyse fallenlassen; sie ist vielmehr ein methodi sches Programm, das uns auffordert, alle philosophischen Sachprobleme zu nächst als Sprach probleme zu stellen, damit klar ist, daß es sich dabei nicht nur um durch sprachlogische Mißverständnisse erzeugte Scheinprobleme handelt. Es geht nach der sinn kritischen Skepsis darum, zuerst die elementaren Ver stehens bedingungen im philosophischen Diskurs selber zu sichern, ehe man sich dann Erkenntnis problemen und den Sachen selbst zuwendet. Sprachanalytisches Philosophieren allein löst in der Regel noch keine Probleme, gestattet aber, sie genauer zu stellen. Aus: Ekkehard Martens / Herbert Schnädelbach (Hg.): Philosophie. Ein Grundkurs. Band 1. Reinbek: Rowohlt 1991, S (Auszug). Bibliografie Descartes: Meditationen über die Grundlagen der Philosophie mit den sämtlichen Einwänden und Erwiderungen (Med.) (übers. v. Buchenau). Hamburg Abhandlungen über die Methode (Abh.) (übers. v. Buchenau). Hamburg Kant: Kritik der reinen Vernunft (KdrV). Akademie-Ausgabe, Bd. 3. Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft (MAN). Akademie-Ausgabe, Bd. 4. Krüger, G. 1962: Die Herkunft des philosophischen Selbstbewußtseins. Darmstadt. Kuhn, Th. S. 1962/1967: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Chicago/Frankfurt/M. Platon: Apologie etc. zitiert nach Platon: Sämtliche Werke (übers. v. Schleiermacher). Reinbek bei Hamburg 1957 ff. Wittgenstein : Tractatus logico-philosophicus (T). In: Wittgenstein Schriften. Frankfurt/M. Philosophische Untersuchungen (PU). In: s. o.
14 Modul Philosophie 14 Fragen 1. Was ist das Hauptziel bzw. das zentrale Thema dieses Aufsatzes? 2. Warum wird in dieser Darstellung ein historischer Abriss präsentiert? Welches spezielle Verhältnis hat die Philosophie zu ihrer eigenen Geschichte? 3. Wird mit diesem Beitrag eine ausführliche Darstellung der Philosophiegeschichte ange strebt? 4. Ist die Geschichte der Philosophie eine Fortschrittsgeschichte? 5. Was ist ein Paradigma? Welche Rolle spielt der Paradigmenbegriff für die Darstellung? 6. Womit befassen sich Metaphysik und Ontologie? 7. Welchen Stellenwert hat laut Schnädelbach das Höhlengleichnis innerhalb von Platons Philosophie? 8. Was ist mit dem Weg nach innen in der mentalistischen Philosophie gemeint? 9. Inwiefern wird beim Übergang vom ontologischen zum mentalistischen Paradigma das Verhältnis von Gegenstand und Methode verändert? 10. Welche inhaltlichen Verluste sind mit dem Übergang vom ontologischen zum mentalis tischen Paradigma verbunden? 11. Wie kam es zur Sinnkrise der Philosophie im 19. Jahrhundert? 12. Wie distanziert sich Wittgenstein von der traditionellen (ontologischen, mentalistischen) Philosophie? 13. Wieso nennt man die Philosophie des linguistischen Paradigmas Analytische Philo sophie? 14. Wie verhält sich die Analytische Philosophie gegenüber traditionellen philosophischen Teildisziplinen (Erkenntnistheorie, Ethik, Ästhetik)? 15. Welche Stellung kommt der Sprachphilosophie im Rahmen des linguistischen Para dig mas zu? 16. Inwiefern ist auch der Übergang vom mentalistischen zum linguistischen Paradigma mit einem Verlust an Themen und Fragemöglichkeiten verbunden? Zusatzfragen 17. In Schnädelbachs Text heißt es, dass der Satz 4 von Wittgensteins Tractatus die voll ständige Abkehr von der Bewußtseinsphilosophie vollziehe. An anderer Stelle wird kon sta tiert, dass es auch Wittgenstein um das Erkennen der Welt und letztlich um die Welt selber gehe. Liegt hierin ein Widerspruch? 18. (Im Text wird Wittgenstein als der Begründer der modernen Analytischen Philosophie be zeichnet. Überprüfen Sie anhand anderer philosophiehistorischer Darstellungen, ob die se Einschätzung unkontrovers ist bzw. ob noch weitere Gründerväter genannt werden. 19. Laut Schnädelbach ist die sprachanalytische Philosophie keine Position, die man einneh men könnte oder auch nicht. Paraphrasieren Sie diese Aussage. Mit welchen Argumenten lässt sich diese These stützen? Text 4 Ernst Tugendhat / Ursula Wolf: Logik und moderne Sprachphilosophie Zur Konzeption der Logik Das Wort [ Logik ] ist im Verlauf der Geschichte dieser Disziplin in verschiedenen Hinsichten enger und weiter gefaßt worden. Dabei ist es nicht sinnvoll zu fragen, welche Bedeutung die richtige ist, da es nicht eine wahre Bedeutung eines Wortes gibt. Was man hier vermeiden muß, ist nicht Falschheit, sondern Unklarheit. Deswegen ist es wichtig, sich darüber Rechenschaft zu geben, in
15 Modul Philosophie 15 welchen Beziehungen die verschiedenen Bedeutungen, in denen das Wort verwendet worden ist, zueinander stehen. Bevor wir das unternehmen können, sind einige orientierende Vorbemerkungen erforderlich. Man kann die Geschichte der Logik grob in drei Perioden einteilen. 1 Die erste umfaßt die ältere Logik, die in etwa von ihrem Begründer Aristoteles bis zum ausgehenden Mittelalter reicht. Die zweite ist die neuzeitliche Logik, beginnende mit der sogenannten Logik von Port-Royal (1662). 2 Diese zweite Periode ist gekennzeichnet durch ein Vorherrschen erkenntnistheoretischer und psychologischer Fragestellungen, durch die die logische Forschung im engeren Sinn und auch die Klärung der logischen Grundbegriffe zurückgedrängt wurde. [...] Die dritte Periode ist die der modernen Logik, die mit Freges Begriffsschrift (1879) beginnt. Diese Logik wird oft als mathematische oder auch symbolische Logik oder auch als Logistik bezeichnet. Diese Bezeichnungen beziehen sich auf die kalkülmäßige Durchführung der Logik. Wichtiger ist jedoch, daß die Logiker dieser dritten Periode die spezifisch logischen von psychologischen Fragestellungen wieder scharf getrennt und die logische Forschung im engeren Sinn erneut aufgenommen und zu ungeahnten Weiterungen geführt haben [...] Was ist denn nun aber mit Logik überhaupt gemeint? Man kann die verschiedenen Antworten, die auf diese Frage gegeben worden sind, in ihrem Verhältnis zueinander nicht recht verstehen, wenn man nicht [...] vor der genaueren Ausgrenzung der Thematik drei verschiedene Auffassungsweisen unterscheidet. Zu diesem Zweck genügt es, zur Thematik vorerst nur so viel zu sagen, daß die Logik doch wohl bestimmte Regeln oder Gesetze oder Zusammenhänge erforscht, und die Frage ist nun: Regeln oder Gesetze oder Zusammenhänge wovon? Handelt es sich um Gesetze des Seins oder der Wirklichkeit (wir wollen das die ontologische Auffassung nennen) oder um Gesetze des Denkens (die psychologische Auffassung) oder um Gesetze der Sprache (die sprachliche Auffassung)? Nehmen wir z. B. den Satz vom Widerspruch. Er besagt ungefähr: Etwas kann nicht zugleich der Fall sein und nicht der Fall sein. Warum nicht? Die einen sagen, das gründe im Wesen des Seins; die anderen: im Wesen des Denkens; die Dritten: im Wesen der Sprache. Diese verschiedenen Auffassungsweisen haben sich auf die Frage, wie man die Thematik der Logik ausgrenzen soll, ausgewirkt. Für die zweite der vorhin unterschiedenen Perioden der Geschichte der Logik ist die psychologische Auffassung charakteristisch. Die Logik von Port-Royal definiert die Logik als die Kunst, seine Vernunft {raison} gut zu leiten. [...] Demgegenüber war die ältere Tradition und auch wieder die moderne Auffassung eher an der Sprache bzw. am Sein orientiert, die moderne primär an der Sprache. [...] Aus: Ernst Tugendhat / Ursula Wolf: Logisch-semantische Propädeutik. Stuttgart: Reclam 1983, Kap. 1: Was heißt Logik, S (Auszug). Der Satz vom Widerspruch Was man den Satz vom Widerspruch nennt, ist der Satz, daß es unmöglich ist, daß eine Aussage, die sich widerspricht, wahr ist. Genaugenommen müßte man also vom Satz vom ausgeschlossenen Wider spruch reden. [... Es stellt] sich die Frage, was der Satz vom Widerspruch [...] genau besagt und worin die Notwendigkeit dieses Satzes ihrerseits gründet. Oder ist es vielleicht gar nicht sinnvoll, nach dem Grund eines solchen irgendwie letzten Satzes zu fragen? Muß der Rückgang im Begründen nicht irgendwo ein Ende finden? Nun wäre es gewiß unsinnig, die notwendige Wahrheit dieses Satzes durch irgendeinen anderen Satz begründen zu wollen; es wäre schon deswegen unsinnig, weil sich dann bei diesem Satz die Frage nach der Begründung von neuem stellen würde. Das zeigt aber nur, daß wir die Antwort auf unsere Frage jedenfalls nicht in dieser Rich tung suchen dürfen; hingegen zeigt es nicht, daß die Frage als solche nicht sinnvoll ist. Die Frage kann nicht sein, worauf (auf welchen anderen Satz) die Notwendigkeit des Satzes vom Widerspruch gründet, sondern wir können nur fragen, worin die Notwendigkeit gründet, worin sie besteht. 1 Zur Geschichte der Logik vgl. Kneale, The Development of Logic. 2 Arnauld/Nicole, La logique ou l art de penser, dt.: Arnauld, Die Logik oder die Kunst des Denkens.
Die analytische Tradition
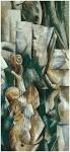 Die analytische Tradition lingustic turn : Wende von der Bewusstseins- zur Sprachphilosophie ab Ende des 19. bzw. Beginn des 20. Jahrhunderts Die analytische Tradition Die Philosophie ist ein Kampf gegen
Die analytische Tradition lingustic turn : Wende von der Bewusstseins- zur Sprachphilosophie ab Ende des 19. bzw. Beginn des 20. Jahrhunderts Die analytische Tradition Die Philosophie ist ein Kampf gegen
die Klärung philosophischer Sachfragen und Geschichte der Philosophie
 Programm Christian Nimtz www.nimtz.net // christian.nimtz@phil.uni erlangen.de Theoretische Philosophie der Gegenwart 1 2 3 Unser Programm in diesem Semester Einführung Man unterscheidet in der Philosophie
Programm Christian Nimtz www.nimtz.net // christian.nimtz@phil.uni erlangen.de Theoretische Philosophie der Gegenwart 1 2 3 Unser Programm in diesem Semester Einführung Man unterscheidet in der Philosophie
Schulinternes Curriculum für das Fach Philosophie
 1 Schulinternes Curriculum für das Fach Philosophie Einführungsphase EPH.1: Einführung in die Philosophie Was ist Philosophie? (Die offene Formulierung der Lehrpläne der EPH.1 lässt hier die Möglichkeit,
1 Schulinternes Curriculum für das Fach Philosophie Einführungsphase EPH.1: Einführung in die Philosophie Was ist Philosophie? (Die offene Formulierung der Lehrpläne der EPH.1 lässt hier die Möglichkeit,
Physik und Metaphysik
 WWU Münster Studium im Alter Eröffnungsvortrag 27. März 2007 Physik und Metaphysik Prof. Dr. G. Münster Institut für Theoretische Physik Zentrum für Wissenschaftstheorie Was ist Physik? Was ist Metaphysik?
WWU Münster Studium im Alter Eröffnungsvortrag 27. März 2007 Physik und Metaphysik Prof. Dr. G. Münster Institut für Theoretische Physik Zentrum für Wissenschaftstheorie Was ist Physik? Was ist Metaphysik?
Taalfilosofie 2008/2009 voltijd
 Taalfilosofie 2008/2009 voltijd Thomas.Mueller@phil.uu.nl 25 februari 2009: Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus http://www.phil.uu.nl/taalfilosofie/vt/ Ludwig Wittgenstein Colleges over
Taalfilosofie 2008/2009 voltijd Thomas.Mueller@phil.uu.nl 25 februari 2009: Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus http://www.phil.uu.nl/taalfilosofie/vt/ Ludwig Wittgenstein Colleges over
Wissenschaftliches Arbeiten. Teil 3: Philosophie und Wissenschaftstheorie
 Wissenschaftliches Arbeiten Teil 3: Philosophie und Wissenschaftstheorie Wissenschaftliches Arbeiten SS2010 - Teil 3/Philosophie 23.04.2010 1 Literatur I [3-1] Rosenberg, Jay F.: Philosophieren. Frankfurt
Wissenschaftliches Arbeiten Teil 3: Philosophie und Wissenschaftstheorie Wissenschaftliches Arbeiten SS2010 - Teil 3/Philosophie 23.04.2010 1 Literatur I [3-1] Rosenberg, Jay F.: Philosophieren. Frankfurt
L E H R P L A N P H I L O S O P H I E
 L E H R P L A N P H I L O S O P H I E Das Schulcurriculum stützt sich auf die in der Obligatorik für das Fach Philosophie vorgesehenen Schwerpunkte und gibt den Rahmen für die individuelle Unterrichtsgestaltung
L E H R P L A N P H I L O S O P H I E Das Schulcurriculum stützt sich auf die in der Obligatorik für das Fach Philosophie vorgesehenen Schwerpunkte und gibt den Rahmen für die individuelle Unterrichtsgestaltung
Foucaults "Was ist ein Autor" und "Subjekt und Macht"
 Geisteswissenschaft Nicole Friedrich Foucaults "Was ist ein Autor" und "Subjekt und Macht" Eine Annäherung Essay Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg Lektürekurs Foucault Sommersemester 2011
Geisteswissenschaft Nicole Friedrich Foucaults "Was ist ein Autor" und "Subjekt und Macht" Eine Annäherung Essay Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg Lektürekurs Foucault Sommersemester 2011
Prof. Dr. Tim Henning
 Prof. Dr. Tim Henning Vorlesung Einführung in die Metaethik 127162001 Mittwoch, 11.30-13.00 Uhr M 18.11 19.10.2016 PO 09 / GymPO PO 14 / BEd 1-Fach-Bachelor: BM4 KM2 Bachelor Nebenfach (neu): KM2 KM2 Lehramt:
Prof. Dr. Tim Henning Vorlesung Einführung in die Metaethik 127162001 Mittwoch, 11.30-13.00 Uhr M 18.11 19.10.2016 PO 09 / GymPO PO 14 / BEd 1-Fach-Bachelor: BM4 KM2 Bachelor Nebenfach (neu): KM2 KM2 Lehramt:
Entwicklung der modernen Naturwissenschaft (speziell der Physik/Mechanik) in Abgrenzung von der mittelalterlich-scholastischen Naturphilosophie
 René Descartes (Rationalismus, Leib-Seele-Dualismus) *31. März 1596 (Le Haye) 1604-1612 Ausbildung im Jesuitenkolleg La Flêche 1616 Baccalaureat und Lizenziat der Rechte an der Fakultät zu Poitiers. Vielfältige
René Descartes (Rationalismus, Leib-Seele-Dualismus) *31. März 1596 (Le Haye) 1604-1612 Ausbildung im Jesuitenkolleg La Flêche 1616 Baccalaureat und Lizenziat der Rechte an der Fakultät zu Poitiers. Vielfältige
Themenvorschläge Philosophie
 Themenvorschläge Philosophie Der Philosophieunterricht: Wie wurde in den vergangenen Jahrhunderten an den Gymnasien des Kantons Luzern Philosophie unterrichtet? Welche Lehrbücher wurden verwendet? Was
Themenvorschläge Philosophie Der Philosophieunterricht: Wie wurde in den vergangenen Jahrhunderten an den Gymnasien des Kantons Luzern Philosophie unterrichtet? Welche Lehrbücher wurden verwendet? Was
Ästhetik ist die Theorie der ästhetischen Erfahrung, der ästhetischen Gegenstände und der ästhetischen Eigenschaften.
 16 I. Was ist philosophische Ästhetik? instrumente. Die Erkenntnis ästhetischer Qualitäten ist nur eine unter vielen möglichen Anwendungen dieses Instruments. In diesem Sinn ist die Charakterisierung von
16 I. Was ist philosophische Ästhetik? instrumente. Die Erkenntnis ästhetischer Qualitäten ist nur eine unter vielen möglichen Anwendungen dieses Instruments. In diesem Sinn ist die Charakterisierung von
Hegels»Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften«
 Hegels»Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften«(1830) Hermann Drüe, Annemarie Gethmann-Siefert, Christa Hackenesch, Walter Jaeschke, Wolfgang Neuser und Herbert Schnädelbach Ein Kommentar zum Systemgrundriß
Hegels»Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften«(1830) Hermann Drüe, Annemarie Gethmann-Siefert, Christa Hackenesch, Walter Jaeschke, Wolfgang Neuser und Herbert Schnädelbach Ein Kommentar zum Systemgrundriß
David Hume zur Kausalität
 David Hume zur Kausalität Und welcher stärkere Beweis als dieser konnte für die merkwürdige Schwäche und Unwissenheit des Verstandes beigebracht werden? Wenn irgend eine Beziehung zwischen Dingen vollkommen
David Hume zur Kausalität Und welcher stärkere Beweis als dieser konnte für die merkwürdige Schwäche und Unwissenheit des Verstandes beigebracht werden? Wenn irgend eine Beziehung zwischen Dingen vollkommen
DER NEUKANTIANISMUS. Theorien gegen die sich der Neukantianismus richtet
 DER NEUKANTIANISMUS erstreckt sich im Zeitraum von ca. 1870 1920 Wegbereiter: Hermann von Helmholtz (1821 1894): die Naturwissenschaften brauchen eine erkenntnistheoretische Grundlegung ihrer Begriffe
DER NEUKANTIANISMUS erstreckt sich im Zeitraum von ca. 1870 1920 Wegbereiter: Hermann von Helmholtz (1821 1894): die Naturwissenschaften brauchen eine erkenntnistheoretische Grundlegung ihrer Begriffe
Ekkehard Martens/ Herbert Schnädelbach (Hg.) Philosophie. Ein Grundkurs. rowohlts enzyklopädie
 Ekkehard Martens/ Herbert Schnädelbach (Hg.) Philosophie Ein Grundkurs rowohlts enzyklopädie Inhalt Ekkehard Martens/Herbert Schnädelbach 1 Vorwort 9 Ekkehard Martens/Herbert Schnädelbach 2 Zur gegenwärtigen
Ekkehard Martens/ Herbert Schnädelbach (Hg.) Philosophie Ein Grundkurs rowohlts enzyklopädie Inhalt Ekkehard Martens/Herbert Schnädelbach 1 Vorwort 9 Ekkehard Martens/Herbert Schnädelbach 2 Zur gegenwärtigen
Philosophie Ergänzungsfach
 Philosophie Ergänzungsfach A. Stundendotation Klasse 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse Wochenlektion 0 0 0 4 B. Didaktische Konzeption Überfachliche Kompetenzen Das Ergänzungsfach Philosophie fördert
Philosophie Ergänzungsfach A. Stundendotation Klasse 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse Wochenlektion 0 0 0 4 B. Didaktische Konzeption Überfachliche Kompetenzen Das Ergänzungsfach Philosophie fördert
Eine Untersuchung zu Verstand und Vernunft
 Joachim Stiller Eine Untersuchung zu Verstand und Vernunft Eine Untersuchung Alle Rechte vorbehalten Eine Untersuchung zu Verstand und Vernunft Was ist der Unterschied zwischen Verstand und Vernunft? Zunächst
Joachim Stiller Eine Untersuchung zu Verstand und Vernunft Eine Untersuchung Alle Rechte vorbehalten Eine Untersuchung zu Verstand und Vernunft Was ist der Unterschied zwischen Verstand und Vernunft? Zunächst
N. Westhof (Februar 2006)
 Die Frage des Menschen nach sich selbst im Philosophieunterricht der Oberstufe und die Notwendigkeit einer doppelten Relativierung der historischen Hinsichten. N. Westhof (Februar 2006) Einleitung Daß
Die Frage des Menschen nach sich selbst im Philosophieunterricht der Oberstufe und die Notwendigkeit einer doppelten Relativierung der historischen Hinsichten. N. Westhof (Februar 2006) Einleitung Daß
Voransicht. Bilder: Optische Täuschungen.
 S II A Anthropologie Beitrag 5 1 Eine Einführung in die Erkenntnistheorie Juliane Mönnig, Konstanz Bilder: Optische Täuschungen. Klasse: 11/12 Dauer: 12 Stunden Arbeitsbereich: Anthropologie / Erkenntnistheorie
S II A Anthropologie Beitrag 5 1 Eine Einführung in die Erkenntnistheorie Juliane Mönnig, Konstanz Bilder: Optische Täuschungen. Klasse: 11/12 Dauer: 12 Stunden Arbeitsbereich: Anthropologie / Erkenntnistheorie
Inhaltsverzeichnis. I. Geschichte der Philosophie 1. Inhaltsverzeichnis. Vorwort
 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Vorwort Einleitung XI XIII I. Geschichte der Philosophie 1 1 Antike 3 1.1 Einführung 3 1.2 Frühe griechische Philosophen 4 1.3 Die sophistische Bewegung und Sokrates
Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Vorwort Einleitung XI XIII I. Geschichte der Philosophie 1 1 Antike 3 1.1 Einführung 3 1.2 Frühe griechische Philosophen 4 1.3 Die sophistische Bewegung und Sokrates
Grundlagen der Philosophie
 1 Grundlagen der Philosophie Was ist ein Philosoph? Nennen Sie zwei Bedeutungen. Elenktik? Maieutik? Charakterisieren Sie den Begriff des Staunens. Stellen Sie fünf typische philosophische Fragen. Erklären
1 Grundlagen der Philosophie Was ist ein Philosoph? Nennen Sie zwei Bedeutungen. Elenktik? Maieutik? Charakterisieren Sie den Begriff des Staunens. Stellen Sie fünf typische philosophische Fragen. Erklären
Zum Höhlengleichnis von Platon
 Geisteswissenschaft Eric Jänicke Zum Höhlengleichnis von Platon Essay Essay Höhlengleichnis Proseminar: Philosophie des Deutschen Idealismus und des 19. Jahrhunderts Verfasser: Eric Jänicke Termin: WS
Geisteswissenschaft Eric Jänicke Zum Höhlengleichnis von Platon Essay Essay Höhlengleichnis Proseminar: Philosophie des Deutschen Idealismus und des 19. Jahrhunderts Verfasser: Eric Jänicke Termin: WS
Paul Natorp. Philosophische Propädeutik. in Leitsätzen zu akademischen Vorlesungen
 Paul Natorp Philosophische Propädeutik (Allgemeine Einleitung in die Philosophie und Anfangsgründe der Logik, Ethik und Psychologie) in Leitsätzen zu akademischen Vorlesungen C e l t i s V e r l a g Bibliografische
Paul Natorp Philosophische Propädeutik (Allgemeine Einleitung in die Philosophie und Anfangsgründe der Logik, Ethik und Psychologie) in Leitsätzen zu akademischen Vorlesungen C e l t i s V e r l a g Bibliografische
Kritik der Urteilskraft
 IMMANUEL KANT Kritik der Urteilskraft Anaconda INHALT Vorrede...................................... 13 Einleitung..................................... 19 I. Von der Einteilung der Philosophie..............
IMMANUEL KANT Kritik der Urteilskraft Anaconda INHALT Vorrede...................................... 13 Einleitung..................................... 19 I. Von der Einteilung der Philosophie..............
Entwicklung der modernen Naturwissenschaft (speziell der Physik/Mechanik) in Abgrenzung von der mittelalterlich-scholastischen Naturphilosophie
 René Descartes (1596-1650) Meditationen über die Grundlagen der Philosophie (1641) Geistes- bzw. wissenschaftsgeschichtlicher Hintergrund Entwicklung der modernen Naturwissenschaft (speziell der Physik/Mechanik)
René Descartes (1596-1650) Meditationen über die Grundlagen der Philosophie (1641) Geistes- bzw. wissenschaftsgeschichtlicher Hintergrund Entwicklung der modernen Naturwissenschaft (speziell der Physik/Mechanik)
Immanuel Kant. *22. April 1724 in Königsberg +12. Februar 1804 in Königsberg
 Immanuel Kant *22. April 1724 in Königsberg +12. Februar 1804 in Königsberg ab 1770 ordentlicher Professor für Metaphysik und Logik an der Universität Königsberg Neben Hegel wohl der bedeutendste deutsche
Immanuel Kant *22. April 1724 in Königsberg +12. Februar 1804 in Königsberg ab 1770 ordentlicher Professor für Metaphysik und Logik an der Universität Königsberg Neben Hegel wohl der bedeutendste deutsche
Grundlagen der THEORETISCHEN PHILOSOPHIE
 Philosophische Fakultät Institut für Philosophie Lehrstuhl für Theoretische Philosophie Dr. Holm Bräuer MBA Grundlagen der THEORETISCHEN PHILOSOPHIE Sommersemester 2017 1 TEAM 11 Vorlesung Dozent: Dr.
Philosophische Fakultät Institut für Philosophie Lehrstuhl für Theoretische Philosophie Dr. Holm Bräuer MBA Grundlagen der THEORETISCHEN PHILOSOPHIE Sommersemester 2017 1 TEAM 11 Vorlesung Dozent: Dr.
Was es gibt und wie es ist
 Was es gibt und wie es ist Dritte Sitzung Existenzfragen 0. Zur Erinnerung Benjamin Schnieder Philosophisches Seminar der Universität Hamburg 0 1 Was ist die Ontologie? Platons Bart Eine Standard-Antwort
Was es gibt und wie es ist Dritte Sitzung Existenzfragen 0. Zur Erinnerung Benjamin Schnieder Philosophisches Seminar der Universität Hamburg 0 1 Was ist die Ontologie? Platons Bart Eine Standard-Antwort
Formale Logik. 1. Sitzung. Allgemeines vorab. Allgemeines vorab. Terminplan
 Allgemeines vorab Formale Logik 1. Sitzung Prof. Dr. Ansgar Beckermann Sommersemester 2005 Wie es abläuft Vorlesung Übungszettel Tutorien Es gibt ca. in der Mitte und am Ende des Semesters je eine Klausur
Allgemeines vorab Formale Logik 1. Sitzung Prof. Dr. Ansgar Beckermann Sommersemester 2005 Wie es abläuft Vorlesung Übungszettel Tutorien Es gibt ca. in der Mitte und am Ende des Semesters je eine Klausur
Sicherer, nicht sinnvoll bezweifelbarer Ausgangspunkt des Denkens: Ich existiere.
 Descartes, Zweite Meditation Sicherer, nicht sinnvoll bezweifelbarer Ausgangspunkt des Denkens: Ich existiere. Das ist selbst dann nicht bezweifelbar, wenn ich in Betracht ziehe, dass es einen allmächtigen
Descartes, Zweite Meditation Sicherer, nicht sinnvoll bezweifelbarer Ausgangspunkt des Denkens: Ich existiere. Das ist selbst dann nicht bezweifelbar, wenn ich in Betracht ziehe, dass es einen allmächtigen
Einführung in die Logik
 Einführung in die Logik Prof. Dr. Ansgar Beckermann Wintersemester 2001/2 Allgemeines vorab Wie es abläuft Vorlesung (Grundlage: Ansgar Beckermann. Einführung in die Logik. (Sammlung Göschen Bd. 2243)
Einführung in die Logik Prof. Dr. Ansgar Beckermann Wintersemester 2001/2 Allgemeines vorab Wie es abläuft Vorlesung (Grundlage: Ansgar Beckermann. Einführung in die Logik. (Sammlung Göschen Bd. 2243)
Einführung in die Wissenschaftstheorie
 Einführung in die Wissenschaftstheorie von Dr. Wolfgang Brauner Was ist Wissen? Wissen = Kenntnis von etwas haben (allg.) Wissen = wahre, gerechtfertigte Meinung (Philosophie: Platon) Formen des Wissens:
Einführung in die Wissenschaftstheorie von Dr. Wolfgang Brauner Was ist Wissen? Wissen = Kenntnis von etwas haben (allg.) Wissen = wahre, gerechtfertigte Meinung (Philosophie: Platon) Formen des Wissens:
Master of Arts. Philosophie
 Master of Arts Philosophie Philosophie in Göttingen Seit den Anfängen der Universität im Jahr 1737 ist die Göttinger Philosophie den Idealen der Aufklärung verpflichtet. Persönlichkeiten wie Edmund Husserl
Master of Arts Philosophie Philosophie in Göttingen Seit den Anfängen der Universität im Jahr 1737 ist die Göttinger Philosophie den Idealen der Aufklärung verpflichtet. Persönlichkeiten wie Edmund Husserl
Die Anfänge der Logik
 Die Anfänge der Logik Die Entwicklung des logischen Denkens vor Aristoteles Holger Arnold Universität Potsdam, Institut für Informatik arnold@cs.uni-potsdam.de Grundfragen Was ist Logik? Logik untersucht
Die Anfänge der Logik Die Entwicklung des logischen Denkens vor Aristoteles Holger Arnold Universität Potsdam, Institut für Informatik arnold@cs.uni-potsdam.de Grundfragen Was ist Logik? Logik untersucht
Bernd Prien. Kants Logik der Begrie
 Bernd Prien Kants Logik der Begrie Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 4 2 Die Struktur der Erkenntnis 8 2.1 Erkenntnis im eigentlichen Sinne........................ 8 2.2 Die objektive Realität von Begrien......................
Bernd Prien Kants Logik der Begrie Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 4 2 Die Struktur der Erkenntnis 8 2.1 Erkenntnis im eigentlichen Sinne........................ 8 2.2 Die objektive Realität von Begrien......................
INHALTSÜBERSICHT I. TRANSZENDENTALE ELEMENTARLEHRE.. 79
 INHALTSÜBERSICHT Zueignung 19 Vorrede zur zweiten Auflage 21 Einleitung 49 I. Von dem Unterschiede der reinen und empirischen Erkenntnis 49 II. Wir sind im Besitze gewisser Erkenntnisse a priori, und selbst
INHALTSÜBERSICHT Zueignung 19 Vorrede zur zweiten Auflage 21 Einleitung 49 I. Von dem Unterschiede der reinen und empirischen Erkenntnis 49 II. Wir sind im Besitze gewisser Erkenntnisse a priori, und selbst
1. Welche Aussagen treffen die Texte über Ursprung und Genese der Kultur?
 TPS: Einführung in die Kulturphilosophie (2.); SS 2007; Donnerstag (4. DS, d.i. 13:00 14:30 Uhr ), ASB/328, Dozent: René Kaufmann; Sprechzeit: Mittw.: 14-15 Uhr, Donn.: 17-18 Uhr, BZW/A 524; Tel.: 4633-6438/-2689;
TPS: Einführung in die Kulturphilosophie (2.); SS 2007; Donnerstag (4. DS, d.i. 13:00 14:30 Uhr ), ASB/328, Dozent: René Kaufmann; Sprechzeit: Mittw.: 14-15 Uhr, Donn.: 17-18 Uhr, BZW/A 524; Tel.: 4633-6438/-2689;
SPRACHPHILOSOPHIE (Wittgenstein, Heidegger, Adorno)
 SPRACHPHILOSOPHIE (Wittgenstein, Heidegger, Adorno) Philosophie ist: Sagen, was sich nicht sagen lässt, sagt Adorno. Für Wittgenstein bedeuten die Grenzen der Sprache die Grenzen der Welt: Was man nicht
SPRACHPHILOSOPHIE (Wittgenstein, Heidegger, Adorno) Philosophie ist: Sagen, was sich nicht sagen lässt, sagt Adorno. Für Wittgenstein bedeuten die Grenzen der Sprache die Grenzen der Welt: Was man nicht
Seele und Emotion bei Descartes und Aristoteles
 Geisteswissenschaft Anne-Kathrin Mische Seele und Emotion bei Descartes und Aristoteles Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 2 2. Das Leib-Seele-Verhältnis bei Descartes und Aristoteles...
Geisteswissenschaft Anne-Kathrin Mische Seele und Emotion bei Descartes und Aristoteles Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 2 2. Das Leib-Seele-Verhältnis bei Descartes und Aristoteles...
Uwe Schulz SELBSTBESTIMMUNG UND SELBSTERZIEHUNG DES MENSCHEN
 Uwe Schulz SELBSTBESTIMMUNG UND SELBSTERZIEHUNG DES MENSCHEN Untersuchungen im deutschen Idealismus und in der geisteswissenschaftlichen Pädagogik /Ä«fe/M-Verlag Stuttgart Inhaltsverzeichnis Einleitung
Uwe Schulz SELBSTBESTIMMUNG UND SELBSTERZIEHUNG DES MENSCHEN Untersuchungen im deutschen Idealismus und in der geisteswissenschaftlichen Pädagogik /Ä«fe/M-Verlag Stuttgart Inhaltsverzeichnis Einleitung
DER DEUTSCHE IDEALISMUS (FICHTE, SCHELLING, HEGEL) UND DIE PHILOSOPHISCHE PROBLEMLAGE DER GEGENWART
 MARTIN HEIDEGGER DER DEUTSCHE IDEALISMUS (FICHTE, SCHELLING, HEGEL) UND DIE PHILOSOPHISCHE PROBLEMLAGE DER GEGENWART El VITTORIO KLOSTERMANN FRANKFURT AM MAIN L }0 -/* INHALT EINLEITUNG Die gegenwärtige
MARTIN HEIDEGGER DER DEUTSCHE IDEALISMUS (FICHTE, SCHELLING, HEGEL) UND DIE PHILOSOPHISCHE PROBLEMLAGE DER GEGENWART El VITTORIO KLOSTERMANN FRANKFURT AM MAIN L }0 -/* INHALT EINLEITUNG Die gegenwärtige
Paradoxien der falschen Meinung in Platons "Theätet"
 Geisteswissenschaft Anonym Paradoxien der falschen Meinung in Platons "Theätet" Essay Paradoxien der falschen Meinung in Platons Theätet Einleitung (S.1) (I) Wissen und Nichtwissen (S.1) (II) Sein und
Geisteswissenschaft Anonym Paradoxien der falschen Meinung in Platons "Theätet" Essay Paradoxien der falschen Meinung in Platons Theätet Einleitung (S.1) (I) Wissen und Nichtwissen (S.1) (II) Sein und
Lehrveranstaltungen von Wilhelm G. Jacobs
 Lehrveranstaltungen von Wilhelm G. Jacobs WS 65/66 Begriff und Begründung der Philosophie (Vorlesung). Fichte: Über die Bestimmung des Gelehrten ( Seminar). WS 66/67 Descartes: Meditationes de prima philosophia
Lehrveranstaltungen von Wilhelm G. Jacobs WS 65/66 Begriff und Begründung der Philosophie (Vorlesung). Fichte: Über die Bestimmung des Gelehrten ( Seminar). WS 66/67 Descartes: Meditationes de prima philosophia
Sprachspiel - Lebensform - Weltbild
 Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt Christian Kellner 22. Mai 2006 Bei Fragen: Gleich fragen! :) Ludwig Wittgenstein Leben Werk Sprache Einführung Realistische Semantik Sprachspiele
Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt Christian Kellner 22. Mai 2006 Bei Fragen: Gleich fragen! :) Ludwig Wittgenstein Leben Werk Sprache Einführung Realistische Semantik Sprachspiele
Liebe als eine Leidenschaft bei Descartes.
 Andre Schuchardt präsentiert Liebe als eine Leidenschaft bei Descartes. Inhaltsverzeichnis Liebe als eine Leidenschaft bei Descartes...1 1. Einleitung...1 2. Körper und Seele....2 3. Von Liebe und Hass...4
Andre Schuchardt präsentiert Liebe als eine Leidenschaft bei Descartes. Inhaltsverzeichnis Liebe als eine Leidenschaft bei Descartes...1 1. Einleitung...1 2. Körper und Seele....2 3. Von Liebe und Hass...4
Gorgias und Phaidros - Platons Stellung zur Rhetorik
 Geisteswissenschaft Asmus Green Gorgias und Phaidros - Platons Stellung zur Rhetorik Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung...2 2. Gorgias...3 2.1 Gorgias und Sokrates...4 2.2 Polos und Sokrates...6
Geisteswissenschaft Asmus Green Gorgias und Phaidros - Platons Stellung zur Rhetorik Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung...2 2. Gorgias...3 2.1 Gorgias und Sokrates...4 2.2 Polos und Sokrates...6
INHALTSVERZEICHNIS ERSTER TEIL: KANT VORWORT... 7 INHALTSVERZEICHNIS... 9 SIGLENVERZEICHNIS... 15
 INHALTSVERZEICHNIS VORWORT... 7 INHALTSVERZEICHNIS... 9 SIGLENVERZEICHNIS... 15 EINLEITUNG: DIE KOPERNIKANISCHE WENDE IN DER PHILOSOPHIE... 17 ZUSAMMENFASSUNG... 27 ERSTER TEIL: KANT... 31 KAPITEL 1 EINFÜHRUNG
INHALTSVERZEICHNIS VORWORT... 7 INHALTSVERZEICHNIS... 9 SIGLENVERZEICHNIS... 15 EINLEITUNG: DIE KOPERNIKANISCHE WENDE IN DER PHILOSOPHIE... 17 ZUSAMMENFASSUNG... 27 ERSTER TEIL: KANT... 31 KAPITEL 1 EINFÜHRUNG
Gegenstände / Themen / Inhalte Arbeitstechniken / Arbeitsmethoden Kompetenzen. - philosophisches Gespräch
 Gymnasium Sedanstr. Lehrpläne S II Fach: Philosophie Jahrgang: 11/I Unterrichtsvorhaben : Einführung in die Philosophie Einführung in die Philosophie 1. Traum und Realität 2. Staunen und Wissen 3. Die
Gymnasium Sedanstr. Lehrpläne S II Fach: Philosophie Jahrgang: 11/I Unterrichtsvorhaben : Einführung in die Philosophie Einführung in die Philosophie 1. Traum und Realität 2. Staunen und Wissen 3. Die
Richard M. Hare: Alles egal? Richard M. Hare
 Richard M. Hare: Alles egal? Richard M. Hare *1919 Bristol während des 2. Weltkriegs mehr als drei Jahre in japanischer Kriegsgefangenschaft 1947 Abschluss seines Studiums in Philosophie und Altphilologie
Richard M. Hare: Alles egal? Richard M. Hare *1919 Bristol während des 2. Weltkriegs mehr als drei Jahre in japanischer Kriegsgefangenschaft 1947 Abschluss seines Studiums in Philosophie und Altphilologie
Rezension zum Aufsatz von Wolfgang Klafki: "Studien zur Bildungstheorie und Didaktik"
 Pädagogik Simone Strasser Rezension zum Aufsatz von Wolfgang Klafki: "Studien zur Bildungstheorie und Didaktik" Rezension / Literaturbericht Rezension zum Aufsatz von Wolfang Klafki: Studien zur Bildungstheorie
Pädagogik Simone Strasser Rezension zum Aufsatz von Wolfgang Klafki: "Studien zur Bildungstheorie und Didaktik" Rezension / Literaturbericht Rezension zum Aufsatz von Wolfang Klafki: Studien zur Bildungstheorie
Lehrplan Philosophie
 D S T Y Deutsche Schule Tokyo Yokohama Lehrplan Philosophie Sekundarstufe II Vorbemerkung: An der DSTY ist ein zweistündiger, aus den Jgst. 12 und 13 kombinierter Philosophiekurs eingerichtet. Daraus ergibt
D S T Y Deutsche Schule Tokyo Yokohama Lehrplan Philosophie Sekundarstufe II Vorbemerkung: An der DSTY ist ein zweistündiger, aus den Jgst. 12 und 13 kombinierter Philosophiekurs eingerichtet. Daraus ergibt
Einführung in die Theoretische Philosophie SS 2013
 Philosophische Fakultät Institut für Philosophie, Lehrstuhl für Theoretische Philosophie, Dr. Holm Bräuer Einführung in die Theoretische Philosophie 1 Vorlesung Dr. Holm Bräuer Mi (3) [11:10 12:40] WEB/KLEM/U
Philosophische Fakultät Institut für Philosophie, Lehrstuhl für Theoretische Philosophie, Dr. Holm Bräuer Einführung in die Theoretische Philosophie 1 Vorlesung Dr. Holm Bräuer Mi (3) [11:10 12:40] WEB/KLEM/U
Joachim Ritter, 1961 Aristoteles und die theoretischen Wissenschaften
 Aristoteles und die theoretischen Wissenschaften Die theoretische Wissenschaft ist so für Aristoteles und das gilt im gleichen Sinne für Platon später als die Wissenschaften, die zur Praxis und ihren Künsten
Aristoteles und die theoretischen Wissenschaften Die theoretische Wissenschaft ist so für Aristoteles und das gilt im gleichen Sinne für Platon später als die Wissenschaften, die zur Praxis und ihren Künsten
1 Was ist Philosophie?
 Einleitung 19 sei, bringt ihrerseits einen Dogmatismus ins Spiel, näm lich die Eingenommenheit von der Tradi tion. Unter dieser Voraussetzung entfällt das radikal-ursprüngliche Fragen, da die hermeneutische
Einleitung 19 sei, bringt ihrerseits einen Dogmatismus ins Spiel, näm lich die Eingenommenheit von der Tradi tion. Unter dieser Voraussetzung entfällt das radikal-ursprüngliche Fragen, da die hermeneutische
Wissenschaftstheorie für Pädagogen
 2*120 Friedrich W. Krön Wissenschaftstheorie für Pädagogen Mit 25 Abbildungen und 9 Tabellen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Inhalt Vorwort 9 1.0 Erkenntnis als Grundlegung 11 1.4.3 1.4.4 Handlungskonzepte
2*120 Friedrich W. Krön Wissenschaftstheorie für Pädagogen Mit 25 Abbildungen und 9 Tabellen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Inhalt Vorwort 9 1.0 Erkenntnis als Grundlegung 11 1.4.3 1.4.4 Handlungskonzepte
Die Wiedergeburt eines "neuen Menschen" in der Renaissance
 Geisteswissenschaft Nicole Borchert Die Wiedergeburt eines "neuen Menschen" in der Renaissance Exemplarische Betrachtungen in Philosophie, Kunst und Gesellschaft Studienarbeit Technische Universität Darmstadt
Geisteswissenschaft Nicole Borchert Die Wiedergeburt eines "neuen Menschen" in der Renaissance Exemplarische Betrachtungen in Philosophie, Kunst und Gesellschaft Studienarbeit Technische Universität Darmstadt
Bachelor of Arts Sozialwissenschaften und Philosophie (Kernfach Philosophie)
 06-03-101-1 Pflicht Einführung in die Theoretische Philosophie 1. Semester jedes Wintersemester Vorlesung "Einführung in die Theoretische Philosophie" (2 SWS) = 30 h Präsenzzeit und 70 h Seminar "Philosophische
06-03-101-1 Pflicht Einführung in die Theoretische Philosophie 1. Semester jedes Wintersemester Vorlesung "Einführung in die Theoretische Philosophie" (2 SWS) = 30 h Präsenzzeit und 70 h Seminar "Philosophische
Descartes, Dritte Meditation
 Descartes, Dritte Meditation 1. Gewissheiten: Ich bin ein denkendes Wesen; ich habe gewisse Bewusstseinsinhalte (Empfindungen, Einbildungen); diesen Bewusstseinsinhalten muss nichts außerhalb meines Geistes
Descartes, Dritte Meditation 1. Gewissheiten: Ich bin ein denkendes Wesen; ich habe gewisse Bewusstseinsinhalte (Empfindungen, Einbildungen); diesen Bewusstseinsinhalten muss nichts außerhalb meines Geistes
Syllabus Beschreibung der Lehrveranstaltung
 Syllabus Beschreibung der Lehrveranstaltung Titel der Lehrveranstaltung Einleitung in die Philosophie Code der Lehrveranstaltung Wissenschaftlichdisziplinärer Bereich der M-Fil/03 M-Fil/01 Lehrveranstaltung
Syllabus Beschreibung der Lehrveranstaltung Titel der Lehrveranstaltung Einleitung in die Philosophie Code der Lehrveranstaltung Wissenschaftlichdisziplinärer Bereich der M-Fil/03 M-Fil/01 Lehrveranstaltung
Nietzsches Philosophie des Scheins
 Nietzsches Philosophie des Scheins Die Deutsche Bibliothek CIP-Einheitsaufnahme Seggern, Hans-Gerd von: Nietzsches Philosophie des Scheins / von Hans-Gerd von Seggern. - Weimar : VDG, 1999 ISBN 3-89739-067-1
Nietzsches Philosophie des Scheins Die Deutsche Bibliothek CIP-Einheitsaufnahme Seggern, Hans-Gerd von: Nietzsches Philosophie des Scheins / von Hans-Gerd von Seggern. - Weimar : VDG, 1999 ISBN 3-89739-067-1
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Abiturwissen Evangelische Religion. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Abiturwissen Evangelische Religion Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Inhalt Gebrauchsanweisung.....................................
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Abiturwissen Evangelische Religion Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Inhalt Gebrauchsanweisung.....................................
Inhaltsverzeichnis. Vorwort 11
 Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 1. Einleitung 13 1.1 Vorblick 13 1.2 Aufgaben der Ethik als eines Prozesses der Reflexion 13 1.2.1 Ohne Fragestellung kein Zugang zur ethischen Reflexion 13 1.2.2 Was bedeutet
Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 1. Einleitung 13 1.1 Vorblick 13 1.2 Aufgaben der Ethik als eines Prozesses der Reflexion 13 1.2.1 Ohne Fragestellung kein Zugang zur ethischen Reflexion 13 1.2.2 Was bedeutet
Modul-Nr. 01 (AWF Informatik): Methoden der Philosophie
 Modul-Nr. 01 (AWF Informatik): Methoden der Philosophie Kennnummer: M.05.127.010 90 h / 2 SWS 1. Semester c) Ü Argumentationstheorie 30 h 1 LP 2. Lehrformen / Veranstaltungen: Übung Kompetenz zur Identifikation
Modul-Nr. 01 (AWF Informatik): Methoden der Philosophie Kennnummer: M.05.127.010 90 h / 2 SWS 1. Semester c) Ü Argumentationstheorie 30 h 1 LP 2. Lehrformen / Veranstaltungen: Übung Kompetenz zur Identifikation
Profilkurs. Schulinternes Curriculum Philosophie. Einführung in das Philosophieren
 Schulinternes Curriculum Philosophie Profilkurs Einführung in das Philosophieren Anhand der vier Fragen Kants Philosophiegeschichte im Überblick sowie Überblick über die zentralen Fragen der Reflexionsbereiche
Schulinternes Curriculum Philosophie Profilkurs Einführung in das Philosophieren Anhand der vier Fragen Kants Philosophiegeschichte im Überblick sowie Überblick über die zentralen Fragen der Reflexionsbereiche
Gültig für Studierende, die ab dem Wintersemester 2012/13 mit ihrem Studium beginnen.
 Institut für Philosophie Stand 21.08.2014 Gültig für Studierende, die ab dem Wintersemester 2012/13 mit ihrem Studium beginnen. Modulhandbuch M.A. (2-Fach) Philosophie Das Studienziel des MA-Studiengangs
Institut für Philosophie Stand 21.08.2014 Gültig für Studierende, die ab dem Wintersemester 2012/13 mit ihrem Studium beginnen. Modulhandbuch M.A. (2-Fach) Philosophie Das Studienziel des MA-Studiengangs
Grundkurs Philosophie / Metaphysik und Naturphilosophie (Reclams Universal-Bibliothek) Click here if your download doesn"t start automatically
 Grundkurs Philosophie / Metaphysik und Naturphilosophie (Reclams Universal-Bibliothek) Click here if your download doesn"t start automatically Grundkurs Philosophie / Metaphysik und Naturphilosophie (Reclams
Grundkurs Philosophie / Metaphysik und Naturphilosophie (Reclams Universal-Bibliothek) Click here if your download doesn"t start automatically Grundkurs Philosophie / Metaphysik und Naturphilosophie (Reclams
Metaphysik und Erkenntnismethode bei Descartes. - Falsch sind also nicht die Vorstellungen, sondern die Urteile, die daraus abgeleitet werden.
 Metaphysik und Erkenntnismethode bei Descartes - Vorstellungen an sich können nicht falsch sein. Auch die Vorstellungen von Chimären (Lebewesen, die es nicht gibt) sind an sich nicht falsch - Falsch sind
Metaphysik und Erkenntnismethode bei Descartes - Vorstellungen an sich können nicht falsch sein. Auch die Vorstellungen von Chimären (Lebewesen, die es nicht gibt) sind an sich nicht falsch - Falsch sind
Ludwig Wittgenstein - alle Philosophie ist Sprachkritik
 Ludwig Wittgenstein - alle Philosophie ist Sprachkritik Andreas Hölzl 15.05.2014 Institut für Statistik, LMU München 1 / 32 Gliederung 1 Biographie Ludwig Wittgensteins 2 Tractatus logico-philosophicus
Ludwig Wittgenstein - alle Philosophie ist Sprachkritik Andreas Hölzl 15.05.2014 Institut für Statistik, LMU München 1 / 32 Gliederung 1 Biographie Ludwig Wittgensteins 2 Tractatus logico-philosophicus
Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung über die Bedeutung der Wahrheit nach Thomas von Aquin.
 Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung über die Bedeutung der Wahrheit nach Thomas von Aquin Zweite Lieferung Zum Thema: Die Klugheit als das Wesen der Moralität [1] Inwiefern
Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung über die Bedeutung der Wahrheit nach Thomas von Aquin Zweite Lieferung Zum Thema: Die Klugheit als das Wesen der Moralität [1] Inwiefern
Hilary Putnam. Für die Erkenntnistheorie wichtige Schriften (Auswahl) The Meaning of Meaning (1975) Putnam I ( metaphysischer.
 Hilary Putnam *1926 in Chicago lebt ab 1927 mit seiner Familie in Paris 1934 Rückkehr in die USA 1944-48 Studium der Mathematik und Philosophie an der University of Pennsylvania 1948-49 Graduiertenstudium
Hilary Putnam *1926 in Chicago lebt ab 1927 mit seiner Familie in Paris 1934 Rückkehr in die USA 1944-48 Studium der Mathematik und Philosophie an der University of Pennsylvania 1948-49 Graduiertenstudium
Die Epoche des Barock
 Seminar: Geschichte der Pädagogik, 14.11.2007 lic. phil. Christine Ruckdäschel Die Epoche des Barock Pracht, Prunk und Prügel? Oder: Zwischen Reformation und Aufklärung Heutige Sitzung Epoche des Barock:
Seminar: Geschichte der Pädagogik, 14.11.2007 lic. phil. Christine Ruckdäschel Die Epoche des Barock Pracht, Prunk und Prügel? Oder: Zwischen Reformation und Aufklärung Heutige Sitzung Epoche des Barock:
Folien zur Vorlesung Perspektivität und Objektivität von Prof. Martin Seel. Sitzung vom 1. November 2004
 Folien zur Vorlesung Perspektivität und Objektivität von Prof. Martin Seel Sitzung vom 1. November 2004 1 Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 74: Unsre Erkenntnis entspringt aus zwei Grundquellen des Gemüts,
Folien zur Vorlesung Perspektivität und Objektivität von Prof. Martin Seel Sitzung vom 1. November 2004 1 Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 74: Unsre Erkenntnis entspringt aus zwei Grundquellen des Gemüts,
sich die Schuhe zubinden können den Weg zum Bahnhof kennen die Quadratwurzel aus 169 kennen
 Programm Christian Nimtz www.nimtz.net // lehre@nimtz.net Grundfragen der Erkenntnistheorie Kapitel 2: Die klassische Analyse des Begriffs des Wissens 1 Varianten des Wissens 2 Was ist das Ziel der Analyse
Programm Christian Nimtz www.nimtz.net // lehre@nimtz.net Grundfragen der Erkenntnistheorie Kapitel 2: Die klassische Analyse des Begriffs des Wissens 1 Varianten des Wissens 2 Was ist das Ziel der Analyse
Michalski DLD80 Ästhetik
 Michalski DLD80 Ästhetik 1565 2008 00104 23-04-2010 WIEDERHOLUNG Baumgartens Ästhetik hat nicht nur eine theoretische, sondern auch eine praktische Absicht. Definition der Ästhetik (im Unterschied zur
Michalski DLD80 Ästhetik 1565 2008 00104 23-04-2010 WIEDERHOLUNG Baumgartens Ästhetik hat nicht nur eine theoretische, sondern auch eine praktische Absicht. Definition der Ästhetik (im Unterschied zur
Was ist ein Gedanke?
 Lieferung 8 Hilfsgerüst zum Thema: Was ist ein Gedanke? Thomas: Es bleibt zu fragen, was der Gedanke selbst [ipsum intellectum] ist. 1 intellectus, -us: Vernunft, Wahrnehmungskraft usw. intellectum, -i:
Lieferung 8 Hilfsgerüst zum Thema: Was ist ein Gedanke? Thomas: Es bleibt zu fragen, was der Gedanke selbst [ipsum intellectum] ist. 1 intellectus, -us: Vernunft, Wahrnehmungskraft usw. intellectum, -i:
GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL WERKE 8
 GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL WERKE 8 Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830) Erster Teil Die Wissenschaft der Logik Mit den mündlichen Zusätzen SUHRKAMP INHALT Vorrede zur
GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL WERKE 8 Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830) Erster Teil Die Wissenschaft der Logik Mit den mündlichen Zusätzen SUHRKAMP INHALT Vorrede zur
Prüfungsprogramm aus Philosophie für externe Kandidatinnen und Kandidaten
 Prüfungsprogramm aus Philosophie für externe Kandidatinnen und Kandidaten Dieses von den Lehrpersonen der Fachgruppe Philosophie heraus gegebene Prüfungsprogramm stellt eine Konkretisierung des Fachcurriculums
Prüfungsprogramm aus Philosophie für externe Kandidatinnen und Kandidaten Dieses von den Lehrpersonen der Fachgruppe Philosophie heraus gegebene Prüfungsprogramm stellt eine Konkretisierung des Fachcurriculums
Wie können wir entscheiden ob eine Person oder ein Wesen einen Geist hat?
 Einleitung Dr. M. Vogel Vorlesung Grundprobleme der Philosophie des Geistes Wie können wir entscheiden ob eine Person oder ein Wesen einen Geist hat? Malvin Gattinger Vor einem Antwortversuch will ich
Einleitung Dr. M. Vogel Vorlesung Grundprobleme der Philosophie des Geistes Wie können wir entscheiden ob eine Person oder ein Wesen einen Geist hat? Malvin Gattinger Vor einem Antwortversuch will ich
Einführung in die moderne Logik
 Sitzung 1 1 Einführung in die moderne Logik Einführungskurs Mainz Wintersemester 2011/12 Ralf Busse Sitzung 1 1.1 Beginn: Was heißt Einführung in die moderne Logik? Titel der Veranstaltung: Einführung
Sitzung 1 1 Einführung in die moderne Logik Einführungskurs Mainz Wintersemester 2011/12 Ralf Busse Sitzung 1 1.1 Beginn: Was heißt Einführung in die moderne Logik? Titel der Veranstaltung: Einführung
Die Reflexion des Wirklichen
 Riccardo Dottori Die Reflexion des Wirklichen Zwischen Hegels absoluter Dialektik und der Philosophie der Endlichkeit von M. Heidegger und H. G. Gadamer Mohr Siebeck Inhaltsverzeichnis Vorwort V Einleitung
Riccardo Dottori Die Reflexion des Wirklichen Zwischen Hegels absoluter Dialektik und der Philosophie der Endlichkeit von M. Heidegger und H. G. Gadamer Mohr Siebeck Inhaltsverzeichnis Vorwort V Einleitung
Theoretische Konzepte der Mensch-Natur- Beziehung und Ansätze für ihre Analyse
 Modul 1 Grundlagen der Allgemeinen Ökologie Di Giulio Geschichte der Wissenschaft 1 Theoretische Konzepte der Mensch-Natur- Beziehung und Ansätze für ihre Analyse Lernziel Sie kennen die geistesgeschichtlichen
Modul 1 Grundlagen der Allgemeinen Ökologie Di Giulio Geschichte der Wissenschaft 1 Theoretische Konzepte der Mensch-Natur- Beziehung und Ansätze für ihre Analyse Lernziel Sie kennen die geistesgeschichtlichen
Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie in der Einführungsphase der Gesamtschule Aachen-Brand
 Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie in der Einführungsphase der Gesamtschule Aachen-Brand Stand: August 2014 Unterrichtsvorhaben I Eigenart philosophischen Fragens und Denkens - Was heißt es
Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie in der Einführungsphase der Gesamtschule Aachen-Brand Stand: August 2014 Unterrichtsvorhaben I Eigenart philosophischen Fragens und Denkens - Was heißt es
Anselms Gottesbeweis und die Logik. und überhaupt: Beweise
 Anselms Gottesbeweis und die Logik und überhaupt: Beweise Inhalt 1) Vorbemerkungen zur Logik (und Wissenschaft) 2) Vorbemerkungen zu Gottesbeweisen und zu Anselm von Canterbury 3) Anselms Ontologisches
Anselms Gottesbeweis und die Logik und überhaupt: Beweise Inhalt 1) Vorbemerkungen zur Logik (und Wissenschaft) 2) Vorbemerkungen zu Gottesbeweisen und zu Anselm von Canterbury 3) Anselms Ontologisches
t r a n s p o s i t i o n e n
 t r a n s p o s i t i o n e n Jean-Luc Nancy Daniel Tyradellis Was heißt uns Denken? diaphanes Grundlage dieses Buches bildet ein Gespräch, das Jean-Luc Nancy und Daniel Tyradellis am 3. November 2012
t r a n s p o s i t i o n e n Jean-Luc Nancy Daniel Tyradellis Was heißt uns Denken? diaphanes Grundlage dieses Buches bildet ein Gespräch, das Jean-Luc Nancy und Daniel Tyradellis am 3. November 2012
MARX: PHILOSOPHISCHE INSPIRATIONEN
 09.11.2004 1 MARX: PHILOSOPHISCHE INSPIRATIONEN (1) HISTORISCHER RAHMEN: DIE DEUTSCHE TRADITION KANT -> [FICHTE] -> HEGEL -> MARX FEUERBACH (STRAUSS / STIRNER / HESS) (2) EINE KORRIGIERTE
09.11.2004 1 MARX: PHILOSOPHISCHE INSPIRATIONEN (1) HISTORISCHER RAHMEN: DIE DEUTSCHE TRADITION KANT -> [FICHTE] -> HEGEL -> MARX FEUERBACH (STRAUSS / STIRNER / HESS) (2) EINE KORRIGIERTE
Was können wir wissen?
 Was können wir wissen? Bandi Die Natur der Erkenntnis Beiträge zur Evolutionären Erkenntnistheorie Prof. Dr. rer. nat. Dr. phil. Gerhard Vollmer Zentrum für Philosophie und Grundlagen der Wissenschaft
Was können wir wissen? Bandi Die Natur der Erkenntnis Beiträge zur Evolutionären Erkenntnistheorie Prof. Dr. rer. nat. Dr. phil. Gerhard Vollmer Zentrum für Philosophie und Grundlagen der Wissenschaft
Joachim Stiller. Platon: Menon. Eine Besprechung des Menon. Alle Rechte vorbehalten
 Joachim Stiller Platon: Menon Eine Besprechung des Menon Alle Rechte vorbehalten Inhaltliche Gliederung A: Einleitung Platon: Menon 1. Frage des Menon nach der Lehrbarkeit der Tugend 2. Problem des Sokrates:
Joachim Stiller Platon: Menon Eine Besprechung des Menon Alle Rechte vorbehalten Inhaltliche Gliederung A: Einleitung Platon: Menon 1. Frage des Menon nach der Lehrbarkeit der Tugend 2. Problem des Sokrates:
Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung über Theologische Fragen an die Hirnforschung. Erste Lieferung
 Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung über Theologische Fragen an die Hirnforschung Erste Lieferung Zum Thema: Einführung: Verbreitete Ansichten, die für die Theologie relevant
Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung über Theologische Fragen an die Hirnforschung Erste Lieferung Zum Thema: Einführung: Verbreitete Ansichten, die für die Theologie relevant
Frege löst diese Probleme, indem er zusätzlich zum Bezug (Bedeutung) sprachlicher Ausdrücke den Sinn einführt.
 1 Vorlesung: Denken und Sprechen. Einführung in die Sprachphilosophie handout zum Verteilen am 9.12.03 (bei der sechsten Vorlesung) Inhalt: die in der 5. Vorlesung verwendeten Transparente mit Ergänzungen
1 Vorlesung: Denken und Sprechen. Einführung in die Sprachphilosophie handout zum Verteilen am 9.12.03 (bei der sechsten Vorlesung) Inhalt: die in der 5. Vorlesung verwendeten Transparente mit Ergänzungen
Was es heißt, (selbst-)bewusst zu leben. Theorien personaler Identität
 Geisteswissenschaft Miriam Ben-Said Was es heißt, (selbst-)bewusst zu leben. Theorien personaler Identität Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1) Einleitung...S.2 2) Bedeutung der Schlüsselbegriffe...S.3
Geisteswissenschaft Miriam Ben-Said Was es heißt, (selbst-)bewusst zu leben. Theorien personaler Identität Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1) Einleitung...S.2 2) Bedeutung der Schlüsselbegriffe...S.3
Die Induktion und ihre Widersacher
 Joachim Hofmann Die Induktion und ihre Widersacher DR. HÄNSEL-HOHENHAUSEN FRANKFURT A.M.. MÜNCHEN. MIAMI. NEW YORK INHALTSVERZEICHNIS EINLEITUNG UND ANSATZ 9 ERSTES BUCH: DIE INDUKTION HISTORISCH 13 ERSTER
Joachim Hofmann Die Induktion und ihre Widersacher DR. HÄNSEL-HOHENHAUSEN FRANKFURT A.M.. MÜNCHEN. MIAMI. NEW YORK INHALTSVERZEICHNIS EINLEITUNG UND ANSATZ 9 ERSTES BUCH: DIE INDUKTION HISTORISCH 13 ERSTER
1 Immanuel Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Erster Abschnittäus ders.: Kritik
 In diesem Essay werde ich die Argumente Kants aus seinem Text Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Erster Abschnitt 1 auf Plausibilität hinsichtlich seiner Kritik an der antiken Ethik überprüfen (Diese
In diesem Essay werde ich die Argumente Kants aus seinem Text Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Erster Abschnitt 1 auf Plausibilität hinsichtlich seiner Kritik an der antiken Ethik überprüfen (Diese
1. Welche Aussagen treffen die Texte über Ursprung und Genese der Kultur?
 PS: Einführung in die Kulturphilosophie; WS 2007/08, Dozent: René Kaufmann; Sprechzeit: Mittw.: 14-15 Uhr, Donn.: 17-18 Uhr, BZW/A 524; Tel.: 4633-6438/-2689; e-mail: Rene.Kaufmann@tu-dresden.de. Leitfragen
PS: Einführung in die Kulturphilosophie; WS 2007/08, Dozent: René Kaufmann; Sprechzeit: Mittw.: 14-15 Uhr, Donn.: 17-18 Uhr, BZW/A 524; Tel.: 4633-6438/-2689; e-mail: Rene.Kaufmann@tu-dresden.de. Leitfragen
Immanuel Kant. *22. April 1724 in Königsberg +12. Februar 1804 in Königsberg
 Immanuel Kant *22. April 1724 in Königsberg +12. Februar 1804 in Königsberg ab 1770 ordentlicher Professor für Metaphysik und Logik an der Universität Königsberg Neben Hegel wohl der bedeutendste deutsche
Immanuel Kant *22. April 1724 in Königsberg +12. Februar 1804 in Königsberg ab 1770 ordentlicher Professor für Metaphysik und Logik an der Universität Königsberg Neben Hegel wohl der bedeutendste deutsche
3q Philosophie. Arbeitsaufwand (Stunden) Präsenzzeit S Vor- und Nachbereitungszeit S. Formen aktiver Teilnahme. Lehr- und Lernform.
 3q Basismodul: Philosophisches Argumentieren I Hochschule/Fachbereich/Institut: Freie Universität Berlin/ FB und Geisteswissenschaften/ Institut für Qualifikationsziele: Die Studentinnen und Studenten
3q Basismodul: Philosophisches Argumentieren I Hochschule/Fachbereich/Institut: Freie Universität Berlin/ FB und Geisteswissenschaften/ Institut für Qualifikationsziele: Die Studentinnen und Studenten
Erkenntnistheorie I. Der klassische Wissensbegriff: Wissen ist wahre, gerechtfertigte Überzeugung
 Erkenntnistheorie I Platon II: Das Höhlengleichnis Die Ideenlehre Wiederholung Der klassische Wissensbegriff: Wissen ist wahre, gerechtfertigte Überzeugung Was kann man ( sicher ) wissen? Wahrheiten über
Erkenntnistheorie I Platon II: Das Höhlengleichnis Die Ideenlehre Wiederholung Der klassische Wissensbegriff: Wissen ist wahre, gerechtfertigte Überzeugung Was kann man ( sicher ) wissen? Wahrheiten über
7 Gültigkeit und logische Form von Argumenten
 7 Gültigkeit und logische Form von Argumenten Zwischenresümee 1. Logik ist ein grundlegender Teil der Lehre vom richtigen Argumentieren. 2. Speziell geht es der Logik um einen spezifischen Aspekt der Güte
7 Gültigkeit und logische Form von Argumenten Zwischenresümee 1. Logik ist ein grundlegender Teil der Lehre vom richtigen Argumentieren. 2. Speziell geht es der Logik um einen spezifischen Aspekt der Güte
Anhang: Modulbeschreibung
 Anhang: Modulbeschreibung Modul 1: Religionsphilosophie und Theoretische Philosophie (Pflichtmodul, 10 CP) - Ansätze aus Geschichte und Gegenwart im Bereich der Epistemologie und Wissenschaftstheorie sowie
Anhang: Modulbeschreibung Modul 1: Religionsphilosophie und Theoretische Philosophie (Pflichtmodul, 10 CP) - Ansätze aus Geschichte und Gegenwart im Bereich der Epistemologie und Wissenschaftstheorie sowie
Oliver Sensen. Die Begründung des Kategorischen Imperativs
 Oliver Sensen Die Begründung des Kategorischen Imperativs Erschienen in: Dieter Schönecker (Hrsg.), Kants Begründung von Freiheit und Moral in Grundlegung III ISBN 978-3-89785-078-1 (Print) mentis MÜNSTER
Oliver Sensen Die Begründung des Kategorischen Imperativs Erschienen in: Dieter Schönecker (Hrsg.), Kants Begründung von Freiheit und Moral in Grundlegung III ISBN 978-3-89785-078-1 (Print) mentis MÜNSTER
