Effekte einer direkt-instruktiven Förderung der Lesegenauigkeit*
|
|
|
- Greta Richter
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 147 Empirische Sonderpädagogik, 2011, Nr. 2, Effekte einer direkt-instruktiven Förderung der Lesegenauigkeit* Michael Grosche Humanwissenschaftliche Fakultät, Universität zu Köln Trotz der gesellschaftlichen Relevanz und einer großen Prävalenz von funktionalem Analphabetismus in Deutschland ist bislang ungeklärt, welche Alphabetisierungsmethoden im Leseunterricht mit Erwachsenen erfolgreich sind. Daher wurde in der vorliegenden multiplen Einzelfallstudie mit drei Analphabeten eine direkt-instruktive Förderung der Lesegenauigkeit für Wörter evaluiert. Aufgrund sehr langsamer Lernfortschritte bei Analphabeten sind die Ergebnisse relativ inkonsistent. Zwar verbesserten sich die Lernenden teilweise, aber neben einem eingeschränkten Lerntransfer konnten wiederholt zeitweilige Leseverlangsamungen beobachtet werden, was sich durch experimentell erhobene spezifische Lernbarrieren von Analphabeten erklären lässt. Limitationen der Studie und gesellschaftliche Implikationen werden diskutiert. Schlüsselwörter: Direkte Instruktion, Einzelfallstudie, funktionaler Analphabetismus Effects of Direct Instruction in Reading Accuracy Despite tremendous societal relevance and high prevalence of functional illiteracy in Germany, it is unknown which basic education methods in reading instruction are effective with adults. Consequently, the present multiple baseline study with three adult struggling readers evaluates a direct instruction approach in reading accuracy. Due to low rates of learning, results are somewhat inconsistent. Namely, learners only partially increased their reading skills, there was limited generalizability of learning, and a temporarily decline in reading skills. This pattern could be explained by specific learning barriers of functionally illiterate adults. Limitations of the study and societal implications are discussed. Key words: direct instruction, functional illiteracy, single-case study Gute Lese- und Schreibkompetenzen sind eine Grundvoraussetzung für die aktive soziale Partizipation in literalisierten Gesellschaften wie Deutschland. Nicht zuletzt aus diesem Grund werden alle Kinder und Jugendlichen zum Schulbesuch verpflichtet und viele Jahre im Lesen und Schreiben unterrichtet. Daher müssten eigentlich alle hier geborenen Erwachsenen zumindest grundlegend alphabetisiert sein. Jedoch konnten in der ersten für * Das dem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) unter dem Förderkennzeichen 01AB im Projekt Alphabetisierung, Beratung, Chancen ( gefördert.
2 148 M. Grosche Deutschland repräsentativen Studie 14.5 % aller erwerbsfähigen Erwachsenen nicht einmal einfache Informationen aus Texten entnehmen (Grotlüschen & Riekmann, 2011). Weil die Betroffenen die Funktion von Schrift kaum nutzen können, werden sie als funktionale Analphabeten bezeichnet (Egloff, Grosche, Hubertus & Rüsseler, in Druck). Im Gegensatz zu totalen Analphabeten besitzen sie durch ihren Schulbesuch zwar einige Schriftkenntnisse (Wagner & Eulenberger, 2008). Diese reichen aber für die soziale Teilhabe kaum aus. So haben Betroffene z.b. Probleme mit dem Ausfüllen von Formularen oder Wahlzetteln, mit der eigenen lebenslangen Weiterbildung oder mit ihrem beruflichen Aufstieg (Döbert & Hubertus, 2000). Im Rahmen von Alphabetisierungskursen wird versucht, ihnen das Lesen und Schreiben erneut zu vermitteln. Für den Unterricht mit erwachsenen Analphabeten wird meist ein offener, wenig schulnaher und eigenverantwortlicher Unterricht empfohlen, in denen Lerndruck vermieden und Fehler ausdrücklich geduldet werden sollen (Ambroz, 1990; Kamper, 1997; Linde, 2008; Nickel, 2000; Rittmeyer, 1990). Auch wenn dies plausibel erscheint, kommen die wenigen vorliegenden Evaluationsstudien (die zudem methodologisch meist mangelhaft sind, vgl. Shi & Tsang, 2008) zu dem Schluss, dass Alphabetisierungskurse in ihrer bisherigen Konzeption wenig erfolgreich sind (Boudett & Friedlander, 1997; Fitzgerald & Young, 1997; Friedlander & Martinson, 1996; Philliber, Spillman & King, 1996; Sheehan- Holt & Smith, 2000; Torgerson, Porthouse & Brooks, 2003, 2005). Die geringe Wirksamkeit könnte durch das Vorherrschen von ineffektiven Unterrichtsmethoden erklärt werden (Mellard & Scanlon, 2006). Die Effektivität von Grundbildungskursen lässt sich daher vermutlich durch den Einsatz von evidenzbasierten Unterrichtsprinzipien steigern. Eine bei Kindern und Jugendlichen nachgewiesenermaßen effektive Unterrichtsmethode ist die direkte Instruktion von basalen Lesekompetenzen (zur Übersicht Grünke, 2006; Walter, 2007). Darunter wird eine hoch-strukturierte, lehrergesteuerte, lernerzentrierte, schrittweise, feedback- und redundanzreiche Förderung verstanden, in der die zu lernenden Fähigkeiten vom Lehrer präsentiert, in Anleitung mit dem Schüler modelliert und letztendlich so lange einschleifend geübt werden, bis sich ein hoher Automatisierungsgrad zeigt (Watkins & Slocum, 2004). Die direkte Instruktion erscheint auf den ersten Blick nicht erwachsenengerecht. Jedoch konnten sich in einer multiplen Einzelfallstudie von Hintz und Grosche (2010) sechs Alphabetisierungskursteilnehmer durch eine direkt-instruktive Förderung von Buchstabe-Laut-Verbindungen verbessern, wobei ein Transfereffekt auf die Wortlesekompetenz meist ausblieb. Eine Lernerin zeigte infolge der Leseförderung eine unerwartete Verlangsamung der Lesegeschwindigkeit ein Befund, der durch eine weitere Einzelfalluntersuchung zur direkt-instruktiven Förderung der Lesegenauigkeit von Grosche und Hintz (2010) repliziert wurde und durch Besonderheiten im adulten Leselernprozess gedeutet werden kann (s.u.). Beide Evaluationen sind jedoch nur mit Einschränkungen zu interpretieren. Zum einen wurde die unabhängige Variable (direkte Instruktion) nicht systematisch manipuliert, was kausale Schlüsse auf die Unterrichtsmethode verbietet. Zum anderen erfolgte die Interpretation der Leseverlangsamung erst im Nachhinein (post hoc), was zu wissenschaftstheoretischen Problemen führt. Daher wird im vorliegenden Beitrag eine Einzelfallstudie mit einem multiplen Grundratenversuchsplan zur direkten Instruktion der Lesegenauigkeit mit hypothesengeleiteter Erfassung von potentiellen Leseverlangsamungen vorgestellt.
3 149 Leseverlangsamungen im Lernprozess bei funktionalen Analphabeten Als grundlegende Leseprozesse lassen sich die langsame, aber universelle alphabetische und die schnelle, aber spezifische orthografische Lesestrategie unterscheiden (phonologisches buchstabenweises Erlesen von links nach rechts vs. schnelles Erfassen von Wörtern auf einen Blick; vgl. Ehri, 2005). Beginnenden Lesern wird meist die alphabetische Strategie beigebracht, da dadurch ein sogenannter self-teaching mechanism (Share, 1995) in Gang gesetzt wird. Durch diesen Mechanismus können selbständig immer mehr Wörter gelesen werden, die durch mehrmaliges alphabetisches Lesen letztlich im sogenannten orthografischen Sichtwortschatz gespeichert werden und sich so eine effiziente orthografische Lesestrategie entwickelt. Geübte Leser können alle bekannten Wörter sehr schnell auf einen Blick als Sichtwort lesen (orthografische Lesestrategie). Unbekannte Wörter oder Pseudowörter (Wörter, die zwar aussprechbar sind, aber keinen Sinn ergeben) müssen auch von geübten Lesern langsam von links nach rechts lautiert werden (alphabetische Lesestrategie). Viele Analphabeten haben bedingt durch starke phonologische Beeinträchtigungen (Greenberg, Ehri, Perin, 1997; Grosche, 2009; Grosche & Grünke, im Druck; Thompkins & Binder, 2003) Probleme mit der alphabetischen Lesestrategie. Es kann daher für möglich gehalten werden, dass sie zur Kompensation dieser Einschränkungen vor allem orthografisch lesen gelernt haben. Trifft dies zu, dann würden sie versuchen, vor allem anhand orthografischer Merkmale auf das Wort zu schließen anstatt es phonologisch zu analysieren. Da diese Strategie aber nur bei bereits häufig gelesenen Wörtern effektiv ist (Ehri, 2005), gelingt ihnen das Lesen nur eingeschränkt. Wird ihnen dann das alphabetische Lesen vermittelt, müssen sie von ihren gewohnten und automatisierten orthografischen Lesestrategien abweichen. Aber weil die orthografischen Lesestrategien beim Lesen ständig automatisch mitaktiviert werden, stören diese die Ausführung und den Erwerb alphabetischer Lesestrategien, was als Strategie-Interferenz bezeichnet wird (Grosche, in Druck) 1. Sollten sich in der durchgeführten direkten Instruktion bei Analphabeten also kein Zuwachs oder gar ein Rückschritt in der absoluten Lesegeschwindigkeit zeigen, könnte das an einer Verschiebung des Anteils von alphabetischen und orthografischen Lesestrategien liegen. Das wäre durchaus als Erfolg der Maßnahme zu bewerten. Da die Ausführung solcher Lesestrategien implizit und unwillkürlich geschieht, können diese nicht verbalisiert und erfragt werden. Daher wurden sie in der vorliegenden Studie durch ein experimentelles Paradigma erhoben. Fragestellung und Hypothesen Aus den postulierten spezifischen Lernbarrieren und der durchgeführten direkt-instruktiven Unterrichtsmethode lassen sich folgende Forschungsfragen ableiten: 1. Steigert sich die Lesekompetenz von erwachsenen funktionalen Analphabeten durch eine direkt-instruktive Förderung der Lesegenauigkeit? 2. Erfolgt ein Transfer auf standardisierte Lesetests? 3. Findet eine Verschiebung in der Anwendung von Lesestrategien statt? Dazu lassen sich folgende Hypothesen aufstellen: 1 Diese Interferenz ist nicht unbedingt ein sogenanntes Strategie-Nutzungsdefizit (Hasselhorn & Gold, 2006), sondern könnte eher im Sinne eines Stroop-Effektes interpretiert werden (genauer bei Grosche, in Druck).
4 150 M. Grosche 1. Analphabeten verbessern sich in der Lesegeschwindigkeit, wenn eine direkt-instruktive Förderung erfolgt. 2. Es findet ein Transfer auf standardisierte Lesetests statt. 3. Analphabeten verwenden im Laufe der Förderung vermehrt alphabetische und weniger orthografische Lesestrategien. Methode Stichprobe An der multiplen Einzelfallstudie nahmen drei funktionale Analphabeten teil, die in einem täglich stattfindenden Grundbildungsintensivkurs an der Volkshochschule Oldenburg das Lesen und Schreiben lernten. Eine durchschnittliche Unterrichtseinheit zur direkten Instruktion der Lesegenauigkeit dauerte etwa 15 Minuten und wurde zweimal täglich wiederholt. Die Evaluation erfolgte über einen Zeitraum von drei Monaten durch einen multiplen Grundratenversuchsplan mit drei Lernenden (Eva, Georg und Olaf; alle Namen geändert). Alle drei ehemaligen Förderschüler konnten nahezu alle Buchstaben sicher lautieren, aber lasen nur auf dem Niveau der ersten Grundschulklasse. Eva (50 Jahre) litt unter frühen Lernproblemen und in der Folge unter Gewalterfahrungen durch den Vater. Ihre Motivation zur Kursteilnahme ist, dass ihr dann Briefe nicht mehr von der Tochter oder vom Ehemann vorgelesen werden müssen. Georg (55 Jahre) war bereits zu Beginn sehr schlecht in der Schule und wurde kaum gefördert. Als Frührentner möchte er seine freie Zeit sinnvoll nutzen. Olaf (24 Jahre) ist nach eigener Aussage in der Schule sehr faul gewesen. Er möchte seinen Hauptschulabschluss und den Führerschein nachmachen. Beschreibung der direkt-instruktiven Unterrichtsmethode Gerade das bedächtige, aber korrekte Vorlesen ist für schwache Lerner mit phonologischen Problemen überaus schwierig (Carnine, Silbert, Kame enui, Tarver & Jungjohann, 2004; Pullen, Lane, Lloyd, Nowak & Ryals, 2005). Daher ist die Grundlage der direkt-instruktiven Förderung das sehr langsame phonologisch-alphabetische Erlesen von Wörtern in Leserichtung, dessen Geschwindigkeit im Laufe der Unterrichtung immer weiter gesteigert wird. So soll eine möglichst hohe Lesegenauigkeit erreicht und der self-teaching mechanism in Gang gesetzt werden. Allgemein lassen sich dazu die folgenden drei Unterrichtsschritte unterscheiden (für eine Praxisanleitung siehe Engel, 2011b): 1. Einführung neuer Buchstabenkombinationen. Der Lehrende schreibt ein Wort mit den zu lernenden Buchstaben oder Buchstabenkombination an die Tafel. Das Wort muss den Lernenden bekannt sein und darf nur diejenigen Buchstaben enthalten, die von allen sicher beherrscht werden. Anschließend fährt der Lehrende mit dem Finger von Buchstabe zu Buchstabe, pausiert dort für jeweils etwa 1,5 Sekunden und begleitet das Zeigen mit dem kontinuierlichen und extrem gedehnten Lautieren des Wortes. Bei nicht-dehnbaren Lauten (z.b. k, t, p) wird nur für einen kurzen Augenblick gehalten. Anschließend kehrt der Lehrende mit dem Finger zurück zum Anfang des Wortes und wiederholt das Wort kurz und prägnant, begleitet vom schnellen Mitzeigen des Wortes. 2. Überprüfung der Korrektheit. Einzelne Lernende werden in zufälliger Reihenfolge aufgerufen, um den ersten Lernschritt zu wiederholen. Der Lehrende fährt mit dem Finger langsam von Buchstabe zu Buchstabe und der Lernende liest den Buchstaben, unter dem der Finger des Lehrenden ist, sehr langsam und gedehnt vor. Verliest sich ein Lernender, benennt einzelne
5 151 Buchstaben, anstatt sie zusammenzuschleifen, oder liest er zu schnell, korrigiert der Lehrende ihn und zeigt ihm die richtige Vorgehensweise erneut. Lernschritt 2 wird für jeden Lerner wiederholt, bis sichergestellt ist, dass alle Lerner das geübte Wort langsam, aber korrekt phonologisch dekodieren können. 3. Transfer auf andere Wörter. Der Lehrende schreibt ein weiteres Wort mit dem zu trainierenden Buchstaben oder der Buchstabenfolge an die Tafel. Die Lernschritte 1 und 2 werden so lange wiederholt, bis Sicherheit im Lesen der betreffenden Worte erreicht ist. Nach einiger Übung lesen sich die Lernenden gegenseitig die Wörter auf Arbeitsblättern langsam vor. Forschungsdesign Das Forschungsdesign konnte nicht wie geplant zeitlich versetzt dreistufig durchgeführt werden, weil Eva als sehr ängstliche Teilnehmerin lieber mit Georg zusammen die direkte Instruktion beginnen wollte. In den ersten drei Wochen erfolgte die Erhebung der Grundrate (Baseline), in der keine direkt-instruktive Förderung der Lesegenauigkeit, sondern ausschließlich der reguläre Grundbildungsunterricht stattfand. Danach folgten zwei Wochen Osterferien. Ab der fünften Woche starteten Georg und Eva mit der Unterrichtung der Lesegenauigkeit. Olaf blieb für drei weitere Wochen in der Baseline-Bedingung und startete anschließend mit der Intervention, wobei nicht nur die Lehrenden, sondern auch Georg und Eva die alphabetische Lesestrategie vormachten. Insgesamt dauerte die Evaluation etwa 100 Tage. Die Logik des Forschungsdesigns sieht vor, dass dann auf einen kausalen Effekt der Unterrichtsmethode geschlossen werden kann, wenn bei allen Teilnehmern ein Fortschritt ab dem zeitlich versetzten Trainingsbeginn nachgewiesen werden kann (Horner, Carr, Halle, McGee, Odom & Wolery, 2005; Julius, 2004; Stoner, Scarpati, Phaneuf & Hintze, 2002). Abhängige Variablen und statistische Analysen Die aktuelle Leseleistung wurde über eine curriculum-basierte Messung (CBM) mit Wortlisten gemessen (etwa zweimal pro Woche). Die Entwicklung der CBM-Wortlisten erfolgte durch die Ziehung von 50 Wörtern aus einfachen Texten anhand spezifischer Kriterien, wie Silbenanzahl und Wortfunktion. Die Zeit für das Lesen der Liste wurde in gelesene Wörter pro Minute verrechnet. Pro Teilnehmer wurde ein Regressionsmodell gerechnet mit den gelesenen Wörtern pro Minute als abhängiger Variablen. Für die Verwendung einer Regression spricht, dass nur durch dieses Verfahren sowohl Änderungen im Niveau als auch Änderungen im Trend adäquat berücksichtigt werden können. Als Prädiktoren im Regressionsmodell fungierten die Anzahl der seit Beginn der Evaluation verstrichenen Tage, eine Dummy-Variable (0=Baseline vs. 1=Intervention) sowie eine Interaktionsvariable (slope change variable) als Produkt aus der Dummy-Variablen und der seit Beginn der Intervention verstrichenen Tage (Beretvas & Chung, 2008; Grosche & Hintz, 2010; Huitema & McKean, 2000; Parker et al., 2005; Parker, Hagan-Burke & Vannest, 2007). Bei wenigen Messwerten können Ausreißer die Regressionsrechnung stark verzerren. Aus diesem Grund wurden alle Werte von ± 1.5 SD um die Regressionsgerade ausgeschlossen (das betraf Eva und Olaf mit einem Wert und Georg mit zwei Werten). Insgesamt liegen für Eva, Georg und Olaf jeweils 18, 22 und 19 Messungen vor. Laut der aufgestellten Hypothese sollte die Steigung nach Einsetzen der Intervention größer als in der Grundratenphase sein. Diese Hypothese wird über das oben dargestellte Regressionsmodell von Huitema und McKean (2000) auf Signifikanz geprüft, in
6 152 M. Grosche dem (nach der Parameterschätzung durch das vollständige Modell) die Regressionsmodelle mit und ohne Berücksichtigung der Interaktionsvariablen auf Signifikanz getestet werden. Allerdings berücksichtigt die Regressionsanalyse nicht die Autokorrelation der Daten, weshalb das Signifikanzniveau streng genommen nicht interpretiert werden darf (Köhler, 2008). Die Autokorrelation der vorliegenden Daten kann nicht korrekt berechnet werden, weil die Abstände zwischen den Erhebungen ungleich sind und viel zu wenige Messwerte vorliegen (regulär wird für die Berechnung der Autokorrelation ein Mindestmaß von 50 Messzeitpunkten gefordert, vgl. Köhler, 2008). Wird sie trotzdem berechnet, liegt bei Eva, Georg und Olaf jeweils eine lag- 1-Autokorrelation von ρ =.48,.40 und.35 vor. Entscheidender als die Signifikanz ist daher die Effektstärke R 2. Allerdings wird im Falle der Autokorrelation die Effektivität einer Intervention überschätzt, was Parker et al. (2005) in einer Metaanalyse sowie Beretvas und Chung (2008) in einer Simulationsstudie nachweisen konnten. Bislang liegen jedoch keine neuen Bewertungskriterien für die Interpretation der Effektstärken vor, so dass in Ermangelung von Alternativen auf Cohen (1987) zurückgegriffen wird, dessen Interpretationsgrenzen für kleine, mittlere und große Effekte R 2 =.01,.09 und.25 betragen. Zur Erfassung möglicher Transfereffekte wurde vor und nach dem Evaluationszeitraum die aktuelle Leseleistung durch die Würzburger Leise-Leseprobe (WLLP) erhoben (Küspert & Schneider, 1998). Auch hier ist von einer Verbesserung der richtig gelesenen Items auszugehen. Um die Hypothese der Lesestrategieverlagerung zu überprüfen, wurden zu Beginn, in der Mitte (als Olaf mit der Förderung begann) und am Ende der Förderung ein experimenteller Reaktionszeit-Tests für Sichtwort- Lesestrategien verwendet (Grosche & Hintz, 2010), in dem jeweils 30 Wörter, Pseudowörter und Bruchteile von Wörtern (z.b. Fenster, Fenske und Fen) auf einem Computerbild- schirm in randomisierter Reihenfolge präsentiert wurden und so schnell wie möglich vorgelesen werden sollten. Die abhängigen Variablen bildeten die Anzahl der Lesefehler und die Reaktionszeiten für richtig gelesene Wörter. In die Berechnung gingen nur diejenigen Reaktionszeiten ein, die in der jeweiligen Bedingung innerhalb von ± 2 SD um den Mittelwert streuten. Starke orthografische Sichtwortleser lesen Wörter deutlich schneller als Pseudowörter, da letztere nur durch die langsamere alphabetische Strategie gelesen werden können. Durch die Unterrichtung sollte sich bei Sichtwortlesern die Differenz zwischen Wörtern und Pseudowörtern reduzieren. Die Differenzen werden durch die Effektstärke d ausgedrückt, deren Interpretationsgrenzen für kleine, mittlere und große Effekte bei d =.20,.50 und.80 liegen (Cohen, 1987). Ergebnisse Tab. 1: Rohwerte und Prozentränge in der WLLP vor und nach dem direkt-instruktiven Unterricht Tabelle 1 zeigt die Rohwerte in der WLLP vor und nach der Durchführung der Evaluation sowie die Prozentränge im Vergleich zur ersten Grundschulklasse. Unter Berücksichtigung des Standardmessfehlers der WLLP (8.6 Rohwertpunkte) ist nur bei Olaf von einer echten Steigerung der Leseleistung in stan- Vortest Nachtest Rohwerwert PR Roh- PR Eva Georg Olaf Anmerkungen. Rohwert = korrekt gelesene Items pro Minute; PR = Prozentrang im Vergleich zur ersten Grundschulklasse
7 153 Abb. 1: Die Leseleistungen von Eva, Georg und Olaf in insgesamt gelesenen Wörtern pro Minute (schwarz) und die Ergebnisse der Regressionsrechnungen (grau) im Verlauf bis zu 100 Tagen. dardisierten Wortlesetests auszugehen. Eva und Georg zeigten dagegen keine signifikanten Verbesserungen in der WLLP. Innerhalb der Vertrauensintervallgrenzen von 95 % hat sich keiner der Lernenden verbessert. Die Ergebnisse der CBM-Leseleistungen (Wörter pro Minute) im Verlauf der Evaluati- on sind in Abbildung 1 als schwarze Kurve eingezeichnet. Die visuelle Analyse der Kurve gestaltet sich aufgrund der starken tagesaktuellen Schwankungen sehr schwierig, weshalb eine reine visuelle Analyse unzuverlässig und wenig objektiv erscheint. Aus diesem Grund wurde pro Person das oben be-
8 154 M. Grosche Tab. 2: Parameter der Regressionsmodelle mit der Anzahl bearbeiteter Wörter pro Minute als abhängige Variable Parameter des Gesamtmodells Änderung Steigung Änderung Konstante β 0 β 1 β 2 β 3 R 2 p ΔR 2 p ΔR² p Eva Georg Olaf Anmerkungen. β 0 = Konstante in der Baseline-Phase, β 1 = Steigung in der Baseline-Phase pro Tag, β 2 = Änderung der Konstanten in der Interventionsphase, β 3 = Änderung der Steigung in der Interventionsphase; die Steigung in der Interventionsphase beträgt β 1 + β 3 ; die Konstante zur Interventionsphase beträgt β 0 + β 1 (verstrichene Tage bis zum Einsetzen der Intervention) + β 2 ; ΔR 2 = zusätzliche Varianzaufklärung durch Berücksichtigung von β 3 (Steigung) bzw. von β 2 (Konstante) im Vergleich zur Regressionsrechnung ohne diese Variable; p = Signifikanzniveau. schriebene Regressionsmodel berechnet und als graue Linie in Abbildung 1 eingezeichnet. Die Regressionsgewichte finden sich in Tabelle 2 und sind folgendermaßen zu interpretieren (zur Nomenklatur siehe Huitema & McKean, 2000): β 0 ist die Konstante während der Baseline- Phase, d.h. die geschätzte Anzahl der gelesenen Wörter pro Minute zu Beginn der Baseline. β 1 ist die Steigung der Regressionsgeraden in der Baseline-Phase, d.h. der Zuwachs insgesamt gelesener Wörter pro Tag während der Baseline-Phase. β 2 ist die Veränderung der Konstanten der Regressionsgeraden in der Interventionsphase im Vergleich zur Baseline-Phase. β 3 ist die Veränderung der Steigung in der Interventionsphase im Vergleich zur Baseline-Phase. β 1 + β 3 ist die Steigung der Regressionsgeraden in der Interventionsphase. β 0 + β 1 (Anzahl der Tage der Baseline-Bedingung+1) + β 2 ist die Konstante der Interventionsphase 2. Die Modellaufklärung R 2 durch das Gesamtregressionsmodell mit allen Variablen und das zugehörige Signifikanzniveau finden sich ebenfalls in Tabelle 2. Zur Interpretation der Fördereffekte werden zwei restringierte Modelle gerechnet und der Zuwachs in der Varianzaufklärung durch das vollständige Modell als Effektstärke ΔR 2 und Signifikanzprüfung p erfasst. Das erste Modell (Änderung in der Steigung während der Intervention) wird ohne β 3 berechnet; das zweite Modell (Änderung in der Konstante in der Interventionsphase) ohne β 2. Evas Leseleistungen blieben während der Baseline auf einem sehr niedrigen Niveau konstant. Sie startete die Evaluation mit einer relativ niedrigen Leseleistung von etwa 2.8 Wörtern pro Minute (β 0 ), ein Lernzuwachs fand während des regulären Alphabetisierungsunterrichts mit Wörtern pro Tag (bzw Wörter pro Woche) nicht statt (β 1 ). Mit Einsetzen der direkt-instruktiven Förderung verschlechterte sich die Leseleistung von Eva zwar zuerst um Wörter (β 2 ), aber im Laufe der Intervention stieg ihre Le- 2 Die Konstante der Interventionsphase ist bei Beretvas und Chung (2008) falsch dargestellt, weshalb auf Huitema und McKean (2000) zurückgegriffen werden sollte.
9 155 sekompetenz mit Wörtern pro Tag (bzw Wörtern pro Woche) viermal so stark wie im normalen Unterricht (β 1 + β 3 ). Insgesamt kann das Gesamtmodell 58.3 % der Varianz in Evas Leseleistungen aufklären (p =.006). Der Interventionseffekt auf die Steigung von Evas Leseleistungen beträgt 44.3 % (p =.001), was nach Cohen (1987) eine große Effektstärke darstellt. Der Interventionseffekt von 10.4 % auf die kurzzeitige Leseverschlechterung zu Beginn der Förderung verfehlt gerade eben das Signifikanzniveau (p =.073). Damit ist die Steigung der Geraden in der Interventionsphase steiler als in der Baseline-Phase. Georg startete die Evaluation mit einer Ausgangsleistung von etwa 12 Wörtern pro Minute (β 0 ). Seine Leseleistungen verschlechterten sich in der Baseline-Phase mit Wörtern pro Tag (bzw Wörtern pro Woche), er las also tendenziell immer langsamer (β 1 ). Nach Einsetzen der Intervention stieg seine Leseleistung schlagartig um Wörter an (β 2 ). Ebenfalls konnte er sich allmählich mit Wörtern pro Tag (bzw Wörter pro Woche) wieder verbessern (β 1 + β 3 ) und erreichte am Ende der Evaluation etwa das Niveau, das er bereits vor der Förderung aufwies. Der Effekt der Intervention auf die Steigung der Regressionsgeraden beträgt 44.6 % (p =.001) und auf die Änderung zu Beginn der Intervention 26.7 % (p =.005). Beides sind große Effektstärken in der Terminologie von Cohen (1987). Damit konnte nachgewiesen werden, dass die Leseentwicklung mit Einsetzen der Förderung positiver verlief. Olaf begann mit einer mittleren Leseleistung von etwa 6.3 Wörtern pro Minute und zeigte weder in der Baseline- noch der Interventionsphase eine Entwicklung. Sämtliche Fördereffekte sind praktisch unbedeutsam und verfehlen weit das Signifikanzniveau. Des weiteren sollte überprüft werden, ob diese Verbesserungen, Stagnationen und/ oder Verschlechterungen auf eventuelle Verschiebungen von alphabetischen und orthografischen Lesestrategien zurückzuführen sind. Dazu wurden die Daten der experimentellen Reaktionszeittests herangezogen. In Tabelle 3 sind die Prozentwerte der insgesamt korrekt gelesenen Items pro Teilnehmer (Eva, Georg, Olaf), Bedingung (Wörter, Pseudowörter, Bruchteile von Wörtern) und Messzeitpunkt (Messzeitpunkte T1, T2, T3) aufgeschlüsselt. T1 T2 T3 Eva Wörter Pseudowörter Bruchteile Georg Wörter Pseudowörter Bruchteile Olaf Wörter Pseudowörter Bruchteile Anmerkungen. T1 = erster Messzeitpunkt vor Beginn der Intervention; T2 = zweiter Messzeitpunkt zum Zeitpunkt des Interventionsbeginns für Olaf; T3 = dritter Messzeitpunkt nach Ende der Intervention. Tab. 3: Prozentsatz der richtig gelesenen Items im Sichtwortlesetest zu den drei Messzeitpunkten
10 156 M. Grosche Zu Beginn der Evaluation (T1) hatte Eva vor allem Schwierigkeiten mit dem Lesen von Pseudowörtern. Wörter und Bruchteile von Wörtern bereiteten ihr weniger Probleme. Nach den ersten Wochen der Förderung verschlechterten sich Evas Leseleistungen dramatisch (T2). Zu T3 konnte sie sich jedoch wieder stark verbessern und erreichte zumindest beim Lesen von Wörtern und Bruchteilen von Wörtern höhere Werte als vor der Intervention. Das Lesen von Pseudowörtern machte ihr dagegen weiterhin sehr große Probleme. Georgs Lesekompetenz für Wörter und Pseudowörter veränderte sich von T1 zu T2 nicht, lediglich Bruchteile von Wörtern las er besser. Am Ende der direkt-instruktiven Unterrichtung (T3) konnte er sich in allen drei Bedingungen noch einmal steigern. Olaf zeigte zum ersten und zweiten Messzeitpunkt relativ ähnliche Fähigkeiten. Zu T3 konnte er sich sehr stark verbessern. Er las sogar alle Wörter korrekt und machte nur noch wenige Fehler beim Lesen von Pseudowörtern und Bruchteilen von Wörtern. Zuletzt erfolgte die Analyse des Sichtworteffekts bei Analphabeten im Verlauf der Förderung. Die Unterschiede in den Reaktionszeiten für das Lesen von realen Wörtern vs. Pseudowörtern bzw. reale Wörter vs. Bruchteile von Wörtern werden in die Effekt- stärke d überführt (Tabelle 4). Zu Beginn der Evaluation (T1) las Eva reale Wörter etwa gleichschnell wie Pseudowörter, was sehr untypisch im Vergleich zu den übrigen Befunden ist. Sie zeigte erst nach den ersten Wochen der Förderung (T2) einen Sichtworteffekt (was gegen die eingangs formulierte Hypothese der Strategie-Verschiebung spricht), der zum Ende der Intervention (T3) wieder etwas annahm (was wiederum für die Hypothese spricht). Bruchteile von Wörtern las sie im Vergleich zu Wörtern im Verlauf der Evaluation zunehmend schneller. Georg zeigte zu Beginn einen sehr großen orthografischen Sichtworteffekt, da er Pseudowörter deutlich langsamer als Wörter las. Zum zweiten Messzeitpunkt (nach einigen Wochen Förderung) offenbarte sich ein ähnliches Muster. Am Ende der Evaluation konnten sich die Lesezeiten für Wörter und Pseudowörter auf eine mittlere Effektstärke annähern; sein Sichtworteffekt verringerte sich demnach. Die Differenzen zwischen Bruchteilen von Wörtern und Wörtern änderte sich dagegen kaum. Auch Olaf las Pseudowörter zu T1 und T2 deutlich langsamer als Wörter; auch bei ihm lag also ein starker orthografischer Sichtworteffekt vor. Nach Ende der Evaluation näherten sich die Lesezeiten für Wörter und Pseudowörter weiter an. Der Sichtworteffekt wur- T1 T2 T3 Eva Pseudowörter Bruchteile Georg Pseudowörter Bruchteile Olaf Pseudowörter Bruchteile Anmerkungen. Bei positiven Werten wurden Pseudowörter/ Bruchteile schneller als reale Wörter gelesen; bei negativen Werten wurden Pseudowörter langsamer als reale Wörter gelesen; T1 = erster Messzeitpunkt vor Beginn der Intervention; T2 = zweiter Messzeitpunkt zum Zeitpunkt des Interventionsbeginns für Olaf; T3 = dritter Messzeitpunkt nach Ende der Intervention. Tab. 4: Standardisierte Differenzen d der Lesezeiten für Pseudowörter und Bruchteile von Wörtern im Vergleich zu realen Wörtern
11 157 de also geringer. Olaf las zu Beginn der Förderung Wörter und Bruchteile von Wörtern nahezu gleich schnell. Im Laufe der Evaluation verschnellerte sich das Lesen von Bruchteilen rascher als das Lesen von Wörtern. Diskussion In der vorliegenden Studie sollte untersucht werden, ob sich die Lesekompetenz von drei erwachsenen funktionalen Analphabeten durch eine direkt-instruktive Förderung der Lesegenauigkeit steigern lässt, ob ein Transfer auf standardisierte Lesetests erfolgt und ob eine Verschiebung von Lesestrategien stattfindet. Laut Lehrereinschätzung ist Eva die schwächste und ängstlichste Teilnehmerin des Kurses. Sie konnte sich mit Einsetzen der direkt-instruktiven Unterrichtung stark verbessern, auch wenn sie sich absolut gesehen noch immer auf einem sehr geringen Niveau befindet. Dagegen ist eine vergleichbare Verbesserung in der WLLP nicht zu replizieren. In der Analyse der experimentellen Lesetests verschlechterten sich Evas Leseleistungen nach Einsetzen der Förderung, konnten aber zum Ende einen hohen Wert für das Lesen von realen Wörtern und Bruchteilen von Wörtern annehmen. Diese zeitweilige Verschlechterung kann durch Strategie-Interferenzen erklärt werden (Grosche, in Druck). Danach kann unter der Oberfläche der gemessenen Leseleistungen eine intrinsische Lesestrategieverschiebung stattfinden, die durchaus positiv zu sehen wäre. Auffällig ist jedoch, dass Eva auch am Ende der Evaluation sehr starke Probleme mit dem korrekten und schnellen Lesen von Pseudowörtern hat. Pseudowörter können ausschließlich durch die alphabetische, nicht aber durch die orthografische Lesestrategie gelesen werden, da kein Sichtworteintrag für Pseudowörter existiert (Ehri, 2005). Da in der Förderung ausschließlich die alphabetische Strategie geübt wurde, wäre besonders hier ein Anstieg eine starke Evidenz für den kausalen Effekt der In- tervention. Völlig untypisch ist, dass Eva zu Beginn Wörter vergleichbar schnell wie Pseudowörter liest. Dieses Ergebnis könnte am besten als tagesaktuelle Schwankung interpretiert werden, denn in den beiden weiteren Tests zeigte Eva einen deutlichen Sichtworteffekt. Zusammengefasst liefern die Analysen von Evas Fall sehr inkonsistente Ergebnisse: Sie las mit Einsetzen der direkt-instruktiven Förderung immer besser, was sich aber weder im standardisierten Lesetest noch im Ausmaß der verwendeten Lesestrategien widerspiegelte. Georg verschlechterte sich im Laufe der Baseline-Bedingung stark, in der er den regulären Grundbildungskurs besuchte. Das muss nicht unbedingt gegen die gegenwärtig implementierten Unterrichtsmethoden sprechen, denn ein Absinken kann auch durch Strategie-Interferenzen erklärt werden (Grosche, in Druck). Eine solche Interpretation ist mit den folgenden Analysen konsistent: Mit dem Einsetzen der direkt-instruktiven Intervention konnte sich Georg wieder verbessern, erreichte allerdings am Ende der Evaluation in etwa das Niveau, das er bereits vor der Förderung aufwies. Das repliziert die Ergebnisse der Einzelfallstudie von Grosche und Hintz (2010). Auch hier konnte ein Tal der Leseleistungen beobachtet werden, das am ehesten durch Verschiebungen von schnellen (aber unzuverlässigen) orthografischen zu langsamen (aber zuverlässigeren) alphabetischen Lesestrategien begründet zu sein scheint. Das würde auch erklären, warum Georg in der WLLP keinen Lernzuwachs zeigte. Für einen kausalen Effekt der Intervention spricht neben der Steigerung in der CBM ab Einsetzen der direkt-instruktiven Unterrichtsmethode die Verringerung des Sichtworteffektes. Im Verlauf der Förderung verschoben sich die Lesestrategien zunehmend in Richtung alphabetischer Strategien. Es scheint, als hätte die alphabetische Intervention ihn von der sehr starken Verwendung der orthografischen Leseroute zur vermehrten Anwendung der flexiblen alphabetischen
12 158 M. Grosche Route bewegen können. Wahrscheinlich konnte die direkt-instruktive Unterrichtung die Strategie-Interferenzen reduzieren und so den self-teaching mechanism in Gang setzen. In Zukunft ist zu erwarten, dass Georg mehr liest und sich beide Strategien immer weiter entwickeln. Olafs Leseleistungen stagnieren vor und nach dem Einsetzen der Förderung. Wahrscheinlich war der Unterrichtszeitraum zu kurz, um die bei Analphabeten mehrfach replizierte sehr langsame Kompetenzsteigerung adäquat abzubilden (Grosche & Hintz, 2010; Hintz & Grosche, 2010). Dagegen spricht allerdings die Verbesserung in der WLLP. Da sich in der CBM kaum Effekte zeigten, ist diese Steigerung in der WLLP nicht unbedingt auf den direkt-instruktiven Unterricht zurückzuführen, sondern könnte ebenso durch den regulären Alphabetisierungsunterricht oder externe Effekte zu erklären sein. Hilfen zur Interpretation liefern die Analysen der Reaktionszeittests. Olaf konnte seine Leseleistungen nach Einsetzen der Förderung verbessern und einen geringeren Sichtworteffekt erreichen. Es scheint damit ein Hinweis vorzuliegen, dass durch die Unterrichtung der self-teaching mechanism initiiert und die Strategie-Interferenz reduziert wurde. Genau wie bei Georg ist bei Olaf davon auszugehen, dass er dadurch seine Leseleistungen in Zukunft verbessern wird. Für eine solche Interpretation spricht auch die bei allen drei Lernenden zu beobachtende Verschnellerung im Lesen von Bruchteilen von Wörtern: Analphabeten lesen Silben sehr viel schneller als reale Wörter und Pseudowörter. Nach der phonological grain size theory von Ziegler und Goswami (2005) könnte dies einen wichtigen Entwicklungsschritt reflektieren. Weil die kleineren Einheiten der Schrift (grain sizes) in der deutschen Orthografie sehr regelmäßig sind, ermöglichen sie eine hohe Lesegenauigkeit. Daher sollten sich in der weiteren Lesekompetenzentwicklung der Teilnehmer die Reaktionszeiten auch für größere Einheiten immer mehr der Geschwindigkeit für die Analyse kleinerer Einheiten annähern. Die vorliegende Studie wurde initiiert, um die Desiderata der bislang vorliegenden Studien zur direkten Instruktion bei Analphabeten durch die Anwendung eines gestuften multiplen Grundratenversuchplans und die Analyse der orthografischen Sichtwortlesestrategien im Verlauf der Förderung zu beseitigen. Leider konnte das Forschungsdesign nicht wie geplant dreistufig, sondern nur zweistufig durchgeführt werden, was den Praxisbedingungen im sonderpädagogischen Feld geschuldet ist. Nach Einsetzen der Förderung konnte sich Olaf nicht im Lesen verbessern, weshalb die Steigerungen bei Eva und Georg nicht eindeutig kausal auf die direkt-instruktive Förderung zurückgeführt werden können. Deshalb wurde sich dem ersten Desideratum des gestuften Grundratenversuchplans zwar genähert, aber es wurde nicht vollständig erreicht. Die Analyse der Lesestrategietests kann bei Olaf und Georg relativ gut als angestrebte Verschiebung zugunsten der alphabetischen Strategie interpretiert werden. Dagegen scheinen Evas Leistungen starken tagesaktuellen Schwankungen ausgesetzt zu sein. Aufgrund dieser Inkonsistenzen konnte auch das zweite Desideratum der Analyse von Lesestrategieverschiebungen nicht völlig erreicht werden. Es bleibt also zu konstatieren, dass zwar einige positive Hinweise auf Fördereffekte der direkten Instruktion in der Grundbildung von erwachsenen funktionalen Analphabeten gefunden wurden. Aber dies spiegelt sich ebenso wie die sehr positiven subjektiven Einschätzungen von Lernenden und Lehrenden zur Verwendbarkeit der direkten Instruktion im Alphabetisierungsunterricht (vgl. Engel, 2011a; Grosche, Hintz & Grünke, 2011; Weber, Müller-Holtz & Schulte-Beerbühl, 2011) nicht in den hier objektiv gemessenen, aber inkonsistenten Leseleistungen wider. Daher stellt die direkte Instruktion auch nach Vorlage dieser Studie keine eindeutig empi-
13 159 risch bewährte Methode für den Grundbildungsunterricht dar. Allerdings gilt der Aspekt der fehlenden empirischen Evidenz auch für jede andere Unterrichtsmethode in der Alphabetisierungspädagogik. Es bleibt deshalb zu fordern, dass Replikationsstudien vielfältige didaktische Prinzipien evaluieren (z.b. nach den Vorschlägen von Grosche & Hintz, 2010), um so empirisch abgesicherte Empfehlungen für den Unterricht geben zu können. Einzelfallstudien sind in diesen frühen Stadien der Alphabetisierungsforschung ein sinnvolles und ökonomisches Evaluationsprinzip. Wie in der hier vorgelegten Untersuchung können so bei der sehr schwierig zugänglichen und in der sonderpädagogischen Forschung völlig unterrepräsentierten Population der erwachsenen Analphabeten erste Spezifizierungen der Vorgehensweisen und erste Hypothesen zu Effektgrößen, Zielpopulationen und Wirkmechanismen überprüft werden (vgl. Cholewa, 2010; Buchner & Koenig, 2008; Schmetz, 2004). Die wiederholt nachgewiesenen sehr langsamen Lernfortschritte der Analphabeten deuten darauf hin, dass bei ihnen spezifische Lernbarrieren für den Schriftspracherwerb vorliegen, wie z.b. Strategie-Interferenzen (Grosche, im Druck) und phonologische Beeinträchtigungen (Greenberg et al., 1997; Grosche, 2009; Grosche & Grünke, im Druck; Thompkins & Binder, 2003). Diese Barrieren können voraussichtlich nur durch ein intensives und stark explizites Training der basalen Lesekompetenzen überwunden werden (Foorman & Torgesen, 2001; Grosche et al., 2011). Damit ist neben dem pädagogischen auch ein politischer Auftrag erteilt: Zur Intervention bei funktionalem Analphabetismus reichen die bisherigen wöchentlichen Grundbildungsangebote nicht aus. Stattdessen muss jedem lernwilligen Erwachsenen Zugang zu niederschwelligen, kostenfreien, langfristigen, intensiven und evidenzbasierten Alphabetisierungskursen gewährt werden, um ihr oder ihm durch den Erwerb der Funktion von Schrift die gesellschaftliche Partizipation in literalisierten Gesellschaften zu ermöglichen. Literatur Ambroz, K. L. (1990). Alphabetisierungskurse Legasthenietherapie für Erwachsene? Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete, 59, Beretvas, S. N. & Chung, H. (2008). An evaluation of modified R²-change effect size indices for single-subject experimental designs. Evidence-based Communication Assessment and Intervention, 2 (3), Boudett, K. P. & Friedlander, D. (1997). Does mandatory basic education improve achievement test scores of AFDC recipients? Evaluation Review, 21, Buchner, T. & Koenig, O. (2008). Methoden und eingenommene Blickwinkel in der sonder- und heilpädagogischen Forschung von eine Zeitschriftenanalyse. Heilpädagogische Forschung, 34, Carnine, D. W., Silbert, J., Kame enui, E. J., Tarver, S. G. & Jungjohann, K. (2006). Teaching struggling and at-risk readers. A direct instruction approach. New Jersey: Pearson. Cholewa, J. (2010). Empirische Sprachheilpädagogik: Strategien der Sprachtherapieforschung bei Störungen der Sprachentwicklung. Empirische Sonderpädagogik, 2, Cohen, J. (1987). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. Döbert, M. & Hubertus, P. (2000). Ihr Kreuz ist die Schrift. Analphabetismus und Alphabetisierung in Deutschland. Stuttgart: Klett. Egloff, B., Grosche, M., Hubertus, P. & Rüsseler, J. (in Druck). Funktionaler Analphabetismus: eine Definition. In alphabund (Hrsg.), Besonderheiten der Erwachsenenalphabetisierung [Arbeitstitel]. Ehri, L. C. (2005). Development of sight word reading: phases and findings. In M. J. Snowling & C. Hulme (Eds.), The science of reading (pp ). Malden: Blackwell. Engel, N. (2011a). Blick in die Praxis Direkte Instruktion. In K. Ratzke & A. Scholz (Hrsg.),
14 160 M. Grosche Alphabetisierung Beratung Chancen. Abschlussbericht zu einem Forschungs- und Entwicklungsprojekt (S ). Oldenburg: DIZ. Engel, N. (2011b). Schere statt Scherze wie die Lesegenauigkeit gefördert werden kann. Alfa-Forum, 76, Fitzgerald, N. B. & Young, M. B. (1997). The influence of persistence on literacy learning in adult education. Adult Education Quarterly, 47, Foorman, B. R. & Torgesen, J. K. (2001). Critical elements of classroom and small-group instruction promote reading success in all children. Learning Disabilities Research & Practice, 16, Friedlander, D. & Martinson, K. (1996). Effects of mandatory basic education for adult AFDC recipients. Educational Evaluation and Policy Analysis, 18, Greenberg, D., Ehri, L. C. & Perin, D. (1997). Are word-reading processes the same or different in adult literacy students and thirdfifth graders matched for reading level? Journal of Educational Psychology, 89, Grosche, M. (2009). Zur Rolle der phonologischen Bewusstheit bei Analphabetismus. Alfa-Forum, 72, Grosche, M. (in Druck). Barrieren beim Lesenlernen durch Strategie-Interferenzen. In alphabund (Hrsg.), Besonderheiten der Erwachsenenalphabetisierung [Arbeitstitel]. Grosche, M. & Grünke, M. (im Druck). Beeinträchtigungen in der phonologischen Informationsverarbeitung bei funktionalen Analphabeten. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie. Grosche, M. & Hintz, A.-M. (2010). Überprüfung von Verfahren zur Evaluation von Alphabetisierungskursen durch eine Einzelfallstudie. Heilpädagogische Forschung, 36, Grosche, M., Hintz, A.-M. & Grünke, M. (2011). Direkte Instruktion in der Grundbildung. In K. Ratzke & A. Scholz (Hrsg.), Alphabetisierung Beratung Chancen. Abschlussbericht zu einem Forschungs- und Entwicklungsprojekt (S ). Oldenburg: DIZ. Grotlüschen, A. & Riekmann, W. (2011). leo. Level-One Studie. Literalität von Erwachsenen auf den unteren Kompetenzniveaus [Presseheft]. Universität Hamburg. Abgerufen am 15. April 2011 von epb.uni-hamburg.de/leo/files/2011/02/leo- Level-One-Studie-Presseheft1.pdf. Grünke, M. (2006). Zur Effektivität von Fördermethoden bei Kindern und Jugendlichen mit Lernstörungen. Kindheit und Entwicklung, 15, Hasselhorn, M. & Gold, A. (2006). Pädagogische Psychologie. Stuttgart: Kohlhammer. Hintz, A.-M. & Grosche, M. (2010). Förderung basaler Lesekompetenzen von erwachsenen Analphabeten nach Prinzipien der direkten Instruktion. Empirische Sonderpädagogik, 2, Horner, R. H., Carr, E. G., Halle, J., McGee, G., Odom, S. & Wolery, M. (2005). The use of single-subject research to identify evidencebased practice in special education. Exceptional Children, 71, Huitema, B. E. & McKean, J. W. (2000). Design specification issues in time-series intervention models. Educational and Psychological Measurement, 60 (1), Julius, H. (2004). Evaluation der Intervention. In G. W. Lauth, M. Grünke & J. C. Brunstein (Hrsg.), Interventionen bei Lernstörungen (S ). Göttingen: Hogrefe. Kamper, G. (1997). Wenn Lesen und Schreiben und Lernen schwerfallen. Münster: Schreibwerkstatt für neue Leser und Schreiber. Köhler, T. (2008). Statistische Einzelfallanalyse. Weinheim: Beltz. Küspert, P. & Schneider, W. (1998). Würzburger Leise Leseprobe (WLLP). Göttingen: Hogrefe. Linde, A. (2008). Literalität und Lernen. Münster: Waxmann. Mellard, D. & Scanlon, D. (2006). Feasibility of explicit instruction in adult basic education: instructor-learner interaction patterns. Adult Basic Education, 16 (1), Nickel, S. (2000). Wie lernen Erwachsene lesen und schreiben? In M. Döbert & P. Hubertus, Ihr Kreuz ist die Schrift (S ). Stuttgart: Klett. Parker, R. I., Brossart, D. F., Vannest, K. J., Long, J. R., De-Alba, R. G., Baugh, F. G. et al. (2005). Effect sizes in single case research: how large is large? School Psychology Review, 34,
15 161 Parker, R. I., Hagan-Burke, S. & Vannest, K. J. (2007). Percentage of all non-overlapping data (PAN): an alternative to PND. Journal of Special Education, 40, Philliber, W. W., Spillman, R. E. & King, R. E. (1996). Consequences of family literacy for adults and children: some preliminary findings. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 39, Pullen, P. C., Lane, H. B., Lloyd, J. W., Nowak, R. & Ryals, J. (2005). Effects of explicit instruction on decoding of struggling first grade students: a data-based case study. Education and Treatment of Children, 28, Rittmeyer, C. (1990). Zur Methodik und Didaktik der Alphabetisierung Erwachsener. Sonderpädagogik, 20, Schmetz, D. (2004). Förderschwerpunkt Lernen. Zeitschrift für Heilpädagogik, 55, Share, D. L. (1995). Phonological recoding and self-teaching: sine qua non of reading acquisition. Cognition, 55, Sheehan-Holt, J. K. & Smith, M. C. (2000). Does basic skills education affect adults literacy proficiencies and reading practices? Reading Research Quarterly, 35, Shi, Y. & Tsang, M. C. (2008). Evaluation of adult literacy education in the United States: a review of methodological issues. Educational Research Review, 3, Stoner, G., Scarpati, S. E., Phaneuf, R. L. & Hintze, J. M. (2002). Using curriculum-based measurement to evaluate intervention efficacy. Child & Family Behavior Therapy, 24, Thompkins, A. C. & Binder, K. S. (2003). A comparison of the factors affecting reading performance of functionally illiterate adults and children matched by reading level. Reading Research Quarterly, 38, Torgerson, C. J., Porthouse, J. & Brooks, G. (2003). A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials evaluating interventions in adult literacy and numeracy. Journal of Research in Reading, 26, Torgerson, C. J., Porthouse, J. & Brooks, G. (2005). A systematic review of controlled trials evaluating interventions in adult literacy and numeracy. Journal of Research in Reading, 28, Wagner, H. & Eulenberger, J. (2008). Analphabetenzahlen Probleme, Forschungsstrategien und Ergebnisse. In J. Schneider, U. Gintzel & H. Wagner (Hrsg.), Sozialintegrative Alphabetisierungsarbeit. Bildungs- und sozialpolitische sowie fachliche Herausforderungen (S ). Münster: Waxmann. Walter, J. (2007). Meta- und Megaanalyse als Erkenntnismethode zur Darstellung von Trainingseffekten bei Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. In J. Walter & F. B. Wember (Hrsg.), Sonderpädagogik des Lernens (S ). Göttingen: Hogrefe. Watkins, C. L. & Slocum, T. A. (2004). The components of direct instruction. Journal of Direct Instruction, 3, Weber, M. G., Müller-Holtz, R. & Schulte-Beerbühl, S. (2011). Qualitative Analyse der Effekte der direkten Instruktion zur Förderung der Leseflüssigkeit in der Alphabetisierung Erwachsener. In K. Ratzke & A. Scholz (Hrsg.), Alphabetisierung Beratung Chancen. Abschlussbericht zu einem Forschungs- und Entwicklungsprojekt (S ). Oldenburg: DIZ. Ziegler, J. C. & Goswami, U. (2005). Reading acquisition, developmental dyslexia, and skilled reading across languages: a psycholinguistic grain size theory. Psychological Bulletin, 131, Anschrift des Autors: MICHAEL GROSCHE Universität zu Köln Humanwissenschaftliche Fakultät Klosterstr. 79b Köln michael.grosche@uni-koeln.de
Kapitel 5: Einfaktorielle Varianzanalyse
 Rasch, Friese, Hofmann & Naumann (006). Quantitative Methoden. Band (. Auflage). Heidelberg: Springer. Kapitel 5: Einfaktorielle Varianzanalyse Berechnen der Teststärke a priori bzw. Stichprobenumfangsplanung
Rasch, Friese, Hofmann & Naumann (006). Quantitative Methoden. Band (. Auflage). Heidelberg: Springer. Kapitel 5: Einfaktorielle Varianzanalyse Berechnen der Teststärke a priori bzw. Stichprobenumfangsplanung
Grundlagen der evidenzbasierten neurologischen Rehabilitation
 Grundlagen der evidenzbasierten neurologischen Rehabilitation Prof. Dr. phil. Helmut Hildebrandt Klinikum Bremen-Ost, Neurologie Universität Oldenburg, Psychologie email: helmut.hildebrandt@uni-oldenburg.de
Grundlagen der evidenzbasierten neurologischen Rehabilitation Prof. Dr. phil. Helmut Hildebrandt Klinikum Bremen-Ost, Neurologie Universität Oldenburg, Psychologie email: helmut.hildebrandt@uni-oldenburg.de
Aufgaben zu Kapitel 7:
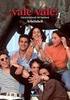 Aufgaben zu Kapitel 7: Aufgabe 1: In einer Klinik sollen zwei verschiedene Therapiemethoden miteinander verglichen werden. Zur Messung des Therapieerfolges werden die vorhandenen Symptome einmal vor Beginn
Aufgaben zu Kapitel 7: Aufgabe 1: In einer Klinik sollen zwei verschiedene Therapiemethoden miteinander verglichen werden. Zur Messung des Therapieerfolges werden die vorhandenen Symptome einmal vor Beginn
Die vorliegenden Unterlagen wurden im Rahmen des
 Die vorliegenden Unterlagen wurden im Rahmen des Bund-Länder-Wettbewerbs Aufstieg durch Bildung: Offene Hochschulen 1. Wettbewerbsrunde 01.10.2011-30.09.2017 als Teil des Vorhabens der Gottfried Wilhelm
Die vorliegenden Unterlagen wurden im Rahmen des Bund-Länder-Wettbewerbs Aufstieg durch Bildung: Offene Hochschulen 1. Wettbewerbsrunde 01.10.2011-30.09.2017 als Teil des Vorhabens der Gottfried Wilhelm
Lernen mit Portfolio Chancen und Grenzen
 Lernen mit Portfolio Chancen und Grenzen Prof. Dr. Tina Hascher, Fachbereich Erziehungswissenschaft "eportfolio im:focus - Erwartungen, Strategien, Modellfälle, Erfahrungen, 09. Mai 2007 Gliederung 1.
Lernen mit Portfolio Chancen und Grenzen Prof. Dr. Tina Hascher, Fachbereich Erziehungswissenschaft "eportfolio im:focus - Erwartungen, Strategien, Modellfälle, Erfahrungen, 09. Mai 2007 Gliederung 1.
VS PLUS
 VS PLUS Zusatzinformationen zu Medien des VS Verlags Statistik II Inferenzstatistik 2010 Übungsaufgaben und Lösungen Inferenzstatistik 2 [Übungsaufgaben und Lösungenn - Inferenzstatistik 2] ÜBUNGSAUFGABEN
VS PLUS Zusatzinformationen zu Medien des VS Verlags Statistik II Inferenzstatistik 2010 Übungsaufgaben und Lösungen Inferenzstatistik 2 [Übungsaufgaben und Lösungenn - Inferenzstatistik 2] ÜBUNGSAUFGABEN
Das Stepped Wedge Design
 Das Stepped Wedge Design Chance und Herausforderung zur Bestimmung der Effektivität in der Versorgungsforschung Sven Reuther, MScN 4. Fachtagung der DGP Methodische Herausforderungen an Pflegeforschung
Das Stepped Wedge Design Chance und Herausforderung zur Bestimmung der Effektivität in der Versorgungsforschung Sven Reuther, MScN 4. Fachtagung der DGP Methodische Herausforderungen an Pflegeforschung
Wortspezifische Lesetrainingseffekte bei gleichzeitig ausbleibendem Lerntransfer
 222 Michael Grosche, Anna-Maria Hintz & Andreas Hölz Empirische Sonderpädagogik, 2013, Nr. 3, S. 222-236 Wortspezifische Lesetrainingseffekte bei gleichzeitig ausbleibendem Lerntransfer Analyse eines computergestützten
222 Michael Grosche, Anna-Maria Hintz & Andreas Hölz Empirische Sonderpädagogik, 2013, Nr. 3, S. 222-236 Wortspezifische Lesetrainingseffekte bei gleichzeitig ausbleibendem Lerntransfer Analyse eines computergestützten
Lernen durch Concept Maps
 Lernen durch Concept Maps Elisabeth Riebenbauer & Peter Slepcevic-Zach Karl-Franzens-Universität Graz Institut für Wirtschaftspädagogik Linz, 15. April 2016 Hamburg, Mai 2014 Überblick Concept Maps Theoretische
Lernen durch Concept Maps Elisabeth Riebenbauer & Peter Slepcevic-Zach Karl-Franzens-Universität Graz Institut für Wirtschaftspädagogik Linz, 15. April 2016 Hamburg, Mai 2014 Überblick Concept Maps Theoretische
Der Zusammenhang von Lese-Rechtschreib- Schwächen, sozialen Bildungsbenachteiligungen und Analphabetismus
 Der Zusammenhang von Lese-Rechtschreib- Schwächen, sozialen Bildungsbenachteiligungen und Analphabetismus Michael Grosche Potsdamer Zentrum für Empirische Inklusionsforschung (ZEIF) Entwicklung von Fördermaterial
Der Zusammenhang von Lese-Rechtschreib- Schwächen, sozialen Bildungsbenachteiligungen und Analphabetismus Michael Grosche Potsdamer Zentrum für Empirische Inklusionsforschung (ZEIF) Entwicklung von Fördermaterial
Funktionaler Analphabetismus in Deutschland Definition, Größenordnung, Ursachen
 Funktionaler Analphabetismus in Deutschland Definition, Größenordnung, Ursachen Prof. Dr. J. Rüsseler Otto-Friedrich-Universität Bamberg Professur für Allgemeine Psychologie A N A L P H A B E T I S M U
Funktionaler Analphabetismus in Deutschland Definition, Größenordnung, Ursachen Prof. Dr. J. Rüsseler Otto-Friedrich-Universität Bamberg Professur für Allgemeine Psychologie A N A L P H A B E T I S M U
Pressekonferenz. Thema: Vorstellung des Geburtenbarometers - Eine neue Methode zur Messung der Geburtenentwicklung
 Pressekonferenz mit Bundesministerin Ursula Haubner, Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz und Prof. Dr. Wolfgang Lutz, Direktor des Instituts für Demographie der
Pressekonferenz mit Bundesministerin Ursula Haubner, Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz und Prof. Dr. Wolfgang Lutz, Direktor des Instituts für Demographie der
Phonologische Bewusstheit, Benennungsgeschwindigkeit und automatisierte Leseprozesse
 i Berichte aus der Pädagogik Andreas Mayer Phonologische Bewusstheit, Benennungsgeschwindigkeit und automatisierte Leseprozesse Aufarbeitung des Forschungsstandes und praktische Fördermöglichkeiten Shaker
i Berichte aus der Pädagogik Andreas Mayer Phonologische Bewusstheit, Benennungsgeschwindigkeit und automatisierte Leseprozesse Aufarbeitung des Forschungsstandes und praktische Fördermöglichkeiten Shaker
STATISTISCHE MUSTERANALYSE - DARSTELLUNGSVORSCHLAG
 STATISTISCHE MUSTERANALYSE - DARSTELLUNGSVORSCHLAG Statistische Methoden In der vorliegenden fiktiven Musterstudie wurden X Patienten mit XY Syndrom (im folgenden: Gruppe XY) mit Y Patienten eines unauffälligem
STATISTISCHE MUSTERANALYSE - DARSTELLUNGSVORSCHLAG Statistische Methoden In der vorliegenden fiktiven Musterstudie wurden X Patienten mit XY Syndrom (im folgenden: Gruppe XY) mit Y Patienten eines unauffälligem
Kapitel 2, Führungskräftetraining, Kompetenzentwicklung und Coaching:
 Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? von Tanja Hollinger 1. Auflage Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? Hollinger schnell und portofrei
Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? von Tanja Hollinger 1. Auflage Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? Hollinger schnell und portofrei
Modul G.1 WS 07/08: Statistik 17.01.2008 1. Die Korrelation ist ein standardisiertes Maß für den linearen Zusammenhangzwischen zwei Variablen.
 Modul G.1 WS 07/08: Statistik 17.01.2008 1 Wiederholung Kovarianz und Korrelation Kovarianz = Maß für den linearen Zusammenhang zwischen zwei Variablen x und y Korrelation Die Korrelation ist ein standardisiertes
Modul G.1 WS 07/08: Statistik 17.01.2008 1 Wiederholung Kovarianz und Korrelation Kovarianz = Maß für den linearen Zusammenhang zwischen zwei Variablen x und y Korrelation Die Korrelation ist ein standardisiertes
Standardisierte Vorgehensweisen und Regeln zur Gewährleistung von: Eindeutigkeit Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden sind nur dann zwingend
 Standardisierte Vorgehensweisen und Regeln zur Gewährleistung von: Eindeutigkeit Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden sind nur dann zwingend oder eindeutig, wenn keine alternativen Interpretationsmöglichkeiten
Standardisierte Vorgehensweisen und Regeln zur Gewährleistung von: Eindeutigkeit Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden sind nur dann zwingend oder eindeutig, wenn keine alternativen Interpretationsmöglichkeiten
Prof. Dr. Christoph Kleinn Institut für Waldinventur und Waldwachstum Arbeitsbereich Waldinventur und Fernerkundung
 Systematische Stichprobe Rel. große Gruppe von Stichprobenverfahren. Allgemeines Merkmal: es existiert ein festes, systematisches Muster bei der Auswahl. Wie passt das zur allgemeinen Forderung nach Randomisierung
Systematische Stichprobe Rel. große Gruppe von Stichprobenverfahren. Allgemeines Merkmal: es existiert ein festes, systematisches Muster bei der Auswahl. Wie passt das zur allgemeinen Forderung nach Randomisierung
Hypothesentests mit SPSS. Beispiel für einen t-test
 Beispiel für einen t-test Daten: museum-f-v04.sav Hypothese: Als Gründe, in ein Museum zu gehen, geben mehr Frauen als Männer die Erweiterung der Bildung für Kinder an. Dies hängt mit der Geschlechtsrolle
Beispiel für einen t-test Daten: museum-f-v04.sav Hypothese: Als Gründe, in ein Museum zu gehen, geben mehr Frauen als Männer die Erweiterung der Bildung für Kinder an. Dies hängt mit der Geschlechtsrolle
LRS bei Hörgeschädigte Definition- Prävalenz- Klassifikation
 LRS bei Hörgeschädigte Definition- Prävalenz- Klassifikation Klassifikation: Leserechtschreibstörung Achse I Klinisch-psychiatrisches Syndrom (z.b. Schulangst) Achse II Umschriebene Entwicklungsstörung
LRS bei Hörgeschädigte Definition- Prävalenz- Klassifikation Klassifikation: Leserechtschreibstörung Achse I Klinisch-psychiatrisches Syndrom (z.b. Schulangst) Achse II Umschriebene Entwicklungsstörung
8. Konfidenzintervalle und Hypothesentests
 8. Konfidenzintervalle und Hypothesentests Dr. Antje Kiesel Institut für Angewandte Mathematik WS 2011/2012 Beispiel. Sie wollen den durchschnittlichen Fruchtsaftgehalt eines bestimmten Orangennektars
8. Konfidenzintervalle und Hypothesentests Dr. Antje Kiesel Institut für Angewandte Mathematik WS 2011/2012 Beispiel. Sie wollen den durchschnittlichen Fruchtsaftgehalt eines bestimmten Orangennektars
ABC-Projekt erprobt Direkte Instruktion (Ergebnisse einer Studie) Unterrichtsforschung im ABC-Projekt
 ABC-Projekt erprobt Direkte Instruktion (Ergebnisse einer Studie) Unterrichtsforschung im ABC-Projekt Das Forschungsvorhaben A.B.C. (Alphabetisierung - Beratung - Chancen) wird von der Volkshochschule
ABC-Projekt erprobt Direkte Instruktion (Ergebnisse einer Studie) Unterrichtsforschung im ABC-Projekt Das Forschungsvorhaben A.B.C. (Alphabetisierung - Beratung - Chancen) wird von der Volkshochschule
Aufgaben zu Kapitel 9
 Aufgaben zu Kapitel 9 Aufgabe 1 Für diese Aufgabe benötigen Sie den Datensatz Nominaldaten.sav. a) Sie arbeiten für eine Marktforschungsfirma und sollen überprüfen, ob die in diesem Datensatz untersuchte
Aufgaben zu Kapitel 9 Aufgabe 1 Für diese Aufgabe benötigen Sie den Datensatz Nominaldaten.sav. a) Sie arbeiten für eine Marktforschungsfirma und sollen überprüfen, ob die in diesem Datensatz untersuchte
Schüchternheit im kulturellen Kontext
 Psychologie in Erziehung und Unterricht 49. Jahrgang, Heft 2, 2002 Schüchternheit im kulturellen Kontext Eine vergleichende Studie zu Korrelaten von Schüchternheit bei Schulkindern in der Schweiz und in
Psychologie in Erziehung und Unterricht 49. Jahrgang, Heft 2, 2002 Schüchternheit im kulturellen Kontext Eine vergleichende Studie zu Korrelaten von Schüchternheit bei Schulkindern in der Schweiz und in
Zwei alternative Methoden in der Legasthenietherapie: Eine Eye Tracking Studie
 Zwei alternative Methoden in der Legasthenietherapie: Eine Eye Tracking Studie Linda Bruch Salzburg, 19. Oktober 2012 1 Legasthenie: Definition Die Legasthenie ist eine spezifische Lernschwierigkeit, die
Zwei alternative Methoden in der Legasthenietherapie: Eine Eye Tracking Studie Linda Bruch Salzburg, 19. Oktober 2012 1 Legasthenie: Definition Die Legasthenie ist eine spezifische Lernschwierigkeit, die
Lernstrategien und selbstreguliertes Lernen im regulären Unterricht
 Lernstrategien und selbstreguliertes Lernen im regulären Unterricht Prof. Dr. Heidrun Stöger Lehrstuhl für Schulpädagogik Fakultät für Psychologie, Pädagogik und Sportwissenschaft Gliederung 1) Lernstrategien:
Lernstrategien und selbstreguliertes Lernen im regulären Unterricht Prof. Dr. Heidrun Stöger Lehrstuhl für Schulpädagogik Fakultät für Psychologie, Pädagogik und Sportwissenschaft Gliederung 1) Lernstrategien:
Umgang mit und Ersetzen von fehlenden Werten bei multivariaten Analysen
 Umgang mit und Ersetzen von fehlenden Werten bei multivariaten Analysen Warum überhaupt Gedanken machen? Was fehlt, ist doch weg, oder? Allgegenwärtiges Problem in psychologischer Forschung Bringt Fehlerquellen
Umgang mit und Ersetzen von fehlenden Werten bei multivariaten Analysen Warum überhaupt Gedanken machen? Was fehlt, ist doch weg, oder? Allgegenwärtiges Problem in psychologischer Forschung Bringt Fehlerquellen
Proseminar - Organisation und Personal Seminar Organisational Theory and Human Resource Management
 1 Proseminar - Organisation und Personal Seminar Organisational Theory and Human Resource Management Veranstaltungsnummer / 82-021-PS08-S-PS-0507.20151.001 Abschluss des Studiengangs / Bachelor Semester
1 Proseminar - Organisation und Personal Seminar Organisational Theory and Human Resource Management Veranstaltungsnummer / 82-021-PS08-S-PS-0507.20151.001 Abschluss des Studiengangs / Bachelor Semester
Vorschulische Sprachstandserhebungen in Berliner Kindertagesstätten: Eine vergleichende Untersuchung
 Spektrum Patholinguistik 7 (2014) 133 138 Vorschulische Sprachstandserhebungen in Berliner Kindertagesstätten: Eine vergleichende Untersuchung Stefanie Düsterhöft, Maria Trüggelmann & Kerstin Richter 1
Spektrum Patholinguistik 7 (2014) 133 138 Vorschulische Sprachstandserhebungen in Berliner Kindertagesstätten: Eine vergleichende Untersuchung Stefanie Düsterhöft, Maria Trüggelmann & Kerstin Richter 1
Überblick Publikationsorgane
 Seite 1 von 5 Sprachtherapie / Logopädie American Journal of Speech-Language Pathology 1058-0360 4 EN US ASHA 2.448 2.897 0.227 Annals of Dyslexia 0736-9387 2 EN US Springer 1.520 2.094 0.333 Aphasiology
Seite 1 von 5 Sprachtherapie / Logopädie American Journal of Speech-Language Pathology 1058-0360 4 EN US ASHA 2.448 2.897 0.227 Annals of Dyslexia 0736-9387 2 EN US Springer 1.520 2.094 0.333 Aphasiology
The Economics of Higher Education in Germany
 Michael Maihaus The Economics of Higher Education in Germany Salary Expectations, Signaling, and Social Mobility Tectum Verlag Dr. rer. pol. Michael Maihaus, born in Steinfurt/Germany in 1983, studied
Michael Maihaus The Economics of Higher Education in Germany Salary Expectations, Signaling, and Social Mobility Tectum Verlag Dr. rer. pol. Michael Maihaus, born in Steinfurt/Germany in 1983, studied
Hormone replacement therapy and risk of venous thromboembolism in postmenopausal women: systematic review and meta-analysis
 Hormone replacement therapy and risk of venous thromboembolism in postmenopausal women: systematic review and meta-analysis Canonico M, Plu-Bureau G, Lowe G and Scarabin PY. BMJ May 2008;336:1227-1231
Hormone replacement therapy and risk of venous thromboembolism in postmenopausal women: systematic review and meta-analysis Canonico M, Plu-Bureau G, Lowe G and Scarabin PY. BMJ May 2008;336:1227-1231
Regression ein kleiner Rückblick. Methodenseminar Dozent: Uwe Altmann Alexandra Kuhn, Melanie Spate
 Regression ein kleiner Rückblick Methodenseminar Dozent: Uwe Altmann Alexandra Kuhn, Melanie Spate 05.11.2009 Gliederung 1. Stochastische Abhängigkeit 2. Definition Zufallsvariable 3. Kennwerte 3.1 für
Regression ein kleiner Rückblick Methodenseminar Dozent: Uwe Altmann Alexandra Kuhn, Melanie Spate 05.11.2009 Gliederung 1. Stochastische Abhängigkeit 2. Definition Zufallsvariable 3. Kennwerte 3.1 für
Willkommen zur Vorlesung Statistik (Master)
 Willkommen zur Vorlesung Statistik (Master) Thema dieser Vorlesung: Verteilungsfreie Verfahren Prof. Dr. Wolfgang Ludwig-Mayerhofer Universität Siegen Philosophische Fakultät, Seminar für Sozialwissenschaften
Willkommen zur Vorlesung Statistik (Master) Thema dieser Vorlesung: Verteilungsfreie Verfahren Prof. Dr. Wolfgang Ludwig-Mayerhofer Universität Siegen Philosophische Fakultät, Seminar für Sozialwissenschaften
Lese-Rechtschreibstörungen (LRS)
 Andreas Mayer Lese-Rechtschreibstörungen (LRS) Mit einem Beitrag von Sven Lindberg Mit 32 Abbildungen und 14 Tabellen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Prof. Dr. Andreas Mayer, Sprachheilpädagoge, hat
Andreas Mayer Lese-Rechtschreibstörungen (LRS) Mit einem Beitrag von Sven Lindberg Mit 32 Abbildungen und 14 Tabellen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Prof. Dr. Andreas Mayer, Sprachheilpädagoge, hat
LITERATURLISTE ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE DIPLOMSTUDIENGANG Gültig für Prüfungen im Frühjahr und Herbst 2008
 LITERATURLISTE ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE DIPLOMSTUDIENGANG Gültig für Prüfungen im Frühjahr und Herbst 2008 Die folgende Liste für das Jahr 2008 weicht von der für 2007 substantiell ab. Falls sie eine Prüfung
LITERATURLISTE ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE DIPLOMSTUDIENGANG Gültig für Prüfungen im Frühjahr und Herbst 2008 Die folgende Liste für das Jahr 2008 weicht von der für 2007 substantiell ab. Falls sie eine Prüfung
Gestaltungsempfehlungen
 Professur E-Learning und Neue Medien Institut für Medienforschung Philosophische Fakultät Lehren und Lernen mit Medien I Gestaltungsempfehlungen Überblick Auswahl der Empfehlungen Gestaltungseffekte Empirische
Professur E-Learning und Neue Medien Institut für Medienforschung Philosophische Fakultät Lehren und Lernen mit Medien I Gestaltungsempfehlungen Überblick Auswahl der Empfehlungen Gestaltungseffekte Empirische
Entstehung und Verlauf des Forschungsprojekts...7
 Inhaltsverzeichnis 1. Entstehung und Verlauf des Forschungsprojekts...7 2. Der Elternfragebogen... 10 2.1 Das methodische Vorgehen... 10 2.2 Die Ergebnisse des Elternfragebogens... 12 2.2.1 Trägerschaft
Inhaltsverzeichnis 1. Entstehung und Verlauf des Forschungsprojekts...7 2. Der Elternfragebogen... 10 2.1 Das methodische Vorgehen... 10 2.2 Die Ergebnisse des Elternfragebogens... 12 2.2.1 Trägerschaft
3 Fragestellung und Hypothesen 3.1 Herleitung der Fragestellung
 Fragestellung und Hypothesen 62 3 Fragestellung und Hypothesen 3.1 Herleitung der Fragestellung In der vorliegenden Arbeit wird folgenden Fragen nachgegangen: 1. Existieren Geschlechtsunterschiede in der
Fragestellung und Hypothesen 62 3 Fragestellung und Hypothesen 3.1 Herleitung der Fragestellung In der vorliegenden Arbeit wird folgenden Fragen nachgegangen: 1. Existieren Geschlechtsunterschiede in der
Konzept-, Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität
 Konzept-, Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität PD Dr. Rainer Strobl Universität Hildesheim Institut für Sozialwissenschaften & proval Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Analyse, Beratung und
Konzept-, Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität PD Dr. Rainer Strobl Universität Hildesheim Institut für Sozialwissenschaften & proval Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Analyse, Beratung und
Einführung in die Psychologie
 Institut für Psychologie, Fakultät Kultur- und Sozialwissenschaften Übersicht Kurse in Modul 1 3400 Einführung in die Psychologie und ihre Geschichte KE 1 / KE 2 3401 Einführung in die Forschungsmethoden
Institut für Psychologie, Fakultät Kultur- und Sozialwissenschaften Übersicht Kurse in Modul 1 3400 Einführung in die Psychologie und ihre Geschichte KE 1 / KE 2 3401 Einführung in die Forschungsmethoden
Gütekriterien für evaluative Messinstrumente in der Rehabilitation
 12. Rehabilitationswissenschaftliches Kolloquium Rehabilitation im Gesundheitssystem Bad Kreuznach, 10. bis 12. März 2003 Gütekriterien für evaluative Messinstrumente in der Rehabilitation Dipl.-Psych.
12. Rehabilitationswissenschaftliches Kolloquium Rehabilitation im Gesundheitssystem Bad Kreuznach, 10. bis 12. März 2003 Gütekriterien für evaluative Messinstrumente in der Rehabilitation Dipl.-Psych.
DOE am Beispiel Laserpointer
 DOE am Beispiel Laserpointer Swen Günther Ein wesentliches Ziel im Rahmen der Neuproduktentwicklung ist die aus Kundesicht bestmögliche, d.h. nutzenmaximale Konzeption des Produktes zu bestimmen (vgl.
DOE am Beispiel Laserpointer Swen Günther Ein wesentliches Ziel im Rahmen der Neuproduktentwicklung ist die aus Kundesicht bestmögliche, d.h. nutzenmaximale Konzeption des Produktes zu bestimmen (vgl.
DIE FILES DÜRFEN NUR FÜR DEN EIGENEN GEBRAUCH BENUTZT WERDEN. DAS COPYRIGHT LIEGT BEIM JEWEILIGEN AUTOR.
 Weitere Files findest du auf www.semestra.ch/files DIE FILES DÜRFEN NUR FÜR DEN EIGENEN GEBRAUCH BENUTZT WERDEN. DAS COPYRIGHT LIEGT BEIM JEWEILIGEN AUTOR. Rahel Clemenz; rahel.clemenz@unifr.ch 1 Einzelfallforschung
Weitere Files findest du auf www.semestra.ch/files DIE FILES DÜRFEN NUR FÜR DEN EIGENEN GEBRAUCH BENUTZT WERDEN. DAS COPYRIGHT LIEGT BEIM JEWEILIGEN AUTOR. Rahel Clemenz; rahel.clemenz@unifr.ch 1 Einzelfallforschung
Willkommen zur Vorlesung Statistik (Master)
 Willkommen zur Vorlesung Statistik (Master) Thema dieser Vorlesung: Letzte Worte zur Inferenzstatistik, v. a. zu Signifikanztests Prof. Dr. Wolfgang Ludwig-Mayerhofer Universität Siegen Philosophische
Willkommen zur Vorlesung Statistik (Master) Thema dieser Vorlesung: Letzte Worte zur Inferenzstatistik, v. a. zu Signifikanztests Prof. Dr. Wolfgang Ludwig-Mayerhofer Universität Siegen Philosophische
INFERENZSTATISTISCHE AUSSAGEN FÜR LAGEMAßE UND STREUUNGSMAßE. Inferenzstatistik für Lagemaße Inferenzstatistik für Streuungsmaße
 DAS THEMA: INFERENZSTATISTIK III INFERENZSTATISTISCHE AUSSAGEN FÜR LAGEMAßE UND STREUUNGSMAßE Inferenzstatistik für Lagemaße Inferenzstatistik für Streuungsmaße Inferenzstatistik für Lagemaße Standardfehler
DAS THEMA: INFERENZSTATISTIK III INFERENZSTATISTISCHE AUSSAGEN FÜR LAGEMAßE UND STREUUNGSMAßE Inferenzstatistik für Lagemaße Inferenzstatistik für Streuungsmaße Inferenzstatistik für Lagemaße Standardfehler
Gestaltungsempfehlungen
 Gestaltungsempfehlungen Prof. Dr. Günter Daniel Rey 1 Überblick Auswahl der Empfehlungen Gestaltungseffekte Empirische Überprüfung Variablenarten Versuchspläne Beispiel eines Experimentes Statistische
Gestaltungsempfehlungen Prof. Dr. Günter Daniel Rey 1 Überblick Auswahl der Empfehlungen Gestaltungseffekte Empirische Überprüfung Variablenarten Versuchspläne Beispiel eines Experimentes Statistische
TEIL 4: FORSCHUNGSDESIGNS UND UNTERSUCHUNGSFORMEN
 TEIL 4: FORSCHUNGSDESIGNS UND UNTERSUCHUNGSFORMEN GLIEDERUNG Forschungsdesign Charakterisierung Grundbegriffe Verfahrensmöglichkeit Störfaktoren Graphische Darstellung Arten von Störfaktoren Techniken
TEIL 4: FORSCHUNGSDESIGNS UND UNTERSUCHUNGSFORMEN GLIEDERUNG Forschungsdesign Charakterisierung Grundbegriffe Verfahrensmöglichkeit Störfaktoren Graphische Darstellung Arten von Störfaktoren Techniken
Entwicklung eines Erhebungsinstruments. Thema: Verteilung klinischer und subklinischer Essstörungen an der Universität Kassel
 Entwicklung eines Erhebungsinstruments Thema: Verteilung klinischer und subklinischer Essstörungen an der Universität Kassel Vorstellung des Themas In: Lehrforschungswerkstatt: Quantitative Untersuchungsverfahren
Entwicklung eines Erhebungsinstruments Thema: Verteilung klinischer und subklinischer Essstörungen an der Universität Kassel Vorstellung des Themas In: Lehrforschungswerkstatt: Quantitative Untersuchungsverfahren
Eine zweidimensionale Stichprobe
 Eine zweidimensionale Stichprobe liegt vor, wenn zwei qualitative Merkmale gleichzeitig betrachtet werden. Eine Urliste besteht dann aus Wertepaaren (x i, y i ) R 2 und hat die Form (x 1, y 1 ), (x 2,
Eine zweidimensionale Stichprobe liegt vor, wenn zwei qualitative Merkmale gleichzeitig betrachtet werden. Eine Urliste besteht dann aus Wertepaaren (x i, y i ) R 2 und hat die Form (x 1, y 1 ), (x 2,
Waist-to-height Ratio als Prädiktor für kardiovaskuläre Erkrankungen
 Waist-to-height Ratio als Prädiktor für kardiovaskuläre Erkrankungen Rapid Assessment zum Vergleich anthropometrischer Messmethoden Department für Evidenzbasierte Medizin und Klinische Epidemiologie Autorin
Waist-to-height Ratio als Prädiktor für kardiovaskuläre Erkrankungen Rapid Assessment zum Vergleich anthropometrischer Messmethoden Department für Evidenzbasierte Medizin und Klinische Epidemiologie Autorin
Studiendesign/ Evaluierungsdesign
 Jennifer Ziegert Studiendesign/ Evaluierungsdesign Praxisprojekt: Nutzerorientierte Evaluierung von Visualisierungen in Daffodil mittels Eyetracker Warum Studien /Evaluierungsdesign Das Design einer Untersuchung
Jennifer Ziegert Studiendesign/ Evaluierungsdesign Praxisprojekt: Nutzerorientierte Evaluierung von Visualisierungen in Daffodil mittels Eyetracker Warum Studien /Evaluierungsdesign Das Design einer Untersuchung
2. Woran erkenne ich Kinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten?
 Inhalt 1. Kennen Sie das?......................................... 7 2. Woran erkenne ich Kinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten?.. 9 3. In welchem Alter werden Lese-Rechtschreibschwierigkeiten sichtbar?..............................................
Inhalt 1. Kennen Sie das?......................................... 7 2. Woran erkenne ich Kinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten?.. 9 3. In welchem Alter werden Lese-Rechtschreibschwierigkeiten sichtbar?..............................................
Fortgeschrittene Statistik Logistische Regression
 Fortgeschrittene Statistik Logistische Regression O D D S, O D D S - R A T I O, L O G I T T R A N S F O R M A T I O N, I N T E R P R E T A T I O N V O N K O E F F I Z I E N T E N, L O G I S T I S C H E
Fortgeschrittene Statistik Logistische Regression O D D S, O D D S - R A T I O, L O G I T T R A N S F O R M A T I O N, I N T E R P R E T A T I O N V O N K O E F F I Z I E N T E N, L O G I S T I S C H E
Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW
 Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW Ergebnisse der Vergleichsarbeiten (VERA), Klasse 3, für das Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2007 21. August 2007 Am 8. und 10. Mai 2007 wurden in
Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW Ergebnisse der Vergleichsarbeiten (VERA), Klasse 3, für das Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2007 21. August 2007 Am 8. und 10. Mai 2007 wurden in
Evaluation Des Sozialtraining in der Schule
 Evaluation Des Sozialtraining in der Schule Die erste Evaluation des vorliegenden Trainings fand im Jahr 1996 an vier Bremer Schulen statt. Es nahmen insgesamt 158 Schüler im Alter von acht bis zwölf Jahren,
Evaluation Des Sozialtraining in der Schule Die erste Evaluation des vorliegenden Trainings fand im Jahr 1996 an vier Bremer Schulen statt. Es nahmen insgesamt 158 Schüler im Alter von acht bis zwölf Jahren,
Regelmäßige Beurteilung beruflichen Könnens als Bestandteil des Lernprozesses
 Regelmäßige Beurteilung beruflichen Könnens als Bestandteil des Lernprozesses Dr. Philipp Grollmann, Dr. Roland Tutschner AG BFN-Workshop 26./27. Februar 2007 Projekt Qual-Praxis Gemeinsame Ausgangspunkte
Regelmäßige Beurteilung beruflichen Könnens als Bestandteil des Lernprozesses Dr. Philipp Grollmann, Dr. Roland Tutschner AG BFN-Workshop 26./27. Februar 2007 Projekt Qual-Praxis Gemeinsame Ausgangspunkte
Einstellungen zu Gesundheitssystemen und Ungleichheiten in der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen im internationalen Vergleich
 Monika Mischke, Claus Wendt Einstellungen zu Gesundheitssystemen und Ungleichheiten in der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen im internationalen Vergleich Literatur / Quellen: Reibling, Nadine und
Monika Mischke, Claus Wendt Einstellungen zu Gesundheitssystemen und Ungleichheiten in der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen im internationalen Vergleich Literatur / Quellen: Reibling, Nadine und
Eine Veranstaltung der Allianz für die Handschrift und des BLLV
 Eine Veranstaltung der Allianz für die Handschrift und des BLLV (2) Werner Kuhmann (Allianz für die Handschrift): Handschreiben Rechtschreiben Textschreiben. Psychologie ihrer gegenseitigen Abhängigkeit
Eine Veranstaltung der Allianz für die Handschrift und des BLLV (2) Werner Kuhmann (Allianz für die Handschrift): Handschreiben Rechtschreiben Textschreiben. Psychologie ihrer gegenseitigen Abhängigkeit
Lernen und Instruktion Themen- und Literaturliste für die 1. Staatsprüfung
 Sommersemester 2015 Lernen und Instruktion Themen- und Literaturliste für die 1. Staatsprüfung Erziehungswissenschaftliche Fakultät Psychologie des Lernens und Lehrens, der Entwicklung und Erziehung in
Sommersemester 2015 Lernen und Instruktion Themen- und Literaturliste für die 1. Staatsprüfung Erziehungswissenschaftliche Fakultät Psychologie des Lernens und Lehrens, der Entwicklung und Erziehung in
Lösungen zu den Übungsaufgaben in Kapitel 10
 Lösungen zu den Übungsaufgaben in Kapitel 10 (1) In einer Stichprobe mit n = 10 Personen werden für X folgende Werte beobachtet: {9; 96; 96; 106; 11; 114; 114; 118; 13; 14}. Sie gehen davon aus, dass Mittelwert
Lösungen zu den Übungsaufgaben in Kapitel 10 (1) In einer Stichprobe mit n = 10 Personen werden für X folgende Werte beobachtet: {9; 96; 96; 106; 11; 114; 114; 118; 13; 14}. Sie gehen davon aus, dass Mittelwert
Phrasensammlung für wissenschaftliches Arbeiten
 Phrasensammlung für wissenschaftliches Arbeiten Einleitung In diesem Aufsatz/dieser Abhandlung/dieser Arbeit werde ich... untersuchen/ermitteln/bewerten/analysieren... Um diese Frage zu beantworten, beginnen
Phrasensammlung für wissenschaftliches Arbeiten Einleitung In diesem Aufsatz/dieser Abhandlung/dieser Arbeit werde ich... untersuchen/ermitteln/bewerten/analysieren... Um diese Frage zu beantworten, beginnen
Mögliche Themen für Abschlussarbeiten (Zulassungs-, Bachelor- oder Masterarbeiten) bei der Professur für Sport- und Gesundheitspädagogik
 Mögliche Themen für Abschlussarbeiten (Zulassungs-, Bachelor- oder Masterarbeiten) bei der Professur für Sport- und Gesundheitspädagogik Am Lehrstuhl Sport- und Gesundheitspädagogik sind folgende Abschlussarbeiten
Mögliche Themen für Abschlussarbeiten (Zulassungs-, Bachelor- oder Masterarbeiten) bei der Professur für Sport- und Gesundheitspädagogik Am Lehrstuhl Sport- und Gesundheitspädagogik sind folgende Abschlussarbeiten
Multiple Regression. Ziel: Vorhersage der Werte einer Variable (Kriterium) bei Kenntnis der Werte von zwei oder mehr anderen Variablen (Prädiktoren)
 Multiple Regression 1 Was ist multiple lineare Regression? Ziel: Vorhersage der Werte einer Variable (Kriterium) bei Kenntnis der Werte von zwei oder mehr anderen Variablen (Prädiktoren) Annahme: Der Zusammenhang
Multiple Regression 1 Was ist multiple lineare Regression? Ziel: Vorhersage der Werte einer Variable (Kriterium) bei Kenntnis der Werte von zwei oder mehr anderen Variablen (Prädiktoren) Annahme: Der Zusammenhang
Unsystematische Störvariablen
 wirken auf AV, variieren aber nicht mit UV haben keinen Einfluss auf Unterschiede zwischen den Bedingungen Unsystematische Störvariablen (Eid, Gollwitzer & Schmitt, 2010, S. 56f) Es gibt individuelle Unterschiede
wirken auf AV, variieren aber nicht mit UV haben keinen Einfluss auf Unterschiede zwischen den Bedingungen Unsystematische Störvariablen (Eid, Gollwitzer & Schmitt, 2010, S. 56f) Es gibt individuelle Unterschiede
Ziele beim Umformen von Gleichungen
 Ziele beim Umformen von Gleichungen für GeoGebraCAS Letzte Änderung: 29. März 2011 1 Überblick 1.1 Zusammenfassung Beim Lösen von Gleichungen ist besonders darauf zu achten, dass Schüler/innen den Äquivalenzumformungen
Ziele beim Umformen von Gleichungen für GeoGebraCAS Letzte Änderung: 29. März 2011 1 Überblick 1.1 Zusammenfassung Beim Lösen von Gleichungen ist besonders darauf zu achten, dass Schüler/innen den Äquivalenzumformungen
Inklusion durch Teilhabe an Literalität Schule aus der Sicht funktionaler Analphabeten
 Inklusion durch Teilhabe an Literalität Schule aus der Sicht funktionaler Analphabeten Dipl.- Päd. D. Horch Leibniz Universität Hannover, Institut für Sonderpädagogik Das BMBF-Verbundvorhaben Verbleibsstudie
Inklusion durch Teilhabe an Literalität Schule aus der Sicht funktionaler Analphabeten Dipl.- Päd. D. Horch Leibniz Universität Hannover, Institut für Sonderpädagogik Das BMBF-Verbundvorhaben Verbleibsstudie
Literatur zu den Vorlesungen Allgemeine Psychologie I
 Literatur zu den Vorlesungen Allgemeine Psychologie I gültig ab WiSe 2015/2016 Primäres Lehrbuch B.G.1 Lernen, Gedächtnis und Wissen (Hilbig) Lieberman, D.A. (2012). Human learning and memory. Cambridge:
Literatur zu den Vorlesungen Allgemeine Psychologie I gültig ab WiSe 2015/2016 Primäres Lehrbuch B.G.1 Lernen, Gedächtnis und Wissen (Hilbig) Lieberman, D.A. (2012). Human learning and memory. Cambridge:
1 Einleitung. 1.1 Was ist Ökonometrie und warum sollte man etwas darüber lernen?
 1 Einleitung 1.1 Was ist Ökonometrie und warum sollte man etwas darüber lernen? Idee der Ökonometrie: Mithilfe von Daten und statistischen Methoden Zusammenhänge zwischen verschiedenen Größen messen. Lehrstuhl
1 Einleitung 1.1 Was ist Ökonometrie und warum sollte man etwas darüber lernen? Idee der Ökonometrie: Mithilfe von Daten und statistischen Methoden Zusammenhänge zwischen verschiedenen Größen messen. Lehrstuhl
Anerkennung: Was macht gutes Feedback aus?
 Anerkennung: Was macht gutes Feedback aus? Frank Fischer Ludwig-Maximilians-Universität München Impulsvortrag im Rahmen der Weiterbildung Anerkennung macht Schule, 17.9.2011, Evangelische Akademie Tutzing
Anerkennung: Was macht gutes Feedback aus? Frank Fischer Ludwig-Maximilians-Universität München Impulsvortrag im Rahmen der Weiterbildung Anerkennung macht Schule, 17.9.2011, Evangelische Akademie Tutzing
Auswertung des IAT anla sslich der Ausstellung Check Your Stereotypes
 Hanna Schiff, Honorata Kaczykowski-Patermann, Renate Schubert Auswertung des IAT anla sslich der Ausstellung Check Your Stereotypes Was ist der IAT? Stereotype sind Wegbereiter für Vorurteile und Diskriminierungen.
Hanna Schiff, Honorata Kaczykowski-Patermann, Renate Schubert Auswertung des IAT anla sslich der Ausstellung Check Your Stereotypes Was ist der IAT? Stereotype sind Wegbereiter für Vorurteile und Diskriminierungen.
Statistik. Jan Müller
 Statistik Jan Müller Skalenniveau Nominalskala: Diese Skala basiert auf einem Satz von qualitativen Attributen. Es existiert kein Kriterium, nach dem die Punkte einer nominal skalierten Variablen anzuordnen
Statistik Jan Müller Skalenniveau Nominalskala: Diese Skala basiert auf einem Satz von qualitativen Attributen. Es existiert kein Kriterium, nach dem die Punkte einer nominal skalierten Variablen anzuordnen
PISA 2012 Zusammenfassung erster Ergebnisse im Hinblick auf Geschlechterdifferenzen
 bm:ukk, Abt. IT/1, Referat a Dr. Mark Német (Tel. DW 5902), Mag. Andreas Grimm (DW 4316) PISA 2012 Zusammenfassung erster Ergebnisse im Hinblick auf Geschlechterdifferenzen Differenz zwischen Knaben und
bm:ukk, Abt. IT/1, Referat a Dr. Mark Német (Tel. DW 5902), Mag. Andreas Grimm (DW 4316) PISA 2012 Zusammenfassung erster Ergebnisse im Hinblick auf Geschlechterdifferenzen Differenz zwischen Knaben und
Probe-Reihungstest Jahr: 2014
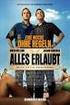 Berufsmaturitätsschule Liechtenstein Probe-Reihungstest Jahr: 2014 Fach: Deutsch Dauer: 45 Minuten Name: Vorname: Prüfungsnummer: Textverständnis (1 6) /12 Punkte Sprachbetrachtung (7 13) /13 Punkte Punkte
Berufsmaturitätsschule Liechtenstein Probe-Reihungstest Jahr: 2014 Fach: Deutsch Dauer: 45 Minuten Name: Vorname: Prüfungsnummer: Textverständnis (1 6) /12 Punkte Sprachbetrachtung (7 13) /13 Punkte Punkte
Analytische Statistik II
 Analytische Statistik II Institut für Geographie 1 Schätz- und Teststatistik 2 Das Testen von Hypothesen Während die deskriptive Statistik die Stichproben nur mit Hilfe quantitativer Angaben charakterisiert,
Analytische Statistik II Institut für Geographie 1 Schätz- und Teststatistik 2 Das Testen von Hypothesen Während die deskriptive Statistik die Stichproben nur mit Hilfe quantitativer Angaben charakterisiert,
Vielfalt als Zukunft Instandhaltung
 10.02.2016, 13.00 13.30 CET Dr. Franziska Hasselmann Studienleitung CAS Managing Infrastructure Assets Maintenance Schweiz 2016 Vielfalt als Zukunft Instandhaltung Einladungstext zum Vortrag... Täglich
10.02.2016, 13.00 13.30 CET Dr. Franziska Hasselmann Studienleitung CAS Managing Infrastructure Assets Maintenance Schweiz 2016 Vielfalt als Zukunft Instandhaltung Einladungstext zum Vortrag... Täglich
Umgang mit Heterogenität / Individualisierung. "Selbsteinschätzung" - Grundlage für wirksame individuelle Förderung
 "Selbsteinschätzung" - Grundlage für wirksame individuelle Förderung Das Lernen individuell wirkungsvoll steuern und unterstützen Was macht das Lernen nachhaltig wirksam? Was macht das Lernen für jeden
"Selbsteinschätzung" - Grundlage für wirksame individuelle Förderung Das Lernen individuell wirkungsvoll steuern und unterstützen Was macht das Lernen nachhaltig wirksam? Was macht das Lernen für jeden
Exemplar für Prüfer/innen
 Exemplar für Prüfer/innen Kompensationsprüfung zur standardisierten kompetenzorientierten schriftlichen Reifeprüfung AHS Juni 2016 Mathematik Kompensationsprüfung 3 Angabe für Prüfer/innen Hinweise zur
Exemplar für Prüfer/innen Kompensationsprüfung zur standardisierten kompetenzorientierten schriftlichen Reifeprüfung AHS Juni 2016 Mathematik Kompensationsprüfung 3 Angabe für Prüfer/innen Hinweise zur
METHODENLEHRE I WS 2013/14 THOMAS SCHÄFER
 METHODENLEHRE I WS 2013/14 THOMAS SCHÄFER DAS THEMA: INFERENZSTATISTIK IV INFERENZSTATISTISCHE AUSSAGEN FÜR ZUSAMMENHÄNGE UND UNTERSCHIEDE Inferenzstatistik für Zusammenhänge Inferenzstatistik für Unterschiede
METHODENLEHRE I WS 2013/14 THOMAS SCHÄFER DAS THEMA: INFERENZSTATISTIK IV INFERENZSTATISTISCHE AUSSAGEN FÜR ZUSAMMENHÄNGE UND UNTERSCHIEDE Inferenzstatistik für Zusammenhänge Inferenzstatistik für Unterschiede
Stichprobenauslegung. für stetige und binäre Datentypen
 Stichprobenauslegung für stetige und binäre Datentypen Roadmap zu Stichproben Hypothese über das interessierende Merkmal aufstellen Stichprobe entnehmen Beobachtete Messwerte abbilden Schluss von der Beobachtung
Stichprobenauslegung für stetige und binäre Datentypen Roadmap zu Stichproben Hypothese über das interessierende Merkmal aufstellen Stichprobe entnehmen Beobachtete Messwerte abbilden Schluss von der Beobachtung
Studiendesign und Statistik: Interpretation publizierter klinischer Daten
 Studiendesign und Statistik: Interpretation publizierter klinischer Daten Dr. Antje Jahn Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik Universitätsmedizin Mainz Hämatologie im Wandel,
Studiendesign und Statistik: Interpretation publizierter klinischer Daten Dr. Antje Jahn Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik Universitätsmedizin Mainz Hämatologie im Wandel,
Kommentar für Lehrpersonen
 Kommentar für Lehrpersonen Überblick über das Projekt Überblick Im Herbst 2005 lanciert die «Neue Zürcher Zeitung» mit dem «Lernset Eigene Meinung» eine elektronische, interaktive Unterrichtseinheit, die
Kommentar für Lehrpersonen Überblick über das Projekt Überblick Im Herbst 2005 lanciert die «Neue Zürcher Zeitung» mit dem «Lernset Eigene Meinung» eine elektronische, interaktive Unterrichtseinheit, die
Funktion Das Skript erstellt ROC-Kurven mit Konfidenzbändern, berechnet (gewichtete) Cutoff-Punkte und (partial) Area under the Curve (AUC, pauc).
 Skriptname: ROC_pAUC7.jsl JMP-Version: JMP 7 Datum: 10.09.2007 Download: ROC.zip Funktion Das Skript erstellt ROC-Kurven mit Konfidenzbändern, berechnet (gewichtete) Cutoff-Punkte und (partial) Area under
Skriptname: ROC_pAUC7.jsl JMP-Version: JMP 7 Datum: 10.09.2007 Download: ROC.zip Funktion Das Skript erstellt ROC-Kurven mit Konfidenzbändern, berechnet (gewichtete) Cutoff-Punkte und (partial) Area under
Praktische Theorie und theoretische Praxis in der ErzieherInnenausbildung
 Praktische Theorie und theoretische Praxis in der ErzieherInnenausbildung Prof.Dr.Rainer Dollase, Uni Bielefeld, Abt.Psychologie Beutelsbach, 18.5.2006 Gliederung 1. Theorie und Praxis -Beispiele und Begriffe
Praktische Theorie und theoretische Praxis in der ErzieherInnenausbildung Prof.Dr.Rainer Dollase, Uni Bielefeld, Abt.Psychologie Beutelsbach, 18.5.2006 Gliederung 1. Theorie und Praxis -Beispiele und Begriffe
Gestaltung von Computersimulationen
 Gestaltung von Computersimulationen Prof. Dr. Günter Daniel Rey Professur E-Learning und Neue Medien 7. Gestaltung von Computersimulationen 1 Überblick Computersimulationen Probleme beim Lernen mit Simulationen
Gestaltung von Computersimulationen Prof. Dr. Günter Daniel Rey Professur E-Learning und Neue Medien 7. Gestaltung von Computersimulationen 1 Überblick Computersimulationen Probleme beim Lernen mit Simulationen
Forum Training. Referent: Dr. phil. Arne Morsch
 Forum Training Analyse der realisierten Trainingsintensitäten im fitnessorientierten Krafttraining Mit welchen Intensitäten trainieren Fitness-Sportler? Referent: Dr. phil. Arne Morsch -1- Agenda Forschungsdesiderat
Forum Training Analyse der realisierten Trainingsintensitäten im fitnessorientierten Krafttraining Mit welchen Intensitäten trainieren Fitness-Sportler? Referent: Dr. phil. Arne Morsch -1- Agenda Forschungsdesiderat
Selbstreguliertes Lernen
 Selbstreguliertes Lernen Felix Kapp Workshop Lehren und Lernen mit digitalen Medien TU Dresden 03.-04.12.2009 Gliederung Begriffsdefinition Selbstreguliertes Lernen Modelle des Selbstregulierten Lernens
Selbstreguliertes Lernen Felix Kapp Workshop Lehren und Lernen mit digitalen Medien TU Dresden 03.-04.12.2009 Gliederung Begriffsdefinition Selbstreguliertes Lernen Modelle des Selbstregulierten Lernens
5 Selbstkonstruktion und interpersonale Distanz empirische Prüfung
 Selbstkonstruktion und interpersonale Distanz U.R. Roeder - 66-5 Selbstkonstruktion und interpersonale Distanz empirische Prüfung 5.1 Die Hypothesen Im Rahmen dieser Arbeit können nur wenige der im theoretischen
Selbstkonstruktion und interpersonale Distanz U.R. Roeder - 66-5 Selbstkonstruktion und interpersonale Distanz empirische Prüfung 5.1 Die Hypothesen Im Rahmen dieser Arbeit können nur wenige der im theoretischen
Testleiterbefragung. Einleitung. Fragestellung. Methode. Wie viele Schüler/innen zeigten das folgende Verhalten?
 Testleiterbefragung Einleitung "Ruhe bitte!" Vom Pausenhof schallt Geschrei in die Klasse, in der hinteren Reihe tauschen sich mehrere Schülerinnen und Schüler über die Lösung der letzten Frage aus, ein
Testleiterbefragung Einleitung "Ruhe bitte!" Vom Pausenhof schallt Geschrei in die Klasse, in der hinteren Reihe tauschen sich mehrere Schülerinnen und Schüler über die Lösung der letzten Frage aus, ein
Alphabetisierung in Sprachkursen für Migrantinnen und Migranten
 Alphabetisierung in Sprachkursen für Migrantinnen und Migranten FORUM MIGRATION: FACHTAGUNG IN MÜNCHEN 30. APRIL 2010 GOETHE-INSTITUT UND BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE ALEXIS FELDMEIER UNIVERSITÄT
Alphabetisierung in Sprachkursen für Migrantinnen und Migranten FORUM MIGRATION: FACHTAGUNG IN MÜNCHEN 30. APRIL 2010 GOETHE-INSTITUT UND BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE ALEXIS FELDMEIER UNIVERSITÄT
Computerspiele & Sozialverhalten: Effekte gewalttätiger und prosozialer Computerspiele. Prof. Dr. Tobias Greitemeyer Universität Innsbruck
 Computerspiele & Sozialverhalten: Effekte gewalttätiger und prosozialer Computerspiele Prof. Dr. Tobias Greitemeyer Universität Innsbruck 1 Medienkonsum In der heutigen Zeit sind wir vielfältigem Medienkonsum
Computerspiele & Sozialverhalten: Effekte gewalttätiger und prosozialer Computerspiele Prof. Dr. Tobias Greitemeyer Universität Innsbruck 1 Medienkonsum In der heutigen Zeit sind wir vielfältigem Medienkonsum
Evaluierung von Anti-Stress Programmen innerhalb der SKEI Gewerkschaft Ergebnisse der Pilot-Studie
 Evaluierung von Anti-Stress Programmen innerhalb der SKEI Gewerkschaft Ergebnisse der Pilot-Studie Dr. Paulino Jiménez Mag. a Anita Dunkl Mag. a Simona Šarotar Žižek Dr. Borut Milfelner Dr.Alexandra Pisnik-Korda
Evaluierung von Anti-Stress Programmen innerhalb der SKEI Gewerkschaft Ergebnisse der Pilot-Studie Dr. Paulino Jiménez Mag. a Anita Dunkl Mag. a Simona Šarotar Žižek Dr. Borut Milfelner Dr.Alexandra Pisnik-Korda
Design-based research in music education
 Design-based research in music education An approach to interlink research and the development of educational innovation Wilfried Aigner Institute for Music Education University of Music and Performing
Design-based research in music education An approach to interlink research and the development of educational innovation Wilfried Aigner Institute for Music Education University of Music and Performing
Allgemeines Lineares Modell: Univariate Varianzanalyse und Kovarianzanalyse
 Allgemeines Lineares Modell: Univariate Varianzanalyse und Kovarianzanalyse Univariate Varianz- und Kovarianzanlyse, Multivariate Varianzanalyse und Varianzanalyse mit Messwiederholung finden sich unter
Allgemeines Lineares Modell: Univariate Varianzanalyse und Kovarianzanalyse Univariate Varianz- und Kovarianzanlyse, Multivariate Varianzanalyse und Varianzanalyse mit Messwiederholung finden sich unter
Anglizismen in der Werbung. Eine empirische Studie
 Wirtschaft Andre Steiner / Matthias Strobel / Yanfeng Gao Anglizismen in der Werbung. Eine empirische Studie Studienarbeit Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... I Abbildungsverzeichnis...
Wirtschaft Andre Steiner / Matthias Strobel / Yanfeng Gao Anglizismen in der Werbung. Eine empirische Studie Studienarbeit Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... I Abbildungsverzeichnis...
