DIE SPECHTE IM STADTGEBIET ST. PÖLTENS/NÖ.
|
|
|
- Brit Becker
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 1
2 DIE SPECHTE IM STADTGEBIET ST. PÖLTENS/NÖ. Erhebung der Spechtarten im Bezirk St. Pölten Stadt mit besonderer Berücksichtigung des Blutspechtes von Hannes Seehofer und Christian Steinböck (Beitrag Blutspecht) 1. EINLEITUNG UND METHODE Spechte gelten als Bioindikatoren für naturnahe Wälder. Durch das spezifische Bauen von Bruthöhlen sind sie gleichzeitig Wegbereiter für zahlreiche baumhöhlenbewohnende Tierarten wie Kleineulen, Fledermäuse oder Insekten. Im Zuge einer Spechterhebung im gesamten Mostviertel durch die Forschungsgemeinschaft LANIUS (HOCHEBNER 1994) wurde 1995 mit gezielten Untersuchungen zur Verbreitung der Spechte im Stadtgebiet von St. Pölten begonnen. Dazu wurden potentielle Spechtlebensräume besonders zur Revierbildungsund Brutzeit (Februar bis Juli) durch mehrere Kartierer begangen und akustische sowie optische Spechtnachweise notiert. Teilweise kamen auch Klangattrappen zur Anwendung d.h. mit einem Tonbandgerät wurden Spechtrufe abgespielt und die Spechte zur Reaktion provoziert. Zusätzlich wurden frühere Verbreitungsdaten aus dem Zeitraum ausgewertet. Der Blutspecht fand bei den Erhebungen als tiergeografisch besonders interessante Art spezielle Berücksichtigung. Im Zuge dieses Projektes wurde auch in Zusammenarbeit mit der Umweltschutzabteilung des Magistrates eine Schautafel der Spechtarten in St. Pölten und ein Artikel erstellt, der in einigen Medien wie Stadtzeitung, NÖN u.a. erschienen ist (siehe Anhang). Bei der Umweltkomitteesitzung am 11. April 1996 wurden die Spechte im Stadtgebiet im Rahmen eines Diavortrages vorgestellt. Neben den Autoren beteiligten sich folgende Mitarbeiter in dankenswerter Weise an den Erhebungen: C. Bamberger, M. Braun, T. Hochebner, P. Kumpera. H.-M. Berg danken wir für die kritische Durchsicht des Manuskriptes. 2. UNTERSUCHUNGSGEBIET (UG) Im gesamten Magistratsgebiet St. Pöltens (Fläche: 108,5 km 2 ) wurden die vorkommenden Spechte erfaßt. Der Waldanteil ist mit etwa 15 % (ca. 16 km 2 ) relativ gering. Die Hauptbaumarten sind Fichte, Buche, Eiche, Hainbuche, Hybridpappel, Esche u.a. Der Anteil an Gärten beträgt etwa 6-7 %. Das Untersuchungsgebiet (UG) liegt auf den Österreich-Karten Nr. 38, 55 und 56 ( N, E). Die Seehöhe im UG beträgt etwa m. Im Rahmen dieses Projektes war eine flächendeckende Kartierung nicht möglich. Daher lag der Schwerpunkt der Kontrollen in Waldgebieten, Auen an der Traisen, größeren Grünflächen, Parks und Gartenvierteln. Eine Erhebung in größeren Privatgärten und Privatparks mit Altbaumbeständen war nicht oder nur randlich von öffentlichen Flächen aus möglich. 3. ERGEBNISSE 2
3 Insgesamt wurden über 130 Verbreitungsdaten gesammelt und ausgewertet. Von 10 in Österreich vorkommenden Spechtarten leben acht im Stadtgebiet St. Pöltens. Diese sind Wendehals, Grauspecht, Grünspecht, Schwarzspecht, Buntspecht, Blutspecht, Mittelspecht und Kleinspecht. Der Dreizehenspecht, ein Bergwaldbewohner sowie der Weißrückenspecht als Altholzbewohner fehlen im Stadtgebiet. Übersichtstabelle der Spechtarten im Stadtgebiet St. Pöltens ART Status Häufigkeit RLNÖ RLÖ VSRL Wendehals (Jynx torquilla) nbv ss 3 3 Grauspecht (Picus canus) wbv s I Grünspecht (Picus viridis) nbv mh Schwarzspecht (Dryocopus martius) wbv mh I Buntspecht (Picoides major) nbv h Blutspecht (Picoides syriacus) nbv mh 4! 4 I Mittelspecht (Picoides medius) nbv ss 3! 4 I Kleinspecht (Picoides minor) wbv s 6 Status: BV...Brutvogel (n=nachgewiesen, w=wahrscheinlich, m=möglich) Häufigkeit: h...häufig, mh...mäßig häufig, s...selten, ss...sehr selten Gefährdung: RLNÖ: Rote Liste ausgewählter Tiergruppen Niederösterreichs Vögel (BERG 1997) RLÖ: Rote Liste der in Österreich gefährdeten Vogelarten (BAUER 1994) Kategorien: 1... Vom Aussterben bedroht 2... Stark gefährdet 3... Gefährdet 4... Potentiell gefährdet 5... Gefährdungsgrad nicht genau bekannt 6... Nicht genau bekannt!... Verbreitungsschwerpunkt in NÖ bzw. besondere Schutzveranwortung für NÖ VSRL: Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie des Rates über die Erhaltung wildlebender Vogelarten 1979): Auf die in Anhang I angeführten Arten sind besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer Lebensräume anzuwenden. Bedeutende Spechtlebensräume im Stadtgebiet Zahl der bisher festgestellten Spechtarten Grasberg 4-5 Gartenvierteln (z.b. Eisberg etc) 3-4 Hammerpark und Umgebung 3-4 Laubwald bei Waldsiedlung Spratzern 3-4 Schildberger Wald 4-5 Stadtwald 3-4 Traisenauen 5-6 Wald zwischen Viehofen und Radlberg 4-5 Wälder im GÜPL Völtendorf/Brunnenfeld BESCHREIBUNG DER FESTGESTELLTEN ARTEN WENDEHALS (Jynx torquilla) - Vogel des Jahres
4 Beschreibung: Sperlingsgroß, Gefieder graubraun rindenfarbig gezeichnet, Männchen und Weibchen kaum zu unterscheiden, Zugvogel: ab April bis September bei uns anzutreffen, eigentlich kein richtiger Specht sondern nur mit den Spechten eng verwandt, kann selbst keine Baumhöhle zimmern und brütet daher gerne in Nistkästen, spezialisierter Ameisen-jäger. Der Name stammt von der Fähigkeit den Kopf bis zu 180 drehen zu können. Gefährdung: Rote Liste Kategorie 3 gefährdet. Gefährdungsursachen: Verschwinden von Streuobstwiesen und ameisenreichen Wiesenflächen Lebensraum: Halboffene Landschaften, lichte Auwälder, lockere Kiefernbestände, Streuobstwiesen, Parkanlagen, Gärten, Alleen, Friedhöfe und Weinbaugebiete. Der Wendehals ist auf vorhandene Baumhöhlen oder Nistkästen (Einflugloch mindestens 34 mm Durchmesser) angewiesen. Vorkommen in St. Pölten: Der Wendehals besiedelt die Gartenviertel besonders mit alten Gärten (z.b. Eisbergsiedlung, Jahnstraße, Handel-Mazetti-St./Parkstr.), wiesenreiche Grünflächen, Stadtrandbereiche (Aurand) und kleine Ortschaften um die Stadt. Ein Brutnachweis gelang bisher erst in Schrebergärten am Nadelbach (Nistkasten). Besondere Bedeutung haben ältere Obstgärten im Stadtgebiet. Insgesamt liegen bisher 9 Wendehals- Nachweise aus dem Stadtgebiet vor, wobei es sich bei zeitigen Frühjahrsbeobachtungen auch um durchziehende Exemplare handeln kann. Die Verbreitung des Wendehals in St. Pölten ist bisher noch nicht ausreichend bekannt, daher kann nur eine grobe Bestandsschätzung mit ca Brutpaaren angegeben werden. GRAUSPECHT (Picus canus) Beschreibung: Ähnlich dem Grünspecht aber etwas kleiner, Kopf grau - nur beim Männchen kleine rote Stirnplatte. Erdspecht (Nahrungssuche oft am Boden), Stimme: abfallende Rufreihe, die leicht nachgepfiffen werden kann. Gefährdung: europaweit gefährdet (VSRL: Anhang I). Gefährdungsursachen: Intensivierung der Forstwirtschaft: Umwandlung von Laubwälder in Forste, Verlust von Streuobstwiesen. Lebensraum: Strukturreiche Laub- und Mischwälder, Streuobstgebiete, Feldgehölze und Parkanlagen. Vorkommen in St. Pölten: Der Grauspecht besiedelt naturnahe Laubwaldbereiche (z.b. am Viehofner Kogel bei Radlberg) und größere Grünanlagen und Gartenvierteln. Er ist viel seltener als seine Zwillingsart, der Grünspecht. Bisher liegen Nachweise aus 6 Gebieten vor, wobei sicher auch beim Grauspecht noch Erhebungslücken existieren und der Gesamtbestand nur grob geschätzt werden kann. Vorkommen in Stadtgebiet Schildberg bei Zwischenbrunn Wiedenholz bei Unterradlberg Viehofner Kogel bei Oberradlberg Stadtrand Robinson Spielplatz-Traisenau Umgebung Südpark Geschätzer Gesamtbestand: GRÜNSPECHT (Picus viridis) 1-2 Brutpaare Brutpaare Beschreibung: ca. taubengroßer Erdspecht, Oberseite grün, Unterseite graugrün, rote Kopfplatte und Nacken, schwarze Gesichtsmaske, Weibchen schwarzer - Männchen roter 4
5 Bartstreif. Stimme: auffallendes, schallendes Lachen; wie der Grauspecht oft am Boden (Ameisenjagd) Gefährdung: derzeit nicht gefährdet Lebensraum: In Randzonen lichter Laub- und Mischwälder, Auwälder, Parklandschaften und Streuobstgebieten. Verbreitung in St. Pölten: Der Grünspecht ist nach dem Buntspecht die verbreitetste Spechtart im Stadtgebiet. Er ist vor allem in den Auwaldresten entlang der Traisen, in Gartenvierteln, größeren Grünflächen und Parks zu finden. Insgesamt liegen 20 Nachweise aus etwa 10 Teilgebieten vor. Vorkommen in Stadtgebiet Linke Traisenau bei Bhf Viehofen+Paderta Teich Viehofner Kogel zw. Viehhofen und Oberradlberg Rechte Traisenau von Ratzersdorf bis Pottenbrunn Rechte u. linke Traisenau südlich Raabbrücke bis A1 Rechte u. linke Traisenau von Harland bis Ochsenburg Stadtwald und Eisberg GÜPL Völtendorf und Brunnenfeld Spratzern Witzendorf-Mooshöfe Hammerpark, Südpark und Umgebung Geschätzer Gesamtbestand: 1-2 Brutpaar 1-2 Brutpaar 1-3 Brutpaare 1-2 Brutpaar Brutpaare SCHWARZSPECHT (Dryocopus martius) Beschreibung: Größte heimische Spechtart, fast krähengroß, schwarz mit rotem Scheitelfleck. Gefährdung: gilt in der EU als gefährdet (VSRL: Anhang I). Gefährdungsursachen: intensive Forstwirtschaft, Umwandlung naturnaher Waldbestände in Fichtenmonokulturen. Lebensraum: Größere Misch- und Nadelwaldgebiete mit Altholzbeständen und hohem Angebot totholzbewohnender Insekten, längsovale Nesthöhle, bevorzugt in Buche oder Rotföhre (Durchmesser 13 x 9 cm), wichtiger Höhlenbauer für andere Höhlenbrüter wie Hohltaube, Rauhfußkauz, Siebenschläfer oder Fledermäuse. Vorkommen in St. Pölten: Der Schwarzspecht besiedelt vor allem größere Waldgebiete rund um die Landeshauptstadt. Im bebauten Siedlungsgebiet ist er kaum, wenn dann, nur am Stadtrand anzutreffen. Die Reviergröße beträgt in Mitteleuropa durchschnittlich je nach Habitatqualität ha. Da es im Stadtgebiet auch zahlreiche kleine inselartige Waldgebiete oft auf Hügelkuppen gibt, kann ein Schwarzspechtrevier durchaus mehrere solcher Waldinseln umfassen und sich über die Magistratsgrenze ausdehnen. Am Kollerberg wurde der Schwarzspecht zweimal beobachtet, er wurde dort aber nur als Nahrungsgast eingestuft (BRAUN 1997). Insgesamt liegen bisher 9 Nachweise aus dem Stadtgebiet vor. Das Vorkommen des Schwarzspechtes ist auch in Wäldern rund um St. Georgen, z.b. Reitzersdorfer Wald und Ochsenburg (Probstwald) zu erwarten. Vorkommen in Stadtgebiet Grasberg bei Wasserburg: Schildberg bei Zwischenbrunn: Wiedenholz bei Unter/Oberradlberg 2 Brutpaare 5
6 Fuchsenwald/Kaibling Wälder im GÜPL Völtendorf, Waldsiedlung Geschätzer Gesamtbestand: Brutpaare BUNTSPECHT (Picoides major) - Vogel des Jahres 1997 Beschreibung: Fast amselgroßer schwarzweiß gezeichneter Specht mit kräftig roten Unterschwanzdecken, nur das Männchen mit rotem Nackenfleck, als typischer Hackspecht selten am Boden, schafft Wohnraum für zahlreiche andere Höhlenbrüter Gefährdung: nicht gefährdet, häufigste Spechtart Lebensraum: Alle Nadel- und Laubwälder, Alleen, Parks, Gärten, Grünanlagen Verbreitung in St. Pölten: Der Buntspecht ist als häufigste Spechtart im gesamten Stadtgebiet verbreitet. Hohe Dichten erreicht er zum Beispiel in der Traisenau und im Stadtwald. Von dieser Art liegen über 50 Nachweise, darunter zahlreiche Brutnachweise vor, wobei zahlreiche Beobachtungen nicht mehr notiert wurden. Er ist auch in der Innenstadt zu finden, soweit noch geeignete Spechtbäume vorhanden sind. In letzter Zeit hat sich der Buntspecht auch zunehmend an Hausfassaden zu schaffen gemacht und es gibt diesbezüglich einige Beschwerden. Dagegen helfen nur glatte Mauerkanten, wo sich dieser geschickte Kletterer nicht festhalten kann. Geschätzter Gesamtbestand: Paare. MITTELSPECHT (Picoides medius) Beschreibung: etwas kleiner als der Buntspecht, rote Kopfplatte und schwarz längsgefleckter Bauch, Unterschwanzdecken rosa. Gefährdung: österreichweit und europaweit gefährdet, Gefährdungsursachen: intensive Forstwirtschaft, Umwandlung naturnaher Laubmischwälder in Forste. Lebensraum: Reichgegliederte Laubmischwälder mit hohen Eichenanteilen, Auwälder und Streuobstbestände, Grünflächen und Parks mit Eichenbeständen. Wesentlich für das Vorkommen sind Altbäume mit hohem Totholzanteil in der Krone. Verbreitung in St. Pölten: Der Mittelspecht ist die seltenste Spechtart im Stadtgebiet. Bisher liegen nur 4 Beobachtungen vor. Als Brutvogel kommt er im Bereich der Schloßallee in Ochsenburg, am Grasberg und seit kurzem auch im Stadtwald vor. Ein einmaliger Nachweis aus dem Hammerpark ist voraussichtlich nur als Nahrungsbesuch zu werten. In St. Pölten bevorzugt die Art eichenreiche Waldflächen und Obstbaumbestände. Ein Vorkommen wäre auch in Traisenau vorstellbar. Hier sind noch genauere Kontrollen nötig, da die Art aufgrund ihrer jahreszeitlich frühen Rufaktivität leicht übersehen werden kann. Vorkommen in Stadtgebiet Grasberg bei Wasserburg: Ochsenburg Stadtwald Geschätzer Gesamtbestand: 2-3 Brutpaar 4-6 Brutpaare BLUTSPECHT (Picoides syriacus) von Christian Steinböck Einleitung und Methode: Die Verbreitung des Blutspechtes in Österreich ist verhältnismäßig gut dokumentiert. Für das Gebiet der Landeshauptstadt St. Pölten lagen jedoch kaum Beobachtungsdaten vor. Die Forschungsgemeinschaft LANIUS setzte es sich daher zum Ziel, hier die Verbreitung des Blutspechtes vor allem im Stadtgebiet zu dokumentieren. Die 6
7 Erfassung der Bestände erfolgte einerseits gezielt mittels Klangattrappe, wobei vor allem Gebiete mit potentiell geeignet erscheinenden Habitatstrukturen aufgesucht wurden, andererseits im Rahmen eine Spechterhebung für das gesamte Niederösterreichische Mostviertel. Feldkennzeichen: Der Blutspecht ähnelt in allen Kleidern dem Buntspecht, von dem er sich durch das nicht unterbrochene weiße Kopf- und Halsseitenband (bei Jungvögeln nur bedingt anwendbar, da bei jungen Buntspechten die dunkle Querbinde hinter den Ohrdecken schwächer und oft nur unvollständig ausgebildet ist), die dunklen, wenig weiß gezeichneten Schwanzseiten und die blaßrote Färbung von Bauch und Unterschwanzdecken unterscheidet. Stimme: Häufigste Lautäußerung ist der Einzelruf güg, der mit einiger Erfahrung gut vom Ruf des Buntspechtes zu unterscheiden ist.. Verbreitung: Das Brutgebiet des Blutspechtes erstreckt sich vom südlichen Iran über den Irak, Syrien und Libanon bis Nordwest-Jordanien und Südisrael, Aserbeidschan, Armenien und Ost-Grusinien und die Türkei. In Europa besiedelt er einen Großteil der Balkanhalbinsel, das Donau- und westliche Schwarzmeertiefland und Nordgriechenland. Im östlichen Mitteleuropa hat er Ostösterreich, den Südosten der Slowakei und Ungarn besiedelt. Ostwärts setzt sich das Brutvorkommen über Bulgarien und Rumänien bis in die westliche Ukraine fort. Lebensraum: Der Blutspecht bevorzugt in Europa, im Gegensatz zum Buntspecht, offene Landschaften mit schütterem Baumbestand wie Weingärten mit eingestreuten Steinobstbeständen, Obstbaumalleen und extensiv genutzte Streuobstgärten. In Parks, Friedhöfen, Klein- und Schrebergärten sowie Villenvierteln dringt er auch in den menschlichen Siedlungsbereich vor. In Österreich beschränkt sich das Brutvorkommen im wesentlichen auf die klimatisch begünstigten Tief- und Hügelländer im Osten des Landes, die Schwerpunkte liegen im nördlichen Burgenland und im östlichen Niederösterreich. Hier ist der Blutspecht ein verbreiteter Brutvogel in der offenen Kulturlandschaft und in kleineren Ortschaften. Auch in Wien ist er lokal verbreitet. Nahrung: Abweichend von allen anderen mitteleuropäischen Spechten ernährt sich der zum erheblichen Teil von Vegetabilien wie Kirschen, Weichseln und Maulbeeren, daneben aber auch Marillen, Himbeeren, Erdbeeren, Johannisbeeren und Weinbeeren, reifende Wal- und Haselnüsse sowie Mandeln. Die tierische Nahrung gleicht der des Buntspechtes. Fortpflanzung: Der Blutspecht zimmert seine Bruthöhlen in die Stämme oder starke Äste von Bäumen, nicht selten auch in hölzerne Leitungsmasten. Die 4 bis 7 Eier werden in 9 bis 11 Tagen von Weibchen und Männchen ausgebrütet. Die Jungvögel verlassen nach 17 bis 21 Tagen und werden von den Eltern noch ca. 14 Tage geführt. Die Brutsaison beginnt meist im Mai, in der Regel erfolgt eine Jahresbrut, Ersatzgelege sind bei Verlust des Erstgeleges nicht selten. Ausbreitungsgeschichte: Der Blutspecht hat in den letzten 100 Jahren sein Brutgebiet ähnlich der Türkentaube beträchtlich erweitert wurde er erstmals in Ungarn nachgewiesen, 1949 in der ehemaligen Tschechoslowakei. Zur Zeit der ersten Feststellung im April 1951 im Burgenland hatte er das weitere Gebiet um den Neusiedler See offenbar bereits besiedelt. Die Folgejahre erbrachten Brutnachweise aus Graz, bei Mattersburg, dem Wiener Becken, bei Herzogenburg, Krems und dem Nordwestrand des Weinviertels. Nach Westen drang der Blutspecht bis Linz vor, dieses Brutvorkommen konnte jedoch in den Folgejahren nicht mehr bestätigt werden. Neuansiedlungen in der Südsteiermark und westlich der Mur blieben nur lokaler Natur. Vorkommen in St. Pölten: Der Blutspecht besiedelt vor allem Gebiete mit relativ offenem Baumbestand (Parks, Friedhöfe, Schrebergärten und Siedlungsgärten) und größeren 7
8 Rasenflächen (Sportplätze, Liegewiesen beim Kaltbad). Wichtig ist das Vorhandensein geeigneter Höhlenbäume. Offene, kurzrasige Grünflächen wie Sportplätze werden bevorzugt zur Zeit der Aufzucht der Jungvögel aufgesucht, wo er u.a. Regenwürmer aufsammelt. Insgesamt liegen 18 Nachweise des Blutspechtes an verschiedenen Stellen des Stadtgebietes vor. Da zweifellos noch Erhebungslücken vorhanden sind, liegt der Brutbestand wahrscheinlich höher als die aufgrund der vorliegenden Daten durchgeführte Schätzung von Brutpaaren. Ein Verbreitungsschwerpunkt wird von der Mariazeller Straße, dem Schulring und dem Traisenfluß umschlossen und umfaßt den Hammerpark, den Garten des BORG und die offenen Auwaldreste südlich des Regierungsviertels. Alleine hier liegen 12 Beobachtungen (davon 5 Winterbeobachtungen) vor, der Bestand wurde mit 3-4 Brutpaaren geschätzt. Die restlichen 6 Nachweise verteilen sich auf 6 teilweise weit auseinander liegende Stadtteile. In Spratzern konnte ein adulter Specht in Gesellschaft zweier Jungvögel beobachtet werden, rufende Spechte wurden im Garten des Altersheimes, im Bereich des Stadtfriedhofes und am Spratzerner Kirchenweg lokalisiert. Revierverhalten konnte im Garten des BORG und im Gebiet Kranzbichlerstraße/Spratzerner Kirchenweg festgestellt werden. In einen alten Kirschbaum am Spratzerner Kirchenweg zimmerte ein Blutspecht eine Höhle, die er dann jedoch nicht besiedelte. Vorkommen im Stadtgebiet Spratzern Ober-Wagram Umgebung ÖBB-Hauptwerkstätte Bereich Julius Raab Brücke Hammerpark - Garten BORG-Jahnstraße Umgebung Matthias-Corvinus-Straße (Sportplatz) Kranzbichler Straße/Spratzerner Kirchenweg Umgebung Altersheim St. Pölten Umgebung Städtischer Friedhof 1-2 Brutpaare 2-3 Brutpaare 2 Brutpaare 1-2 Brutpaare Konkurrenz zum Buntspecht: Im Garten des BORG lieferte sich ein Paar Blutspechte mit einem brütenden Buntspechtpaar einen heftigen Revierkampf. Auch in der Traisenau wurde Territorialverhalten zwischen beiden Arten festgestellt. Weitere Revierkonflikte zwischen diesen beiden Arten konnten nicht beobachtet werden. Zusammenfassung: In den Jahren 1992 bis 1997 wurde im Zuge einer Spechtkartierung die Verbreitung des Blutspechtes in St. Pölten erforscht. Der Brutbestand wurde mit Paaren geschätzt, dürfte aber aufgrund vorhandener Erhebungslücken höher liegen. KLEINSPECHT (Picoides minor) Beschreibung: kleinste heimische Spechtart, etwa sperlingsgroß, Weibchen weiße, Männchen rote Stirnplatte, im Unterschied zum Mittelspecht keine rötlichen Unterschwanzdecken, schwarzweiß gebänderter Rücken ohne weiße Schulterflecken. 8
9 Gefährdung: In NÖ in der Roten Liste, Kategorie 6 Gefährdungssituation nicht genau bekannt ; Gefährdungsursachen: Verlust von Ufergehölzen, Auwäldern und extensiv genutzten Obstgärten. Lebensraum: Weichholzdominierte totholzreiche Laubwälder, Auwälder, Streuobstbestände, Parkanlagen und Gärten mit Altbäumen. Verbreitung in St. Pölten: Der Klein- oder Zwergspecht wurde vorwiegend in naturnahen Bereichen der Traisenau, naturnahen Waldgebieten, altholzreichen Parks und Gärten festgestellt. Insgesamt liegen 8 Nachweise vor. Bis zu Beginn der 90er Jahre war die Art nach eigenen Beobachtungen noch häufiger im Siedlungsgebiet anzutreffen. Dieser unauffällige Specht ist relativ selten zu beobachten; aufgrund der wenigen Nachweise ist keine Schätzung des Gesamtbestandes möglich. Vorkommen in Stadtgebiet Grasberg bei Wasserburg: Schildberg bei Zwischenbrunn: e Traisenau bei Pottenbrunn Traisenaureste bei Schießstätte 0- Hammerpark und Umgebung 0- Viehofen Rabuspark, Gärten, Ufergehölze Mühlbach 0- Wälder im GÜPL Völtendorf, Brunnenfeld Spratzern Geschätzer Brutbestand:??? 5. GEFÄHRDUNG DER SPECHTE IN ST. PÖLTEN Intensive Forstwirtschaft: Umwandlung naturnaher Laubwälder in Fichten- und Douglasienbestände rund um St.. Pölten: z.b Waldgebiet bei der Waldsiedlung, Schildberger Wald, Fuchsenwald, Reitzersdorfer Wald, Waldgebiet bei Schwadorf und bei Witzendorf etc. Spechte sind besonders auf Altholz (das sind Bäume ab 100 Jahre) und Totholz angewiesen, beides ist bei der derzeit üblichen forstlichen Bewirtschaftung kaum möglich. Verlust geeigneter Lebensräume: Im Siedlungsgebiet wurden und werden zahlreiche Gärten, Grünflächen, Aubereiche, Althölzer gerodet und verbaut. Beispiele: Regierungsviertel, Einkaufszentren, Wohnungsbau (z.b.himmelgründe, Rabuspark etc), Traisensekundärdamm, Brücken- und Straßenbauten etc. Intensivierung und Nutzungsänderung städtischer Grünanlagen und Gärten: Naturnahe Gärten verschwinden immer mehr oder werden in sterile Ziergärten umgewandelt; alte Obstgehölze werden gerodet, Nachpflanzungen werden nur in ungenügendem Ausmaß vorgenommen. Verlust geeigneter Nahrungsflächen: Wiesenflächen verschwinden immer mehr zu Gunsten steriler Zierrasen. 6. ARTENSCHUTZMASSNAHMEN FÜR SPECHTE 9
10 Eine Voraussetzung für den Spechtschutz ist eine nachhaltige naturverträgliche Waldbewirtschaftung. Die Stadt sollte auf ihren Waldgrundstücken eine Vorbildfunktion für die vielfach naturfern wirtschaftenden privaten Grundbesitzer erfüllen. In öffentlichen Waldflächen wie Stadtwald, Kollerberg u.a. sollte nicht forstliche Nutzung im Vordergrund stehen, sondern der Aufbau eines Laubmischwaldes als Erholungswald für die Bevölkerung und naturnaher Lebensraum für eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt. Maßnahme: starke Durchforstung der Fichtenmonokulturen (Entfernen der Blaufichten) am Kollerberg und im Stadtwald, Naturverjüngung wäre einer Aufforstung vorzuziehen; Erhöhung des Laubwaldanteiles. Neuanlage und Erhaltung von Baumalleen Maßnahme: Pflanzung von Laubbäumen oder Hochstamm-Mostobstbäumen entlang von Straßen und Wegen (wie zum Beispiel bereits entlang eines Weges am Teufelhof Richtung Nadelbach durchgeführt) Erhaltung und Schutz von Streuobstwiesen und Obstbaumbeständen: Maßnahme: Nachpflanzung von Hochstamm-Obstgehölzen, Bewußtseinsbildung für Obstbaum im Hausgarten, eventuell einmalige Prämien als Anreiz für die Erhaltung alter Obstbäume oder für Nachpflanzungen im Siedlungsgebiet. Für landwirtschaftliche Flächen gibt es Obstbaumförderungen des Landes, die von der Agrarbehörde abgewickelt werden. Vermehrte Pflanzung von Hochstammobstgehölzen auf öffentlichen Flächen. Erhaltung von Spechtbäumen: Maßnahme: Stehenlassen von alten Bäumen mit Spechthöhlen, eventuell Verwendung einer Spechtbaumtafel im Stadtbereich zur Kennzeichnung Totholz als wichtiges Lebensraumrequisit für Spechte sollte zumindest abseits von Wegen erhalten bleiben. Erhaltung von Magerwiesen und offenen extensiv genutzten Flächen als Nahrungshabitate für Ameisenfresser wie Wendehals, Grünspecht u.a. Bestandskontrolle: Ein zukünftiges Monitoring besonders bei seltenen und gefährdeten Spechtarten wie Wendehals, Mittelspecht und Kleinspecht wäre auch im Hinblick auf die Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen sinnvoll. 7. LITERATUR BAUER, K. (1994): Rote Liste der in Österreich gefährdeten Vogelarten (Aves). In Gepp, J.: Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs. Grüne Reihe des BMUJF, Band 2, Graz. BERG, H.-M. (1997): Rote Listen ausgewählter Tiergruppen Niederösterreichs - Vögel (Aves), 1. Fassung NÖ Landesregierung, Abteilung Naturschutz, Wien, 184 S. BRAUN, M. (1997): Ornithologische Kartierung von Parks und Grünflächen in St. Pölten. Forschungsgemeinschaft LANIUS, Krems. DVORAK, M, A. RANNER & H.-M. BERG (1993): Atlas der Brutvögel Österreichs. Umweltbundesamt, Wien, 527 S. 10
11 Forschungsgemeinschaft LANIUS (1996): Bestandsaufnahme von Biotopflächen im Stadtgebiet Erhebung im Auftrag der Umweltschutzabteilung, St. Pölten. HOCHEBNER, T. (1993): Siedlungsdichte und Lebensraum einer randalpinen Population des Mittelspechts (Picoides medius) im NÖ Alpenvorland. Egretta 36, HOCHEBNER, T. (1994): Projekt Spechtkartierung im NÖ Mostviertel u. Zentralraum, Zwischenber , Forschungsgemeinschaft LANIUS - Jahresber. 92/93,52-60, Krems. KARNER, E. et al (1997): Handlungsbedarf für Österreich zur Erfüllung der EU- Vogelschutzrichtlinie. Umweltbundesamt Report Nr. 144, Wien, 169 S. LFU (1993): Artenschutzsymposium Spechte. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. Nr. 67, Karlsruhe, 240 S. MOSLER-BERGER, C. (1993): Spechte, Infodienst Wildbiologie & Ökologie, Biologie einheimischer Wildtiere 1/43, Zürich, 14 S. PECHACEK, P. (1995) Spechte (Picidae) im Nationalpark Berchtesgaden. Nationalparkverwaltung Berchtesgaden, Forschungsbericht 31, 183 S. RUGE, K. et al. (1988): Der Wendehals. Lebensraum, Bedrohung, Hilfen. Verlag opus data, Vogelkunde Bücherei Band 5, Rottenburg, 80 S. SCHERZINGER, W. (1982): Die Spechte im Nationalpark Bayrischer Wald. Schriftenreihe des Bayer. Staatsmin. ELWF, Heft 9, Passau, 119 S. 11
Bayerisches Landesamt für Umwelt
 NATURA 2000 - Vogelarten Dreizehenspecht (Picoides tridactylus) Der Dreizehenspecht ist ein knapp buntspechtgroßer, schwarz- weiß gefärbter Specht, der keine rötliche Färbung aufweist. Er ist ein typischer
NATURA 2000 - Vogelarten Dreizehenspecht (Picoides tridactylus) Der Dreizehenspecht ist ein knapp buntspechtgroßer, schwarz- weiß gefärbter Specht, der keine rötliche Färbung aufweist. Er ist ein typischer
Spechte im Duisburger Süden 1
 Elektronische Aufsätze der Biologischen Station Westliches Ruhrgebiet 1.14 (25): 1-6 Electronic Publications of the Biological Station of Western Ruhrgebiet 1.14 (25): 1-6 Spechte im Duisburger Süden 1
Elektronische Aufsätze der Biologischen Station Westliches Ruhrgebiet 1.14 (25): 1-6 Electronic Publications of the Biological Station of Western Ruhrgebiet 1.14 (25): 1-6 Spechte im Duisburger Süden 1
Der Grünspecht. Vogel des Jahres 2014
 Der Grünspecht Vogel des Jahres 2014 Foto: M. Gläßel Foto: Gebel & Mergemeier http://www.bing.com/images/search?q=dohle&view=detail&id=bc5add B648F94E45759E96228B66CF57EE19B5D1&first=0&FORM=IDFRIR Die
Der Grünspecht Vogel des Jahres 2014 Foto: M. Gläßel Foto: Gebel & Mergemeier http://www.bing.com/images/search?q=dohle&view=detail&id=bc5add B648F94E45759E96228B66CF57EE19B5D1&first=0&FORM=IDFRIR Die
Die neun Spechtarten in der Schweiz
 Die neun Spechtarten in der Schweiz 1 1. Buntspecht (Dendrocopos major) 2. Mittelspecht (Dendrocopos medius) 3. Kleinspecht (Dendrocopos minor) 4. Weissrückenspecht (Dendrocopos leucotos) 5. Dreizehenspecht
Die neun Spechtarten in der Schweiz 1 1. Buntspecht (Dendrocopos major) 2. Mittelspecht (Dendrocopos medius) 3. Kleinspecht (Dendrocopos minor) 4. Weissrückenspecht (Dendrocopos leucotos) 5. Dreizehenspecht
Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft. Vogelschutz im Wald
 Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft Vogelschutz im Wald Wald ist nicht gleich Wald Wälder sind für viele Vogelarten wertvoller Lebens raum. Von den in Bayern vorkommenden 207 Brutvogelarten
Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft Vogelschutz im Wald Wald ist nicht gleich Wald Wälder sind für viele Vogelarten wertvoller Lebens raum. Von den in Bayern vorkommenden 207 Brutvogelarten
Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg (Hg.) Stadtwald Augsburg. 100 Tiere, Pflanzen und Pilze
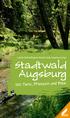 Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg (Hg.) Stadtwald Augsburg 100 Tiere, Pflanzen und Pilze 5 Verbände 6 Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg 6 Landesbund für Vogelschutz 8 Naturwissenschaftlicher
Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg (Hg.) Stadtwald Augsburg 100 Tiere, Pflanzen und Pilze 5 Verbände 6 Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg 6 Landesbund für Vogelschutz 8 Naturwissenschaftlicher
ERFASSUNG & BEWERTUNG VON ARTEN DER VS-RL IN BAYERN
 BAYERISCHE LANDESANSTALT FÜR WALD UND FORSTWIRTSCHAFT ERFASSUNG & BEWERTUNG VON ARTEN DER VS-RL IN BAYERN Grauspecht Picus canus - Entwurf Stand: Januar 2009 Erhebungsumfang Ersterfassung Die Bestandserfassung
BAYERISCHE LANDESANSTALT FÜR WALD UND FORSTWIRTSCHAFT ERFASSUNG & BEWERTUNG VON ARTEN DER VS-RL IN BAYERN Grauspecht Picus canus - Entwurf Stand: Januar 2009 Erhebungsumfang Ersterfassung Die Bestandserfassung
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt Leben im Wald. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt Leben im Wald Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Reihe: Veränderbare Arbeitsblätter für
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt Leben im Wald Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Reihe: Veränderbare Arbeitsblätter für
Jahrestagung Aktuelle Beiträge zur Spechtforschung. Projektgruppe Spechte der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft und Nationalpark Harz
 Jahrestagung 2008 Aktuelle Beiträge zur Spechtforschung Projektgruppe Spechte der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft und Nationalpark Harz Herausgegeben von der Schriftenreihe aus dem Nationalpark Harz
Jahrestagung 2008 Aktuelle Beiträge zur Spechtforschung Projektgruppe Spechte der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft und Nationalpark Harz Herausgegeben von der Schriftenreihe aus dem Nationalpark Harz
Legekreis Heimische Vögel
 Legekreis Heimische Vögel Susanne Schäfer www.zaubereinmaleins.de www.zaubereinmaleins.de Das Rotkehlchen ist ein Singvogel und gehört zur Familie der Drosseln. Es hat eine orangerote Brust, Kehle und
Legekreis Heimische Vögel Susanne Schäfer www.zaubereinmaleins.de www.zaubereinmaleins.de Das Rotkehlchen ist ein Singvogel und gehört zur Familie der Drosseln. Es hat eine orangerote Brust, Kehle und
Der Hausrotschwanz. Familie: Fliegenschnäpper. Länge: 14cm Gewicht: 14-20g
 Kartei von Vera Deutsch 2006 Der Hausrotschwanz Länge: 14cm Gewicht: 14-20g Familie: Fliegenschnäpper Das Männchen ist schwarzgrau mit schwarzer Kehle, weißer Flügelspitze und einem rostrotem Schwanz.
Kartei von Vera Deutsch 2006 Der Hausrotschwanz Länge: 14cm Gewicht: 14-20g Familie: Fliegenschnäpper Das Männchen ist schwarzgrau mit schwarzer Kehle, weißer Flügelspitze und einem rostrotem Schwanz.
Handbuch der Vögel Mitteleuropas
 Handbuch der Vögel Mitteleuropas Herausgegeben von URS N. GLUTZ VON BLOTZHEIM Bearbeitet von URS N. GLUTZ VON BLOTZHEIM KURT M.BAUER unter Mitwirkung von MICHAEL ABS, EINHARD BEZZEL, DIETER BLUME, KLAUS
Handbuch der Vögel Mitteleuropas Herausgegeben von URS N. GLUTZ VON BLOTZHEIM Bearbeitet von URS N. GLUTZ VON BLOTZHEIM KURT M.BAUER unter Mitwirkung von MICHAEL ABS, EINHARD BEZZEL, DIETER BLUME, KLAUS
Europäische Vogelschutzgebiete und ihre Bedeutung für Waldvogelarten
 Europäische Vogelschutzgebiete und ihre Bedeutung für Waldvogelarten Bestandsentwicklung von Waldvogelarten in Deutschland IBA und SPA in Bayern Bedeutung einzelner Waldgebiete für den Vogelschutz Umsetzung
Europäische Vogelschutzgebiete und ihre Bedeutung für Waldvogelarten Bestandsentwicklung von Waldvogelarten in Deutschland IBA und SPA in Bayern Bedeutung einzelner Waldgebiete für den Vogelschutz Umsetzung
Faktensammlung zur Dritten Bundeswaldinventur (BWI 3) für Mecklenburg-Vorpommern
 Faktensammlung zur Dritten Bundeswaldinventur (BWI 3) für Mecklenburg-Vorpommern Erhebungsmethodik BWI Großrauminventur auf Stichprobenbasis. Ziel Erfassung der aktuellen Waldverhältnisse und Produktionsmöglichkeiten
Faktensammlung zur Dritten Bundeswaldinventur (BWI 3) für Mecklenburg-Vorpommern Erhebungsmethodik BWI Großrauminventur auf Stichprobenbasis. Ziel Erfassung der aktuellen Waldverhältnisse und Produktionsmöglichkeiten
Spechte in Nordrhein- Westfalen
 Spechte in Nordrhein- Westfalen Dr. Joachim Weiss Waldverbreitung in 1 NRW-BVA 15-20 BR 2 Wendehals Areal: Nordwestgrenze Besiedlungsfläche: aktuell nur noch 2 regelmäßige Vorkommen TÜP/Heidegebiete/VSchG
Spechte in Nordrhein- Westfalen Dr. Joachim Weiss Waldverbreitung in 1 NRW-BVA 15-20 BR 2 Wendehals Areal: Nordwestgrenze Besiedlungsfläche: aktuell nur noch 2 regelmäßige Vorkommen TÜP/Heidegebiete/VSchG
Projekt: Höhlenbäume im urbanen Raum
 Projekt: Höhlenbäume im urbanen Raum Präsentation Werkstattgespräch HVNL, 27.11.13 Christa Mehl-Rouschal Untere Naturschutzbehörde Arten- u. Biotopschutz 2 Gliederung - Ziel des Gutachtens - Vorgeschichte
Projekt: Höhlenbäume im urbanen Raum Präsentation Werkstattgespräch HVNL, 27.11.13 Christa Mehl-Rouschal Untere Naturschutzbehörde Arten- u. Biotopschutz 2 Gliederung - Ziel des Gutachtens - Vorgeschichte
Erstellt mit dem Worksheet Crafter - Zwickzwack Mappe. Niederösterreich. Die 4 Viertel.
 Erstellt mit dem Worksheet Crafter - www.worksheetcrafter.com Zwickzwack Mappe Niederösterreich Die 4 Viertel www.lernfrosch.jimdo.com Erstellt mit dem Worksheet Crafter - www.worksheetcrafter.com www.lernfrosch.jimdo.com
Erstellt mit dem Worksheet Crafter - www.worksheetcrafter.com Zwickzwack Mappe Niederösterreich Die 4 Viertel www.lernfrosch.jimdo.com Erstellt mit dem Worksheet Crafter - www.worksheetcrafter.com www.lernfrosch.jimdo.com
Eulen des Burgwalds. Warum sind Eulen so interessant?
 Eulen des Burgwalds Vom König und vom Kobold der Nacht Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.v., Lindenstr. 5, 61209 Echzell Arbeitskreis Marburg-Biedenkopf, In den Erlengärten 10,
Eulen des Burgwalds Vom König und vom Kobold der Nacht Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.v., Lindenstr. 5, 61209 Echzell Arbeitskreis Marburg-Biedenkopf, In den Erlengärten 10,
LEBENSRAUM LANDSCHAFTS- ELEMENTE 6-10 SACH INFORMATION NATURNAHE LEBENSRÄUME
 SACH INFORMATION Für den Landwirt sind Landschaftselemente oft Hindernisse bei der Bewirtschaftung und Flächenräuber. Für die Tier- und Pflanzenwelt sind sie wichtige Lebensräume. Für den Betrachter einer
SACH INFORMATION Für den Landwirt sind Landschaftselemente oft Hindernisse bei der Bewirtschaftung und Flächenräuber. Für die Tier- und Pflanzenwelt sind sie wichtige Lebensräume. Für den Betrachter einer
Biodiversität im Siedlungsraum: Zustand und Potenziale
 Biodiversität im Siedlungsraum: Zustand und Potenziale Manuela Di Giulio Natur Umwelt Wissen GmbH Siedlungen: Himmel oder Hölle? Wirkungsmechanismen unklar, Aussagen teilweise widersprüchlich Methodische
Biodiversität im Siedlungsraum: Zustand und Potenziale Manuela Di Giulio Natur Umwelt Wissen GmbH Siedlungen: Himmel oder Hölle? Wirkungsmechanismen unklar, Aussagen teilweise widersprüchlich Methodische
Der Kormoran in der Steiermark
 Der Kormoran in der Steiermark Ein Überblick über Bestandsentwicklung und Verbreitung. Sebastian Zinko Inhalt Allgemeines Verbreitung Bestandsentwicklung Jahreszeitliches Auftreten Herkunft unserer Kormorane
Der Kormoran in der Steiermark Ein Überblick über Bestandsentwicklung und Verbreitung. Sebastian Zinko Inhalt Allgemeines Verbreitung Bestandsentwicklung Jahreszeitliches Auftreten Herkunft unserer Kormorane
Übersicht. Vogel des Jahres Biologie der Mehlschwalbe Lebensraum Gefährdung Schutzmassnahmen
 Übersicht Vogel des Jahres Biologie der Mehlschwalbe Lebensraum Gefährdung Schutzmassnahmen Mehlschwalbe als Vogel des Jahres 2010 Im Internationalen Jahr der Biodiversität wirbt die Mehlschwalbe für mehr
Übersicht Vogel des Jahres Biologie der Mehlschwalbe Lebensraum Gefährdung Schutzmassnahmen Mehlschwalbe als Vogel des Jahres 2010 Im Internationalen Jahr der Biodiversität wirbt die Mehlschwalbe für mehr
Familie Thaller vlg. Wratschnig
 Natur auf unserem Betrieb Impressum: Herausgeber: Arge NATURSCHUTZ und LFI Kärnten; Für den Inhalt verantwortlich: Mag. Margret Dabernig; Text und Layout: Mag. Margret Dabernig und Fam. Thaller; Fotos:
Natur auf unserem Betrieb Impressum: Herausgeber: Arge NATURSCHUTZ und LFI Kärnten; Für den Inhalt verantwortlich: Mag. Margret Dabernig; Text und Layout: Mag. Margret Dabernig und Fam. Thaller; Fotos:
Hirschkäfer, Lucanus cervus
 Hirschkäfer, Lucanus cervus Johann August Rösel von Rosenhof (1705 1759) Abbildung aus: Insectenbelustigung, Rösel von Rosenhof, 1705-1759 (1978) Workshop Biologie und Schutz xylobionter Käfer am Beispiel
Hirschkäfer, Lucanus cervus Johann August Rösel von Rosenhof (1705 1759) Abbildung aus: Insectenbelustigung, Rösel von Rosenhof, 1705-1759 (1978) Workshop Biologie und Schutz xylobionter Käfer am Beispiel
Alte Bäume Zentren der Artenvielfalt
 Alte Bäume Zentren der Artenvielfalt Hubert Weiger Vorsitzender BUND BN 10.04.2008 25.06.2008 Die Lage alter Wälder in Mitteleuropa ist. sehr kritisch Wälder mit alten Bäumen und Strukturen der Altersphase
Alte Bäume Zentren der Artenvielfalt Hubert Weiger Vorsitzender BUND BN 10.04.2008 25.06.2008 Die Lage alter Wälder in Mitteleuropa ist. sehr kritisch Wälder mit alten Bäumen und Strukturen der Altersphase
r e b s r e l l a b e i r t e b t s r , h c s e l e t t i M n i r e t i e l r e i v e r, s s i e w a s i l önnen. hützen zu k
 der wald lebt Lebensräume erhalten und verbessern, Vielfalt gewährleisten und fördern: Das ist der Kern unserer Arbeit. Wir wollen keine räumliche Trennung der wirtschaftlichen und ökologischen Aufgaben
der wald lebt Lebensräume erhalten und verbessern, Vielfalt gewährleisten und fördern: Das ist der Kern unserer Arbeit. Wir wollen keine räumliche Trennung der wirtschaftlichen und ökologischen Aufgaben
Artenschutzfachliche Ergebnisse für den Bebauungsplan 1-35 ba Kulturforum, Berlin-Tiergarten
 Artenschutzfachliche Ergebnisse für den Bebauungsplan 1-35 ba Kulturforum, Berlin-Tiergarten 1. Methodisches Vorgehen zur Erfassung der Avifauna Als Methode für die Erfassung der Brutvögel kam die Revierkartierung
Artenschutzfachliche Ergebnisse für den Bebauungsplan 1-35 ba Kulturforum, Berlin-Tiergarten 1. Methodisches Vorgehen zur Erfassung der Avifauna Als Methode für die Erfassung der Brutvögel kam die Revierkartierung
aufgestellt: Weilheim a.d. Teck, den
 ro 061352 01.04.2015 Stadt Ebersbach Erschließung Sulpacher Straße aufgestellt: Weilheim a.d. Teck, den 01.04.2015 SI Beratende Ingenieure GmbH+Co.KG Bahnhofstraße 4 73235 Weilheim a.d. Teck Seite 1 von
ro 061352 01.04.2015 Stadt Ebersbach Erschließung Sulpacher Straße aufgestellt: Weilheim a.d. Teck, den 01.04.2015 SI Beratende Ingenieure GmbH+Co.KG Bahnhofstraße 4 73235 Weilheim a.d. Teck Seite 1 von
An die Stadt Ettenheim Fachbereich III Stadtentwicklung/Bauen/Umwelt Rohanstraße Ettenheim z.hd. Herrn Bauch / Schoor 5.04.
 An die Stadt Ettenheim Fachbereich III Stadtentwicklung/Bauen/Umwelt Rohanstraße 16 77955 Ettenheim z.hd. Herrn Bauch / Schoor 5.04.2013 Artenschutzrechtliche Vorprüfung für die Erweiterung des Gewerbegebietes
An die Stadt Ettenheim Fachbereich III Stadtentwicklung/Bauen/Umwelt Rohanstraße 16 77955 Ettenheim z.hd. Herrn Bauch / Schoor 5.04.2013 Artenschutzrechtliche Vorprüfung für die Erweiterung des Gewerbegebietes
DR. JÜRGEN MARX, JÖRG RATHGEBER, DR. MICHAEL WAITZMANN REFERAT 25 ARTEN- UND FLÄCHENSCHUTZ, LANDSCHAFTSPFLEGE
 AuT-Konzept, Anh. IV-Arten, MaP, ASP... Noch mehr Artenschutz? (!) DR. JÜRGEN MARX, JÖRG RATHGEBER, DR. MICHAEL WAITZMANN REFERAT 25 ARTEN- UND FLÄCHENSCHUTZ, LANDSCHAFTSPFLEGE Arten in Baden-Württemberg
AuT-Konzept, Anh. IV-Arten, MaP, ASP... Noch mehr Artenschutz? (!) DR. JÜRGEN MARX, JÖRG RATHGEBER, DR. MICHAEL WAITZMANN REFERAT 25 ARTEN- UND FLÄCHENSCHUTZ, LANDSCHAFTSPFLEGE Arten in Baden-Württemberg
Aeshna subarctica Hochmoor-Mosaikjungfer
 150 Libellen Österreichs Aeshna subarctica Hochmoor-Mosaikjungfer Diese Art ist in Österreich vorwiegend in den Alpen anzutreffen. Verbreitung und Bestand Die Hochmoor-Mosaikjungfer ist ein eurosibirisches
150 Libellen Österreichs Aeshna subarctica Hochmoor-Mosaikjungfer Diese Art ist in Österreich vorwiegend in den Alpen anzutreffen. Verbreitung und Bestand Die Hochmoor-Mosaikjungfer ist ein eurosibirisches
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Würzburg. Markt Höchberg WALDNATURSCHUTZ IM GEMEINDEWALD
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Würzburg Markt Höchberg WALDNATURSCHUTZ IM GEMEINDEWALD Foto: Wolfgang Fricker Eiche Hainbuche Rotbuche Der Gemeinde-wald Höchberg Der Gemeindewald Höchberg
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Würzburg Markt Höchberg WALDNATURSCHUTZ IM GEMEINDEWALD Foto: Wolfgang Fricker Eiche Hainbuche Rotbuche Der Gemeinde-wald Höchberg Der Gemeindewald Höchberg
Erfassung Hügelbauende Waldameisen 2011
 Erfassung Hügelbauende Waldameisen 11 Inhalt: 1. Einleitung 1.1 Was wird erfasst 1.2 Wie wird erfasst 1.3 Wann wird erfasst 1.4 Erfasste Fläche 2. Ergebnisse der Erfassung 11 2.1 Verteilung der Arten 2.2
Erfassung Hügelbauende Waldameisen 11 Inhalt: 1. Einleitung 1.1 Was wird erfasst 1.2 Wie wird erfasst 1.3 Wann wird erfasst 1.4 Erfasste Fläche 2. Ergebnisse der Erfassung 11 2.1 Verteilung der Arten 2.2
Plenterwaldstudie im Bezirk Bregenz
 Plenterwaldstudie im Bezirk Bregenz Was versteht man unter einem Plenterwald? Bei einem Plenterwald existieren alle Entwicklungsstufen der Bäume nebeneinander. Dadurch entsteht auf kleinster Fläche eine
Plenterwaldstudie im Bezirk Bregenz Was versteht man unter einem Plenterwald? Bei einem Plenterwald existieren alle Entwicklungsstufen der Bäume nebeneinander. Dadurch entsteht auf kleinster Fläche eine
Ergänzungssatzung Sandackerstraße, Gemeinde Kusterdingen, Gemarkung Jettenburg
 Potenzialabschätzung Artenschutz Ergänzungssatzung Sandackerstraße, Gemeinde Kusterdingen, Gemarkung Jettenburg 12. November 2014 Auftraggeber: Künster Architektur + Stadtplanung Bismarckstrasse 25 72764
Potenzialabschätzung Artenschutz Ergänzungssatzung Sandackerstraße, Gemeinde Kusterdingen, Gemarkung Jettenburg 12. November 2014 Auftraggeber: Künster Architektur + Stadtplanung Bismarckstrasse 25 72764
Biodiversität im Wald was ist zu tun? Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz Werner Müller / Christa Glauser
 Biodiversität im Wald was ist zu tun? Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz Werner Müller / Christa Glauser Schematischer Zyklus in einem Naturwald mit den wichtigen Strukturelementen für die Biodiversität
Biodiversität im Wald was ist zu tun? Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz Werner Müller / Christa Glauser Schematischer Zyklus in einem Naturwald mit den wichtigen Strukturelementen für die Biodiversität
Wald 1) : Mehrere bis viele Hektar große Flächen, die mit Bäumen unterschiedlicher
 Kulturhistorischer Rahmenplan 1 2 3 4 Callenberger Forst - Wildpark 273 Callenberger Forst 275 Coburger Forst Nordwest 277 Weihersholz - Spitzacker 279 Wald 1) : Mehrere bis viele Hektar große Flächen,
Kulturhistorischer Rahmenplan 1 2 3 4 Callenberger Forst - Wildpark 273 Callenberger Forst 275 Coburger Forst Nordwest 277 Weihersholz - Spitzacker 279 Wald 1) : Mehrere bis viele Hektar große Flächen,
Einfluss des Mikroklimas auf xylobionte Käfergemeinschaften
 Umweltforschungsplan 2011 FKZ 3511 86 0200 Anpassungskapazität ausgewählter Arten im Hinblick auf Änderungen durch den Klimawandel Einfluss des Mikroklimas auf xylobionte Käfergemeinschaften Elisabeth
Umweltforschungsplan 2011 FKZ 3511 86 0200 Anpassungskapazität ausgewählter Arten im Hinblick auf Änderungen durch den Klimawandel Einfluss des Mikroklimas auf xylobionte Käfergemeinschaften Elisabeth
GLB Schubertgrund Lichtenstein
 GLB Schubertgrund Lichtenstein Naturschutzfachliche Würdigung des Gebietes vor einer geplanten Durchforstung Bearbeitung: Elmar Fuchs, Dipl.-Ing. (FH) Landschaftsnutzung & Naturschutz Datum: 25.07.2017
GLB Schubertgrund Lichtenstein Naturschutzfachliche Würdigung des Gebietes vor einer geplanten Durchforstung Bearbeitung: Elmar Fuchs, Dipl.-Ing. (FH) Landschaftsnutzung & Naturschutz Datum: 25.07.2017
Ökologische Potentialanalyse
 K M B Kerker, Müller + Braunbeck Freie Architekten Stadtplaner und beratende Ingenieure Architektur, Stadtplanung, Innenarchitektur, Vermessung, Landschaftsarchitektur, Tiefbauplanung, Strassenplanung
K M B Kerker, Müller + Braunbeck Freie Architekten Stadtplaner und beratende Ingenieure Architektur, Stadtplanung, Innenarchitektur, Vermessung, Landschaftsarchitektur, Tiefbauplanung, Strassenplanung
Für die Artenschutzprüfung relevante Schutzkategorien / Planungsrelevante Arten
 Für die Artenschutzprüfung relevante Schutzkategorien / Planungsrelevante Arten 16./17.09.2015 Dr. Ernst-Friedrich Kiel MKULNV, Referat III-4 (Biotop- und Artenschutz, Natura 2000, Klimawandel und Naturschutz,
Für die Artenschutzprüfung relevante Schutzkategorien / Planungsrelevante Arten 16./17.09.2015 Dr. Ernst-Friedrich Kiel MKULNV, Referat III-4 (Biotop- und Artenschutz, Natura 2000, Klimawandel und Naturschutz,
Gerhard Egger Prioritäre Handlungsfelder für den Naturschutz in den March-Thaya-Auen
 Gerhard Egger 28.05.10 Prioritäre Handlungsfelder für den Naturschutz in den March-Thaya-Auen Motivation 13 Lebensraumtypen (Anhang 1 FFH-RL) und 65 Arten (Anhang 2 FFH-RL) 53 Biotoptpyen, 46 Säugetiere,
Gerhard Egger 28.05.10 Prioritäre Handlungsfelder für den Naturschutz in den March-Thaya-Auen Motivation 13 Lebensraumtypen (Anhang 1 FFH-RL) und 65 Arten (Anhang 2 FFH-RL) 53 Biotoptpyen, 46 Säugetiere,
Abschlussbericht 2016
 Wiederansiedelung des Wiedehopfs Abschlussbericht 2016 Gefördert mit Mitteln des Förderprogramms Biosphärengebiet Schwäbische Alb Titelfoto: Wiedehopf in Kohlberg, NABU Neuffen-Beuren Projektidee: Bis
Wiederansiedelung des Wiedehopfs Abschlussbericht 2016 Gefördert mit Mitteln des Förderprogramms Biosphärengebiet Schwäbische Alb Titelfoto: Wiedehopf in Kohlberg, NABU Neuffen-Beuren Projektidee: Bis
Windpark-Planung Denklingen-Fuchstal
 Windpark-Planung Denklingen-Fuchstal Ergebnisse der Untersuchungen zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (sap) 12.02.2014 Untersuchungen zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung nach 44 BNatschG
Windpark-Planung Denklingen-Fuchstal Ergebnisse der Untersuchungen zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (sap) 12.02.2014 Untersuchungen zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung nach 44 BNatschG
FFH-LEBENSRAUMTYPEN IM WALD & ART. 17-BERICHT
 FFH-LEBENSRAUMTYPEN IM WALD & ART. 17-BERICHT MARIA STEJSKAL-TIEFENBACH, THOMAS ELLMAUER FFH-LEBENSRAUMTYPEN IM WALD INHALT Wald in Österreich Waldtypen und Wald-Lebensraumtypen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
FFH-LEBENSRAUMTYPEN IM WALD & ART. 17-BERICHT MARIA STEJSKAL-TIEFENBACH, THOMAS ELLMAUER FFH-LEBENSRAUMTYPEN IM WALD INHALT Wald in Österreich Waldtypen und Wald-Lebensraumtypen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
Schwalben willkommen!
 Schwalben willkommen! Inhalt Erster Teil 1. Schwalben - allgemeine Informationen Systematik Merkmale Verbreitung Schwalbenvorkommen in Brandenburg 2. Rauchschwalbe 3. Mehlschwalbe 4. Uferschwalbe 5. Gefährdungsursachen
Schwalben willkommen! Inhalt Erster Teil 1. Schwalben - allgemeine Informationen Systematik Merkmale Verbreitung Schwalbenvorkommen in Brandenburg 2. Rauchschwalbe 3. Mehlschwalbe 4. Uferschwalbe 5. Gefährdungsursachen
NATURWALDRESERVAT WOLFSEE
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen NATURWALDRESERVAT WOLFSEE Naturwaldreservat Wolfsee Der Wolfsee gab dem Reservat seinen Namen. ALLGEMEINES Das Naturwaldreservat Wolfsee liegt im
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen NATURWALDRESERVAT WOLFSEE Naturwaldreservat Wolfsee Der Wolfsee gab dem Reservat seinen Namen. ALLGEMEINES Das Naturwaldreservat Wolfsee liegt im
NEUES ZUHAUSE FÜR DEN WALDKAUZ
 Der Wohnungsnot entgegenwirken TREUER MIETER Einmal eingezogen, bleibt der Waldkauz als Standvogel das ganze Jahr über in seinem Revier. Untersuchungen zufolge verbrachten sogar 80 bis 90 Prozent der beringten
Der Wohnungsnot entgegenwirken TREUER MIETER Einmal eingezogen, bleibt der Waldkauz als Standvogel das ganze Jahr über in seinem Revier. Untersuchungen zufolge verbrachten sogar 80 bis 90 Prozent der beringten
Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 55 khz
 Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 55 khz - Spannweite 19 cm - Gewicht 4 Gramm - Farbe: Rücken schwarzbraun, Bauch etwas heller, Flughäute und Ohren schwärzlich, generell etwas heller als ihre Zwillingsart
Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 55 khz - Spannweite 19 cm - Gewicht 4 Gramm - Farbe: Rücken schwarzbraun, Bauch etwas heller, Flughäute und Ohren schwärzlich, generell etwas heller als ihre Zwillingsart
Stadt Jüterbog B-Plan Nr. 038 Wohngebiet Fuchsberge/Weinberge. Artenschutzrechtliche Beurteilung
 Stadt Jüterbog B-Plan Nr. 038 Wohngebiet Fuchsberge/Weinberge Artenschutzrechtliche Beurteilung Mai 2015 Stadt Jüterbog B-Plan Nr. 038 Wohngebiet Fuchsberge/Weinberge Artenschutzrechtliche Beurteilung
Stadt Jüterbog B-Plan Nr. 038 Wohngebiet Fuchsberge/Weinberge Artenschutzrechtliche Beurteilung Mai 2015 Stadt Jüterbog B-Plan Nr. 038 Wohngebiet Fuchsberge/Weinberge Artenschutzrechtliche Beurteilung
Wildnisgebietskonzept NRW
 Wildnisgebietskonzept NRW Dr. Martin Woike Abteilungsleiter Forsten, Naturschutz, MKULNV NRW Vortrag anlässlich des Winterkolloquiums der Universität Freiburg am 28.01.2011 Natura 2000 in NRW Schutzgebiete
Wildnisgebietskonzept NRW Dr. Martin Woike Abteilungsleiter Forsten, Naturschutz, MKULNV NRW Vortrag anlässlich des Winterkolloquiums der Universität Freiburg am 28.01.2011 Natura 2000 in NRW Schutzgebiete
Adalbert Niemeyer-Lüllwitz Kleine Flächen Große Wirkung Der Wert naturnaher Geländegestaltung NUA-Tagung , Duisburg
 Kleine Flächen Große Wirkung Der Wert naturnaher Geländegestaltung NUA-Tagung 29.04.2015, Duisburg Foto: A. Niemeyer-Lüllwitz Kleine Flächen an der NUA Was bedeutet naturnahes Grün in der Stadt? Was bedeutet
Kleine Flächen Große Wirkung Der Wert naturnaher Geländegestaltung NUA-Tagung 29.04.2015, Duisburg Foto: A. Niemeyer-Lüllwitz Kleine Flächen an der NUA Was bedeutet naturnahes Grün in der Stadt? Was bedeutet
DR. MICHAEL WAITZMANN REFERAT 25 ARTEN- UND FLÄCHENSCHUTZ, LANDSCHAFTSPFLEGE
 Erfolgreicher Naturschutz ohne Artenwissen? DR. MICHAEL WAITZMANN REFERAT 25 ARTEN- UND FLÄCHENSCHUTZ, LANDSCHAFTSPFLEGE Beispiele aus dem amtlichen Natur- und Artenschutz Arten- und Biotopschutzprogramm
Erfolgreicher Naturschutz ohne Artenwissen? DR. MICHAEL WAITZMANN REFERAT 25 ARTEN- UND FLÄCHENSCHUTZ, LANDSCHAFTSPFLEGE Beispiele aus dem amtlichen Natur- und Artenschutz Arten- und Biotopschutzprogramm
Wie lange bleiben Baumstöcke dem Ökosystem Wald erhalten?
 GErHarD NIESE Wie lange bleiben Baumstöcke dem Ökosystem Wald erhalten? Wie lange verbleiben die mit dem Boden verbundenen Reste der gefällten Bäume im Bestand? Welche Bedeutung haben Baumart und Seehöhe?
GErHarD NIESE Wie lange bleiben Baumstöcke dem Ökosystem Wald erhalten? Wie lange verbleiben die mit dem Boden verbundenen Reste der gefällten Bäume im Bestand? Welche Bedeutung haben Baumart und Seehöhe?
Eine Initiative der NaturFreunde
 Eine Initiative der NaturFreunde Natura 2000 Bedeutend aber unbekannt Um dem stetigen Rückgang der biologischen Vielfalt entgegenzuwirken, wurden durch die EU auf einer Fläche von knapp 950 000 km 2 mehr
Eine Initiative der NaturFreunde Natura 2000 Bedeutend aber unbekannt Um dem stetigen Rückgang der biologischen Vielfalt entgegenzuwirken, wurden durch die EU auf einer Fläche von knapp 950 000 km 2 mehr
Schwarzspecht. Gestatten, mein Name ist Specht. Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz
 Gestatten, mein Name ist Specht Schwarzspecht Andreas Schoellhorn Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz Wiedingstr. 78 Postfach CH-8036 Zürich Tel 044 457 70 20 Fax 044 457 70 30 www.birdlife.ch svs@birdlife.ch
Gestatten, mein Name ist Specht Schwarzspecht Andreas Schoellhorn Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz Wiedingstr. 78 Postfach CH-8036 Zürich Tel 044 457 70 20 Fax 044 457 70 30 www.birdlife.ch svs@birdlife.ch
Übersicht. Langzeitunterstudien am Mittelspecht. 1. Mittelspecht in Hessen. 2. Habitatansprüche
 Langzeitunterstudien am Mittelspecht Nümbrecht 15.03.2013 Dr. Rolf Hennes Bad Homburg hennes-keidel@t-online.de Übersicht 1. Mittelspecht in Hessen 2. Habitatansprüche 3. Fehlermöglichkeiten bei klassischen
Langzeitunterstudien am Mittelspecht Nümbrecht 15.03.2013 Dr. Rolf Hennes Bad Homburg hennes-keidel@t-online.de Übersicht 1. Mittelspecht in Hessen 2. Habitatansprüche 3. Fehlermöglichkeiten bei klassischen
EINGRIFFS-AUSGLEICHS-REGELUNG
 EINGRIFFS-AUSGLEICHS-REGELUNG Fachtagung 11. Dezember 2009 Redoutensäle, Promenade 39, 4020 Linz Referent: Dr. Thomas Wrbka Thema: Landschaft unter Druck Landnutzung und biologische Vielfalt im Spiegel
EINGRIFFS-AUSGLEICHS-REGELUNG Fachtagung 11. Dezember 2009 Redoutensäle, Promenade 39, 4020 Linz Referent: Dr. Thomas Wrbka Thema: Landschaft unter Druck Landnutzung und biologische Vielfalt im Spiegel
INFO. Spechte. Suchbegriffe. Allgemeine Info
 INFO Spechte Suchbegriffe Spechte, Erdspechte, Hackspechte, Trommeln, Ringeln, Fassadenschäden, Höhlenbau, Höhlenbrüter, Wald Allgemeine Info Spechte leben in Wäldern und Gehölzen. Keine Vogelgruppe ist
INFO Spechte Suchbegriffe Spechte, Erdspechte, Hackspechte, Trommeln, Ringeln, Fassadenschäden, Höhlenbau, Höhlenbrüter, Wald Allgemeine Info Spechte leben in Wäldern und Gehölzen. Keine Vogelgruppe ist
Naturwaldreservate als Datenbasis zur Einschätzung natürlicher Waldentwicklungen in einem künftigen Nationalpark
 Naturwaldreservate als Datenbasis zur Einschätzung natürlicher Waldentwicklungen Dr. Patricia Balcar Dr. Patricia Balcar AUSWEISUNGEN VON NATURWALDRESERVATEN IN RHEINLAND-PFALZ aus der Nutzung genommen
Naturwaldreservate als Datenbasis zur Einschätzung natürlicher Waldentwicklungen Dr. Patricia Balcar Dr. Patricia Balcar AUSWEISUNGEN VON NATURWALDRESERVATEN IN RHEINLAND-PFALZ aus der Nutzung genommen
Mauserumfang und Altersbestimmung von Spechten
 Mauserumfang und Altersbestimmung von Spechten Spechte haben 10 Handschwingen, die zehnte (äusserste) ist stark reduziert und im Jugendkleid länger als im Adultkleid. Sie haben 6 Armschwingen (AS 1 6)
Mauserumfang und Altersbestimmung von Spechten Spechte haben 10 Handschwingen, die zehnte (äusserste) ist stark reduziert und im Jugendkleid länger als im Adultkleid. Sie haben 6 Armschwingen (AS 1 6)
NATURWALDRESERVAT WEIHERBUCHET
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Weilheim i. OB NATURWALDRESERVAT WEIHERBUCHET Naturwaldreservat Weiherbuchet Flache Terrassen und steile Wälle der Endmoräne prägen das Reservat. ALLGEMEINES
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Weilheim i. OB NATURWALDRESERVAT WEIHERBUCHET Naturwaldreservat Weiherbuchet Flache Terrassen und steile Wälle der Endmoräne prägen das Reservat. ALLGEMEINES
& ) %*#+( %% * ' ),$-#. '$ # +, //$ ' ' ' ' %0 -. % ( #+$1 $$! / 0# ' $ " ' #) % $# !! # ' +!23!4 * ' ($!#' (! " # $ & - 2$ $' % & " $ ' '( +1 * $ 5
 !"!! # " # $% $ & $$% % & " $ ' '( &% % # ) # $ ' #% $ $$ $ (! ' #%#'$ & ) %*#+( %% * ' ) $-#. '$ # + //$ ' ' ' ' %0 -. % ( #+$1 $$! / 0# ' $ " ' #) % $# 0+ ' +!23!4 * ' ($!#' (! ) ' $1%%$( - 2$ $' +1
!"!! # " # $% $ & $$% % & " $ ' '( &% % # ) # $ ' #% $ $$ $ (! ' #%#'$ & ) %*#+( %% * ' ) $-#. '$ # + //$ ' ' ' ' %0 -. % ( #+$1 $$! / 0# ' $ " ' #) % $# 0+ ' +!23!4 * ' ($!#' (! ) ' $1%%$( - 2$ $' +1
Nachhaltige Waldwirtschaft aus Sicht der Naturschutzverbände
 Nachhaltige Waldwirtschaft aus Sicht der Naturschutzverbände 90 % naturnaher Wirtschaftswald 10 % Urwälder (von morgen) Florian Schöne Waldverteilung heute Ca. 31 % der Landfläche Walz et al. 2013 PNV
Nachhaltige Waldwirtschaft aus Sicht der Naturschutzverbände 90 % naturnaher Wirtschaftswald 10 % Urwälder (von morgen) Florian Schöne Waldverteilung heute Ca. 31 % der Landfläche Walz et al. 2013 PNV
Natura Vogelschutzgebiete
 Natura 2000 - Vogelschutzgebiete Region Doupovské hory und Krušné hory (Erzgebirge) Vít Tejrovský Agentur zum Schutz der Natur und Landschaft der Tschechichen Republik Landschaftsschutzgebiet Labské pískovce
Natura 2000 - Vogelschutzgebiete Region Doupovské hory und Krušné hory (Erzgebirge) Vít Tejrovský Agentur zum Schutz der Natur und Landschaft der Tschechichen Republik Landschaftsschutzgebiet Labské pískovce
Baumtorso Krone abgebrochen, Spechtloch in Schadstelle große Höhle, Schwarzspecht möglich, Nutzspuren 3 3
 Esche ausgefaultes Astloch 3 1 Esche Spechthöhle in ausgefaultem Astloch frische Hackspuren 3 2 Baumtorso Krone abgebrochen, Spechtloch in Schadstelle große Höhle, Schwarzspecht möglich, Nutzspuren 3 3
Esche ausgefaultes Astloch 3 1 Esche Spechthöhle in ausgefaultem Astloch frische Hackspuren 3 2 Baumtorso Krone abgebrochen, Spechtloch in Schadstelle große Höhle, Schwarzspecht möglich, Nutzspuren 3 3
Vogel des Jahres Kletterer - Trommler - Schmied - Höhlenbauer Der Buntspecht
 Vogel des Jahres 2016 Kletterer - Trommler - Schmied - Höhlenbauer Der Buntspecht Der Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz hat uns dieses Jahr zu Botschaftern für den Erhalt von grossen alten Bäumen
Vogel des Jahres 2016 Kletterer - Trommler - Schmied - Höhlenbauer Der Buntspecht Der Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz hat uns dieses Jahr zu Botschaftern für den Erhalt von grossen alten Bäumen
B-PLAN NR. 15 DER STADT GEHRDEN, ORTSCHAFT LEVESTE
 B-PLAN NR. 15 DER STADT GEHRDEN, ORTSCHAFT LEVESTE Bestandserfassung und Bewertung der planungsrelevanten Populationen von und Feldvögeln in 2016 AUFGABENSTELLUNG: Am östlichen Ortsrand von Leveste ist
B-PLAN NR. 15 DER STADT GEHRDEN, ORTSCHAFT LEVESTE Bestandserfassung und Bewertung der planungsrelevanten Populationen von und Feldvögeln in 2016 AUFGABENSTELLUNG: Am östlichen Ortsrand von Leveste ist
BESONDERS ERHALTENSWERTE BIOTOPBÄUME AUF DEM EV. ALTER LUISENSTADT-FRIEDHOF AN DER BERGMANNSTRASSE IM BERLINER BEZIRK FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG
 BESONDERS ERHALTENSWERTE BIOTOPBÄUME AUF DEM EV. ALTER LUISENSTADT-FRIEDHOF AN DER BERGMANNSTRASSE IM BERLINER BEZIRK FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG I. BEDEUTUNG DES FRIEDHOFS II. METHODIK UND ERGEBNISSE DER
BESONDERS ERHALTENSWERTE BIOTOPBÄUME AUF DEM EV. ALTER LUISENSTADT-FRIEDHOF AN DER BERGMANNSTRASSE IM BERLINER BEZIRK FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG I. BEDEUTUNG DES FRIEDHOFS II. METHODIK UND ERGEBNISSE DER
Obwohl Österreich sehr dicht besiedelt ist, kommt auf jeden Bundesbürger fast ein halber Hektar Wald.
 1. Wald in Österreich Österreich ist mit rund 4 Millionen Hektar Waldfläche - das ist mit 47,6 Prozent nahezu die Hälfte des Bundesgebietes - eines der waldreichsten Länder der EU. Der durchschnittliche
1. Wald in Österreich Österreich ist mit rund 4 Millionen Hektar Waldfläche - das ist mit 47,6 Prozent nahezu die Hälfte des Bundesgebietes - eines der waldreichsten Länder der EU. Der durchschnittliche
Zustand der Waldvogelarten in Österreich
 Zustand der Waldvogelarten in Österreich Norbert Teufelbauer & Gábor Wichmann Biodiversität im Wald netzwerk zukunftsraum land 4.5.2017, Salzburg Zustand Waldvogelarten Einfache Frage längere Antwort Zustand
Zustand der Waldvogelarten in Österreich Norbert Teufelbauer & Gábor Wichmann Biodiversität im Wald netzwerk zukunftsraum land 4.5.2017, Salzburg Zustand Waldvogelarten Einfache Frage längere Antwort Zustand
Pfiffner & Birrer Projekt «Mit Vielfalt punkten»
 «Mit Vielfalt Punkten (MVP)» Ein Forschungs- und Umsetzungsprojekt (2009 2016) Lukas Pfiffner & Simon Birrer Biodiversität Grundlage Ökosystemleistungen Natürliche Bestäubung, Schädlingsregulation, fruchtbarer
«Mit Vielfalt Punkten (MVP)» Ein Forschungs- und Umsetzungsprojekt (2009 2016) Lukas Pfiffner & Simon Birrer Biodiversität Grundlage Ökosystemleistungen Natürliche Bestäubung, Schädlingsregulation, fruchtbarer
BIOTOP KARTIERUNG BAYERN
 BIOTOP KARTIERUNG BAYERN Biotope sind Lebensräume. Der Begriff Biotop setzt sich aus den griechischen Wörtern bios, das Leben und topos, der Raum zusammen, bedeutet also Lebensraum. Lebensraum für eine
BIOTOP KARTIERUNG BAYERN Biotope sind Lebensräume. Der Begriff Biotop setzt sich aus den griechischen Wörtern bios, das Leben und topos, der Raum zusammen, bedeutet also Lebensraum. Lebensraum für eine
Tal der Fledermäuse: Urwald-Fledermaus nachgewiesen
 19.02.2015 Tal der Fledermäuse: Urwald-Fledermaus nachgewiesen Forschungsprojekt von Land NÖ und Bundesforsten in Europaschutzgebiet - 22 seltene Fledermausarten - Sensationeller Nachweis des Veilchenblauen
19.02.2015 Tal der Fledermäuse: Urwald-Fledermaus nachgewiesen Forschungsprojekt von Land NÖ und Bundesforsten in Europaschutzgebiet - 22 seltene Fledermausarten - Sensationeller Nachweis des Veilchenblauen
05 Artenschutzrechtliche Vorprüfung
 GROSSE KREISSTADT WAGHÄUSEL 05 Artenschutzrechtliche Vorprüfung zum Bebauungsplan Gewerbepark Eremitage Teilbereich I, 2. Änderung im beschleunigten Verfahren gem. 13a BauGB 21.04.2017 Projekt: 1750 Bearbeiter:
GROSSE KREISSTADT WAGHÄUSEL 05 Artenschutzrechtliche Vorprüfung zum Bebauungsplan Gewerbepark Eremitage Teilbereich I, 2. Änderung im beschleunigten Verfahren gem. 13a BauGB 21.04.2017 Projekt: 1750 Bearbeiter:
Ablaufplan eines Elternabends Kennenlernen von PSE-Methodentraining
 Ablaufplan eines Elternabends Kennenlernen von PSE-Methodentraining Um unsere Eltern über das Projekt zu informieren, wurden alle Eltern der Klassen, die an dem Projekt teilnehmen, eingeladen. Da unsere
Ablaufplan eines Elternabends Kennenlernen von PSE-Methodentraining Um unsere Eltern über das Projekt zu informieren, wurden alle Eltern der Klassen, die an dem Projekt teilnehmen, eingeladen. Da unsere
Der Gartenrotschwanz braucht unsere Hilfe!
 Der Gartenrotschwanz braucht unsere Hilfe! Der Gartenrotschwanz - ein kleiner, Insekten fressender Singvogel, müsste dem Namen nach eigentlich in jedem Garten zu finden sein. Leider ist dies jedoch längst
Der Gartenrotschwanz braucht unsere Hilfe! Der Gartenrotschwanz - ein kleiner, Insekten fressender Singvogel, müsste dem Namen nach eigentlich in jedem Garten zu finden sein. Leider ist dies jedoch längst
Jagd und Umwelt. Hofkirchen 1960
 Jagd und Umwelt Die Jagdausübung in Hofkirchen unterlag in den letzten Jahrzehnten großen Veränderungen. Einen wesentlichen Einfluss auf die Landschaft und dementsprechend auf den Lebensraum unserer Wildtiere
Jagd und Umwelt Die Jagdausübung in Hofkirchen unterlag in den letzten Jahrzehnten großen Veränderungen. Einen wesentlichen Einfluss auf die Landschaft und dementsprechend auf den Lebensraum unserer Wildtiere
Verbreitung. Riesa. Freiberg
 Hertweck & Hieke: Auswertung der Wildtiererfassung 2000 / 2001 Rothirsch - Cervus elaphus Linnaeus, 1758 Verbreitung Verbreitungsgebiet auch Standwild entsprechende Der Rothirsch ist als zweitgrößte europäische
Hertweck & Hieke: Auswertung der Wildtiererfassung 2000 / 2001 Rothirsch - Cervus elaphus Linnaeus, 1758 Verbreitung Verbreitungsgebiet auch Standwild entsprechende Der Rothirsch ist als zweitgrößte europäische
Kartierungsarbeiten zu Flora und Fauna Welche Tiere leben unter der derzeitigen Hochstraße
 Kartierungsarbeiten zu Flora und Fauna Welche Tiere leben unter der derzeitigen Hochstraße Nord und welche Pflanzen haben sich dort angesiedelt? Gibt es Arten, die einen besonderen Schutz genießen? Mit
Kartierungsarbeiten zu Flora und Fauna Welche Tiere leben unter der derzeitigen Hochstraße Nord und welche Pflanzen haben sich dort angesiedelt? Gibt es Arten, die einen besonderen Schutz genießen? Mit
Folge 7: Naturerlebnispfad im Freizeitpark Marienfelde
 Folge 7: Naturerlebnispfad im Freizeitpark Marienfelde Der Ausflug führt nach Marienfelde in den Diedersdorfer Weg im Bezirk Tempelhof- Schöneberg. Hier befindet sich der Freizeitpark Marienfelde. Von
Folge 7: Naturerlebnispfad im Freizeitpark Marienfelde Der Ausflug führt nach Marienfelde in den Diedersdorfer Weg im Bezirk Tempelhof- Schöneberg. Hier befindet sich der Freizeitpark Marienfelde. Von
STATION 1: MISCHWALD
 STATION 1: MISCHWALD ENTSPANNEN ERLEBEN ACHTSAMKEIT WAHRNEHMUNG 10 MIN JEDES ALTER ABBILD DER NATUR Achtsames Betrachten LEBENSRAUM: WIESE WALD SEE BERG FLUSS/BACH Betrachten Sie ein Naturphänomen, das
STATION 1: MISCHWALD ENTSPANNEN ERLEBEN ACHTSAMKEIT WAHRNEHMUNG 10 MIN JEDES ALTER ABBILD DER NATUR Achtsames Betrachten LEBENSRAUM: WIESE WALD SEE BERG FLUSS/BACH Betrachten Sie ein Naturphänomen, das
Vogelschutz und Forstwirtschaft (k)ein Widerspruch?
 Stiftung Fürst Liechtenstein Guts- und Forstbetrieb Wilfersdorf Vogelschutz und Forstwirtschaft (k)ein Widerspruch? Praxisbeispiele von der Stiftung Fürst Liechtenstein Wilfersdorf Dir. Dipl.Ing. Hans
Stiftung Fürst Liechtenstein Guts- und Forstbetrieb Wilfersdorf Vogelschutz und Forstwirtschaft (k)ein Widerspruch? Praxisbeispiele von der Stiftung Fürst Liechtenstein Wilfersdorf Dir. Dipl.Ing. Hans
Bayerisches Landesamt für Umwelt
 NATURA 2000 - Vogelarten Alpenschneehuhn (Lagopus mutus) Das Alpenschneehuhn trägt im Winter bis auf die Schwanzfedern ein weißes Federkleid. Im Sommer sind nur die Flügel weiß, das restliche Federkleid
NATURA 2000 - Vogelarten Alpenschneehuhn (Lagopus mutus) Das Alpenschneehuhn trägt im Winter bis auf die Schwanzfedern ein weißes Federkleid. Im Sommer sind nur die Flügel weiß, das restliche Federkleid
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag. zu den Brutvögeln und Fledermäusen. für das B-Plangebiet "Wilstedter Straße" in Tarmstedt.
 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zu den Brutvögeln und Fledermäusen für das B-Plangebiet "Wilstedter Straße" in Tarmstedt Phase I Erstellt für die Gemeinde Tarmstedt durch MEYER Biologische Gutac & RAHMEL
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zu den Brutvögeln und Fledermäusen für das B-Plangebiet "Wilstedter Straße" in Tarmstedt Phase I Erstellt für die Gemeinde Tarmstedt durch MEYER Biologische Gutac & RAHMEL
Projekt: Neubau Flusskraftwerk Mühlau
 Projekt: Neubau Flusskraftwerk Mühlau Bericht: Ökologische Aufwertung und Projektbegleitung / Faunistisches Monitoring 2012 (Teilprojekt des Projektes Natur pur an Necker und Thur ) Thurlauf im Gebiet
Projekt: Neubau Flusskraftwerk Mühlau Bericht: Ökologische Aufwertung und Projektbegleitung / Faunistisches Monitoring 2012 (Teilprojekt des Projektes Natur pur an Necker und Thur ) Thurlauf im Gebiet
Fenster auf! Für die Feldlerche.
 Fenster auf! Für die Feldlerche. Mit wenig Aufwand viel erreichen Jan-Uwe Schmidt, Pirna, 05.03.2015 Foto: Bodenbrüterprojekt, M. Dämmig Im Auftrag von: Hintergründe Lebensraum Acker Ackerland umfasst
Fenster auf! Für die Feldlerche. Mit wenig Aufwand viel erreichen Jan-Uwe Schmidt, Pirna, 05.03.2015 Foto: Bodenbrüterprojekt, M. Dämmig Im Auftrag von: Hintergründe Lebensraum Acker Ackerland umfasst
Ressourcenprojekt zur Erhaltung und Förderung der gefährdeten Schweizer Ackerbegleitflora. Fotodokumentation einiger Zielarten
 Ressourcenprojekt zur Erhaltung und Förderung der gefährdeten Schweizer Ackerbegleitflora Fotodokumentation einiger Zielarten Auf den folgenden Seiten werden einige repräsentative Vertreter der einheimischen
Ressourcenprojekt zur Erhaltung und Förderung der gefährdeten Schweizer Ackerbegleitflora Fotodokumentation einiger Zielarten Auf den folgenden Seiten werden einige repräsentative Vertreter der einheimischen
GESTALTUNG DER YBBSMÜNDUNG
 Impressum: Herausgeber: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung Abteilung Wasserbau Landhausplatz 1 3109 St. Pölten Redaktion: Thomas Kaufmann Erich Czeiner Erhard Kraus Fotos: Bauer/ Kaufmann (freiwasser),
Impressum: Herausgeber: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung Abteilung Wasserbau Landhausplatz 1 3109 St. Pölten Redaktion: Thomas Kaufmann Erich Czeiner Erhard Kraus Fotos: Bauer/ Kaufmann (freiwasser),
nachhaltig malen lesen verstehen
 nachhaltig malen lesen verstehen Dieses Heft gehört:... Liebe Eltern! Liebe Lehrerinnen und Lehrer! Dieses Heft soll Kindern das Thema Nachhaltigkeit an Hand des Waldes und seiner Bewirtschaftung näher
nachhaltig malen lesen verstehen Dieses Heft gehört:... Liebe Eltern! Liebe Lehrerinnen und Lehrer! Dieses Heft soll Kindern das Thema Nachhaltigkeit an Hand des Waldes und seiner Bewirtschaftung näher
Deklaration Biologische Vielfalt in Kommunen. Veröffentlicht am Internationalen Tag der Biodiversität am 22. Mai 2010
 Deklaration Veröffentlicht am Internationalen Tag der Biodiversität am 22. Mai 2010 Die biologische Vielfalt ist bedroht Die biologische Vielfalt, d. h. die Vielfalt innerhalb der Arten, zwischen den Arten
Deklaration Veröffentlicht am Internationalen Tag der Biodiversität am 22. Mai 2010 Die biologische Vielfalt ist bedroht Die biologische Vielfalt, d. h. die Vielfalt innerhalb der Arten, zwischen den Arten
Das Tagebuch einer Kohlmeise
 Igisch Clara 7eO6 LMRL 2006-2007 Das Tagebuch einer Kohlmeise Beschreibung Kohlmeise (lux.: Schielmees, Kuelmees) Systematik Klasse: Vögel (Aves) Unterklasse: Neukiefervögel (Neognathae) Ordnung: Sperlingsvögel
Igisch Clara 7eO6 LMRL 2006-2007 Das Tagebuch einer Kohlmeise Beschreibung Kohlmeise (lux.: Schielmees, Kuelmees) Systematik Klasse: Vögel (Aves) Unterklasse: Neukiefervögel (Neognathae) Ordnung: Sperlingsvögel
Haese Büro für Umweltplanung
 . Haese Büro für Umweltplanung Von-Werner-Straße 34 52222 Stolberg/Rhld Tel.: 02402/12757-0 mobil: 0162-2302085 e-mail: bfu-wieland@t-online.de 73. Änderung des Flächennutzungsplans, nördl. Teil (Stadt
. Haese Büro für Umweltplanung Von-Werner-Straße 34 52222 Stolberg/Rhld Tel.: 02402/12757-0 mobil: 0162-2302085 e-mail: bfu-wieland@t-online.de 73. Änderung des Flächennutzungsplans, nördl. Teil (Stadt
WAS IST NATURA 2000 WAS KANN NATURA 2000?
 WAS IST NATURA 2000 WAS KANN NATURA 2000? NÖ NATURSCHUTZTAG 2017 Thomas Ellmauer NATURA 2000 POLARISIERT 2 WAS IST NATURA 2000 WAS KANN NATURA 2000? NATURA 2000 IST eine modernes, auf wissenschaftlichen
WAS IST NATURA 2000 WAS KANN NATURA 2000? NÖ NATURSCHUTZTAG 2017 Thomas Ellmauer NATURA 2000 POLARISIERT 2 WAS IST NATURA 2000 WAS KANN NATURA 2000? NATURA 2000 IST eine modernes, auf wissenschaftlichen
Wasserstraßen-Neubauamt Magdeburg Kleiner Werder 5c 39114 Magdeburg Telefon: 03 91-5 35-0 www.wna-magdeburg.de info@wna-md.wsd.de
 Wasserstraßen-Neubauamt Magdeburg Kleiner Werder 5c 39114 Magdeburg Telefon: 03 91-5 35-0 www.wna-magdeburg.de info@wna-md.wsd.de Impressum Herausgeber: Wasserstraßen-Neubauamt Magdeburg Stand: Oktober
Wasserstraßen-Neubauamt Magdeburg Kleiner Werder 5c 39114 Magdeburg Telefon: 03 91-5 35-0 www.wna-magdeburg.de info@wna-md.wsd.de Impressum Herausgeber: Wasserstraßen-Neubauamt Magdeburg Stand: Oktober
Gemeinde Wain, Neubaugebiet Brühl, 2. Bauabschnitt Artenschutz-Problematik
 Gemeinde Wain, Neubaugebiet Brühl, 2. Bauabschnitt Artenschutz-Problematik Auftraggeber: Ing.büro Wassermüller Ulm GmbH Hörvelsinger Weg 44 89081 Ulm 30.09.2017 Anlass: Die Gemeinde Wain will innerorts
Gemeinde Wain, Neubaugebiet Brühl, 2. Bauabschnitt Artenschutz-Problematik Auftraggeber: Ing.büro Wassermüller Ulm GmbH Hörvelsinger Weg 44 89081 Ulm 30.09.2017 Anlass: Die Gemeinde Wain will innerorts
24 Bäume, davon 13 Bäume alt. 1 Nussbaum, sonst verschiedenen Sorten Apfelbäume. Grünspecht.
 Objekt Nr.: Objekt-Kategorie: OG_01 Obstgarten Koordinaten: 671187/251347 Parzelle: 9205 Fläche: 3900 m 2 Grundeigentümer: Stadt Dietikon Zone: Landwirtschaftszone Datum: 02.10.2013 Status Objektblatt:
Objekt Nr.: Objekt-Kategorie: OG_01 Obstgarten Koordinaten: 671187/251347 Parzelle: 9205 Fläche: 3900 m 2 Grundeigentümer: Stadt Dietikon Zone: Landwirtschaftszone Datum: 02.10.2013 Status Objektblatt:
Managementplanung Leitsakgraben. Managementplanung Natura 2000 im Land Brandenburg
 Managementplanung Natura 2000 im Land Managementplan für das FFH-Gebiet Leitsakgraben DE 3343-301 1 Gliederung der Präsentation Darstellung der Erhaltungszustände Maßnahmenvorschläge Entwicklungsziele
Managementplanung Natura 2000 im Land Managementplan für das FFH-Gebiet Leitsakgraben DE 3343-301 1 Gliederung der Präsentation Darstellung der Erhaltungszustände Maßnahmenvorschläge Entwicklungsziele
