AUSGABE 24/ OKTOBER 2014 STERBEHILFE. Das Onlinemagazin zur Gesundheitspolitik
|
|
|
- Sophie Jaeger
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 STERBEHILFE Das Onlinemagazin zur Gesundheitspolitik
2 Inhalt Inhaltsverzeichnis Seite Plattform Gesundheit IKK e.v. Titelstory Sterbehilfe... 4 Kommunikation... 8 Berichte 11. Plattform Gesundheit IKK e.v. Delegation und Substitution brauchen wir immer einen Arzt? AstraZeneca Arzneimittelversorgung in der Onkologie Seite 14 AstraZeneca Arzneimittelversorgung in der Onkologie Nachrichten BVMed-Herbstumfrage zur Lage der MedTech-Branche Qualitätsorientierte Versorgungssteuerung und Vergütung Positionen des GKV-SV TK Meinungsimpuls Seite 20 TK Meinungsimpuls
3 Inhalt vdek Krankenhausplanung Planen nach Qualität und Erreichbarkeit Seite 22 vdek Krankenhausplanung 2.0 DAK-Gesundheit und Lilly Symposium Zukunft Demenz Leben mit Schizophrenie die entscheidende Rolle der Angehörigen AG Zukunft des Gesundheitswesens Gesundheitswirtschaft zwischen Kosten- und Qualitätsinteressen BZgA und PKV - Älter werden in Balance Seite 24 DAK-Gesundheit und Lilly Symposium Zukunft Demenz Boulevard Parlamentarischer Abend des BKK Dachverbands Parlamentarischer Abend der deutschen industriellen Gesundheitswirtschaft...38 Impressum...45 Seite 34 Parlamentarischer Abend des BKK Dachverband 3
4 TITELSTORY Sterbehilfe Wie schon in den letzten Legislaturperioden wurde jetzt wieder das Thema Sterbehilfe auf die Tagesordnung gesetzt und zwar entsprechend Beschluss und Zeitplan der geschäftsführenden Vorstände von CDU/CSU und SPD Fraktion vom 29. April 2014, nach dem im 4. Quartal 2014 die Gruppenfindung und die Erarbeitung der einzelnen Gesetzentwürfe auf dem Programm steht. Die 1. Lesung soll laut Plan im 1. Quartal 2015 stattfinden, die Anhörung im 2. Quartal, 2./3. Lesung im 3. Quartal Insofern ein völlig normaler parlamentarischer Vorgang. In diesem Beschluss heißt es: Über das Thema Sterbehilfe wird emotional und kontrovers diskutiert. Es stellt jeden Menschen vor existenzielle Fragen. In Deutschland ist die aktive Sterbehilfe als Tötung auf Verlangen strafbar. Straffrei hingegen ist die Beihilfe zur Selbsttötung, auch assistierter Suizid genannt. Seit einigen Jahren sind in Deutschland Vereinigungen aktiv, die Hilfeleistungen zur Selbsttötung anbieten. Wir müssen als Gesellschaft daher die Entscheidung treffen, ob wir diese Art von Sterbehilfe wollen. Diese ethische Grundfrage soll jede Abgeordnete und jeder Abgeordneter für sich selbst beantworten. Zugleich halten wir eine umfassende Auseinandersetzung mit den ethischen und rechtlichen Fragen im Parlament und auch außerhalb für erforderlich. Die Grundfrage, die die Fraktionsvorstände politisch und rechtlich geklärt haben wollen, ist anscheinend die Frage, ob Vereine wie Sterbehilfe Deutschland verboten werden sollen, eine Frage, die man auch isoliert entscheiden könnte, ohne das gesamte Fass Sterbehilfe aufzumachen. Darüber hinaus will man anscheinend den ärztlich assistierten Suizid gesetzlich und nicht nur durch höchstrichterlichen Spruch als straffrei verankern und damit die Ärzteschaft in eine Art Zugzwang bringen, ihr Standesrecht zu ändern und in allen Landesärztekammern das Standesrecht zu vereinheitlichen. Inzwischen beginnt sich die Diskussion, auch durch eine öffentliche Debatte zu verselbständigen, wie auch nicht anders, auch nicht von den Fraktionsvorständen zu erwarten war. Dies war laut Beschluss der geschäftsführenden Vorstände der Koalitionsfraktionen sogar intendiert. Als man diesen Diskussionsprozess in Gang setzte, hat man sich sicherlich zuvor der unterschiedlichen Lager in einer solchen, existenzielle Fragen berührenden Debatte und der Mehrheit im Parlament versichert, zumal man diesen gegen Ende der letzten Legislaturperiode auf Eis gelegt hatte. Neben Hardlinern, die nicht nur den assistierten Suizid, sondern auch wenn dies unrealistisch ist am liebsten noch die indirekte Sterbehilfe, am besten auch noch die passive Sterbehilfe unter Strafe stellen wollen, und den in dieser Frage Liberalen, die 4
5 TITELSTORY vielleicht sogar eine aktive Sterbehilfe tolerieren würden, die aber aus unterschiedlichen Gründen wahrscheinlich keinen Gruppenantrag stellen werden, befindet sich in der Mitte zwischen diesen Positionen wohl die Gruppe von Abgeordneten, die den assistierten Suizid befürworten, aber eine aktive Sterbehilfe ablehnen. Sie dürften wohl die meisten Abgeordneten hinter sich scharen können. Protagonisten dieser Gruppe sind Carola Reimann, Karl Lauterbach, Burkhard Lischka, Katharina Reiche und Dagmar Wöhrl, die mit ihrem Papier Sterben in Würde vom in der Bundespressekonferenz die öffentliche Debatte eröffnen wollten. Sie wollen den heute schon straffreien assistierten Suizid weiter straffrei stellen, aber dessen Voraussetzungen detailliert regeln, derart detailliert, dass man den Eindruck gewinnen könnte, dass für sie die Alltagspraxis und deren Unwägbarkeiten in den Hintergrund gerückt ist. Vehement wehren sich zur Zeit die Bundesärztekammer und einige Landesärztekammern gegen das Vorhaben dieser Gruppe. So argumentiert Frank Ulrich Montgomery, dieser Vorschlag münde in die Freigabe der aktiven Sterbehilfe, er mache den assistierten Suizid gesellschaftsfähig, die Grenze zur Tötung auf Verlangen sei damit überschritten, der Deutsche Ärztetag habe sich 2011 mit einer dreiviertel Mehrheit dagegen entschieden. Daher sei Ärzten die aktive Sterbehilfe via Berufsrecht verboten. Dahingestellt, dass man unter aktiver Sterbehilfe gemeinhin etwas anderes versteht als den assistierten Suizid, ist diese Position durchaus verständlich. Man muss sich nur das national-sozialistische Erbe der Deutschen Ärzteschaft ins Gedächtnis rufen, das bis heute nur bruchstückhaft aufgearbeitet ist und manchem sicherlich noch wie ein Albtraum tief in den Knochen steckt und auch stecken sollte. Zudem widerspricht ein assistierter Suizid dem immer noch vorherrschenden, zumindest theoretischen Selbstverständnis der verfassten Ärzteschaft. Insofern ist diese Position verständlich mit Blick auf Weiterungen in Richtung aktiver Sterbehilfe, die manch einer fürchten mag. Etliche andere Ärztefunktionäre denken mit ebenso gutem Grund in dieser Frage völlig anders. Sie wollen die Freiheit eines Menschen, sein Leben zu leben oder im Wissen um einen unentrinnbaren, schmerzhaften und grausamen Tod zu sterben, achten und ihnen nicht ärztliche Hilfe versagen. Auch diese Position ist eine honorige Position, für die vieles, auch das menschliche Mitgefühl für Sterbende und ihre Angehörigen spricht und die dem Ideal der Barmherzigkeit entspricht. Sterbehilfe ist eben kein Thema, das man mit schlichten Klischees und einfachen Lösungen abhandeln kann, für das es kein einfaches richtig und falsch geben kann. An diesem Thema könnte sich ein beinahe unlösbarer Konflikt zwischen Politik und Ärzteschaft entzünden, da von der Politik offensichtlich erwartet wird, dass die Ärzteschaft ihr Standesrecht bei entsprechenden parlamentarischen Mehrheiten für die oben skizzierte Position ändert. 5
6 TITELSTORY Kann Standesrecht aber nicht etwas untersagen, was nicht strafbewährt ist? Andererseits hat schon jemand seine/ ihre Approbation verloren, weil er oder sie einem Suizid assistierte? Könnte vielleicht die gesamte Debatte in eine falsche Richtung laufen, weil die gesetzten Prämissen den Sachverhalt nicht treffen, nicht treffen können? Es stellt sich aber auch die Frage, ob denn tatsächlich Regelungsbedarf besteht? Manchmal hilft ein Blick in die Realität, in die Praxis, um diese Fragen zu beantworten und von dort aus weiter zu denken. Passive Sterbehilfe ist in Deutschland Gang und Gäbe und laut eines Urteils des Bundesgerichtshofs erlaubt und wird Tag für Tag in Krankenhäusern, in Hospizen, Heimen und auch durch das Sterben im eigenen Heim praktiziert. Die Politik hat einen entsprechenden Rahmen schon gesetzt. Auch die indirekte Sterbehilfe ist straffrei, auch dies hat der Bundesgerichtshof entschieden. Viele haben diese Form der letzten Begleitung eines Sterbenden durch Ärzte und Pflegepersonal in der eigenen Familie, im eigenen Umfeld erlebt und gesehen, wie dankbar Sterbende und ihre Familien diese Hilfe angenommen haben. Gegner der indirekten Sterbehilfe ignorieren oder verdrängen sie, selbst wenn sie im engsten Umfeld der Familie praktiziert wurde. Diese beiden Formen von Sterbehilfe sind für Dogmatiker eines natürlichen Todes schon eine deutliche Überschreitung der Grenzen von Sterbenden, Angehörigen, Ärzten und Pflegepersonal, aus bestimmten Traditionen wie z.b. einem fundamentalistischen Christentum heraus nachvollziehbar. Wer aber jemals ein schweres Sterben miterlebt hat, dem werden Fundamentalpositionen weniger bedeuten als menschliches Mitgefühl und Barmherzigkeit. Denkt man dieses Problem logisch durch, ist der assistierte Suizid nichts anderes als ein Vorwegnehmen der indirekten Sterbehilfe durch den Sterbenden selbst, zudem sind hier die Grenzen fließend. Also warum ein ausgefeiltes Regelwerk und nicht für die doch viel häufiger praktizierte indirekte Sterbehilfe? Die einzige Antwort kann sein, dass im Fall der indirekten Sterbehilfe die Agonie schon den Sterbenden ergriffen hat, nicht aber beim assistierten Suizid. Dieser Unterschied liegt wahrscheinlich nur in einer situativen Betrachtung, die aber in der Wirklichkeit durchaus praktikabel ist. Ein assistierter Suizid ist für Menschen, deren Krankheit weit fortgeschritten ist, oft die einzige Möglichkeit, nicht unendlich lange zu siechen und findet auch in der Wirklichkeit öfter statt, als die reine Lehre vermuten lässt. Hier ist menschliches Mitgefühl und Barmherzigkeit oft stärker als Angst vor dem Standesrecht. Zudem auch das wissen Praktiker besser als alle anderen mit Fallkonstruktionen ist die Unterschiedlichkeit der Fälle in der Wirklichkeit niemals auch nur grob kategorisierbar, was aber für rechtliche Regelungen Voraussetzung ist. Dies gilt für viele Lebensbereiche, aber was die Sterbehilfe angeht, ist es existenziell und 6
7 TITELSTORY besonders komplex wie in nur wenigen anderen Bereichen. Ein völlig anderer Fall ist die aktive Sterbehilfe, die nach 216 StGB mit bis zu 5 Jahren Freiheitsentzug geahndet wird. Hier übernimmt ein anderer das Töten vollständig, aber auch hier konnte man Fälle liebevoller Zuwendung z.b. von Seiten liebender Ehepartner oder Kinder erleben, die bereit waren, für ihre Taten Gefängnisstrafen auf sich zu nehmen. Anders verhält es sich mit einer aktiven Sterbehilfe, die sich isoliert und ausschließlich mit Sterbehilfe befasst, wie Sterbehilfevereine, die Bezüge des Sterbewilligen, sein Umfeld und seinen tatsächlichen Gesundheitszustand nur peripher kennen können. Es ist nachvollziehbar, dass aktive Sterbehilfe bestraft wird und es wäre deshalb auch folgerichtig, Vereine für aktive Sterbehilfe zu verbieten. Auch darf niemandem zugemutet werden, aktiv Sterbehilfe zu leisten. Leider lässt sich ebenso vernünftig eine Gegenposition aufbauen. Auch wird man aktive Sterbehilfe nicht verhindern können, denn in anderen europäischen Ländern ist sie erlaubt. Ähnliches haben wir seinerzeit mit dem 218-Tourismus in die Niederlande erlebt, als Kliniken an der Grenze zu Deutschland beinahe ausschließlich von deutschen Frauen aufgesucht wurden. Das Feld Sterbehilfe ist demnach ein weitaus schwierigeres Gelände, als es bei ersten Überlegungen erscheint, und letztlich rechtlich, auch standesrechtlich nur schwer fassbar. Dieses Feld darf weder ein Tummelplatz für Dogmatiker, noch für Leichtfertige werden. Ein gewisser rechtlicher Rahmen ist notwendig, aber den hat der Bundesgerichtshof schon gesetzt. Er hat damit auch die Rolle der Ärzte beschrieben, die wertvolle Hilfe leisten können. Die letzte Entscheidung müssen aber der Sterbende, seine Angehörigen und der Sterbehilfeleistende treffen und dies ist eine Entscheidung nach moralischen Kriterien und nicht nach rechtlichen. Moral ist bekanntermaßen kein Spielplatz für Dogmatiker oder Oberflächliche. Moralisches Handeln bedeutet, immer dann, wenn man darüber nachdenken muss, was das richtige Handeln ist, vorher Güter abzuwägen. Dies sind hier das Recht auf Leben, die Unversehrtheit der Person, das Verbot zu töten und andererseits das Recht auf die freie Entscheidung, nicht qualvoll sterben zu wollen, Angehörige nicht unnötig und ohne Ausweg leiden zu sehen, dem Sterbenden voller Mitleid und Barmherzigkeit auf seinem letzten Weg zu begleiten. Moral kann das Recht, der Staat nicht verordnen oder gar erzwingen, sondern nur Legalität. Der Gesetzgeber und die höchstrichterliche Rechtsprechung haben dazu schon den Rahmen, die Grenzen dessen, was legal ist und was nicht, hinreichend vorgegeben. Auch eine Suizidprävention, für die Gegenbeispiele angeführt werden können, ist kein 7
8 TITELSTORY / KOMMUNIKATION Argument dafür, hier weiteren Regulierungsbedarf zu reklamieren. Was jetzt noch zusätzlich geregelt werden soll, wird in der Realität nichts verändern und in einer Vielzahl der Fälle nicht greifen und damit wird auch noch das freiwillige Sterben mit bürokratischen Vorgaben versehen. Will man Sterbehilfevereine verbieten, dann soll man dies mit den entsprechenden Mehrheiten im Parlament verabschieden. Will man Ärztekammern zwingen, das Standesrecht zu ändern, dann sollte man dies mit Hinweis auf geltendes Recht durchsetzen. Aber die Achtung vor einem selbstbestimmten Leben und Sterben darf nicht aus der moralischen Verantwortung des Einzelnen und dessen Privatheit in bürokratische Regulierungen gezogen werden. Dies widerspricht der Idee einer freiheitlichen Gesellschaft. Diese Debatte und die Abstimmung wird wohl keine Sternstunde des Parlaments werden, wie auf der Pressekonferenz von einer Abgeordneten geäußert. Die Abstimmung im Deutschen Bundestag soll im 3. Quartal 2015 stattfinden und man kann schon heute erahnen, welche Gruppe die Mehrheit erhalten wird. Es wird, es kann für dieses Thema keinen Fraktionszwang geben, die Abgeordneten werden nur ihrem Gewissen verantwortlich sein, so sehen es auch die Fraktionsvorstände, was trotz des ernsten, existenziellen Themas schmunzeln lässt. Sollten Abgeordnete nicht immer ihrem Gewissen und nur ihrem Gewissen verantwortlich sein? Liebe Leserin, lieber Leser, der Schätzerkreis hat gesprochen, 0,9% Zusatzbeitrag ist das Maß aller Dinge und oh Wunder, das BMG hat mit seinen Vorausberechnungen völlig richtig gelegen! Mit der Veröffentlichung hat der Schätzerkreis auch den Startschuss zum Tanz um das goldene Kalb eröffnet und im Krankenkassenlager herrscht dementsprechend erhebliche Unruhe. Nicht nur die Gehälterdiskussion treibt die Krankenkassen, ihre Vorstände und die Selbstverwalter um, sondern vielmehr, ob sie den Beitragssatz halten können, ob sie Beiträge über den besagten 0,9% nehmen müssen oder ob sie sogar den Beitragssatz senken können. 8
9 KOMMUNIKATION Der kassenindividuelle Beitragssatz wird noch viel Unruhe ins System bringen, einige Kapriolen sind zu erwarten. Da wird prophylaktisch schon in diesem, aber sicher im nächsten Jahr die eine oder andere Satzungsleistung gestrichen werden, und der Sparkommissar wird in etlichen, vor allem in einigen großen Versorgerkassen, vor allem in jenen, die nicht aus dem Morbi-RSA beglückt werden, den Rotstift ansetzen müssen. Manche sehen auch schon die eine oder andere Fusion aus Not am Horizont aufleuchten. Dies alles wird die Gehälterdiskussion wahrscheinlich nicht überdecken, sondern eher noch anheizen. Andere Krankenkassen werden den Beitrag senken können, und schon hat die erste, die AOK Plus, angekündigt, dass ihr Beitrag zum von 15,5% auf 14,9% sinken wird, sie ihre Mitglieder um 250 Mio. entlastet und sie außerdem 5,6% mehr für Leistungen ausgeben wird. Dies alles soll stabil über das Jahr 2015 bleiben. Die AOK Plus hofft, ihren Marktanteil mit diesen Maßnahmen von 48% auf über 50% zu erhöhen. Dies ist eine Kampfansage an die anderen Krankenkassen in Sachsen und Thüringen. Die meisten werden sich noch erinnern, wie die gute finanzielle Lage der Krankenkassen, insbesondere der AOKen in den neuen Bundesländern entstanden ist, aber dies spielt heute keine Rolle mehr. Es kommt Bewegung in die Krankenkassenlandschaft, eine Bewegung, die einiges durchwirbeln dürfte und vielleicht sogar den einen oder anderen ins Trudeln bringen könnte. Trotz vollmundiger Aussagen der Politik darf im Grunde niemand daran Interesse haben, aber dies scheint zur Zeit niemanden zu bekümmern. Ob dies klug ist oder gar der Verbesserung der Versorgung dient, darf mit Recht bezweifelt werden, und spielt letztlich nur denen in die Hände, die einer Vielfalt selbstverwalteter Krankenkassen einerseits und einer privaten Säule der Krankenversicherung, das heutige System, sowohl von der einen wie von der anderen Seite den Garaus machen wollen. Versorgung ist dann nur Beiwerk. Ihr highlights team 9
10 BERICHTE Quelle: IKK e.v. 11. Plattform Gesundheit IKK e.v. Delegation und Substitution brauchen wir immer einen Arzt? Berlin, Auch in dieser Legislaturperiode sind Delegation und Substitution ärztlicher Leistungen als politisches Thema gesetzt. Die Vorgaben des Koalitionsvertrags zur Förderung qualifizierter nichtärztlicher Gesundheitsberufe sollen mit dem GKV-VSG umgesetzt werden. Gelegenheit zur Positionierung in diesem immer noch stark verminten Gelände bot die 11. Plattform Gesundheit des IKK e.v. mit dem sicherlich Einige provozierenden Titel Delegation und Substitution Brauchen wir immer einen Arzt? Hans-Jürgen Müller (IKK e.v.); Quelle: IKK e.v. 10
11 BERICHTE In seiner Begrüßung führte Hans-Jürgen Müller kurz in die Thematik ein. Arbeiten im Auftrag des Arztes, sprich Delegation, sei mittlerweile in Klinik und Arztpraxis Alltag. Anders sehe es für die Substitution aus, der Verlagerung von bisher allein dem Arzt vorbehaltenen Tätigkeiten auf nichtärztliche Gesundheitsberufe. Dazu gehörten Diagnose, die Wahl der Behandlung und die Verschreibung. Die entsprechenden Entscheidungen würde im Rahmen der Substitution nicht mehr der Arzt, sondern die Pflegekraft, der Physiotherapeut oder in Zukunft vielleicht auch der Gesundheitshandwerker treffen. Alle Akteure im Gesundheitswesen seien in dieser Frage gefordert und müssten mehr denn je zusammenarbeiten, um den Problemen einer alternden Gesellschaft gerecht zu werden. Aus Sicht der Versicherten seien Standesdebatten unter diesen Rahmenbedingungen nicht nachvollziehbar. Gesundheitsberufe, prädestiniert für dieses Thema, für die Unionsfraktion. Im Fokus der Diskussion müsse die Gewährleistung einer guten Behandlung stehen, entsprechend seien die Ziele, die erreicht werden müssten, zu definieren. Man müsse tragfähige Modelle entwickeln und die Kollegen an der Basis mitnehmen. Wichtig seien eine messbare, nachweisbare Qualität, eine gute Kommunikation und eine transparente Dokumentation, außerdem das Vertrauen der Ärzte, aber auch der Krankenkassen als Zahler. Elisabeth Scharfenberg (MdB Bündnis 90/Die Grünen); Quelle: IKK e.v. Roy Kühne (MdB CDU); Quelle: IKK e.v. Höchst pragmatisch argumentierte Roy Kühne, Berichterstatter für die Themen Heil- und Hilfsmittel und nichtärztliche In der Zielvorgabe, nämlich vom Patienten her zu denken, stimmte die pflegepolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, Elisabeth Scharfenberg, mit ihrem Vorredner noch überein. Das war aber auch schon das Ende der Gemeinsamkeiten. Die Politik wolle, so Elisabeth Scharfenberg weiter, in Modellvorhaben eine selbständige Ausübung der Heilkunde durch Pflegekräfte erproben. In der Realität sei ihr aber kein entsprechendes Modellprojekt bekannt. Die Ärzteschaft wehre sich mit 11
12 BERICHTE Händen und Füßen gegen derartige Projekte. Ziel müsse eine Kooperation auf Augenhöhe sein, keine bloße Verschiebung von Tätigkeiten. ein riesiger europäischer Dampfer längst volle Fahrt aufgenommen, die Klärung der Zuständigkeiten liege längst nicht mehr in nationaler Hoheit. Die Mobilität in der EU sei nicht zu unterschätzen, Stichworte seien Bologna-Prozess, Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit. Man könne heute aber schon funktionierende Modelle von anderen Ländern übernehmen, z.b. den Beruf des Arztassistenten. Seine abschließende These: Wenn Politik und Ärzte dieses Feld nicht proaktiv beackerten, werde sich ein Wildwuchs entwickeln, der für die Bevölkerung gefährlich werden könnte. Karl-Ludwig Resch (Deutsches Institut für Gesundheitsforschung) Quelle: IKK e.v. Karl-Ludwig Resch, Geschäftsführender Gesellschafter des Deutschen Institutes für Gesundheitsforschung, führte in seinem wissenschaftlich-unterhaltsamen Vortrag dieses Motiv weiter aus. Man müsse den Mut haben, Ross und Reiter zu nennen, die Ärzteschaft habe schlicht Angst, dass aus Delegation Substitution werde. Internationale Studien kämen zum Ergebnis, dass durch die Übernahme ärztlicher Tätigkeiten von Pflegepersonal die Qualität verbessert werde und weniger Geld für Ärzte ausgegeben werden müsse. Dann wies er auf einen Aspekt hin, der in der deutschen Gesundheitspolitik immer wieder unterschlagen wird. In Sachen Delegation und Substitution habe In der Podiumsdiskussion war auch die verfasste Ärzteschaft mit Ellen Lundershausen, Vizepräsidentin der Landesärztekammer Thüringen, vertreten. Diese gab sich verschnupft und ging zum Gegenangriff über. Sie empfinde es als ungerecht, dass nur der Arzt störe. Sie habe einen guten Kontakt mit Ellen Lundershausen (LÄK Thüringen); Quelle: IKK e.v. 12
13 BERICHTE anderen Gesundheitsberufen. Dass die Modellvorhaben zur Substitution nicht funktionierten, liege auch an mangelnden und zu aufwendigen Qualifikationsmöglichkeiten. Im Übrigen seien auch die Kassen nicht an Substitution interessiert. Sie habe kein Problem mit einer Delegation von Leistungen und vieles funktioniere doch bereits. Karl-Heinz Kellermann mit dem Argument, dass jeder Schritt dokumentiert werde. Ihn unterstützte Klaus Focke, BKK Dachverband, aus dem Publikum heraus mit dem Hinweis, dass Heilberufe auch unter Delegation nicht alles tun könnten, was sie wollten, da Krankenkassen Verträge über Mengen, Preise, Qualität, etc. abschließen würden. Jürgen Hohnl zog ein nüchtern-realistisches Resümee dieser erneut gut besuchten IKK Plattform Gesundheit. Es seien heute erwartungsgemäß keine endgültigen Lösungen präsentiert worden. Man müsse sich jeweils auf die Realität des andern einlassen, Bedenken und Probleme ernst nehmen. Karl-Heinz Kellermann (Verband für physikalische Therapie); Quelle: IKK e.v. Danach wurde sachlich über dieses Themenfeld anhand eines Modellprojekts der IKK Brandenburg und Berlin diskutiert. Kern dieses stetig evaluierten Projekts ist die Erweiterung der heilberuflichen Verantwortung und Kompetenz der Physiotherapeuten. 59 Physiotherapeuten, so Karl-Heinz Kellermann, Landes- und Bundesvorsitzender des Verbandes für physikalische Therapie, nähmen mittlerweile an dem Projekt teil. Der Arzt verordne weder, welche physiotherapeutische Leistung zu erbringen sei, noch die Frequenz und ohne ärztliche Richtgrößenprüfungen. Die Frage, ob dieses Modellprojekt für die Physiotherapeuten nicht eine Lizenz zum Gelddrucken sei, verneinte Jürgen Hohnl (IKK e.v.); Quelle: IKK e.v. Substitution sei vielleicht der falsche Begriff, man müsse zu einer Erweiterung der Versorgung gelangen, definieren, wohin welche Qualität führen solle. Gemeint sei damit aber nicht Deregulierung, kein Weniger an Qualität. Vor allem müsse man die Kernkompetenzen des andern wertschätzen. 13
14 BERICHTE AstraZeneca Arzneimittelversorgung in der Onkologie v.l.: Claus Runge (Astra Zeneca), Diana Lüftner (DGHO), Andrea Hahne (BRCA-Netzwerk), Karl-Heinz Schönbach (AOK-BV), Martina Stamm-Fibich (MdB SPD) Berlin, Dirk Greshake umriss den Stand der aktuellen Forschung AstraZenecas. Als eine von drei forschenden Firmen ständen sie in der Immunonkologie vor einem Durchbruch. Es bestehe bei Krebs jetzt eine Chance, aus einer tödlichen eine chronische Erkrankung bei guter Lebensqualität zu machen, ähnlich der Entwicklung in der Aidsforschung und -therapie. Tumore sollten aus der Kraft der körpereigenen Abwehr zerstört und ferngehalten werden. Es existiere eine Reihe an Studien mit exzellenten Daten. AstraZeneca forsche aber nicht nur im Bereich der Immunonkologie, sondern auch in der klassischen Onkologie. Wenn die Zukunft in einer Kombination liege, sei es gut, wenn man zwei Propeller habe. Karl-Heinz Schönbach, Leiter Versorgung im AOK-BV, sprach über Neuerungen und Herausforderungen im Gesundheitssystem. In der Versorgung von Mammakarzinomen habe mit der Einführung der DMPs eine deutliche Konzentration in zertifizierten Zentren stattgefunden. Dies sei eine positive Entwicklung. Lungenkarzinome würden dagegen nur zu 20% in Zentren behandelt. Sein Appell: Lassen Sie uns gemeinsam schauen, dass das, was beim Mammakarzinom erreicht wurde, auch bei anderen 14
15 BERICHTE Karzinomen erreicht wird! Wolle man keine Rationierung, müsse man die Versorgungsqualität in den Mittelpunkt stellen, statt Verteilungsdebatten zu führen. Man könne Arzneimittel nur dort einsetzen, wo entsprechende Verordnungskompetenz liege. Pharmanah formuliert, werde das Nutzenpotential nicht ausgeschöpft. Die Entwicklung von Qualitätsindikatoren dürfe nicht an der Unbeweglichkeit der Länder scheitern. Wenn etwas in die Versorgung gehe, was Niedergelassene verordneten, Krankenhäuser aber nicht, komme es zu Krieg im System. Er halte es für besser, NUBs in Krankenhäusern zu testen. Er stütze die Krankenhaus-Reformbemühungen der Bundesregierung. Martina Stamm-Fibich (MdB SPD) Auch Martina Stamm-Fibich sprach sich für eine Zentrenbildung aus. Das größte Problem stelle hier das Thema Lunge dar, weil kaum ein Bereich derart interdisziplinär sei. Für Niedergelassene seien vielfältige Ortswechsel nicht möglich. Ein weiteres Problem sei der Onkologenmangel. Es würden künftig Onkologen allein in Berlin fehlen und der NC halte viele junge Menschen von einem Studium ab. Es sei schwierig, sich über Verfahren zu verständigen, von denen man niemals erfahren habe. Karl-Heinz Schönbach sah als Berater der Politik in fachlichen Fragen das BMG für zuständig an, dessen Kompetenz sollte stärker in den Blick genommen werden. Andrea Hahne, BRCA-Netzwerk zur Hilfe bei familiärem Brustkrebs und Eierstockkrebs, schilderte stellvertretend für viele andere die Situation der Betroffenen. Sie sähen in der Nutzenbewertung ein Zeitdilemma, einerseits dauere es zu lange, bis neue Medikamenten in die Verschreibung kämen, teilweise sei die Dauer aber zu kurz, weil Bereiche über längere Fristen betrachtet werden müssten, um Nebenwirkungen auch auf die Lebensqualität hin zu untersuchen. Ärztliche Versorgungszentren seien gut, die Realität sei aber, dass der Zugang gewährleistet sein müsse. Dafür sei die Entfernung wesentlich. Niedergelassene müssten qualifiziert werden, damit auch dort Gentests möglich seien, wo keine spezialisierten Zentren erreichbar seien. 15
16 BERICHTE Patienten relativ schnell in den Verum-Arm geschoben. Dies sei unter ethischen Gesichtspunkten richtig, stelle sie im AMNOG Prozess aber vor unlösbare Aufgaben. Außerdem bedürfe es mehr Freiheiten für Ärzte. Patienten würden für eine teure genetische Testung in die Ambulanz geschickt, da Unklarheit über die Abrechnungsmöglichkeiten existiere. Claus Runge (AstraZeneca) Claus Runge definierte Aufgaben und Möglichkeiten seitens AstraZenecas für die Onkologieversorgung. Sie könnten Medikamente entwickeln, in Bezug auf die Organisation von Strukturen und Versorgung seien sie auf der Suche nach ihrer Rolle. So seien vor einigen Jahren Präparate zur Behandlung von Lungenkrebs auf den Markt gebracht worden, die mit einer Testung verbunden gewesen seien. Wenn sie hier für eine Infrastrukturverbesserung für Tests sorgten, was eine Rolle sein könnte, vermute er den Vorwurf, dass nicht unabhängig geforscht werde. Schwierigkeiten mit dem AMNOG hätten sie oftmals gerade in der Onkologie, wenn kleine Tumorentitäten mit wenigen Patienten in Studien und keine Therapiealternativen vorlägen. Werde ein wirksames Medikament eingesetzt und im Placebo-Arm festgestellt, dass die Therapie nicht anschlage, oder ein starker Progress stattfinde, würden die Diana Lüftner, DGHO, kritisierte die Gesprächsqualität in den Anhörungen des IQWiG, auf den Symposien seien die Gespräche dagegen offen und interessant. Leider dürften die Ergebnisse nicht veröffentlicht werden, darunter leide die Umsetzung, hier sei Transparenz wichtig. Sie hätten die gesamten Nutzenbewertungen in Europa zusammengetragen es existierten Unterschiede, die nicht sein nachvollziehbar seien, da alle mit den gleichen wissenschaftlichen Ergebnissen arbeiteten. Diagnostik im Vorfeld abrechenbar zu machen, wäre die ideale Welt. Momentan sorgten Strukturschwächen dafür, dass diejenigen, die sich nicht mehr wehren könnten, unterversorgt seien. 16
17 NACHRICHTEN BVMed-Herbstumfrage zur Lage der MedTech-Branche 2014 Berlin, Einen Tag nach Bekanntwerden des Referentenentwurfs des VSG umriss Joachim M. Schmitt eine erste Einschätzung seines Verbands und präsentierte die Ergebnisse ihrer Herbstumfrage. In der Phase nach Markteinführung müssten sich die Hersteller an Studien beteiligen. Dies sei zu begrüßen, sofern diese Studien Besonderheiten der Medizinprodukte berücksichtigten. Dass Bewertungen durch den GBA nach 2 Jahren abgeschlossen sein müssten, werde in dem neuen 137 h, SGB V für die Klassen 2b und 3 umgesetzt. Inklusive der Erprobungsregelung werde das Verfahren insgesamt 4 ½ Jahre dauern dies sei seiner Meinung nach zu lang. Die Trittbrettfahrerproblematik bleibe dabei unbeantwortet. Nach Angaben der 94 Unternehmen, die sich an der Umfrage beteiligt hätten, rechneten sie mit einem Umsatzwachstum von 3,4% gegenüber dem Vorjahr (2013 bei 2,6%), dagegen seien die Gewinne durch Preisdruck und Pauschalen rückläufig. Das Innovationsklima werde von diesen Unternehmen schlechter beurteilt als im Jahr zuvor auf einer Skala von 0-10 habe sich der Wert von 6,2 auf 4,9 verschlechtert. Meinrad Lugan stellte den 5-Punkte-Plan des BVMed zur Nutzenbewertung vor: 1. Methoden, nicht Produkte bewerten Nutzenstudien zu NUB mit Medizinprodukten hoher Risikoklasse, keine Produktstudien. 2. Strukturqualitätskriterien alle Krankenhäuser sollten sich an den Studien beteiligen können, wenn sie die erforderliche Strukturqualität erfüllten. 3. Innovationszugang sicherstellen teilnehmende Krankenhäuser sollten allen Patienten, welche diese neuen Methode benötigten, offen stehen, diese Leistungen sollten vergütet werden. 4. Bewertungsverfahren insgesamt beschleunigen von Antrag bis Stempel 2 Jahre Dauer in einem transparenten Verfahren. 5. Eigene Methodik für Medizintechnologien unter Mitarbeit der Industrie sollten wissenschaftliche Leitlinien für die Nutzenbewertung von NUB mit Medizinprodukten hoher Risikoklasse entwickelt werden. 17
18 NACHRICHTEN Zur EU-Medizinprodukteverordnung erklärte der Vorstandsvorsitzende, auf europäischer Ebene werde neu begonnen, über einen Rechtsrahmen zu diskutieren. Die Verordnung müsse durch neue Beteiligte neu aufgerollt werden. Wenn das Parlament oder die Kommission in den nächsten 3 Jahren etwas beschließe, sei der aktuelle Rechtsrahmen in Deutschland hinfällig. Langwierige Diskussionen wie jene über die Wiederaufarbeitung von Medizinprodukten müssten abermals geführt werden. Kritik übte er an IQWiG, Krankenkassen und Bewertungsausschuss. Der Bewertungsausschuss arbeite zu langsam, es dauere zu lange, bis erstattet werde. Krankenkassen verweigerten NUB-Finanzierungen, hier bedürfe es einer Klarstellung. Das IQWiG sei ein Verhinderungsinstrument für Innovationen, es bestehe kein Interesse, Bewertungsmethoden mit der Industrie zu entwickeln. Qualitätsorientierte Versorgungssteuerung und Vergütung Positionen des GKV-SV v.l.: Wulf-Dietrich Leber, Bernhard Egger, Doris Pfeiffer (alle GKV-SV) Berlin, Doris Pfeiffer eröffnete die Pressekonferenz mit der Bemerkung, es sei bereits eine Vielfalt von Entscheidungen zur Qualitätssicherung getroffen worden. Es sei wichtig, Anreize zu setzen, damit gute Qualität sich lohne. Sie seien über die aktuelle Diskussion besorgt, Qualitätsstandards nur optional anzuwenden. Entscheidend sei 18
19 NACHRICHTEN eine Transparenz der Qualität für Patienten und einweisende Ärzte, dazu würden entsprechende Indikatoren benötigt. Im stationären Sektor sei die Berichterstattung bereits transparent, im ambulanten lasse sie zu wünschen übrig. Wulf-Dietrich Leber beleuchtete das Thema Mindestmengen und Mindestqualität. Gesetzliche Anforderungen bauten unnötige Hürden auf, hingegen sei es notwendig, Mindestmengen rechtssicher in Festlegung und Umsetzung zu gestalten. Man benötige auch für seltene Krankheiten Mindestmengen, dort sei nicht nachzuweisen, dass sie für bessere Ergebnisse sorgten, obwohl es naheliegend sei. Es existierten bereits eindeutige gesetzliche Grundlagen, die Mindestmengen vorgäben, z.b. bei Lebertransplantationen würden diese teilweise schon langjährig unterschritten. Krankenkassen könnten Zahlungen dennoch nicht einstellen dies würde einen medialen Wirbel auslösen. Es sollte aber kein Patient auf die Warteliste eines Krankenhauses, das Transplantation nur als Gelegenheitschirurgie anbiete. Die qualitätsorientierte Vergütung liege noch im experimentellen Bereich. Im Koalitionsvertrag seien größere Abschläge auf Mehrleistungen vorgesehen, Qualitätsabschläge müssten sich selbstverständlich auf alle Leistungen beziehen. Richtige Indikatoren seien schwierig zu finden. Sie müssten u.a. die Ergebnisqualität abbilden, evidenzbasiert und zeitnah an den Ergebnissen sein. Die Entwicklung neuer Indikatoren dauere 5 Jahre, gleichgültig welches Institut beauftragt werde. Künftig werde Strukturqualität vorgegeben. Wenn die Mindestqualität nicht erfüllt werde, komme es zum Ausschluss aus der Versorgung. Für kleine Mengen sei schlechte Ergebnisqualität jedoch kaum nachzuweisen. Ihr Vorschlag sei Umverteilung: Es solle ein Exzellenzzuschlag für die besten 10% und einen Abschlag für die schlechtesten 10% eingeführt werden. Krankenkassen wollten und würden damit nicht an schlechter Qualität verdienen. Erfolge und Misserfolge einer Behandlung könnten nur bewertet werden, wenn auch nach einem Krankenhausaufenthalt gemessen werde, ergänzte Doris Pfeiffer. Oft sei die Verweildauer nämlich derart kurz, dass Komplikationen erst danach einträten. Oftmals fehlten Voraussetzungen, so habe man ambulant keine Codierziffern für bestimmte Verfahren. Sie forderten die maschinelle Erfassbarkeit im ambulanten Bereich und einheitliche Dokumentationsregeln für alle Sektoren. Wenn Routinedaten der Krankenkassen genutzt würden, benötige man keine separaten Dokumentationsbögen. Qualitätsmaßnahmen seien für alle gültig, die Daten der PKV seien aber oft unvollständig, da dort die Einwilligung der Patienten erforderlich sei. Das erste sektorenübergreifende Qualitätssicherungs-Verfahren, das im GBA beschlossen worden sei, gelte für Herzkatheter und Stentimplantationen. Der Richtlinienbeschluss sei für das Frühjahr 2015, die Datenerfassung für 2016 vorgesehen. Mit diesem Qualitätssicherungsverfahren würde einiges erreicht: 19
20 NACHRICHTEN Gleiche Qualitätsmessung Überwindung Sektorengrenzen Messung relevanter Ergebnisqualität durch Follow-Up und Transparenz der Ergebnisse im stationären Bereich. Aus dem ambulanten Bereich dürften Ergebnisse nicht veröffentlicht werden, dies sei nicht weiter tragbar. Die neue Richtlinie verschlechtere die Situation partiell, denn Belegärzte würden als Vertragsärzte ausgenommen. Informationen müssten Patienten zugänglich gemacht werden, damit sie eine fundierte Auswahl treffen könnten. Es sei noch ein weiter Weg zu echter Qualitätstransparenz. Sie wünschten sich einen aussagekräftigen Qualitätsbericht, der ambulant und stationär als Einheit, nicht als Gegensätze begreife. v.l.: Manfred Güllner (forsa), Jens Baas, Dorothee Meusch (beide TK) TK Meinungsimpuls 2014 Berlin, In einer neuen Studie der TK, durchgeführt vom Forsa-Institut, wurden bevölkerungsrepräsentative Personen befragt. Insgesamt sei die Zufriedenheit gewachsen, so Jens Baas, drei Viertel seien sehr zufrieden mit dem deutschen Gesundheitssystem, 9 von 10 sähen aber Reformbedarf. 20
21 NACHRICHTEN Jens Baas (TK) Als besonders problematisch wurden die künftige Finanzierung des Systems und vor allem des medizinischen Fortschritts sowie die flächendeckende Versorgung im ländlichen Bereich eingestuft. Jens Baas sprach sich gegen Rationierung und für eine qualitätsorientierte Finanzierung aus. Die Befragten sahen in Telemedizin und Delegation/Substitution Möglichkeiten, die Situation zu verbessern. Die Mehrheit gab an, bereit zu sein, sich auch von einer Krankenschwester behandeln zu lassen oder mit Ärzten per Video zu kommunizieren. Von Wettbewerb versprach sich jeder 2. ein besseres Kassenmanagement mit geringeren Verwaltungskosten. Keine Abstriche wollten Versicherte in Bezug auf Wartezeiten machen. Nahezu die Hälfte wollte maximal eine Woche auf einen Facharzttermin warten. Jens Baas kritisierte eine gesetzliche Regelung für Wartezeiten, dies sei ein Selbstverwaltungsthema. Eine deutliche Diskrepanz in der Beurteilung der ambulanten Versorgung sei zwischen Stadt und Land festzustellen auf dem Land sei jeder 5. unzufrieden, erklärte Manfred Güllner. Die Zufriedenheit sinke mit geringerer Einwohnerzahl deutlich. Lange Wege für eine qualitativ hohe Versorgung würden jedoch von nahezu allen akzeptiert. Überraschend seien nur die Ergebnisse zur Pflegevorsorge. Die meisten wüssten um die Kosten der Pflege und sorgten dennoch nicht vor. Dieses Thema werde vielfach verdrängt. 21
22 NACHRICHTEN vdek Krankenhausplanung Planen nach Qualität und Erreichbarkeit Berlin, Es sei Zeit für eine umfassende Reform der Krankenhäuser, so Ulrike Elsner zum Einstieg in die Pressekonferenz zur Vorstellung des RWI-Gutachtens Erarbeitung von Umsetzungsvorschlägen der Positionen der Ersatzkassen zur Krankenhausplanung. Qualität und Erreichbarkeit müssten im Mittelpunkt der Krankenhausplanung stehen, Geld richtig eingesetzt, der Versorgungsbedarf der Zukunft berücksichtigt werden. Deshalb solle der Gemeinsame Bundesausschuss auf Basis der Daten aus den Qualitätssicherungsverfahren planungstaugliche Kriterien für eine gute Qualität definieren, v.l.: Boris Augurzky (RWI), Ulrike Elsner (vdek), Christoph Dodt (Deutsche Gesellschaft für Notfall- und Akutmedizin) Beispiel Mindestmengenregelungen und Personalvorgaben. Kriterien zur Erreichbarkeit, Sicherstellung und Notfallversorgung seien ebenfalls zwingend erforderlich, auch als Basis für die Planung in den Ländern. Die Krankenhausplanung solle Aufgabe der Länder bleiben, allerdings auf Basis bundesweit einheitlich definierter Standards und Kriterien, umrahmt von einer guten Notfallversorgung. Einer Investitionsfinanzierung durch die Länder bedürfe es weiterhin. Für viele Krankenhäuser werde es zunehmend schwieriger, ihre Kapazitäten auszulasten und das notwendige Personal zu finden. Es sei wichtig, dass die Länder Angebote erhielten, Alternativen für nicht bedarfsnotwendige Krankenhäuser zu entwickeln, z.b. eine Umwidmung zu Pflegeeinrichtungen. Es existierten zurzeit keine bundesweit einheitlichen Planungskriterien weder für die Basis- und Schwerpunkt- noch für 22
23 NACHRICHTEN die Notfallversorgung. Daher plädierten sie dafür, dass Bund und Länder künftig in der Planung besser zusammenarbeiteten, die Krankenkassen als Hauptfinanziers mehr Mitspracherechte erhielten. Die Investitionsfinanzierung durch die Bundesländer sei seit 1972 von Jahr zu Jahr verringert geworden. Dies zwinge Krankenhäuser dazu, Finanzierungslücken durch Einsparungen im Betriebskostenbereich oder durch Mengenausweitung zu schließen. Damit zahlten letztendlich Krankenkassen die fehlenden Investitionskosten über die Beiträge ihrer Versicherten. Die Bundesländer sollten künftig verpflichtet werden, die Förderung auf Investitionspauschalen umzustellen und die Investitionsfinanzierung zu vereinheitlichen. Eine Investitionsquote solle als Untergrenze gesetzlich festgeschrieben werden. Da sich die Haushaltslage der Bundesländer vermutlich nicht verbessern werde, sollte sich der Bund an der Investitionsfinanzierung beteiligen. Im Gegenzug würde der Bund mehr Mitspracherechte in der Gestaltung der bundesweiten einheitlichen Vorgaben erhalten. Zur Operationalisierung der Position des Verbands sei das RWI damit beauftragt worden, praktische Umsetzungsempfehlungen zu erarbeiten. Boris Augurzky (RWI) stellte 7 Empfehlungen zur Modifizierung der Krankenhausplanung vor: Notfallversorgung neu ausrichten bundesweit einheitliche Standards zur Erreichbarkeit vorgeben verbindliche Qualitätsvorgaben erstellen einheitliche Datengrundlage schaffen Vorgaben durch ein systematisches Versorgungsmonitoring überprüfen. Es seien allgemeingültige Mindeststandards festzulegen und bundesweit einheitlich auszugestalten, vertiefte Boris Augurzky. Der Grund- und Regelversorgung seien in Deutschland 1311 Standorte zuzuordnen. Für elektive Behandlungen der Grund- und Regelversorgung sei z.b. eine Erreichbarkeit von maximal 30 PKW-Minuten vorzusehen, für Schwerpunkt- und Maximalversorger bis zu 60 PKW-Minuten, die Zeitspanne bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes dürfe maximal 12 Minuten betragen. Qualität müsse als verbindliches Kriterium in die Krankenhausplanung aufgenommen werden, kurz- und mittelfristig mit Vorgaben an Struktur- und Prozessqualität, langfristig mit Vorgaben an Indikations- und Ergebnisqualität. Diese Vorgaben seien durch ein systematisches Versorgungsmonitoring, Rahmenvorgaben des Bundes, regelmäßig und anlassbezogen von den Ländern zu überprüfen, um Auffälligkeiten festzustellen und Konsequenzen daraus zu ziehen. einheitliche Vorgaben für bedarfsgerechte Versorgung Grund- und Regelversorgung klar definieren 23
24 NACHRICHTEN DAK-Gesundheit und Lilly Symposium Zukunft Demenz v.l.: Gerd Kräh (Lilly), Heike von Lützau-Hohlbein (DAlzG), Pia Zimmermann (MdB Die Linke), Erwin Rüddel (MdB CDU), Elisabeth Scharfenberg (MdB Die Grünen), Hilde Mattheis (MdB SPD), Herbert Rebscher (DAK- Gesundheit), Cornelia Spohn Berlin, Pünktlich zum Abschluss der Ausschussberatungen des 1. PSG veranstalteten DAK- Gesundheit und Lilly ein gemeinsames Symposium zum Thema Demenz. Herbert Rebscher gab eine kurze Einführung, die Pflegeversicherung sei von Anfang an eine Teilkostenerstattung gewesen, eine persönliche Belastung werde den Bürgern kein System abnehmen können. Die Pflegeversicherung sei dennoch ein wichtiger Faktor, der unmittelbarste für die finanzielle Absicherung und den Aufbau einer Infrastruktur, aber dies sei eben nicht alles. 80% aller Problemsituationen im Zusammenhang mit Demenz seien kein Versicherungsproblem, sondern persönlicher Natur. Ziel sei, durch Kooperationen eine Entwicklung und Fortentwicklung von Problemlösungsstrategien zu erzielen. Herbert Rebscher (DAK-Gesundheit) Neben bekannten Positionen zum 1. PSG wurde die Situation Demenzkranker mitsamt den aus der 24
25 NACHRICHTEN Krankheit erwachsenden Defiziten, aber auch den Chancen zur Verbesserung der Versorgung an Demenz Erkrankter aus verschiedenen Perspektiven erörtert. Von Selbsthilfe, über Abgeordnete, Pharmaindustrie und Krankenkassen waren alle Akteure vertreten. Die Beteiligten waren sich in der Problemanalyse weitgehend einig, die Lösungswege unterschieden sich dagegen deutlich. Hilde Mattheis sprach sich für die Stärkung des Ehrenamtes, höhere Löhne für Pflegekräfte und die (finanzielle) Stärkung der Kommunen aus, während Erwin Rüddel eine stärkere Koordinierungsfunktion für Kommunen, mehr Gestaltungsspielraum für den Bund und finanzielle Freiräume für Pharmaunternehmen forderte. Auch Elisabeth Scharfenberg sah in den ungedeckten Haushalten der Kommunen ein Problem. Auf ihre Forderung nach mehr Geldern, kritisierte Erwin Rüddel, nur die Hälfte dieser Gelder komme bei den Erkrankten an, die andere Hälfte werde zum Stopfen von Simone Thomsen (Lilly) Haushaltslöchern verwendet. Aus medizinischer Sicht stelle die undifferenzierte Diagnosestellung ein schwerwiegendes Problem dar, so Wolfgang Maier, Präsident der DGPPN. Gerd Kräh, Lilly, führte aus, dass eine frühzeitige, sichere Diagnosestellung wesentlich sei, bisher bleibe aber die Hälfte der Diagnosen unspezifisch. Dieses Problem müsse gelöst werden. Sie seien in der pharmakologischen Forschung noch nicht so weit, dass sie einen Baustein zur Lösung der Probleme beisteuern zu können, aber er sei optimistisch, dass sie bald etwas Innovatives erforscht hätten. Simone Thomsen (Lilly) erklärte, sie hätten gelernt, dass eine Verlangsamung oder ein Stopp der Krankheitsentwicklung bereits ein Erfolg wäre. Sie arbeiteten weiter an Arzneimitteln zur Heilung. Ingrid Fischbach sprach sich für eine weitere Enttabuisierung der Krankheit aus und forderte mehr Orientierungshilfen in Ämtern, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. Sie hätten am die Allianz für Menschen mit Demenz gegründet, um eine nationale Demenzstrategie zu erarbeiten. 25
26 NACHRICHTEN Darüber hinaus wurden bürokratische Hürden und die Rolle des Hausarztes kontrovers diskutiert. Reiner Klingholz, Direktor des Berliner Instituts für Bevölkerung und Entwicklung, kritisierte bürokratische Hürden bei Wohnformzusammenschlüssen. Der allgemeinen Kritik von Heike von Lützau- Hohlbein, und Sabine Jansen, beide von der DAlzG, die komplizierten Gesetze seien vielen Betroffenen keine Hilfe, sondern weckten Beratungsbedarf, pflichtete Erwin Rüddel bei. Das Gesundheitssystem sei reguliert und werde immer kompliziert bleiben, aber es brauche Kümmerer. Für Wolfgang Maier fiel die Wahl als vorwiegende Versorger aufgrund der Zahl der Erkrankungen auf die Hausärzte. Elisabeth Scharfenberg hielt Hausärzte für eine persönliche Beratung dagegen nicht für geeignet, weil sie keine Zeit hätten, das räumliche und menschliche Umfeld im Blick zu behalten. FÜR GESUNDHEITSPOLITIK 3-4/14 Forum für Gesundheitspolitik Zeit zur Positionierung Ausgabe 3-4/14 Online lesen Zeit zur Positionierung 26
27 NACHRICHTEN Leben mit Schizophrenie die entscheidende Rolle der Angehörigen Berlin, Hilde Lauwers, Forschungskoordinatorin des LUCAS, eines Zentrums für Versorgungsforschung und Beratung der Universität Leuven, stellte erste Ergebnisse einer internationalen Studie mit Handlungsempfehlungen zur Rolle der Angehörigen von an Schizophrenie Erkrankten vor. Die in 25 Ländern durchgeführte Studie werde 2015 abgeschlossen, bisher lägen die Ergebnisse aus 7 Ländern vor. Bedürfnisse und Herausforderungen von Angehörigen sollten erhoben, Lebensumstände und die Belastungen der Angehörigen analysiert werden. Die Studie solle außerdem genauere Erkenntnisse zur Rolle der Angehörigen für das Krankheitsmanagement und der Genesung psychisch Kranker liefern. In Europa lebten 10 Millionen Angehörige von Menschen, die an Schizophrenie erkrankt seien, in Deutschland 1,2 bis 1,5 Millionen. Die Belastung der Angehörigen sei multidimensional und betreffe unterschiedliche Aspekte psychologische, soziale, physische und finanzielle, vor allem aber litten sie unter der mit dieser Krankheit verbundenen Stigmatisierung. Hilde Lauwers (LUCAS) In Deutschland fühlten sich im internationalen Vergleich Angehörige weniger stark stigmatisiert, aber ca. 15 % seien unzufriedener mit der Unterstützung durch Ärzte und Krankenpfleger, aber zufriedener mit den Patienten/Angehörigen-Verbänden. Angehörige in Deutschland hätten weniger finanzielle Probleme, lebten meist nicht mit ihren psychisch erkrankten Angehörigen zusammen, sorgten sich mehr um ihre eigene physische Gesundheit, seien häufiger nicht in der Lage, eine Auszeit zu nehmen und erreichten häufiger eine Belastungsgrenze. 27
28 NACHRICHTEN Notwendig sei die Organisation individueller Hilfsangebote wie z.b. die Ermutigung zur Selbsthilfe und Hilfe mittels Peer-Support durch andere Angehörige, Informations- und Schulungsangebote, emotionale Unterstützung, gezielte Förderung und Stärkung der Familien, aber auch die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Fachkräften und Angehörigen und die Verbreiterung der ambulanten Versorgung. Notwendig sei außerdem die Entstigmatisierung der Krankheit in der Öffentlichkeit durch Aufklärung über Schizophrenie und die Sensibilisierung der Medien für die Krankheit. Janine Berg-Peer (EUFAMI) Janine Berg-Peer, deutsche Repräsentantin der EUFAMI European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness, die 25 Millionen Familien in 48 Mitgliedsorganisationen in 28 Ländern repräsentiert - kommentierte diese Ergebnisse. Über die Resultate der Studie wundere sie sich nicht. Schizophrenie bringe eine große Belastung für Angehörige, besonders für Frauen mit sich. Von Ärzten würde keine Information, keine Struktur geboten. Ihr größter Wunsch sei Information. Angehörige seien eine wichtige Ressource, man müsse sie qualifizieren, sie ständen aber nicht im Fokus der Professionellen, obwohl Angehörige ständig in Alarmbereitschaft ständen und für eine stabile Umgebung sorgen sollten, stehe immer Angst im Hintergrund. Auf der anderen Seite müsse auch deutlich werden, dass Angehörige nur die 2. Wahl sein könnten, ein stärkerer Ausbau der ambulanten Versorgung sei notwendig. Die Zusammenarbeit Ärzte Psychotherapeuten Angehörige müsse verbessert werden, Kranke müssten stärker für eine Entstigmatisierung in die Öffentlichkeit treten. 28
29 NACHRICHTEN AG Zukunft des Gesundheitswesens Gesundheitswirtschaft zwischen Kostenund Qualitätsinteressen v.l.: Andreas Penk (Pfizer), Stephan Albani (MdB CDU), Brigitte Zypries (BMJ), Jürgen Wasem (Uni Duisburg- Essen), Michael Hennrich (MdB CDU) Berlin, Die AG Zukunft des Gesundheitswesens hatte in die saarländische Vertretung eingeladen, um das Thema Zukunft Gesundheitspolitik unter dem Aspekt Gesundheitswirtschaft zwischen Kosten- und Qualitätsinteressen eine nicht nur nationale, gesundheitsökonomische Betrachtung mit Vorträgen und einer Podiumsdiskussion zu behandeln. Jürgen Wasem zeigte Wege auf, wie eine integrierte wirtschafts- und gesundheitspolitische Perspektive aussehen könnte. Gesamtwirtschaftliche Bezüge müssten bei der Ausgestaltung von Governance-Strukturen im Gesundheitswesen berücksichtigt werden. Dies gelte insbesondere für den GBA mit Beschlüssen zu Lasten Dritter und der Interdependenz zwischen GBA und GKV-SV Stichwort AMNOG. Jürgen Wasem plädierte außerdem dafür, eine gesamtwirtschaftliche Folgenabschätzung für Gesetzesänderungen im Bereich der GKV zu implementieren, etwa zu den Themen Finanzierungsarchitektur der GKV oder Abgrenzung und Spielräume für den 2. Gesundheitsmarkt. Außerdem sollte in Nutzen- bzw. Kosten-Nutzen-Betrachtungen die gesellschaftliche Perspektive berücksichtigt werden. 29
30 NACHRICHTEN Michael Hennrich hielt ihm entgegen, das AMNOG als Gesetz sei gut, Probleme entständen nur durch die konkret gelebte Praxis. Andreas Penk brachte die Perspektive eines internationalen Konzerns ein. Die Umsetzung des AMNOG habe den Blick auf den Standort Deutschland getrübt. Eine kritische Auseinandersetzung mit der AMNOG-Methodik finde kaum statt. Die freie Preisbildung im 1. Jahr müsse beibehalten werden, dies sei die letzte Planungssicherheit für die Unternehmen. Das IQWiG sende international starke Signale, seine Bewertungen würden sofort von Wallstreet-Analysten gelesen, wogegen Ablehnungen onkologischer Innovationen durch das NICE nicht mehr ernst genommen würden. Mittlerweile könne man die Ergebnisse des AMNOG statistisch analysieren und sei nicht mehr auf nur bloße Fallbetrachtungen angewiesen. Ihre Analysen kämen zu dem Ergebnis, dass abhängig vom Zusatznutzen nicht vorhersehbar sei, auf welchem Preisniveau man lande, selbst mit Zusatznutzen seien Preise tief unterhalb des europäischen Schnitts möglich. Die Preistransparenz schränke die Spielräume für Verhandlungen in Deutschland ein und habe Effekte auf viele andere Märke. Deutschland werde als Referenzmarkt unterschätzt. Der GKV-Spitzenverband agiere wie ein Einkäufer vorhandener Güter, Impulse für ein Investment in Zukunftsprodukte würden nicht ausgesendet. Deutschland Regulierungsprobleme lösen könne. Darauf antwortete Brigitte Zypries, vielen Unternehmen würden Schwierigkeiten erleichtert, wenn amerikanische Doppelprüfungen wegfielen. Sie verstehe die Angst vor einer Lockerung der Standards nicht. In vielen Bereichen hätten die USA höhere Standards als Deutschland. Andreas Penk sah bezüglich der Standards vergleichbare Anforderungen. Er rechne eher mit Erleichterungen, wenn EMA und FDA kooperierten, z.b. für die Inspektion von Werken, der Zusammenlegung des wissenschaftlichen Bereichs oder durch eine Harmonisierung der Studienanforderungen. In der Podiumsdiskussion warf Michael Hennrich die Frage auf, ob das TTIP in 30
31 v.l.: Ingo Froböse (Deutsche Sporthochschule Köln), Elisabeth Pott (BZgA), Volker Leienbach (PKV) BZgA und PKV - Älter werden in Balance Berlin, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und PKV-Verband stellten gemeinsam das neue bundesweite Programm Älter werden in Balance vor. Dieses Präventionsprogramm richtet sich an Frauen und Männer ab 65 Jahren und setzt vor allem auf alltagsnahe Bewegungen, zu denen mit unterschiedlichen Informationsangeboten animiert werden soll. Die PKV gibt für die Kampagne in diesem Jahr 2 Mio. und im nächsten Jahr 3 Mio. aus. Man wolle, so Elisabeth Pott, älter werdenden Menschen eine gute Lebensqualität ermöglichen. Alter werde oft mit Pflegebedürftigkeit, Krankheit und Einschränkungen gleichgesetzt, es werde eine defizitäre Alterssituation beschrieben. Sie dagegen wollten stärkende Faktoren in den Mittelpunkt stellen, wollten soziale, psychisch-kulturelle und physische Gesundheit als Ganzes betrachten und eine Balance herstellen. Ziel sei, den Eintritt von Pflegebedürftigkeit mit einem ganzheitlichen Ansatz zeitlich zu 31
32 NACHRICHTEN Dienst (Medicproof) und der Gründung der Stiftung Zentrum für Qualität in der Pflege dem bislang einzigen nationalen Kompetenzzentrum für die Pflege. Bislang habe Prävention zur Verhinderung von Pflegebedürftigkeit für sie noch nicht im Fokus gestanden, aber auch Prävention gehöre zur Versorgungskette. Diese Lücke wollten sie mit dieser Kampagne schließen. Elisabeth Pott (BZgA) Für den Faktor Begeisterung im neuen Bewegungs- Programm ist Ingo Froböse zuständig. Menschen verzögern. Dazu müsse man bei älter werdenden Menschen die Begeisterung für Bewegung wecken. Entgegen käme ihnen, dass Menschen lebenslang lernfähig und bis ins hohe Alter trainierbar seien. Die Website zur Kampagne werde heute gestartet, außerdem werde ein Fotowettbewerb ausgelobt für bewegende Momente aus dem Altersleben bewegender Alltag, bewegende Hobbys und bewegender Sport. Auch Volker Leienbach betonte das Ziel, Pflegebedürftigkeit zu vermeiden oder hinauszuzögern. Die PKV habe unter Qualitätsgesichtspunkten die gesamte Versorgungskette im Blick mit eigener Pflegeberatung (Compass), einem eigenen medizinischen Volker Leienbach (PKV) müssten aktiviert werden, so der Leiter des Instituts für Bewegungstherapie und 32
33 NACHRICHTEN Ingo Froböse (Deutsche Sporthochschule Köln) bewegungsorientierte Prävention und Rehabilitation der Deutschen Sporthochschule Köln, z. B. mit folgender Intervention: 15 Wochen lang Schritte mehr am Tag, Spazierengehen und glückliche Momente mit einem Haustier verbringen. Man müsse die Bewegung zum Menschen bringen, auf die Alltagsaktivitäten vor der Tür hinweisen. Ohne Reizsetzung würden die Muskeln absterben, Muskeln seien aber lebenslang trainierbar. Bewegung fördere kognitive Fähigkeiten, mache schlau. Balance heiße, aktiv in allen Lebenslagen werden. Dies sei mit einer Vollkaskoversicherung vergleichbar, um dem Pflegeheim lange davonzulaufen. Ingo Froböse wird auch im zur Kampagne gehörenden Adventskalender zu sehen sein, den die BZgA im Rahmen ihres Internetauftritts freischalten wird, gemeinsam mit Ulla und Dieter, die zu Bewegungsaktivitäten animieren sollen. 33
34 Boulevard PARLAMENTARISCHER ABEND DES BKK DACHVERBANDS Quelle: Lopata/Axentis Berlin, Im ehemaligen Kaiserlichen Telegraphenamt, erbaut um 1877, empfing der BKK Dachverband zu seinem zweiten parlamentarischen Abend. Die Location überzeugte schon beim Eintritt, im imposanten Eingangsbereich verbinden sich die Fassade aus Glas und Stahl und den historischen Kern stilvoll zu einem neuen Ganzen. Der hohe Saal füllte sich innerhalb kürzester Zeit und der Gastgeber begrüßte die vielen Gäste anscheinend wollte sich niemand diesen Abend entgehen lassen. Franz Knieps stellte in seiner kurzen Einführung den Zusammenhang zwischen der Location, in diesem Falle der Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom, und der betrieblichen Krankenversicherung respektive der politischen Strategie seines Verbandes her. Die Deutsche Telekom, sei einer der größten Trägerbetriebe der Deutschen BKK und verkörpere in besonderer Weise die Idee der betrieblichen Krankenversicherung. Die 34
35 Boulevard Franz Knieps (BKK-DV); Quelle: Lopata / Axentis Postkrankenkasse sei am 1. Oktober 1885 gegründet worden, anfangs nur für Arbeiter zugänglich, habe 2 Weltkriege überstanden und sei damit ein Musterbeispiel für eine überlebensfähige Sozialversicherung. Andererseits sei die Telekom Repräsentant der neuen digitalen Welt. Gesetzgeber: Geben Sie uns Handlungsfreiheit! Nach einem kleinen Seitenhieb auf die AOK zum Stichwort gerechte Finanzierung schloss er mit dem Hinweis ab, dass die zahlreichen Gäste ein Beleg dafür seien, dass die betriebliche Krankenversicherung augenscheinlich viele Freunde im System und in der Politik habe. Anschließend zog die gesamte Gesellschaft weiter in das bunt erleuchtete Atrium. Man erwarte spannende Gesetzentwürfe Krankenhausreform, Prävention, Versorgungsstärkungsgesetz. Sein Appell an den Michael Hennrich (MdB CDU) v.l.: Gertrud Demmler (SBK), Rolf-Ulrich Schlenker (BARMER GEK), Karin Maag (MdB CDU) Hier sorgte das heimische Gastronomieteam für das leibliche Wohl der Gäste: Als Vorspeise im Flying Service wurden Salat von Babyspinat mit karamellisierten Birnenspalten, gerösteten Nüssen, Ziegenkäseperlen und Himbeerdressing, Tomatensalat mit Fetakäse und Petersilienpesto, Scheiben vom Jungschweinrücken mit mariniertem 35
36 Boulevard v.l.: Andrea Galle (BKK VBU), Norbert Klusen, Iris Beumler (BKK Ernst &Young) Schwarzwurzelsalat und Holunderbeerendip gereicht. Am Buffet erwarteten die Gäste bardiertes Zanderfilet mit Spreewälder Gurkenrisotto und glasierte Kirschtomaten, Geschmortes vom Rind im Rotwein-Wiesenkräuterfond mit Ragout von Teltower Rübchen und Rosmarinkartoffeln oder Kürbis-Ricotta-Canelloni an Tomatensugo zur Auswahl und für den süßen Hunger Zwetschgensalat mit Vanilleschaum oder Espresso-Crème-Brûlée alles von hervorragender Qualität und exzellentem Geschmack. Dazu wurden ein Grauburgunder aus dem Markgräfler Land und ein Salento Rosso ausgeschenkt. Gut gestärkt und gestimmt, wurde vor allem über den lange unter Verschluss gehaltenen Arbeitsentwurf des Versorgungsstärkungsgesetztes diskutiert wenn auch noch hinter vorgehaltener Hand. Manch einer hatte ihn schon auf dem Display seines v.l.: Susan Knoll, Bork Bretthauer (Progenerika) v.l.: Frank Diener (Treuhand Hannover), Sebastian Schmitz (ABDA) 36
37 Boulevard v.l.: Silke Baumann (BMG), Jens Bürger (BKK Landesverband Süd) v.l.: Ann Hillig (IKK e.v.), Erwin Rüddel (MdB CDU), Alexandra Gutwein (Büro Erwin Rüddel) Smartphones gefunden und am nächsten Morgen war er bereits in aller Munde. Weitere Themen des Abends waren die Fusionen im BKK-System und die Finanzsituation der Kassen und naturgemäß der Zusatzbeitrags zum 1.1. In einer außergewöhnlich lockeren und heiteren Atmosphäre, untermalt von Swing bis Hot Jazz von den Jazzladies war es nicht verwunderlich, dass manch einer an diesem Abend zum Nachtschwärmer wurde. Jazzladies v.l.: Florian Eckert (Bayer Healthcare), Gudrun Bärthel-Schneck (Büro Edgar Franke), Edgar Franke (MdB SPD), Daniel Poerschke (Bayer Healthcare) 37
38 Boulevard PARLAMENTARISCHER ABEND DER DEUTSCHEN INDUSTRIELLEN GESUNDHEITSWIRTSCHAFT Berlin, Hinter der deutschen industriellen Gesundheitswirtschaft stehen die Unternehmen Braun Melsungen, Bayer HealthCare, Boehringer Ingelheim und Fresenius wohlklingende Namen von Unternehmen im Gesundheitswesen. Wen kann es wundern, dass Hermann Gröhe diesem Konsortium seine Aufwartung machte, eine Rede hielt, den Statements von Vertretern dieser Firmen aufmerksam lauschte und dann noch etliche Zeit auf dem Event angeregt plauderte? In seiner Rede hob der Minister die Bedeutung der industriellen Gesundheitswirtschaft für das Gesundheitswesen, deren Rolle für Deutschland in der Weltwirtschaft und für den Arbeitsmarkt mit 5 Mio. Beschäftigten hervor. Ihm sei an einer guten Zusammenarbeit gelegen. Diese Unternehmen ermöglichten auch eine medizinische Versorgung auf der Höhe der Zeit und könnten die Standards in eine gute Zukunft tragen, um die kommenden Herausforderungen zu meistern. Die Anforderungen änderten sich, eine Hermann Gröhe (BMG) 38
39 Boulevard v.l.: Henning Fahrenkamp (BPI), Gabriela Soskuty (B. Braun) internationale Verantwortung, wie aktuell Ebola beweise, sei notwendig. Ohne Forschung sei dies nicht zu schultern. Eine weitere Herausforderung sei die älter werdende Gesellschaft, das Pflegestärkungsgesetz sei ein Beitrag dazu, wie auch die Arbeit der Bund-Länder AG Krankenhausfinanzierung, wie moderne Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten. Er erwarte einen Beitrag der Industrie, die Versorgung auf dem Land zu sichern z.b. durch Telemedizin. Der Stadt-Land-Graben, der in der Bundesrepublik geschlossen worden sei, dürfe nicht wieder aufbrechen. Die Beschäftigten müssten gute Arbeitsbedingungen vorfinden, die Arbeitgeber verlässliche Rahmenbedingungen, um den Innovationsstandort Deutschland zu stärken. Dazu gehöre auch die Finanzierbarkeit des Gesundheitswesens ohne steigende Beiträge. Innovationen müssten den Patienten schnell zur Verfügung gestellt werden. Die Bundesregierung habe schon viel dazu getan, den Prozess Forschungspolitik Medizintechnik initiiert, den Gesundheitswirtschaftskongress durchgeführt und den Pharmadialog angestoßen, um die Herausforderungen zu meistern. Auch die Exportwirtschaftsinitiative Gesundheitswirtschaft sei ein wichtiger Beitrag die deutsch-chinesischen Konsultationen habe man genutzt, um verlässliche Rahmenbedingungen und einen guten Marktzugang auch für Mittelständler einzufordern. Konkret hätten sie die Pharmaindustrie und die Medizintechnik angesprochen, zur Stärkung des Wohlergehens der Menschen weltweit und zur Stärkung der deutschen Industrie. Das Einführungsstatement hielt Markus Müschenich, Concept Health ( Hier geht es mehr um den Weg vom guten alten Gesundheitswesen Bismarkscher Prägung hin zu einem Gesundheitssystem der Zukunft. Es gilt darüber nachzudenken, wie ein Gesundheitssystem aussehen kann, das wirklich seinen Namen verdient. Eigenbeschreibung). v.l.: Georg Baum (DKG), Joachim Breuer (DGUV) 39
40 Boulevard Markus Müschenich (Concept Health) v.l.: Ingrid Fischbach (BMG), Ulrike Elsner (vdek) Eine strategische Frühaufklärung sei für jedes Management wichtig, so sein Grundstatement. Dann stellte er einige Gesundheitsapps mit bedeutungsvoller Miene vor und beklagte, dass die Ärztekammern Sturm gegen derartige Apps aufgrund des Verbots von Ferndiagnosen liefen, wogegen er sich wiederum massiv in Stellung brachte. Seine Argumente waren eine Reduzierung der Arzt-Patienten-Kontakte und eine Kostenreduzierung. Diese Apps brächten Medizin in ganzer Breite und zwar via Internet. Damit entstehe ein neuer Metasektor, der die traditionellen Sektoren im Gesundheitswesen mit nur einer Zielgruppe, den Patienten, überwinde. So entstehe ein neuer Gesundheitsmarkt mit Milliardenerwartungen an Umsatz, der das traditionelle Gesundheitswesen entlaste, und schon würden sich in diesen neuen Markt renommierte Institutionen wie die Mayo Kliniken einklinken. Gute Medizin werde sich in Zukunft auch im Internet abspielen. Dies alles ist nicht neu, Gesundheitsapps sind seit einigen Jahren fest etablierte Größen, auch was die konkrete Versorgung angeht. Ein völlig anderer Punkt ist, dass bisher für sie kein rechtlicher Rahmen und keine Zertifizierung zur Verfügung steht, dass sie Wildgewächse sind, und dass eine Ferndiagnose rechtlich aus guten Gründen auch zumindest prekär ist. Aber auf einen rechtlichen Rahmen, der auch zum Schutz der Patienten unbedingt notwendig ist, schien Markus Müschenich weniger zu rekurrieren als auf die wirtschaftlichen Möglichkeiten. Danach kamen die Veranstalter des parlamentarischen Abends zu Wort. Zuerst sprach Marco Annas, Leiter Gesundheitspolitik Bayer HealthCare, in Vertretung 40
41 Boulevard Arbeitsplätze. Sie fühlten sich von dieser Regierung gut verstanden und hofften auf ein gutes Ergebnis des Pharmadialogs. Für das AMNOG müsse eine neue Balance gefunden werden. Marco Annas (Bayer HealthCare) Meinrad Lugan, Vorstand Braun Melsungen AG, führte aus, dass bei 20 Mrd. Exportumsatz 2/3 auf dem Heimatmarkt erwirtschaftet werden müssten. des an Grippe erkrankten Wolfgang Plischke. Es sei revolutionär, dass sie in dieser Konstellation gemeinsam aufträten. Sie alle hätten ihre Basis in Deutschland und seien auf dem Feld des Gesundheitswesens tätig. Selbstkritisch müsse er bekennen, die Industrie habe bisher oft in Silos gedacht, Fortschritte seien aber nur zu erzielen, wenn man zusammenarbeite. Meinrad Lugan (Braun Melsungen) Bayer HealthCare umfasse 12 Standorte in Deutschland, sie seien hier stark verwurzelt und investierten hier, auch in Köpfe. Sie kooperierten mit Universitäten, zahlten ihre Steuern in Deutschland und schafften hier Innovationen wie jener Chip, mit dem eine bestimmte Gruppe von Blinden heute schon mehr als schemenhaft sehen könnte, dürften doch nicht einer 4½ Jahre andauernden Nutzenbewertung unterworfen werden, denn dann werde das Produkt längst überholt sein. Zeit sei ein wichtiger Faktor für den Erfolg. Für Boehringer Ingelheim sprach Stefan Rinn, Geschäftsführer Deutschland. Die Lebenserwartung sei in den letzten 10 Jahren um 5 Jahre angestiegen, ein Erfolg innovativer Medikamente. 41
42 Boulevard für die Patienten Innovationen zügig eingeführt würden. Gesundheitswirtschaft dürfe man nicht nur unter Kostenaspekten betrachten, sondern auch volkswirtschaftlich. Fresenius sei nicht nur ein Hersteller, sondern auch der größte Stefan Rinn (Boehringer Ingelheim) Er berichtete weiterhin von Erleichterungen für an Krebs Erkrankte durch innovative Medikamente. Obwohl der Umsatz in Deutschland nur bei 7% liege, hätten sie zu 50% in Deutschland investiert, hier arbeiteten 30% der Mitarbeiter. Ob sie hier aber eine risikoadäquate Rendite erwirtschafteten, sei fraglich. Der Standort Deutschland sei immer weniger bereit, für Innovationen zu zahlen. In den USA fragten sich die Bürger, ob es richtig sei, dass die Amerikaner die Hauptkosten tragen müssten. Es dürfe doch nicht sein, dass Deutschland immer weniger zu F&E beitrage. Der Pharmadialog sei eine Chance für eine Balance zwischen Kostendämpfung und Innovationen für Patienten. Als letzter Vertreter der industriellen Gesundheitswirtschaft sprach Joachim Weith, Geschäftsführer der Fresenius ProServe GmbH. Sie engagierten sich gemeinsam dafür, dass Joachim Weith (Fresenius) europäische Krankenausbetreiber, der größte Arbeitgeber im Gesundheitswesen mit 5 Mrd. Umsatz. Die Gesundheitswirtschaft weise eine höhere Exportquote auf als die Automobilindustrie. Man müsse wegkommen von der Kostendeckungsdiskussion. Hermann Gröhe antwortete auf die Statements mit wohlgesetzten Worten. Er spüre das gemeinsame Ziel, sei überzeugt, dass die geplanten Maßnahmen alles beschleunigen würden. Einiges seien auch Antworten auf Fehlentwicklungen der 42
43 Boulevard Vergangenheit. Die Frage sei, was gute regulatorische Antworten seien. Sie hätten schon einiges gemeinsam entwickelt wie das Prothesenregister. Er sei hoffnungsfroh für die Zukunft. Dann wurden die Gäste in der edlen Sky Lobby in der DZ Bank zum wohlverdienten Buffet und zu vielen interessanten Gesprächen, auch mit dem Minister, der Staatssekretärin Ingrid Fischbach, dem Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses und vielen Abgeordneten entlassen. 43
44 Boulevard Volker Leienbach (PKV Verband) Die Gäste schienen sich an diesem Abend wohl zu fühlen und zeigten sich aufgeschlossen. Die Firmen des Konsortiums können höchst zufrieden sein, sie können ihren 1. Parlamentarischen Abend als vollen Erfolg buchen. v.l.: Roxana-Diana Calin (Büro MdB Erich Irlsdorfer), Katrin Witzel, Markus Griffig (beide Büro MdB CDU Roy Kühne), Stephan Wilke (CDU/CSU-Fraktion), Hartwig Bohne (Büro MdB Tino Sorge), Hermann Gröhe (BMG), Katharina Altenburg (Büro MdB CDU Dietrich Monstadt) 44
Würde des Menschen im letzten Lebensabschnitt Palliativ- u. Hospiz-Versorgung sichern
 Würde des Menschen im letzten Lebensabschnitt Palliativ- u. Hospiz-Versorgung sichern Gesetzentwürfe zur Sterbehilfe Hospiz- und Palliativgesetz (HPG) Fachkonferenz der LSVfS Sterbehilfe (?) Aktuelle Gesetzeslage
Würde des Menschen im letzten Lebensabschnitt Palliativ- u. Hospiz-Versorgung sichern Gesetzentwürfe zur Sterbehilfe Hospiz- und Palliativgesetz (HPG) Fachkonferenz der LSVfS Sterbehilfe (?) Aktuelle Gesetzeslage
vdek-bewertung des Koalitionsvertrages Deutschlands Zukunft gestalten von CDU, CSU und SPD für die ambulante Versorgung
 Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung Der vdek bewertet positiv, dass die Koalition mehr Anreize zur Ansiedlung von Ärzten in strukturschwachen Gebieten schaffen und flexiblere Rahmenbedingungen
Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung Der vdek bewertet positiv, dass die Koalition mehr Anreize zur Ansiedlung von Ärzten in strukturschwachen Gebieten schaffen und flexiblere Rahmenbedingungen
Rolle der Qualitätsdaten in der Krankenhausplanung
 Prof. Dr. med. Susanne Schwalen Geschäftsführende Ärztin der Ärztekammer Nordrhein Rolle der Qualitätsdaten in der Krankenhausplanung Deutscher Krankenhaustag, BDI Symposium, Düsseldorf, 17.11.2015 Ärztekammer
Prof. Dr. med. Susanne Schwalen Geschäftsführende Ärztin der Ärztekammer Nordrhein Rolle der Qualitätsdaten in der Krankenhausplanung Deutscher Krankenhaustag, BDI Symposium, Düsseldorf, 17.11.2015 Ärztekammer
Zukunftsrolle der Krankenkassen
 Gestalten oder Verwalten? Zukunftsrolle der Krankenkassen 15. Plattform Gesundheit des IKK e.v. 9.11.2016, 15 Uhr, Kalkscheune Die Krankenkassen stehen im Spannungsfeld zwischen dem proklamierten Wettbewerb
Gestalten oder Verwalten? Zukunftsrolle der Krankenkassen 15. Plattform Gesundheit des IKK e.v. 9.11.2016, 15 Uhr, Kalkscheune Die Krankenkassen stehen im Spannungsfeld zwischen dem proklamierten Wettbewerb
Inhalt. Worum es heute geht. Wie funktioniert Gesundheitspolitik? Warum wollen die Länder mehr Mitsprache?
 Zweiter Meilensteinworkshop zur Brandenburger Fachkräftestudie Pflege Forum 1 Impuls Möglichkeiten und Grenzen landespolitischer Initiativen in den Bereichen (Seniorenpolitik, Pflege und) Gesundheit Bettina
Zweiter Meilensteinworkshop zur Brandenburger Fachkräftestudie Pflege Forum 1 Impuls Möglichkeiten und Grenzen landespolitischer Initiativen in den Bereichen (Seniorenpolitik, Pflege und) Gesundheit Bettina
Thomas Ballast, stellv. Vorsitzender des Vorstands, Berlin, 2. Oktober 2014
 Thomas Ballast, stellv. Vorsitzender des Vorstands, Berlin, 2. Oktober 2014 Agenda Der gesetzliche Rahmen steht 3 Innovationen: der Prozess im stationären Sektor 5 Probleme der heutigen Krankenhausfinanzierung
Thomas Ballast, stellv. Vorsitzender des Vorstands, Berlin, 2. Oktober 2014 Agenda Der gesetzliche Rahmen steht 3 Innovationen: der Prozess im stationären Sektor 5 Probleme der heutigen Krankenhausfinanzierung
Das neue Hospiz- und Palliativgesetz, ein Beitrag zur würdevollen Versorgung am Ende des Lebens. Till Hiddemann Bundesministerium für Gesundheit
 Das neue Hospiz- und Palliativgesetz, ein Beitrag zur würdevollen Versorgung am Ende des Lebens Till Hiddemann Bundesministerium für Gesundheit Sterbende Menschen gehören in die Mitte der Gesellschaft
Das neue Hospiz- und Palliativgesetz, ein Beitrag zur würdevollen Versorgung am Ende des Lebens Till Hiddemann Bundesministerium für Gesundheit Sterbende Menschen gehören in die Mitte der Gesellschaft
MLP Gesundheitsreport November 2008, Berlin
 MLP Gesundheitsreport 2008 26. November 2008, Berlin Untersuchungssteckbrief Methodische Gesamtverantwortung und Durchführung: Institut für Demoskopie Allensbach Bevölkerungsbefragung Methode: Face-to-face-Interviews
MLP Gesundheitsreport 2008 26. November 2008, Berlin Untersuchungssteckbrief Methodische Gesamtverantwortung und Durchführung: Institut für Demoskopie Allensbach Bevölkerungsbefragung Methode: Face-to-face-Interviews
Einstellungen der Bevölkerung zum Thema GKV-Finanzierung und -Versorgung
 Ergebnisbericht Auftraggeber: Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) Berlin,. Januar 08 70/q768 Mü/Hm, Bü Datenblatt Stichprobe:.000 gesetzlich Krankenversicherte ab 8 Jahren Auswahlverfahren: Auswahl der
Ergebnisbericht Auftraggeber: Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) Berlin,. Januar 08 70/q768 Mü/Hm, Bü Datenblatt Stichprobe:.000 gesetzlich Krankenversicherte ab 8 Jahren Auswahlverfahren: Auswahl der
Qualitätssicherung in der medizinischen Versorgung Pressegespräch
 Qualitätssicherung in der medizinischen Versorgung Pressegespräch Was will der GKV-Spitzenverband erreichen? Dr. Doris Pfeiffer Vorstandsvorsitzende, GKV-Spitzenverband Ł SGB V 2 Satz 3 Qualität und Wirksamkeit
Qualitätssicherung in der medizinischen Versorgung Pressegespräch Was will der GKV-Spitzenverband erreichen? Dr. Doris Pfeiffer Vorstandsvorsitzende, GKV-Spitzenverband Ł SGB V 2 Satz 3 Qualität und Wirksamkeit
Hilfe im Sterben ist ein Gebot der Menschlichkeit
 Bundestag beschließt Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung: Hilfe im Sterben ist Bundestag beschließt Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung Hilfe im Sterben
Bundestag beschließt Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung: Hilfe im Sterben ist Bundestag beschließt Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung Hilfe im Sterben
Empfehlungen zur Krankenhausplanung 2.0
 Empfehlungen zur Pressekonferenz 21. Oktober 2014 Referenten: Dr. Boris Augurzky, Prof. Dr. med. Christoph Dodt Projektteam: Dr. Boris Augurzky, Prof. Dr. Andreas Beivers, Niels Straub, Caroline Veltkamp
Empfehlungen zur Pressekonferenz 21. Oktober 2014 Referenten: Dr. Boris Augurzky, Prof. Dr. med. Christoph Dodt Projektteam: Dr. Boris Augurzky, Prof. Dr. Andreas Beivers, Niels Straub, Caroline Veltkamp
Weiterentwicklung der Palliativ- und Hospizversorgung Im Freistaat Sachsen
 Weiterentwicklung der Palliativ- und Hospizversorgung Im Freistaat Sachsen Rene Kellner Referent Pflege Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) Landesvertretung Sachsen 25. Runder Tisch Pflege am 19.9.2016
Weiterentwicklung der Palliativ- und Hospizversorgung Im Freistaat Sachsen Rene Kellner Referent Pflege Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) Landesvertretung Sachsen 25. Runder Tisch Pflege am 19.9.2016
Palliative Versorgung in Deutschland was haben wir was brauchen wir.?
 Palliative Versorgung in Deutschland was haben wir was brauchen wir.? Sozialmedizinische Begutachtungsgrundlagen ambulanter palliativer Versorgungsbedarfe Hamburg 20.Mai 2015 Dr. Joan Elisabeth Panke Seniorberaterin
Palliative Versorgung in Deutschland was haben wir was brauchen wir.? Sozialmedizinische Begutachtungsgrundlagen ambulanter palliativer Versorgungsbedarfe Hamburg 20.Mai 2015 Dr. Joan Elisabeth Panke Seniorberaterin
16. Plattform Gesundheit des IKK e.v. Notfall Notversorgung! Von Steuerungs- und Strukturdefiziten. Begrüßungsrede Hans-Jürgen Müller
 Begrüßungsrede Hans-Jürgen Müller Sehr geehrte Frau Senatorin, sehr geehrte Vertreter aus dem Deutschen Bundestag und aus den Bundesministerien, sehr geehrte Referenten und Diskutanten auf dem Podium,
Begrüßungsrede Hans-Jürgen Müller Sehr geehrte Frau Senatorin, sehr geehrte Vertreter aus dem Deutschen Bundestag und aus den Bundesministerien, sehr geehrte Referenten und Diskutanten auf dem Podium,
Medizin trifft Recht: Gibt es Regelungslücken in der Qualitätssicherung des SGB V?
 Medizin trifft Recht: Gibt es Regelungslücken in der Qualitätssicherung des SGB V? QS-Konferenz des G-BA, Potsdam, 29.11.2010 Dr. Ilona Köster-Steinebach Agenda 1. Einleitung 2. Fragen zur Qualitätssicherung
Medizin trifft Recht: Gibt es Regelungslücken in der Qualitätssicherung des SGB V? QS-Konferenz des G-BA, Potsdam, 29.11.2010 Dr. Ilona Köster-Steinebach Agenda 1. Einleitung 2. Fragen zur Qualitätssicherung
Mechthild Kern, Mainz. Statement zum Thema. "EMNID-Umfrage: Was hält die Bevölkerung von der Positivliste?"
 Mechthild Kern, Mainz Statement zum Thema "EMNID-Umfrage: Was hält die Bevölkerung von der Positivliste?" Wie vom Gesetzgeber beschlossen, soll im Laufe dieses Jahres von einer eigens für diese Aufgabe
Mechthild Kern, Mainz Statement zum Thema "EMNID-Umfrage: Was hält die Bevölkerung von der Positivliste?" Wie vom Gesetzgeber beschlossen, soll im Laufe dieses Jahres von einer eigens für diese Aufgabe
Interprofessioneller Pflegekongress Rechtliche Grauzone in der Versorgung von älteren Palliativ-Patienten
 Interprofessioneller Pflegekongress Rechtliche Grauzone in der Versorgung von älteren Palliativ-Patienten - Richtlinie zur häuslichen Krankenpflege - Delegationsrecht Gifhorner Palliativ- und Hospiz- Netz
Interprofessioneller Pflegekongress Rechtliche Grauzone in der Versorgung von älteren Palliativ-Patienten - Richtlinie zur häuslichen Krankenpflege - Delegationsrecht Gifhorner Palliativ- und Hospiz- Netz
Fakten zum deutschen Gesundheitssystem.
 Fakten zum deutschen Gesundheitssystem. Neuauflage Nov. 2016 Das Deutsche Gesundheitssystem ist eines der besten weltweit. Die Zufriedenheit der Bürger mit ihrer medizinischen Versorgung liegt heute bei
Fakten zum deutschen Gesundheitssystem. Neuauflage Nov. 2016 Das Deutsche Gesundheitssystem ist eines der besten weltweit. Die Zufriedenheit der Bürger mit ihrer medizinischen Versorgung liegt heute bei
DAK-Gesundheit im Dialog Patientenorientierung im Gesundheitswesen
 DAK-Gesundheit im Dialog Patientenorientierung im Gesundheitswesen Der aktive und informierte Patient Herausforderung für den Medizinbetrieb und Erfolgsfaktor für das Gesundheitswesen? Präsident der Bayerischen
DAK-Gesundheit im Dialog Patientenorientierung im Gesundheitswesen Der aktive und informierte Patient Herausforderung für den Medizinbetrieb und Erfolgsfaktor für das Gesundheitswesen? Präsident der Bayerischen
Wie weit ist der Aufbau klinischer Krebsregister in Deutschland?
 Wie weit ist der Aufbau klinischer Krebsregister in Deutschland? Pressekonferenz des GKV-Spitzenverbandes Berlin, 25. August 2016 Dr. Doris Pfeiffer, Vorstandsvorsitzende Klinische Krebsregister - Einführung
Wie weit ist der Aufbau klinischer Krebsregister in Deutschland? Pressekonferenz des GKV-Spitzenverbandes Berlin, 25. August 2016 Dr. Doris Pfeiffer, Vorstandsvorsitzende Klinische Krebsregister - Einführung
Statement. In Würde sterben Zur aktuellen Diskussion über Sterbehilfe, Hospiz- und Palliativstrukturen. Sterbehilfe im Sinne einer Sterbebegleitung
 Statement In Würde sterben Zur aktuellen Diskussion über Sterbehilfe, Hospiz- und Palliativstrukturen Sterbehilfe im Sinne einer Sterbebegleitung Dr. med. Max Kaplan Präsident der Bayerischen Landesärztekammer
Statement In Würde sterben Zur aktuellen Diskussion über Sterbehilfe, Hospiz- und Palliativstrukturen Sterbehilfe im Sinne einer Sterbebegleitung Dr. med. Max Kaplan Präsident der Bayerischen Landesärztekammer
Arbeiten in Deutschland. Eine Einführung für ausländische Ärzte in das deutsche Gesundheitssystem
 Arbeiten in Deutschland Eine Einführung für ausländische Ärzte in das deutsche Gesundheitssystem Das Deutsche Gesundheitssystem im Überblick 1. Krankenversicherung: GKV und PKV 2. Ambulanter und stationärer
Arbeiten in Deutschland Eine Einführung für ausländische Ärzte in das deutsche Gesundheitssystem Das Deutsche Gesundheitssystem im Überblick 1. Krankenversicherung: GKV und PKV 2. Ambulanter und stationärer
Es gilt das gesprochene Wort.
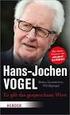 Statement von Dr. Doris Pfeiffer, Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes Es gilt das gesprochene Wort. MDK - drei Buchstaben, die die Versorgung von 70 Mio. gesetzlich Versicherten in Deutschland
Statement von Dr. Doris Pfeiffer, Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes Es gilt das gesprochene Wort. MDK - drei Buchstaben, die die Versorgung von 70 Mio. gesetzlich Versicherten in Deutschland
Hochschulmedizin im Gesundheitswesen: Sind die Universitätsklinika für die GKV Krankenhäuser wie alle anderen?
 Dr. Christopher h Hermann Vorstandsvorsitzender Hochschulmedizin im Gesundheitswesen: Sind die Universitätsklinika für die GKV Krankenhäuser wie alle anderen? IX. Innovationskongress der Deutschen Hochschulmedizin
Dr. Christopher h Hermann Vorstandsvorsitzender Hochschulmedizin im Gesundheitswesen: Sind die Universitätsklinika für die GKV Krankenhäuser wie alle anderen? IX. Innovationskongress der Deutschen Hochschulmedizin
Wettbewerb im Gesundheitswesen Funktioniert der Kassenwettbewerb? Zur Notwendigkeit einer Solidarischen Wettbewerbsordnung
 Wettbewerb im Gesundheitswesen Funktioniert der Kassenwettbewerb? Zur Notwendigkeit einer Solidarischen Wettbewerbsordnung Nürnberg, 5.März 2015 Prof. Dr. h.c. Herbert Rebscher Vorstandsvorsitzender Gesundheitspolitische
Wettbewerb im Gesundheitswesen Funktioniert der Kassenwettbewerb? Zur Notwendigkeit einer Solidarischen Wettbewerbsordnung Nürnberg, 5.März 2015 Prof. Dr. h.c. Herbert Rebscher Vorstandsvorsitzender Gesundheitspolitische
Krankenhaus-Hygiene Über das Richtige berichten - Anforderungen an die Datenerfassung und das Reporting
 Krankenhaus-Hygiene Über das Richtige berichten - Anforderungen an die Datenerfassung und das Reporting Ingo Pfenning Stationäre Versorgung Techniker Krankenkasse Vortrag am 15.Mai 2012 in Berlin Hygienesymposium
Krankenhaus-Hygiene Über das Richtige berichten - Anforderungen an die Datenerfassung und das Reporting Ingo Pfenning Stationäre Versorgung Techniker Krankenkasse Vortrag am 15.Mai 2012 in Berlin Hygienesymposium
Lebenserwartung der Deutschen: Analyse, Prognose und internationaler Vergleich. 18. Juli 2008 Berlin. Statement von:
 Lebenserwartung der Deutschen: Analyse, Prognose und internationaler Vergleich 18. Juli 2008 Berlin Statement von: Cornelia Yzer Hauptgeschäftsführerin des Verbandes Forschender Arzneimittelhersteller
Lebenserwartung der Deutschen: Analyse, Prognose und internationaler Vergleich 18. Juli 2008 Berlin Statement von: Cornelia Yzer Hauptgeschäftsführerin des Verbandes Forschender Arzneimittelhersteller
Klinische Krebsregister
 Klinische Krebsregister Dorothee Krug Abteilung Stationäre Versorgung Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) XVIII. Gesundheitspolitisches Symposium 28. Oktober 2016 in Magdeburg Krebserkrankungen in Deutschland
Klinische Krebsregister Dorothee Krug Abteilung Stationäre Versorgung Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) XVIII. Gesundheitspolitisches Symposium 28. Oktober 2016 in Magdeburg Krebserkrankungen in Deutschland
Erste Pflegenoten zeigen gute und schlechte Qualität der Heime - Transparenzkriterien wirken
 MDS und GKV-Spitzenverband Erste Pflegenoten zeigen gute und schlechte Qualität der Heime - Transparenzkriterien wirken Berlin/Essen (8. Oktober 2009) - In der Zeit vom 1. Juli bis Mitte September sind
MDS und GKV-Spitzenverband Erste Pflegenoten zeigen gute und schlechte Qualität der Heime - Transparenzkriterien wirken Berlin/Essen (8. Oktober 2009) - In der Zeit vom 1. Juli bis Mitte September sind
Erwartungen an die Hilfsmittelversorgung (in der GKV) aus Sicht des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG)
 1. Wittener Tagung zur Hilfsmittelversorgung am 17. September 2010 Erwartungen an die Hilfsmittelversorgung (in der GKV) aus Sicht des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) Hans-Georg Will, Dir. u. Prof.,
1. Wittener Tagung zur Hilfsmittelversorgung am 17. September 2010 Erwartungen an die Hilfsmittelversorgung (in der GKV) aus Sicht des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) Hans-Georg Will, Dir. u. Prof.,
Verordnete Transparenz
 Verordnete Transparenz Keyfacts - Für mehr Transparenz geht die Pharmabranche diesen Schritt freiwillig - Nur rund ein Drittel der Ärzte beteiligt sich bisher - In den USA ist die Transparenz bedeutend
Verordnete Transparenz Keyfacts - Für mehr Transparenz geht die Pharmabranche diesen Schritt freiwillig - Nur rund ein Drittel der Ärzte beteiligt sich bisher - In den USA ist die Transparenz bedeutend
MSD Prinzipien der Zusammenarbeit mit Patientenorganisationen
 MSD Prinzipien der Zusammenarbeit mit Patientenorganisationen Transparenz Vertrauen Partnerschaft Transparenz VerTrauen Inhalt 1. Unsere Mission für Patienten Seite 3 2. Das gesundheitspolitische Umfeld
MSD Prinzipien der Zusammenarbeit mit Patientenorganisationen Transparenz Vertrauen Partnerschaft Transparenz VerTrauen Inhalt 1. Unsere Mission für Patienten Seite 3 2. Das gesundheitspolitische Umfeld
Die Herausforderungen an das Gesundheitswesen in Sachsen-Anhalt
 Die Herausforderungen an das Gesundheitswesen in Sachsen-Anhalt Vor dem Hintergrund einer ständig alternden Bevölkerung Dr. Dr. Reinhard Nehring Innovationsforum MED.TEC.INTEGRAL 22./23.09.2008 Demografischer
Die Herausforderungen an das Gesundheitswesen in Sachsen-Anhalt Vor dem Hintergrund einer ständig alternden Bevölkerung Dr. Dr. Reinhard Nehring Innovationsforum MED.TEC.INTEGRAL 22./23.09.2008 Demografischer
Beauftragung ambulanter Hospizdienste mit Sterbebegleitung in Berliner Krankenhäusern gem. 39a Abs. 2 Satz 2 SGB V *
 Beauftragung ambulanter Hospizdienste mit Sterbebegleitung in Berliner Krankenhäusern gem. 39a Abs. 2 Satz 2 SGB V * Christian Kienle e.v. * Stand des Hospiz- und Palliativgesetzes nach der 2. und 3. Lesung
Beauftragung ambulanter Hospizdienste mit Sterbebegleitung in Berliner Krankenhäusern gem. 39a Abs. 2 Satz 2 SGB V * Christian Kienle e.v. * Stand des Hospiz- und Palliativgesetzes nach der 2. und 3. Lesung
Der Innovationsfonds: Stand der Dinge. November 2017
 Der Innovationsfonds: Stand der Dinge November 2017 Der Innovationsfonds 2016 bis 2019: 300 Mio. p. a. Verwendung Förderung neuer Versorgungsformen: 225 Mio. p.a. Förderung von Versorgungsforschung: 75
Der Innovationsfonds: Stand der Dinge November 2017 Der Innovationsfonds 2016 bis 2019: 300 Mio. p. a. Verwendung Förderung neuer Versorgungsformen: 225 Mio. p.a. Förderung von Versorgungsforschung: 75
Methoden der evidenzbasierten Medizin und des Qualitätsmanagements im Kontext der Aufgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses
 Methoden der evidenzbasierten Medizin und des Qualitätsmanagements im Kontext der Aufgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses Dr. Barbara Pietsch Gemeinsamer Bundesausschuss, Fachberatung Medizin 8. Jahrestagung
Methoden der evidenzbasierten Medizin und des Qualitätsmanagements im Kontext der Aufgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses Dr. Barbara Pietsch Gemeinsamer Bundesausschuss, Fachberatung Medizin 8. Jahrestagung
Die Würde des Menschen ist unantastbar Eine Herausforderung moderner Palliativmedizin
 1 Die Würde des Menschen ist unantastbar Eine Herausforderung moderner Palliativmedizin Rede zur Eröffnung der Palliativstation am St.-Josef-Hospital in Bochum am 10.02.2016 Sehr geehrter Herr Dr. Hanefeld
1 Die Würde des Menschen ist unantastbar Eine Herausforderung moderner Palliativmedizin Rede zur Eröffnung der Palliativstation am St.-Josef-Hospital in Bochum am 10.02.2016 Sehr geehrter Herr Dr. Hanefeld
Gesundheit und Pflege gerecht finanzieren
 Gesundheit und Pflege gerecht finanzieren Eine Studie zu einer neuen Versicherung für alle Bürger und Bürgerinnen Hier lesen Sie einen Beschluss von der Fraktion DIE LINKE im Bundestag. Der Beschluss ist
Gesundheit und Pflege gerecht finanzieren Eine Studie zu einer neuen Versicherung für alle Bürger und Bürgerinnen Hier lesen Sie einen Beschluss von der Fraktion DIE LINKE im Bundestag. Der Beschluss ist
Beschluss des G-BA (nach 91 Abs. 4 SGB V) vom : Fragenkatalog
 Fragenkatalog für Empfehlungen geeigneter chronischer Krankheiten für neue strukturierte Behandlungsprogramme (DMP) Erläuterungen und Ausfüllhinweise Das Ziel der vom Gesetzgeber initiierten strukturierten
Fragenkatalog für Empfehlungen geeigneter chronischer Krankheiten für neue strukturierte Behandlungsprogramme (DMP) Erläuterungen und Ausfüllhinweise Das Ziel der vom Gesetzgeber initiierten strukturierten
SAPV Die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung
 SAPV Die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung von Gliederung Grundlagen Vorraussetzungen Ziele Anspruchs SAPV Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung Neue Richtlinie Beschluss des gemeinsamen
SAPV Die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung von Gliederung Grundlagen Vorraussetzungen Ziele Anspruchs SAPV Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung Neue Richtlinie Beschluss des gemeinsamen
25. März 2010, 15 Uhr Collegium Hungaricum Berlin
 Plattform Gesundheit des IKK e.v. 25. März 2010, 15 Uhr Collegium Hungaricum Berlin Seit 126 Jahren gelten für die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) in Deutschland Solidarität und Subsidiarität: Reich
Plattform Gesundheit des IKK e.v. 25. März 2010, 15 Uhr Collegium Hungaricum Berlin Seit 126 Jahren gelten für die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) in Deutschland Solidarität und Subsidiarität: Reich
Die Notwendigkeit der Verzahnung - Perspektive Stationär -
 Die Notwendigkeit der Verzahnung - Perspektive Stationär - Verbandsdirektor der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft 15. April 2015 Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin
Die Notwendigkeit der Verzahnung - Perspektive Stationär - Verbandsdirektor der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft 15. April 2015 Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin
Krankenhausversorgung neu geplant Offene Baustellen nach dem KHSG
 6. MSD Forum GesundheitsPARTNER Krankenhausversorgung neu geplant Offene Baustellen nach dem KHSG 14. September 2016 Prof. Dr. Boris Augurzky Problemfelder im Krankenhausbereich im Jahr 2015 1 2 3 4 5
6. MSD Forum GesundheitsPARTNER Krankenhausversorgung neu geplant Offene Baustellen nach dem KHSG 14. September 2016 Prof. Dr. Boris Augurzky Problemfelder im Krankenhausbereich im Jahr 2015 1 2 3 4 5
Grußwort. Organspende für Transplantationsbeauftragte. von Dr. Heidemarie Lux Vizepräsidentin der Bayerischen Landesärztekammer
 Grußwort Organspende für Transplantationsbeauftragte von Dr. Heidemarie Lux Vizepräsidentin der Bayerischen Landesärztekammer Seminar am 21. März 2013 in München Es gilt das gesprochene Wort! Sehr geehrte
Grußwort Organspende für Transplantationsbeauftragte von Dr. Heidemarie Lux Vizepräsidentin der Bayerischen Landesärztekammer Seminar am 21. März 2013 in München Es gilt das gesprochene Wort! Sehr geehrte
Personalmangel gefährdet Ihre Gesundheit!
 Personalmangel gefährdet Ihre Gesundheit! Spätdienst auf einer Intensivstation. Melanie P. und Jürgen A. sind für sieben schwerkranke Patientinnen und Patienten verantwortlich. Für die Intensivpflege ist
Personalmangel gefährdet Ihre Gesundheit! Spätdienst auf einer Intensivstation. Melanie P. und Jürgen A. sind für sieben schwerkranke Patientinnen und Patienten verantwortlich. Für die Intensivpflege ist
Kopfpauschale vs. Bürgerversicherung
 Kopfpauschale vs. Bürgerversicherung Bärbel Brünger Pressesprecherin des Verbandes der Ersatzkassen NRW vdek e.v. Veranstaltung in Schloss-Holte-Stukenbrock - 14.April 2010 Warum brauchen wir eine Reform
Kopfpauschale vs. Bürgerversicherung Bärbel Brünger Pressesprecherin des Verbandes der Ersatzkassen NRW vdek e.v. Veranstaltung in Schloss-Holte-Stukenbrock - 14.April 2010 Warum brauchen wir eine Reform
Fakten zum deutschen Gesundheitssystem.
 Fakten zum deutschen Gesundheitssystem. Neuauflage 2018 HOHE ZUFRIEDENHEIT Das deutsche Gesundheitssystem ist eines der besten weltweit. Die große Mehrheit der Bürger stellt unserem Gesundheitssystem ein
Fakten zum deutschen Gesundheitssystem. Neuauflage 2018 HOHE ZUFRIEDENHEIT Das deutsche Gesundheitssystem ist eines der besten weltweit. Die große Mehrheit der Bürger stellt unserem Gesundheitssystem ein
Der G-BA und seine Aufgaben sowie Zielsetzungen
 Der G-BA und seine Aufgaben sowie Zielsetzungen 8. Rheinischer Kongress für Gesundheitswirtschaft 22. September 2010 Universitätsklinikum Köln Referentin: Dr. Dorothea Bronner, G-BA Seite 1 22. September
Der G-BA und seine Aufgaben sowie Zielsetzungen 8. Rheinischer Kongress für Gesundheitswirtschaft 22. September 2010 Universitätsklinikum Köln Referentin: Dr. Dorothea Bronner, G-BA Seite 1 22. September
VKD / VDGH Führungskräfteseminar Berlin, 25./26. Februar Krankenhauspolitik und Qualitätsoffensive. Statement der DKG
 VKD / VDGH Führungskräfteseminar Berlin, 25./26. Februar 2015 Krankenhauspolitik und Qualitätsoffensive Statement der DKG Dr. med. Bernd Metzinger M.P.H. Geschäftsführer Personalwesen und Krankenhausorganisation
VKD / VDGH Führungskräfteseminar Berlin, 25./26. Februar 2015 Krankenhauspolitik und Qualitätsoffensive Statement der DKG Dr. med. Bernd Metzinger M.P.H. Geschäftsführer Personalwesen und Krankenhausorganisation
Stellungnahme. des Medizinischen Dienstes. des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e.v. (MDS) zur Erörterung des
 Stellungnahme des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e.v. (MDS) zur Erörterung des Änderungsantrages der Fraktionen CDU/CSU und SPD - Ausschussdrucksache 18(14)0172.2 PSG-II
Stellungnahme des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e.v. (MDS) zur Erörterung des Änderungsantrages der Fraktionen CDU/CSU und SPD - Ausschussdrucksache 18(14)0172.2 PSG-II
Wie stehen Sie zur Delegation ärztlicher Leistungen und zur Telemedizin? Hartmannbund-Umfrage Februar/März 2014
 Wie stehen Sie zur ärztlicher Leistungen und zur Telemedizin? Hartmannbund-Umfrage Februar/März 2014 Start der Umfrage: 26. Februar 2014 Ende der Befragung: 20. März 2014 Zielgruppe: Niedergelassene und
Wie stehen Sie zur ärztlicher Leistungen und zur Telemedizin? Hartmannbund-Umfrage Februar/März 2014 Start der Umfrage: 26. Februar 2014 Ende der Befragung: 20. März 2014 Zielgruppe: Niedergelassene und
Aktuelle Herausforderungen der Gesundheitspolitik Die gesundheitspolitische Agenda 2015
 Aktuelle Herausforderungen der Gesundheitspolitik Die gesundheitspolitische Agenda 2015 Empfang der Gesundheitsregion Saar e.v. Dr. Doris Pfeiffer, Vorstandsvorsitzende GKV-Spitzenverband Berlin, 10.06.2015
Aktuelle Herausforderungen der Gesundheitspolitik Die gesundheitspolitische Agenda 2015 Empfang der Gesundheitsregion Saar e.v. Dr. Doris Pfeiffer, Vorstandsvorsitzende GKV-Spitzenverband Berlin, 10.06.2015
Arbeiten in Deutschland. Eine Einführung für ausländische Ärzte in das deutsche Gesundheitssystem
 Arbeiten in Deutschland Eine Einführung für ausländische Ärzte in das deutsche Gesundheitssystem Das Deutsche Gesundheitssystem im Überblick 1. Krankenversicherung: GKV und PKV 2. Ambulanter und stationärer
Arbeiten in Deutschland Eine Einführung für ausländische Ärzte in das deutsche Gesundheitssystem Das Deutsche Gesundheitssystem im Überblick 1. Krankenversicherung: GKV und PKV 2. Ambulanter und stationärer
Stellungnahme der Bundesärztekammer
 Stellungnahme der Bundesärztekammer Anhörung Deutscher Bundestag 08.06.2016 Antrag der Fraktion DIE LINKE. Medizinische Versorgung für Geflüchtete und Asylsuchende diskriminierungsfrei sichern (BT-Drucksache
Stellungnahme der Bundesärztekammer Anhörung Deutscher Bundestag 08.06.2016 Antrag der Fraktion DIE LINKE. Medizinische Versorgung für Geflüchtete und Asylsuchende diskriminierungsfrei sichern (BT-Drucksache
Qualität löst alle Probleme?
 Dr. Barbara Voß, Frühjahrstagung der gwrm, 2. Juni 2015 Qualität löst alle Probleme? Wir wollen, dass die Qualitätsorientierung in der Versorgung eine Erfolgsgeschichte wird. Hermann Gröhe bei der 6. Qualitätssicherungskonferenz
Dr. Barbara Voß, Frühjahrstagung der gwrm, 2. Juni 2015 Qualität löst alle Probleme? Wir wollen, dass die Qualitätsorientierung in der Versorgung eine Erfolgsgeschichte wird. Hermann Gröhe bei der 6. Qualitätssicherungskonferenz
STATIONSÄQUIVALENTE BEHANDLUNG
 STATIONSÄQUIVALENTE BEHANDLUNG IN DER GESUNDHEITSPOLITISCHEN DISKUSSION Arno Deister Prof. Dr. med. Zentrum für Psychosoziale Medizin Klinikum Itzehoe Robert-Koch-Str. 2 25525 Itzehoe Deutsche Gesellschaft
STATIONSÄQUIVALENTE BEHANDLUNG IN DER GESUNDHEITSPOLITISCHEN DISKUSSION Arno Deister Prof. Dr. med. Zentrum für Psychosoziale Medizin Klinikum Itzehoe Robert-Koch-Str. 2 25525 Itzehoe Deutsche Gesellschaft
DMP-Realität nach 10 Jahren
 DMP-Realität nach 10 Jahren Dr. Maximilian Gaßner Präsident des Bundesversicherungsamtes Übersicht 1. Einführung der DMP 2. DMP in der Praxis Kritik und Würdigung 3. Ausblick in die Zukunft von DMP 4.
DMP-Realität nach 10 Jahren Dr. Maximilian Gaßner Präsident des Bundesversicherungsamtes Übersicht 1. Einführung der DMP 2. DMP in der Praxis Kritik und Würdigung 3. Ausblick in die Zukunft von DMP 4.
vdek Ein starker Partner im Gesundheitswesen
 vdek Ein starker Partner im Gesundheitswesen 100-jähriges Jubiläum um des Verbandes der Ersatzkassen e. V. im Jahr 2012 SPD Landesparteitag NRW 29.9.12, Münster Der vdek vertritt alle 6 Ersatzkassen 2
vdek Ein starker Partner im Gesundheitswesen 100-jähriges Jubiläum um des Verbandes der Ersatzkassen e. V. im Jahr 2012 SPD Landesparteitag NRW 29.9.12, Münster Der vdek vertritt alle 6 Ersatzkassen 2
Gesetz zur Verbesserung der Hospizund Palliativversorgung in Deutschland. (Hospiz- und Palliativgesetz HPG)
 Gesetz zur Verbesserung der Hospizund Palliativversorgung in Deutschland (Hospiz- und Palliativgesetz HPG) zeitliche Einordnung (I) 10.11.2014 Eckpunkte-Papier von Bundesminister Hermann Gröhe MdB Verbesserung
Gesetz zur Verbesserung der Hospizund Palliativversorgung in Deutschland (Hospiz- und Palliativgesetz HPG) zeitliche Einordnung (I) 10.11.2014 Eckpunkte-Papier von Bundesminister Hermann Gröhe MdB Verbesserung
Ambulante Psychiatrische Pflege
 Loewe Stiftung &TAPP Grips Ambulante Psychiatrische Pflege Angebote für Menschen mit psychischer Erkrankung Themen Wer sind wir? Zielsetzung Leistungen Kooperationspartner Eigenanteil Kontaktaufnahme und
Loewe Stiftung &TAPP Grips Ambulante Psychiatrische Pflege Angebote für Menschen mit psychischer Erkrankung Themen Wer sind wir? Zielsetzung Leistungen Kooperationspartner Eigenanteil Kontaktaufnahme und
Deutsche Gesellschaft für Kassenarztrecht e.v. Symposium am Rechtliche Regelungen der Qualitätssicherung im Vergleich ambulant/stationär
 Deutsche Gesellschaft für Kassenarztrecht e.v. Symposium am 25.04.2013 Rechtliche Regelungen der Qualitätssicherung im Vergleich ambulant/stationär Dr. Bernhard Egger Leiter der Abteilung Medizin, GKV-Spitzenverband
Deutsche Gesellschaft für Kassenarztrecht e.v. Symposium am 25.04.2013 Rechtliche Regelungen der Qualitätssicherung im Vergleich ambulant/stationär Dr. Bernhard Egger Leiter der Abteilung Medizin, GKV-Spitzenverband
DR. CHRISTOPH STRAUB VORSTANDSVORSITZENDER DER BARMER GEK
 BARMER VERSORGUNGS- UND FORSCHUNGSKONGRESS 2016 VERSORGUNGSSTEUERUNG UND ÜBERWINDUNG DER SEKTORENGRENZEN CHANCEN FÜR EINE PATIENTENGERECHTERE VERSORGUNG DR. CHRISTOPH STRAUB VORSTANDSVORSITZENDER DER BARMER
BARMER VERSORGUNGS- UND FORSCHUNGSKONGRESS 2016 VERSORGUNGSSTEUERUNG UND ÜBERWINDUNG DER SEKTORENGRENZEN CHANCEN FÜR EINE PATIENTENGERECHTERE VERSORGUNG DR. CHRISTOPH STRAUB VORSTANDSVORSITZENDER DER BARMER
micura Pflegedienste Nürnberg GmbH In Kooperation mit:
 micura Pflegedienste Nürnberg GmbH In Kooperation mit: 2 PFLEGE UND BETREUUNG ZUHAUSE Ein Gemeinschaftsunternehmen der DKV Pflegedienste & Residenzen GmbH und dem Praxisnetz Nürnberg Süd e.v. Der micura
micura Pflegedienste Nürnberg GmbH In Kooperation mit: 2 PFLEGE UND BETREUUNG ZUHAUSE Ein Gemeinschaftsunternehmen der DKV Pflegedienste & Residenzen GmbH und dem Praxisnetz Nürnberg Süd e.v. Der micura
Kommunikation mit Krankenkassen Notwendiges Übel oder Schlüssel zum Erfolg?
 AOK NORDOST Kommunikation mit Krankenkassen Notwendiges Übel oder Schlüssel zum Erfolg? 28. September 2016, MedInform-Workshop Berlin Agenda Wie kommunizieren Krankenkassen mit Leistungserbringern? Wie
AOK NORDOST Kommunikation mit Krankenkassen Notwendiges Übel oder Schlüssel zum Erfolg? 28. September 2016, MedInform-Workshop Berlin Agenda Wie kommunizieren Krankenkassen mit Leistungserbringern? Wie
70. Bayerischer Röntgenkongress am Universitätsklinikum
 Es gilt das gesprochene Wort! 70. Bayerischer Röntgenkongress am Universitätsklinikum Würzburg am 29. September in Würzburg Grußwort von Barbara Stamm, MdL Präsidentin des Bayerischen Landtags Sehr geehrte
Es gilt das gesprochene Wort! 70. Bayerischer Röntgenkongress am Universitätsklinikum Würzburg am 29. September in Würzburg Grußwort von Barbara Stamm, MdL Präsidentin des Bayerischen Landtags Sehr geehrte
BARMER Versorgungs- und Forschungskongress
 BARMER Versorgungs- und Forschungskongress Aktuelle Versorgungsdiskussion: Bedarfsplanung Sektorenübergreifende Versorgungsplanung: Beispiel Baden-Württemberg 12.09.2017 Seite 1 Joachim Stamm Bereichsleiter
BARMER Versorgungs- und Forschungskongress Aktuelle Versorgungsdiskussion: Bedarfsplanung Sektorenübergreifende Versorgungsplanung: Beispiel Baden-Württemberg 12.09.2017 Seite 1 Joachim Stamm Bereichsleiter
BNHO. Berufsverband der Niedergelassenen Hämatologen und Onkologen in Deutschland e.v. Die KrebsSpezialisten. Weil Kompetenz und Engagement zählen.
 BNHO Berufsverband der Niedergelassenen Hämatologen und Onkologen in Deutschland e.v. Die KrebsSpezialisten. Weil Kompetenz und Engagement zählen. Krebs ist eine häufige Erkrankung In Deutschland leben
BNHO Berufsverband der Niedergelassenen Hämatologen und Onkologen in Deutschland e.v. Die KrebsSpezialisten. Weil Kompetenz und Engagement zählen. Krebs ist eine häufige Erkrankung In Deutschland leben
Lilly Jahressymposium 2008 zur Versorgung von Krebspatienten Nicht kommerzielle Studien in der Onkologie zu Lasten der GKV?
 Lilly Jahressymposium 2008 zur Versorgung von Krebspatienten Nicht kommerzielle Studien in der Onkologie zu Lasten der GKV? Ulrich Dietz Bundesministerium für Gesundheit Berlin, 26. Januar 2007 Arzneimittelversorgung
Lilly Jahressymposium 2008 zur Versorgung von Krebspatienten Nicht kommerzielle Studien in der Onkologie zu Lasten der GKV? Ulrich Dietz Bundesministerium für Gesundheit Berlin, 26. Januar 2007 Arzneimittelversorgung
Statement von. Christian Zahn. stellvertretender Verbandsvorsitzender des Verbandes der Ersatzkassen e. V. (vdek)
 Seite 1 von 5 Statement von Christian Zahn stellvertretender Verbandsvorsitzender des Verbandes der Ersatzkassen e. V. (vdek) anlässlich der gemeinsamen Pressekonferenz der Bundeswahlbeauftragten für die
Seite 1 von 5 Statement von Christian Zahn stellvertretender Verbandsvorsitzender des Verbandes der Ersatzkassen e. V. (vdek) anlässlich der gemeinsamen Pressekonferenz der Bundeswahlbeauftragten für die
Suizid und Suizidbeihilfe Sitzung des Deutschen Ethikrats
 Bundesärztekammer Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ärztekammern Suizid und Suizidbeihilfe Sitzung des Deutschen Ethikrats Berlin, 27. September 2012 Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery Präsident der Bundesärztekammer
Bundesärztekammer Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ärztekammern Suizid und Suizidbeihilfe Sitzung des Deutschen Ethikrats Berlin, 27. September 2012 Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery Präsident der Bundesärztekammer
Qualitätsinstitutionen im Gesundheitswesen. Who is who?
 Qualitätsinstitutionen im Gesundheitswesen Who is who? 1. DVMD-Frühjahrssymposium Hannover, 04.03.2016 Gabriele Damm, Dipl.-Dok. (FH), Systemauditor ZQ, Hannover Qualitätsinstitutionen im Gesundheitswesen
Qualitätsinstitutionen im Gesundheitswesen Who is who? 1. DVMD-Frühjahrssymposium Hannover, 04.03.2016 Gabriele Damm, Dipl.-Dok. (FH), Systemauditor ZQ, Hannover Qualitätsinstitutionen im Gesundheitswesen
Die Weiterentwicklung der Qualitätssicherung durch das Krankenhausstrukturgesetz (KHSG)
 Die Weiterentwicklung der Qualitätssicherung durch das Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) (Stand 5. November 2015 Annahme durch den Bundestag) Diplom-Ökonom Ralf Gommermann Referatsleiter: Stationäre Versorgung
Die Weiterentwicklung der Qualitätssicherung durch das Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) (Stand 5. November 2015 Annahme durch den Bundestag) Diplom-Ökonom Ralf Gommermann Referatsleiter: Stationäre Versorgung
DAS TEAM RUND UM DIE PATIENTINNEN UND PATIENTEN
 DAS TEAM RUND UM DIE PATIENTINNEN UND PATIENTEN ERWARTUNGEN AN DIE GESUNDHEITSBERUFE Mag. Andrea Fried, Bundesgeschäftsführerin ARGE Selbsthilfe Österreich 14.11.2014 1 14.11.2014 2 Primärversorgung NEU
DAS TEAM RUND UM DIE PATIENTINNEN UND PATIENTEN ERWARTUNGEN AN DIE GESUNDHEITSBERUFE Mag. Andrea Fried, Bundesgeschäftsführerin ARGE Selbsthilfe Österreich 14.11.2014 1 14.11.2014 2 Primärversorgung NEU
am in Köln
 Stigmata abbauen Kooperationen fördern Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Gemeindepsychiatrie am 01. 02. 2017 in Köln Die neuen Möglichkeiten der Soziotherapie und der Ambulanten Psychiatrischen Pflege
Stigmata abbauen Kooperationen fördern Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Gemeindepsychiatrie am 01. 02. 2017 in Köln Die neuen Möglichkeiten der Soziotherapie und der Ambulanten Psychiatrischen Pflege
Die Qualitätssicherung aus der Sicht des G-BA Ein wirkungsvolles Instrument zur Steigerung der Patientensicherheit?
 Die Qualitätssicherung aus der Sicht des G-BA Ein wirkungsvolles Instrument zur Steigerung der Patientensicherheit? Symposium des Berufsverbandes Deutscher Internisten Anspruch und Wirklichkeit der Qualitätssicherung
Die Qualitätssicherung aus der Sicht des G-BA Ein wirkungsvolles Instrument zur Steigerung der Patientensicherheit? Symposium des Berufsverbandes Deutscher Internisten Anspruch und Wirklichkeit der Qualitätssicherung
wir haben eine Forsa-Umfrage in Auftrag gegeben, weil wir wissen wollten, welche Erwartungen die Versicherten an die medizinische Versorgung haben.
 Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben eine Forsa-Umfrage in Auftrag gegeben, weil wir wissen wollten, welche Erwartungen die Versicherten an die medizinische Versorgung haben. Wir haben uns vor allem
Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben eine Forsa-Umfrage in Auftrag gegeben, weil wir wissen wollten, welche Erwartungen die Versicherten an die medizinische Versorgung haben. Wir haben uns vor allem
Wie dürfen wir sterben?
 Ökumenischer Arbeitskreis Ethik und Menschenrechte Wie dürfen wir sterben? Informationen über die Diskussion um die Sterbe-Hilfe in Deutschland Text: Brigitte Huber - für den ökumenischen Arbeitskreis
Ökumenischer Arbeitskreis Ethik und Menschenrechte Wie dürfen wir sterben? Informationen über die Diskussion um die Sterbe-Hilfe in Deutschland Text: Brigitte Huber - für den ökumenischen Arbeitskreis
Nationale Strategie Palliative Care. Pia Coppex, Projektleiterin Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren GDK
 Nationale Strategie Palliative Care Pia Coppex, Projektleiterin Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren GDK CURAVIVA-Impulstagung «Palliative Care in der stationären
Nationale Strategie Palliative Care Pia Coppex, Projektleiterin Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren GDK CURAVIVA-Impulstagung «Palliative Care in der stationären
Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung: Bewertung und Erwartungen aus Sicht der DKG
 8. Gefäßspezifisches DRG-Praktikum & Ökonomiepraktikum Offenbach, 23.01./24.01.2014 Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung: Bewertung und Erwartungen aus Sicht der DKG Dr. Michael Mörsch, Leiter
8. Gefäßspezifisches DRG-Praktikum & Ökonomiepraktikum Offenbach, 23.01./24.01.2014 Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung: Bewertung und Erwartungen aus Sicht der DKG Dr. Michael Mörsch, Leiter
20 Jahre PSAG Halle/Saalekreis. Fachforum 2
 20 Jahre PSAG Halle/Saalekreis Fachforum 2 Integrierte Versorgung im Bereich der Erwachsenenpsychiatrie PD Dr. med. D. Leube, Chefarzt AWO Psychiatriezentrum Halle AWO Psychiatriezentrum Halle 100 stationäre
20 Jahre PSAG Halle/Saalekreis Fachforum 2 Integrierte Versorgung im Bereich der Erwachsenenpsychiatrie PD Dr. med. D. Leube, Chefarzt AWO Psychiatriezentrum Halle AWO Psychiatriezentrum Halle 100 stationäre
Verknüpfung von Qualität und Vergütung. Berlin, Dr. Mechtild Schmedders
 Verknüpfung von Qualität und Vergütung Berlin, 22.09.2014 Dr. Mechtild Schmedders Koalitionsvertrag 18. Legislaturperiode für besonders gute Qualität sind Zuschläge möglich. Umgekehrt sollen bei unterdurchschnittlicher
Verknüpfung von Qualität und Vergütung Berlin, 22.09.2014 Dr. Mechtild Schmedders Koalitionsvertrag 18. Legislaturperiode für besonders gute Qualität sind Zuschläge möglich. Umgekehrt sollen bei unterdurchschnittlicher
Der Innovationsausschuss in Zahlen
 Der Innovationsausschuss in Zahlen conhit Connecting Healthcare IT vom 17.- 19. April 2018 in Berlin Dr. Christian Igel Geschäftsführer Innovationsausschuss Der Innovationsfonds 2016 bis 2019: 300 Mio.
Der Innovationsausschuss in Zahlen conhit Connecting Healthcare IT vom 17.- 19. April 2018 in Berlin Dr. Christian Igel Geschäftsführer Innovationsausschuss Der Innovationsfonds 2016 bis 2019: 300 Mio.
Schicksal Demenz Was brauchen die Betroffenen und ihre Angehörigen
 Schicksal Demenz Was brauchen die Betroffenen und ihre Angehörigen Sabine Jansen Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.v. Selbsthilfe Demenz Kooperationstagung Demenz Gemeinsam für eine bessere Versorgung
Schicksal Demenz Was brauchen die Betroffenen und ihre Angehörigen Sabine Jansen Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.v. Selbsthilfe Demenz Kooperationstagung Demenz Gemeinsam für eine bessere Versorgung
Diagnose und dann? Tagung Wieviel Wissen tut uns gut? Hannover, 7. Dezember Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.v. Selbsthilfe Demenz
 Diagnose und dann? Tagung Wieviel Wissen tut uns gut? Hannover, 7. Dezember 2012 Sabine Jansen Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.v. Selbsthilfe Demenz Als Bundesverband 1989 gegründet Gemeinnützige Selbsthilfeorganisation
Diagnose und dann? Tagung Wieviel Wissen tut uns gut? Hannover, 7. Dezember 2012 Sabine Jansen Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.v. Selbsthilfe Demenz Als Bundesverband 1989 gegründet Gemeinnützige Selbsthilfeorganisation
Mehr Spielraum für Kooperationsverträge
 4. MSD Forum GesundheitsPARTNER 17. September 2014 Peter Kurt Josenhans AOK Bremen/Bremerhaven Kooperation im Gesundheitswesen > 300.000 Ergebnisse bei google.de Zusammenarbeit der Leistungserbringer Ärzte/Fachdisziplinen
4. MSD Forum GesundheitsPARTNER 17. September 2014 Peter Kurt Josenhans AOK Bremen/Bremerhaven Kooperation im Gesundheitswesen > 300.000 Ergebnisse bei google.de Zusammenarbeit der Leistungserbringer Ärzte/Fachdisziplinen
Das Diabetische Fußsyndrom 11. Nationales Treffen Netzwerk Diabetischer Fuß 04. und 05. September Interessenskonflikte: Keine
 Das Diabetische Fußsyndrom 11. Nationales Treffen Netzwerk Diabetischer Fuß 04. und 05. September 2015 1 Interessenskonflikte: Keine DAK-Gesundheit: Deutschlands drittgrößte gesetzliche Krankenversicherung
Das Diabetische Fußsyndrom 11. Nationales Treffen Netzwerk Diabetischer Fuß 04. und 05. September 2015 1 Interessenskonflikte: Keine DAK-Gesundheit: Deutschlands drittgrößte gesetzliche Krankenversicherung
Öffnung der Krankenhäuser für die ambulante onkologische Patientenversorgung
 Öffnung der Krankenhäuser für die ambulante onkologische Patientenversorgung Dr. Christoph Straub Techniker Krankenkasse Fokusveranstaltung - Lilly Berlin, den 16. Juni 2004 F 2 Das Kernproblem der 116b,
Öffnung der Krankenhäuser für die ambulante onkologische Patientenversorgung Dr. Christoph Straub Techniker Krankenkasse Fokusveranstaltung - Lilly Berlin, den 16. Juni 2004 F 2 Das Kernproblem der 116b,
Es gilt das gesprochene Wort
 Statement von Wolfgang Schmeinck Vorstandsvorsitzender des BKK Bundesverbandes Vorsitzender des Stiftungsrates IQWiG in Rahmen der Pressekonferenz Drei Jahre IQWiG am Donnerstag, 8. November 2007, 12:00
Statement von Wolfgang Schmeinck Vorstandsvorsitzender des BKK Bundesverbandes Vorsitzender des Stiftungsrates IQWiG in Rahmen der Pressekonferenz Drei Jahre IQWiG am Donnerstag, 8. November 2007, 12:00
AMNOG: Mehr Mitspracherechte für Experten und Patienten
 DGHO AMNOG: Mehr Mitspracherechte für Experten und Patienten Berlin (21. August 2013) Die DGHO Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie e.v. fordert eine weitreichende und frühzeitige
DGHO AMNOG: Mehr Mitspracherechte für Experten und Patienten Berlin (21. August 2013) Die DGHO Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie e.v. fordert eine weitreichende und frühzeitige
1. Was diskutieren wir?
 Selbstbestimmung und Fürsorge am Lebensende Zur Diskussion über Suizidhilfe Pastor Dr. Michael Coors michael.coors@evlka.de www.zfg-hannover.de Evangelische Akademie der Nordkirche Wie nah ist mir der
Selbstbestimmung und Fürsorge am Lebensende Zur Diskussion über Suizidhilfe Pastor Dr. Michael Coors michael.coors@evlka.de www.zfg-hannover.de Evangelische Akademie der Nordkirche Wie nah ist mir der
Fachärztliche Versorgung an der Schnittstelle ambulant und stationär
 Fachärztliche Versorgung an der Schnittstelle ambulant und stationär Positionen zur Zukunft der fachärztlichen Versorgung Dr. Martina Wenker Gliederung 1. Zur Situation der fachärztlichen Versorgung 2.
Fachärztliche Versorgung an der Schnittstelle ambulant und stationär Positionen zur Zukunft der fachärztlichen Versorgung Dr. Martina Wenker Gliederung 1. Zur Situation der fachärztlichen Versorgung 2.
Kommunikation im Gesundheitswesen
 Kommunikation im Gesundheitswesen Alle gezeigten Folien sowie Hintergrundinformationen finden sich bei www.pr-healthcare.de unter Charité Kursziele Lernen, wie das Gesundheitssystem tickt, Typische Systemmängel
Kommunikation im Gesundheitswesen Alle gezeigten Folien sowie Hintergrundinformationen finden sich bei www.pr-healthcare.de unter Charité Kursziele Lernen, wie das Gesundheitssystem tickt, Typische Systemmängel
Gesundheitlichen Versorgung im ländlichen Raum Probleme und mögliche Lösungen
 Deutscher Caritasverband e.v. Workshop Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum was ist zu tun? Frankfurt am Main, 19. April 2012 Gesundheitlichen Versorgung im ländlichen Raum Probleme und mögliche Lösungen
Deutscher Caritasverband e.v. Workshop Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum was ist zu tun? Frankfurt am Main, 19. April 2012 Gesundheitlichen Versorgung im ländlichen Raum Probleme und mögliche Lösungen
Integrierte Versorgung in der PKV
 Integrierte Versorgung in der PKV Vernetzung mit dem Ziel einer besseren Patientenversorgung 1. Hamburger Symposium zur Integrierten Versorgung, 30. November 2005 in Hamburg Dr. Andreas Gent, Mitglied
Integrierte Versorgung in der PKV Vernetzung mit dem Ziel einer besseren Patientenversorgung 1. Hamburger Symposium zur Integrierten Versorgung, 30. November 2005 in Hamburg Dr. Andreas Gent, Mitglied
DÜRFEN ÄRZTE BEIM STERBEN HELFEN? Pfarrer Richard Schuster Ethikforum Klinikum Nürnberg 2. Vorsitzender
 DÜRFEN ÄRZTE BEIM STERBEN HELFEN? Pfarrer Richard Schuster Ethikforum Klinikum Nürnberg 2. Vorsitzender Zu meiner Person Seit 1998 Krankenhausseelsorger im Klinikum Nürnberg Süd Seelsorger der nephrologischen
DÜRFEN ÄRZTE BEIM STERBEN HELFEN? Pfarrer Richard Schuster Ethikforum Klinikum Nürnberg 2. Vorsitzender Zu meiner Person Seit 1998 Krankenhausseelsorger im Klinikum Nürnberg Süd Seelsorger der nephrologischen
Kasper & Kollegen Rechtsanwälte Kassel
 Kasper & Kollegen Rechtsanwälte Kassel Wolfsschlucht 18A 34117 Kassel Telefon: 0561/20865900 Telefax: 0561/20856909 www.rae-med.de und Berufsordnung werden wir Ärzte in die Zange genommen? Kooperation
Kasper & Kollegen Rechtsanwälte Kassel Wolfsschlucht 18A 34117 Kassel Telefon: 0561/20865900 Telefax: 0561/20856909 www.rae-med.de und Berufsordnung werden wir Ärzte in die Zange genommen? Kooperation
SELTENE ERKRANKUNGEN SICHT DER KRANKENKASSEN
 2014 I 6. FORUM Patientennahe Klinische Forschung Freiburg SELTENE ERKRANKUNGEN SICHT DER KRANKENKASSEN BARMER GEK WUPPERTAL Kompetenzzentrum Medizin + Versorgungsforschung Dr. med. Ursula Marschall NAMSE
2014 I 6. FORUM Patientennahe Klinische Forschung Freiburg SELTENE ERKRANKUNGEN SICHT DER KRANKENKASSEN BARMER GEK WUPPERTAL Kompetenzzentrum Medizin + Versorgungsforschung Dr. med. Ursula Marschall NAMSE
Angestellten-Forum des ZVK e. V. Stuttgart, Andrea Wolf
 Angestellten-Forum des ZVK e. V. Stuttgart, 04.03.2016 Andrea Wolf Die externe stationäre Qualitätssicherung am Beispiel der Orthopädie und Unfallchirurgie Implikationen für die Physiotherapie (Aktuelle
Angestellten-Forum des ZVK e. V. Stuttgart, 04.03.2016 Andrea Wolf Die externe stationäre Qualitätssicherung am Beispiel der Orthopädie und Unfallchirurgie Implikationen für die Physiotherapie (Aktuelle
