Biopsychosoziale Diagnostik in der Kinder- und Jugendhilfe
|
|
|
- Lioba Althaus
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1
2
3
4 Silke Birgitta Gahleitner Karl Wahlen Oliver Bilke-Hentsch Dorothee Hillenbrand (Hrsg.) Biopsychosoziale Diagnostik in der Kinder- und Jugendhilfe Interprofessionelle und interdisziplinäre Perspektiven Verlag W. Kohlhammer
5 Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind. 1. Auflage 2013 Alle Rechte vorbehalten 2013 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart Wissenschaftliche Redaktion: Ilona Oestreich Umschlag: Gestaltungskonzept Peter Horlacher Gesamtherstellung: W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. KG, Stuttgart Printed in Germany ISBN
6 Inhalt Einleitung Literatur Interdisziplinäre und interprofessionelle Aspekte Biopsychosozialer Diagnostik 1 Biopsychosoziale Diagnostik aus Sicht der Sozialen Arbeit Silke Birgitta Gahleitner 1.1 Geschichte Inhaltliche Ausgestaltung Literatur Diagnostik aus der Perspektive der Psychologie Karl Wahlen 2.1 Psychodiagnostik als soziale Praxis Erwartungen an psychologische Diagnostik Psychologische Diagnostik im Kontext Erleben und Verhalten im Fokus Subjektivierter und sozialisierter Sinn Konsequenzen für die psychologische Methodik und Theoriebildung Idiografie und Nomothetik Der Untersuchungsbereich psychologischer Diagnostik Psyche zwischen Soma und Umwelt: Anpassungsleistungen Stressregulation Psychodiagnostische Aufmerksamkeit: dreidimensional Resümee Literatur
7 Inhalt 3 Diagnostik aus der Perspektive der Medizin Oliver Bilke-Hentsch 3.1 Diagnose als intersubjektiver Prozess Leitliniengestützte Diagnostik und evidenzbasierte Medizin Screening und Früherkennung Multiaxiale Diagnostik Literatur Diagnostik aus der Perspektive des Jugendamtes Karl Wahlen 4.1 Was ist Diagnostik? Eine Begriffsklärung Zwecke der Jugendhilfe und des Jugendamtes Diagnosebedarf in zweierlei Hinsicht Diagnostik im Einzelfall Schützende Instanzen Risikoverantwortung Optimierung der Hilfeplanung durch Optimierung der Diagnostik Wozu Einzelhilfen? Konsequenzen für Diagnostik und Hilfeplanung Resümee Literatur Interprofessionelle Kooperation in Diagnostikprozessen der Kinderund Jugendhilfe Hans Günther Homfeldt und Silke Birgitta Gahleitner 5.1 Diagnostik und Kooperation: eine schwierige Liaison »Gelingende Kooperation«in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen: Geht das überhaupt? Ausblick Literatur Kategoriale, biografie- und lebensweltorientierte Zugänge zur Diagnostik im Kinder- und Jugendbereich 6 Psychiatrische Diagnosen und deren Klassifikation nach der ICD Klaus Hennicke 6.1 Was ist die ICD-10? Was bedeutet Klassifikation einer psychiatrischen Diagnose? Wozu sind Klassifikationssysteme notwendig?
8 Inhalt 6.4 Was können Klassifikationssysteme nicht leisten? Womit können sie Schaden anrichten? Was kann man dagegen tun? Zusammenfassung und Schlussfolgerungen Literatur Das multiaxiale Klassifikationsschema für psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters (MAS) Klaus Hennicke 7.1 Multiaxiale Klassifikation nach dem MAS MAS und multimodale therapeutische Interventionen Fazit: Das MAS ist ein hilfreiches Klassifikationssystem Literatur Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen (ICF-CY) in der interdisziplinären Diagnostik Ursula Mohn-Kästle und Hedwig Amorosa 8.1 Zum Aufbau im Einzelnen Zum Nutzen des Einschätzungsbogens Literatur Die operationalisierte psychodynamische Diagnostik im Kindes- und Jugendalter (OPD-KJ) als Instrument zur multimodalen Therapieplanung Oliver Bilke-Hentsch, Agnes von Wyl und Ruth Weissensteiner 9.1 Grundstruktur des Manuals Die Achsenstruktur des OPD-KJ Kombination der OPD-KJ mit anderen Diagnosesystemen Fallvignette Anwendung der OPD-KJ in der Psychotherapieforschung Fazit Literatur Diagnostik der Erziehungs- und Entwicklungssituation nach dem Multiaxialen Diagnosesystem Jugendhilfe (MAD-J) Karl Wahlen und André Jacob 10.1 Ausgangslage: Wirkungen und Nebenwirkungen von Erziehungshilfen Korrekturbedarf bei der Ermittlung des Hilfebedarfs Grundannahmen und Ausrichtung
9 Inhalt 10.4 Architektur des MAD-J Diagnostische Bewertungen Prozessaufwand und Ertrag Literatur Sozialpädagogische Diagnose ein Meilenstein auf dem Weg zu einer wirkungsorientierten Prozessgestaltung in der Einzelfallhilfe Hans Hillmeier und Harald Britze 11.1 Entwicklung der Sozialpädagogischen Diagnose-Tabellen Konzeptioneller Hintergrund Evaluation Neufassung Anwendung Implementierung Literatur Biografieorientiertes Verstehen und Verständigen als ganzheitlich, lebensweltlich und dialogisch orientierte Fallarbeit ein rekonstruktiver Zugang in der Kinder- und Jugendhilfe Bettina Völter 12.1 Biografieorientiertes Verstehen und Verständigen eine Definition und grundlagentheoretische Einführung Biografische Diagnostik oder Biografieorientiertes Verstehen und Verständigen Methoden biografieorientierten Verstehens und Verständigens in der Kinder- und Jugendhilfe Literatur EQUALS ein teilstandardisiertes Instrument zur interdisziplinären Zielvereinbarung und Unterstützung des Hilfeplanverfahrens in der Kinder- und Jugendhilfe Martin Schröder, Nils Jenkel und Marc Schmid 13.1 Die Entstehung und Haltung von EQUALS Die psychometrische Testbatterie Das Zielerreichungsinstrument Anwendung von EQUALS anhand eines Fallbeispiels Fazit Literatur
10 Inhalt 14 Lebenswelt und Lebensfeld Diagnostik des Sozialen in der Jugendhilfe Peter Pantuček 14.1 Lebenswelt und Lebensfeld »Dezentrierte«Formen der Diagnostik und Intervention Riskante Entscheidungen Resümee Literatur Systematische Diagnostik in der Jugendhilfe mit dem Störungsübergreifenden Diagnostik-System für die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie (SDS-KJ) Michael Borg-Laufs 15.1 Multimodale Fallerfassung Interventionsplanung mit dem SDS-KJ im Überblick Datenerhebung: Vorgehensweise Datenerhebung: Inhaltsbereiche Interventionsrelevante Bedingungsdiagnosen Interventionsplanung mit dem SDS-KJ Literatur Zugänge und Anwendungen systemischer Diagnostik Sebastian Baumann und Hartmut Epple 16.1 Systemisch und Diagnostik keine Liebeshochzeit, aber eine Vernunftehe mit Entwicklungspotenzial Grundhaltungen systemischer Diagnostik Systemische Diagnostik auf drei Ebenen Schlussbemerkung Literatur Sonderpädagogische Diagnostik als Teil des Beratungsauftrags von Klinikschulen am Beispiel der Berliner Schule in der Charité Inka Vogler und Ronald Vierock 17.1 Die Schule in der Charité eine Klinikschule und ihr Auftrag Maßgebliche Tätigkeitsfelder für die Diagnostik der Klinikschule Eingesetzte diagnostische Verfahren Literatur
11 Inhalt Vorschlag für ein biopsychosoziales Rahmenverbund-Modell 18 Zur Implementation biopsychosozialer Diagnostik in der Kinderund Jugendhilfe ein Vorschlag Silke Birgitta Gahleitner und Hans Günther Homfeldt 18.1 Erster Schritt: erste Suchrichtung und interprofessionelle Verständigung Zweiter und dritter Schritt: Fallverstehen und biografische Kontextualisierung Erfassung der sozialen Komplexität des Falls Vierter Schritt: Strukturierungsvorschläge für die Hilfeplanung Weitere Argumente für eine alltagsnahe Umsetzung Kritische Reflexionen zur Implementation und Ausblick Literatur Autorinnen und Autoren
12 Einleitung Kinder, Heranwachsende und deren Familien geraten mitunter in schwierige Lebenslagen, in denen das Gelingen ihrer Entwicklung bzw. Erziehung gefährdet erscheint. Familien können dann zur Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern und zur Unterstützung des Entwicklungsprozesses ihrer Kinder besondere, an ihre Situation und deren Herausforderungen angepasste Hilfen in Anspruch nehmen. Nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) stehen ihnen»hilfen zur Erziehung«(gem. 27 ff. SGB VIII) und/oder»eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche«(gem. 35 a SGB VIII) zu, wenn entsprechende Voraussetzungen erfüllt sind. Aber welche Hilfe ist für wen und unter welchen Umständen tatsächlich hilfreich? Wie findet man die angemessene Intervention? Was gibt im Einzelfall den Ausschlag für eine ambulante oder (teil-) stationäre, für eine sozialpädagogische, psychologische, beraterische und/oder (psycho-)therapeutische Hilfe? Woran erkennt man, dass die Hilfeleistung im Sinne des 36 SGB VIII jeweils»geeignet und notwendig«(gewesen) ist? Auf diese Fragen müssen in den Hilfeplanungs- und Evaluationsprozessen der Kinder- und Jugendhilfe Antworten gefunden werden in jedem Einzelfall, aber auch in grundsätzlicher Hinsicht. Begründete Antworten auf die Indikationsfrage setzen begründete diagnostische Beschreibungen und Bewertungen voraus. Den gesetzlichen Vorgaben der Kinder- und Jugendhilfe entsprechend sind deren diagnostische Einschätzungen stets auf die besondere Entwicklungssituation der Kinder bzw. Jugendlichen zu beziehen, zu deren Unterstützung eine Hilfe in Erwägung gezogen wird. Jugendhilfespezifische Diagnosen verstehen diese Situation im Kontext der jeweils gegebenen erzieherischen und sozialisatorischen Verhältnisse als vorläufiges Resultat eines individuellen Entwicklungsprozesses. Im Sinne des 1 Abs. 1 SGB VIII bewerten sie die Entwicklungs- und Erziehungssituation am Maßstab des Rechtes junger Menschen auf eine Entwicklung zur autonomen und teilhabefähigen Persönlichkeit sowie auf eine Erziehung durch Elternpersonen, die sie in ihrer Entwicklung begleiten und in altersgerechter, entwicklungsfördernder Weise zur Mündigkeit führen. Die diagnostische Aufmerksamkeit müsste demnach bifokal ausgerichtet sein. Zum einen wäre unter entwicklungspsychologischen Gesichtspunkten die Art und Weise zu fokussieren, wie das Kind bzw. die/der Jugendliche ihre/seine Entwicklungsaufgaben und -bedürfnisse realisiert. In sozial-systemischer Perspektive wären zum anderen die entwicklungsrelevanten Interaktionssysteme zu betrachten, an denen das Kind bzw. der/die Heranwachsende teilnimmt und die ihm/ihr entsprechende Erziehungs- und Sozialisationserfahrungen vermitteln. Primär ist das die Familie, sekundär sind es weitere soziale Systeme, die Einfluss auf die 11
13 Einleitung individuelle Entwicklung nehmen (Schule, Gleichaltrigengruppen, Medien usw.). Diagnostik, die für die Jugendhilfe und für deren Aufgabenerfüllung nutzbringend ist, sollte also im Wesentlichen psychosozial strukturiert sein. Gebraucht werden psychosoziale Diagnosen, die belastbare Aussagen über die Lebenslage junger Menschen machen, und zwar sowohl im Hinblick auf ihre Autonomie- und Partizipationsentwicklung als auch im Hinblick auf die sozialen Verhältnisse, in denen sie sich entwickeln. Nimmt man hinzu, dass der Körper mit seinen Besonderheiten für alles, was einen Menschen, seine Subjektivität und seine Persönlichkeit ausmacht, die Grundlage bildet, so folgt daraus, dass Diagnostik im Rahmen der Jugendhilfe in angemessener Weise berücksichtigen muss, dass die jungen Menschen, denen ihre Aufmerksamkeit und Sorge gilt, biopsychosozial verfasst sind. Diagnostik kann Kinder und Jugendliche also nicht allein als soziale Wesen oder als Wesen mit»erzieherischem Bedarf«betrachten, wenn sie ihnen als ganze Menschen gerecht werden will. Das heißt nicht, dass die Jugendhilfe für die Behandlung körperlicher oder seelischer Erkrankungen finanziell aufkommen muss. Aber es heißt, dass sie Erkrankungen ebenso wenig wie andere Beeinträchtigungen und Gefährdungen eines jungen Menschen außer Acht lassen kann. Andernfalls steigt die Wahrscheinlichkeit fehlangepasster Indikationen, einseitig ausgerichteter Hilfeleistungen und scheiternder Hilfeverläufe (vgl. z. B. Schmid et al., 2006). Spätestens seit 2005 mit der Einfügung des 8 a (»Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung«) in das SGB VIII die grundsätzliche und keineswegs neue Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe unterstrichen wurde, Kinder und Jugendliche davor zu bewahren, dass sie in ihrer Entwicklung Schaden erleiden, konnte die Notwendigkeit diagnostischer Verfahren zur sorgfältigen Abklärung vermuteter Gefährdungslagen der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ebenfalls nicht mehr ignoriert werden. Dass Hilfeplanungen und -entscheidungen in der Kinder- und Jugendhilfe generell diagnostische Erkenntnisse benötigen, die den Hilfezwecken entsprechen, hat schon der 11. Kinder- und Jugendbericht (2002) betont. Zugleich hat er das Fehlen eines ausgearbeiteten, konsensuell anerkannten und praktizierten Begriffs von Diagnostik in der Jugendhilfe beklagt. 1 Es gebe keine»in der Profession«für allgemein verbindlich gehaltene Diagnoseverfahren und Diagnosekriterien, die einen erkennbaren Unterschied»zu anderen Diagnosekonzepten (z. B. aus der klinischen oder therapeutischen Diagnostik)«(S. 254) machen 1 Der Bericht benutzt den Ausdruck»sozialpädagogische Diagnose«, um das Besondere von Diagnostik in der Jugendhilfe hervorzuheben (ebd.). Die Verengung jugendhilfespezifischer Diagnostik auf sozialpädagogische Diagnostik ist üblich; siehe z. B. den VfK-Tagungsbericht zum Thema»Diagnostik in der Kinder- und Jugendhilfe«(2005). Fast ausnahmslos sind es Vertreter der sozialpädagogischen Profession, die sich in der Kontroverse um das Für und Wider diagnostischer Urteilsbildungen in der Jugendhilfe befinden: Gibt es eine sozialpädagogische Diagnostik? Sollte es sie überhaupt geben? Wenn ja, wie sollte sie gestaltet sein? Andere Professionen (Medizin, Psychologie, Psychotherapie) werden in dieser Kontroverse nur erwähnt, wenn es um Schnittstellen-, Abgrenzungs- und Kooperationsfragen geht, die sich im Verhältnis der Jugendhilfe zu anderen Versorgungssystemen, insbesondere zum Gesundheitswesen, stellen. 12
14 Einleitung würden. Seitdem haben die Auseinandersetzungen um und das Interesse an Diagnostik in der Kinder- und Jugendhilfe deutlich zugenommen. Von einer Übersichtlichkeit oder gar Einheitlichkeit im Vorgehen und von umfassenden wissenschaftlich fundierten Konzepten ist die Jugendhilfe jedoch noch weit entfernt. Inzwischen hat sich jedoch an vielen Stellen die Erkenntnis durchgesetzt, dass der Bedarf an biopsychosozialen Hilfen für vulnerable Kinder, Jugendliche und deren Familien sich nur in interprofessioneller Kooperation fachgerecht abklären lässt. Diese Einsicht ist freilich noch keine Lösung. Sie wirft vielmehr eine Reihe von praktischen und theoretischen Fragen auf. Im Hinblick auf die psychotherapeutische Versorgung im Schnittfeld von Jugendhilfe und Gesundheitswesen werden solche Fragen seit vielen Jahren von der Kammer für Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten im Land Berlin diskutiert. Eine interdisziplinär zusammengesetzte»kjhg-kommission«beispielsweise hat Fragen der Indikation, der Besonderheit und der Qualitätsanforderungen an Psychotherapie im Rahmen der Jugendhilfe bearbeitet und die Ergebnisse der Fachöffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 2 Eine als»interdisziplinäres Colloquium«organisierte Veranstaltungsreihe hat die angemessene psychotherapeutische Versorgung insbesondere der als»hard to reach«bezeichneten Gruppe von Jugendlichen thematisiert. Zuletzt stand den Fachkräften verschiedenster Professionen in Berlin von 2009 bis 2011 ein Forum zur Verfügung, das den Blick über psychotherapeutische Hilfen hinaus auf die gesamte Palette der Hilfeleistungen im Kinder- und Jugendhilfebereich erweitert und zugleich den Akzent der Betrachtung auf Probleme der Diagnostik gelegt hat. In zweimonatlichem Rhythmus haben die Alice-Salomon-Hochschule, das Vivantes Klinikum Berlin- Hellersdorf und die Psychotherapeutenkammer Berlin zu einem»jour Fixe Psychosoziale Diagnostik im Kinder- und Jugendhilfebereich«eingeladen, der von der Hochschule fachlich organisiert wurde. Die TeilnehmerInnen kamen aus den Berufsfeldern der Sozialarbeit und Sozialpädagogik, der Psychologie und Psychotherapie sowie der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Der kollegiale Austausch über Disziplingrenzen hinweg galt folgenden Fragen: Welche Konzepte, Instrumente und Vorgehensweisen sind wann und wo in der Fallabklärung nützlich und sinnvoll? Welche Einrichtungen und Disziplinen sind daran beteiligt? Welche Begrifflichkeiten und fachlichen Perspektiven bestimmen den diagnostischen Prozess insgesamt und in seinen Teilen? Welche Ziele werden dabei verfolgt? Wer, welche Person, welche Disziplin, welche Institution übernimmt in diesem Prozess welche Verantwortung? Wie unterscheiden sich die diagnostischen Beiträge der beteiligten Professionen? Wie lassen sie sich aufeinander beziehen? Wie können sie im diagnostischen Prozess integriert werden? Wie lässt sich zur Erarbeitung psychosozialer Diagnosen in der Jugendhilfe die Kooperation der Disziplinen, Professionen und Institutionen organisieren und verstetigen? Kann die Kommunikation transdisziplinär optimiert werden? Ist in den Hilfeplanungsprozessen eine Vereinheitlichung des Sprachgebrauchs und ein gemeinsames Fall- 2 Siehe: (Suchwort: KJHG) 13
15 Einleitung verständnis möglich? Müssten nicht die Begrifflichkeiten und die diagnostischen Praktiken im Sinne der Zwecke der Jugendhilfe koordiniert sein? Insgesamt bewerteten die teilnehmenden Fachkräfte die Möglichkeit, eine Reihe von diagnostischen Herangehensweisen kennenzulernen und interprofessionell besser nachvollziehen zu können, als fruchtbar. Als Vorteile von Diagnostik im interprofessionellen Diskurs betrachteten sie die reichhaltigeren Erklärungsmodelle für komplexe und»unverständliche«verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen, die dadurch zustande kommen, und den Abbau von Kooperationshemmnissen zwischen den Berufsständen, auch zwischen erkenntnistheoretisch unterschiedlichen»herkünften«. Viele Fragen und Anliegen hat der Jour Fixe freilich offengelassen. Aber er hat zu weiterer Ausarbeitung und Umsetzung angeregt. Und er hat der interprofessionellen Diagnose- und Indikationspraxis der Kinder- und Jugendhilfe bei den TeilnehmerInnen zu ein wenig mehr Sicherheit im Feld verholfen. Die Erfahrungen aus den Präsentationen und Diskussionen einer Reihe bereits erprobter Diagnostikmodelle aus allen Disziplinen und Professionen und Ideen für neue, noch zu entwickelnde Verfahrensweisen haben die Konzeption des vorliegenden Bandes angeregt. Zum Einstieg wurden dafür im ersten Abschnitt des Buches»Interdisziplinäre und interprofessionelle Aspekte Biopsychosozialer Diagnostik«alle Disziplinen aufgefordert, ihre jeweilige Perspektive auf Diagnostik darzustellen. Silke Birgitta Gahleitner, Karl Wahlen und Oliver Bilke-Hentsch stellen in den ersten drei Beiträgen Diagnostik aus der Perspektive der jeweiligen Disziplinen Soziale Arbeit, Psychologie und Medizin vor. Soziale Diagnostik, psychologische Diagnostik und medizinische Diagnostik so wird in allen drei Beiträgen deutlich kann ohne den kooperativen Bezug auf die jeweils anderen disziplinären Wissensbestände keine tragfähigen diagnostischen Realitätsbeschreibungen, Befunde und Interpretationen hervorbringen. Psychologische, medizinische und soziale Diagnostik sind nicht bereits an und für sich, jeweils von sich aus schon biopsychosoziale Diagnostik. Alle drei diagnostischen Perspektiven müssen dafür von der Struktur ihres eigenen Untersuchungsbereiches her biopsychosozial dimensioniert gedacht werden. Individuelles, psychisches Erleben und Verhalten ist somit stets somatisch verankert und zugleich an sozial validiertem, in sozialen Systemen zur Geltung gebrachtem Sinn orientiert.»das Psychische«so wird in den Beiträgen deutlich entsteht als individueller erlebens- und verhaltensförmiger Anpassungsprozess an der Grenze zwischen dem menschlichen Organismus und seiner sozialen Umwelt stets neu. Um diesen Prozess diagnostisch angemessen erfassen zu können, muss er jeweils in einem biopsychosozialen Rahmen begriffen werden. In diesem Sinne integrierte diagnostische Prozesse befinden sich an vielen Stellen noch in den Kinderschuhen. In dem darauf folgenden Artikel»Diagnostik aus der Perspektive des Jugendamtes«stellt Karl Wahlen die Verbindung der eingangs erarbeiteten Einsichten zur Praxis der Kinder- und Jugendhilfe im Arbeitsbereich des Jugendamtes her. Jugendhilfespezifische Diagnostik als biopsychosoziale Diagnostik im Unterschied zur»rein«psychologischen und medizinischen, aber auch zur sog. sozialpädagogischen Diagnose ist nach wie vor eher ein Desiderat als eine gängige Praxis. Der Beitrag untersucht zunächst die Barrieren in der praktischen Umsetzung 14
16 Einleitung qualitativ anspruchsvoller Diagnostik, sodann wird ein Vorschlag skizziert, wie fallzuständige Fachleute im Jugendamt den diagnostischen Prozess adäquat organisieren können. Im Zentrum einer solchen Diagnostik steht die stets am Kindeswohl orientierte Abwägung von erkennbaren Chancen und Risiken, die sowohl mit dem Unterlassen als auch mit dem Gewähren von Hilfen verknüpft sind. Im abschließenden Artikel des ersten Buchabschnitts»Interprofessionelle Kooperation in Diagnostikprozessen der Kinder- und Jugendhilfe«widmen sich Hans Günther Homfeldt und Silke Birgitta Gahleitner dem Thema Kooperation. Die Zunahme von»hochrisikogruppen«in der Kinder- und Jugendhilfe stellt die derzeitigen Versorgungssysteme vor die Aufgabe der Spezialisierung. Aus dieser Entwicklung ergeben sich weitreichende Folgen für die Tätigkeitsmerkmale der Fachkräfte der Sozialen Dienste sowie im Hinblick auf organisatorische Ausdifferenzierungen. Die daraus entstehende wechselseitige Verwiesenheit der sozialen Dienste kann nur durch die Integration bzw. Kooperation sozialarbeiterischer, sozialpädagogischer, therapeutischer und medizinischer Hilfen gelöst werden. In der Alltagsrealität der Fachkräfte jedoch fehlen für gelingende Kooperationen zwischen den Professionellen der Kinder- und Jugendhilfe des Gesundheitsbereiches bislang zumeist die Voraussetzungen methodisch wie strukturell. In dem vorliegenden Artikel werden auf Basis der Hintergründe und Traditionen interprofessioneller Zusammenarbeit Kooperationsverhältnisse charakterisiert, konkrete Erfahrungen aus dem bereits in der Einleitung benannten Jour Fixe eingebracht und konstruktive Anregungen für gelingende Kooperationen gegeben. Das Kapitel»Kategoriale, biografie- und lebensweltorientierte Zugänge zur Diagnostik im Kinder- und Jugendbereich«wird eingeleitet durch zwei Artikel von Klaus Hennicke. Nach einer allgemeinen Einführung in die Problematik von psychiatrischer Diagnostik und Klassifikation im Artikel»Psychiatrische Diagnosen und deren Klassifikation nach der ICD-10«wird in einem weiteren Artikel»Das multiaxiale Klassifikationsschema für psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters (MAS)«ausführlich auf die Struktur und Methodik der ICD-10 am Beispiel des MAS (Multiaxiales Klassifikationsschema für psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters nach ICD-10 der WHO) eingegangen. Die ICD kann auf diese Weise in der Kinder- und Jugendhilfe ein praktikables Instrument darstellen, menschliche Äußerungsformen, die von einer gedachten Normalität signifikant abweichen, möglichst objektiv, d. h. mit mehr oder weniger eindeutig operationalisierten Kriterien zu erkennen und zu einem Störungsbild zusammenzufassen mit dem Ziel, multimodale therapeutische Interventionen auf allen Ebenen zu begründen. Die Möglichkeiten der multiaxialen Klassifikation und das Prinzip der Komorbidität erlauben dann bei aller Kritik eine hinreichende dimensionale Abbildung menschlicher Problemlagen und psychischer Leidensformen zur Begründung von Hilfekonzepten. In ihrem Artikel»Die operationalisierte psychodynamische Diagnostik im Kindes- und Jugendalter (OPD-KJ) als Instrument zur multimodalen Therapieplanung«veranschaulichen Oliver Bilke-Hentsch, Agnes von Wyl und Ruth Weissensteiner eine Herangehensweise an Diagnostik aus einer ganz anderen Perspektive. Das tiefenpsychologisch-psychodynamisch orientierte Instrument hat eine beachtliche Historie in den diagnostischen Bemühungen einer langen 15
17 Einleitung Reihe psychoanalytischer AutorInnen. Gleichwohl hat es sich als Klassifikationsund Diagnosesystem aufgrund seiner Komplexität bisher praktisch nicht recht durchsetzen können. Ab Anfang der 1990er Jahre hat eine Gruppe von psychodynamisch orientierten PsychotherapeutInnen versucht, das Problem der mit jeder Operationalisierung einhergehenden Reduktion der Komplexität von klinischen Einzelfällen zu lösen und sich damit den Kriterien der Nachvollziehbarkeit, einer gewissen Objektivität sowie der Reliabilität zu stellen. Die AutorInnen veranschaulichen das Instrument an einem Einzelfallbeispiel. In ihrem Artikel»Diagnostik der Erziehungs- und Entwicklungssituation nach dem Multiaxialen Diagnosesystem Jugendhilfe (MAD-J)«stellen Karl Wahlen und André Jacob ein weiteres spezifisches Diagnoseinstrument vor, welches sich auf den komplexen Themenbereich der elterlichen Erziehung und kindlichen Entwicklung bezieht. Es schlägt eine mehrdimensionale Systematik vor, die wesentliche Aspekte des Erziehungshandelns von Eltern, der Entwicklung ihrer Kinder und der Bedingungen beschreibt, unter denen sich in Familien Erziehungs- und Entwicklungsprozesse vollziehen und miteinander verschränken. Die MAD-J-Dimensionen spannen einen Merkmalsraum auf, der die diagnostische Aufmerksamkeit differenziert und wichtige Wirkfaktoren hervorhebt, die auf das familiäre Erziehungsund Entwicklungsgeschehen Einfluss nehmen. Auf diese Weise lassen sich jugendhilferelevante familiäre Störungen, die die Entwicklung eines Kindes beeinträchtigen, leichter erkennen, beschreiben, verstehen/erklären und bewerten und passende, bedarfsgerechte Hilfeformen finden. In ihrem Artikel»Sozialpädagogische Diagnose ein Meilenstein auf dem Weg zu einer wirkungsorientierten Prozessgestaltung in der Einzelfallhilfe«bringen Hans Hillmeier und Harald Britze ein weiteres, bereits zahlreich bewährtes Diagnostikinstrument ein. Mit den Sozialpädagogischen Diagnose-Tabellen hat das Bayerische Landesjugendamt bereits seit vielen Jahren eine Handreichung zur Diagnostik in der Kinder- und Jugendhilfe geboten, die Fachkräfte in der Alltagspraxis der Gefährdungseinschätzung, der Feststellung der Leistungsvoraussetzungen für eine Hilfe zur Erziehung und in der Hilfeplanung unterstützt. Im vorliegenden Beitrag werden die Grundzüge der vor kurzem evaluierten und aktualisierten Sozialpädagogischen Diagnose-Tabellen beschrieben und verfahrensstrukturell in das Hilfeplanverfahren eingeordnet. Auf dem Weg zu einer wirkungsorientierten Steuerung und im Dialog mit Kooperationspartnern in der Gesundheitshilfe, Schule, Verwaltung und Justiz wird zudem versucht, sozialpädagogische Fachlichkeit als rechtsstaatliches Verwaltungshandeln nachvollziehbar auf den Punkt und zur Geltung zu bringen. In ihrem Artikel»Biografieorientiertes Verstehen und Verständigen als ganzheitlich, lebensweltlich und dialogisch orientierte Fallarbeit. Ein rekonstruktiver Zugang in der Kinder- und Jugendhilfe«stellt Bettina Völter einen ganzheitlichen und damit klassisch sozialarbeiterischen Zugang zur Diagnostik vor, der die Grundprinzipien eines lebenswelt- und subjektorientierten, transperspektivischen und transdimensionellen, professions- und institutionenkritischen, auch i. S. von Macht dekonstruierenden, selbst- und fremdreflexiven sowie ethnografisch und qualitativ-rekonstruktiv fundierten Fallverstehens vertritt. Der Alltags- und Lebensweltbezug ist in diesem Ansatz ebenso enthalten wie gesundheitliche, soziale 16
18 Einleitung oder psychische Aspekte. Die Methoden der Biografiearbeit sind für dieses Verfahren ebenso geeignet wie Formen narrativer und narrativ-biografischer Gesprächsführung. Darüber hinaus werden im Aufsatz zwei Varianten der professionellen und diagnostischen Aufarbeitung einer dialogisch und/oder spielerisch erhobenen Wissensbasis vorgestellt. Das Verfahren schließt damit an die aktuellen Diskussionen in der sozialpädagogischen Einzelfallhilfe sowie an partizipative sowie dialogische Ansätze in der Kinder- und Jugendhilfe an. In ihrem Artikel»EQUALS ein teilstandardisiertes Instrument zur interdisziplinären Zielvereinbarung und Unterstützung des Hilfeplanverfahrens in der Kinder- und Jugendhilfe«vertreten Martin Schröder, Nils Jenkel und Marc Schmid eine vermittelnde Position zwischen den bisher vorgestellten Ansätzen. Der Beitrag der Autoren zielt darauf ab, den Bedarf eines interdisziplinären und teilstandardisierten Instruments zur Bestimmung der gesellschaftlichen Teilhabe von jungen Menschen in der Kinder- und Jugendhilfe deutlich zu machen. Auf der Grundlage einer gemeinsam erarbeiteten Diagnostik wird ein umfassendes Fallverständnis produziert, welches die Basis für die Hilfeplangespräche im Einzelnen und somit für die gesamte Erziehungshilfe im Allgemeinen legt. Anhand eines Praxisbeispiels mit dem Computerprogramm EQUALS wird ein idealtypischer Verlauf zur Strukturierung und Erstellung eines Hilfeplangesprächs verdeutlicht. Damit wird der Nutzen eines strukturierten Hilfeplangesprächs unter Verwendung von EQUALS für alle Beteiligten deutlich und führt nach Ansicht der AutorInnen zu einer Professionalisierung des Hilfeplanverfahrens. In seinem Artikel»Lebenswelt und Lebensfeld Diagnostik des Sozialen in der Jugendhilfe«beschäftigt sich Peter Pantuček mit diagnostischen Verfahren, die verschiedene Aspekte der sozialen Einbindung von Personen abbilden. Diese sind geeignet, Ressourcen und Hindernisse für wünschenswerte Änderungen in der Lebenssituation der AdressatInnen aufzuspüren. Im Fokus stehen die Beziehungen im Umfeld, Aspekte der Inklusion, aber auch biografische Fakten. Besonders interessant, so der Autor, sind dabei Instrumente, die eine strukturierte kooperative Diagnostik, also die Beteiligung der KlientInnen am Prozess der Datenproduktion und Interpretation ermöglichen. Gerahmt wird der Beitrag durch grundsätzliche Überlegungen zu Fragen der Sozialen Diagnostik im Kontext der Jugendhilfe, insbesondere zum Verhältnis von Diagnose und Intervention und zu Problemen der Einschätzung von Risiken. In seinem Artikel»Systematische Diagnostik in der Jugendhilfe mit dem Störungsübergreifenden Diagnostik-System für die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie (SDS-KJ)«stellt Michael Borg-Laufs ein Verfahren vor, das eine systematische Diagnostik ermöglicht, die so der Autor im Bereich der Kinderund Jugendhilfe gut nutzbar ist. Exemplarisch wird dazu in das Diagnostik-System eingeführt. Auf den Ebenen Verhaltensanalyse, Beziehungsanalyse, Motivationsanalyse, Störungsbildanalyse, Ressourcenanalyse und Systemanalyse werden interventionsorientierte Einschätzungen generiert, die wichtige Aspekte der Kinderund Jugendhilfe abdecken. In ihrem Artikel»Zugänge und Anwendungen systemischer Diagnostik«reflektieren Sebastian Baumann und Hartmut Epple die Entwicklungen im systemischen Bereich zum vorliegenden Thema. Die Zeiten, in denen systemische 17
19 Einleitung Therapeuten auf diagnostische Verfahren einzig mit Stirnrunzeln reagierten, sind ihrer Ansicht nach vorbei, geblieben ist jedoch, so die Autoren, ein spezifisches Verständnis von Diagnostik. Der vorliegende Beitrag schafft einen Zugang dazu, wozu systemische Diagnostik in der Jugendhilfe nützlich sein kann und worin sie sich im Vergleich zu anderen diagnostischen Sichtweisen und Selbstverständnissen unterscheidet. Im zweiten Teil des Artikels werden systemisch orientierte diagnostische Perspektiven auf drei miteinander verbundenen Ebenen vorgestellt: Der Ebene der Klienten, der des Helfersystems sowie einer Selbstdiagnostik. Die einzelnen Zugänge und Anwendungen sind durch Fallbeispiele erläutert. In ihrem Artikel»Sonderpädagogische Diagnostik als Teil des Beratungsauftrags von Klinikschulen am Beispiel der Berliner Schule in der Charité«zeigen Inka Vogler und Ronald Vierock, dass Klinikschulen über den Bildungs- und Erziehungsauftrag hinaus auch weitere Aufgaben haben. Ein wesentlicher Auftrag ist die Schullaufbahnberatung für Kliniken, Schüler und Eltern, aber auch für Heimatschulen und andere beteiligte Institutionen. Dazu ist es erforderlich, wesentliche Informationen zur schulischen Entwicklung, zum Lern- und Entwicklungsstand und zum Sozialverhalten zu ermitteln und in die klinische Diagnostik einzubringen. Auf dieser Grundlage wird eine fundierte schulische Empfehlung formuliert, die sich auf die Kompetenzen der Schülerin bzw. des Schülers bezieht und an sonderpädagogischen Kriterien sowie an inklusiven schulischen Voraussetzungen orientiert ist. Hierzu wurden in den letzten Jahren zahlreich Verfahren entwickelt. Der Artikel gibt einen Überblick. Das abschließende Kapitel»Vorschlag für ein biopsychosoziales Rahmen- Verbundmodell«versucht, über alle vorhergehenden Artikel hinweg einen Bogen zu spannen. Es wird ein Modell vorgestellt, in dem konzeptionell die vorherigen Ideen, Instrumente und Vorgehensweisen Platz finden. Dieses Rahmen-Verbundmodell wird skizzenhaft an einem Fallbeispiel verdeutlicht. Unter dem Titel»Zur Implementation biopsychosozialer Diagnostik in der Kinder- und Jugendhilfe: ein Vorschlag«reflektieren Silke Birgitta Gahleitner und Hans Günther Homfeldt jedoch zugleich, ob und inwiefern die Implementation biopsychosozialer Diagnostik in der Kinder- und Jugendhilfe gelingen kann und welche Aspekte dabei zu berücksichtigen sind. Dabei wird deutlich: Das Projekt»biopsychosozial«stellt an die beteiligten Professionen und an die zugrundeliegenden Disziplinen hohe Ansprüche. Für deren Einlösung hat die Kinder- und Jugendhilfe noch eine Reihe von Aufgaben vor sich. Die Kinder- und Jugendhilfe steht in einem prekären Spannungsfeld von gesellschaftlichen und professionellen Veränderungsprozessen. Lebens- und Arbeitswelten verlangen besonders von Heranwachsenden, sich flexibel zu verhalten, Risiken einzugehen und selbstbestimmt zu leben. Die Auflösung sozialer Milieus, Individualisierungsschübe und die Entgrenzung der Lebensalter beschleunigen sich wechselseitig und treffen Kinder und Jugendliche aus sozioökonomisch und -kulturell benachteiligten Bevölkerungsteilen besonders hart. Ihre Teilhabechancen am gesellschaftlichen Leben sind so eingeschränkt, dass sie einen»besonderen Versorgungsbedarf«aufweisen. Vor diesem Hintergrund ist ein spezifischer psychosozialer Hilfebedarf entstanden (Keupp, 2012), der beteiligte Fachkräfte wie 18
20 Literatur Institutionen vor beachtliche Herausforderungen stellt. Insbesondere der Diagnostikbereich stellt hier einen sensiblen Abschnitt in der Hilfeplanung dar, der besonderes Augenmerk verlangt. Wir hoffen, das vorliegende Buch trägt dazu bei, im Prozess der Hilfeplanung und -durchführung noch etwas genauer hinzuschauen, Kooperationen besser gelingen zu lassen und Entscheidungen über die Gewährung und Gestaltung von Hilfen noch fundierter zu treffen. Berlin, Dezember 2012 Silke Birgitta Gahleitner, Karl Wahlen, Oliver Bilke-Hentsch und Dorothee Hillenbrand Literatur Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2002). Elfter Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. Berlin: BMFSFJ. ( Zugriff am Schmid, M., Nützel, J., Fegert, J. M. & Goldbeck, L. (2006). Wie unterscheiden sich Kinder aus Tagesgruppen von Kindern aus der stationären Jugendhilfe? Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie 55 (7), Verein für Kommunalwissenschaften (VfK) e. V. (2005). Diagnostik in der Kinder- und Jugendhilfe. Vom Fallverstehen zur richtigen Hilfe. Dokumentation der Fachtagung vom April 2005 (Reihe: Aktuelle Beiträge zur Kinder- und Jugendhilfe, Bd. 51). Berlin: Verein für Kommunalwissenschaften e. V. (edoc.difu.de/edoc.php?id=u31 045WG), Zugriff am
21
22 Interdisziplinäre und interprofessionelle Aspekte Biopsychosozialer Diagnostik
23
24 1 Biopsychosoziale Diagnostik aus Sicht der Sozialen Arbeit Silke Birgitta Gahleitner Die Soziale Diagnose hat eine lange und wechselvolle Geschichte. Vertieft man sich in Klassiker wie z. B. Alice Salomons historisches Werk (1926/2004), stellt man fest, dass viele ihrer Forderungen bis heute uneingelöst geblieben sind. Insbesondere Salomons Anspruch an wissenschaftliche Fundierung und Theorieorientierung einerseits und Praxiszugewandtheit andererseits erinnert stark an aktuelle Fachdebatten. Tatsächlich hat sich nach einem nachhaltigen Bruch im Nationalsozialismus erst wieder in den vergangenen beiden Jahrzehnten ein breiterer wissenschaftlicher Diskurs zum Thema Diagnostik in der Sozialen Arbeit etabliert. Gerade in Kinder- und Jugendhilfezusammenhängen distanzieren sich soziale und pädagogische Berufsgruppen z. T. bis heute enttäuscht von machtträchtigen Entmündigungsprozessen aus den dominanten medizinischen und psychologischen Professionsbereichen nicht selten von Diagnostikprozessen insgesamt. Vor dem Hintergrund der wechselvollen deutschen Geschichte ist die Notwendigkeit eines sensiblen und berufsethisch reflektierten Umgangs der Sozialen Arbeit mit Diagnostik und Diagnosen auch verstehbar das darf jedoch nicht zu einem Rückzug aus dem methodischen Feld insgesamt führen, das für jede Intervention Voraussetzung ist. Im Folgenden soll, nach einer kurzen Darstellung des geschichtlichen Hintergrundes, die inhaltliche Ausgestaltung biopsychosozialer Diagnostik in der Sozialen Arbeit in den Grundzügen skizziert werden. 1.1 Geschichte Bereits zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts entwickelte Mary Richmond in den USA Gedanken zur Sozialen Diagnose, die aus ihrer Sicht»als Versuch beschrieben werden kann, die exaktest mögliche Definition einer Situation und Persönlichkeit eines Menschen mit bestimmten sozialen Bedürfnissen vorzunehmen, und zwar im Zusammenhang mit anderen Menschen, [...] aber auch im Zusammenhang mit den sozialen Institutionen seines Gemeinwesens«(Richmond, 1917, S. 357; Übersetzung Geißler-Piltz; vgl. hier und im Folgenden Gahleitner, Hahn & Glemser, 2012). Alice Salomon griff diese Überlegungen auf und passte sie an passgenaue Versorgungsbedarfe an, betonte also bereits damals die Unabdingbarkeit von Diagnostik für die Fallkonzeption und Intervention. Auf diese Weise gelang es ihr, in der Isolation Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg die damals 23
25 1 Biopsychosoziale Diagnostik aus Sicht der Sozialen Arbeit aktuellen Diskurse um die Gestaltung der Sozialen Arbeit aufzugreifen, international Anschluss zu finden und darauf aufbauend mit Siddy Wronsky die methodischen Grundlagen einer»sozialen Therapie«(Salomon & Wronsky, 1926) zu postulieren. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten jedoch kam die Entwicklung und Professionalisierung der Sozialen Arbeit in Deutschland zum Erliegen,»für das beruflich-ethische Selbstverständnis hat[te] das Gesetz zur Vereinheitlichung des Gesundheitswesens (Juli 1934) verheerende Folgen«(Geißler-Piltz, 2006, S. 9). Die nationalsozialistischen Gesetzgeber unterstellten mit diesem Gesetz die GesundheitsfürsorgerInnen den MedizinerInnen als Hilfskräfte, und in der Folge wurden die Ideen einer Sozialen Diagnose pervertiert und für menschenverachtende, selektive und eugenische Zwecke missbraucht. In den 1960er und 1970er Jahren wurde im Versuch, den Nationalsozialismus aufzuarbeiten, verständlicherweise»diagnose [...] als Stigmatisierung und Verrat am gesellschaftlichen Auftrag gewertet. Soziale Probleme, so lautet[e] die Kritik, werden psychologisiert und dadurch geglättet«(ebd., S. 10). In diesem Widerstreit zwischen Politisierung und Therapeutisierung der Sozialen Arbeit wuchs jedoch zunehmend die Gefahr methodischer Willkürlichkeit, und der Sozialen Arbeit gelang es kaum, sich spezifisch und professionell auszurichten. Erst im Zuge der Psychiatrie-Enquête 1975 fand die psychosoziale Einzelfallarbeit sowie die inhärente Bedeutung sozialer Faktoren für die Entstehung und Behandlung von Erkrankungen und psychischen Störungen wieder stärkere Beachtung. In den letzten beiden Jahrzehnten der Professionalisierung in der Sozialen Arbeit und verstärkt mit der Ausgestaltung fachsozialarbeiterischer Strömungen ist jedoch die Überzeugung gereift, dass die Soziale Arbeit ihrer Schlüsselrolle in Diagnostikprozessen insbesondere der Kinder- und Jugendhilfe gerecht werden sollte ( Kap. 4; 18). Seither hat sich die Soziale Arbeit wieder stärker der Aufgabe gewidmet, das Zusammenspiel zwischen personalen, interpersonalen, institutionellen und kulturellen Dimensionen im sozialberuflichen Handlungsfeld in Diagnostik wie Intervention auszuleuchten und zusammenzudenken. Die Notwendigkeit einer eigenständigen Diagnostik in der Sozialen Arbeit wird nicht mehr ernsthaft infrage gestellt, auch nicht, dass sie einer engen Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen und Professionen bedarf. Im Folgenden sollen kurz einige aktuelle Positionen Sozialer Diagnostik für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe dargelegt werden. 1.2 Inhaltliche Ausgestaltung In ihrer Aufgabe, sozialen Dysfunktionen vorzubeugen und entgegenzuwirken (Klüsche, 1999), erweist sich Soziale Arbeit als besonders qualifiziert, die Schnittstelle zwischen individueller, sozialer, psychischer, medizinischer, ökonomischer 24
26 1.2 Inhaltliche Ausgestaltung und politischer Realität zu erfassen. Aufgrund der zentralen Stellung in der Hilfeplanung und Hilfeentscheidung in der Kinder- und Jugendhilfe fällt der Sozialen Arbeit in diesem Arbeitsgebiet ohnehin eine zentrale Schlüsselposition zu ( Kap. 4). In der Zusammenarbeit mit im diagnostischen Bereich stärker etablierten Disziplinen und Professionen aus dem Bereich der Medizin und Psychologie benötigt sie dazu jedoch eine klare Ausformulierung ihres Gegenstandes unter Nutzung der erworbenen psychosozialen und transdisziplinären Kompetenz als Kennzeichen einer»originären sozialarbeiterischen Berufsidentität«(Mühlum & Gahleitner, 2008, S. 49). Fachkräfte der Sozialen Arbeit sind folglich nicht nur gefordert, über interdisziplinäre Kenntnisse und Grundkonzepte zu verfügen, sondern zusätzlich, diese auf der Basis ihres Professionsverständnisses für ihre Berufspraxis kritisch zu reflektieren (Pauls & Gahleitner, 2011). Im Folgenden werden einige Kernaspekte zu dieser These zusammenfassend dargestellt Wozu biopsychosozial? Die psychosoziale und gesundheitliche Situation von Kindern und Jugendlichen in Deutschland gleicht einem Spagat. Das Gros der Kinder und Jugendlichen ist so gut versorgt wie keine Generation zuvor (Dornes, 2012). In der ZEIT formulierte Spiewak (2008):»Zu keiner anderen Zeit ging es der Mehrzahl der Kinder in diesem Land so gut wie heute.«es existiert jedoch auch eine andere Seite der Medaille: Kinder aus sozial benachteiligten Bevölkerungsteilen. In ihnen verdichten sich multiple sozioökonomische Problemlagen, die Akkumulation biologischer und sozialer Risikofaktoren und ein Mangel an Ressourcen und Bewältigungsmöglichkeiten zu einem hochgradigen Entwicklungsrisiko (Beck, 2012; vgl. hier und im Folgenden auch Gahleitner, 2012; Homfeldt & Gahleitner, 2012). Dieser Widerspruch ist relativ leicht erklärbar. Für alle Altersgruppen ist das Leben heute einerseits so gestaltbar, andererseits jedoch so gestaltungsbedürftig wie nie zuvor. Das»moderne Kind«benötigt daher ein großes Ausmaß an Flexibilität, Orientierung und Selbststeuerung, um das eigene Handeln entlang motivationaler Aspekte zu beeinflussen. Dies gilt für alle Kinder. Nicht alle Kinder jedoch bekommen dafür die gleichen Voraussetzungen. Bereits die Eltern»auffälliger«Kinder sind häufiger physisch oder psychisch krank und geben so bereits Ausgangsbelastungen an ihre Kinder weiter (Ravens-Sieberer & Erhart, 2008). Schlechte Bindungsqualitäten zu den Eltern wiederum sind ein Risikofaktor für spätere Beeinträchtigungen (Melzer, Bilz & Dümmler, 2008, S. 136). Wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass MigrantInnen-Kinder häufiger in Familien mit einem niedrigen sozioökonomischen Status leben und dass behinderte Kinder häufiger psychische Krankheiten entwickeln, wird deutlich, wie viele verschiedene Einflussfaktoren an den Bedingungen des Aufwachsens beteiligt sind (s. o.; vgl. zu Kindern und Jugendlichen mit besonderem Versorgungsbedarf Gahleitner & Homfeldt, 2012). In einer groß angelegten Studie aus den USA konnte beispielsweise aufgezeigt werden, wie stark Ungleichheitsverhältnisse sich auf den Gesundheitszustand auswirken (vgl. Wilkinson & Pickett, 2010). Soziale und gesundheitliche Probleme 25
Einleitung Literatur Biopsychosoziale Diagnostik aus Sicht der Sozialen Arbeit Silke Birgitta Gahleitner
 Einleitung... 11 Literatur................................ 19 Interdisziplinäre und interprofessionelle Aspekte Biopsychosozialer Diagnostik 1 Biopsychosoziale Diagnostik aus Sicht der Sozialen Arbeit...
Einleitung... 11 Literatur................................ 19 Interdisziplinäre und interprofessionelle Aspekte Biopsychosozialer Diagnostik 1 Biopsychosoziale Diagnostik aus Sicht der Sozialen Arbeit...
Einleitung 11. Literatur Biopsychosoziale Diagnostik aus Sicht der Sozialen Arbeit Silke Birgitta Gahleitner
 Einleitung 11 Literatur 19 Interdisziplinäre und interprofessionelle Aspekte Biopsychosozialer Diagnostik 1 Biopsychosoziale Diagnostik aus Sicht der Sozialen Arbeit... 23 Silke Birgitta Gahleitner 1.1
Einleitung 11 Literatur 19 Interdisziplinäre und interprofessionelle Aspekte Biopsychosozialer Diagnostik 1 Biopsychosoziale Diagnostik aus Sicht der Sozialen Arbeit... 23 Silke Birgitta Gahleitner 1.1
Einleitung W. Kohlhammer, Stuttgart
 Kinder, Heranwachsende und deren Familien geraten mitunter in schwierige Lebenslagen, in denen das Gelingen ihrer Entwicklung bzw. Erziehung gefährdet erscheint. Familien können dann zur Stärkung der Erziehungskompetenz
Kinder, Heranwachsende und deren Familien geraten mitunter in schwierige Lebenslagen, in denen das Gelingen ihrer Entwicklung bzw. Erziehung gefährdet erscheint. Familien können dann zur Stärkung der Erziehungskompetenz
DER WEG ZUM ZIEL. FALLVERSTEHEN IN DER SOZIALEN ARBEIT
 DER WEG ZUM ZIEL. FALLVERSTEHEN IN DER SOZIALEN ARBEIT Impulsvortrag am 07.05.2015 im Rahmen des 3. Bundeskongresses der Jugendhilfe im Strafverfahren und der ambulanten sozialpädagogischen Angebote für
DER WEG ZUM ZIEL. FALLVERSTEHEN IN DER SOZIALEN ARBEIT Impulsvortrag am 07.05.2015 im Rahmen des 3. Bundeskongresses der Jugendhilfe im Strafverfahren und der ambulanten sozialpädagogischen Angebote für
MAD-J Multiaxiales Diagnosesystem Jugendhilfe
 MAD-J Multiaxiales Diagnosesystem Jugendhilfe Ein diagnostisches Instrument zur Beschreibung und Bewertung der familiären Erziehungs- und Entwicklungssituation von Klienten der Kinder- und Jugendhilfe
MAD-J Multiaxiales Diagnosesystem Jugendhilfe Ein diagnostisches Instrument zur Beschreibung und Bewertung der familiären Erziehungs- und Entwicklungssituation von Klienten der Kinder- und Jugendhilfe
Roland Becker-Lenz Stefan Busse Gudrun Ehlert Silke Müller (Hrsg.) Professionalität in der Sozialen Arbeit
 Roland Becker-Lenz Stefan Busse Gudrun Ehlert Silke Müller (Hrsg.) Professionalität in der Sozialen Arbeit Roland Becker-Lenz Stefan Busse Gudrun Ehlert Silke Müller (Hrsg.) Professionalität in der Sozialen
Roland Becker-Lenz Stefan Busse Gudrun Ehlert Silke Müller (Hrsg.) Professionalität in der Sozialen Arbeit Roland Becker-Lenz Stefan Busse Gudrun Ehlert Silke Müller (Hrsg.) Professionalität in der Sozialen
Einführung in die Pädagogik bei Verhaltensstörungen
 Clemens Hillenbrand Einführung in die Pädagogik bei Verhaltensstörungen Mit 25 Abbildungen, 6 Tabellen und 45 Übungsaufgaben 4., überarbeitete Auflage Ernst Reinhardt Verlag München Basel Prof. Dr. Clemens
Clemens Hillenbrand Einführung in die Pädagogik bei Verhaltensstörungen Mit 25 Abbildungen, 6 Tabellen und 45 Übungsaufgaben 4., überarbeitete Auflage Ernst Reinhardt Verlag München Basel Prof. Dr. Clemens
Forschung und Entwicklung in der Erziehungswissenschaft. Herausgegeben von R. Treptow, Tübingen, Deutschland
 Forschung und Entwicklung in der Erziehungswissenschaft Herausgegeben von R. Treptow, Tübingen, Deutschland Herausgegeben von Prof. Dr. Rainer Treptow Tübingen, Deutschland Rainer Treptow Facetten des
Forschung und Entwicklung in der Erziehungswissenschaft Herausgegeben von R. Treptow, Tübingen, Deutschland Herausgegeben von Prof. Dr. Rainer Treptow Tübingen, Deutschland Rainer Treptow Facetten des
Vorwort Vorwort zur dritten Auflage Inhaltsverzeichnis Einleitung... 15
 Vorwort... 5 Vorwort zur dritten Auflage... 7 Inhaltsverzeichnis... 9 1 Einleitung... 15 Teil I 2 Soziale Arbeit... 23 2.1 Gegenstand Sozialer Arbeit... 23 2.1.1 Historische Wurzeln: Sozialpädagogik und
Vorwort... 5 Vorwort zur dritten Auflage... 7 Inhaltsverzeichnis... 9 1 Einleitung... 15 Teil I 2 Soziale Arbeit... 23 2.1 Gegenstand Sozialer Arbeit... 23 2.1.1 Historische Wurzeln: Sozialpädagogik und
Was braucht die postmoderne Gesellschaft an psychosozialer Beratung? Prof. Dr. Silke Birgitta Gahleitner -
 Was braucht die postmoderne Gesellschaft an psychosozialer Beratung? Prof. Dr. Silke Birgitta Gahleitner - www.gahleitner.net Ausgangspunkt Insbesondere in der postmodernen Welt bedürfen scheiternde Menschen
Was braucht die postmoderne Gesellschaft an psychosozialer Beratung? Prof. Dr. Silke Birgitta Gahleitner - www.gahleitner.net Ausgangspunkt Insbesondere in der postmodernen Welt bedürfen scheiternde Menschen
W- 377? Einführung in die Verhaltensgestörtenpädagogik. Clemens Hillenbrand. Ernst Reinhardt Verlag München Basel
 W- 377? Clemens Hillenbrand Einführung in die Verhaltensgestörtenpädagogik Mit 24 Abbildungen, 6 Tabellen und 45 Übungsaufgaben 2., aktualisierte Auflage Ernst Reinhardt Verlag München Basel Inhalt Vorwort
W- 377? Clemens Hillenbrand Einführung in die Verhaltensgestörtenpädagogik Mit 24 Abbildungen, 6 Tabellen und 45 Übungsaufgaben 2., aktualisierte Auflage Ernst Reinhardt Verlag München Basel Inhalt Vorwort
Inhalt. Teil I Grundlagen der Kinder- und Jugendhilfe
 Inhalt Teil I Grundlagen der Kinder- und Jugendhilfe Kapitel 1 Kinder- und Jugendhilfe - Geschichte und Gegenwart 15 Kinder- und Jugendhilfe - eine sozialpädagogische Dienstleistungsinfrastruktur für Kinder,
Inhalt Teil I Grundlagen der Kinder- und Jugendhilfe Kapitel 1 Kinder- und Jugendhilfe - Geschichte und Gegenwart 15 Kinder- und Jugendhilfe - eine sozialpädagogische Dienstleistungsinfrastruktur für Kinder,
Weiterbildung für Approbierte PP/KJP. Zusatzbezeichnung Systemische Therapie. Baustein. Theorie
 Baustein Theorie Die theoretische Weiterbildung setzt sich aus insgesamt 240 Stunden zusammen, deren Themen Systemisches Basiswissen, Systemische Diagnostik, Therapeutischer Kontrakt und Systemische Methodik
Baustein Theorie Die theoretische Weiterbildung setzt sich aus insgesamt 240 Stunden zusammen, deren Themen Systemisches Basiswissen, Systemische Diagnostik, Therapeutischer Kontrakt und Systemische Methodik
Vorwort 5. 1 Einleitung 13
 Vorwort 5 1 Einleitung 13 Teil I 19 2 Soziale Arbeit 21 2.1 Gegenstand Sozialer Arbeit 21 2.1.1 Historische Wurzeln: Sozialpädagogik und Sozialarbeit... 22 2.1.2 Soziale Arbeit als neuer Leitbegriff 25
Vorwort 5 1 Einleitung 13 Teil I 19 2 Soziale Arbeit 21 2.1 Gegenstand Sozialer Arbeit 21 2.1.1 Historische Wurzeln: Sozialpädagogik und Sozialarbeit... 22 2.1.2 Soziale Arbeit als neuer Leitbegriff 25
Inhalt. Teil I Grundlagen. Einführung 11
 http://www.beltz.de/de/nc/verlagsgruppe-beltz/gesamtprogramm.html?isbn=978-3-7799-3083-9 5 Inhalt Einführung 11 Teil I Grundlagen Kapitel 1: Kinderschutz was ist das? 18 1.1 Kinderschutz als vielfältiger
http://www.beltz.de/de/nc/verlagsgruppe-beltz/gesamtprogramm.html?isbn=978-3-7799-3083-9 5 Inhalt Einführung 11 Teil I Grundlagen Kapitel 1: Kinderschutz was ist das? 18 1.1 Kinderschutz als vielfältiger
Neuere konzeptionelle Entwicklungen auf dem Gebiet der psychosozialen Beratung
 Fachgruppentreffen Systemische Beratung in Magdeburg am 24.09.2015 Neuere konzeptionelle Entwicklungen auf dem Gebiet der psychosozialen Beratung Franz-Christian Schubert I. Einleitung: Entwicklung und
Fachgruppentreffen Systemische Beratung in Magdeburg am 24.09.2015 Neuere konzeptionelle Entwicklungen auf dem Gebiet der psychosozialen Beratung Franz-Christian Schubert I. Einleitung: Entwicklung und
Psychotherapie in der Erziehungsberatung
 Psychotherapie in der Erziehungsberatung 3. Landespsychotherapeutentag Stuttgart, 30. Juni 2007 Klaus Menne Für Erziehungsberatung ist psychoth. Kompetenz konstitutiv. Erziehungsberatung geht in ihren
Psychotherapie in der Erziehungsberatung 3. Landespsychotherapeutentag Stuttgart, 30. Juni 2007 Klaus Menne Für Erziehungsberatung ist psychoth. Kompetenz konstitutiv. Erziehungsberatung geht in ihren
«Das neue Konzept definiert ein Entwicklungsmodell, mit welchem sich das komplexe Zusammenspiel unterschiedlicher Faktoren in Bezug auf Behinderung
 12 «Das neue Konzept definiert ein Entwicklungsmodell, mit welchem sich das komplexe Zusammenspiel unterschiedlicher Faktoren in Bezug auf Behinderung abbilden und erklären lässt.» 2Geschichte des Konzepts
12 «Das neue Konzept definiert ein Entwicklungsmodell, mit welchem sich das komplexe Zusammenspiel unterschiedlicher Faktoren in Bezug auf Behinderung abbilden und erklären lässt.» 2Geschichte des Konzepts
Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e. V. (Hrsg.) Psychologie Gesellschaft Politik 2012 Die großen Volkskrankheiten
 Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e. V. (Hrsg.) Psychologie Gesellschaft Politik 2012 Die großen Volkskrankheiten 1 Herausgeber Vorstand des Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen
Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e. V. (Hrsg.) Psychologie Gesellschaft Politik 2012 Die großen Volkskrankheiten 1 Herausgeber Vorstand des Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen
Handbuch interdisziplinäre Frühförderung
 Klaus Sarimski Handbuch interdisziplinäre Frühförderung Mit 22 Abbildungen und 10 Tabellen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Prof. Dr. Klaus Sarimski, Dipl.-Psych. lehrt sonderpädagogische Frühförderung
Klaus Sarimski Handbuch interdisziplinäre Frühförderung Mit 22 Abbildungen und 10 Tabellen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Prof. Dr. Klaus Sarimski, Dipl.-Psych. lehrt sonderpädagogische Frühförderung
Soziale Arbeit in der Psychiatrie
 Margret Dörr Soziale Arbeit in der Psychiatrie 2., unveränderte Auflage Ernst Reinhardt Verlag München Basel Prof. Dr. Margret Dörr, Katholische Fachhochschule für Soziale Arbeit, Mainz Die 1. Auflage
Margret Dörr Soziale Arbeit in der Psychiatrie 2., unveränderte Auflage Ernst Reinhardt Verlag München Basel Prof. Dr. Margret Dörr, Katholische Fachhochschule für Soziale Arbeit, Mainz Die 1. Auflage
1 Psychodynamische Psychotherapie eine Begriffsbestimmung ... 1
 XI 1 Psychodynamische Psychotherapie eine Begriffsbestimmung... 1 1.1 Entwicklungen auf psychoanalytischer Grundlage... 1 1.2 Gemeinsame Grundkonzepte... 5 1.2.1 Das Wirken innerer psychischer Kräfte...
XI 1 Psychodynamische Psychotherapie eine Begriffsbestimmung... 1 1.1 Entwicklungen auf psychoanalytischer Grundlage... 1 1.2 Gemeinsame Grundkonzepte... 5 1.2.1 Das Wirken innerer psychischer Kräfte...
Zentrum Bayern Familie und Soziales
 Bayerisches Landesjugendamt 1 Der Monitor Hilfen zur Erziehung 2018 Was steckt hinter den Zahlen? Berlin, 25. Oktober 2018 Dr. Harald Britze stellv. Leiter der Verwaltung des Bayerischen Landesjugendamtes
Bayerisches Landesjugendamt 1 Der Monitor Hilfen zur Erziehung 2018 Was steckt hinter den Zahlen? Berlin, 25. Oktober 2018 Dr. Harald Britze stellv. Leiter der Verwaltung des Bayerischen Landesjugendamtes
Peter Pantucek. Lebensweltorientierte Individualhilfe Eine Einführung für soziale Berufe. Lambertus
 Peter Pantucek Lebensweltorientierte Individualhilfe Eine Einführung für soziale Berufe Lambertus Inhalt Vorwort 0. EINFÜHRUNG: ZUR BEDEUTUNG DER EINZELFALL- HILFE ALS ARBEITSFORM FÜR DIE SOZIALE ARBEIT
Peter Pantucek Lebensweltorientierte Individualhilfe Eine Einführung für soziale Berufe Lambertus Inhalt Vorwort 0. EINFÜHRUNG: ZUR BEDEUTUNG DER EINZELFALL- HILFE ALS ARBEITSFORM FÜR DIE SOZIALE ARBEIT
Ursula Hochuli Freund/Walter Stotz. Kooperative. Prozessgestaltung. in der Sozialen Arbeit. Ein methodenintegratives Lehrbuch
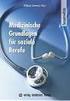 Ursula Hochuli Freund/Walter Stotz Kooperative Prozessgestaltung in der Sozialen Arbeit Ein methodenintegratives Lehrbuch 3., überarbeitete Auflage Verlag W. Kohlhammer Vorwort 5 Vorwort zur dritten Auflage
Ursula Hochuli Freund/Walter Stotz Kooperative Prozessgestaltung in der Sozialen Arbeit Ein methodenintegratives Lehrbuch 3., überarbeitete Auflage Verlag W. Kohlhammer Vorwort 5 Vorwort zur dritten Auflage
Klinische Sozialarbeit
 Brigitte Geißler-Piltz Albert Mühlum Helmut Pauls Klinische Sozialarbeit Mit 3 Abbildungen und 2 Tabellen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Inhalt Vorwort der Herausgeber 9 1 Selbstverständnis und professionsbezogene
Brigitte Geißler-Piltz Albert Mühlum Helmut Pauls Klinische Sozialarbeit Mit 3 Abbildungen und 2 Tabellen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Inhalt Vorwort der Herausgeber 9 1 Selbstverständnis und professionsbezogene
Soziale Arbeit im Gesundheitswesen
 Qualifizierungsbereich im Gesundheitswesen Intention der ist es, (1) die Potentiale der Sozialen Arbeit wie auch das damit verbundene soziale Mandat für das Gesundheitssystem nutzbar zu machen; (2) für
Qualifizierungsbereich im Gesundheitswesen Intention der ist es, (1) die Potentiale der Sozialen Arbeit wie auch das damit verbundene soziale Mandat für das Gesundheitssystem nutzbar zu machen; (2) für
Selbstgesteuertes Lernen bei Studierenden
 Pädagogik Tanja Greiner Selbstgesteuertes Lernen bei Studierenden Eine empirische Studie mit qualitativer Inhaltsanalyse von Lerntagebüchern Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Pädagogik Tanja Greiner Selbstgesteuertes Lernen bei Studierenden Eine empirische Studie mit qualitativer Inhaltsanalyse von Lerntagebüchern Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Inhaltsverzeichnis. O. Einleitung I. Problemdarstellung... 23
 5 Inhaltsverzeichnis O. Einleitung... 11 I. Problemdarstellung... 23 1. Der Pflegeprozess als Grundlage für die Umsetzung einer professionellen Pflege... 24 1.1. Einführung in den Pflegeprozess... 25 1.1.1.
5 Inhaltsverzeichnis O. Einleitung... 11 I. Problemdarstellung... 23 1. Der Pflegeprozess als Grundlage für die Umsetzung einer professionellen Pflege... 24 1.1. Einführung in den Pflegeprozess... 25 1.1.1.
Inhaltsverzeichnis. Teil I Vorwort Einleitung... 13
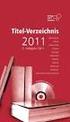 Vorwort..................................... 5 1 Einleitung................................ 13 Teil I............................... 19 2 Soziale Arbeit.............................. 21 2.1 Gegenstand
Vorwort..................................... 5 1 Einleitung................................ 13 Teil I............................... 19 2 Soziale Arbeit.............................. 21 2.1 Gegenstand
Online-Schulung Besonderheiten der Zielgruppe MmgB. Gefördert durch die KfW Stiftung
 Online-Schulung Besonderheiten der Zielgruppe MmgB Besonderheit der Zielgruppe Spezifika Geistige Behinderung Agenda 1. Menschen mit geistiger Behinderung 2. Begriffsklärung Geistige Behinderung 3. Definition
Online-Schulung Besonderheiten der Zielgruppe MmgB Besonderheit der Zielgruppe Spezifika Geistige Behinderung Agenda 1. Menschen mit geistiger Behinderung 2. Begriffsklärung Geistige Behinderung 3. Definition
Lernen mit ADS-Kindern
 Dr. Armin Born ist Diplom-Psychologe, Diplom- Pädagoge und Psychologischer Psychotherapeut. Nach dem Studium des Lehramts an Grund- und Hauptschulen, der Pädagogik und der Psychologie bildete er zunächst
Dr. Armin Born ist Diplom-Psychologe, Diplom- Pädagoge und Psychologischer Psychotherapeut. Nach dem Studium des Lehramts an Grund- und Hauptschulen, der Pädagogik und der Psychologie bildete er zunächst
Kindheits- und Jugendforschung
 Cathleen Grunert Kindheits- und Jugendforschung Einführung zum Modul Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung
Cathleen Grunert Kindheits- und Jugendforschung Einführung zum Modul Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung
Leitbild Soziale Arbeit im Gesundheitswesen
 Leitbild Soziale Arbeit im Gesundheitswesen Berufsverband Soziale Arbeit Schweiz Association professionnelle suisse du travail social Associazione professionale lavoro sociale Svizzera Associaziun professiunala
Leitbild Soziale Arbeit im Gesundheitswesen Berufsverband Soziale Arbeit Schweiz Association professionnelle suisse du travail social Associazione professionale lavoro sociale Svizzera Associaziun professiunala
Professionelles Handeln ist kooperatives Handeln!
 Inwiefern ist professionelles Handeln kooperatives Handeln? Professionelles Handeln ist kooperatives Handeln! Praxistagung vom 28. Januar 2015 Kathrin Schreiber Raphaela Ursprung Ziele dieses Angebots
Inwiefern ist professionelles Handeln kooperatives Handeln? Professionelles Handeln ist kooperatives Handeln! Praxistagung vom 28. Januar 2015 Kathrin Schreiber Raphaela Ursprung Ziele dieses Angebots
Inhaltsverzeichnis. Abbildungsverzeichnis... XI Tabellenverzeichnis... XIII
 Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis... XI Tabellenverzeichnis... XIII Rahmung/Einleitung... 1 Ausgangslage und Problemstellung... 5 Zur Relevanz der Sozialen Arbeit für die Psychiatrie (und das Gesundheitswesen)...
Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis... XI Tabellenverzeichnis... XIII Rahmung/Einleitung... 1 Ausgangslage und Problemstellung... 5 Zur Relevanz der Sozialen Arbeit für die Psychiatrie (und das Gesundheitswesen)...
Gesundes Aufwachsen in Familien mit psychisch kranken Eltern Verbindliche Kooperationen schaffen - komplexe Hilfen ermöglichen
 Gesundes Aufwachsen in Familien mit psychisch kranken Eltern Verbindliche Kooperationen schaffen - komplexe Hilfen ermöglichen Diplom-Psychologe Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen Abteilung Paderborn
Gesundes Aufwachsen in Familien mit psychisch kranken Eltern Verbindliche Kooperationen schaffen - komplexe Hilfen ermöglichen Diplom-Psychologe Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen Abteilung Paderborn
Psychologische Psychotherapeuten: Systemische Therapie
 Praktische Tätigkeit ( 2 PsychTh-APrV) Die Praktische Tätigkeit umfasst insgesamt mind. 1800 Stunden. Davon sind mind. 1200 Stunden in einer klinischen Einrichtung und mind. 600 Stunden in einer Psychotherapeutischen
Praktische Tätigkeit ( 2 PsychTh-APrV) Die Praktische Tätigkeit umfasst insgesamt mind. 1800 Stunden. Davon sind mind. 1200 Stunden in einer klinischen Einrichtung und mind. 600 Stunden in einer Psychotherapeutischen
Inhalt.
 Einleitung 11 1 Entwicklungen und Veränderungen der Heimerziehung 15 Das Negativimage der Heimerziehung 15 Die Entwicklung der Heimerziehung in ihrem historischen Kontext 16 Reformen und ihre Auswirkungen
Einleitung 11 1 Entwicklungen und Veränderungen der Heimerziehung 15 Das Negativimage der Heimerziehung 15 Die Entwicklung der Heimerziehung in ihrem historischen Kontext 16 Reformen und ihre Auswirkungen
Inhalt. Glemser
 Fachtag Denken, Verhalten und Einstellungen 20. Juni 2011 JVA Charlottenburg Psychosoziale Diagnostik Rolf Glemser M.A. Klinischer Sozialarbeiter Inhalt Glemser 2011 2 1 Inhalt Glemser 2011 3 Grundlagen
Fachtag Denken, Verhalten und Einstellungen 20. Juni 2011 JVA Charlottenburg Psychosoziale Diagnostik Rolf Glemser M.A. Klinischer Sozialarbeiter Inhalt Glemser 2011 2 1 Inhalt Glemser 2011 3 Grundlagen
Fachliche Weiterentwicklung und finanzielle Steuerung der Hilfen zur Erziehung
 Fachliche Weiterentwicklung und finanzielle Steuerung der Hilfen zur Erziehung Warum Kommunen handeln müssen - und worüber sie nachdenken sollten? Sechs Thesen zur Weiterentwicklung der HzE 1 Überblick:
Fachliche Weiterentwicklung und finanzielle Steuerung der Hilfen zur Erziehung Warum Kommunen handeln müssen - und worüber sie nachdenken sollten? Sechs Thesen zur Weiterentwicklung der HzE 1 Überblick:
Fragensammlung mit kommentierten Antworten
 Annette Fink Claudia Tritschler Prüfungsfragen Psychotherapie Fragensammlung mit kommentierten Antworten 4., korrigierte Auflage Annette Fink Claudia Tritschler Prüfungsfragen Psychotherapie Fragensammlung
Annette Fink Claudia Tritschler Prüfungsfragen Psychotherapie Fragensammlung mit kommentierten Antworten 4., korrigierte Auflage Annette Fink Claudia Tritschler Prüfungsfragen Psychotherapie Fragensammlung
ICF (Thema) / ICF-CY Klassifikation
 Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF / ICF-CY: bei Kindern und Jugendlichen) 1. WHO Klassifikationen 2. ICF / ICF-CY Überblick 3. Diagnostik auf Basis
Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF / ICF-CY: bei Kindern und Jugendlichen) 1. WHO Klassifikationen 2. ICF / ICF-CY Überblick 3. Diagnostik auf Basis
Junge Menschen für das Thema Alter interessieren und begeistern Lebenssituation von älteren, hochaltrigen und pflegebedürftigen Menschen verbessern
 Stefanie Becker Vorgeschichte Die Geschichte der Gerontologie ist eine lange und von verschiedenen Bewegungen gekennzeichnet Das Leben im (hohen) Alter wird mit steigender Lebenserwartung komplexer und
Stefanie Becker Vorgeschichte Die Geschichte der Gerontologie ist eine lange und von verschiedenen Bewegungen gekennzeichnet Das Leben im (hohen) Alter wird mit steigender Lebenserwartung komplexer und
Kinderschutz in Einrichtungen und Diensten der Jugendhilfe
 Basistexte Erziehungshilfen Kinderschutz in Einrichtungen und Diensten der Jugendhilfe Ein Lehr- und Praxisbuch zum Umgang mit Fragen der Kindeswohlgefährdung Bearbeitet von Reinhold Schone, Wolfgang Tenhaken
Basistexte Erziehungshilfen Kinderschutz in Einrichtungen und Diensten der Jugendhilfe Ein Lehr- und Praxisbuch zum Umgang mit Fragen der Kindeswohlgefährdung Bearbeitet von Reinhold Schone, Wolfgang Tenhaken
Mediation mit psychisch kranken Menschen
 Mediation mit psychisch kranken Menschen Sonja Schlamp Mediation mit psychisch kranken Menschen Wenn Merkmalsausprägungen psychischer Störungen den Mediationsprozess beeinflussen Bibliografische Informationen
Mediation mit psychisch kranken Menschen Sonja Schlamp Mediation mit psychisch kranken Menschen Wenn Merkmalsausprägungen psychischer Störungen den Mediationsprozess beeinflussen Bibliografische Informationen
Evangelische Jugendhilfe Kirschbäumleboden ggmbh
 Evangelische Jugendhilfe Kirschbäumleboden ggmbh Vernetzung Wohngruppe für Kinder (6-12 Jahre) Wohngruppe für Mädchen (6-16 Jahre) Außenwohngruppe für Jungen (13-17 Jahre) Wohngruppen Tagesgruppen Tagesgruppe
Evangelische Jugendhilfe Kirschbäumleboden ggmbh Vernetzung Wohngruppe für Kinder (6-12 Jahre) Wohngruppe für Mädchen (6-16 Jahre) Außenwohngruppe für Jungen (13-17 Jahre) Wohngruppen Tagesgruppen Tagesgruppe
Bedeutung der sozialpädagogischen Diagnostik. Sara Graute Marco Cabreira da Benta
 Bedeutung der sozialpädagogischen Diagnostik Sara Graute Marco Cabreira da Benta Sammeln von Daten und Fakten zum Fall sowie Einschätzungen von Dritten Verständnis und Akzeptanz hinsichtlich der Selbst-
Bedeutung der sozialpädagogischen Diagnostik Sara Graute Marco Cabreira da Benta Sammeln von Daten und Fakten zum Fall sowie Einschätzungen von Dritten Verständnis und Akzeptanz hinsichtlich der Selbst-
20 Jahre KJHG/ SGB VIII Flexible Hilfen: Idee und Realität
 Reinhard Wiesner 20 Jahre KJHG/ SGB VIII Flexible Hilfen: Idee und Realität EREV Forum 38-2009 Ambulante, flexible Hilfen 23.-25.September 2009 Frankfurt/ Main Übersicht 1. Flexible Hilfen: Annäherung
Reinhard Wiesner 20 Jahre KJHG/ SGB VIII Flexible Hilfen: Idee und Realität EREV Forum 38-2009 Ambulante, flexible Hilfen 23.-25.September 2009 Frankfurt/ Main Übersicht 1. Flexible Hilfen: Annäherung
Frage: Was stellt ihr euch unter dem Begriff Beratung vor? Hier wird Wissen Wirklichkeit
 Beratung Frage: Was stellt ihr euch unter dem Begriff Beratung vor? 2 Historie der Psychotherapie Ursprung von Psychotherapie und psychosozialer Beratung Ende des 19. Jhd. Erster Höhepunkt in Folge des
Beratung Frage: Was stellt ihr euch unter dem Begriff Beratung vor? 2 Historie der Psychotherapie Ursprung von Psychotherapie und psychosozialer Beratung Ende des 19. Jhd. Erster Höhepunkt in Folge des
Zentrum Bayern Familie und Soziales
 Zentrum Bayern Bayerisches Landesjugendamt 23.11.2016 Eingliederungshilfe nach 35a SGB VIII Wichtige Aspekte für die Gewährung von Hilfen - Vortrag im Rahmen des 7. Irsser Symposiums für Kinder- und Jugendpsychiatrie
Zentrum Bayern Bayerisches Landesjugendamt 23.11.2016 Eingliederungshilfe nach 35a SGB VIII Wichtige Aspekte für die Gewährung von Hilfen - Vortrag im Rahmen des 7. Irsser Symposiums für Kinder- und Jugendpsychiatrie
Manuela Brandstetter Monika Vyslouzil (Hrsg.) Soziale Arbeit im Wissenschaftssystem
 Manuela Brandstetter Monika Vyslouzil (Hrsg.) Soziale Arbeit im Wissenschaftssystem VS RESEARCH Manuela Brandstetter Monika Vyslouzil (Hrsg.) Soziale Arbeit im Wissenschaftssystem Von der Fürsorgeschule
Manuela Brandstetter Monika Vyslouzil (Hrsg.) Soziale Arbeit im Wissenschaftssystem VS RESEARCH Manuela Brandstetter Monika Vyslouzil (Hrsg.) Soziale Arbeit im Wissenschaftssystem Von der Fürsorgeschule
Die strukturelle Einbindung der Sozialen Arbeit in Palliative Care Teams
 Julia Bartkowski Die strukturelle Einbindung der Sozialen Arbeit in Palliative Care Teams Diplomica Verlag Julia Bartkowski Die strukturelle Einbindung der Sozialen Arbeit in Palliative Care Teams ISBN:
Julia Bartkowski Die strukturelle Einbindung der Sozialen Arbeit in Palliative Care Teams Diplomica Verlag Julia Bartkowski Die strukturelle Einbindung der Sozialen Arbeit in Palliative Care Teams ISBN:
Sabine Behn Nicolle Kügler Hans-Josef Lembeck Doris Pleiger Dorte Schaffranke Miriam Schroer Stefan Wink. Mediation an Schulen
 Sabine Behn Nicolle Kügler Hans-Josef Lembeck Doris Pleiger Dorte Schaffranke Miriam Schroer Stefan Wink Mediation an Schulen Sabine Behn Nicolle Kügler Hans-Josef Lembeck Doris Pleiger Dorte Schaffranke
Sabine Behn Nicolle Kügler Hans-Josef Lembeck Doris Pleiger Dorte Schaffranke Miriam Schroer Stefan Wink Mediation an Schulen Sabine Behn Nicolle Kügler Hans-Josef Lembeck Doris Pleiger Dorte Schaffranke
Inhaltsverzeichnis. Teil A: Grundlagen
 Inhaltsverzeichnis Teil A: Grundlagen 1 Grundlagen der Traumatherapie 15 Markus A. Landolt & Thomas Hensel 1.1 Warum eigentlich Traumatherapie? 15 1.2 Das psychische Trauma und seine Folgen 16 1.3 Traumazentrierte
Inhaltsverzeichnis Teil A: Grundlagen 1 Grundlagen der Traumatherapie 15 Markus A. Landolt & Thomas Hensel 1.1 Warum eigentlich Traumatherapie? 15 1.2 Das psychische Trauma und seine Folgen 16 1.3 Traumazentrierte
Methodisches Handeln in der Sozialen Arbeit
 Hiltrud von Spiegel Methodisches Handeln in der Sozialen Arbeit Grundlagen und Arbeitshilfen für die Praxis Mit 4 Abbildungen, 4 Tabellen und 30 Arbeitshilfen 5., vollständig überarbeitete Auflage Ernst
Hiltrud von Spiegel Methodisches Handeln in der Sozialen Arbeit Grundlagen und Arbeitshilfen für die Praxis Mit 4 Abbildungen, 4 Tabellen und 30 Arbeitshilfen 5., vollständig überarbeitete Auflage Ernst
Klinische Sozialarbeit
 Brigitte Geißler-Piltz Albert Mühlum Helmut Pauls 3 Klinische Sozialarbeit Mit 3 Abbildungen und 2 Tabellen Ernst Reinhardt Verlag München Basel 4 Selbstverständnis und professionsbezogene Verortung Prof.
Brigitte Geißler-Piltz Albert Mühlum Helmut Pauls 3 Klinische Sozialarbeit Mit 3 Abbildungen und 2 Tabellen Ernst Reinhardt Verlag München Basel 4 Selbstverständnis und professionsbezogene Verortung Prof.
Kapitel 1 Entwicklungen und Veränderungen der Heimerziehung
 Einleitung... Kapitel 1 Entwicklungen und Veränderungen der Heimerziehung Das Negativimage der Heimerziehung... Die Entwicklung der Heimerziehung in ihrem historischen Kontext... Reformen und ihre Auswirkungen...
Einleitung... Kapitel 1 Entwicklungen und Veränderungen der Heimerziehung Das Negativimage der Heimerziehung... Die Entwicklung der Heimerziehung in ihrem historischen Kontext... Reformen und ihre Auswirkungen...
Psychosoziale Diagnostik in der Jugendhilfe
 Viola Harnach Psychosoziale Diagnostik in der Jugendhilfe Grundlagen und Methoden für Hilfeplan, Bericht und Stellungnahme 5., überarbeitete Auflage 2007 Juventa Verlag Weinheim und München Inhalt 1. Aufgaben
Viola Harnach Psychosoziale Diagnostik in der Jugendhilfe Grundlagen und Methoden für Hilfeplan, Bericht und Stellungnahme 5., überarbeitete Auflage 2007 Juventa Verlag Weinheim und München Inhalt 1. Aufgaben
Sozialarbeit in Familien mit psychisch krankem Elternteil
 Geisteswissenschaft Birgit Lesker Sozialarbeit in Familien mit psychisch krankem Elternteil Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet
Geisteswissenschaft Birgit Lesker Sozialarbeit in Familien mit psychisch krankem Elternteil Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet
Konzept Ärztliche Psychotherapie
 Konzept Ärztliche Psychotherapie MAS und DAS Ärztliche Psychotherapie Leitung Studiengang lic. phil. Regula Flury Sekretariat Gulnara Berger Jutta Storck Rom UniversitätsSpital Zürich Klinik für Psychiatrie
Konzept Ärztliche Psychotherapie MAS und DAS Ärztliche Psychotherapie Leitung Studiengang lic. phil. Regula Flury Sekretariat Gulnara Berger Jutta Storck Rom UniversitätsSpital Zürich Klinik für Psychiatrie
Praxis und Methoden der Heimerziehung. Entwicklungen, Veränderungen und Perspektiven der stationären Erziehungshilfe
 Richard Günder Praxis und Methoden der Heimerziehung Entwicklungen, Veränderungen und Perspektiven der stationären Erziehungshilfe Lambertus Inhalt EINLEITUNG 11 KAPITEL I ENTWICKLUNGEN UND VERÄNDERUNGEN
Richard Günder Praxis und Methoden der Heimerziehung Entwicklungen, Veränderungen und Perspektiven der stationären Erziehungshilfe Lambertus Inhalt EINLEITUNG 11 KAPITEL I ENTWICKLUNGEN UND VERÄNDERUNGEN
1 Risiken und Folgen für Kinder psychisch kranker Eltern - Zum Stand der Forschung 17
 Inhalt Teil 1: Risiken und Belastungen 1 Risiken und Folgen für Kinder psychisch kranker Eltern - Zum Stand der Forschung 17 1.1 Exkurs: Prävalenz psychischer Störung im Kindes- und Jugendalter in der
Inhalt Teil 1: Risiken und Belastungen 1 Risiken und Folgen für Kinder psychisch kranker Eltern - Zum Stand der Forschung 17 1.1 Exkurs: Prävalenz psychischer Störung im Kindes- und Jugendalter in der
De-Psychologisierung und Professionalisierung der Sonderpädagogik
 Marc Willmann De-Psychologisierung und Professionalisierung der Sonderpädagogik Kritik und Perspektiven einer Pädagogik für schwierige Kinder Mit 3 Abbildungen und 9 Tabellen Ernst Reinhardt Verlag München
Marc Willmann De-Psychologisierung und Professionalisierung der Sonderpädagogik Kritik und Perspektiven einer Pädagogik für schwierige Kinder Mit 3 Abbildungen und 9 Tabellen Ernst Reinhardt Verlag München
Wenn Schüler streiten und provozieren
 Karl Landscheidt Wenn Schüler streiten und provozieren Richtig intervenieren bei antisozialem Verhalten Mit 3 Abbildungen und 10 Tabellen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Dipl.-Psych. Dr. Karl Landscheidt,
Karl Landscheidt Wenn Schüler streiten und provozieren Richtig intervenieren bei antisozialem Verhalten Mit 3 Abbildungen und 10 Tabellen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Dipl.-Psych. Dr. Karl Landscheidt,
LVR-Landesjugendamt. Junge Kinder in den Angeboten der stationären Erziehungshilfe
 Junge Kinder in den Angeboten der stationären Erziehungshilfe Rahmenbedingungen und fachliche Grundlagen der Angebote mit Plätzen für junge Kinder zur Erteilung der Betriebserlaubnis nach 45 SGB VIII in
Junge Kinder in den Angeboten der stationären Erziehungshilfe Rahmenbedingungen und fachliche Grundlagen der Angebote mit Plätzen für junge Kinder zur Erteilung der Betriebserlaubnis nach 45 SGB VIII in
Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen
 Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen Forum 2 Prof. Dr. Petra Mund, KHSB 2 Im Kontext von Beteiligung und Beschwerde stellen sich viele Fragestellungen:
Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen Forum 2 Prof. Dr. Petra Mund, KHSB 2 Im Kontext von Beteiligung und Beschwerde stellen sich viele Fragestellungen:
Gunter Groen Franz Petermann. Wie wird mein. Kind. wieder glücklich? Praktische Hilfe gegen Depressionen
 Gunter Groen Franz Petermann Wie wird mein Kind wieder glücklich? Praktische Hilfe gegen Depressionen Groen / Petermann Wie wird mein Kind wieder glücklich? Verlag Hans Huber Psychologie Sachbuch Wissenschaftlicher
Gunter Groen Franz Petermann Wie wird mein Kind wieder glücklich? Praktische Hilfe gegen Depressionen Groen / Petermann Wie wird mein Kind wieder glücklich? Verlag Hans Huber Psychologie Sachbuch Wissenschaftlicher
KINDERSCHUTZ BEDEUTET AUCH JUGENDLICHE SCHÜTZEN!
 KINDERSCHUTZ BEDEUTET AUCH JUGENDLICHE SCHÜTZEN! 1 Einführung zu Begrifflichkeiten, Gefährdungslagen und zur Beteiligung Julia Pudelko, Institut für soziale Arbeit e.v. KINDERSCHUTZ JUGENDLICHER MEHR ALS
KINDERSCHUTZ BEDEUTET AUCH JUGENDLICHE SCHÜTZEN! 1 Einführung zu Begrifflichkeiten, Gefährdungslagen und zur Beteiligung Julia Pudelko, Institut für soziale Arbeit e.v. KINDERSCHUTZ JUGENDLICHER MEHR ALS
Volkskrankheit Depression
 Natalia Schütz Volkskrankheit Depression Selbsthilfegruppen als Unterstützung in der Krankheitsbewältigung Diplomica Verlag Natalia Schütz Volkskrankheit Depression: Selbsthilfegruppen als Unterstützung
Natalia Schütz Volkskrankheit Depression Selbsthilfegruppen als Unterstützung in der Krankheitsbewältigung Diplomica Verlag Natalia Schütz Volkskrankheit Depression: Selbsthilfegruppen als Unterstützung
Das Multiaxiale Diagnosesystem Jugendhilfe (MAD-J)
 André Jacob Karl Wahlen Das Multiaxiale Diagnosesystem Jugendhilfe (MAD-J) Mit 33 Abbildungen und 25 Tabellen Mit Manual und 20 Formularen auf CD-ROM Mit CD-ROM Ernst Reinhardt Verlag München Basel Dr.
André Jacob Karl Wahlen Das Multiaxiale Diagnosesystem Jugendhilfe (MAD-J) Mit 33 Abbildungen und 25 Tabellen Mit Manual und 20 Formularen auf CD-ROM Mit CD-ROM Ernst Reinhardt Verlag München Basel Dr.
Kapitel 1 Entwicklungen und Veränderungen der Heimerziehung... 17
 Einleitung 13 Kapitel 1 Entwicklungen und Veränderungen der Heimerziehung... 17 Das Negativimage der Heimerziehung 19 Die Entwicklung der Heimerziehung in ihrem historischen Kontext 20 Reformen und ihre
Einleitung 13 Kapitel 1 Entwicklungen und Veränderungen der Heimerziehung... 17 Das Negativimage der Heimerziehung 19 Die Entwicklung der Heimerziehung in ihrem historischen Kontext 20 Reformen und ihre
Einführung in die Konfrontative Pädagogik
 Rainer Kilb / Jens Weidner Einführung in die Konfrontative Pädagogik Mit 5 Abbildungen, 4 Tabellen und 6 Übersichten Mit einem Beitrag von Manfred Oster Ernst Reinhardt Verlag München Basel Prof. Dr. Rainer
Rainer Kilb / Jens Weidner Einführung in die Konfrontative Pädagogik Mit 5 Abbildungen, 4 Tabellen und 6 Übersichten Mit einem Beitrag von Manfred Oster Ernst Reinhardt Verlag München Basel Prof. Dr. Rainer
Gelingende Kooperation im Kinderschutz. - Aus Fehlern lernen -
 Gelingende Kooperation im Kinderschutz - Aus Fehlern lernen - Christine Gerber, Jugend- & Sozialamt Frankfurt NZFH/DJI 15. Oktober 2014 Kooperation & Vernetzung als zentrale Strategie zur Qualitätsentwicklung
Gelingende Kooperation im Kinderschutz - Aus Fehlern lernen - Christine Gerber, Jugend- & Sozialamt Frankfurt NZFH/DJI 15. Oktober 2014 Kooperation & Vernetzung als zentrale Strategie zur Qualitätsentwicklung
Fortschritte der Psychotherapie Band 24 Essstörungen von Prof. Dr. Corinna Jacobi, Dr. Thomas Paul und PD Dr. Andreas Thiel
 Essstörungen Fortschritte der Psychotherapie Band 24 Essstörungen von Prof. Dr. Corinna Jacobi, Dr. Thomas Paul und PD Dr. Andreas Thiel Herausgeber der Reihe: Prof. Dr. Dietmar Schulte, Prof. Dr. Klaus
Essstörungen Fortschritte der Psychotherapie Band 24 Essstörungen von Prof. Dr. Corinna Jacobi, Dr. Thomas Paul und PD Dr. Andreas Thiel Herausgeber der Reihe: Prof. Dr. Dietmar Schulte, Prof. Dr. Klaus
PROJEKTSKIZZE ZUM AUFBAU VON NETZWERKEN FÜR PSYCHISCH ERKRANKTE ELTERN UND IHRE KINDER IN MÜNCHEN
 PROJEKTSKIZZE ZUM AUFBAU VON NETZWERKEN FÜR PSYCHISCH ERKRANKTE ELTERN UND IHRE KINDER IN MÜNCHEN erstellt von der Koordination für Psychiatrie und Suchthilfe der Landeshauptstadt München auf der Grundlage
PROJEKTSKIZZE ZUM AUFBAU VON NETZWERKEN FÜR PSYCHISCH ERKRANKTE ELTERN UND IHRE KINDER IN MÜNCHEN erstellt von der Koordination für Psychiatrie und Suchthilfe der Landeshauptstadt München auf der Grundlage
Vernachlässigte Kinder besser schützen
 Institut für Sozialarbeit und Sozialpäd ago gik e. V. (ISS) (Hg.) Vernachlässigte Kinder besser schützen Sozialpäd ago gisches Handeln bei Kindeswohlgefährdung 2., überarbeitete und ergänzte Auflage Mit
Institut für Sozialarbeit und Sozialpäd ago gik e. V. (ISS) (Hg.) Vernachlässigte Kinder besser schützen Sozialpäd ago gisches Handeln bei Kindeswohlgefährdung 2., überarbeitete und ergänzte Auflage Mit
Häufige Fragen, die im Zusammenhang mit dem Konzept der Funktionalen Gesundheit (Konzept FG) und der ICF gestellt werden.
 64 Häufige Fragen, die im Zusammenhang mit dem Konzept der Funktionalen Gesundheit (Konzept FG) und der ICF gestellt werden. Das Konzept der Funktionalen Gesundheit / FAQ FAQ Welchen Nutzen können Menschen
64 Häufige Fragen, die im Zusammenhang mit dem Konzept der Funktionalen Gesundheit (Konzept FG) und der ICF gestellt werden. Das Konzept der Funktionalen Gesundheit / FAQ FAQ Welchen Nutzen können Menschen
Jörg Fischer Thomas Buchholz Roland Merten (Hrsg.) Kinderschutz in gemeinsamer Verantwortung von Jugendhilfe und Schule
 Jörg Fischer Thomas Buchholz Roland Merten (Hrsg.) Kinderschutz in gemeinsamer Verantwortung von Jugendhilfe und Schule Jörg Fischer Thomas Buchholz Roland Merten (Hrsg.) Kinderschutz in gemeinsamer Verantwortung
Jörg Fischer Thomas Buchholz Roland Merten (Hrsg.) Kinderschutz in gemeinsamer Verantwortung von Jugendhilfe und Schule Jörg Fischer Thomas Buchholz Roland Merten (Hrsg.) Kinderschutz in gemeinsamer Verantwortung
Psychokardiologie. Ein Praxisleitfaden für Ärzte und Psychologen. Bearbeitet von C. Herrmann-Lingen, C. Albus, G. Titscher
 Psychokardiologie Ein Praxisleitfaden für Ärzte und Psychologen Bearbeitet von C. Herrmann-Lingen, C. Albus, G. Titscher 1. Auflage 2007. Buch. 200 S. ISBN 978 3 7691 0518 6 Zu Leseprobe schnell und portofrei
Psychokardiologie Ein Praxisleitfaden für Ärzte und Psychologen Bearbeitet von C. Herrmann-Lingen, C. Albus, G. Titscher 1. Auflage 2007. Buch. 200 S. ISBN 978 3 7691 0518 6 Zu Leseprobe schnell und portofrei
Wissenschaftliche und praktische Qualifizierung für die Approbation - Vorschläge der BPtK
 Wissenschaftliche und praktische Qualifizierung für die Approbation - Vorschläge der BPtK Dr. Nikolaus Melcop BPtK-Symposium Reform des Psychotherapeutengesetzes am 8.11.2016 in Berlin Ziele des Approbationsstudiums
Wissenschaftliche und praktische Qualifizierung für die Approbation - Vorschläge der BPtK Dr. Nikolaus Melcop BPtK-Symposium Reform des Psychotherapeutengesetzes am 8.11.2016 in Berlin Ziele des Approbationsstudiums
Neue Bindungen wagen
 Silke Birgitta Gahleitner Neue Bindungen wagen Beziehungsorientierte Therapie bei sexueller Traumatisierung Ernst Reinhardt Verlag München Basel Dr. phil. Silke Birgitta Gahleitner, Studium der Sozialpädagogik
Silke Birgitta Gahleitner Neue Bindungen wagen Beziehungsorientierte Therapie bei sexueller Traumatisierung Ernst Reinhardt Verlag München Basel Dr. phil. Silke Birgitta Gahleitner, Studium der Sozialpädagogik
Rechtliche Grundlagen Ablaufschema Zusammenfassung
 !"#$% & '% ( ) Rechtliche Grundlagen Ablaufschema Zusammenfassung )+) SGB IX - 2, Abs.1 Satz 1 SGB XII - 53 Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit
!"#$% & '% ( ) Rechtliche Grundlagen Ablaufschema Zusammenfassung )+) SGB IX - 2, Abs.1 Satz 1 SGB XII - 53 Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit
Silke B. Gahleitner / Dorothea Zimmermann / Dima Zito. Psychosoziale und traumapädagogische Arbeit mit geflüchteten Menschen
 Silke B. Gahleitner / Dorothea Zimmermann / Dima Zito Psychosoziale und traumapädagogische Arbeit mit geflüchteten Menschen V Geflüchtete Menschen psychosozial unterstützen und begleiten Herausgegeben
Silke B. Gahleitner / Dorothea Zimmermann / Dima Zito Psychosoziale und traumapädagogische Arbeit mit geflüchteten Menschen V Geflüchtete Menschen psychosozial unterstützen und begleiten Herausgegeben
Sexueller Missbrauch - Kinder als Täter
 Geisteswissenschaft Daniela Koch Sexueller Missbrauch - Kinder als Täter Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Geisteswissenschaft Daniela Koch Sexueller Missbrauch - Kinder als Täter Diplomarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Teil Methodische Überlegungen Zur Dysgrammatismus-Forschung... 17
 Inhaltsverzeichnis Dysgrammatismus EINLEITUNG Teil 1... 9 A Phänomen des Dysgrammatismus... 13 Methodische Überlegungen... 15 Zur Dysgrammatismus-Forschung... 17 B Die Sprachstörung Dysgrammatismus...
Inhaltsverzeichnis Dysgrammatismus EINLEITUNG Teil 1... 9 A Phänomen des Dysgrammatismus... 13 Methodische Überlegungen... 15 Zur Dysgrammatismus-Forschung... 17 B Die Sprachstörung Dysgrammatismus...
1. Programmatik 2. Theoretische Zugänge 3. Forschungsebene 4. Praxisebene
 Empfehlungen der DVSG 27. Reha-Kolloquium München DRV Deutscher Kongress für Rehabilitationsforschung Stephan Dettmers 1. Vorsitzender Gliederung 1. Programmatik 2. Theoretische Zugänge 3. Forschungsebene
Empfehlungen der DVSG 27. Reha-Kolloquium München DRV Deutscher Kongress für Rehabilitationsforschung Stephan Dettmers 1. Vorsitzender Gliederung 1. Programmatik 2. Theoretische Zugänge 3. Forschungsebene
David Reichel. Staatsbürgerschaft und Integration
 David Reichel Staatsbürgerschaft und Integration VS RESEARCH David Reichel Staatsbürgerschaft und Integration Die Bedeutung der Einbürgerung für MigrantInnen VS RESEARCH Bibliografische Information der
David Reichel Staatsbürgerschaft und Integration VS RESEARCH David Reichel Staatsbürgerschaft und Integration Die Bedeutung der Einbürgerung für MigrantInnen VS RESEARCH Bibliografische Information der
Die Behandlung psychischer Erkrankungen in Deutschland
 Die Behandlung psychischer Erkrankungen in Deutschland Springer Berlin Heidelberg New York Barcelona Budapest Ho ngkong London Mailand Paris Santa Clara Singapur Tokio ~tgesell... e:,'" für.r~.::::,: Psychiatrie,
Die Behandlung psychischer Erkrankungen in Deutschland Springer Berlin Heidelberg New York Barcelona Budapest Ho ngkong London Mailand Paris Santa Clara Singapur Tokio ~tgesell... e:,'" für.r~.::::,: Psychiatrie,
Stellungnahme der Bundesärztekammer
 Stellungnahme der Bundesärztekammer zur Änderung der Psychotherapie-Richtlinie: Indikation Schizophrenie (Anfrage des Gemeinsamen Bundesausschusses vom 17. April 2013) Berlin, 15.05.2013 Bundesärztekammer
Stellungnahme der Bundesärztekammer zur Änderung der Psychotherapie-Richtlinie: Indikation Schizophrenie (Anfrage des Gemeinsamen Bundesausschusses vom 17. April 2013) Berlin, 15.05.2013 Bundesärztekammer
Katja Wohlgemuth. Prävention in der Kinder- und Jugendhilfe
 Katja Wohlgemuth Prävention in der Kinder- und Jugendhilfe Katja Wohlgemuth Prävention in der Kinder- und Jugendhilfe Annäherung an eine Zauberformel Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Katja Wohlgemuth Prävention in der Kinder- und Jugendhilfe Katja Wohlgemuth Prävention in der Kinder- und Jugendhilfe Annäherung an eine Zauberformel Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Rückkehr einer autoritären Jugendhilfe? Kontrolle und Strafe unter dem Deckmantel von Schutz und Fürsorge
 Prof. Dr. Reinhold Schone FH Münster, FB Sozialwesen Die Rückkehr einer autoritären Jugendhilfe? Kontrolle und Strafe unter dem Deckmantel von Schutz und Fürsorge Dresden am 29.05.2013 KomDAT Jugendhilfe
Prof. Dr. Reinhold Schone FH Münster, FB Sozialwesen Die Rückkehr einer autoritären Jugendhilfe? Kontrolle und Strafe unter dem Deckmantel von Schutz und Fürsorge Dresden am 29.05.2013 KomDAT Jugendhilfe
1 Einleitung zur ersten Auflage 1. 2 Grundzüge kardialer Erkrankungen 5
 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung zur ersten Auflage 1 2 Grundzüge kardialer Erkrankungen 5, Markus Haass 2.1 Einführung in die normale Anatomie und Physiologie des Herz-Kreislauf-Systems - 5 2.2 Arterielle
Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung zur ersten Auflage 1 2 Grundzüge kardialer Erkrankungen 5, Markus Haass 2.1 Einführung in die normale Anatomie und Physiologie des Herz-Kreislauf-Systems - 5 2.2 Arterielle
Band II Heinz-Hermann Krüger Einführung in Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft
 Einführungskurs Erziehungswissenschaft Herausgegeben von Heinz-Hermann Krüger Band II Heinz-Hermann Krüger Einführung in Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft Die weiteren Bände Band I Heinz-Hermann
Einführungskurs Erziehungswissenschaft Herausgegeben von Heinz-Hermann Krüger Band II Heinz-Hermann Krüger Einführung in Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft Die weiteren Bände Band I Heinz-Hermann
Case Management in der Jugendhilfe
 Peter Löcherbach, Hugo Mennemann, Thomas Hermsen (Hrsg.) Case Management in der Jugendhilfe Mit 34 Abbildungen und 7 Tabellen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Prof. Dr. Peter Löcherbach, Dipl.-Päd.,
Peter Löcherbach, Hugo Mennemann, Thomas Hermsen (Hrsg.) Case Management in der Jugendhilfe Mit 34 Abbildungen und 7 Tabellen Ernst Reinhardt Verlag München Basel Prof. Dr. Peter Löcherbach, Dipl.-Päd.,
Qualität kontinuierlich und im Dialog entwickeln im Landkreis Hildesheim
 Qualität kontinuierlich und im Dialog entwickeln im Landkreis Hildesheim Konzeptentwicklung und Instrumente Stand 29.01.2016 Inhaltsverzeichnis 1. Ausgangssituation im LK Hildesheim 2. Definition Qualität
Qualität kontinuierlich und im Dialog entwickeln im Landkreis Hildesheim Konzeptentwicklung und Instrumente Stand 29.01.2016 Inhaltsverzeichnis 1. Ausgangssituation im LK Hildesheim 2. Definition Qualität
Die Qualitative Sozialforschung und die Methode der Biographieforschung
 Geisteswissenschaft Stefanie Backes Die Qualitative Sozialforschung und die Methode der Biographieforschung Studienarbeit Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... 1 1. Einleitung... 2 2. Qualitative Sozialforschung...
Geisteswissenschaft Stefanie Backes Die Qualitative Sozialforschung und die Methode der Biographieforschung Studienarbeit Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... 1 1. Einleitung... 2 2. Qualitative Sozialforschung...
