Wenn das Leben aus den Fugen gerät
|
|
|
- Susanne Keller
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Wenn das Leben aus den Fugen gerät
2 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Psychosoziale Krisen - Eine Gratwanderung zwischen Bewältigen und Scheitern Welche Potenziale bietet die Soziale Arbeit in Bezug auf die Mobilisierung von Bewältigungsstrategien und die Aktivierung von Widerstandskräften aufgezeigt am Beispiel der Krisenintervention - um gestärkt aus psychosozialen Krisen hervorzugehen? Bachelorarbeit von: Carmen Nicolini Myriam Thomann Riel 5 Via Fravi Domat/Ems 7013 Domat/Ems HS2010 HS2010 an der: FHS St. Gallen Hochschule für Angewandte Wissenschaften Fachbereich Soziale Arbeit Studienrichtung Sozialarbeit begleitet von: Prof. Stefan Ribler Dozent Fachbereich Soziale Arbeit Für den vorliegenden Inhalt sind ausschliesslich die Autorinnen verantwortlich. St. Gallen, 10. März 2014
3 1 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Inhaltsverzeichnis Abstract... 3 Vorwort... 8 Einleitung Psychosoziale Krisen Definition Entstehung Formen von Krisen Traumatische Krise Lebensveränderungs- und Entwicklungskrise Gefahren einer Krise Chancen einer Krise Persönlichkeitsentwicklung Ziel- und Motivationsentwicklung Entwicklung der persönlichen Wert- und Normvorstellungen Das persönliche Wachstum Resümee Resilienz Definition Merkmale Resilienz als Gegenstand der Forschung Risiko- und Schutzfaktoren Ein Wechselwirkungsprozess Risikofaktoren Schutzfaktoren Wechselwirkung Resümee Bewältigung Definition Bewältigungsverhalten Der Sozialisations- und Lebensbewältigungsprozess Konzept Selbstwertgefühl Lebenslagenkonzept Resümee...52
4 2 Wenn das Leben aus den Fugen gerät 4. Krisenintervention Definition Versorgungssysteme Ziele und Grundprinzipien Ablauf einer Krisenintervention Schutz vor Integritätsverletzungen seitens der Fachkräfte Resümee Krisenintervention in der Praxis Frauenhaus Graubünden Lebenslaufberatung und Care Team Grischun Dargebotene Hand Gesamtfazit der Interviewergebnisse Schlussfolgerungen...85 Schlusswort...95 Literaturverzeichnis...96 Quellenverzeichnis...98 Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis
5 3 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Abstract Keiner ist weise, der nicht das Dunkel kennt. (Hermann Hesse) Die Arbeit Wenn das Leben aus den Fugen gerät. Psychosoziale Krisen - Eine Gratwanderung zwischen Bewältigen und Scheitern beschreibt die Bewältigung von psychosozialen Krisen und den Einfluss von Resilienz diesbezüglich. Des Weiteren werden Interventionsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit im Sinne von ressourcenfördernden Faktoren - am Beispiel der Krisenintervention - aufgezeigt. Die Thematik der Risikogesellschaft verweist auf den gesellschaftlichen Prozess der Individualisierung, welcher beinhaltet, dass Menschen in ihrer Lebensbewältigung immer nach psychosozialer und biografischer Handlungsfähigkeit streben. Psychosoziale sowie subjektbezogene Problemstellungen stellen das Individuum jedoch vor diverse Herausforderungen in der alltäglichen Lebensbewältigung. Ein verlässlicher Rahmen wird immer weniger gewährleistet. Mit dem zunehmenden Zwang zur Selbstorganisation im gegenwärtigen Strukturwandel tritt der Bewältigungscharakter der Lebenslage umso stärker hervor. Viele sind durch die verlorene soziale Verlässlichkeit der industriellen Moderne entgrenzt. In dieser Dynamik werden individuelle Biographien immer öfters zu einer Aufschichtung von Bewältigungserfahrungen, indem sie immer wieder neuen kritischen Lebensereignissen ausgesetzt sind (vgl. Böhnisch, 2012, S. 31). Dieses Zusammenspiel erhöht die Wahrscheinlichkeit von psychosozialen Krisen. Die Soziale Arbeit als lebensweltorientierte Profession konzentriert sich auf die Lösung sozialer Probleme, wobei psychosoziale Krisen einen entscheidenden Gegenstand darstellen. Insofern sind Professionelle der Sozialen Arbeit Akteure sozialen Wandels innerhalb der Gesellschaft wie auch innerhalb der Lebenswelt der Individuen, Familien und sozialen Organisationen, in deren Auftrag sie arbeiten. Die Soziale Arbeit geht auf Krisen und Notlagen ebenso ein, wie auf alltägliche persönliche und gesellschaftliche Probleme. Psychosoziale Krisen sind, aufgrund der potenziellen Krisenbetroffenheit jeder und jedes Einzelnen, Gegenstand in jedem Handlungsfeld der Sozialen Arbeit. Neben der Auseinandersetzung mit Methoden, Modellen und Interventionsmassnahmen in Bezug auf den Umgang mit Krisen auf der Ebene der Klientinnen und Klienten, beinhaltet das Thema auch immer den Umgang mit eigenen und professionellen Grenzen und wird so zu einem persönlichen und beruflichen Anliegen.
6 4 Wenn das Leben aus den Fugen gerät In einer Gesellschaft, die auf effiziente Lösungen von Problemen ausgerichtet ist, schliesst die Soziale Arbeit den Aspekt mit ein, dass trotz aller Anstrengungen und dem Streben nach Handlungsfähigkeit nicht alle Herausforderungen bewältigt werden können. Angehörige beratender Professionen sind manchmal überfordert, wenn keine passende Problemlösung bereit steht und die Grenzen der Machbarkeit vor Augen geführt werden. Zudem laufen sie auch Gefahr, in der Ausübung ihrer Tätigkeit, selbst Opfer von Integritätsverletzungen zu werden. Die Erforschung von Schutz- und Risikofaktoren, als Grundlage zur Ressourcenerschliessung für die Förderung von Resilienz sowie anderen positiven und erfolgsversprechenden Bewältigungsmechanismen und Verhaltensweisen, kann aufschlussreiche und relevante Erkenntnisse für Interventionsmassnahmen im Berufsfeld der Sozialen Arbeit bezüglich Krisen liefern. Zudem kann ein Beitrag zur Prävention vor Integritätsverletzungen seitens der Professionellen der Sozialen Arbeit geleistet werden. Zusätzlich könnten, trotz Technologiedefizit, mit Hilfe des Theorie-Praxis-Transfers wichtige Grundprinzipien im Umgang mit Krisen erschlossen werden und handlungsleitende Ansätze daraus resultieren. Die daraus abgeleitete Fragestellung lässt sich wie folgt zusammenfassen: Welche Potenziale bietet die Soziale Arbeit in Bezug auf die Mobilisierung von Bewältigungsstrategien und die Aktivierung von Widerstandskräften - aufgezeigt am Beispiel der Krisenintervention - um gestärkt aus psychosozialen Krisen hervorzugehen? Es wird von der These ausgegangen, dass die Soziale Arbeit mit gezielten Interventionen dazu verhelfen kann, dass psychosoziale Krisen bei ausreichender Bewältigung zu Chancen in der persönlichen Entwicklung werden können. Kritische Lebensereignisse beinhalten das Risiko, bei einer unzureichenden Bewältigung in einer psychosozialen Krise zu münden. Psychosoziale Krisen treten in verschiedenen Formen auf und nehmen unterschiedliche Verläufe an. Sie sind durch einen Verlust von Handlungs- und Orientierungsfähigkeiten gekennzeichnet. Aus Sicht der Entwicklungstheorie bergen Krisen jedoch auch immer die Chance für eine positive persönliche Entwicklung. Bereits der Titel und die Gestaltung des Deckblatts implizieren, dass ein Krisenverlauf immer einen negativen als auch positiven Ausgang verzeichnen kann. Mit den kapiteleinleitenden Zitaten soll auflockernd verdeutlicht werden, dass Krisen Teil eines jeden Lebenslaufes sind und jede Person plötzlich und unvorbereitet davon betroffen sein kann. Dadurch weisen sie, genau wie die Lebensweisheiten, eine gewisse Allgemeingültigkeit sowie einen hohen Identifikationswert auf. Obwohl Krisen in der Umgangssprache generell eher negativ belastet sind, wird die Wendung zum Guten, im besten Fall vielleicht sogar zum Besseren, im Zuge dieser Arbeit immer mitgedacht.
7 5 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Die Gratwanderung zwischen dem Bewältigen und Scheitern einer Krise und welche Schritte auf dem Weg dieses Prozesses entscheidend sind, wird in den folgenden sechs Kapiteln beschrieben. Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Definition und den Merkmalen von psychosozialen Krisen. Welche Aspekte beeinflussen die Entstehung einer Krise und welche Faktoren beeinflussen ihren Verlauf? Wie sind die einzelnen Phasen gekennzeichnet und wie werden psychosoziale Krisen überhaupt klassifiziert? Welche Gefahren bergen sich hinter Krisen und welche Chancen ergeben sich allenfalls für die Betroffenen daraus? Welche Warnsignale gelten als eine mögliche Gefährdung und weshalb ist es wichtig, diese richtig einzuschätzen? Das zweite Kapitel befasst sich mit der Resilienztheorie. Ein Phänomen, dass es Menschen ermöglicht, trotz enormer Belastungen, welche eine positive Entwicklung bedrohen, scheinbar unbeschadet, wenn nicht sogar gestärkt, aus kritischen Lebensereignissen und Krisen hervorgehen - kurzum dem Leben zu widerstehen. Welche Faktoren tragen dazu bei, dass sich zahlreichen Risiken ausgesetzte Menschen positiv entwickeln? Ist Resilienz in bestimmten Menschen als genetische Eigenschaft angelegt oder eher ein Produkt des Sozialisationsprozesses? Was ist unter dem Risiko- und Schutzfaktorenkonzept zu verstehen und wie wirkt es sich auf das Gleichgewicht einer Person aus? Welche Erkenntnisse liefert die Resilienztheorie für mögliche Interventionen seitens der Sozialen Arbeit in Bezug auf den Umgang mit Krisen? Im dritten Kapitel wird der Fokus auf die Bewältigung von alltäglichen Lebensanforderungen und kritischen Lebensereignissen gelegt. Wie verhalten sich Krisenbetroffene angesichts der Bewältigungsanforderungen und welche Rolle spielen dabei Bewältigungsmechanismen? Mit Hilfe des Belastungs-Bewältigungsmodells nach Hurrelmann (2006) sowie dem Bewältigungsmodell nach Böhnisch (2012) wird der Bewältigungsprozess erläutert. Daraus abgeleitet, wird die hohe Signifikanz eines stabilen Selbstwertes, aufgezeigt. In Anlehnung an das erweiterte Lebenslagenkonzepts nach Meier Kressig und Husi (2013) werden für die verschiedenen Lebensbereiche konkrete Interventionsmöglichkeiten zur Krisenbewältigung erläutert. Darauf aufbauend wird im vierten Kapitel die Handlungsmethode der Krisenintervention, als konkretes Beispiel aus dem Methodenspektrum der Sozialen Arbeit, als potenzielle Erfolgschance, in Bezug auf die Krisenbewältigung, vorgestellt. Welche Grundvoraussetzungen müssen für eine effektive Unterstützung und Begleitung von Krisenbetroffenen gegeben sein? Welches sind die wichtigsten Schritte in der akuten Phase? Gibt es überhaupt einen konkreten Ablauf als Leitfaden für die Durchführung? Wer ist alles involviert und wo werden gegebenenfalls Triagen gemacht?
8 6 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Was ist das konkrete Ziel einer Krisenintervention, wo endet die Zusammenarbeit und kann ein Erfolg überprüft werden? In der Auseinandersetzung mit psychosozialen Krisen stellt sich weiter die Frage, wie sich Professionelle der Sozialen Arbeit vor eigenen Integritätsverletzungen schützen können. In diesem Zusammenhang wird der Integritätsbegriff nach Pollmann (2005) näher vorgestellt und mögliche Präventionsmassnahmen wie die Psychohygiene, die Selbstreflexion, das Coaching, die Supervision sowie die Kollegiale Beratung näher erläutert. Schliesslich wird im fünften Kapitel versucht, die Theoriebezüge aus den vorhergehenden Kapiteln in der Praxis zu überprüfen. Anhand von Befragungen drei gezielt ausgewählter Organisationen der Sozialen Arbeit, welche sich in ihrem professionellen Alltag direkt mit Krisen und deren Interventionen beschäftigen, wird eine Auswertung der Theorietauglichkeit vorgenommen. Hierzu wird die Methode des Leitfadeninterviews angewendet, wobei die Ergebnisse in fünf Kategorien dargestellt werden. Die Kategorien untersuchen das Angebot und den Zugang der jeweiligen Organisationen, der Ablauf einer Krisenintervention, die Ausbildungen und Kompetenzen der Mitarbeitenden, die Zusammenarbeit mit anderen Fachstellen, so wie die internen und externen Angebote bezüglich Psychohygiene respektive anderen protektiven Massnahmen. Ist es in der Praxis möglich, anhand von theoretischen Modellen in einer akuten Krise zu intervenieren? Sind die aus der Theorie erörterten Grundprinzipien deckungsgleich? Werden Präventionsmassnahmen für Integritätsverletzungen seitens der Sozialarbeitenden in den Berufsalltag integriert? In einem Gesamtfazit werden alle Ergebnisse aus den Interviews nochmals in den jeweiligen Kategorien verdichtet und als Erkenntnisse in die Verknüpfung der Schlussfolgerungen einbezogen. Es hat sich gezeigt, dass Krisenintervention eine der Kernaufgaben der Sozialen Arbeit darstellt. Ausgehend von der Annahme, dass jede Krise Chance und Risiko gleichermassen darstellt, begegnen Sozialarbeitende in der täglichen Arbeit Menschen, deren seelisches Gleichgewicht durch ein kritisches Lebensereignis bedroht ist. Die Folgen der unverhältnismässig grossen Aufbringung von Energie zur Bewältigung dieser Belastungen (Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit), löst häufig psychosoziale Krisen aus. Durch professionelle Interventionen können Krisen aufgefangen werden. Konkret geht es um die Klärung einer Krisensituation und in diesem Zusammenhang um Schutz bei akuter Gefährdung, eine deeskalierende Einwirkung auf die Betroffenen und ihr Umfeld, das Aufzeigen von Handlungsmöglichkeiten (Hilfe zur Selbsthilfe) und die Beratung hinsichtlich möglicher Hilfen und gegebenenfalls deren Einleitung.
9 7 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Um den Bewältigungsprozess (im Zuge einer längerfristigen Krisenberatung / -begleitung) positiv zu beeinflussen, ist die Mobilisierung und Aktivierung von personalen und sozialen Ressourcen zentral. Der Bewältigungsprozess selbst ist nicht Teil einer eigentlichen Krisenintervention, die Qualität derselben kann sich jedoch entscheidend darauf auswirken und zielt natürlich immer auf ein Gelingen hin. Erfolge wie auch Misserfolge können dabei nicht auf die Intervention zurückgeführt werden. Es wird deutlich, dass nicht auf ein Pauschalkonzept zur Krisenintervention zurückgegriffen werden kann. Bewältigungsverhalten entwickelt sich im Zuge der Sozialisation und ist darum individuell geprägt, was bewirkt, dass nicht allgemeingültig (Technologiedefizit) interveniert werden kann sondern, entlang von Grundprinzipien und Handlungsmaximen, internalisiert gearbeitet wird. Umso wichtiger ist die multiprofessionelle und interdisziplinäre Zusammenarbeit. Qualität kann anhand der Erreichbarkeit, der Flexibilität und der Handlungskompetenz des Hilfesystems sowie struktureller und örtlicher Ressourcen abgebildet werden. Dabei stellen sich Fragen nach einem niederschwelligen Zugang, von qualifizierten und kompetenten Beratenden Rund-um-die-Uhr, nach der Vernetzung des Angebotes, nach neutralen und geschützten Krisenräumen und nach freiwilliger Inanspruchnahme von Hilfen beziehungsweise einer Behandlung gegen den eigenen Willen. Durch Psychohygiene, welche von Organisationen Sozialer Arbeit durch interne und externe Angebote bewusst gefördert werden sollte, können sich Professionelle vor Integritätsverletzungen schützen, da diese aufgrund der hohen Anforderungen ein grosses Risiko darstellen und die Qualität der Krisenarbeit beeinträchtigen.
10 8 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Vorwort Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit Vielem wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr. (Xavier Naidoo) Dem ist nichts hinzuzufügen ausser Dank an unsere Begleitperson Prof. Stefan Ribler für den aufmunternden Zuspruch und die Steigerung der eigenen Kompetenzwahrnehmung, Dank an die Interviewpartnerinnen und partner für ihre Offenheit und Bereitschaft uns Einblick in ihrer Tätigkeit zu gewähren, Dank an Nicole Dobmann und Eva Maria Kampichler für das aufmerksame Vor-lesen und die aufschlussreichen Kommentare und Korrekturen, Dank an unsere Familien und Freunde für die Motivation, die Geduld und die Ratschläge. Und nicht zuletzt, herzlichen Dank an die Co-Autorinnen selbst, für die ausgezeichnete Zusammenarbeit, die ehrliche und konstruktive Kritik, die aufbauenden Worte, die Ordnung und Übersicht im unübersichtlichen Chaos, das gemeinsame Lachen, das Verzweifeln und wieder neuen Mut finden Krise als Chance? Aber sicher! Carmen Nicolini & Myriam Thomann, März 2014
11 9 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Einleitung Life is complicated. (G.A. Miller) Im Leben wird man immer wieder mit Schicksalsschlägen konfrontiert, denen wir ohne Vorwarnung und fassungslos gegenüberstehen. Es konfrontiert uns mit Verlusten, kleineren oder grösseren Katastrophen - kurzum Schattenseiten - denen wir schutzlos ausgeliefert sind und die sich fernab vom Alltag bewegen. Alltag bedeutet in diesem Sinne Handlungsroutinen abzurufen, die uns entlasten. Er bedeutet Sicherheit, in dem Gewohnheiten wiederholt und nicht immer wieder aufs Neue reflektiert werden müssen. Kritische Lebensereignisse hingegen werfen uns aus unserem Alltag in einen Zustand des Ungleichgewichts. Sie stellen eine Bedrohung dar, welche die Belastbarkeit übersteigen und zu Hilflosigkeit, Ohnmacht oder einem Verlust der Handlungsfähigkeit führen können und damit in eine Krise übergehen. Das Wort Krise stammt aus dem griechischen crisis und meint so viel wie Streit, Scheidung oder Entscheidung. Seine Wurzeln gehen zurück auf den Begriff krinein, was wiederum trennen bedeutet und darauf hinweist, dass Krisen in Verbindung mit einem Unterbruch stehen und ein einschneidendes Erlebnis beschreiben. Krisen begegnen wir in den unterschiedlichsten Bereichen - ob in der Wirtschaft, Politik, Medizin oder auch der Sozialen Arbeit - eines ist allen Krisen gemein: Mit Krisen ist ein Wendepunkt im Entwicklungsgeschehen gemeint, gekennzeichnet mit einem unsicheren Ausgang. Das chinesische Wort für Krise (Weiji) ist aus den beiden Begriffen Gefahr und Möglichkeit zusammengesetzt. Somit ist die Wendung zum Guten gleichermassen einbezogen wie die Wendung zum Schlechten. In unserem Alltagsgebrauch und im subjektiven Erleben der Menschen ist die Krise jedoch stark mit einer negativen Wertung verbunden. Um die Wortbedeutung von Krisen und kritische Lebensereignisse besser voneinander abgrenzen zu können, ist eine Begriffserklärung nötig: Von kritischen Lebensereignissen wird dann gesprochen, wenn Lebensereignisse beziehungsweise Lebenserfahrungen mit einer besonderen affektiven Tönung, die von der betroffenen Person als einschneidend im Lebenslauf betrachtet werden, eintreffen und beträchtliche Anpassungsleistungen erfordern. Kritische Lebensereignisse können sprichwörtlich aus der Bahn werfen und Pläne durchkreuzen. Ein solches kritisches Lebensereignis könnte beispielsweise eine Krankheit, eine Scheidung oder ein Partnerverlust sein. Zuweilen treten sie auch in Gestalt traumatischer Erfahrungen oder existenzieller Bedrohungen in Erscheinung. Diese kritischen Ereignisse können den Selbstwert einer Person in Frage stellen (vgl. Filipp & Aymanns, 2010, S ).
12 10 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Es gibt in allen Lebensläufen, wenn auch nicht zu allen Zeiten gleich, belastende Lebensereignisse und Krisen, auf die wir Antworten finden müssen Wir wollen die Quellen finden, welche einen Menschen darin unterstützen, sich trotz widriger Umstände zu entwickeln und vielleicht sogar daran zu gedeihen (Welter- Enderlin, 2010, S ). Ganz im Sinne von Welter-Enderlin ist diese Arbeit ein Versuch herauszufinden, was erforderlich ist, damit schwierige Lebenssituationen nicht als Bedrohung angesehen, sondern als Herausforderung des Lebens verstanden werden. Wer ein kritisches Lebensereignis erfolgreich hinter sich lässt, geht - so die Vermutung - gestärkt daraus hervor und vielleicht entwickelt es sich sogar zu einer Chance und eröffnet den Weg in positive Transformationen des Verhaltens und Erlebens und des Verständnisses von der eigenen Person und der Welt.
13 11 Wenn das Leben aus den Fugen gerät 1. Psychosoziale Krisen Chancen präsentieren sich uns mit Vorliebe in der Maske von Unannehmlichkeiten. (F.F.) In jeder Lebensphase können Menschen in Situationen geraten, die eine potenzielle Gefahr für einen weiteren positiven Entwicklungsverlauf darstellen. Sogenannte psychosoziale Krisen können jeden Menschen in jeder Lebensphase treffen. In diesem Kapitel wird zunächst der Begriff der psychosozialen Krise anhand verschiedener Definitionen erklärt. Weiter wird auf die Entstehung und Entwicklung eingegangen indem verschiedene Faktoren erläutert werden, die massgeblich auf den Krisenverlauf Einfluss nehmen. Auf zwei Formen von Krisen wird spezifischer eingegangen, um anhand dieser, die verschiedenen Phasen eines Krisenverlaufes vorzustellen. Zum Schluss wird auf mögliche Gefahren hingewiesen sowie auf die Chance des persönlichen Wachstums, der bei einer gelingenden Bewältigung entwickelt werden kann Definition Im Unterschied zum klassisch-medizinischen Begriff der Krise wird in den psychiatrischen und sozialwissenschaftlichen Theorien die Krise als ein Prozess aufgefasst, der durch eine Überlastung des Systems eine Labilisierung auslöst, die mit den üblichen Bewältigungsstrategien nicht mehr bewältigt werden kann und zu einer Bedrohung des Systems führt. In einer Krise wird die Identität im Sinne eines Zusammenbruchs, einer Minderung oder nachhaltigen Veränderung gefährdet, so, dass sich das System der Persönlichkeit nicht mehr aus sich heraus stabilisieren kann (vgl. Langwieser, 2004, S. 4). Der Begriff Krise wird im Alltag inzwischen sehr häufig verwendet, weshalb eine Definition äusserst schwierig ist. Wissenschaftlich gesehen bereitet dieser Umstand Probleme, weshalb bereits Caplan (1964) den Krisenbegriff zu präzisieren versuchte. So definiert Caplan (zit. in Fleisch, 2012, S. 3) eine psychosoziale Krise wie folgt: Verlust des seelischen Gleichgewichtes, den ein Mensch verspürt, wenn er mit Ereignissen und Lebensumständen konfrontiert wird, die er im Augenblick nicht bewältigen kann, weil sie von der Art und dem Ausmass her seine durch frühere Erfahrungen erworbenen Fähigkeiten und erprobten Hilfsmittel zur Erreichung wichtiger Lebensziele oder zur Bewältigung seiner Lebenssituation überfordern.
14 12 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Eine psychosoziale Krise kann auch definiert werden als ein belastender und temporärer Veränderungsprozess in einer Person, welcher offen in seinem Verlauf und seinen Folgen ist und sich durch einen Unterbruch der Kontinuität des Erlebens und Handelns kennzeichnet, in dem es zu einer partiellen Desintegration der Handlungsorganisation und einer Destabilisierung im emotionalen Bereich kommt (vgl. Ulich, 1987, zit. in Filipp & Aymanns, 2010, S. 14). Psychosoziale Krisen sind also zeitlich unbegrenzte Situationen, in welchen die Betroffenen erkennen, dass das Passungsgefüge zwischen ihnen und ihrer Umwelt nicht mehr funktioniert und dieses Ungleichgewicht auch nicht mittels einfacher Korrektur behoben werden kann. Die Auseinandersetzung mit dem kritischen Lebensereignis droht dann in einen krisenhaften Verlauf zu münden, wenn die Versuche der Reorganisation der Personen-Umwelt-Passung misslingen und, die daraus resultierenden negativen Affekte nicht reguliert werden können. Die Einschränkungen der Handlungs- und Problemlösungsfähigkeit nehmen stetig zu und führen zu einer zunehmenden emotionalen Destabilisierung (ebd., S. 15). Ciompi (1993) hingegen beschreibt die Merkmale einer Krise als meist akut, überraschend und mit bedrohlichem Charakter. Dies bringe eine Labilisierung mit sich, die mit einer erhöhten Suggestibilität verbunden ist und deshalb kleine Ursachen eine grosse Wirkung haben können. Der Mensch wird in einer momentanen Lebenssituation mit neuen belastenden Ereignissen oder Lebensumständen konfrontiert, die meist überraschend auftreten. Die bisherigen Lebensziele werden plötzlich in Frage gestellt. Diese zusätzliche Belastung können die Betroffenen nicht mehr mit ihren üblichen Lebensbewältigungsstrategien meistern, was zu einer innerpsychischen und sozialen Labilisierung führt. Betroffene Personen haben den Eindruck, ihr eigenes Leben nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Dieser emotionale Ablauf stellt eine massive Störung des seelischen Gleichgewichts dar. Das Identitätserleben und das Selbstwertgefühl kommen ins Wanken. Die Herausforderungen des Alltags können dadurch nicht mehr bewältigt werden, was zu zusätzlichen Schwierigkeiten in anderen Lebensbereichen führen kann (vgl. Stein, 2009, S ).
15 13 Wenn das Leben aus den Fugen gerät 1.2. Entstehung Jeder Mensch kann im Leben von aussergewöhnlichen Belastungen betroffen sein und muss sich diesen Veränderungen stellen. Manchmal gelingt dies besser, manchmal schlechter. Trotzdem müssen diese Herausforderungen des Lebens nicht unbedingt in eine Krise führen. Erst, wenn die Situation als bedrohlich empfunden wird und die Überzeugung aufkommt, dass die eigenen Ressourcen nicht mehr ausreichen, ist der Weg in die eigentliche Krise nicht mehr weit entfernt. Dieses Ungleichgewicht zwischen einem belastenden Ereignis und der eigenen Bewältigungsstrategie ist das zentrale Element der Krisenentstehung. Wie sich eine Krise entwickelt und welchen Verlauf diese annimmt, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, die in einer komplexen Wechselwirkung zueinander stehen. In der Methode der Krisenintervention ist diese Kenntnis von grosser diagnostischer Bedeutung (vgl. Stein, 2009, S. 25). Krisenanfälligkeit Subjektive Bedeutung Persönlichkeit Ereignis Bewältigungsmöglichkeit Reaktion der Umwelt Ressourcen Abb. 1: Faktoren, die zur Entstehung und zum Verlauf einer Krise massgeblich beitragen nach Stein Die Art und Schwere des Ereignisses sowie die subjektive Empfindung der Betroffenen sind für den weiteren Verlauf und Entwicklung einer Krise massgebend. Ein Ereignis bekommt erst dann einen krisenhaften Charakter, wenn es durch die subjektive Bedeutung des Menschen als krisenhaft empfunden wird. Das Gefühl, dass eine Belastung momentan nicht zu bewältigen ist, hängt zudem mit der kognitiven Auffassung einer Situation zusammen.
16 14 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Die Persönlichkeit und Krisenanfälligkeit spielen dabei ebenfalls eine massgebende Rolle. Der Betroffene muss überprüfen, auf welche Ressourcen er zurückgreifen kann und über welche Bewältigungsmöglichkeiten er verfügt. Dieses Wechselspiel zwischen Belastung und Bewältigung entscheidet, ob sich das aktuelle Ereignis zu einer Krise entwickelt. Weshalb Betroffene jedoch eine Situation kognitiv genauso auffassen und nicht anders, hängt stark mit ihrer Persönlichkeits- und Lebensentwicklung zusammen. Werden Menschen mit einem kritischen Lebensereignis konfrontiert, obwohl sie eine aktuelle Krise noch nicht bewältigt haben, kann dies den Bewältigungsprozess erheblich beeinträchtigen. Vor allem wenn die Thematik der neuen Belastung ähnlich ist, besteht eine erhöhte Krisenanfälligkeit (ebd., S ). Viele Krisen können durch eine tragfähige Unterstützung des sozialen Umfelds ohne professionelle Hilfe bewältigt werden. Die früheren Bindungserfahrungen eines Individuums spielen dabei einen wesentlichen Faktor. Wenn Menschen in ihrer Kindheit in kritischen Lebensereignissen auf die Hilfe ihrer Bezugspersonen zählen und dadurch Bewältigungsstrategien entwickeln konnten, wächst im späteren Leben das Vertrauen, dass Probleme gemeinsam besser gelöst werden können. Nicht alle Betroffenen können jedoch auf die Unterstützung von Familie und Freunde zurückgreifen. Vielleicht wirkt sich das unmittelbare soziale Umfeld sogar negativ auf eine Krise aus, was zu einer Verschärfung der Situation führen könnte (Reaktion der Umwelt). Ressourcen, die zielorientiert zur Bewältigung von kritischen Lebensereignissen eingesetzt und mobilisiert werden, können in Krisensituationen stabilisierende und bestärkende Effekte erzielen. All diese beschriebenen Faktoren tragen somit dazu bei, ob sich das eingetretene Ereignis zu einer Krise entwickelt und wie Betroffene letztlich mit ihr umgehen. Wie bedrohlich das Ereignis empfunden wird, bestimmen die verschiedenen Aspekte. In mehreren Phasen erfolgt die Anpassung an die veränderte Situation (Ereignis) und führt, je nachdem ob der Bewältigungsversuch erfolgreich war, zu einer Stabilisierung oder eben nicht (ebd., S ).
17 15 Wenn das Leben aus den Fugen gerät 1.3. Formen von Krisen In der Spezifizierung von Krisen gibt es keine eindeutigen Theoriebezüge. In der Praxis haben sich einige Unterscheidungen durchgesetzt, die jedoch sehr alternativ gebraucht werden und keiner allgemeingültigen Klassifikation unterliegen. In dieser Arbeit wird auf zwei, in der Praxis häufig verwendete, Krisenmodelle Bezug genommen - die Traumatische Krise und die Lebensveränderungs- und Entwicklungskrise - welche im Folgenden näher beschrieben werden. Dabei handelt es sich um idealtypische Modelle, weshalb die unten beschriebenen linearen Phasen in dieser Eindeutigkeit kaum vorkommen. Krisen entstehen nämlich unter den unterschiedlichsten Bedingungen und haben die vielfältigsten Erscheinungs- und Verlaufsformen. Die Phasen verstehen sich somit als spiralförmig und in Schleifen durchlaufend Traumatische Krise Eine traumatische Krise ist eine plötzlich eintretende Situation welche Cullberg (1978) als eine durch einen Krisenanlass mit subjektiver Wertigkeit plötzlich aufkommende Situation von allgemein schmerzlicher Natur, die auf einmal die psychische Existenz, die soziale Identität und Sicherheit und die fundamentalen Befriedigungsmöglichkeiten bedroht definiert (zit. in Stein, 2009, S. 57). Zur traumatischen Krise gehören unvorhergesehene Schicksalsschläge, wie der Tod eines nahestehenden Menschen, die Bekanntgabe einer Diagnose, der Ausbruch einer schweren Krankheit, die plötzliche Invalidität, der plötzliche Verlust des Arbeitsplatzes, Gewalt und Misshandlungen. Nach Cullberg (1978) verläuft eine traumatische Krise typischerweise in vier Phasen (ebd., S. 57). 1. Phase: Schockphase Der intensive Schmerz führt dazu, dass Vorgänge in Gang gesetzt werden, deren Ziel es ist, die Unerträglichkeit von sich fernzuhalten. Die momentanen Gefühle werden durch Bewusstseinseinengung und Betäubung verdrängt. Gegen Aussen scheinen die Betroffenen unter Umständen sogar ruhig und gefasst zu sein - innerlich sieht es jedoch chaotisch und desorientiert aus. Zu einem späteren Zeitpunkt zeigen sich dann meist heftige Gefühlsausbrüche, wie Weinkrämpfe und Schreien, verbunden mit körperlichen Zeichen von panischer Angst. In einigen Fällen verharren die Betroffenen auch in einem Zustand der Erstarrung. Die Schockphase dauert wenige Tage bis maximal zwei Wochen (ebd., S ).
18 16 Wenn das Leben aus den Fugen gerät 2. Phase: Reaktionsphase Die Konfrontation mit der schmerzhaften und bedrohlichen Realität wird in dieser Phase unvermeidbar. Trauer, Angst, Wut und Schuldgefühle können nicht mehr vollständig unterdrückt werden. Bestenfalls versuchen Betroffene das Geschehene so schonend wie möglich zu verarbeiten und setzen dabei ihre gewohnten Abwehrmechanismen und Bewältigungsstrategien ein - die eigenen Ressourcen werden mobilisiert und gezielt eingesetzt. Im ungünstigsten Fall reagieren Betroffene über einen längeren Zeitraum mit sozialem Rückzug. Wenn Bewältigungsversuche immer wieder scheitern, entsteht ein Gefühl des Nicht mehr weiter Wissens, wobei Betroffene schildern, diesen Zustand nicht länger ertragen zu können. Als letzter Ausweg können suizidale Handlungen erscheinen - es kommt zu einer Zuspitzung oder Chronifizierung. Ziel ist, dass Betroffene ihre Emotionen und Symptome als adäquaten Ausdruck ihrer Krise verstehen können (ebd., S. 58). 3. Phase: Bearbeitungsphase In dieser Phase wird das Erlebte integriert, indem sich Betroffene allmählich von der Vergangenheit und vom Schmerz lösen, der mit dem Verlust verbunden war. Auch wenn wieder Zukunftspläne geschmiedet werden und neue Interessen auftauchen, ist es durchaus immer noch möglich, rückfällig zu werden und in die vorhergehende Reaktionsphase zu kommen (ebd., S. 58). 4. Phase: Neuorientierung Betroffene können sich in dieser Phase meist wieder auf neue Beziehungen einlassen und das verlorene Selbstwertgefühl wieder herstellen. Bestenfalls wurden neue Lebensbewältigungsstrategien entwickelt und gelernt, diese einzusetzen. Im individuellen Verarbeitungsprozess reagieren Menschen auf sehr unterschiedliche Reaktionsweisen. Die meisten Betroffenen greifen zunächst auf Vertrautes zurück, bevor sie neue Bewältigungsstrategien ausprobieren. Auch wechseln Menschen bei der Krisenbewältigung immer wieder zwischen konstruktiven und tendenziell eher schädigenden Versuchen (ebd., S. 59). Cullberg (1978) beschrieb mit diesen Phasen erstmals, dass Menschen sehr unterschiedliche Reaktionen in Bezug auf ihre Problemlösungsstrategien aufweisen. Die Feststellung, dass Betroffene während der Bewältigung immer zwischen konstruktivem und destruktivem Verhalten wechseln, ist ebenfalls zentral. Letztlich tragen die verschiedenen Faktoren dazu bei, welche Bewältigungsstrategien überwiegen und somit den Verlauf einer Krise beeinflussen und deren Ausgang bestimmen (ebd., S. 59).
19 17 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Das Phasenmodell von Cullberg (1978) lässt sich graphisch wie folgt darstellen und verläuft typischer Weise in vier Phasen; Das akute Stadium umfasst dabei die erste sowie den Beginn der zweiten Phase (vgl. D Amelio, 2010, S. 7): Traumatisches Lebensereignis Schock Reaktion Mobilisierung eigener Ressourcen Bearbeitung Zuspitzung oder Chronifizierung Bewältigung Neuorientierung Abb. 2: Die Phasen der Traumatischen Krise nach Cullberg Beim vorgestellten Phasenkonzept handelt es sich, wie bereits erwähnt, um einen idealtypischen und schematischen Phasenverlauf. Die Art und Weise, wie Menschen letztlich mit Verlusten umgehen, ist individuell und sehr unterschiedlich - sie kann auch im Laufe eines Lebens stark variieren. Zu rigide Konzepte können zudem unter Umständen ungeeignete Erwartungen erwecken und die Betroffenen sowie ihre Angehörige zusätzlich verunsichern (vgl. Stein, 2009, S. 59).
20 18 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Lebensveränderungs- und Entwicklungskrise Im Gegensatz zur Traumatischen Krise handelt es sich bei Lebensveränderungs- und Entwicklungskrisen, um vorhersehbare Situationen und übliche Ereignisse des Lebensverlaufes, die zum Krisenauslöser führen (Pubertät, Berufsfindung, Pensionierung etc.). Die Entfaltung von Lebensveränderungs- und Entwicklungskrisen entstehen oft an den Übergängen von einer in die nächste Lebensphase, wo Entwicklungsaufgaben zu lösen sind und Neuanpassungen notwendig werden. Die verschiedenen zu bewältigenden Entwicklungsaufgaben auf den verschiedenen Lebensstufen können in der Regel ganz ohne therapeutische Hilfe bewältigt werden. In solchen Lebensabschnitten, die mit tiefgreifenden Veränderungen im Selbsterleben verbunden sind, sind Menschen jedoch sehr labil und reagieren daher deutlich empfindlicher auf äussere Belastungen. Deshalb geraten Menschen häufiger als in anderen Lebensphasen in akute psychosoziale Krisen, die eine Unterstützung in Form einer Krisenintervention benötigen. Wenn sich Zielsetzung und motivationale Konflikte widersprechen, kann dies zu einer Überforderung führen, was sich wiederum zu einer Krise entwickeln kann. Lebensveränderungs- und Entwicklungskrisen entwickeln sich langsam und eskalieren typischerweise dann, wenn alle Bewältigungsversuche erfolglos bleiben. Ob also ein übliches Ereignis des Lebensverlaufes zu einer Krise führt, hängt stark von der subjektiven Bedeutung, der Krisenanfälligkeit und der Persönlichkeit eines Menschen ab. Nach Caplan(1964) verläuft die Lebensveränderungs- und Entwicklungskrise in fünf Phasen. Beim folgenden Phasenmodell kann die krisenhafte Entwicklung in jeder dieser Stadien zu Ende gehen, falls die Bewältigungsversuche erfolgreich waren (vgl. Stein, 2009, S ). 1. Phase: Konfrontation Die Konfrontation mit einem kritischen Ereignis kann zunächst unter Umständen gar nicht als übermässig belastend empfunden werden. Erst wenn das übliche Bewältigungsverhalten und die gewohnten Strategien sowie Hilfsmitteln wirkungslos bleiben, beginnt die krisenhafte Entwicklung. Die Betroffenen versuchen ihre Aktivität zu steigern und intensivieren ihre Bewältigungsversuche. Bestenfalls suchen sie Unterstützung bei der Familie und bei Freunden (ebd., S. 61). 2. Phase: Versagen Scheitert der Bewältigungsversuch entsteht zunehmend das Gefühl des Versagens. Angst und Hilflosigkeit nehmen zu, die Spannung steigt und der Selbstwert sinkt. Gewisse Betroffene halten in dieser Phase an destruktiven und nicht erfolgsversprechenden Bewältigungsstrategien fest (ebd., S ).
21 19 Wenn das Leben aus den Fugen gerät 3. Phase: Mobilisierung In dieser Phase führt der innere und äussere Druck zur Mobilisierung aller vorhandenen Bewältigungskapazitäten. Die Situation wird neu überdacht und eingeschätzt, Ungewohntes und Neues wird ausprobiert. Diese neuen Anstrengungen können entweder erfolgreich sein und das kritische Ereignis wird bewältigt, oder es zeigen sich resignative Tendenzen, die zu einer Isolation führen. Manche Betroffene greifen gar zu Suchtmitteln, um das Gefühl der Ohnmacht zu betäuben (ebd., S. 62). 4. Phase: Vollbild der Krise Nach einer längeren Phase seelischer Zermürbung kann bereits eine Kleinigkeit die Situation zum Eskalieren bringen. Es entsteht das Vollbild der Krise mit ihren unerträglichen Spannungen. Von Aussen wirken Betroffene noch geordnet, während innerlich durch Verleugnung der Wirklichkeit sowie Rückzug die Verwirrung und Desorganisation dominieren. Wenn die Belastbarkeit der Umgebung erschöpft ist, kann dies im schlimmsten Fall zusätzliche Konflikte verursachen, die ohne äussere Hilfe nicht zu überbrücken sind (ebd., S. 62). 5. Phase: Bearbeitung und Neuorientierung Nach der Eskalationsphase erfolgt im günstigsten Fall - meist mit Hilfe von Aussen - eine Bearbeitung und Neuanpassung der Situation. War die Hilfe angepasst, kommt es zur Bewältigung und damit zur Beendigung der Krise: War die Hilfe inadäquat, kann es zu Rückzug und Resignation kommen, allenfalls auch zur Chronifizierung (vgl. Fleisch, 2012, S. 6-7).
22 20 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Lebensveränderungs- und Entwicklungskrisen setzen entsprechend den Krisenanlässen nicht schlagartig ein, sondern entwickeln sich innerhalb einiger Tage bis zu sechs Wochen und nehmen dabei nach Caplan (1964) ebenfalls einen typischen Verlauf in fünf Phasen; Das akute Stadium beginnt jedoch erst am Ende der dritten Phase und ist in der vierten voll ausgeprägt (vgl. D Amelio, 2010, S. 6): Konfrontation mit einem Ereignis Versagen von gewohnten Problembewältigungsstrategien Mobilisierung zusätzlicher Ressourcen Selbstheilung ( => Primäre Bewältigung) Psychische Labilisierung (z.b. Zunahme von Unruhe und Ängstlichkeit etc.) Sozialer Rückzug ( => Gefahr der Chronifizierung) Vollbild der Krise (Innere Lähmung, Starten von kopflosen Aktivitäten) Bearbeitung des Krisenanlasses und seiner Konsequenzen Abklingen der Krise ( => Sekundäre Bewältigung) Abb. 3: Die Phasen der Lebensveränderungs- und Entwicklungskrisen nach Caplan Zu beachten gilt, dass zusätzlich zu der primären Labilisierung, das Scheitern der Bewältigungsversuche bei den Betroffenen den Eindruck beziehungsweise die Überzeugung auslösen kann, Versager oder Opfer zu sein. Diese Überzeugung kann mit dem Auftreten von gravierenden Schuld- und/oder Wutgefühlen verbunden sein und damit eine zunehmende sekundäre Labilisierung der Betroffenen mit der Gefahr von Selbst- oder Fremdgefährdung bedingen. Die oben beschriebenen Merkmale und Phasen von Krisen dürfen nicht als Allgemeingültig verstanden werden. Wie eine Krise schlussendlich verläuft und wie sie ausgeht, hängt stark von der betroffenen Person ab; Diese entscheidet letztlich selbst, welcher Weg für sie der richtige und zufriedenstellende ist (ebd., S. 7).
23 21 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Professionelle haben es in der Praxis oft mit komplexen Mischformen von Krisen zu tun, wobei mit zahlreichen Überschneidungen und fliessenden Grenzen gerechnet werden muss. Die Herausforderung liegt darin, herauszufinden, bei welchen Krisen und in welcher Verlaufsphase eine Indikation für eine professionelle Krisenintervention gegeben und bei welchen eine andere Behandlungsform angezeigt ist (vgl. Stein, 2009, S. 48) Gefahren einer Krise Menschen, die sich in einer Krise befinden, sind meist verzweifelt und desorganisiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu inadäquaten, destruktiven und irreversiblen Handlungen kommt, ist sehr hoch. Um das unerträgliche Gefühl in einer Krise zu reduzieren, greifen viele Betroffene zu schädigende Verhaltensweisen, was unter Umständen langwierige Fehlentwicklungen zur Folge haben können (vgl. Stein, 2009, S. 96). Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die möglichen Gefahren einer Krise und die daraus resultierenden Folgen (ebd., S. 98). Akute Gefährdungen mit unmittelbaren Folgen: Selbstgefährdung: Suizidalität, Selbstverletzung, selbst verschuldete Unfälle Fremdgefährdung: Gewaltandrohungen und handlungen Akute Verschlechterung einer bestehenden psychischen Störung Gefährdungen mit längerfristigen Folgen: Pathologische Trauerreaktionen Beginn einer psychischen Erkrankung (z.b. Depression, Angststörung, Posttraumatische Belastungsstörung) Beginn von Medikamenten- oder Alkoholmissbrauch Beginn somatischer oder psychosomatischer Erkrankungen Verschlechterung einer vorbestehenden psychischen oder psychosomatischen Erkrankung Verlust sozialer Sicherheit Verlust von Beziehungen (soziale Isolation) Tabelle 1: Gefährdungen in Krisen nach Stein
24 22 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Um das Gefahrenpotenzial in einer Krise deuten und richtig einschätzen zu können, ist es wichtig, auf die verschiedenen Warnsignale zu achten. Als Hinweis auf eine Gefährdung gilt die Ankündigung von selbst- oder fremdgefährdendem Verhalten. Eine solche Äusserung muss unbedingt ernst genommen werden. Eine Situation kann dann gefährlich werden, je systematischer und realistischer die Androhungen werden und desto weniger Alternativen zur Verfügung stehen. Besonders gefährlich ist der Verlust der Selbstkontrolle dann, wenn er im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit tödlicher Mittel (z.b. Waffen, Medikamente) steht. Wenn die Eigenverantwortlichkeit der Betroffenen eingeschränkt ist, sind Professionelle gefordert, mehr Verantwortung zu übernehmen. Eine solche Verantwortung kann unter bestimmten Umständen auch das Einleiten einer Zwangsmassnahme bedeuten. Auffallende Verhaltensweisen müssen auch immer im Vergleich zum Verhalten vor der Krise betrachtet werden. Das Vermeiden von Kontakten zu anderen Menschen sowie die mangelnde Vertragsbereitschaft stellen ebenfalls ein ernst zu nehmendes Alarmsignal dar. Möglicherweise sind Betroffene nicht mehr in der Lage eigenverantwortlich für sich zu handeln (ebd., S ). In der untenstehenden Tabelle sind verschiedene Warnsignale aufgelistet, die in einer Krisensituation auftreten können (ebd., S. 101): Ankündigung selbst- oder fremdgefährdenden Verhaltens Leichter Zugriff auf tödliche Mittel, insbesondere Schusswaffen Kontrollverlust bzw. deutliche Herabsetzung der Selbstkontrolle Mangelnder oder fehlender Realitätsbezug Fehlen von Distanzierungsmöglichkeiten Starke Schwankungen der Gefühlslage Auffällige Verhaltensweisen Funktionsausfälle Kontaktaufnahme zum Betroffenen schwierig oder unmöglich, Gefühl der Unerreichbarkeit Mangelnde Vertragsbereitschaft und fähigkeit Tabelle 2: Warnsignale nach Stein Solche Warnsignale werden als mögliches Gefahrenpotenzial gedeutet. Im Hinblick auf eine positive Bewältigung ist es wichtig, diese Signale ernst zu nehmen und die vorhandenen Ressourcen zu mobilisieren.
25 23 Wenn das Leben aus den Fugen gerät 1.5. Chancen einer Krise Der Fokus wird folgend auf das Veränderungspotenzial in Krisen und auf die Gewinne, die Betroffenen aus ihren Krisenerfahrungen ziehen können, gerichtet. Wenn von Krisen und ihren negativen Folgen die Rede ist, so stellt sich auch immer die Gegenfrage, inwiefern Krisen auch Chancen bedeuten. Wie schon Goethe formulierte: Wo viel verloren wird, ist manches zu gewinnen oder Schopenhauer Meistens belehrt erst der Verlust uns über den Wert der Dinge, ist das Leiden eine wichtige Voraussetzung für den Gewinn von Einsicht und Wissen (zit. in Filipp & Aymanns, 2010, S. 99). Verluste schliessen somit Gewinn mit ein und eröffnen eine positive Transformation des Selbstwertes und des Lebens. Der Verlauf einer Krise bringt uns gezwungenermassen zu dem Punkt, an dem sich die weitere Entwicklung entweder zum Positiven oder zum Negativen wendet. Der Fokus wird auf die entwicklungstheoretische Perspektive gesetzt, die Krisen als eine Chance für die Veränderungen der Persönlichkeit sehen. Diese Betrachtungsweise impliziert, dass Krisen für die Betroffenen letztlich für ihre Entwicklung förderlich sind. In der Bewältigungsforschung wird davon ausgegangen, dass der Umgang mit Krisen auch mit vielfältigen Bemühungen charakterisiert ist, die den Selbstwert bewahren und verteidigen (Kapitel 3). Diese Sichtweise bestätigt sich auch wiederum, wenn von Resilienz (Kapitel 2) die Rede ist. Krisen können somit die Selbstwirksamkeit stärken und Vertrauen in die eigenen Bewältigungskompetenzen wecken (vgl. Filipp & Aymanns, 2010, S ) Persönlichkeitsentwicklung Die Persönlichkeit gilt als eine stabile Verhaltensdisposition. Verschiedene Studien haben sich mit der Frage befasst, inwiefern Krisen eine Veränderung der Persönlichkeit verursachen. Leider sind die Befunde solcher Studien wenig aussagekräftig, da nur schwache Zusammenhänge zwischen den Persönlichkeitsmerkmalen und den vorangegangenen Krisen bestehen. Zusammengefasst wurde jedoch herausgefunden, dass der alleinige Eintritt einer Krise kein klares Muster von Persönlichkeitsveränderungen erzeugt. Bei normativen Übergängen in eine neue Lebensphase haben sich die Veränderungsprozesse als irreversibel erwiesen. Das heisst, die Persönlichkeitsmerkmale blieben unverändert, auch wenn zum Beispiel eine Beziehung wieder aufgelöst wurde. Hingegen verändern sich Persönlichkeitsmerkmale bei non-normativen Übergängen viel stärker. Dabei handelt es sich um Situationen, in denen Betroffene vor Anforderungen gestellt werden, die diffus sind. Diese Situationen sind durch hohe Handlungsunsicherheit bis hin zu Orientierungsverlust charakterisiert.
26 24 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Je nach eintretendem Lebensereignis verändern sich die Persönlichkeitsmerkmale deshalb mehr oder weniger (vgl. Filipp & Aymanns, 2010, S ) Ziel- und Motivationsentwicklung Krisen können die persönliche Zielerreichung dermassen gefährden, dass Betroffene Veränderungen in ihren individuellen Zielen vornehmen müssen. Persönliche Ziele geben Struktur und Sicherheit, deshalb ist es wichtig zu verstehen, welche Folgen und Auswirkungen Krisen auf die persönlichen und individuellen Zielsetzungen haben können. Die Bewältigungstheorien befassen sich stark mit dieser Frage, denn eine erfolgreiche und positive Bewältigung einer Krise hängt damit zusammen, inwiefern es einer Person gelingt, nicht erreichte Ziele in neue Ziele umzuwandeln, neue Prioritäten zu setzen und alternative Wege zu suchen und gehen. Die verschiedenen Bewältigungsmodelle (Böhnisch 2012, Hurrelmann 2006) verdeutlichen, dass die Schritte im Bewältigungsprozess eng mit der Zielverfolgung, der Zielablösung und der Veränderung von Zielstrukturen zusammenhängen (Kapitel 3). Die Autoren Emmons, Colby und Kaiser (1998, zit. in Filipp & Aymanns, 2010, S. 106) führten eine Studie durch, die sich den Veränderungen in den persönlichen Zielen als Folge der Konfrontation mit Krisen widmete. In mehreren Schritten und Arbeiten konnten letztlich folgende Befunde festgehalten werden: Um eine Krise unbeschadet zu bewältigen, gehe es nicht zwingend darum, die persönlichen Ziele zu verändern oder neu zu formulieren, sondern vielmehr um die Bewahrung bestehender Ziele. Eine starke Bindung an spirituelle und religiöse Ziele spielte ebenfalls eine grosse Rolle, da diese negative Erfahrungen im Leben integrieren und eine Antwort auf Fragen nach dem Sinn liefern. Die Veränderung und Neuordnung von persönlichen Zielen kann als eine Strategie für den Umgang mit Krisen betrachtet werden. Die negativen Folgen von Krisen liegen demnach in einem nachlassenden Bemühen, das eigene Leben durch aktives Tun beeinflussen zu wollen. Krisen untergraben häufig das primäre Kontrollstreben, vor allem dann, wenn es sich um Krisen mit Wiederfahrnis-Charakter oder Schicksalsschläge handelt. Die Folgen von Krisen können sehr nachhaltig sein und ungünstige, negative Entwicklungen begünstigen (ebd., S ).
27 25 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Entwicklung der persönlichen Wert- und Normvorstellungen Krisen transportieren Botschaften, die sich als unverträglich mit den eigenen Überzeugungen erweisen. Im Folgenden geht es um die Frage, was die Konfrontation mit Krisen für die eigenen Wert- und Normvorstellungen bedeuten könnte. Das Konzept von Janoff-Bulmann (1992, zit. in Filipp & Aymanns, 2010, S ) geht davon aus, dass alles Geschehene einen Sinn hat und einem speziellen Zweck dient. Die eigene Persönlichkeit ist durch positive Eigenschaften, vielfältige Fähigkeiten und moralisches Handeln charakterisiert. Solange die geglaubte Welt mit der real gehaltenen Welt als identisch erachtet wird, lassen sich solche Wertvorstellungen als positiv auffassen. Basierend auf dieser Grundannahme wird ein kritisches Lebensereignis erst dann zur Krise, wenn die damit transportierte Botschaft nicht oder nur schwer anzupassen ist, weil sie den eigenen Wertund Normvorstellungen nicht mehr entsprechen. Ob sich die persönlichen Werte und Normen nach Eintritt einer Krise verändern, hängt stark vom Inhalt der jeweiligen Krise ab. Wichtig dabei ist, dass die Betroffenen erkennen, was sie tatsächlich verloren haben und welche Bedrohung besteht. Beispielsweise geht mit dem Tod der letzten noch lebenden Elternperson die Rolle des Kindes definitiv verloren. Dieser Verlust markiert wiederum den Übergang in eine neue Identität und erzeugt Veränderungen im eigenen Werte- und Normsystem. Beim Verlust des Arbeitsplatzes beispielsweise wird angenommen, dass die Selbstwirksamkeit und das Selbstwertgefühl verloren gehen. Es ist anzunehmen, dass durch diese Überprüfung eine Krise erfolgreich bewältigt werden kann. Lebensziele werden hinterfragt, Prioritäten neu geordnet und Ziele neu festgelegt. In einer Krise ist gerade das Bedürfnis nach Sicherung der Identität und der Kontinuität des Selbstwerts besonders hoch. Schliesslich geht es im Leben darum, solche Erfahrungen als Teil des eigenen Lebens zu akzeptieren und ihnen den angemessenen Platz in der eigenen Lebensgeschichte zu gewähren (ebd., S ) Das persönliche Wachstum Die Vorstellung von Krisen wurde oft als ein krankhafter Prozess verstanden. Dass Krisen jedoch auch positive Folgen mit sich bringen und Betroffene durchaus gestärkt aus ihnen hervorgehen und neue Wege in eine positive Richtung eröffnet werden, wurde in dieser Betrachtung nicht berücksichtigt. Mittlerweile ist klar, dass Menschen durchaus fähig sind, inmitten ihrer Krise auch positive Seiten abgewinnen können. Solche Entwicklungen werden in der Fachliteratur zahlreich dokumentiert. Dabei wird vor allem auf einen Zuwachs an persönlicher Stärke und Selbstvertrauen im Umgang mit Anderen sowie einer höheren Bereitschaft zur Selbstöffnung verwiesen.
28 26 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Betroffene erzählen von einer veränderten Sicht auf das Leben. Der Wert der kleinen Dinge im Leben wird erkannt und nichts ist mehr selbstverständlich. Es wird von einer positiven Transformation gesprochen, die dann beobachtet wird, wenn die Krise wie eine Art Weckruf wirkte und Betroffene im wahrsten Sinne des Wortes wachgerüttelt wurden. Die Krise wird als eine Chance und als einen Gewinn angesehen. Obwohl diese positive Neigung weitverbreitet scheint, gibt es trotzdem Menschen, die ihren Glauben verlieren und in eine Verzweiflung verfallen. Es stellt sich deshalb die Frage, ob es sich bei der Rekonstruktion von Gewinnen nicht um eine Selbsttäuschung handelt, um die Realität zu leugnen? Ob das persönliche Wachstum demzufolge eine erfolgreiche Bewältigung einer Krise abbildet, kann deshalb nicht so einfach beantwortet werden (ebd., S ) Resümee Kritische Lebensereignisse bergen einige Gefahren, die bei einer ungenügenden Bewältigung zur Auslösung einer ernsthaften psychosozialen Krise führen können. Die Unterscheidung zwischen einem kritischem Lebensereignis und der eigentlichen Krise ist deshalb zentral. Psychosoziale Krisen zeigen sich in verschiedenen Erscheinungsformen und nehmen unterschiedliche Verläufe an. Damit eine Krise positiv bewältigt werden kann, müssen Betroffene ihre Ressourcen kennen, diese mobilisieren und schliesslich zielgerichtet einsetzen, um neue Bewältigungsstrategien zu eröffnen. Wie beschrieben wurde, sind Krisen durch einen Verlust der Handlungsfähigkeit gekennzeichnet, da sie sich von alltäglichen Bewältigungsherausforderungen unterscheiden. Das Krisenverständnis und der jeweilige Umgang hängt fest damit zusammen, wie Betroffene mit den Anforderungen des Lebens umgehen und wie ihr Sozialisationsprozess gekennzeichnet war. Für die Krisenintervention ist die Kenntnis des Krisenanlasses (Traumatische Krise oder Lebensveränderungs- und Entwicklungskrise) in seiner jeweiligen subjektiven Bedeutung, also in der Berücksichtigung des persönlichen Stellenwerts der Betroffenen, von grosser Bedeutung. Die individuelle Krisenanfälligkeit ist abhängig von dieser inneren Bedeutung des Krisenanlasses und der Fähigkeit, sich damit auseinander zu setzen, sowie von dem Mass der sozialen Integration und früheren Lernerfahrungen. Wer zum Beispiel bereits an einer psychischen Erkrankung leidet oder frühere Krisen noch nicht verarbeitet hat, ist einem höheren Risiko ausgesetzt nochmals in eine Krise zu fallen. Alle Massnahmen, die für das vermindern der Krisenanfälligkeit eingesetzt werden, können sich deshalb gesundheitsfördern auswirken.
29 27 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Die Reaktion der Umwelt ist nicht nur für das Entstehen von Krisen von grosser Bedeutung, sondern auch für den weiteren Verlauf, da Krisen nicht in einem sozialen Vakuum ablaufen. Insbesondere bei Lebensveränderungs- und Entwicklungskrisen beeinflusst die Umwelt den Krisenverlauf wesentlich. So unangenehm Krisen auch sein mögen, aus Sicht der Entwicklungstheorie bedeuten sie auch immer eine Chance für die Veränderung der eigenen Persönlichkeit, wobei es zur Förderung der persönlichen Entwicklung kommen kann. Nachdem in diesem ersten Kapitel psychosoziale Krisen mit ihren negativen sowie positiven Folgen vorgestellt wurden, wird im Weiteren der Fokus auf das Phänomen gesetzt, welches anscheinend Menschen besitzen, die unbeschadet oder sogar gestärkt aus Krisen hervorgehen. Diese Erscheinung, genannt Resilienz, umfasst eine nicht zu unterschätzende Bedeutung in der erfolgreichen Bewältigung einer Krise.
30 28 Wenn das Leben aus den Fugen gerät 2. Resilienz Was uns nicht umbringt, macht uns stärker. (Friedrich Nietzsche) Nach Hurrelmann (2006, S. 7) ist Sozialisation ein Prozess, bei welchem die eigene Persönlichkeit entwickelt wird, indem sich das Individuum wechselseitig mit sich selbst und seiner Umwelt auseinandersetzt. Ist diese Entwicklung mit Risiken konfrontiert, wird eine gelingende Sozialisation gefährdet. Eine belastende Kindheit, welche im schlimmsten Fall von Missbrauch, Vernachlässigung oder Gewalt bestimmt war, führt - wie demzufolge angenommen - zu einem zum Scheitern verurteilten Leben. Oft wird dabei vergessen, dass sogar die schwierigsten Umstände nicht zwingend schlechte Auswirkungen mit sich bringen müssen. Von vielen Menschen, welche unter problembehafteten Bedingungen aufwachsen, bleibt die Entwicklung unbeschädigt. Dieses Phänomen einer angeblichen Invulnerabilität ist bei gewissen Personen, angesichts mit den im Laufe eines Lebens konfrontierten kritischen Lebensereignissen, immer wieder anzutreffen. Diese Personen werden dann als resilient bezeichnet. Im folgenden Abschnitt soll erläutert werden, was sich hinter diesem Adjektiv verbirgt und welchem Konzept es zugrunde liegt. Nach einer Definition von Resilienz und der Beschreibung ihrer Merkmale, werden ausführlich die Risiko- und Schutzfaktoren erklärt. Nach der Vorstellung zentraler Resilienzfaktoren werden anschliessend erste Ansätze für die Soziale Arbeit zur Resilienzförderung abgeleitet Definition Das Adjektiv resilient ist im englischen Sprachgebrauch angesiedelt, wo es sich wiederum vom lateinischen resilire ableitet, was mit zurückspringen oder abprallen übersetzt werden kann. Es meint die Eigenschaft eines Materials, elastisch oder widerstandsfähig zu sein und nach Druckerfahrung seine eigentliche Form wieder zu erlangen. Der Begriff wurde auf den Menschen übertragen, um eine Beobachtung von Personen zu beschreiben, denen Risiken scheinbar nichts anhaben können und die unverwundbar sind (vgl. Wustmann, 2012, S. 18). Auf der Suche nach einem wissenschaftlichen Verständnis von Resilienz ist der Rückgriff auf Fachliteratur unerlässlich, doch auch dort existiert keine allgemeingültige Definition. Die disziplinübergreifende Auseinandersetzung mit dem Konzept und der fehlende Konsens bezüglich Massstab für Kriterien, führen zu einer Vielzahl von Erklärungen.
31 29 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Es können explizit die inneren Befindlichkeiten berücksichtigt werden, oder Resilienz kann als Anpassungsleistung an die soziale Umwelt verstanden werden (Bengel et al. 2009, zit. in Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2001, S. 9). Unter Betrachtung dieser Deutungen wurde für die folgende Auseinandersetzung eine Definition gewählt, welche sowohl externale als auch internale Kriterien mit einbezieht: Wustmann (2012) versteht Resilienz als Fähigkeit des Individuums, erfolgreich mit belastenden Lebensumständen und negativen Stressfolgen umgehen zu können und fasst sie als psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken zusammen (vgl. S. 18). Auf den internationalen Kongress Resilienz - gedeihen trotz widriger Umstände in Zürich im Februar 2005 wurde folgende Definition von Resilienz festgelegt: Unter Resilienz wird die Fähigkeit von Menschen verstanden, Krisen im Lebenszyklus unter Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklung zu nutzen (zit. in Welter-Enderlin & Hildenbrand, 2012, S. 13). In der Resilienzforschung wird davon ausgegangen, dass sich resilientes Verhalten nur dann zeigt, wenn eine als risikoerhöhende Gefährdung für die Entwicklung eingestufte Situation erfolgreich bewältigt werden kann. Personen, für die niemals eine Belastung bestand, welche entwicklungsbedrohendes Potenzial aufweist, können daher nicht als resilient bezeichnet werden (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2011, S. 10) Merkmale Resilienz als Gegenstand der Forschung Die Resilienzforschung ist ressourcenorientiert ausgerichtet und geht davon aus, dass Menschen durch soziale Unterstützung die Chance haben, erfolgreich mit gegebenen Situationen umzugehen und somit ihr Leben aktiv mitgestalten und bewältigen. Es geht darum, die Kompetenzen und Ressourcen einer Person zu nutzen, damit sie lernt, besser mit Risikosituationen umzugehen. Bei Resilienz geht es in erster Linie also nicht um das Herausfiltern von möglichen Risiken, sondern vielmehr um den Erwerb bzw. Erhalt altersangemessener Fähigkeiten und Kompetenzen sowie die erfolgreiche Bewältigung von altersspezifischen Entwicklungsaufgaben (Wustmann, 2012, S. 20). Nach Havighurst (1948) stellen Entwicklungsaufgaben Anforderungen an das Individuum dar, welche in jeder Altersstufe bestehen. Werden diese erfolgreich bewältigt, entwickeln sich Fähigkeiten und Kompetenzen, welche dazu verhelfen, Veränderungen und Belastungen nicht als bedrohlich, sondern als bewältigungsbare Herausforderungen zu betrachten (zit. in Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2011, S. 12).
32 30 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Im Mittelpunkt der Resilienzforschung stehen: Die positive Entwicklung trotz andauerndem, hohem Risikostatus. Die beständige Kompetenz unter akuten Stressbedingungen. Die Erholung von traumatischen Ereignissen (vgl. Wustmann 2012, S. 19) Der bildliche Gebrauch des Wortes resilient lässt vermuten, dass es sich bei diesem Phänomen um eine menschliche Eigenschaft handeln könnte (z.b. ein Fels in der Brandung sein ). Zu Beginn der Resilienzforschung wurde der Begriff auch tatsächlich als solche angesehen. Dies liess darauf schliessen, dass ein Individuum Resilienz in den Genen hat (oder eben nicht). Nach Wustmann (2012) ist heute erwiesen, dass mit Resilienz kein Persönlichkeitsmerkmal bezeichnet wird. Vielmehr handelt es sich um eine Kapazität, welche im Verlauf der Entwicklung, im Kontext der Personen-Umwelt-Interaktion, erworben wird. In dieser Auseinandersetzung nimmt Resilienz die Rolle eines dynamischen Anpassungs- und Entwicklungsprozesses ein (vgl. S. 28). Resilienz muss also aktiv erworben werden, indem Individuen mit der Bewältigung von kritischen Lebensereignissen konfrontiert werden und Handlungs- und Orientierungsmuster für die Krisenbewältigung herausbilden. Dabei ist dieser Aneignungsvorgang - die Entwicklung dieser Muster - ein lebenslanger Prozess, welcher sich nicht auf eine spezifische Lebensphase beschränkt und deshalb immer multidimensional betrachtet werden muss (vgl. Welter-Enderlin, 2012, S. 205). Daraus kann abgeleitet werden, dass sich Resilienz im Laufe des Lebens verändert und somit keine stabile Einheit von immerwährender Invulnerabilität gegenüber kritischer Lebensereignissen, sondern eine variable Grösse darstellt. Resilienz kann auch nicht auf alle Lebensbereiche einer Person übertragen werden, sondern es wird von situationsspezifischen Ausformungen, teilweise sogar von bereichsspezifischer Resilienz, (z.b. emotionale oder soziale Resilienz) gesprochen. Dadurch wird verdeutlicht, dass resiliente Personen die Fähigkeit besitzen, positiv zu bewältigen, indem sie Ressourcen und Handlungsweisen nutzen und miteinander kombinieren (Wustmann, 2012, S. 30). Hier kann wieder an Hurrelmann angeknüpft werden, welcher Sozialisation als eine wechselseitige Auseinandersetzung des Individuums mit seinen Anlagen und seinem Umfeld sieht. So wird ersichtlich, dass es sich bei Resilienz nicht um eine konstante Eigenschaft handeln kann, denn der Mensch verändert sich während seines gesamten Lebens und auch sein Umfeld unterliegt ebenso ständiger Veränderung (vgl. Hurrelmann, 2006, S. 7). Eine erfolgreich bewältigte Krise bedeutet demzufolge nicht, dass im späteren Leben wieder die Fähigkeit dazu besteht, was die Bedeutung von resilient als unverwundbar revidiert.
33 31 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Welche Bedingungen jedoch gegeben sein müssen, damit Resilienz entwickelt werden kann, wurde bisher nur angerissen. Ob ein Mensch schwierige Lebensumstände positiv bewältigt, also resilient werden kann, hängt vom Zeitpunkt im Lebensverlauf, den individuellen Anlagen, seiner Umgebung und den sogenannten Risiko- und Schutzfaktoren ab Risiko- und Schutzfaktoren Ein Wechselwirkungsprozess Zur Entstehung von Krisen tragen eine Vielzahl von risikofördernden Faktoren bei. Der wesentliche Fokus im Resilienzkonzept liegt auf der Bewältigung dieser Risiken. Demgegenüber stehen jedoch risikomildernde Ressourcen, welche diese Risiken dämpfen und Resilienz fördern. Der Begriff der Ressourcen wurde am internationalen Kongress Resilienz gedeihen trotz widriger Umstände 2005 verwendet, um Resilienz zu definieren. Resilienz liegt demzufolge dann vor, wenn Krisen mit Hilfe von Ressourcen erfolgreich bewältigt werden (vgl. Welter-Enderlin & Hildenbrand, 2012, S. 13). Petermann und Schmidt (2006, zit. in Loth, 2008, S. 14) bezeichnen Ressourcen als aktuell verfügbare Potentiale ( ), die die Entwicklung unterstützen. Resilienz beschreiben sie in Anlehnung an Bender und Lösel (1998) als bereichsspezifische Ressourcen, die durch die Interaktion mit der Umwelt erworben sind (ebd., S. 14). Dabei differenzieren sie die Ressourcen nach ihrer Herkunft, ob sie aus der Person selbst oder aus ihrer Umwelt stammen. Die Risiko- und Schutzfaktoren beeinflussen die Entwicklung und darüber hinaus auch sich gegenseitig in einer Wechselwirkung. Das Ergebnis aus diesem Zusammenwirken sind Vulnerabilität und Resilienz (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2011, S ). Im Folgenden wird dieser Interaktionsprozess beschrieben Risikofaktoren Unter Risikofaktoren werden die Einflüsse, Faktoren und Lebensbedingungen verstanden, welche eine Bedrohung für die individuelle gesunde (Weiter-) Entwicklung darstellen, indem sie krankheitsbegünstigende, risikoerhöhende und entwicklungshemmende Merkmale aufweisen. Aufgrund der belastenden Situation für die Betroffenen bedürfen sie einer Bewältigung (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2011, S ). Meist werden solche Umstände als risikobehaftet umschrieben, welche Krisen darstellen und / oder die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von psychischen Störungen erhöhen (Bender & Lösel, 1999, zit. in Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2011, S. 24).
34 32 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Bei den Risikofaktoren wird unter zwei Merkmalsgruppen unterschieden: Die Vulnerabilitätsfaktoren, welche die biologischen und psychologischen Merkmale umfassen und nochmals in primäre (Anlage) und sekundäre (durch Interaktion mit der Umwelt erworben) Faktoren unterteilt werden, sowie die Stressoren (z.b. Familiäre Disharmonie, niedriger sozioökonomischer Status), welche in der psychosozialen Umwelt entstehen. Risikofaktoren können in diesem Zusammenhang auch bezüglich ihrer Veränderbarkeit unterteilt werden. So gibt es strukturelle Faktoren, welche unveränderbar sind (z.b. genetische Faktoren) sowie variable Faktoren, die sich durch Interventionen verändern lassen. Die variablen Faktoren werden darüber hinaus in diskrete Faktoren (führen zu einer unmittelbaren Veränderung, z.b. Verlust des Partners) und kontinuierliche Faktoren (können über die Zeit in Ausmass und der Auswirkung variieren, z.b. Qualität der Beziehung zum Partner) unterschieden. Im Vergleich zu psychosozialen Risikofaktoren (Stressoren), welche häufiger zu Beeinträchtigungen von Entwicklungsverläufen oder Folgewirkungen führen, wirken sich Vulnerabilitätsfaktoren wenig gravierend auf die Entwicklung aus (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2011, S ). Aufgrund der Veränderbarkeit sind für Interventionen und Präventionsmassnahmen hauptsächlich variable Faktoren von Bedeutung. Eine Übersicht der unterschiedlichen Merkmale bietet die folgende Grafik. Wustmann (2012) bezeichnet traumatische Erlebnisse wie z.b. Gewalttaten, Naturkatastrophen oder Kriegs- und Terrorerlebnisse als besonders schwerwiegende Risikofaktoren, welche darum einzeln aufgeführt werden (vgl. S. 44). Vulnerabilitätsfaktoren Risikofaktoren / Stressoren Traumatische Erlebnisse Strukturelle Faktoren Variable Faktoren Primär Sekundär Diskrete Faktoren Kontinuierliche Faktoren Abb. 4: Risikoerhöhende Merkmale nach Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse
35 33 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Jedoch stellt nicht jeder Risikofaktor per se eine Entwicklungsgefährdung dar. Eine bedeutsame Eigenschaft von Risikofaktoren besteht im Aufweisen einer grossen Heterogenität bezüglich ihrer Risikoeffekte. Derselbe Faktor kann bei einer Person ein Risiko darstellen, bei einer anderen Person jedoch keine Wirkung zeigen. Somit sind Risikofaktoren multifinal (ebd., S. 44). Ob die Auswirkung von Risikofaktoren entwicklungsgefährdend ist, hängt auch mit der entsprechenden Entwicklungsphase zusammen, in welcher sich eine Person befindet. Solche Phasen, in welchen Personen anfälliger für risikoerhöhende Faktoren sind, werden Phasen erhöhter Vulnerabilität genannt und treten vermehrt bei Übergängen / Transitionen, wie z.b. Berufseinsteig oder Pensionierung, (im Sinne von Entwicklungsaufgaben nach Havighurst 1981, zit. in Hurrelmann, 2006, S. 270) im Laufe der Entwicklung auf. Auch Zeiten, in welchen viele Herausforderungen bewältigt werden müssen, wie etwa die Pubertät, gelten als hoch vulnerable Phasen. Die Wahrscheinlichkeit für unangepasste Entwicklungen steigt durch das Auftreten belastender Situationen in solchen Phasen, entscheidend sind jedoch noch viele weitere Aspekte wie (vgl. Scheithauer & Petermann, 1999, zit. in Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2011, S. 24): Anhäufung der Belastungen Dauer / Kontinuität von Belastungen (Chronifizierung) Abfolge der Ereignisse Alter und Entwicklungsstand Geschlechtsspezifische Aspekte Subjektive Bewertung der Risikobelastung In der Auseinandersetzung mit Risikofaktoren hat sich gezeigt, dass meist mehrere Risikofaktoren zusammenspielen und sie selten isoliert auftreten. Dies wird als Risikokumulation bezeichnet, was als Indikatoren für Konstellationen von Risiken zu begreifen (Laucht, Schmidt et al., 2000, zit. in Loth, S. 17) ist. Der Entwicklungsverlauf sollte sich jedoch nicht nur auf die Beurteilung von Risikofaktoren beschränken, sondern auch die schützenden oder protektiven Faktoren berücksichtigen.
36 34 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Schutzfaktoren Wustmann (2012) beschreibt Schutzfaktoren als ( ) Schlüsselfunktionen im Prozess der Bewältigung von Stress- und Risikofaktoren (..). Sie fördern die Anpassung eines Individuums an seine Umwelt bzw. erschweren die Manifestation einer Störung (S. 46). Schützende Bedingungen erhöhen also die Wahrscheinlichkeit gegenüber potenziell schädlichen Auswirkungen besser ausgerüstet zu sein und erfolgreicher mit Belastungen umgehen zu können. Sie scheinen die negativen Effekte der Risikobelastung abzuschwächen, zu kompensieren bzw. aufheben zu können. Ohne diese Schutzfaktoren würde es dementsprechend, durch individuelle Reaktionen, zu einer kontraproduktiven Anpassung der Umstände kommen. Die Schutzfaktoren wirken als eine Art Puffer, indem durch Modifizierung Reaktionen verbessert werden können. Generell werden unter schützenden Faktoren Fähigkeiten oder Umstände verstanden, welche eine resiliente Entwicklung unterstützen. Dabei wird unterschieden zwischen den eigentlichen Schutzfaktoren und förderlichen Bedingungen. Scheithauer et al (2000, zit. in Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2011, S. 27) verstehen unter förderlichen Bedingungen die Entfaltung von protektiven Wirkungen, selbst beim Fehlen eines erhöhten Risikos. Nach Petermann und Schmidt (2006, zit. in ebd., S. 27) gelten daher nur diese Ressourcen als Schutzfaktoren, welche trotz vorhandener Gefahr, die Entstehung einer psychischen Störung verhindern und bereits vor den Risikofaktoren existierten. Dies weist darauf hin, dass nur in Anwesenheit eines Risikos von einem protektiven Effekt gesprochen und somit eine Risikosituation beseitigt werden kann (Puffereffekt). Das Vorhandensein von Schutzfaktoren allein, verspricht jedoch keine Garantie für die Entwicklung von Resilienz. Bis zu einem gewissen Punkt sind sie zwar hilfreich, wenn jedoch zu viele Risikofaktoren zusammenkommen, kann auch eine bisher als widerstandsfähige zu bezeichnende Person zu Schaden kommen. Resilient sind Individuen nur solange, wie Risiko- und Schutzfaktoren in einem ausgewogenen Verhältnis vorhanden sind. Schutzfaktoren können also im Sinne von risikomildernden Faktoren ein Gleichgewicht herstellen und neue Möglichkeiten eröffnen, indem sie die negativen Auswirkungen von Risikofaktoren reduzieren. Demzufolge eliminieren sie ein Risiko nicht, sondern können einfach die Art des Umgangs damit verbessern (ebd., S. 28). Die einzelnen Schutzfaktoren können, genau wie die Risikofaktoren, nicht isoliert voneinander betrachtet werden. Hier gilt ebenso die kumulative Wirkweise: Je mehr Schutzfaktoren vorhanden sind, desto grösser ist die protektive Wirkung. Einige Faktoren haben mehr Einfluss auf die Entwicklung als andere. Die Betrachtung der konkreten Lebenssituation muss für die Qualitätsbeurteilung eines Faktors daher immer mit einbezogen werden.
37 BEWÄLTIGUNG 35 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Sowie spezifische Risikofaktoren abgeleitet wurden, können auch Schutzfaktoren genauer unterteilt werden: Die Schutzfaktoren werden in personale und soziale Ressourcen unterschieden. Zu den personalen Ressourcen gehören neben den personalen Faktoren (positive Temperamenteigenschaften, intellektuelle Fähigkeiten, Erstgeborenes und weiblich) auch die Resilienzfaktoren. Resilienzfaktoren sind Eigenschaften, welche von einer Person in der Interaktion mit ihrer Umwelt sowie durch die erfolgreiche Bewältigung von altersspezifischen Entwicklungsaufgaben erworben werden. Diese Faktoren haben bei der Bewältigung von Krisen eine besondere Rolle (vgl. Wustmann, 2012, S ). Eine Vielzahl protektiver Faktoren aus verschiedensten empirischen Studien sowie den von der WHO als Lebenskompetenzen definierten life skills (vgl. WHO, 1994, zit. in Fröhlich- Gildhoff & Rönnau-Böse, 2011, S. 41) konnten sich in sechs übergeordnete Faktoren zusammenfassen lassen, welche als Grundlage wirksam zur Entwicklung von Resilienz gelten und die Bewältigungsfähigkeit von Krisensituationen verbessern (ebd., S ): Angemessene Selbsteinschätzung und Informationsverarbeitung Regulation von Gefühlen und Erregung: Aktivierung oder Beruhigung Kritische Lebensereignisse / Krisen Überzeugung, Anforderung bewältigen zu können Unterstützung holen, Selbstbehauptung, Konfliktlösung Fähigkeit zur Realisierung vorhandener Kompetenzen in der Situation Allg. Strategien zur Analyse und zum Bearbeiten von Problemen Abb. 5: Resilienzfaktoren nach Fröhlich-Gildhoff et al.
38 Transaktionaler Prozess zwischen Person und Umwelt Resilienzprozess und Anpassungsmechanismen 36 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Selbst- und Fremdwahrnehmung, Selbststeuerung, Selbstwirksamkeit, Soziale Kompetenz, Umgang mit Stress und Problemlösung gelten in der Konfrontation mit einem kritischen Lebensereignis als besonders wirksam für die Herausbildung von Resilienz. Die aus den sechs Resilienzfaktoren abgeleiteten Kompetenzen bilden somit die Voraussetzung für eine gelingende Bewältigung (ebd., S ) Wechselwirkung Ob eine Begebenheit ein Risiko- oder Schutzfaktor ist, kann nicht pauschal bestimmt werden, denn welche Umstände welche Wirkung auslösen, wird vom individuellen Kontext bestimmt. Daher ist es nicht möglich von Gegensätzen zu sprechen, denn eine Variable kann in verschiedenen Kontexten sowohl eine negative als auch eine positive Ausprägung haben, sprich protektiv oder auch risikobehaftet wirken. Es muss zudem berücksichtigt werden, dass ein fehlender Schutzfaktor als Risikofaktor gesehen werden kann, aber nicht umgekehrt, da das alleinige Fehlen von Risikofaktoren an sich keinen Schutz darstellt (Ball & Peters, 2007, zit. in Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2011, S. 37). Vielmehr beeinflussen sich Risiko- und Schutzfaktoren gegenseitig. Kumpfer (1999, zit. in Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2011, S. 37) unterscheidet in einem Rahmenmodell der Resilienz unter vier Einflussbereichen: Positives Entwicklungsergebnis Risikofaktoren Stressor Personale Ressourcen / Resilienzfaktoren Umweltbedingungen Anpassung / Fehlanpassung Schutzfaktoren Negatives Entwicklungsergebnis Abb. 6: Rahmenmodell der Resilienz nach Kumpfer Stressoren treffen auf Umweltbedingungen mit spezifischen Risiko- und Schutzfaktoren. Im Zusammenhang zwischen Person und Umwelt kommen die personalen Ressourcen beziehungsweise Resilienzfaktoren zum Tragen. Aus diesem Zusammenspiel ergibt sich eine Anpassung, also eine Bewältigung der stressauslösenden Situation oder es kommt zur Fehlanpassung, also zur Nichtbewältigung und somit zu einem negativen Entwicklungsereignis.
39 37 Wenn das Leben aus den Fugen gerät 2.4. Resümee Resilienz beschreibt im Wesentlichen die Fähigkeit, sich zwar von kritischen Lebensereignissen und Krisen beeinträchtigen, jedoch nicht zerstören zu lassen; zu biegen ohne zu brechen. Nach Boss (2006) sind diejenigen, welche Resilienz besitzen nach Krisen in der Lage zu einer Funktionsweise zurückzukehren, die dem Niveau vor der Krise entspricht oder in ihrer Qualität noch besser ist (zit. in Loth, S. 7). Resiliente Personen zeichnen sich also vor allem durch ihre Bewältigungskompetenzen aus, welches es ihnen ermöglichen, positiv mit kritischen Lebensereignissen umzugehen. Es gibt angeborene förderliche Ressourcen im Individuum selbst, welche jedoch nicht per se resilient machen. Resilienz ist nicht eine Eigenschaft, sondern ein kontextabhängiger, dynamischer Wechselwirkungsprozess von positiver Anpassung bei der Konfrontation mit kritischen Lebensereignissen. Diese Fähigkeit kann in der Interaktion von Anlage und Umfeld entwickelt werden. Charakteristisch sind die variable Grösse, das situationsspezifische Auftreten sowie die damit verbundene Multidimensionalität. Wer an Schwierigkeiten gedeiht und welche Kräfte dazu benötigt werden, ist jedoch nicht vorhersehbar und muss in jeder Lebenslage und -situation, in Form eines Entwicklungsprozesses, aufs Neue erkannt werden. Dabei gibt es Faktoren, welche einen positiven Verlauf begünstigen resp. hemmen - die Risiko- und Schutzfaktoren. Ein Faktor gilt dann als protektiv wirksam, wenn drei verschiedenen Bedingungen gegeben sind: Eine risikoerhöhende Gefährdung liegt vor. Risikoeffekte werden abgepuffert und dadurch das Risiko für eine ungünstige Entwicklung verringert. Der Schutzfaktor hat zeitlich bereits vor dem risikoerhöhenden Ereignis bestanden und beeinflusst jetzt dessen Auswirkung. Risiko- und Schutzfaktoren beeinflussen die Entwicklung in einem wechselseitigen Prozess. Das Ergebnis ihres Zusammenwirkens sind Vulnerabilität und Resilienz. Um die Schutzfaktoren, personale und soziale Ressourcen, herauszufiltern und gezielt für die Bewältigung zu nutzen, bedarf es möglicherweise einer Unterstützung. Denn an widrigen Umständen gedeihen zu können, bedeutet auch, die eigenen Grenzen und die unserer Lebenswelt zu erkennen. Hier könnte die professionelle Soziale Arbeit Abhilfe schaffen, indem sie Resilienzfaktoren (z.b. die Stabilisierung des Selbstwertes, siehe Kapitel 3) gezielt fördert.
40 38 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Risikoerhöhende Bedingungen Risikomildernde Bedingungen Personenbezogen (primäre Vulnerabilität) Umgebungsbezogen (Risikofaktoren) Personenbezogen Umgebungsbezogen (Schutzfaktoren) Entwicklungsförderliche Bedingungen Phasen erhöhter Vulnerabilität Sekundäre Vulnerabilität Resilienz Kompetenzen Belastungen Ressourcen Bilanz: Belastungen vs. Ressourcen Gesamtbelastbarkeit einer Person Anstrengungen zur Belastungsbewältigung Entwicklungsprognose: Anpassung vs. Fehlanpassung Abb. 7: Zusammenspiel von Risiko- und Schutzfaktoren nach Petermann et al. Wer letztlich an Schwierigkeiten gedeiht und wer nicht beziehungsweise, welche Kräfte es im Leben braucht damit Gedeihen überhaupt möglich wird, kann nicht im Voraus gesagt werden. Sicher ist nur, dass diese Fähigkeit ein Geheimnis ist, und dass nicht damit gerechnet werden kann, dass jeder Mensch sie hat (vgl. Welter-Enderlin, 2010, S.13-22). Manchmal bewirkt erst das Negative, dass der Mensch erkennen kann, welche Stärken in ihm verborgen liegen. Welche Mechanismen und Verhaltensweisen dazu verhelfen alltägliche Lebensanforderungen sowie kritische Lebensereignisse und Krisen zu bewältigen, davon soll im folgenden Kapitel die Rede sein.
41 39 Wenn das Leben aus den Fugen gerät 3. Bewältigung Es kommt nicht darauf an, wie die Dinge sind, sondern wie du damit umgehst. (Kurt Tepperwein) Kritische Lebensereignisse und Krisen stellen das Leben auf den Kopf. Im Kapitel 1 wurde bereits ausführlich dargestellt, worin das Kritische in solchen Ereignisse liegt und warum das Leben angesichts solcher Ereignisse zu einer enormen Belastung werden kann. In der bisherigen Auseinandersetzung war jedoch kaum vom Umgang einzelner Menschen mit ihrer individuellen Krise die Rede. Folglich sollen Krisen als Ausgangspunkt, für die Frage nach dem weiteren Entwicklungsverlauf genommen werden, der einen positiven Krisen-Ausgang begünstigen oder die Betroffenen sogar stärken kann. Der Schlüssel dazu heisst Bewältigung. In diesem Kapitel werden, nach einer einführenden Definition, das Bewältigungsverhalten in Bezug auf Bewältigungsmechanismen erläutert. Darüber hinaus wird ein Bezugsrahmen entwickelt, in welchem das Zusammenwirken von sozialstrukturellen und psychosozialen Einflussfaktoren thematisiert und strukturiert werden kann. Anschliessend wird der Bewältigungsprozess mit Hilfe des Belastungs-Bewältigungsmodells nach Hurrelmann (2006), welches auf Grundkonzepten der Sozialisationstheorie beruht sowie dem Bewältigungsmodell nach Böhnisch (2012) ausgeführt. Daraus werden dann, als mögliche Ansätze für Interventionen seitens der Sozialen Arbeit, das Konzept Selbstwert nach Potreck-Rose und Jacob (2010) sowie das Lebenslagenkonzept nach Meier Kressig und Husi (2013) abgeleitet. Anhand dieser Modelle lässt sich die Komplexität abstrakter darstellen und erklären Definition Der Begriff Bewältigung lässt sich auf das lateinische valere zurückführen, wobei der Wortstamm val so viel bedeutet wie stark sein. Davon abgeleitet meint das Althochdeutsche waltan so viel wie Gewalt oder walten. Die Bedeutung des Wortes kann also so rekonstruiert werden, dass jemand sich einer Sache gewaltig zeigt, damit fertig wird. (vgl. Filipp & Aymanns, 2010, S ). Als Bewältigung werden Bemühungen kognitiver und handlungsorientierter Art bezeichnet, welche in der Auseinandersetzung zwischen Bedürfnissen und Realitätsanforderungen, durch zielgerichtetes Handeln (Einsatz von Abwehr und Bewältigungsmechanismen) unternommen werden, um ein Geschehen zu verarbeiten, auszugleichen oder zu meistern.
42 40 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Das Ergebnis ist dabei vorerst immer offen. Dabei stützt sich die Bewältigung auf wesentliche innerpsychische (personale) und soziale Ressourcen (vgl. Heim, 1993, zit. in Stein, 2009, S. 31). Bewältigung in Bezug auf eine Krise meint dementsprechend, dass einer betroffenen Person die Reorganisation des Passungsgefüges zwischen Person und Umwelt in Folge eines kritischen Lebensereignisses gelingt. Der Erfolg im Umgang mit einem kritischen Lebensereignis gründet dabei auf die Fähigkeit, das Kritische in der Problemsituation zu erkennen, sie zu strukturieren und die zur Verfügung stehenden Ressourcen (Schutzfaktoren) zu aktivieren. So kann die Phase der Orientierungsunsicherheit und der Verlust der Handlungsfähigkeit - und somit die Krise selbst - konstruktiv überwunden werden (vgl. Filipp & Aymanns, 2010, S ). Die Umwelt muss entweder durch aktives Einwirken den Handlungsoptionen angenähert werden, oder die krisenbetroffenen Peron muss sich durch ein Umdenken ihres Handelns der veränderten Umwelt anpassen (Versuch die gestörte Transaktion zu verändern). Das Bewältigungsgeschehen kann jedoch auch aus der Perspektive einer Regulation von Ist-Soll-Diskrepanz betrachtet werden, um eine wechselseitige Angleichung zwischen dem was ist dem was sein soll herzustellen (Versuch die Emotionen zu regulieren). Bestenfalls betont diese emotionszentrierte Bewältigungsform den guten Aspekt eines kritischen Lebensereignisses, indem die Situation neu bewertet wird und positive Vergleiche mit anderen Situationen gezogen werden. Es kann zu einer Umdeutung des Geschehens kommen, indem nicht mehr das warum? sondern das wozu? fokussiert wird. Dies kann zu einer Erweiterung des Handlungsspielraumes sowie dem Gewinn neuer Einsichten führen, was gegebenenfalls persönliches Wachstum und Kompetenzsteigerung mit sich bringt (ebd., S ) Bewältigungsverhalten Menschen werden konstant mit Problemen der Lebensherausforderungen konfrontiert, die es zu lösen gibt, um eine gesunde Balance aufrechtzuerhalten. Empfindet man eine Unausgewogenheit zwischen der Schwere des eigenen Problems und dem zur Verfügung stehenden Bestand an Bewältigungsmechanismen, kann dies zu einer Krise führen. Unter Bewältigungsmechanismen werden mehr oder weniger bewusst eingesetzte Denk-, Empfindungs- und Verhaltensstrategien verstanden (vgl. Stein, 2009, S. 31). Angelehnt an Lazarus, welcher Informationssuche, direktes Handeln, Unterlassen von Handlungen sowie intrapsychisches Bewältigen als Bewältigungsstrategien klassifizierte, können acht Faktoren von Typischen Bewältigungsverhalten unterschieden werden:
43 41 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Konfrontative Bewältigung, Distanzierung, Selbstkontrolle, Suche nach soziale Unterstützung, akzeptieren der Verantwortlichkeit, Flucht/Vermeidung, planvolles Problemlösen und positive Umdeutung. Die Vielfältigkeit der Ressourcen und Reaktionen im Umgang mit einem kritischen Lebensereignis bieten so Schutz vor emotionalen Belastungen (vgl. Kunz et al., 2009, S. 188). Jeder Mensch verfügt über eine bestimmte Anzahl von Strategien, die er je nach Krisensituation auswählt, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Die Bewältigungsversuche werden auf dieses Ziel ausgerichtet und auf ihren Erfolg hin erprobt. Je nach Krise kann deshalb auch Rückzug, Abwehr oder Verleugnung sinnvoll sein (vgl. Stein, 2009, S. 32). Wie krisenauslösende Ereignisse von jedem Einzelnen wahrgenommen werden, hängt von seinen Erfahrungen in der Vergangenheit, den Erwartungen an die Gegenwart und an die Zukunft ab (vgl. Caplan, 1964, zit. in Aguilera, 2000, S. 61). Für die Erklärung des Krisenerlebens ist die Bedeutung von Ressourcen zur Krisenbewältigung, zentral (Kapitel 2). Wie eine Krise emotional erlebt wird, hängt von der kognitiven Bewertung der Situationsanforderung sowie den vorhandenen Ressourcen, in diesem Zusammenhang auch Schutzfaktoren genannt, ab. Aguilera (2000) beschreibt, dass der sich in einem Ungleichgewicht befindende Mensch das Bedürfnis hat, sein Gleichgewicht wiederherzustellen. Über den Grad des psychischen Gleichgewichts entscheiden drei Ausgleichsfaktoren. Die Stärken oder Schwächen dieser Faktoren wirken sich unmittelbar darauf aus, ob es zu einer Krise kommt oder nicht. Die Ausgleichsfaktoren umfassen die realistische Wahrnehmung eines Ereignisses, den adäquaten situativen Rückhalt und die adäquaten Bewältigungsmechanismen. Sind diese Faktoren stark genug, kommt es zur Bewältigung und zur Wiedergewinnung des Gleichgewichts. Wenn die Faktoren jedoch fehlen, bleibt das Ungleichgewicht beständig und es entwickelt sich eine Krise. In einer ersten Bewertung wird das Ereignis in seiner Bedeutung für die bestehende oder zu erwartende Krise kognitiv eingeschätzt. Die sekundäre Bewertung bezieht sich auf die vorhandenen Ressourcen und damit auf individuelle Bewältigungsmöglichkeiten, welche für die Auseinandersetzung, im Hinblick auf die emotionale Stabilisierung, zur Verfügung stehen. Es handelt sich dabei um einen Prozess, in dem ein Problem beurteilt, Ziele gesetzt und bei Bedarf Massnahmen ausgewählt werden. Erst bei einer bedrohlichen Einschätzung kommt es dann zu Bewältigungsanstrengungen (vgl. Kunz, Scheuermann & Schürmann, 2009, S. 187). Wie bereits im Kapitel zwei erläutert wurde, können die Schutzfaktoren in personale und soziale Ressourcen unterschieden werden (vgl. Wustmann, 2012, S. 44).
44 42 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Obwohl sich diese bei jeder Person in sehr unterschiedlicher Form zeigen können, konnten von Filipp und Aymanns (2010) einige personale Ressourcen definiert werden, welche aufgrund ihrer weit verbreiteten protektiven Wirkungsweise einen positiven Bewältigungsverlauf begünstigen. Dazu gehören neben der bereits ausführlich beschriebenen Resilienz unter anderem Religiosität und Spiritualität, Optimismus und Hoffnung, Humor, positive Affektivität, Körperliche Gesundheit / Fitness sowie Selbstwertgefühl und Selbstwirksamkeit (vgl. S ). In der Regel sind Menschen auch in ein soziales Netz eingebunden. Die Suche nach Anschluss im Umgang mit kritischen Lebensereignissen ist eine oft zu beobachtende Reaktion, weshalb die Mobilisierung von sozialer Unterstützung eine weitere wirkungsvolle Variante von Bewältigungsverhalten darstellt. Unter dem Aspekt, dass Bewältigung also nicht nur ein personales und mentales sondern auch sozial-interaktives Geschehen kennzeichnet, hilft es einigen Betroffenen auch, wenn sie sich für andere nützlich machen und coping by helping betreiben (ebd., S. 20) Der Sozialisations- und Lebensbewältigungsprozess Böhnisch, Lenz und Schröer (2009) verstehen unter Sozialisation einen offenen Prozess der Lebensbewältigung zur Erlangung und Verstetigung der biografischen Handlungsfähigkeit. In diesem sehen sie das Subjekt in einer institutionell und lebensweltlich vermittelten Spannung zwischen der Behauptung des Selbst und den gesellschaftlichen Erwartungen an einen flexiblen und darin passfähigen Lebenslauf, indem es sich Bewältigungsherausforderungen in der gesellschaftlichen Entgrenzung stellen muss. Damit weist Sozialisation sowohl eine makrosoziale als auch mikrosoziale Dimension auf (S. 31, 63). Entgrenzung, verstanden als globaler Veränderungs- und Umbruchsprozess, insbesondere im Kontext der Globalisierung, in welchem sich etablierte Strukturen auflösen und Grenzen verschwimmen, ist gekennzeichnet durch einen Vermittlungsbezug zwischen Subjekt und Gesellschaft (ebd., S. 9-11). Dieser wird unter dem Begriff der Identität von der Person ausgehend thematisiert wobei mit dem Habitus primär danach gefragt wird, wie sich soziale Bedingungen in einer Person abbilden (ebd., S ). Da im Zuge des gesellschaftlichen Entgrenzungsprozesses erwartbare Normalbiografien ihre Selbstverständlichkeit verloren haben, gewinnt die Perspektive der Bewältigung zunehmend an Bedeutung. Die verwundbarer gewordenen Lebensläufe verlangen ein fortlaufendes Streben nach Handlungsfähigkeit. Dieses, als bewältigungsrelevant erlebtes, Bedürfnis nach Integrität geht einher mit gesellschaftlichen Ermöglichungen beziehungsweise Verwehrungen.
45 43 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Die Bewältigungsspielräume entwickeln sich dann aus der individuellen Lebenslage (Kapitel 3.5). In der Verbindung von Lebenslage, Identität und Habitus wird deutlich, dass Bewältigungsverhalten immer einem sozialisationsgeprägten Muster folgen und nicht situativ beliebig sind. Diese, aus der Persönlichkeit heraus aktivierten, Prägungen sind veränderbar und wirken in der weiteren Entwicklung strukturierend, wobei sie besonders angesichts kritischer Lebensereignisse für den Bewältigungsprozess freigesetzt werden (ebd., S.63-65). Als Ziel des Bewältigungsprozesses bezeichnet Klaus Hurrelmann in seinem Buch der Sozialisationstheorie (2006) folgendes: Ziel ist es, die persönliche Handlungsfähigkeit zu erhalten ( ) oder - falls dieses nicht möglich ist - die Belastung durch die Umstellung der Handlungsfähigkeit und der emotionalen Verarbeitung zu ertragen (vgl. S. 269). Die Aufrechterhaltung und Sicherung der eigenen Identität ist das Ergebnis einer gelingenden Bewältigung, die sich in einer angepassten sozialen, psychischen sowie körperlichen Verhaltensweise zeigt. Soziale Integration, psychisches Wohlbefinden und körperliche Integrität ist dann gewährleistet, wenn der Bewältigungsprozess erfolgreich war. Die erfolgreiche Bewältigung ist Voraussetzung dafür, dass ein Mensch auch weiterhin eine produktive Verarbeitung von Belastungen und Anforderungen mit gesunder Persönlichkeitsentwicklung im sozialen, psychischen und körperlichen Bereich leisten kann (Havighurst, 1981, zit. in Hurrelmann, 2006, S. 270). Kann ein Bewältigungsprozess nicht erfolgreich vollzogen werden, kann es zu einer gestörten Verarbeitung der Realität kommen, die Symptome der Überbeanspruchung in Form von sozialer Abweichung (dissoziales Verhalten), psychischen Störungen und sogar körperlichen Krankheiten hervorruft. All dies führt letztendlich zu einer Gefährdung der eigenen Identität. Gesellschaftliche Bedingungen in Arbeit, Bildung und sozialem Netzwerk Belastungen im Lebensalltag - Entwicklungsaufgaben - Lebensübergänge - Rollenkonflikte - Kritische Lebensereignisse Individuelle Bedingungen von genetischer Disposition, Temperament und Persönlichkeitsstruktur Versuch der Bewältigung Gelingende Bewältigung - soziale Integration - psychisches Wohlbefinden - körperliche Integrität mit gesicherter Identität Nicht gelingende Bewältigung - soziale Abweichung - psychische Störung - körperliche Krankheit mit ungesicherter Identität Abb. 8: Das Belastungs-Bewältigungsmodell nach Hurrelmann
46 44 Wenn das Leben aus den Fugen gerät In der Abbildung werden links die verschiedenen Belastungen und Bedingungen, die einem Menschen im Laufe seines Lebens begegnen, aufgeführt. Auf der rechten Seite sind die Auswirkungen einer gelingenden sowie einer nicht gelingenden Bewältigung der Anforderungen und ihren Folgen aufgelistet. Entscheidend für eine gelingende Bewältigung ist Variationsreichtum bei der Auswahl von Strategien und die Widerstandskraft. Bei jeder Aufgabe wird der Bewältigungsprozess wieder neu gestartet (vgl. Hurrelmann, 2006, S. 272). Lebenskonstellationen werden von den Subjekten dann als kritisch empfunden, wenn die bislang verfügbaren personalen und sozialen Ressourcen für die Bewältigung nicht mehr ausreichen. Wie bereits ausgeführt wurde, geht Aguilera (2000) davon aus, dass die Bewältigung von kritischen Lebensereignissen so strukturiert ist, dass der Mensch um jeden Preis nach der Wiedererlangung eines Gleichgewichtszustandes strebt (vgl. S ). An diese Logik knüpft auch das Bewältigungskonzept nach Böhnisch (2012) und fokussiert mit der Frage nach subjektiver Handlungsfähigkeit die Anstrengungen des Individuums. Durch den Subjektbezug können die Betroffenheit und Befindlichkeiten der Individuen erkannt und ihr darauf bezogenes Verhalten verstanden werden (vgl. S ). Entlang von vier Grunddimensionen wird die Komplexität der Bewältigungsproblematik aufgezeigt: Die Erfahrung des Selbstwertverlustes geht einher mit der Suche nach der Wiedergewinnung des Selbstwertes und betrifft die subjektive Befindlichkeit und Betroffenheit der Individuen genauso wie die soziale Anerkennung durch andere. Der Erfahrung fehlenden sozialen Rückhalts angesichts nicht mehr überschaubarer biografischer Risikosituationen steht die Suche nach Halt und Unterstützung gegenüber. Die Erfahrung sozialer Orientierungslosigkeit ist verbunden mit der Suche nach Orientierung oder im ungünstigsten Fall mit Aufgabe mit Rückzug und Apathie. Mit der handlungsorientierten Suche nach erreichbaren Formen sozialer Integration wird versucht, Desintegration zu überwinden und Normalisierung herzustellen anders ausgedrückt: dort anzukommen, was als Normalität vorgestellt wird. Dies kann auch sozial abweichendes Verhalten sein, falls dieses Anerkennung, Anschluss und Selbstwirksamkeit verspricht (ebd., S. 35). Angelehnt an den bereits beschriebenen Bewältigungsprozess hat Böhnisch (2012) ein Bewältigungsmodell erstellt, in welchem er die Handlungsfähigkeit eines Menschen in einem Dreieck, welches das psychosoziale Gleichgewicht - im Zusammenspiel von sozialer Anerkennung, Selbstwirksamkeit und Selbstwert - darstellt. Sind diese drei Bewältigungsimpulse im Gleichgewicht, so fühlt sich der Mensch wohl und handlungsfähig.
47 45 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Auch dieses Dreieck kann global oder bereichsspezifisch angeschaut werden. Ist es nicht im Gleichgewicht, was noch nicht etwas Beunruhigendes sein muss, so erfährt der Mensch die Hilflosigkeit des Selbst und es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu ändern. Die erste Bewältigungsmethode ist die positive Thematisierung, entweder im Alltag oder professionell. Durch die Thematisierung normalisiert sich die Balance des Dreiecks wieder. Hat das Individuum, zum Beispiel auf Grund der Entwicklung, nie gelernt, was Thematisierung überhaupt ist und bewirken kann oder hat es das Gefühl, dass die Hilflosigkeit zu gross ist, so kann es zur Abspaltung kommen. Meist zeigt sich dies mit Rückzug und der Projektion des Ungleichgewichts auf Schwächere, zum Beispiel mit Fremdoder Selbstverletzung. Die nächste Stufe wird Abstraktion genannt. Die Pole des Dreiecks können nun nur noch beispielsweise mittels Sucht aufrechterhalten werden. Um von der Position des Opfers als Träger der eigenen Hilflosigkeit wieder wegzukommen, hilft es nicht mehr, das Ausgangsproblem zu thematisieren. Die Person muss, durch eine funktionale Äquivalenz auf eine neue Art und Weise lernen, das Positive zu erkennen und zu erleben. Physisch Abspaltung Psychisch Projektion auf schwächere Soziale Anerkennung Hilflosigkeit des Selbst Abstraktion Selbstwert Selbstwirksamkeit Opfer als Träger der eigenen Hilflosigkeit Thematisierung Alltagsberatung Professionelle Beratung Abb. 9: Das Bewältigungsmodell nach Böhnisch
48 46 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Wenn die Handlungsfähigkeit, welche nach unbedingter Verwirklichung strebt, nicht im gegebenen gesellschaftlichen Rahmen gefunden werden kann, wird soziale Anerkennung neben den in kulturellen Anerkennungskontext geltenden gesellschaftlichen Normen auch in Form von abweichendem Verhalten gesucht. Selbstwirksamkeit wiederum kann in der sozialen Partizipation sowie in Gewalt gleichermassen gespürt werden. Dieses Modell erklärt, dass die äussere Abspaltung, Symptom eines instabilen Selbstwerts ist (vgl. Böhnisch, 2012, S ). Zusammenfasend lässt sich definieren, dass eine sich in einer Krise befindende Person den Bewältigungsprozess in Bezug auf das Eintreten eines kritischen Lebensereignisses nicht erfolgreich vollziehen konnte. Dies unter anderem aufgrund der genannten, nicht oder zu wenig vorhandenen Ressourcen bei der Entwicklung in Bezug auf die Faktoren des Selbstwertes. Um in der professionellen Bewältigungsbegleitung beobachten zu können, wie sich ein geringer Selbstwert oder ein schwaches Selbstkonzept zeigt, ist eine Konkretisierung dieser Begrifflichkeiten und das dahinterstehende Konzept notwendig Konzept Selbstwertgefühl Selbstwertschutz und Selbstwerterleben sind zentrale Motive für das menschliche Handeln. Um den Anforderungen kritischer Lebensereignisse gewachsen zu sein braucht es daher ein positives Selbstwertkonzept um ein Gefühl der Selbstwirksamkeit zu erreichen. Da Krisen jedoch gerade mit Merkmalen des Selbstzweifels verbunden sind, sind die Fähigkeiten zu Selbstregulation (Person-Umwelt-Anpassung) und zum Selbstmanagement entscheidend. Das Selbstwertgefühl ist ein Konstrukt aus positiven Bewertungen, die eine Person bezüglich sich selbst abgibt. Die Quellen dafür sind die Selbstwahrnehmung, soziale Rückmeldungen und Vergleiche. Die Bereiche auf welche sich diese Bewertungen beziehen sind je nach Persönlichkeit, Geschlecht, Kultur, Alter usw. unterschiedlich. In der Forschung werden Selbstakzeptanz, Erfolge und individuelle Fähigkeiten, soziale Überlegenheit und Manipulationsfähigkeit, soziale Kontaktfähigkeit und Eingebunden sein in soziale Beziehungen genannt. Im Zusammenhang mit Entwicklungsphasen, Lebensereignissen und sozialen Einflüssen sowie Rahmenbedingungen kommt es zu Selbstwertveränderungen. Kritische Lebensereignisse können zu einer Selbstwertbelastung werden (z.b. Arbeitslosigkeit) oder sogar, je nach Ausmass derselben, eine traumatisierende Auswirkung auf das Selbstwertgefühl haben (z.b. bei sexuellen Misshandlungen). Ein niedriges Selbstwertgefühl wird auch als Risikofaktor für Suizidalität diskutiert und Suchtverhalten als Versuch gewertet, ein beschädigtes Selbstwertgefühl zu stabilisieren (Kapitel 3.3).
49 47 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Alle Situationen, welche die positive Selbstwahrnehmung einer Person in Frage stellen, gelten als Selbstwertbedrohung. Ausbleibende Anerkennung, Abwertung, Konflikte, Misserfolge, Selbst- und Fremdkritik usw. sind zudem selbstwertbeeinträchtigend. Im Kontext Sozialer Arbeit kommt so die Wichtigkeit des Selbstwertaspektes und der Massnahmen zur Selbstwertregulation in Bezug auf Krisen zum Ausdruck: Ausprägung und Funktionalität des Selbstwertgefühls und die mit der Krise verbundene Belastung sind zu erkennen, identifizieren, benennen und möglichst zu beseitigen. Die Aktivierung bevorzugter Selbstwertquellen und neue zu erschaffen stehen dabei im Mittelpunkt. Wichtig hierbei ist vor allem die professionelle Beziehung als relevant für den Selbstwert zu begreifen und sie auch zu nutzen (vgl. Kunz et al., 2009, S ). Potreck-Rose und Jacob (2010) verstehen den Selbstwert als Dach, welches von vier Säulen gestützt wird. Sind viele Bausteine vorhanden, so ist der Selbstwert stabil. Ist das Fundament aber brüchig, wird der Selbstwert als instabil bezeichnet. Die folgende Abbildung soll dieses Konstrukt bildlich darstellen. Es ist klar erkennbar, dass Selbstvertrauen, Selbstakzeptanz und Selbstwert zwar miteinander in Verbindung stehen, jedoch nicht dasselbe sind. Die Trennung zwischen den einzelnen Säulen kann nicht so scharf vollzogen werden, wie dies auf der Abbildung zu sehen ist. Selbstwert Selbstakzeptanz: Positive Einstellung zu sich selbst als Person Selbstvertrauen: Positive Einstellung zu eigenen Fähigkeiten und Leistungen Soziale Kompetenz: Erleben von Kontaktfähigkeit Soziales Netz: Eingebundensein in positive soziale Beziehungen Zufrieden mit sich sein Etwas gut können Mit Menschen umgehen können Befriedigende Partnerschaft Einverstanden mit sich sein Etwas gut machen Sich schwierigen Situationen gewachsen fühlen Befriedigende Familienbeziehungen Sich wertschätzen Etwas erreichen Flexibel reagieren können Freunde haben Eins mit sich sein Etwas durchhalten Positive Resonanz spüren Sich verlassen können/verlässlich sein Sich in sich selbst zu Hause fühlen Etwas lassen können Nähe/Distanz regulieren können Wichtig sein für andere Intrapersonelle Dimension Interpersonelle Dimension Abb. 10: Die 4 Säulen des Selbstwerts nach Potreck-Rose & Jacob
50 48 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Es wird zwischen der intrapersonellen Dimension, wo es um die Person als Individuum und ihre inneren Gefühle geht, und der interpersonellen Dimension, wo das Umfeld und der Umgang damit einbezogen wird, unterschieden (vgl. S ). Die Basis für den Aufbauprozess von Selbstwertgefühl bilden nach Green (2007) die fünf Komponenten des Selbstwertgefühls: Sicherheit, Man-Selbst-Sein, Zugehörigkeit, Mission und Kompetenz. Je höher die Zahl der vorhandenen Komponenten ist, desto höher ist der allgemeine Selbstwert und umgekehrt. Die Sicherheit bildet die Basis, denn mit dem Sicherheitsgefühl steigen die anderen Komponenten auch ohne spezifische Förderung. Diese Komponente beinhaltet den Aufbau von Vertrauensbeziehung. So ist es wichtig, eine positive, akzeptierende, vertrauende, ermutigende, unterstützende, sichere und Anteil nehmende Umgebung zu schaffen. Das Man-Selbst-Sein ist eng mit der Frage Wer bin ich? verbunden. In dieser Komponente wird der Fokus auch auf die Selbsteinschätzung und die Selbstwirksamkeit gelegt. Die Zugehörigkeit kann von aussen nur bedingt gesteuert werden, da das Gefühl der Zugehörigkeit sehr individuell ist. Die Mission und die Kompetenz hängen zusammen. In der Mission geht es darum, die Fähigkeit zu entwickeln, Entscheidungen zu treffen und Alternativen zu finden. In dieser Komponente braucht es durch Feedback und Begleitung Hilfe von aussen. Bei der Kompetenz geht es um das Bewusstsein und die Akzeptanz von Stärken und Schwächen. Bei als subjektiv wichtig und wertvoll erachteten Dingen führen Erfolgserlebnisse zu einem Gefühl von Leistungsfähigkeit. Die Mission und die Kompetenz sind Komponenten der, im vorherigen Kapitel, genannten Säule Selbstvertrauen (vgl. S ). Ein stabiler Selbstwert zeigt sich also darin, in dem viele Bausteine für die Säulen vorhanden oder die Zahl der Komponenten hoch sind. Eine Person kann in verschiedenen Bereichen verschiedene Selbstwerte haben (bereichsspezifischer Selbstwert). Dieser bereichsspezifische Selbstwert unterscheidet sich wiederum vom globalen Selbstwert, der sich dem Gesamtgefühl einer Person widmet. Auf Grund dieser Individualität sind alle diese Modelle nur Annäherungen an die Eigenschaft des Selbstwerts - in das Innere einer Person kann niemand sehen (vgl. Potreck-Rose & Jacob, 2010, S. 76).
51 49 Wenn das Leben aus den Fugen gerät 3.5. Lebenslagenkonzept Die Spielräume der Lebensbewältigung sind vor allem durch die soziale Lebenslage der Einzelnen massgeblich beeinflusst. Das Konstrukt Lebenslage verweist auf die sozialstrukturelle Einbettung der Lebensverhältnisse und damit auf Ressourcen individueller Lebensbewältigung. Lebenslagen sind ein Produkt gesellschaftlicher Entwicklungen und gleichzeitig eine Ausgangsbedingung für die Entwicklung von Individuen, deren Handeln sich in einem Wechselwirkungsprozess wieder auf die Lebenslage auswirkt. Hier kann wieder auf den Habitus verwiesen werden, der in diesem Zusammenhang einen Aneignungsmodus darstellt und mit welchem, die Lebenslage beeinflussende, Ermöglichungen und Verwehrungen interpretiert werden können. Dem Habitus kommt so die Rolle als Produzent neuer Handlungsmuster zu. Der Begriff Lebenslage umschreibt im Kontext gesellschaftlicher Entwicklungen verfügbare Bewältigungsressourcen. Zusätzlich wird thematisiert, wie Lebensschwierigkeiten als soziale Probleme gesellschaftlich anerkannt werden (vgl. Böhnisch et al., 2009, S ). Im Lebenslagenkonzept nach Meier Kressig und Husi (2013) können die gesellschaftlich vermittelten Belastungen wie Spielräume aufeinander bezogen und explizit mit individuellen Aspekten verbunden werden. Wendt (1988, zit. in Meier Kressig & Husi, 2013) versteht die Lebenslage als relationalen Zusammenhang aus äusseren (gesellschaftlichen und kulturellen) Lebensbedingungen und inneren Zuständen (in Form etwa von kognitiven und emotionalen Deutungs- und Verarbeitungsmustern), in welchen das Individuum verstrickt ist (S. 1). Das Lebenslagenkonzept kann durch Erfassung der Ressourcen und Belastungen von Krisenbetroffenen, in Bezug auf den Bewältigungsprozess, eingesetzt werden. Um die Lebenslage besser zu erfassen, könnten folgende Fragen Aufschluss über das bisherige Bewältigungsverhalten liefern: 1. Welche Mittel, Interessen und Handlungen kennzeichnen die Lebenslage, -ziele und weisen der Krisenbetroffenen? Welche Mittel könnten für die Bewältigung genutzt werden respektive welche Mittel besitzt die krisenbetroffene Person (Habitus)? Welche Mittel werden tatsächlich genutzt oder bleiben unausgeschöpft? 2. Wer und was beeinflusst wie, dass die krisenbetroffene Person ihre Lebensherausforderungen (kritischen Lebensereignisse) auf eine bestimmte Weise bewältigt? Welche Neigungen könnten ihr Handeln anleiten (d. h. welche Neigungen hat sie?), welche Neigungen leiten ihr Handeln tatsächlich an und welche Neigungen können nicht ausgelebt werden?
52 50 Wenn das Leben aus den Fugen gerät 3. Wie geht es der krisenbetroffenen Person? Wie ist ihre subjektive Lebenslage? Welche Lebenssituationen sind konkret veränderungswürdig und welche bieten (k)einen Handlungsanlass für die Soziale Arbeit? 4. Wie können die erwünschten Veränderungen realisiert werden und was steht dem entgegen? Nachfolgend wird von individuellen Lebensverhältnissen ausgegangen, die sich mit den Begriffen Lebenslage, Lebensziele, Lebensweise und Lebensgefühl beschreiben lassen und welche sich gegenseitig beeinflussen (vgl. Meier Kressig & Husi, 2013, S. 4). Lebenslage Mittel & Zwänge (können & müssen) Lebensziele Wünsche & Ziele (mögen & wollen) Lebensgefühl Erleben Handeln Lebensweise Rollen Rechte & Pflichten (dürfen & sollen) Abb. 11: Lebenslagenmodell nach Meier Kressig & Husi Husi (2008, zit. in Meier Kressig & Husi, 2013) konnte in Bezug auf das menschliche Handeln paarweise drei Typen von Modalitäten unterscheiden, welche sich den folgenden Lebensverhältnissen zuordnen lassen (S. 4-5). Husi (2010) vertritt die Meinung, dass menschliches Handeln weder voraussetzungslos erfolgt, noch ausschliesslich durch die Einbindung in soziale Konstellationen geprägt wird. Da die Menschen bestimmte Dinge tun (und unterlassen) können und müssen (d.h. nicht anders können), mögen und wollen, dürfen und sollen, entsteht ein überall und immer begrenzter Handlungsspielraum. Dieser Spielraum wird durch Ermöglichungen (Mittel, Wünsche und Rechte) vergrössert und durch Einschränkungen (Zwänge, Ziele und Pflichten) verkleinert (zit. in ebd., S. 5).
53 51 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Rollen betrachten den Menschen nicht in seiner Ganzheit, sondern meine einen Vielzahl von normativen Erwartungen an eine Person, als Inhaberin oder Inhaber einer Position. Sie bringen zum Ausdruck wie jemand in einer gewissen Situation handeln soll oder darf. Indem Individuen in den verschiedenen Lebensbereichen unterschiedliche Rollen einnehmen können, stellen sie sich gegebenenfalls auch unterschiedlichen Erwartungen, was zu Rollenkonflikten führen könnte. Lebenslage meint die Gesamtheit der Mittel (Ressourcen/Kapitalien), welche einem Menschen zur Verfügung stehen. Diese stellen, unter dem positiven Aspekt der Ermöglichung betrachtet, Lebenschancen und unter dem negativen Aspekt der Bedrohung betrachtet, Lebensrisiken bzw. gefahren dar. Zusätzlich können zwischen inneren und äusseren Mitteln unterschieden werden (ebd., S ). Äussere Mittel Materielle Mittel (Geld, Eigentum, Güter) Soziale Mittel (Beziehungsnetz, Einflussmöglichkeiten) Kulturelle Mittel (Wissen, Bildung, Prestige) Innere Mittel Kognitive Fähigkeiten (geistige Gesundheit, Intelligenz) Emotionale Fähigkeiten (Empathie, Emotionsregulation, -bewusstsein) Körperliche Fähigkeiten (körperliche Gesundheit, Motorik) Volitive Fähigkeiten (Willenkraft) Tabelle 3: Gesamtheit verfügbarer Mittel nach Meier Kressig & Husi Darüber hinaus charakterisiert die Lebenslage auch die Zwänge denen die Menschen ohne Einflussmöglichkeiten ausgesetzt sind. Intersubjektiven Zwängen wie Sucht oder Zwangsstörungen, mit möglicher psychischer oder physischer Grundlage, kann meist nicht willentlich entgegengesetzt werden. Bei intersubjektiven Zwängen wie Gewalt oder Androhungen liegt die Quelle ausserhalb der Person und es geht um physische oder psychische Schädigungen einer anderen Person. Das Ziel einer Intervention auf dieser Ebene kann sich auf die Veränderung der Ressourcen und Kompetenzen beziehen (z.b. Ressourcenorientierung und Empowerment). Lebensziele bezeichnen die Gesamtheit der Neigungen und Beweggründe eines Menschen. Es sind Anliegen, Projekte und Bestrebungen, die eine Person in ihrem Alltag verfolgt und in Zukunft in unterschiedlichen Lebensbereichen erreichen oder vermeiden möchte.
54 52 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Lebensziele motivieren, geben dem Alltag eine Struktur und eine Richtung. Sie sind zudem eine Grundlage für den Lebenssinn. Lebensziele - ob kurzfristige oder längerfristige - kann man bewusst verfolgen oder eher unbewusst. Lebensziele unterscheiden sich hinsichtlich ihres Konkretisierungsgrades bzw. ihrer Handlungswirksamkeit. Bei Intervention auf der Ebene Lebensziele geht es (in gemeinsamer Absprache) um die Veränderung von Plänen, Werten und Wünschen (z.b. Lösungsorientierter Ansatz und Motivational Interviewing). Der Begriff Lebensweise bezieht sich auf die Gesamtheit der Handlungen, die ein Mensch ausführt. Die Lebensweise drückt das Tun (und Lassen) eines Menschen aus. Der Blick richtet sich auf das Zusammenspiel von Handlungen in verschiedenen Lebensbereichen (z.b. work-life-blance). Handlungsroutinen und reflektiertes Handeln reproduzieren die Lebenslage, Lebensziele und Rollen einer Person. Das Ziel einer Intervention kann sich auf die Veränderung von Handlungsmuster und Deutungsmuster beziehen. Zusätzlich geht es aber auch einfach darum, der krisenbetroffenen Person bei der Bewältigung ihrer alltäglichen Lebensführung beizustehen. Lebensgefühl meint die relativ dauerhafte subjektive Einschätzung des eigenen Lebens und bezeichnet einen spezifischen Aspekt der Lebensqualität. Das Lebensgefühl eines Menschen ergibt sich aus dem Zusammenspiel seiner Rolle, seiner Lebenslage, seiner Lebensziele und seiner Lebensweise, also aus dem Erleben dieser Wechselwirkungen. Auf der Dimension des Lebensgefühls können beispielsweise Hoffnungen und Befürchtungen, Zukunftsängste und Vertrauen thematisiert werden (ebd., S ) Resümee Die Thematisierung der Spannung zwischen gesellschaftlichen Entgrenzungsprozessen und dem subjektiven Streben nach biographischer Handlungsfähigkeit ist zentral für die Bestimmung der Vermittlungsdimensionen der Sozialisation. Der Entgrenzungsbegriff ist dabei eng an die alltägliche Lebensführung gebunden, denn die Entgrenzung gesellschaftlicher Strukturen und die Entgrenzung der Lebensbereiche stehen in einem ambivalenten Verhältnis zueinander. Einerseits verkörpert sie für das Subjekt den Kontext der Erreichbarkeit der Handlungsfähigkeit, andererseits lässt sie den gesellschaftlichen Preis vergessen, um den diejenige errungen wird. Im Mittelpunkt steht die Beobachtung, dass biographische Bewältigungsanforderungen zunehmen. Die Vermittlung zwischen Subjekt und Gesellschaft kann sich nicht mehr auf Stützfunktionen für die Stabilität von Normalbiographien verlassen. Der traditionelle Anker des Lebenslaufes hat sich gelockert und die sozialstaatliche Sicherheit hat abgenommen.
55 Individualisierung / Entgrenzung Integrität 53 Wenn das Leben aus den Fugen gerät Sozialstrukturelle und psychosoziale Einflussfaktoren ergeben eine Anhäufung von Bewältigungsanforderungen. Die Suche nach biographischer Handlungsfähigkeit gerät zwischen Chance und Zwang zur Selbstorganisation. Misserfolge und Scheitern werden dem Individuum zugeschoben, wenn traditionelle Bewältigungskontexte nicht mehr ohne Weiteres verfügbar sind. Sozialisationsprozesse können jedoch nicht nur subjektzentriert erklärt, sondern müssen in der Spannung zwischen Individuum und Gesellschaft betrachtet werden. Strukturwandel Identität / Habitus SUBJEKT Kritischem Lebensereignis ausgesetzt Balance herstellen Risikogesellschaft Risiko- vs. Schutzfaktoren Abb. 12: Modell der Bewältigungsherausforderungen nach Böhnisch et al. Die erfolgreiche Verarbeitung einer Krise erfordert, wie bereits ausgeführt, geeignete Bewältigungsstrategien, welche sich wiederum auf Ressourcen stützen. Aufgrund der Einschätzung der eigenen Ressourcen wird erwogen, welche Strategie der gegebenen Situation angemessen ist. Ressourcen sind dadurch Hilfsmittel zur Bewältigung und werden in zielorientierten Handlungen eingesetzt. Nun sind Krisen jedoch gerade mit Ressourcenverlust gekennzeichnet. So geht beispielsweise bei einer Trennung der Partner, als oft wichtigste Stütze in der Lebensbewältigung, verloren. Ebenfalls können Krisen auftreten, wenn der Einsatz von Ressourcen in keinem Verhältnis zum Ergebnis steht, z.b. eine Note, welche den Aufwand für eine Prüfung nicht ausgleicht.
Titel Wenn das Leben aus den Fugen gerät. Psychosoziale Krisen Eine Gratwanderung zwischen Bewältigen und Scheitern.
 Abstract Titel Wenn das Leben aus den Fugen gerät. Psychosoziale Krisen Eine Gratwanderung zwischen Bewältigen und Scheitern. Kurzzusammenfassung Die Arbeit beschreibt die Bewältigung von psychosozialen
Abstract Titel Wenn das Leben aus den Fugen gerät. Psychosoziale Krisen Eine Gratwanderung zwischen Bewältigen und Scheitern. Kurzzusammenfassung Die Arbeit beschreibt die Bewältigung von psychosozialen
KRISE ALS CHANCE. Christine Calabrese Oberärztliche Leitung/ Akutambulanz (ZDK)
 KRISE ALS CHANCE Christine Calabrese Oberärztliche Leitung/ Akutambulanz (ZDK) 1 Krise ist kein krankhafter Zustand, kann jeden Menschen in jedem Lebensalter betreffen. 2 Griechisch Krisis : trennen, unterscheiden...ein
KRISE ALS CHANCE Christine Calabrese Oberärztliche Leitung/ Akutambulanz (ZDK) 1 Krise ist kein krankhafter Zustand, kann jeden Menschen in jedem Lebensalter betreffen. 2 Griechisch Krisis : trennen, unterscheiden...ein
Krisen von Angehörigen Damit muss ich alleine fertig werden! Warum fällt es uns so schwer, in belastenden Situationen Hilfe anzunehmen
 Krisen von Angehörigen Damit muss ich alleine fertig werden! Warum fällt es uns so schwer, in belastenden Situationen Hilfe anzunehmen D R. C L A U D I U S S T E I N K R I S E N I N T E R V E N T I O N
Krisen von Angehörigen Damit muss ich alleine fertig werden! Warum fällt es uns so schwer, in belastenden Situationen Hilfe anzunehmen D R. C L A U D I U S S T E I N K R I S E N I N T E R V E N T I O N
Krisen meistern Krisen meistern: Gefahr des Scheiterns und Chance des Neuanfangs
 Krisen meistern: Gefahr des Scheiterns und Chance des Neuanfangs 1 Inhalt 1. Was ist eine Krise? 2. Arten von Krisen 3. Entstehung einer Krise 4. Die vier Phasen einer Krise 5. Einflüsse auf den Umgang
Krisen meistern: Gefahr des Scheiterns und Chance des Neuanfangs 1 Inhalt 1. Was ist eine Krise? 2. Arten von Krisen 3. Entstehung einer Krise 4. Die vier Phasen einer Krise 5. Einflüsse auf den Umgang
Krisenintervention bei akuter Traumatisierung und Krise Claudius Stein
 Krisenintervention bei akuter Traumatisierung und Krise Claudius Stein Krisen bewegen sich in einem Spannungsfeld zwischen Katharsis und Katastrophe, zwischen Gelingen und Scheitern. Krisen bedeuten Wagnis.
Krisenintervention bei akuter Traumatisierung und Krise Claudius Stein Krisen bewegen sich in einem Spannungsfeld zwischen Katharsis und Katastrophe, zwischen Gelingen und Scheitern. Krisen bedeuten Wagnis.
Psychosoziale Krisen- Definition, Aspekte, Erscheinungsbilder
 Krisenintervention Wege für medizinische Berufe 15.05.2013 Was ist eine Krise? Psychosoziale Krisen- Definition, Aspekte, Erscheinungsbilder Es handelt sich bei Krisen um eine Problemlage, die als Folge
Krisenintervention Wege für medizinische Berufe 15.05.2013 Was ist eine Krise? Psychosoziale Krisen- Definition, Aspekte, Erscheinungsbilder Es handelt sich bei Krisen um eine Problemlage, die als Folge
Krisen von und mit Jugendlichen und Gruppendynamik in stationären Betreuungseinrichtungen
 Krisen von und mit Jugendlichen und Gruppendynamik in stationären Betreuungseinrichtungen PSYCHOSOZIALE KRISE Verlust des seelischen Gleichgewichts, den ein Mensch verspürt, wenn er mit Ereignissen und
Krisen von und mit Jugendlichen und Gruppendynamik in stationären Betreuungseinrichtungen PSYCHOSOZIALE KRISE Verlust des seelischen Gleichgewichts, den ein Mensch verspürt, wenn er mit Ereignissen und
Therapiebedürftige Kinder und Jugendliche im Schulalter. Erfahrungen aus psychotherapeutischer Sicht und präventive Ansätze
 Therapiebedürftige Kinder und Jugendliche im Schulalter Erfahrungen aus psychotherapeutischer Sicht und präventive Ansätze Übersicht: Psychische Störungen Kinder- und Jugendliche als Patienten Prävention
Therapiebedürftige Kinder und Jugendliche im Schulalter Erfahrungen aus psychotherapeutischer Sicht und präventive Ansätze Übersicht: Psychische Störungen Kinder- und Jugendliche als Patienten Prävention
"... danach ist nichts mehr wie vorher - Erste Hilfe durch traumasensible Beratung. Ulrich Pasch Ambulanz für Gewaltopfer, Gesundheitsamt Düsseldorf
 "... danach ist nichts mehr wie vorher - Erste Hilfe durch traumasensible Beratung Ulrich Pasch Ambulanz für Gewaltopfer, Gesundheitsamt Düsseldorf Aufkleber in Bussen und Bahnen würde. Leitlinien akute
"... danach ist nichts mehr wie vorher - Erste Hilfe durch traumasensible Beratung Ulrich Pasch Ambulanz für Gewaltopfer, Gesundheitsamt Düsseldorf Aufkleber in Bussen und Bahnen würde. Leitlinien akute
Resilienz. Ein anderer Blick auf Verlustreaktionen. Aeternitas - Service - Reihe: Trauer. Aeternitas - Service - Reihe: Trauer
 Resilienz Ein anderer Blick auf Verlustreaktionen Gliederung Einführung Definition Trauer und Resilienz Resilienz-Forschung Was zeichnet resiliente Menschen aus? Schlussfolgerungen für die Praxis 2 Einführung
Resilienz Ein anderer Blick auf Verlustreaktionen Gliederung Einführung Definition Trauer und Resilienz Resilienz-Forschung Was zeichnet resiliente Menschen aus? Schlussfolgerungen für die Praxis 2 Einführung
Entstehung und Prävention von Schulangst
 Pädagogik Michael Obenaus Entstehung und Prävention von Schulangst Studienarbeit HS Päd. Psychologie Störungen der Sozialverhaltens Verfasser: Michael Obenaus Zum Referat Angst und Schulangst Schulangst
Pädagogik Michael Obenaus Entstehung und Prävention von Schulangst Studienarbeit HS Päd. Psychologie Störungen der Sozialverhaltens Verfasser: Michael Obenaus Zum Referat Angst und Schulangst Schulangst
Grundbedingungen nach Jaspers (1965)
 Inhaltsübersicht -Allgemeine Überlegungen -Nomenklatur psychoreaktiver Störungen -Akute Belastungsreaktion -Posttraumatische Belastungsstörung -Anpassungsstörungen -Sonstige psychopathologische Syndrome
Inhaltsübersicht -Allgemeine Überlegungen -Nomenklatur psychoreaktiver Störungen -Akute Belastungsreaktion -Posttraumatische Belastungsstörung -Anpassungsstörungen -Sonstige psychopathologische Syndrome
Womit beschäftigt sich Resilienz?
 Resilienz RESILIENZ Womit beschäftigt sich Resilienz? Das Resilienzkonzept beschäftigt sich mit der Frage was Menschen hilft, schwierige Situationen erfolgreich zu bewältigen und einen positiven Entwicklungsverlauf
Resilienz RESILIENZ Womit beschäftigt sich Resilienz? Das Resilienzkonzept beschäftigt sich mit der Frage was Menschen hilft, schwierige Situationen erfolgreich zu bewältigen und einen positiven Entwicklungsverlauf
Resilienz - Krisen unbeschadet überstehen
 1 von 8 21.09.2015 21:06 Startseite Haftung Copyright Impressum Datenschutz Link Tipps suchen Resilienz - Krisen unbeschadet überstehen Mit Resilienz wird die innere Stärke eines Menschen bezeichnet, Konflikte,
1 von 8 21.09.2015 21:06 Startseite Haftung Copyright Impressum Datenschutz Link Tipps suchen Resilienz - Krisen unbeschadet überstehen Mit Resilienz wird die innere Stärke eines Menschen bezeichnet, Konflikte,
Wie gehe ich mit Suizidalität um? Dr. med. Barbara Hochstrasser, M.P.H. Chefärztin Privatklinik Meiringen
 Wie gehe ich mit Suizidalität um? Dr. med. Barbara Hochstrasser, M.P.H. Chefärztin Privatklinik Meiringen Suizidalität : Begriffbestimmung Suizidalität meint die Summe aller Denk- und Verhaltensweisen,
Wie gehe ich mit Suizidalität um? Dr. med. Barbara Hochstrasser, M.P.H. Chefärztin Privatklinik Meiringen Suizidalität : Begriffbestimmung Suizidalität meint die Summe aller Denk- und Verhaltensweisen,
Woran scheitern Veränderung Prozesse?
 So verändern Sie Ihre Firma erfolgreich! Woran scheitern Veränderung Prozesse? Der Begriff Change Management steht für Veränderungen für den Betrieb und die Mitarbeiter. So meistern Arbeitgeber erfolgreich
So verändern Sie Ihre Firma erfolgreich! Woran scheitern Veränderung Prozesse? Der Begriff Change Management steht für Veränderungen für den Betrieb und die Mitarbeiter. So meistern Arbeitgeber erfolgreich
Krisenintervention - Erste Hilfe in akuten Lebenskrisen aus professioneller Sicht
 Krisenintervention - Erste Hilfe in akuten Lebenskrisen aus professioneller Sicht Dr. Thomas Kapitany, Kriseninterventionszentrum Wien 53. Linzer Psychiatrischer Samstag erste hilfe für die seele Krise
Krisenintervention - Erste Hilfe in akuten Lebenskrisen aus professioneller Sicht Dr. Thomas Kapitany, Kriseninterventionszentrum Wien 53. Linzer Psychiatrischer Samstag erste hilfe für die seele Krise
Mit schwierigen Gefühlen und Stress besser umgehen 65. Mit den Folgen der Erkrankung besser zurechtkommen 114
 Einleitung 7 Was ist Borderline? 12 Borderline besser verstehen 32 Die stabile Seite stärken 49 Mit schwierigen Gefühlen und Stress besser umgehen 65 Notfallkoffer 87 Absprachen treffen 99 Mit den Folgen
Einleitung 7 Was ist Borderline? 12 Borderline besser verstehen 32 Die stabile Seite stärken 49 Mit schwierigen Gefühlen und Stress besser umgehen 65 Notfallkoffer 87 Absprachen treffen 99 Mit den Folgen
Grundlagen der systemischen Beratung
 Grundlagen der systemischen Beratung S.1 Was heißt eigentlich systemisch? Technisch gesprochen ist ein System eine aus mehreren Komponenten zusammengesetzte Einheit. Diese Komponenten sind aufeinander
Grundlagen der systemischen Beratung S.1 Was heißt eigentlich systemisch? Technisch gesprochen ist ein System eine aus mehreren Komponenten zusammengesetzte Einheit. Diese Komponenten sind aufeinander
Krisenintervention Mara Adam, Nora Geiser, Carla Holzapfel, Laura Petri, Paulina Schnur
 Krisenintervention 28.11.16 Mara Adam, Nora Geiser, Carla Holzapfel, Laura Petri, Paulina Schnur Gliederung Definition Krise Symptome Gefahren Krisenmodelle Intervention Definition Krise Eine Krise entsteht
Krisenintervention 28.11.16 Mara Adam, Nora Geiser, Carla Holzapfel, Laura Petri, Paulina Schnur Gliederung Definition Krise Symptome Gefahren Krisenmodelle Intervention Definition Krise Eine Krise entsteht
Die Arbeit in Mutter-Kind-Einrichtungen: Eine fachliche und persönliche Herausforderung
 Die Arbeit in Mutter-Kind-Einrichtungen: Eine fachliche und persönliche Herausforderung In Mutter-Kind-Einrichtungen leben heute Frauen, die vielfach belastet sind. Es gibt keinen typischen Personenkreis,
Die Arbeit in Mutter-Kind-Einrichtungen: Eine fachliche und persönliche Herausforderung In Mutter-Kind-Einrichtungen leben heute Frauen, die vielfach belastet sind. Es gibt keinen typischen Personenkreis,
Eltern sein plus! Beispiele von Elternbegleitung aus der Erfahrungswelt einer Praxis für f medizinische Genetik und vorgeburtliche Diagnostik
 Eltern sein plus! Beispiele von Elternbegleitung aus der Erfahrungswelt einer Praxis für f medizinische Genetik und vorgeburtliche Diagnostik 1 zeitlich unterschiedliche Situationen Person mit besonderen
Eltern sein plus! Beispiele von Elternbegleitung aus der Erfahrungswelt einer Praxis für f medizinische Genetik und vorgeburtliche Diagnostik 1 zeitlich unterschiedliche Situationen Person mit besonderen
Psychosoziale Risiken und ihre Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit Herausforderungen für die Mediziner 14. SIZ-Care Forum
 Psychosoziale Risiken und ihre Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit Herausforderungen für die Mediziner 14. SIZ-Care Forum Dr. med. Andreas Canziani FMH Psychiatrie und Psychotherapie Themen Was sind
Psychosoziale Risiken und ihre Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit Herausforderungen für die Mediziner 14. SIZ-Care Forum Dr. med. Andreas Canziani FMH Psychiatrie und Psychotherapie Themen Was sind
Ich bin stark, wenn. Resilienz. Stefanie Schopp
 Ich bin stark, wenn Resilienz Stefanie Schopp Entscheidungsforschung? Als der Psychologe Antonio Damasioseinen Als der Psychologe Antonio Damasioseinen Patienten nach einer Gehirnoperation untersuchte,
Ich bin stark, wenn Resilienz Stefanie Schopp Entscheidungsforschung? Als der Psychologe Antonio Damasioseinen Als der Psychologe Antonio Damasioseinen Patienten nach einer Gehirnoperation untersuchte,
Den Wandel im Betrieb motivierend gestalten
 Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Wandel ist die Voraussetzung für das Überleben in einer dynamischen Zeit Den Wandel im Betrieb motivierend gestalten If the rate of change outside exceeds
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Wandel ist die Voraussetzung für das Überleben in einer dynamischen Zeit Den Wandel im Betrieb motivierend gestalten If the rate of change outside exceeds
Ausbildung zum Burnout-Coach nach dem Dialogprinzip
 Ausbildung zum Burnout-Coach nach dem Dialogprinzip Gesund werden bedeutet die Bereitschaft, sich ohne Wenn und Aber für die Wahrheit zu entscheiden. Dauer: 6 Monate alle 14 Tage Anmeldung und weitere
Ausbildung zum Burnout-Coach nach dem Dialogprinzip Gesund werden bedeutet die Bereitschaft, sich ohne Wenn und Aber für die Wahrheit zu entscheiden. Dauer: 6 Monate alle 14 Tage Anmeldung und weitere
Ein Schatten auf dem Leben Hinterbliebene nach Suizid. Faktoren, die den Verlauf eines Trauerprozesses beeinflussen können
 Ein Schatten auf dem Leben Hinterbliebene nach Suizid Trauer und Melancholie (S. Freud) Trauer ist eine normale Reaktion auf den Verlust eines nahestehenden Menschen. Trauer ist notwendig, um sich von
Ein Schatten auf dem Leben Hinterbliebene nach Suizid Trauer und Melancholie (S. Freud) Trauer ist eine normale Reaktion auf den Verlust eines nahestehenden Menschen. Trauer ist notwendig, um sich von
Inhalt. Vorbemerkung und Einführung 9. Das Erleben der Betroffenen 11. Die professionelle Diagnose 42
 Inhalt Vorbemerkung und Einführung 9 Das Erleben der Betroffenen 11 Innerseelisches Erleben 12 Wie macht sich die Erkrankung bemerkbar? 17 Wie hat sich die Erkrankung entwickelt die Zeit vor der Erkrankung?
Inhalt Vorbemerkung und Einführung 9 Das Erleben der Betroffenen 11 Innerseelisches Erleben 12 Wie macht sich die Erkrankung bemerkbar? 17 Wie hat sich die Erkrankung entwickelt die Zeit vor der Erkrankung?
Meet The Expert - Bewältigungsstrategien. DGBS Jahrestagung Sep. 2017
 Meet The Expert - Bewältigungsstrategien DGBS Jahrestagung 07. -09. Sep. 2017 Stress Definition Stress (engl. für Druck, Anspannung ; lat. stringere anspannen ) bezeichnet durch spezifische äußere Reize
Meet The Expert - Bewältigungsstrategien DGBS Jahrestagung 07. -09. Sep. 2017 Stress Definition Stress (engl. für Druck, Anspannung ; lat. stringere anspannen ) bezeichnet durch spezifische äußere Reize
KRISEN ANGEMESSEN & ERFOLGREICH BEWÄLTIGEN - BEGLEITEN
 VORTRAG KRISEN ANGEMESSEN & ERFOLGREICH BEWÄLTIGEN - BEGLEITEN 7. Mai 2014 Dr.in Cornelia Patsalidis-Ludwig KRISE ist eine gefährliche Entwicklung, Zuspitzung, Verschärfung, eine Entscheidungs- oder Definition
VORTRAG KRISEN ANGEMESSEN & ERFOLGREICH BEWÄLTIGEN - BEGLEITEN 7. Mai 2014 Dr.in Cornelia Patsalidis-Ludwig KRISE ist eine gefährliche Entwicklung, Zuspitzung, Verschärfung, eine Entscheidungs- oder Definition
Begleiten in Krisensituationen
 Begleiten in Krisensituationen Auszüge aus einem Schreiben von E. J. Smith aus dem Jahre 1907: Am 14. April 1912 lief die britische Luxusdampfer Titanic kurz vor Mitternacht auf der Jungfernfahrt von
Begleiten in Krisensituationen Auszüge aus einem Schreiben von E. J. Smith aus dem Jahre 1907: Am 14. April 1912 lief die britische Luxusdampfer Titanic kurz vor Mitternacht auf der Jungfernfahrt von
Verstehen - Lernen Lehren. Wie können traumabezogene (psycho)therapeutische Konzepte im pädagogischen Alltag genutzt werden?
 Bild: Fotolia Verstehen - Lernen Lehren. Wie können traumabezogene (psycho)therapeutische Konzepte im pädagogischen Alltag genutzt werden? Verstehen - Lernen Lehren. Jan Glasenapp (2018) Bestimmt (k)eine
Bild: Fotolia Verstehen - Lernen Lehren. Wie können traumabezogene (psycho)therapeutische Konzepte im pädagogischen Alltag genutzt werden? Verstehen - Lernen Lehren. Jan Glasenapp (2018) Bestimmt (k)eine
Leben mit einer chronischen Erkrankung Wie gehen Angehörige damit um? Ignorieren bis zu in Watte packen?
 Unternehmensdarstellung der Wicker-Gruppe Leben mit einer chronischen Erkrankung Wie gehen Angehörige damit um? Ignorieren bis zu in Watte packen? Heike Mehmke Diplom-Psychologin Klinik Hoher Meissner,
Unternehmensdarstellung der Wicker-Gruppe Leben mit einer chronischen Erkrankung Wie gehen Angehörige damit um? Ignorieren bis zu in Watte packen? Heike Mehmke Diplom-Psychologin Klinik Hoher Meissner,
Wie erkennen Pflegefachpersonen, was Angehörige von onkologischen Patienten brauchen?
 Wie erkennen Pflegefachpersonen, was Angehörige von onkologischen Patienten brauchen? Onkologische Pflege Fortgeschrittene Praxis September 2010 Diana Zwahlen Psychoonkologischer Dienst, Inselspital Bern
Wie erkennen Pflegefachpersonen, was Angehörige von onkologischen Patienten brauchen? Onkologische Pflege Fortgeschrittene Praxis September 2010 Diana Zwahlen Psychoonkologischer Dienst, Inselspital Bern
Suizid im Jugendalter
 Geisteswissenschaft Ornella Alfonso Suizid im Jugendalter Möglichkeiten und Grenzen der Schulsozialarbeit bei Suizidgefährdung Bachelorarbeit Suizid im Jugendalter Welche Möglichkeiten und Grenzen entstehen
Geisteswissenschaft Ornella Alfonso Suizid im Jugendalter Möglichkeiten und Grenzen der Schulsozialarbeit bei Suizidgefährdung Bachelorarbeit Suizid im Jugendalter Welche Möglichkeiten und Grenzen entstehen
Die Energetische Medizin
 Die Energetische Medizin Die Energetische Medizin ist ein Modell der Medizin, das den Menschen, seine Gesundheit und seine Behandlung aus energetischer Sicht betrachtet. Dieses Modell basiert auf dem energetischen
Die Energetische Medizin Die Energetische Medizin ist ein Modell der Medizin, das den Menschen, seine Gesundheit und seine Behandlung aus energetischer Sicht betrachtet. Dieses Modell basiert auf dem energetischen
Psychologische Beratungsstelle Krise & Suizidalität - an der PBS!
 Krise & Suizidalität - an der PBS! Fortbildung: Netzwerk Krise & Suizid Dipl.-Psych. Cornelia Beck, Leitung PBS 27. Juni 2018 Psychologische Beratungsstelle PBS 6 klinische Psychologinnen und Psychologen
Krise & Suizidalität - an der PBS! Fortbildung: Netzwerk Krise & Suizid Dipl.-Psych. Cornelia Beck, Leitung PBS 27. Juni 2018 Psychologische Beratungsstelle PBS 6 klinische Psychologinnen und Psychologen
Posttraumatische Belastungsstörung - Auswirkung auf das Alltagsleben von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Mag.
 Posttraumatische Belastungsstörung - Auswirkung auf das Alltagsleben von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund Mag. Edita Causevic Übersicht Trauma PTBS Definition Arten Kriterien (DSM-IV
Posttraumatische Belastungsstörung - Auswirkung auf das Alltagsleben von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund Mag. Edita Causevic Übersicht Trauma PTBS Definition Arten Kriterien (DSM-IV
Arbeitstherapie. 2.1 Diagnose
 2.1 Diagnose Eine systematische, arbeitstherapeutische und Behandlungsplanung, sowie die fortlaufende Dokumentation des Therapieverlaufes gelten mittlerweile als verbindliche Bestandteile des Arbeitstherapeutischen
2.1 Diagnose Eine systematische, arbeitstherapeutische und Behandlungsplanung, sowie die fortlaufende Dokumentation des Therapieverlaufes gelten mittlerweile als verbindliche Bestandteile des Arbeitstherapeutischen
Geflüchtete Kinder - Herausforderungen und Chancen kultureller Vielfalt in der frühen Bildung
 Geflüchtete Kinder - Herausforderungen und Chancen kultureller Vielfalt in der frühen Bildung Fachtag der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung in Leipzig 24. November 2014 Bildung und Teilhabe für geflüchtete
Geflüchtete Kinder - Herausforderungen und Chancen kultureller Vielfalt in der frühen Bildung Fachtag der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung in Leipzig 24. November 2014 Bildung und Teilhabe für geflüchtete
Trauma und Krebs. Wie traumatherapeutische Hilfe Heilung unterstützen kann. T , F DW - 20
 Trauma und Krebs Wie traumatherapeutische Hilfe Heilung unterstützen kann co-operations Organisationsentwicklung GmbH Blaasstraße 19, A - 1190 Wien T+43-1 - 369 49 17-17, F DW - 20 www.co-operations.at
Trauma und Krebs Wie traumatherapeutische Hilfe Heilung unterstützen kann co-operations Organisationsentwicklung GmbH Blaasstraße 19, A - 1190 Wien T+43-1 - 369 49 17-17, F DW - 20 www.co-operations.at
Das Wort Resilienz steht für Flexibilität, Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit. Resilienz wird immer wieder mit der Fähigkeit gleichgesetzt mit V
 Das Wort Resilienz steht für Flexibilität, Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit. Resilienz wird immer wieder mit der Fähigkeit gleichgesetzt mit Veränderungen und Widrigkeiten im Leben umzugehen. Es
Das Wort Resilienz steht für Flexibilität, Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit. Resilienz wird immer wieder mit der Fähigkeit gleichgesetzt mit Veränderungen und Widrigkeiten im Leben umzugehen. Es
RESILIENZ EINE GEHEIME KRAFT IN UNS..
 RESILIENZ EINE GEHEIME KRAFT IN UNS.. Resilienz beschreibt die Fähigkeit von Menschen, mit Leistungsdruck, Veränderungen und Krisen konstruktiv umzugehen, handlungsfähig zu bleiben & schlussendlich sogar
RESILIENZ EINE GEHEIME KRAFT IN UNS.. Resilienz beschreibt die Fähigkeit von Menschen, mit Leistungsdruck, Veränderungen und Krisen konstruktiv umzugehen, handlungsfähig zu bleiben & schlussendlich sogar
Bewältigung einer persönlichen Krise. verursacht durch Unglücksfälle und Katastrophen
 Bewältigung einer persönlichen Krise www.peh.sg.ch verursacht durch Unglücksfälle und Katastrophen » Weinen kann Erleichterung bringen! Ein schwerer Unfall, Feuer oder Explosion Ein gewalttätiger Überfall
Bewältigung einer persönlichen Krise www.peh.sg.ch verursacht durch Unglücksfälle und Katastrophen » Weinen kann Erleichterung bringen! Ein schwerer Unfall, Feuer oder Explosion Ein gewalttätiger Überfall
Krankheitsbewältigung und Partnerschaft bei chronischen neurologischen Erkrankungen
 Krankheitsbewältigung und Partnerschaft bei chronischen neurologischen Erkrankungen Heike Meißner Klinische Neuropsychologin GNP Psychologische Psychotherapeutin Neurologisches Rehabilitationszentrum Quellenhof
Krankheitsbewältigung und Partnerschaft bei chronischen neurologischen Erkrankungen Heike Meißner Klinische Neuropsychologin GNP Psychologische Psychotherapeutin Neurologisches Rehabilitationszentrum Quellenhof
Hirntod und Organspende im. H. Tritthart Graz
 Hirntod und Organspende im deutschsprachigen Raum Gesprächsführung H. Tritthart Graz Die Betreuung von Organspendern und seinen Angehörigen gehört zu den sensibelsten Phasen einer postmortalen Organspende
Hirntod und Organspende im deutschsprachigen Raum Gesprächsführung H. Tritthart Graz Die Betreuung von Organspendern und seinen Angehörigen gehört zu den sensibelsten Phasen einer postmortalen Organspende
Krankheitsbewältigung
 Krankheitsbewältigung Dr. med. Jutta Esther Hensen Allgemeinmedizin Psychotherapie Hannover Was ist belastend an einer chronischen Erkrankung? Heilung schwierig Krankheitsverlauf unvorhersehbar Abhängigkeit
Krankheitsbewältigung Dr. med. Jutta Esther Hensen Allgemeinmedizin Psychotherapie Hannover Was ist belastend an einer chronischen Erkrankung? Heilung schwierig Krankheitsverlauf unvorhersehbar Abhängigkeit
3., vollständig revidierte und aktualisierte Auflage
 Clemens Hausmann Notfallpsychologie und Traumabewältigung Ein Handbuch 3., vollständig revidierte und aktualisierte Auflage facultas.wuv Inhaltsübersicht 0 Das Wichtigste zuerst 15 1 Das Feld der Notfallpsychologie
Clemens Hausmann Notfallpsychologie und Traumabewältigung Ein Handbuch 3., vollständig revidierte und aktualisierte Auflage facultas.wuv Inhaltsübersicht 0 Das Wichtigste zuerst 15 1 Das Feld der Notfallpsychologie
Mehr Power und Klarheit durch Resilienz
 Mehr Power und Klarheit durch Resilienz Petra Homberg GbR Martinskirchstraße 74 60529 Frankfurt am Main Telefon 069 / 9 39 96 77-0 Telefax 069 / 9 39 96 77-9 www.metrionconsulting.de E-mail info@metrionconsulting.de
Mehr Power und Klarheit durch Resilienz Petra Homberg GbR Martinskirchstraße 74 60529 Frankfurt am Main Telefon 069 / 9 39 96 77-0 Telefax 069 / 9 39 96 77-9 www.metrionconsulting.de E-mail info@metrionconsulting.de
Persönliche Reifung nach Verlusten
 Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Friedrich Nietzsche Persönliche Reifung nach Verlusten 1 Gliederung Persönliche Reifung: Was ist darunter zu verstehen? Intentionale Selbstentwicklung: Muss
Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Friedrich Nietzsche Persönliche Reifung nach Verlusten 1 Gliederung Persönliche Reifung: Was ist darunter zu verstehen? Intentionale Selbstentwicklung: Muss
Stress am Arbeitsplatz: Signale und Ursachen Persönliche Checkliste
 Stress am Arbeitsplatz: Signale und Ursachen Persönliche Checkliste Die Checkliste hilft Ihnen, persönlich erlebten Stress zu identifizieren und seine Ursachen zu erfassen. In dieser Checkliste wird Stress
Stress am Arbeitsplatz: Signale und Ursachen Persönliche Checkliste Die Checkliste hilft Ihnen, persönlich erlebten Stress zu identifizieren und seine Ursachen zu erfassen. In dieser Checkliste wird Stress
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Impressum:
 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind
Ich bin stark, wenn. Fachtagung "Nächste Stunde: Prävention!" der AOK Nordost am 03. Mai Stefanie Schopp. Stefanie Schopp
 Ich bin stark, wenn Fachtagung "Nächste Stunde: Prävention!" der AOK Nordost am 03. Mai 2017 Stefanie Schopp Stefanie Schopp Entscheidungsforschung? Als der Psychologe Antonio Damasio seinen Patienten
Ich bin stark, wenn Fachtagung "Nächste Stunde: Prävention!" der AOK Nordost am 03. Mai 2017 Stefanie Schopp Stefanie Schopp Entscheidungsforschung? Als der Psychologe Antonio Damasio seinen Patienten
Gruppenbericht. Test GmbH Mustergruppe
 Gruppenbericht Test GmbH Mustergruppe 11.04.2016 2015 SCHEELEN AG RELIEF Gruppenbericht 1 Alle reden über Stress - wie messen ihn! Gute Unternehmen brauchen gute Mitarbeiter die anderen verbrauchen gute
Gruppenbericht Test GmbH Mustergruppe 11.04.2016 2015 SCHEELEN AG RELIEF Gruppenbericht 1 Alle reden über Stress - wie messen ihn! Gute Unternehmen brauchen gute Mitarbeiter die anderen verbrauchen gute
Wann und warum ist eine Fluchtgeschichte traumatisierend?
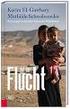 Wann und warum ist eine Fluchtgeschichte traumatisierend? Traumatisiert arbeiten? Eingliederung von traumatisierten Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt Netzwerk InProcedere Bleiberecht durch Arbeit 2. Oktober
Wann und warum ist eine Fluchtgeschichte traumatisierend? Traumatisiert arbeiten? Eingliederung von traumatisierten Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt Netzwerk InProcedere Bleiberecht durch Arbeit 2. Oktober
Persönlicher Umgang mit Wandel!
 Persönlicher Umgang mit Wandel! Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es anders wird; aber soviel kann ich sagen: es muss anders werden, wenn es gut werden soll. (Georg Christoph
Persönlicher Umgang mit Wandel! Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es anders wird; aber soviel kann ich sagen: es muss anders werden, wenn es gut werden soll. (Georg Christoph
Krisenintervention. Psychologische Gesprächsführung HS 2017 U N I V E R S I TÄT F R E I B U R G - D R. E S T H E R B I E D E R T
 Krisenintervention Psychologische Gesprächsführung HS 2017 Nicola Campagnolo, Tatjana F u chs, Dav id Re ichmuth, Smilla We isser U N I V E R S I TÄT F R E I B U R G - D R. E S T H E R B I E D E R T Was
Krisenintervention Psychologische Gesprächsführung HS 2017 Nicola Campagnolo, Tatjana F u chs, Dav id Re ichmuth, Smilla We isser U N I V E R S I TÄT F R E I B U R G - D R. E S T H E R B I E D E R T Was
Bewältigung einer seelischen Krise. nach Unglücksfällen, Katastrophen und anderen belastenden Ereignissen
 Bewältigung einer seelischen Krise nach Unglücksfällen, Katastrophen und anderen belastenden Ereignissen Erfahrungen Sie haben belastende Erlebnisse gehabt: Unglücksfälle, Katastrophen, Gewalterfahrungen
Bewältigung einer seelischen Krise nach Unglücksfällen, Katastrophen und anderen belastenden Ereignissen Erfahrungen Sie haben belastende Erlebnisse gehabt: Unglücksfälle, Katastrophen, Gewalterfahrungen
Krisenintervention bei Menschen mit geistiger Behinderung.
 Krisenintervention bei Menschen mit geistiger Behinderung www.berliner-krisendienst.de Inhalt Vorstellung Berliner Krisendienst (BKD) Krisenverständnis Möglichkeiten des BKD in der Arbeit mit Menschen
Krisenintervention bei Menschen mit geistiger Behinderung www.berliner-krisendienst.de Inhalt Vorstellung Berliner Krisendienst (BKD) Krisenverständnis Möglichkeiten des BKD in der Arbeit mit Menschen
Umgang mit Traumata: Begrüßung und Einführung in die Thematik aus Sicht des IfL
 Umgang mit Traumata: Begrüßung und Einführung in die Thematik aus Sicht des IfL 24. Januar 2017 Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Stephan Letzel Gliederung Beispiele für Traumata (u.a. aus der Sprechstunde
Umgang mit Traumata: Begrüßung und Einführung in die Thematik aus Sicht des IfL 24. Januar 2017 Univ.-Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Stephan Letzel Gliederung Beispiele für Traumata (u.a. aus der Sprechstunde
1. Fachtagung Lehrkräftegesundheit; Martin Titzck / Cor Coaching GmbH
 Welche Möglichkeiten der Intervention bieten sich an? 2 Anforderungs-Belastungs-Modell in der salutogenetischen Sichtweise Die Anforderungen, die nicht durch die Ressourcen abgedeckt sind, werden als Belastung
Welche Möglichkeiten der Intervention bieten sich an? 2 Anforderungs-Belastungs-Modell in der salutogenetischen Sichtweise Die Anforderungen, die nicht durch die Ressourcen abgedeckt sind, werden als Belastung
Emotionale Entwicklung
 Emotionale Entwicklung Die Entwicklung der emotionalen Kompetenz und ihre Bedeutung Die eigenen Gefühle verstehen, sie anderen erklären, Strategien entwickeln, wie negative Emotionen überwunden werden
Emotionale Entwicklung Die Entwicklung der emotionalen Kompetenz und ihre Bedeutung Die eigenen Gefühle verstehen, sie anderen erklären, Strategien entwickeln, wie negative Emotionen überwunden werden
Förderung psychosozialer Ressourcen durch sportliche Aktivität und ihre Bedeutung im Verlauf der Krankheitsbewältigung bei Krebs
 Institut für Sportwissenschaft der Eberhard Karls Universität Tübingen Förderung psychosozialer Ressourcen durch sportliche Aktivität und ihre Bedeutung im Verlauf der Krankheitsbewältigung bei Krebs Dr.
Institut für Sportwissenschaft der Eberhard Karls Universität Tübingen Förderung psychosozialer Ressourcen durch sportliche Aktivität und ihre Bedeutung im Verlauf der Krankheitsbewältigung bei Krebs Dr.
Brauche ich eine Trauerbegleitung?
 Brauche ich eine Trauerbegleitung? Nicht jeder Trauerende braucht eine professionelle Trauerbegleitung. Diese beiden Fragebögen wollen Ihnen eine Orientierung geben, ob in Ihrem Fall ein Erstkontakt mit
Brauche ich eine Trauerbegleitung? Nicht jeder Trauerende braucht eine professionelle Trauerbegleitung. Diese beiden Fragebögen wollen Ihnen eine Orientierung geben, ob in Ihrem Fall ein Erstkontakt mit
Suizidprävention im Alter Claudius Stein, Thomas Kapitany Kriseninterventionszentrum Wien
 Suizidprävention im Alter Claudius Stein, Thomas Kapitany Kriseninterventionszentrum Wien Die Entwicklungskrise des höheren Lebensalters (E.Erikson) Generativität und Integration Kränkung, Resignation
Suizidprävention im Alter Claudius Stein, Thomas Kapitany Kriseninterventionszentrum Wien Die Entwicklungskrise des höheren Lebensalters (E.Erikson) Generativität und Integration Kränkung, Resignation
Regionale Netzwerke zur Versorgung traumatisierter Flüchtlinge
 Regionale Netzwerke zur Versorgung traumatisierter Flüchtlinge Fachdienst Grundsatz- und Koordinierungsangelegenheiten Koordinierungsstelle zur Integrationsorientierten Aufnahme von Flüchtlingen (KiA)
Regionale Netzwerke zur Versorgung traumatisierter Flüchtlinge Fachdienst Grundsatz- und Koordinierungsangelegenheiten Koordinierungsstelle zur Integrationsorientierten Aufnahme von Flüchtlingen (KiA)
Aktivierung und Palliative Care. Bedeutung der Aktivierung im Bereich von Palliative Care
 Aktivierung und Palliative Care Bedeutung der Aktivierung im Bereich von Palliative Care Inhalte Definition Palliative Care Wunsch des Sterbeorts Versorgungsstruktur Interprofessionalität Total Pain Bedeutung
Aktivierung und Palliative Care Bedeutung der Aktivierung im Bereich von Palliative Care Inhalte Definition Palliative Care Wunsch des Sterbeorts Versorgungsstruktur Interprofessionalität Total Pain Bedeutung
Bewältigung einer seelischen Krise. nach Unglücksfällen, Katastrophen und anderen belastenden Ereignissen
 Bewältigung einer seelischen Krise nach Unglücksfällen, Katastrophen und anderen belastenden Ereignissen Nachsorge Nachsorge Na Erfahrungen Sie haben belastende Erlebnisse gehabt: Unglücksfälle, Katastrophen,
Bewältigung einer seelischen Krise nach Unglücksfällen, Katastrophen und anderen belastenden Ereignissen Nachsorge Nachsorge Na Erfahrungen Sie haben belastende Erlebnisse gehabt: Unglücksfälle, Katastrophen,
Das Geheimnis starker Menschen
 AKADEMIE E-MAIL-SEMINAR Das Geheimnis starker Menschen 7 Strategien für mehr Energie und Lebensqualität Leseprobe Resilienz: Sieben Schlüssel für innere Stärke im Alltag und wie Sie davon profitieren können
AKADEMIE E-MAIL-SEMINAR Das Geheimnis starker Menschen 7 Strategien für mehr Energie und Lebensqualität Leseprobe Resilienz: Sieben Schlüssel für innere Stärke im Alltag und wie Sie davon profitieren können
Nie mehr deprimiert. Endlich wieder Lebensfreude! Selbsthilfeprogramm zur Überwindung negativer Gefühle. Rolf Merkle.
 Nie mehr deprimiert ist ein Selbsthilfeprogramm. Es nutzt die Erkenntnisse der modernen Psychotherapie, insbesondere der kognitiven Therapie: Wer die Ursachen seiner depressiven Verstimmungen bewusst erkennt
Nie mehr deprimiert ist ein Selbsthilfeprogramm. Es nutzt die Erkenntnisse der modernen Psychotherapie, insbesondere der kognitiven Therapie: Wer die Ursachen seiner depressiven Verstimmungen bewusst erkennt
Familien stärken- Förderung von Resilienz
 Suchtvorbeugung Jugendsuchtberatung Familien stärken- Förderung von Resilienz Drogenberatung Monika Kaulke-Niermann Suchthilfeverbund Duisburg e.v. 1 Resilienz "resilience" dt. Spannkraft, Elastizität,
Suchtvorbeugung Jugendsuchtberatung Familien stärken- Förderung von Resilienz Drogenberatung Monika Kaulke-Niermann Suchthilfeverbund Duisburg e.v. 1 Resilienz "resilience" dt. Spannkraft, Elastizität,
Krankheitsbewältigung aus psychologischer Sicht
 Krankheitsbewältigung aus psychologischer Sicht U. Engst-Hastreiter Rehabilitationsklinik Wendelstein der BfA Rheumazentrum Bad Aibling Chronische Erkrankung Im Verlauf chronischer Erkrankungen und den
Krankheitsbewältigung aus psychologischer Sicht U. Engst-Hastreiter Rehabilitationsklinik Wendelstein der BfA Rheumazentrum Bad Aibling Chronische Erkrankung Im Verlauf chronischer Erkrankungen und den
Kindheit und Schulzeit 15. Rückzug und erste Krise 16. Erleichterung und Ratlosigkeit 18. Ausbruch und Zusammenbruch 20. Das Leben danach 22
 Vorwort 11 Eine Geschichte 14 Kindheit und Schulzeit 15 Rückzug und erste Krise 16 Erleichterung und Ratlosigkeit 18 Ausbruch und Zusammenbruch 20 Das Leben danach 22 Die Krankheit 25 Das zentrale schizophrene
Vorwort 11 Eine Geschichte 14 Kindheit und Schulzeit 15 Rückzug und erste Krise 16 Erleichterung und Ratlosigkeit 18 Ausbruch und Zusammenbruch 20 Das Leben danach 22 Die Krankheit 25 Das zentrale schizophrene
Fleherstraße Düsseldorf-Bilk Tel Fax
 Fleherstraße 1 40223 Düsseldorf-Bilk www.krebsberatungduesseldorf.de Tel. 0211-30 20 17 57 Fax. 0211-30 32 63 46 09.04.2014 Sabine Krebsgesellschaft Deiss - Krebsberatung NRW Düsseldorf Thema Psychoonkologische
Fleherstraße 1 40223 Düsseldorf-Bilk www.krebsberatungduesseldorf.de Tel. 0211-30 20 17 57 Fax. 0211-30 32 63 46 09.04.2014 Sabine Krebsgesellschaft Deiss - Krebsberatung NRW Düsseldorf Thema Psychoonkologische
Modul 4 Krisenbewältigung für Pflegende
 Modul 4 Krisenbewältigung für Pflegende - - Krise erkennen, einschätzen und begegnen - Krankenhausaufenthalt des Erkrankten oder des pflegenden Angehörigen - Umgang mit Aggression und Gewalt in der Pflege
Modul 4 Krisenbewältigung für Pflegende - - Krise erkennen, einschätzen und begegnen - Krankenhausaufenthalt des Erkrankten oder des pflegenden Angehörigen - Umgang mit Aggression und Gewalt in der Pflege
Psychiatrische Versorgung für traumatisierte Flüchtlinge
 Psychiatrische Versorgung für traumatisierte Flüchtlinge Dr. Michael Brune Psychiater haveno - Psychotherapie und interkulturelle Kommunikation - www.haveno.de Traumatisierte Flüchtlinge sind fast nie
Psychiatrische Versorgung für traumatisierte Flüchtlinge Dr. Michael Brune Psychiater haveno - Psychotherapie und interkulturelle Kommunikation - www.haveno.de Traumatisierte Flüchtlinge sind fast nie
eine Hochrisikopopulation: Biographien betroffener Persönlichkeiten
 Kinder psychisch kranker Eltern eine Hochrisikopopulation: p Biographien betroffener Persönlichkeiten Susanne Schlüter-Müller Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Fürstenbergerstr.
Kinder psychisch kranker Eltern eine Hochrisikopopulation: p Biographien betroffener Persönlichkeiten Susanne Schlüter-Müller Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Fürstenbergerstr.
Was bedeutet Erwachsen-Werden für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung heute?
 Was bedeutet Erwachsen-Werden für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung heute? 9. Dattelner Kinderschmerztage Im Team wirken 16. 18. März 2017 Prof. Dr. Jeanne Nicklas-Faust Bundesgeschäftsführerin Bundesvereinigung
Was bedeutet Erwachsen-Werden für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung heute? 9. Dattelner Kinderschmerztage Im Team wirken 16. 18. März 2017 Prof. Dr. Jeanne Nicklas-Faust Bundesgeschäftsführerin Bundesvereinigung
Soziale Kompetenzen als strategischer Erfolgsfaktor für Führungskräfte
 Europäische Hochschulschriften 3132 Soziale Kompetenzen als strategischer Erfolgsfaktor für Führungskräfte von Christine Scheitler 1. Auflage Soziale Kompetenzen als strategischer Erfolgsfaktor für Führungskräfte
Europäische Hochschulschriften 3132 Soziale Kompetenzen als strategischer Erfolgsfaktor für Führungskräfte von Christine Scheitler 1. Auflage Soziale Kompetenzen als strategischer Erfolgsfaktor für Führungskräfte
Inhalt. 3 Soziale und individuelle Vorstellungen von Krankheit und
 Einleitung 13 I Gesundheit und Krankheit in unserer Gesellschaft 17 1 Zum begrifflichen Verständnis von Gesundheit und Krankheit 18 1.1 Gesundheit und Krankheit als Dichotomie 18 1.2 Gesundheit und Krankheit
Einleitung 13 I Gesundheit und Krankheit in unserer Gesellschaft 17 1 Zum begrifflichen Verständnis von Gesundheit und Krankheit 18 1.1 Gesundheit und Krankheit als Dichotomie 18 1.2 Gesundheit und Krankheit
Universitätsklinikum Regensburg PSYCHOONKOLOGIE. Krebs und Psyche wie kann psychoonkologische Unterstützung helfen? Manja Girbig, Dipl.-Psych.
 PSYCHOONKOLOGIE Krebs und Psyche wie kann psychoonkologische Unterstützung helfen? Manja Girbig, Dipl.-Psych. Psycho - Onkologie Psychoonkologie ist ein Teilgebiet der Onkologie in der Behandlung von Patienten/innen
PSYCHOONKOLOGIE Krebs und Psyche wie kann psychoonkologische Unterstützung helfen? Manja Girbig, Dipl.-Psych. Psycho - Onkologie Psychoonkologie ist ein Teilgebiet der Onkologie in der Behandlung von Patienten/innen
Fragebogen KOMMUNIKATIONSVERHALTEN. Name:...
 Fragebogen KOMMUNIKATIONSVERHALTEN Name:... Seite 1 Fragebogen: Kommunikationsverhalten Der vorliegende Fragebogen soll Sie dabei unterstützen, Ihr persönliches Kommunikationsverhalten genauer zu erkennen
Fragebogen KOMMUNIKATIONSVERHALTEN Name:... Seite 1 Fragebogen: Kommunikationsverhalten Der vorliegende Fragebogen soll Sie dabei unterstützen, Ihr persönliches Kommunikationsverhalten genauer zu erkennen
Danach ist nichts mehr wie es war
 Danach ist nichts mehr wie es war -tische Erlebnisse und ihre Folgen- Dipl.Psych. Claudia Radermacher-Lamberty Caritas Familienberatung Reumontstraße 7a 52064 Aachen el.: 0241 /3 39 53 Auswirkungen auf
Danach ist nichts mehr wie es war -tische Erlebnisse und ihre Folgen- Dipl.Psych. Claudia Radermacher-Lamberty Caritas Familienberatung Reumontstraße 7a 52064 Aachen el.: 0241 /3 39 53 Auswirkungen auf
Die Beeinträchtigung des Kindeswohls durch elterliche Partnerschaftsgewalt
 Die Beeinträchtigung des Kindeswohls durch elterliche Partnerschaftsgewalt Kindliches Miterleben elterlicher Partnerschaftsgewalt und die langfristigen Folgen Marion Ernst, Dipl.-Soziologin Koordinierungsstelle
Die Beeinträchtigung des Kindeswohls durch elterliche Partnerschaftsgewalt Kindliches Miterleben elterlicher Partnerschaftsgewalt und die langfristigen Folgen Marion Ernst, Dipl.-Soziologin Koordinierungsstelle
Veränderte Kindheit? Wie beeinflusst der aktuelle Lebensstil die psychische Gesundheit von Kindern?
 Tag der Psychologie 2013 Lebensstilerkrankungen 1 Veränderte Kindheit? Wie beeinflusst der aktuelle Lebensstil die psychische Gesundheit von Kindern? 2 Überblick Lebensstilerkrankungen bei Kindern Psychische
Tag der Psychologie 2013 Lebensstilerkrankungen 1 Veränderte Kindheit? Wie beeinflusst der aktuelle Lebensstil die psychische Gesundheit von Kindern? 2 Überblick Lebensstilerkrankungen bei Kindern Psychische
Jahrestagung Deviantes oder delinquentes Verhalten. Wann fängt es an und wie gehen wir professionell damit um?
 Jahrestagung Deviantes oder delinquentes Verhalten Wann fängt es an und wie gehen wir professionell damit um? Aufbau Teil 1: Neurobiologische Voraussetzungen, die das Entstehen von Delinquenz begünstigen.
Jahrestagung Deviantes oder delinquentes Verhalten Wann fängt es an und wie gehen wir professionell damit um? Aufbau Teil 1: Neurobiologische Voraussetzungen, die das Entstehen von Delinquenz begünstigen.
1. Einleitung Was Klienten in Krisen hilft oder die Suche nach Ressourcen 13 Die Richtige Mixtur 15
 Inhalt 1. Einleitung 11 2. Was Klienten in Krisen hilft oder die Suche nach Ressourcen 13 Die Richtige Mixtur 15 I. Teil Krisenkompetenz und Ressourcenaktivierung 17 3. Kompetenzen der Klienten entdecken
Inhalt 1. Einleitung 11 2. Was Klienten in Krisen hilft oder die Suche nach Ressourcen 13 Die Richtige Mixtur 15 I. Teil Krisenkompetenz und Ressourcenaktivierung 17 3. Kompetenzen der Klienten entdecken
Psychoonkologische Versorgung auf der Palliativstation
 Psychoonkologische Versorgung auf der Palliativstation Wer an Krebs erkrankt, leidet nicht nur körperlich Jessica Dietrich Psychoonkologin der Palliativstation Kloster Lehnin Anspruch der Palliativversorgung
Psychoonkologische Versorgung auf der Palliativstation Wer an Krebs erkrankt, leidet nicht nur körperlich Jessica Dietrich Psychoonkologin der Palliativstation Kloster Lehnin Anspruch der Palliativversorgung
Missbrauch und Life - events
 Missbrauch und Life - events Gertrude Bogyi, Petra Sackl-Pammer, Sabine Völkl-Kernstock Curriculumdirektion Humanmedizin Medizinische Missbrauch und Life events Missbrauch an Kindern und Jugendlichen kann
Missbrauch und Life - events Gertrude Bogyi, Petra Sackl-Pammer, Sabine Völkl-Kernstock Curriculumdirektion Humanmedizin Medizinische Missbrauch und Life events Missbrauch an Kindern und Jugendlichen kann
Hintergrundwissen Trauma. E. L. Iskenius, Rostock
 Hintergrundwissen Trauma E. L. Iskenius, Rostock Wichtig!!! Zunächst den Menschen mit all seinen Fähigkeiten, auch zum Überleben, seinen Ressourcen und seinen Stärken begegnen. Reaktionen auf das Trauma
Hintergrundwissen Trauma E. L. Iskenius, Rostock Wichtig!!! Zunächst den Menschen mit all seinen Fähigkeiten, auch zum Überleben, seinen Ressourcen und seinen Stärken begegnen. Reaktionen auf das Trauma
Krebs gemeinsam bewältigen
 Dipl.-Psych. Dr. Katja Geuenich Krebs gemeinsam bewältigen Wie Angehörige durch Achtsamkeit Ressourcen stärken Mit einem Geleitwort von Monika Keller Zusätzlich online: Ausdruckbare Übungsbögen Die Übungsbögen
Dipl.-Psych. Dr. Katja Geuenich Krebs gemeinsam bewältigen Wie Angehörige durch Achtsamkeit Ressourcen stärken Mit einem Geleitwort von Monika Keller Zusätzlich online: Ausdruckbare Übungsbögen Die Übungsbögen
Affektive Verarbeitung
 Affektive Verarbeitung IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 1 Kognitive Schemata Die relevanten, problematischen Schemata, die es zu bearbeiten gibt, können kognitive Schemata sein, wie Überzeugungen, Konstruktionen
Affektive Verarbeitung IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 1 Kognitive Schemata Die relevanten, problematischen Schemata, die es zu bearbeiten gibt, können kognitive Schemata sein, wie Überzeugungen, Konstruktionen
Psychologische Grundlagen
 Psychologische Grundlagen Unfallkrankenhaus Berlin, Psychotraumatologie, Dipl.-Psych. Annette Brink Seite 1 I. Psychische Belastungen nach traumatischer Amputation II. Rollenverständnis Peer im Krankenhaus
Psychologische Grundlagen Unfallkrankenhaus Berlin, Psychotraumatologie, Dipl.-Psych. Annette Brink Seite 1 I. Psychische Belastungen nach traumatischer Amputation II. Rollenverständnis Peer im Krankenhaus
Der Labeling Approach
 Geisteswissenschaft Feryal Kor Der Labeling Approach Studienarbeit 1. Einleitung In jeglichen Gesellschaftsformen leben die unterschiedlichsten Individuen, welche vielfältige und unterschiedliche Verhaltensweisen
Geisteswissenschaft Feryal Kor Der Labeling Approach Studienarbeit 1. Einleitung In jeglichen Gesellschaftsformen leben die unterschiedlichsten Individuen, welche vielfältige und unterschiedliche Verhaltensweisen
Recovery: Wie werden psychisch kranke Menschen eigentlich wieder gesund?
 Recovery: Wie werden psychisch kranke Menschen eigentlich wieder gesund? 22. Treffen der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen im Landkreis Esslingen 13. November 2010, Esslingen Andreas Knuf www.gesundungswege.de
Recovery: Wie werden psychisch kranke Menschen eigentlich wieder gesund? 22. Treffen der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen im Landkreis Esslingen 13. November 2010, Esslingen Andreas Knuf www.gesundungswege.de
Referentin: Elisabeth Nüßlein, Dipl. Sozialpädagogin, ausgebildete Trauerbegleiterin, Referentin für Hospizarbeit, Gruppentherapeutin
 Referentin: Elisabeth Nüßlein, Dipl. Sozialpädagogin, ausgebildete Trauerbegleiterin, Referentin für Hospizarbeit, Gruppentherapeutin Gesellschaftliche Rahmenbedingungen Definition von Trauer Psychische
Referentin: Elisabeth Nüßlein, Dipl. Sozialpädagogin, ausgebildete Trauerbegleiterin, Referentin für Hospizarbeit, Gruppentherapeutin Gesellschaftliche Rahmenbedingungen Definition von Trauer Psychische
UMGANG MIT PSYCHISCHER BEEINTRÄCHTIGUNG IN DER SCHULE. z.b bei traumatisierten Flüchtlingen
 UMGANG MIT PSYCHISCHER BEEINTRÄCHTIGUNG IN DER SCHULE z.b bei traumatisierten Flüchtlingen Inhalt Traumapädagogik Traumabekämpfung in der Schule Migration Flüchtlinge Flüchtlinge in der Schule Traumapädagogik
UMGANG MIT PSYCHISCHER BEEINTRÄCHTIGUNG IN DER SCHULE z.b bei traumatisierten Flüchtlingen Inhalt Traumapädagogik Traumabekämpfung in der Schule Migration Flüchtlinge Flüchtlinge in der Schule Traumapädagogik
Wie gehen (ältere) Menschen mit Veränderungen um?
 Wie gehen (ältere) Menschen mit Veränderungen um? Zürcher Migrationskonferenz 2015: «Offene Jugend, skeptisches Alter?» 17. September 2015 Hans Rudolf Schelling, Zentrum für Gerontologie UZH Inhalt Wie
Wie gehen (ältere) Menschen mit Veränderungen um? Zürcher Migrationskonferenz 2015: «Offene Jugend, skeptisches Alter?» 17. September 2015 Hans Rudolf Schelling, Zentrum für Gerontologie UZH Inhalt Wie
Lassen sich Lebensqualität und Behinderung überhaupt miteinander vereinbaren?
 Lassen sich Lebensqualität und Behinderung überhaupt miteinander vereinbaren? SZH-Kongress Pierre Margot-Cattin Seite 1 SZH 1 2013 - P. Margot-Cattin Lebensqualität Gutes Leben? Wohlbefinden? Lebensqualität:
Lassen sich Lebensqualität und Behinderung überhaupt miteinander vereinbaren? SZH-Kongress Pierre Margot-Cattin Seite 1 SZH 1 2013 - P. Margot-Cattin Lebensqualität Gutes Leben? Wohlbefinden? Lebensqualität:
