6 Diverse physikalische Eigenschaften fester Kunststoffe
|
|
|
- Theresa Armbruster
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 6 Diverse physikalische Eigenschaften fester Kunststoffe 6.1 Thermische Eigenschaften 6.2 Elektrische Eigenschaften 6.3 Optische Eigenschaften 6.4 Akustische Eigenschaften 6.5 Diffusions- und Permeationseigenschaften
2 Wärmeausdehnung Allgemeine Aussagen zur Wärmeausdehnung: Der Wärmeausdehnungskoeffizient α ist im Anwendungstemperaturbereich von Kunststoffen nahezu konstant Größenordnung: 0,00015 bis 0,0002 / K Er wird durch Füllstoffe i. allg. verringert Bild 8.7 Menges, S. 196 Wärmeausdehnung von Metallen und Kunststoffen bei 20 C Quelle: Menges, G.: Werkstoffkunde 6.1 Thermische Eigenschaften
3 Wärmeleitfähigkeit Def.: Die Wärmeleitfähigkeit ist ein Maß für die Fähigkeit eines Stoffes, bei vorgegebenen Temperaturgefällen Wärmeströme zu transportieren. Def.: Die Wärmeleitzahl λ gibt diejenige Wärmemenge in Joule an, die in einer bestimmten Zeit durch einen Körper mit definiertem Querschnitt hindurchgeht, wenn ein Temperaturgefälle von 1 K vorliegt. Einheit: W/ m K λ c p c p ρ u l KWärmekapazität ρkdichte ukgeschwindigkeit der elastischen Wellen lkabstand der Moleküle Allgemeine Aussagen zur Wärmeleitfähigkeit: Teilkristalline K. haben im festen Zustand eine höhere W. als amorphe K. (höhere Dichte) Die W. steigt mit zunehmendem Druck Füllstoffe mit höherer W. verbessern die W. des Gesamtsystems Duroplaste verhalten sich prinzipiell wie amorphe K. Quellen: Menges, G.: Werkstoffkunde; Wortberg, J.: Qualitätssicherung 6.1 Thermische Eigenschaften
4 Wärmeleitfähigkeit Bild 8.1 Menges, S. 191 Bild 8.2 Menges, S. 192 Wärmeleitfähigkeit im Vergleich mit metallischen Werkstoffen Wärmeleitfähigkeit verschiedener Thermoplaste Quelle: Menges, G.: Werkstoffkunde 6.1 Thermische Eigenschaften
5 Wärmeleitfähigkeit - Einfluß von Modifikationen und Randbedingungen - Bild 8.3 Menges, S. 193 Änderung der Wärmeleitfähigkeit bei steigendem Druck Quelle: Menges, G.: Werkstoffkunde 6.1 Thermische Eigenschaften
6 6.1 Thermische Eigenschaften Wärmeleitfähigkeit - Einfluß von Modifikationen und Randbedingungen - Bild 8.5 Menges, S. 193 Einfluß von Füllstoffen auf die Wärmeleitfähigkeit Quelle: Menges, G.: Werkstoffkunde VolumenanteildesFüllstoffes WärmeleitfähigkeitdesFüllstoffes λ WärmeleitfähigkeitderMatrix λ WärmeleitfähigkeitdesGemisches λ ) ( 2 2 ) ( 2 2 F F H M K K K L ϕ λ λ λ ϕ λ λ λ λ ϕ λ λ λ H F H F F H F H F F H M = Mischungsregel nach Knappe:
7 Spezifische Wärme/ Spezifische Wärmekapazität Def.: Die Spezifische Wärme ist die Energie, die einem Kilogramm eines Stoffes zugeführt werden muß, um eine Temperaturerhöhung von 1 C zu erzielen. Einheit: J/ kg K c p c p Δh = ΔT p KWärmekapazität Allgemeine Aussagen zur Spezifischen Wärme: Die S.W. ist temperaturabhängig, sie ändert sich im Gebrauchstemperaturbereich der Kunststoffe aber nur wenig Teilkristalline Werkstoffe besitzen eine Unstetigkeitsstelle im Kristallitschmelzbereich auf Duroplast gleichen im ausgehärteten Zustand den amorphen Thermoplasten; der Aushärtvorgang ist mit Veränderung der S.W. verbunden Mit der S.W. kann die Energie abgeschätzt werden, der für die Erwärmung benötigt wird, bzw. bei der Abkühlung abgeführt werden muß Die S.W. steht in engem Zusammenhang mit der Beweglichkeit der Makromoleküle (unter konstantem Druck) hkenthalpie TKTemperatur Quellen: Menges, G.: Werkstoffkunde; Wortberg, J.: Qualitätssicherung 6.1 Thermische Eigenschaften
8 Spezifische Wärme/ Spezifische Wärmekapazität - Qualitative Darstellung - Bild 6.56 Wortberg, S. 226 Quelle: Wortberg, J.: Qualitätssicherung 6.1 Thermische Eigenschaften
9 Temperaturleitfähigkeit Temperaturleitfähigkeit: Verhältnis von Wärmeleitfähigkeit zu Wärmespeicherfähigkeit Von Bedeutung bei instationären Wärmeleitvorgängen b = λ c ρ bkwärmeeindringzahl ba TA + bb TB Tk = ba bb Tk KKontakttemperatur TA,TB KTemperatur von Körper A und B b, b KWärmeeindringzahl von Körper A und B A a = c p ρ KDichte λkwärmeleitfähigkeit B λ ρ KWärmekapazität p c p Bild 8.8 Menges, S. 197 Temperaturleitfähigkeit in Abhängigkeit der Temperatur für teilkristalline Werkstoffe Quelle: Menges, G.: Werkstoffkunde 6.1 Thermische Eigenschaften
10 Temperaturleitfähigkeit Allgemeine Aussagen zur Temperaturleitfähigkeit a: Sie bestimmt den zeitlichen Ablauf von Wärmeausbreitungsvorgängen Sie hat bei teilkristallinen Werkstoffen eine Unstetigkeit am Schmelzpunkt Sie wird durch den Kristallisationsgrad beeinflußt (damit auch von der Abkühlgeschwindigkeit etc.) λ a = b = λ c p ρ ρ c p bkwärmeeindringzahl c p KWärmekapazität ba TA + bb TB Tk = ρkdichte ba bb λkwärmeleitfähigkeit Tk KKontakttemperatur TA,TB KTemperatur von Körper A und B b, b KWärmeeindringzahl von Körper A und B A B Verhältnis von Wärmeleitfähigkeit zu Wärmespeicherfähigkeit Bild 8.8 Menges, S. 197 Temperaturleitfähigkeit in Abhängigkeit der Temperatur für teilkristalline Werkstoffe Quelle: Menges, G.: Werkstoffkunde 6.1 Thermische Eigenschaften
11 Effektive Temperaturleitfähigkeit a eff Die Ermittlung der Temperaturleitfähigkeit ist mit großen Fehlerquellen behaftet. Daher wird oft die effektive Temperaturleitfähigkeit verwendet. Diese wird in praktischen Versuchen (z.b. Spritzgießversuche) ermittelt, so dass Randbedingungen wie der Wärmeübergang zum Werkzeug berücksichtigt werden können. Beipiele für Werte: Quelle: Menges, G.: Werkstoffkunde 6.1 Thermische Eigenschaften
12 Elektrische Eigenschaften von Kunststoffen im Überblick Ohne Füllstoffe/Zusatzstoffe sind Kunststoffe im allgemeinen Nichtleiter ABER: Umgebungseinflüsse, Verarbeitung, Füllstoffe, Verschmutzung etc. können die elektrischen Eigenschaften verändern. Die wichtigsten elektrischen Eigenschaften sind: Elektrischer Widerstand Elektrostatische Aufladung spezieller Durchgangswiderstand Oberflächenwiderstand Durchschlagfestigkeit Dielektrisches Verhalten relative Dielektrizitätszahl dielektrischer Verlustfaktor 6.2 Elektrische Eigenschaften
13 Elektrischer Widerstand von Kunststoffen U R = I Kunststoffe weisen eine um mehrere 10er-Potenzen geringere Leitfähigkeit als metallische Werkstoffe auf es fehlen die freien Ladungsträger (Ionen/ freie Elektronen); lediglich einige niedermolekulare Gruppen wirken als Ladungsträger Spezifischer Durchgangswiderstand U R = I = ρ d d A d...dicke der Probe A...Fläche der Probe Durchgangswiderstand eines Würfels mit der Kantenlänge 1 cm! Ungünstige elektrostatische Eigenschaften! (Aufladen) Oberflächenwiderstand Widerstand auf der Oberfläche des Werkstücks Wird stark durch Umweltbedingungen wie Verunreinigungen, Feuchtigkeit, etc. beeinflußt Durch Erhöhung der Leitfähigkeit der Oberfläche (z.b. Antistatika) können die elektrostatischen Eigenschaften verbessert werden. 6.2 Elektrische Eigenschaften
14 Spezifischer Widerstand von Kunststoffen und Metallen Der spezifische Widerstand von Kunststoffen ist mehrere 10er Potenzen höher als der von Metallen Er ist stark temperaturabhängig 6.2 Elektrische Eigenschaften
15 Beeinflussung des elektrischen Widerstandes durch Füllstoffe Spezifischer Durchgangswiderstand in Abhängigkeit der Polymer-/Ruß-Mischung 6.2 Elektrische Eigenschaften
16 Beeinflussung des elektrischen Widerstandes durch Füllstoffe Widerstand eines mit Metallpulver gefüllten Kunststoffs 6.2 Elektrische Eigenschaften
17 Durchschlagfestigkeit Die Durchschlagfestigkeit bestimmt die elektrische Belastungsfähigkeit Temperatur Probendichte Probenzustand (z.b. Feuchtigkeit, Alterung) Maximale Durchschlagspannung (Wechselspannung) [V/mm] Durchschlagen des Formteils Belastungsgeschwindigkeiten Frequenz Einwirkdauer Fehlstellen Lunker Poren Verunreinigungen Sphärolitgrenzen Die Durchschlagfestigkeit wird gemessen wenn: entscheidende Größen für die Anwendung des Bauteils (Stecker, etc.) zur allgemeinen Materialcharakterisierung (Verunreinigungen, Feuchtigkeit, etc.) Quelle: Wortberg, J.: Qualitätssicherung 6.2 Elektrische Eigenschaften
18 Elektrostatische Aufladung Ladungsverschiebung (z.b. durch Reibung), die längere Zeit aufrecht erhalten bleibt Grund: niedrige Leitfähigkeit in Probeteil und an der Oberfläche die Ladung kann schlecht an die Luft oder an andere Körper abgegeben werden Faustregel: Durchgangswiderstand > Ω Verwendung von Antistatica Hohe Anfälligkeit für elektrostatische Aufladung Probleme: Verarbeitbarkeit Optische Beeinträchtigung Entzündungsgefahr durch Funkenentladung hydrophile Moleküle, die die Oberflächenfeuchtigkeit erhöhen 6.2 Elektrische Eigenschaften
19 Dielektrisches Verhalten Weil Kunststoffe nur sehr wenige freie Ladungsträger besitzen, haben sie dielektrische Eigenschaften die gebundenen Ladungen werden durch ein elektrisches Feld verschoben oder verdreht daraus entsteht eine Polarisation man unterscheidet Elektronen-, Atom- und Dipolpolarisation
20 Dielektrisches Verhalten Unterschied zwischen freien und gebundenen Ladungen im elektrischen Feld (schematisch) Quelle: Menges, G.: Werkstoffkunde
21 Dielektrisches Verhalten Aufgrund des Relaxationsverhaltens hängt die Polarisation im Wechselfeld von der Frequenz ab (insbesondere Dipolpolarisation) Verlauf von Spannung und Strom im Kondensator Es ergibt sich ein dielektrischer Verlust, weshalb der Verlauf für den Strom um den Verlustwinkel δ verzögert ist. Quelle: Menges, G.: Werkstoffkunde
22 Dielektrischer Verlustfaktor tan δ Dielektrisches Verhalten ε r = ε r + i ε r ε r tanδ = ε r Wärmequellterm ε r... Realteil der Dielektrizitätszahl ε r... Imaginärteil, d.h. Verlustanteil >10-2 -> Verlustfaktor technisch von Bedeutung als Wärmequelle tan δ ist das Verhältnis von Wirk- zu Blindleistung eines Kondensators Einflußgrößen: Feldstärke Werkstoff Temperatur Frequenz
23 Dielektrisches Verhalten Quelle: Ruge, Wohlfahrt: Technologie der Werkstoffe
24 Dielektrisches Verhalten - Einflußgrößen auf das dielektrische Verlustverhaltenε 0 ε ω λ Nach Debye gilt: tanδ = ε + ε ω λ 0 Materialeinfluß Temperatureinfluß Frequenzeinfluß ε 0...Dielektrizitätskonstante bei unendlicher Frequenz ε...dielektrizitätskonstante bei Frequenz 0 λ...relaxationszeit ω...kreisfrequenz ω = 2 π f Hohe Verluste unerwünscht Isolatoren Insbesondere Hochfrequenztechnik ε r tan δ < 10-3 Hohe Verluste erwünscht Schweißen mit HF/MW Zuführung von Energie zur Erwärmung ε r tan δ > Elektrische Eigenschaften
25 Magnetisierbarkeit Die Magnetisierbarkeit eines Stoffes in einem Magnetfeld mit der Felstärke H wird durch die magnetische Suszeptibilität χ vermittelt. Beispiele: Tonband Disketten Kühlschrankmagnet M = χ H M ist sehr klein für Kunststoffe Die Magnetisierbarkeit kann durch magnetische Füllstoffe verbessert werden. 6.2 Elektrische Eigenschaften
26 Lichtbrechung Brechungsindex n = sin α/ sin β n = c 0 / c n = f (T, λ) mit n 1 mit n 2 β α α... Einfallwinkel β... Brechungswinkel c 0... Lichtgeschwindigkeit im Vakuum c... Lichtgeschwindigkeit in einem dichteren Medium λ... Wellenlänge des Lichtes Lichtausbreitung in zwei Körpern und, n 2 > n 1, d. h. Körper ist optisch dichter als 6.3 Optische Eigenschaften
27 Lichtbrechung - Einfluß der Temperatur auf die Lichtbrechung Optische Eigenschaften
28 Lichtbrechung - Einfluß der Wellenlänge auf die Lichtbrechung - < 400 nm... UV-Bereich > 800 nm... IR-Bereich Anwendung Flintglas Anwendung Quarzglas blau rot 6.3 Optische Eigenschaften Anwendung Acrylglas
29 Reflexion Absorption - Transmission Ein von einem Lichtstrahl getroffener Körper wird einen Teil des Lichtstrahles reflektieren und einen Teil transmittieren. Anm. zum Bild: Senkrechter Lichteinfall und Vielfachreflexion in auseinandergezogener Darstellung. 6.3 Optische Eigenschaften
30 Reflexion Absorption - Transmission Reflexionsgrad ρ = Reflexion/ Einstrahlung Absorptionsgrad α = Absorption/ Einstrahlung Transmissionsgrad τ = Durchstrahlung/ Einstrahlung Lambertsches Absorptionsgesetz: ρ + α + τ = Optische Eigenschaften
31 Reflexion Absorption - Transmission Durch spezielle Pigmentierung oder Zusatzstoffe können die optischen Eigenschaften eingestellt werden. 6.3 Optische Eigenschaften
32 Lichtremission - Glanzeigenschaften Glänzende Oberfläche Matte Oberfläche 6.3 Optische Eigenschaften
33 Farbeigenschaften Objekt Lichtquelle Licht mit bestimmter spektraler Verteilung Das transmittierte oder das reflektierte Licht wird vom Auge als Farbreiz wahrgenommen! Absorption Transmission Reflexion 6.3 Optische Eigenschaften
34 Farbeigenschaften - Problemstellung bei Kunststoffprodukten - Chargenschwankungen Pigmentveränderung durch Scherung/ Temperatureinwirkung Inhomogene Dispergierung der Pigmente Verfärbungen durch Alterung/ UV-Betrahlung Veränderung des Farbeindrucks durch unterschiedliche Beleuchtung Quelle: Wortberg, J.: Qualitätssicherung 6.3 Optische Eigenschaften
35 Schalldämmung und Schalldämpfung Schalldämmung = Reflexion r möglichst groß Z 2 > Z 1 Maximale Reflexion kann durch z. B. eine schwere Wand mit maximalem Wellenwiderstand erreicht werden Medium 1 Medium 2 e d r Schalldämpfung = Absorption r möglichst klein Z 2 Z 1 Umwandlung von Luftschall in Wärme, z. B. Schaumstoff: Z schaum Z luft Dämpfung von Körperschall durch innere Verluste im Dämpfer, z. B. Elastomer e... einfallende Schallwelle d... durchgelassene Schallwelle r... reflektierte Schallwelle Medium 1 besitzt Impedanz Z 1 Medium 2 besitzt Impedanz Z 2 > Z 1 r = Z Z 2 2 Z + Z 1 1 Anm.: Z = Impedanz = Wellenwiderstand (Z in Luft klein, Z einer Betonwand groß) 6.4 Akustische Eigenschaften
36 Schallausbreitung Eine Longitudinalwelle schwingt in Ausbreitungsrichtung. Sie benötigt immer ein Medium, um sich fortzubewegen. Beispiel: Schall in Luft Eine Transversalwelle ist eine Welle, bei der die Schwingung senkrecht zu ihrer Ausbreitungsrichtung erfolgt. Nicht immer an ein Medium gebunden. Beispiel: Schall im Festkörper Dehnwellen sind eine Kombination aus Transversalwelle und Longitudinalwelle. Beispiel: Schall in Wasser, in Stäben
37 Modul und Schallgeschwindigkeit in Abhängigkeit bei verschiedenen Phasenzuständen Identische Longitudinalwellen für Glaszustand und gummielastischen Zustand Dehn- und Transversalwellengeschwindigkeiten sind im Glaszustand wesentlich größer 6.4 Akustische Eigenschaften
38 Schallgeschwindigkeit in einigen Kunststoffen in Abhängigkeit vom Druck Die Schallgeschwindigkeit ist vergleichbar mit der in Flüssigkeiten. ABER: Aufgrund der Dämpfung nimmt die Amplitude schneller ab! 6.4 Akustische Eigenschaften
39 Schallgeschwindigkeit in einigen Kunststoffen in Abhängigkeit von der Temperatur 6.4 Akustische Eigenschaften
40 Dämpfung verschiedener Werkstoffe 6.4 Akustische Eigenschaften
41 Abgrenzung und Begriffsbestimmungen für Stofftransportvorgänge Adsorption Anlagerung und Aufnahme des diffundierenden Stoffes in die Grenzflächen Diffusion Transport innerhalb eines Stoffes Desorption Abgabe des diffundierenden Stoffes an die Umgebung Chemiesorption Adsorption mit chemischen Verbindungen, nicht reversibel (desorbierte Substanz hat einen anderen chemischen Aufbau als die adsorbierte) Absorption Lösung im Feststoff (eindringende Gase in Flüssigkeiten oder Feststoffe werden dort gelöst, anstatt nur allein an die Oberfläche gebunden zu werden) Permeation Molekularer Stofftransport eines Gases durch eine Membran (Trennwand, die dem Durchtritt verschiedener Stoffe einen unterschiedlichen Widerstand entgegensetzt) 6.5 Diffusions- und Permeationseigenschaften
42 Sauerstoff- und Wasserdampfdurchlässigkeit von 25-µm-Folien aus verschiedenen Thermoplasten 6.5 Diffusions- und Permeationseigenschaften
43 6.5 Diffusions- und Permeationseigenschaften Permeation von Wasserdampf durch Kunststofffolien in Abhängigkeit von der Temperatur
44 6.5 Diffusions- und Permeationseigenschaften Permeation von Stickstoff durch PE- Folien verschiedener Dichte in Abhängigkeit von der Temperatur
45
Basiskenntnistest - Physik
 Basiskenntnistest - Physik 1.) Welche der folgenden Einheiten ist keine Basiseinheit des Internationalen Einheitensystems? a. ) Kilogramm b. ) Sekunde c. ) Kelvin d. ) Volt e. ) Candela 2.) Die Schallgeschwindigkeit
Basiskenntnistest - Physik 1.) Welche der folgenden Einheiten ist keine Basiseinheit des Internationalen Einheitensystems? a. ) Kilogramm b. ) Sekunde c. ) Kelvin d. ) Volt e. ) Candela 2.) Die Schallgeschwindigkeit
Inhalt dieses Vorlesungsteils - ROADMAP
 Inhalt dieses Vorlesungsteils - ROADMAP 2 Von der Kavitation zur Sonochemie 21 Industrieller Einsatz von Ultraschall 22 Physikalische Grundlagen I Was ist Ultraschall? 23 Einführung in die Technik des
Inhalt dieses Vorlesungsteils - ROADMAP 2 Von der Kavitation zur Sonochemie 21 Industrieller Einsatz von Ultraschall 22 Physikalische Grundlagen I Was ist Ultraschall? 23 Einführung in die Technik des
Elektromagnetische Felder und Wellen. Klausur Herbst Aufgabe 1 (5 Punkte) Aufgabe 2 (3 Punkte) Aufgabe 3 (5 Punkte) Aufgabe 4 (12 Punkte) Kern
 Elektromagnetische Felder und Wellen Klausur Herbst 2000 Aufgabe 1 (5 Punkte) Ein magnetischer Dipol hat das Moment m = m e z. Wie groß ist Feld B auf der z- Achse bei z = a, wenn sich der Dipol auf der
Elektromagnetische Felder und Wellen Klausur Herbst 2000 Aufgabe 1 (5 Punkte) Ein magnetischer Dipol hat das Moment m = m e z. Wie groß ist Feld B auf der z- Achse bei z = a, wenn sich der Dipol auf der
Elektromagnetische Felder und Wellen: Klausur
 Elektromagnetische Felder und Wellen: Klausur 2012-2 Aufgabe 1: Aufgabe 2: Aufgabe 3: Aufgabe 4: Aufgabe 5: Aufgabe 6: Aufgabe 7: Aufgabe 8: Aufgabe 9: Aufgabe 10: Aufgabe 11: Aufgabe 12: Aufgabe 13: Aufgabe
Elektromagnetische Felder und Wellen: Klausur 2012-2 Aufgabe 1: Aufgabe 2: Aufgabe 3: Aufgabe 4: Aufgabe 5: Aufgabe 6: Aufgabe 7: Aufgabe 8: Aufgabe 9: Aufgabe 10: Aufgabe 11: Aufgabe 12: Aufgabe 13: Aufgabe
Elektrizitätslehre 2.
 Elektrizitätslehre. Energieumwandlung (Arbeit) im elektrischen Feld Bewegung einer Ladung gegen die Feldstärke: E s Endposition s Anfangsposition g W F Hub s r F Hub r Fq FHub Eq W qes W ist unabhängig
Elektrizitätslehre. Energieumwandlung (Arbeit) im elektrischen Feld Bewegung einer Ladung gegen die Feldstärke: E s Endposition s Anfangsposition g W F Hub s r F Hub r Fq FHub Eq W qes W ist unabhängig
λ = c f . c ist die Es gilt die Formel
 Elektromagnetische Wellen, deren Wellenlänge viel größer als der Durchmesser der Gitterlöcher ist (z.b. die Mikrowellen), können das Metallgitter nicht passieren. Ist die Wellenlänge wie bei Licht dagegen
Elektromagnetische Wellen, deren Wellenlänge viel größer als der Durchmesser der Gitterlöcher ist (z.b. die Mikrowellen), können das Metallgitter nicht passieren. Ist die Wellenlänge wie bei Licht dagegen
Elektromagnetische Felder und Wellen: Klausur
 Elektromagnetische Felder und Wellen: Klausur 2009-2 Name : Vorname : Matrikelnummer : Aufgabe 1: Aufgabe 2: Aufgabe 3: Aufgabe 4: Aufgabe 5: Aufgabe 6: Aufgabe 7: Aufgabe 8: Aufgabe 9: Aufgabe 10: Aufgabe
Elektromagnetische Felder und Wellen: Klausur 2009-2 Name : Vorname : Matrikelnummer : Aufgabe 1: Aufgabe 2: Aufgabe 3: Aufgabe 4: Aufgabe 5: Aufgabe 6: Aufgabe 7: Aufgabe 8: Aufgabe 9: Aufgabe 10: Aufgabe
Vorlesung Messtechnik 2. Hälfte des Semesters Dr. H. Chaves
 Vorlesung Messtechnik 2. Hälfte des Semesters Dr. H. Chaves 1. Einleitung 2. Optische Grundbegriffe 3. Optische Meßverfahren 3.1 Grundlagen dρ 3.2 Interferometrie, ρ(x,y), dx (x,y) 3.3 Laser-Doppler-Velozimetrie
Vorlesung Messtechnik 2. Hälfte des Semesters Dr. H. Chaves 1. Einleitung 2. Optische Grundbegriffe 3. Optische Meßverfahren 3.1 Grundlagen dρ 3.2 Interferometrie, ρ(x,y), dx (x,y) 3.3 Laser-Doppler-Velozimetrie
8. Reines Ethanol besitzt eine Dichte von ρ = 0,79 g/cm³. Welches Volumen V Ethanol ist erforderlich, um eine Masse von m = 158g Ethanol zu erhalten?
 Staatliche Schule für technische Assistenten in der Medizin Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Testklausur Physik 1. 10 2 10 3 =... 2. 4 10 3 2 10 3=... 3. 10 4 m= cm 4.
Staatliche Schule für technische Assistenten in der Medizin Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main Testklausur Physik 1. 10 2 10 3 =... 2. 4 10 3 2 10 3=... 3. 10 4 m= cm 4.
Elektrische Schwingungen und Wellen
 Einführung in die Physik II für Studierende der Naturwissenschaften und Zahnheilkunde Sommersemester 2007 VL #4 am 0.07.2007 Vladimir Dyakonov Elektrische Schwingungen und Wellen Wechselströme Wechselstromgrößen
Einführung in die Physik II für Studierende der Naturwissenschaften und Zahnheilkunde Sommersemester 2007 VL #4 am 0.07.2007 Vladimir Dyakonov Elektrische Schwingungen und Wellen Wechselströme Wechselstromgrößen
NG Brechzahl von Glas
 NG Brechzahl von Glas Blockpraktikum Frühjahr 2007 25. April 2007 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 2 2 Theoretische Grundlagen 2 2.1 Geometrische Optik und Wellenoptik.......... 2 2.2 Linear polarisiertes
NG Brechzahl von Glas Blockpraktikum Frühjahr 2007 25. April 2007 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung 2 2 Theoretische Grundlagen 2 2.1 Geometrische Optik und Wellenoptik.......... 2 2.2 Linear polarisiertes
Anhang A.6 A.7 A.8 A.9 A.10 A.11 A.12 A.13 A.14 A.15 A.16 A.17 A.18 A.19 A.20 A.21
 Anhang A.6 Physikalische Fundamentalkonstanten 373 A.7 Eigenschaften fester e 374 A.8 Eigenschaften von Flüssigkeiten 375 A.9 Dichte und dynamische Viskosität von Wasser 376 A.0 Siedetemperatur des Wassers
Anhang A.6 Physikalische Fundamentalkonstanten 373 A.7 Eigenschaften fester e 374 A.8 Eigenschaften von Flüssigkeiten 375 A.9 Dichte und dynamische Viskosität von Wasser 376 A.0 Siedetemperatur des Wassers
(VIII) Wärmlehre. Wärmelehre Karim Kouz WS 2014/ Semester Biophysik
 Quelle: http://www.pro-physik.de/details/news/1666619/neues_bauprinzip_fuer_ultrapraezise_nuklearuhr.html (VIII) Wärmlehre Karim Kouz WS 2014/2015 1. Semester Biophysik Wärmelehre Ein zentraler Begriff
Quelle: http://www.pro-physik.de/details/news/1666619/neues_bauprinzip_fuer_ultrapraezise_nuklearuhr.html (VIII) Wärmlehre Karim Kouz WS 2014/2015 1. Semester Biophysik Wärmelehre Ein zentraler Begriff
Name: PartnerIn in Crime: Datum: Versuch: Ultraschall 1125B
 Name: PartnerIn in Crime: Datum: Versuch: Ultraschall 1125B Einleitung Eine Welle wird als ein räumlich und zeitlich verändertes Feld aufgefasst, das in der Lage ist, Energie (aber keine Materie) durch
Name: PartnerIn in Crime: Datum: Versuch: Ultraschall 1125B Einleitung Eine Welle wird als ein räumlich und zeitlich verändertes Feld aufgefasst, das in der Lage ist, Energie (aber keine Materie) durch
Versuch 1: Bestimmung der relativen Dielektrizitätszahl ε r
 Bergische Universität Wuppertal raktikum Fachbereich E Werkstoffe und Grundschaltungen Bachelor Electrical Engineering Univ.-rof. Dr. T. Riedl WS 0... / 0... Hinweis: Zu Beginn des raktikums muss die Ausarbeitung
Bergische Universität Wuppertal raktikum Fachbereich E Werkstoffe und Grundschaltungen Bachelor Electrical Engineering Univ.-rof. Dr. T. Riedl WS 0... / 0... Hinweis: Zu Beginn des raktikums muss die Ausarbeitung
Wiederholung: Elektrisches Feld und Feldlinien I Feld zwischen zwei Punktladungen (pos. und neg.)
 Wiederholung: Elektrisches Feld und Feldlinien I Feld zwischen zwei Punktladungen (pos. und neg.) 1 Grieskörner schwimmen in Rhizinusöl. Weil sie kleine Dipole werden, richten sie sich entlang der Feldlinien
Wiederholung: Elektrisches Feld und Feldlinien I Feld zwischen zwei Punktladungen (pos. und neg.) 1 Grieskörner schwimmen in Rhizinusöl. Weil sie kleine Dipole werden, richten sie sich entlang der Feldlinien
4 Thermodynamik mikroskopisch: kinetische Gastheorie makroskopisch: System:
 Theorie der Wärme kann auf zwei verschiedene Arten behandelt werden. mikroskopisch: Bewegung von Gasatomen oder -molekülen. Vielzahl von Teilchen ( 10 23 ) im Allgemeinen nicht vollständig beschreibbar
Theorie der Wärme kann auf zwei verschiedene Arten behandelt werden. mikroskopisch: Bewegung von Gasatomen oder -molekülen. Vielzahl von Teilchen ( 10 23 ) im Allgemeinen nicht vollständig beschreibbar
OW_01_02 Optik und Wellen GK/LK Beugung und Dispersion. Grundbegriffe der Strahlenoptik
 OW_0_0 Optik und Wellen GK/LK Beugung und Dispersion Unterrichtliche Voraussetzungen: Grundbegriffe der Strahlenoptik Literaturangaben: Optik: Versuchsanleitung der Fa. Leybold; Hürth 986 Verfasser: Peter
OW_0_0 Optik und Wellen GK/LK Beugung und Dispersion Unterrichtliche Voraussetzungen: Grundbegriffe der Strahlenoptik Literaturangaben: Optik: Versuchsanleitung der Fa. Leybold; Hürth 986 Verfasser: Peter
Physik 2 (GPh2) am
 Name: Matrikelnummer: Studienfach: Physik (GPh) am 8.0.013 Fachbereich Elektrotechnik und Informatik, Fachbereich Mechatronik und Maschinenbau Zugelassene Hilfsmittel zu dieser Klausur: Beiblätter zur
Name: Matrikelnummer: Studienfach: Physik (GPh) am 8.0.013 Fachbereich Elektrotechnik und Informatik, Fachbereich Mechatronik und Maschinenbau Zugelassene Hilfsmittel zu dieser Klausur: Beiblätter zur
Aufgaben zur Vorbereitung der Klausur zur Vorlesung Einführung in die Physik für Natur- und Umweltwissenschaftler v. Issendorff, WS2013/
 Aufgaben zur Vorbereitung der Klausur zur Vorlesung inführung in die Physik für Natur- und Umweltwissenschaftler v. Issendorff, WS213/14 5.2.213 Aufgabe 1 Zwei Widerstände R 1 =1 Ω und R 2 =2 Ω sind in
Aufgaben zur Vorbereitung der Klausur zur Vorlesung inführung in die Physik für Natur- und Umweltwissenschaftler v. Issendorff, WS213/14 5.2.213 Aufgabe 1 Zwei Widerstände R 1 =1 Ω und R 2 =2 Ω sind in
Einführung in die Physik I. Schwingungen und Wellen 3
 Einführung in die Physik Schwingungen und Wellen 3 O. von der Lühe und U. Landgraf Elastische Wellen (Schall) Elastische Wellen entstehen in Flüssigkeiten und Gasen durch zeitliche und räumliche Veränderungen
Einführung in die Physik Schwingungen und Wellen 3 O. von der Lühe und U. Landgraf Elastische Wellen (Schall) Elastische Wellen entstehen in Flüssigkeiten und Gasen durch zeitliche und räumliche Veränderungen
Grundlagen der Quantentheorie
 Grundlagen der Quantentheorie Ein Schwarzer Körper (Schwarzer Strahler, planckscher Strahler, idealer schwarzer Körper) ist eine idealisierte thermische Strahlungsquelle: Alle auftreffende elektromagnetische
Grundlagen der Quantentheorie Ein Schwarzer Körper (Schwarzer Strahler, planckscher Strahler, idealer schwarzer Körper) ist eine idealisierte thermische Strahlungsquelle: Alle auftreffende elektromagnetische
Maßeinheiten der Wärmelehre
 Maßeinheiten der Wärmelehre Temperatur (thermodynamisch) Benennung der Einheit: Einheitenzeichen: T für Temp.-punkte, ΔT für Temp.-differenzen Kelvin K 1 K ist der 273,16te Teil der (thermodynamischen)
Maßeinheiten der Wärmelehre Temperatur (thermodynamisch) Benennung der Einheit: Einheitenzeichen: T für Temp.-punkte, ΔT für Temp.-differenzen Kelvin K 1 K ist der 273,16te Teil der (thermodynamischen)
1. Klausur ist am 5.12.! Jetzt lernen! Klausuranmeldung: Bitte heute in Listen eintragen!
 1. Klausur ist am 5.12.! Jetzt lernen! Klausuranmeldung: Bitte heute in Listen eintragen! Aggregatzustände Fest, flüssig, gasförmig Schmelz -wärme Kondensations -wärme Die Umwandlung von Aggregatzuständen
1. Klausur ist am 5.12.! Jetzt lernen! Klausuranmeldung: Bitte heute in Listen eintragen! Aggregatzustände Fest, flüssig, gasförmig Schmelz -wärme Kondensations -wärme Die Umwandlung von Aggregatzuständen
HANDOUT. Vorlesung: Glasanwendungen. Überblick optische Eigenschaften
 Materialwissenschaft und Werkstofftechnik an der Universität des Saarlandes HANDOUT Vorlesung: Glasanwendungen Überblick optische Eigenschaften Leitsatz: 21.04.2016 Die Ausbreitung von Licht durch ein
Materialwissenschaft und Werkstofftechnik an der Universität des Saarlandes HANDOUT Vorlesung: Glasanwendungen Überblick optische Eigenschaften Leitsatz: 21.04.2016 Die Ausbreitung von Licht durch ein
Probe-Klausur zur Physik II
 Ruhr-Universität Bochum Fakultät für Physik und Astronomie Institut für Experimentalphysik Name Vorname Matrikel-Nummer Fachrichtung, Abschluss Probe-Klausur zur Physik II für Studentinnen und Studenten
Ruhr-Universität Bochum Fakultät für Physik und Astronomie Institut für Experimentalphysik Name Vorname Matrikel-Nummer Fachrichtung, Abschluss Probe-Klausur zur Physik II für Studentinnen und Studenten
Grundlagen der Elektrotechnik: Wechselstromwiderstand Xc Seite 1 R =
 Grundlagen der Elektrotechnik: Wechselstromwiderstand Xc Seite 1 Versuch zur Ermittlung der Formel für X C In der Erklärung des Ohmschen Gesetzes ergab sich die Formel: R = Durch die Versuche mit einem
Grundlagen der Elektrotechnik: Wechselstromwiderstand Xc Seite 1 Versuch zur Ermittlung der Formel für X C In der Erklärung des Ohmschen Gesetzes ergab sich die Formel: R = Durch die Versuche mit einem
7. Dielektrische Eigenschaften von Festkörpern
 7. Dielektrische Eigenschaften von Festkörpern 1.1 Fläche A C = ε 0 ε r A/L Q=U C ε r = ε r jε r Der Kondensator Y = jωc L Y* U Y = jωcy* C = ε 0 ε r A/L Y*= ω ε 0 ε r A/L Re{ Y} ε '' Definition des Verlustwinkels:
7. Dielektrische Eigenschaften von Festkörpern 1.1 Fläche A C = ε 0 ε r A/L Q=U C ε r = ε r jε r Der Kondensator Y = jωc L Y* U Y = jωcy* C = ε 0 ε r A/L Y*= ω ε 0 ε r A/L Re{ Y} ε '' Definition des Verlustwinkels:
Einführung in die Physik
 Einführung in die Physik für Pharmazeuten und Biologen (PPh) Mechanik, Elektrizitätslehre, Optik Übung : Vorlesung: Tutorials: Montags 13:15 bis 14 Uhr, Liebig-HS Montags 14:15 bis 15:45, Liebig HS Montags
Einführung in die Physik für Pharmazeuten und Biologen (PPh) Mechanik, Elektrizitätslehre, Optik Übung : Vorlesung: Tutorials: Montags 13:15 bis 14 Uhr, Liebig-HS Montags 14:15 bis 15:45, Liebig HS Montags
IV. Elektrizität und Magnetismus
 IV. Elektrizität und Magnetismus IV.5 Elektromagnetische Wellen Physik für Mediziner 1 Elektromagnetische Wellen Physik für Mediziner 2 Wiederholung: Schwingkreis elektrische Feld im Kondensator wird periodisch
IV. Elektrizität und Magnetismus IV.5 Elektromagnetische Wellen Physik für Mediziner 1 Elektromagnetische Wellen Physik für Mediziner 2 Wiederholung: Schwingkreis elektrische Feld im Kondensator wird periodisch
Dirk Eßer (Autor) Ultraschalldiagnostik im Kopf- und Halsbereich (A- und B- Bild- Verfahren)
 Dirk Eßer (Autor) Ultraschalldiagnostik im Kopf- und Halsbereich (A- und B- Bild- Verfahren) https://cuvillier.de/de/shop/publications/885 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentzsch-Cuvillier,
Dirk Eßer (Autor) Ultraschalldiagnostik im Kopf- und Halsbereich (A- und B- Bild- Verfahren) https://cuvillier.de/de/shop/publications/885 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentzsch-Cuvillier,
Maßeinheiten der Elektrizität und des Magnetismus
 Maßeinheiten der Elektrizität und des Magnetismus elektrische Stromstärke I Ampere A 1 A ist die Stärke des zeitlich unveränderlichen elektrischen Stromes durch zwei geradlinige, parallele, unendlich lange
Maßeinheiten der Elektrizität und des Magnetismus elektrische Stromstärke I Ampere A 1 A ist die Stärke des zeitlich unveränderlichen elektrischen Stromes durch zwei geradlinige, parallele, unendlich lange
Strukturaufklärung (BSc-Chemie): Einführung
 Strukturaufklärung (BSc-Chemie): Einführung Prof. S. Grimme OC [TC] 13.10.2009 Prof. S. Grimme (OC [TC]) Strukturaufklärung (BSc-Chemie): Einführung 13.10.2009 1 / 25 Teil I Einführung Prof. S. Grimme
Strukturaufklärung (BSc-Chemie): Einführung Prof. S. Grimme OC [TC] 13.10.2009 Prof. S. Grimme (OC [TC]) Strukturaufklärung (BSc-Chemie): Einführung 13.10.2009 1 / 25 Teil I Einführung Prof. S. Grimme
Thermodynamik 1. Typen der thermodynamischen Systeme. Intensive und extensive Zustandsgröße. Phasenübergänge. Ausdehnung bei Erwärmung.
 Thermodynamik 1. Typen der thermodynamischen Systeme. Intensive und extensive Zustandsgröße. Phasenübergänge. Ausdehnung bei Erwärmung. Nullter und Erster Hauptsatz der Thermodynamik. Thermodynamische
Thermodynamik 1. Typen der thermodynamischen Systeme. Intensive und extensive Zustandsgröße. Phasenübergänge. Ausdehnung bei Erwärmung. Nullter und Erster Hauptsatz der Thermodynamik. Thermodynamische
ULTRASCHALL. Einleitung. Eingenschaften des Ultraschalls. Einleitung. mechanische Schwingung, mechanische Welle
 ULTRASCHALL Einleitung Längswellen (longitudinale Wellen): Verdichtungen und Verdünnungen (d.h. Druckschwankungen gegenüber dem Normaldruck) laufen über das Trägermedium. Die Schwingungsrichtung der einzelnenoszillatoren
ULTRASCHALL Einleitung Längswellen (longitudinale Wellen): Verdichtungen und Verdünnungen (d.h. Druckschwankungen gegenüber dem Normaldruck) laufen über das Trägermedium. Die Schwingungsrichtung der einzelnenoszillatoren
Energietransport durch elektromagnetische Felder
 Übung 6 Abgabe: 22.04. bzw. 26.04.2016 Elektromagnetische Felder & Wellen Frühjahrssemester 2016 Photonics Laboratory, ETH Zürich www.photonics.ethz.ch Energietransport durch elektromagnetische Felder
Übung 6 Abgabe: 22.04. bzw. 26.04.2016 Elektromagnetische Felder & Wellen Frühjahrssemester 2016 Photonics Laboratory, ETH Zürich www.photonics.ethz.ch Energietransport durch elektromagnetische Felder
Ferienkurs Teil III Elektrodynamik
 Ferienkurs Teil III Elektrodynamik Michael Mittermair 27. August 2013 1 Inhaltsverzeichnis 1 Elektromagnetische Schwingungen 3 1.1 Wiederholung des Schwingkreises................ 3 1.2 der Hertz sche Dipol.......................
Ferienkurs Teil III Elektrodynamik Michael Mittermair 27. August 2013 1 Inhaltsverzeichnis 1 Elektromagnetische Schwingungen 3 1.1 Wiederholung des Schwingkreises................ 3 1.2 der Hertz sche Dipol.......................
Einführung in die Physik II für Studierende der Naturwissenschaften und Zahnheilkunde. Sommersemester 2007
 Einführung in die Physik II für Studierende der Naturwissenschaften und Zahnheilkunde Sommersemester 2007 VL #35 am 28.06.2007 Vladimir Dyakonov Leitungsmechanismen Ladungstransport in Festkörpern Ladungsträger
Einführung in die Physik II für Studierende der Naturwissenschaften und Zahnheilkunde Sommersemester 2007 VL #35 am 28.06.2007 Vladimir Dyakonov Leitungsmechanismen Ladungstransport in Festkörpern Ladungsträger
Brewster-Winkel - Winkelabhängigkeit der Reflexion.
 5.9.30 ****** 1 Motivation Polarisiertes Licht wird an einem geschwärzten Glasrohr reflektiert, so dass auf der Hörsaalwand das Licht unter verschiedenen Relexionswinkeln auftrifft. Bei horizontaler Polarisation
5.9.30 ****** 1 Motivation Polarisiertes Licht wird an einem geschwärzten Glasrohr reflektiert, so dass auf der Hörsaalwand das Licht unter verschiedenen Relexionswinkeln auftrifft. Bei horizontaler Polarisation
Das Gasinterferometer
 Physikalisches Praktikum für das Hautfach Physik Versuch 24 Das Gasinterferometer Wintersemester 2005 / 2006 Name: Mitarbeiter: EMail: Grue: Daniel Scholz Hauke Rohmeyer hysik@mehr-davon.de B9 Assistent:
Physikalisches Praktikum für das Hautfach Physik Versuch 24 Das Gasinterferometer Wintersemester 2005 / 2006 Name: Mitarbeiter: EMail: Grue: Daniel Scholz Hauke Rohmeyer hysik@mehr-davon.de B9 Assistent:
Physik für Mediziner Technische Universität Dresden
 Technische Universität Dresden Inhalt Manuskript: Prof. Dr. rer. nat. habil. Birgit Dörschel Inst. für Strahlenschutzphysik WS 2005/06: PD Dr. rer. nat. habil. Michael Lehmann Inst. für Strukturphysik
Technische Universität Dresden Inhalt Manuskript: Prof. Dr. rer. nat. habil. Birgit Dörschel Inst. für Strahlenschutzphysik WS 2005/06: PD Dr. rer. nat. habil. Michael Lehmann Inst. für Strukturphysik
, dabei ist Q F v sin
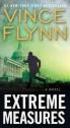 Auf den folgenden Seiten finden sich Anmerkungen und Korrekturen zu dem Studienbuch Physik 2. Sie sind nach Seitenzahlen bzw. Kapiteln und deren Aufgaben geordnet. Stand: 28. März 2012 Kommentare zu Kapitel
Auf den folgenden Seiten finden sich Anmerkungen und Korrekturen zu dem Studienbuch Physik 2. Sie sind nach Seitenzahlen bzw. Kapiteln und deren Aufgaben geordnet. Stand: 28. März 2012 Kommentare zu Kapitel
Aufgaben zur Elektrizitätslehre
 Aufgaben zur Elektrizitätslehre Elektrischer Strom, elektrische Ladung 1. In einem Metalldraht bei Zimmertemperatur übernehmen folgende Ladungsträger den Stromtransport (A) nur negative Ionen (B) negative
Aufgaben zur Elektrizitätslehre Elektrischer Strom, elektrische Ladung 1. In einem Metalldraht bei Zimmertemperatur übernehmen folgende Ladungsträger den Stromtransport (A) nur negative Ionen (B) negative
Wärmelehre/Thermodynamik. Wintersemester 2007
 Einführung in die Physik I Wärmelehre/Thermodynamik Wintersemester 007 Vladimir Dyakonov #4 am 3.0.007 Folien im PDF Format unter: http://www.physik.uni-wuerzburg.de/ep6/teaching.html Raum E43, Tel. 888-5875,
Einführung in die Physik I Wärmelehre/Thermodynamik Wintersemester 007 Vladimir Dyakonov #4 am 3.0.007 Folien im PDF Format unter: http://www.physik.uni-wuerzburg.de/ep6/teaching.html Raum E43, Tel. 888-5875,
Fortgeschrittenenpraktikum: Ausarbeitung - Versuch 14 Optische Absorption Durchgeführt am 13. Juni 2002
 Fortgeschrittenenpraktikum: Ausarbeitung - Versuch 14 Optische Absorption Durchgeführt am 13. Juni 2002 30. Juli 2002 Gruppe 17 Christoph Moder 2234849 Michael Wack 2234088 Sebastian Mühlbauer 2218723
Fortgeschrittenenpraktikum: Ausarbeitung - Versuch 14 Optische Absorption Durchgeführt am 13. Juni 2002 30. Juli 2002 Gruppe 17 Christoph Moder 2234849 Michael Wack 2234088 Sebastian Mühlbauer 2218723
Einführung in die Physik II für Studierende der Naturwissenschaften und Zahnheilkunde. Sommersemester VL #42 am
 Einführung in die Physik II für Studierende der Naturwissenschaften und Zahnheilkunde Sommersemester 2007 VL #42 am 11.07.2007 Vladimir Dyakonov Resonanz Damit vom Sender effektiv Energie abgestrahlt werden
Einführung in die Physik II für Studierende der Naturwissenschaften und Zahnheilkunde Sommersemester 2007 VL #42 am 11.07.2007 Vladimir Dyakonov Resonanz Damit vom Sender effektiv Energie abgestrahlt werden
Elektromagnetische Felder und Wellen: Lösung zur Klausur
 Elektromagnetische Felder und Wellen: zur Klausur 2014-2 1 Aufgabe 1 ( 7 Punkte) Eine ebene Welle der Form E = (E x, ie x, 0) exp{i(kz + ωt)} trifft aus dem Vakuum bei z = 0 auf ein Medium mit ε = 6 und
Elektromagnetische Felder und Wellen: zur Klausur 2014-2 1 Aufgabe 1 ( 7 Punkte) Eine ebene Welle der Form E = (E x, ie x, 0) exp{i(kz + ωt)} trifft aus dem Vakuum bei z = 0 auf ein Medium mit ε = 6 und
1. Klausur in K2 am
 Name: Punkte: Note: Ø: Kernfach Physik Abzüge für Darstellung: Rundung:. Klausur in K am 0.0. Achte auf die Darstellung und vergiss nicht Geg., Ges., Formeln, Einheiten, Rundung...! Angaben: Schallgeschwindigkeit
Name: Punkte: Note: Ø: Kernfach Physik Abzüge für Darstellung: Rundung:. Klausur in K am 0.0. Achte auf die Darstellung und vergiss nicht Geg., Ges., Formeln, Einheiten, Rundung...! Angaben: Schallgeschwindigkeit
Einführung in die Elektrochemie
 Einführung in die Elektrochemie > Grundlagen, Methoden > Leitfähigkeit von Elektrolytlösungen, Konduktometrie > Elektroden Metall-Elektroden 1. und 2. Art Redox-Elektroden Membran-Elektroden > Potentiometrie
Einführung in die Elektrochemie > Grundlagen, Methoden > Leitfähigkeit von Elektrolytlösungen, Konduktometrie > Elektroden Metall-Elektroden 1. und 2. Art Redox-Elektroden Membran-Elektroden > Potentiometrie
Experimentalphysik II Elektromagnetische Schwingungen und Wellen
 Experimentalphysik II Elektromagnetische Schwingungen und Wellen Ferienkurs Sommersemester 2009 Martina Stadlmeier 10.09.2009 Inhaltsverzeichnis 1 Elektromagnetische Schwingungen 2 1.1 Energieumwandlung
Experimentalphysik II Elektromagnetische Schwingungen und Wellen Ferienkurs Sommersemester 2009 Martina Stadlmeier 10.09.2009 Inhaltsverzeichnis 1 Elektromagnetische Schwingungen 2 1.1 Energieumwandlung
Photometrie. EPD.06 Photometrie.doc iha Ergonomie / Arbeit + Gesundheit
 1 EPD.06.doc iha Ergonomie / Arbeit + Gesundheit H. Krueger 6. 6.1 Umrechnung physikalischer in photometrische Grössen Physikalische Grössen werden mittels der spektralen Empfindlichkeitskurve des menschlichen
1 EPD.06.doc iha Ergonomie / Arbeit + Gesundheit H. Krueger 6. 6.1 Umrechnung physikalischer in photometrische Grössen Physikalische Grössen werden mittels der spektralen Empfindlichkeitskurve des menschlichen
XII. Elektromagnetische Wellen in Materie
 XII. Elektromagnetische Wellen in Materie Unten den wichtigsten Lösungen der makroskopischen Maxwell-Gleichungen (XI.1) in Materie sind die (fortschreitenden) Wellen. Um die zugehörigen Wellengleichungen
XII. Elektromagnetische Wellen in Materie Unten den wichtigsten Lösungen der makroskopischen Maxwell-Gleichungen (XI.1) in Materie sind die (fortschreitenden) Wellen. Um die zugehörigen Wellengleichungen
Aufgabe 1 ( 4 Punkte)
 Elektromagnetische Felder und Wellen: zu Klausur 203-2 Aufgabe ( 4 Punkte) Eine kreisförmige Scheibe vom Radius R rotiert mit Umfangsgeschwindigkeit v. Wie groß ist v an einem beliebigen Punkt auf der
Elektromagnetische Felder und Wellen: zu Klausur 203-2 Aufgabe ( 4 Punkte) Eine kreisförmige Scheibe vom Radius R rotiert mit Umfangsgeschwindigkeit v. Wie groß ist v an einem beliebigen Punkt auf der
Maxwell- und Materialgleichungen. B rote t. divb 0 D roth j t divd. E H D B j
 Maxwell- und Materialgleichungen B rote t divb D roth j t divd E H D B j elektrische Feldstärke magnetische Feldstärke elektrischeverschiebungsdichte magnetische Flussdichte elektrische Stromdichte DrE
Maxwell- und Materialgleichungen B rote t divb D roth j t divd E H D B j elektrische Feldstärke magnetische Feldstärke elektrischeverschiebungsdichte magnetische Flussdichte elektrische Stromdichte DrE
Kühlung: Verdampfer-Kühlschrank: Das Arbeitsgas muss sich bei der gewünschten Temperatur verflüssigen lassen. (Frigen, NH 3, SO 2, Propan)
 Kühlung: Verdampfer-Kühlschrank: Das Arbeitsgas muss sich bei der gewünschten Temperatur verflüssigen lassen. (Frigen, NH 3, SO 2, Propan) Ein Kompressor komprimiert das Gas. Bei Abkühlung auf Raumtemperatur
Kühlung: Verdampfer-Kühlschrank: Das Arbeitsgas muss sich bei der gewünschten Temperatur verflüssigen lassen. (Frigen, NH 3, SO 2, Propan) Ein Kompressor komprimiert das Gas. Bei Abkühlung auf Raumtemperatur
1. Klausur ist am 5.12.! (für Vets sowie Bonuspunkte für Zahni-Praktikum) Jetzt lernen!
 1. Klausur ist am 5.12.! (für Vets sowie Bonuspunkte für Zahni-Praktikum) Jetzt lernen! http://www.physik.uni-giessen.de/dueren/ User: duerenvorlesung Password: ****** Druck und Volumen Gesetz von Boyle-Mariotte:
1. Klausur ist am 5.12.! (für Vets sowie Bonuspunkte für Zahni-Praktikum) Jetzt lernen! http://www.physik.uni-giessen.de/dueren/ User: duerenvorlesung Password: ****** Druck und Volumen Gesetz von Boyle-Mariotte:
Physik III im Studiengang Elektrotechnik
 Physik III im Studiengang Elektrotechnik - Schwingungen und Wellen - Prof. Dr. Ulrich Hahn SS 28 Mechanik elastische Wellen Schwingung von Bauteilen Wasserwellen Akustik Elektrodynamik Schwingkreise elektromagnetische
Physik III im Studiengang Elektrotechnik - Schwingungen und Wellen - Prof. Dr. Ulrich Hahn SS 28 Mechanik elastische Wellen Schwingung von Bauteilen Wasserwellen Akustik Elektrodynamik Schwingkreise elektromagnetische
4 Wärmeübertragung durch Temperaturstrahlung
 Als Wärmestrahlung bezeichnet man die in einem bestimmten Bereich der Wellenlängen und Temperaturen auftretende Energiestrahlung (elektromagnetische trahlung). Nach den Wellenlängen unterscheidet man:
Als Wärmestrahlung bezeichnet man die in einem bestimmten Bereich der Wellenlängen und Temperaturen auftretende Energiestrahlung (elektromagnetische trahlung). Nach den Wellenlängen unterscheidet man:
Polarisationsapparat
 1 Polarisationsapparat Licht ist eine transversale elektromagnetische Welle, d.h. es verändert die Länge der Vektoren des elektrischen und magnetischen Feldes. Das elektrische und magnetische Feld ist
1 Polarisationsapparat Licht ist eine transversale elektromagnetische Welle, d.h. es verändert die Länge der Vektoren des elektrischen und magnetischen Feldes. Das elektrische und magnetische Feld ist
Aufgabe 2.1: Wiederholung: komplexer Brechungsindex
 Übungen zu Materialwissenschaften II Prof. Alexander Holleitner Übungsleiter: Jens Repp / Eric Parzinger Kontakt: jens.repp@wsi.tum.de / eric.parzinger@wsi.tum.de Blatt 2, Besprechung: 23.04.2014 / 30.04.2014
Übungen zu Materialwissenschaften II Prof. Alexander Holleitner Übungsleiter: Jens Repp / Eric Parzinger Kontakt: jens.repp@wsi.tum.de / eric.parzinger@wsi.tum.de Blatt 2, Besprechung: 23.04.2014 / 30.04.2014
12. Vorlesung. I Mechanik
 12. Vorlesung I Mechanik 7. Schwingungen 8. Wellen transversale und longitudinale Wellen, Phasengeschwindigkeit, Dopplereffekt Superposition von Wellen 9. Schallwellen, Akustik Versuche: Wellenwanne: ebene
12. Vorlesung I Mechanik 7. Schwingungen 8. Wellen transversale und longitudinale Wellen, Phasengeschwindigkeit, Dopplereffekt Superposition von Wellen 9. Schallwellen, Akustik Versuche: Wellenwanne: ebene
Aufgabe III: Die Erdatmosphäre
 Europa-Gymnasium Wörth Abiturprüfung 212 Leistungskurs Physik LK2 Aufgabe III: Die Erdatmosphäre Leistungsfachanforderungen Hilfsmittel Formelsammlung (war im Unterricht erstellt worden) Taschenrechner
Europa-Gymnasium Wörth Abiturprüfung 212 Leistungskurs Physik LK2 Aufgabe III: Die Erdatmosphäre Leistungsfachanforderungen Hilfsmittel Formelsammlung (war im Unterricht erstellt worden) Taschenrechner
Aufgabe 1 ( 3 Punkte)
 Elektromagnetische Felder und Wellen: Klausur 2016-2 1 Aufgabe 1 ( 3 Punkte) Welche elektrische Feldstärke benötigt man, um ein Elektron (Masse m e, Ladung q = e) im Schwerefeld der Erde schweben zu lassen?
Elektromagnetische Felder und Wellen: Klausur 2016-2 1 Aufgabe 1 ( 3 Punkte) Welche elektrische Feldstärke benötigt man, um ein Elektron (Masse m e, Ladung q = e) im Schwerefeld der Erde schweben zu lassen?
Physik 3 exp. Teil. 30. Optische Reflexion, Brechung und Polarisation
 Physik 3 exp. Teil. 30. Optische Reflexion, Brechung und Polarisation Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Objekt zu sehen: (1) Wir sehen das vom Objekt emittierte Licht direkt (eine Glühlampe, eine Flamme,
Physik 3 exp. Teil. 30. Optische Reflexion, Brechung und Polarisation Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Objekt zu sehen: (1) Wir sehen das vom Objekt emittierte Licht direkt (eine Glühlampe, eine Flamme,
2 Das elektrostatische Feld
 Das elektrostatische Feld Das elektrostatische Feld wird durch ruhende elektrische Ladungen verursacht, d.h. es fließt kein Strom. Auf die ruhenden Ladungen wirken Coulomb-Kräfte, die über das Coulombsche
Das elektrostatische Feld Das elektrostatische Feld wird durch ruhende elektrische Ladungen verursacht, d.h. es fließt kein Strom. Auf die ruhenden Ladungen wirken Coulomb-Kräfte, die über das Coulombsche
Experimentalphysik 3
 Optik Experimentalphysik 3 Dr. Georg von Freymann 26. Oktober 2009 Matthias Blaicher Dieser Text entsteht wärend der Vorlesung Klassische Experimentalphysik 3 im Wintersemester 2009/200 an der Universität
Optik Experimentalphysik 3 Dr. Georg von Freymann 26. Oktober 2009 Matthias Blaicher Dieser Text entsteht wärend der Vorlesung Klassische Experimentalphysik 3 im Wintersemester 2009/200 an der Universität
Labor für Technische Akustik
 Labor für Technische Akustik Kraus Abbildung 1: Experimenteller Aufbau zur optischen Ermittlung der Schallgeschwindigkeit. 1. Versuchsziel In einer mit einer Flüssigkeit gefüllten Küvette ist eine stehende
Labor für Technische Akustik Kraus Abbildung 1: Experimenteller Aufbau zur optischen Ermittlung der Schallgeschwindigkeit. 1. Versuchsziel In einer mit einer Flüssigkeit gefüllten Küvette ist eine stehende
Einführung in die Kunststoffverarbeitung
 Einführung in die Kunststoffverarbeitung von Walter Michaeli unter Mitwirkung von Mitarbeitern des Instituts für Kunststoffverarbeitung (IKV) an der RWTH Aachen und Mitarbeitern des Süddeutschen Kunststoff-Zentrums
Einführung in die Kunststoffverarbeitung von Walter Michaeli unter Mitwirkung von Mitarbeitern des Instituts für Kunststoffverarbeitung (IKV) an der RWTH Aachen und Mitarbeitern des Süddeutschen Kunststoff-Zentrums
Wellen als Naturerscheinung
 Wellen als Naturerscheinung Mechanische Wellen Definition: Eine (mechanische) Welle ist die Ausbreitung einer (mechanischen) Schwingung im Raum, wobei Energie und Impuls transportiert wird, aber kein Stoff.
Wellen als Naturerscheinung Mechanische Wellen Definition: Eine (mechanische) Welle ist die Ausbreitung einer (mechanischen) Schwingung im Raum, wobei Energie und Impuls transportiert wird, aber kein Stoff.
Freie Elektronen bilden ein Elektronengas. Feste positive Aluminiumionen. Abb. 1.1: Metallbindung: Feste Atomrümpfe und freie Valenzelektronen
 1 Grundlagen 1.1 Leiter Nichtleiter Halbleiter 1.1.1 Leiter Leiter sind generell Stoffe, die die Eigenschaft haben verschiedene arten weiterzuleiten. Im Folgenden steht dabei die Leitfähigkeit des elektrischen
1 Grundlagen 1.1 Leiter Nichtleiter Halbleiter 1.1.1 Leiter Leiter sind generell Stoffe, die die Eigenschaft haben verschiedene arten weiterzuleiten. Im Folgenden steht dabei die Leitfähigkeit des elektrischen
1. Systematik der Werkstoffe 10 Punkte
 1. Systematik der Werkstoffe 10 Punkte 1.1 Werkstoffe werden in verschiedene Klassen und die dazugehörigen Untergruppen eingeteilt. Ordnen Sie folgende Werkstoffe in ihre spezifischen Gruppen: Stahl Holz
1. Systematik der Werkstoffe 10 Punkte 1.1 Werkstoffe werden in verschiedene Klassen und die dazugehörigen Untergruppen eingeteilt. Ordnen Sie folgende Werkstoffe in ihre spezifischen Gruppen: Stahl Holz
Physik für Maschinenbau. Prof. Dr. Stefan Schael RWTH Aachen
 Physik für Maschinenbau Prof. Dr. Stefan Schael RWTH Aachen Vorlesung 11 Brechung b α a 1 d 1 x α b x β d 2 a 2 β Totalreflexion Glasfaserkabel sin 1 n 2 sin 2 n 1 c arcsin n 2 n 1 1.0 arcsin
Physik für Maschinenbau Prof. Dr. Stefan Schael RWTH Aachen Vorlesung 11 Brechung b α a 1 d 1 x α b x β d 2 a 2 β Totalreflexion Glasfaserkabel sin 1 n 2 sin 2 n 1 c arcsin n 2 n 1 1.0 arcsin
Theoretische Modellierung von experimentell ermittelten Infrarot-Spektren
 Sitzung des AK-Thermophysik am 24./25. März 211 Theoretische Modellierung von experimentell ermittelten Infrarot-Spektren M. Manara, M. Arduini-Schuster, N. Wolf, M.H. Keller, M. Rydzek Bayerisches Zentrum
Sitzung des AK-Thermophysik am 24./25. März 211 Theoretische Modellierung von experimentell ermittelten Infrarot-Spektren M. Manara, M. Arduini-Schuster, N. Wolf, M.H. Keller, M. Rydzek Bayerisches Zentrum
SCHWINGUNGEN WELLEN. Schwingungen Resonanz Wellen elektrischer Schwingkreis elektromagnetische Wellen
 Physik für Pharmazeuten SCHWINGUNGEN WELLEN Schwingungen Resonanz elektrischer Schwingkreis elektromagnetische 51 5.1 Schwingungen Federpendel Auslenkung x, Masse m, Federkonstante k H d xt ( ) Bewegungsgleichung:
Physik für Pharmazeuten SCHWINGUNGEN WELLEN Schwingungen Resonanz elektrischer Schwingkreis elektromagnetische 51 5.1 Schwingungen Federpendel Auslenkung x, Masse m, Federkonstante k H d xt ( ) Bewegungsgleichung:
Strahlungsdruck, Potentiale
 Übung 7 Abgabe: 29.04. bzw. 03.05.2016 Elektromagnetische Felder & Wellen Frühjahrssemester 2016 Photonics Laboratory, ETH Zürich www.photonics.ethz.ch Strahlungsdruck, Potentiale 1 Der Brewsterwinkel
Übung 7 Abgabe: 29.04. bzw. 03.05.2016 Elektromagnetische Felder & Wellen Frühjahrssemester 2016 Photonics Laboratory, ETH Zürich www.photonics.ethz.ch Strahlungsdruck, Potentiale 1 Der Brewsterwinkel
5 Schwingungen und Wellen
 5 Schwingungen und Wellen Schwingung: Regelmäßige Bewegung, die zwischen zwei Grenzen hin- & zurückführt Zeitlich periodische Zustandsänderung mit Periode T ψ ψ(t) [ ψ(t-τ)] Wellen: Periodische Zustandsänderung
5 Schwingungen und Wellen Schwingung: Regelmäßige Bewegung, die zwischen zwei Grenzen hin- & zurückführt Zeitlich periodische Zustandsänderung mit Periode T ψ ψ(t) [ ψ(t-τ)] Wellen: Periodische Zustandsänderung
Gleichstromkreis. 2.2 Messgeräte für Spannung, Stromstärke und Widerstand. Siehe Abschnitt 2.4 beim Versuch E 1 Kennlinien elektronischer Bauelemente
 E 5 1. Aufgaben 1. Die Spannungs-Strom-Kennlinie UKl = f( I) einer Spannungsquelle ist zu ermitteln. Aus der grafischen Darstellung dieser Kennlinie sind Innenwiderstand i, Urspannung U o und Kurzschlussstrom
E 5 1. Aufgaben 1. Die Spannungs-Strom-Kennlinie UKl = f( I) einer Spannungsquelle ist zu ermitteln. Aus der grafischen Darstellung dieser Kennlinie sind Innenwiderstand i, Urspannung U o und Kurzschlussstrom
Kunststoffe Lern- und Arbeitsbuch für die Aus- und Weiterbildung
 Walter Michaeli / Helmut Greif Leo Wolters / Franz-Josef vossebürger Technologie der Kunststoffe Lern- und Arbeitsbuch für die Aus- und Weiterbildung 2. Auflage HANSER Inhalt Einführung Kunststoff - ein
Walter Michaeli / Helmut Greif Leo Wolters / Franz-Josef vossebürger Technologie der Kunststoffe Lern- und Arbeitsbuch für die Aus- und Weiterbildung 2. Auflage HANSER Inhalt Einführung Kunststoff - ein
Wechselwirkung zwischen Licht und chemischen Verbindungen
 Photometer Zielbegriffe Photometrie. Gesetz v. Lambert-Beer, Metallkomplexe, Elektronenanregung, Flammenfärbung, Farbe Erläuterungen Die beiden Versuche des 4. Praktikumstages sollen Sie mit der Photometrie
Photometer Zielbegriffe Photometrie. Gesetz v. Lambert-Beer, Metallkomplexe, Elektronenanregung, Flammenfärbung, Farbe Erläuterungen Die beiden Versuche des 4. Praktikumstages sollen Sie mit der Photometrie
Systematisierung Felder und Bewegung von Ladungsträgern in Feldern
 Systematisierung Felder und Bewegung von Ladungsträgern in Feldern Systematisierung Feld Unterschiede: Beschreibung Ursache Kräfte auf elektrisches Feld Das elektrische Feld ist der besondere Zustand des
Systematisierung Felder und Bewegung von Ladungsträgern in Feldern Systematisierung Feld Unterschiede: Beschreibung Ursache Kräfte auf elektrisches Feld Das elektrische Feld ist der besondere Zustand des
Problem 1: Die Parabelmethode von Joseph John Thomson
 Problem 1: Die Parabelmethode von Joseph John Thomson Bei einer Internetrecherche für eine Arbeit über Isotope haben Sie den folgenden Artikel von J. J. Thomson gefunden, der in den Proceedings of The
Problem 1: Die Parabelmethode von Joseph John Thomson Bei einer Internetrecherche für eine Arbeit über Isotope haben Sie den folgenden Artikel von J. J. Thomson gefunden, der in den Proceedings of The
HARMONISCHE SCHWINGUNGEN
 HARMONISCHE SCHWINGUNGEN Begriffe für Schwingungen: Die Elongation γ ist die momentane Auslenkung. Die Amplitude r ist die maximale Auslenkung aus der Gleichgewichtslage (r >0). Die Schwingungsdauer T
HARMONISCHE SCHWINGUNGEN Begriffe für Schwingungen: Die Elongation γ ist die momentane Auslenkung. Die Amplitude r ist die maximale Auslenkung aus der Gleichgewichtslage (r >0). Die Schwingungsdauer T
Versuch 2. Physik für (Zahn-)Mediziner. c Claus Pegel 13. November 2007
 Versuch 2 Physik für (Zahn-)Mediziner c Claus Pegel 13. November 2007 1 Wärmemenge 1 Wärme oder Wärmemenge ist eine makroskopische Größe zur Beschreibung der ungeordneten Bewegung von Molekülen ( Schwingungen,
Versuch 2 Physik für (Zahn-)Mediziner c Claus Pegel 13. November 2007 1 Wärmemenge 1 Wärme oder Wärmemenge ist eine makroskopische Größe zur Beschreibung der ungeordneten Bewegung von Molekülen ( Schwingungen,
Amateurfunkkurs. Themen Übersicht. Erstellt: Landesverband Wien im ÖVSV. 1 Widerstand R. 2 Kapazität C. 3 Induktivität L.
 Amateurfunkkurs Landesverband Wien im ÖVSV Erstellt: 2010-2011 Letzte Bearbeitung: 20. Februar 2016 Themen 1 2 3 4 5 6 Zusammenhang zw. Strom und Spannung am Widerstand Ein Widerstand... u i Ohmsches Gesetz
Amateurfunkkurs Landesverband Wien im ÖVSV Erstellt: 2010-2011 Letzte Bearbeitung: 20. Februar 2016 Themen 1 2 3 4 5 6 Zusammenhang zw. Strom und Spannung am Widerstand Ein Widerstand... u i Ohmsches Gesetz
16 Elektromagnetische Wellen
 16 Elektromagnetische Wellen In den folgenden Kapiteln werden wir uns verschiedenen zeitabhängigen Phänomenen zuwenden. Zunächst werden wir uns mit elektromagnetischen Wellen beschäftigen und sehen, dass
16 Elektromagnetische Wellen In den folgenden Kapiteln werden wir uns verschiedenen zeitabhängigen Phänomenen zuwenden. Zunächst werden wir uns mit elektromagnetischen Wellen beschäftigen und sehen, dass
FK Experimentalphysik 3, Lösung 3
 1 Transmissionsgitter FK Experimentalphysik 3, Lösung 3 1 Transmissionsgitter Ein Spalt, der von einer Lichtquelle beleuchtet wird, befindet sich im Abstand von 10 cm vor einem Beugungsgitter (Strichzahl
1 Transmissionsgitter FK Experimentalphysik 3, Lösung 3 1 Transmissionsgitter Ein Spalt, der von einer Lichtquelle beleuchtet wird, befindet sich im Abstand von 10 cm vor einem Beugungsgitter (Strichzahl
Sonne. Sonne. Δ t A 1. Δ t. Heliozentrisches Weltbild. Die Keplerschen Gesetze
 Seite 1 von 6 Astronomische Weltbilder und Keplersche Gesetze Heliozentrisches Weltbild Die Sonne steht im Mittelpunkt unseres Sonnensystems, die Planeten umkreisen sie. Viele Planeten werden von Monden
Seite 1 von 6 Astronomische Weltbilder und Keplersche Gesetze Heliozentrisches Weltbild Die Sonne steht im Mittelpunkt unseres Sonnensystems, die Planeten umkreisen sie. Viele Planeten werden von Monden
Wissenswertes zum Einsatz von Lichtleitern
 Wissenswertes zum Einsatz von Lichtleitern Dr. Jörg-Peter Conzen Vice President NIR & Process Bruker Anwendertreffen, Ettlingen den 13.11.2013 Innovation with Integrity Definition: Brechung Brechung oder
Wissenswertes zum Einsatz von Lichtleitern Dr. Jörg-Peter Conzen Vice President NIR & Process Bruker Anwendertreffen, Ettlingen den 13.11.2013 Innovation with Integrity Definition: Brechung Brechung oder
Schulcurriculum für das 6. Schuljahr am Cornelius-Burgh-Gymnasium Erkelenz. auf der Grundlage vom KLP GY 8 NRW
 Schulcurriculum für das 6. Schuljahr am Cornelius-Burgh-Gymnasium Erkelenz auf der Grundlage vom KLP GY 8 NRW Fachlicher Kontext Konkretisierungen Unterricht (Spektrum NRW) Methoden und Blickpunkte Versuche
Schulcurriculum für das 6. Schuljahr am Cornelius-Burgh-Gymnasium Erkelenz auf der Grundlage vom KLP GY 8 NRW Fachlicher Kontext Konkretisierungen Unterricht (Spektrum NRW) Methoden und Blickpunkte Versuche
Ferienkurs Experimentalphysik 3
 Ferienkurs Experimentalphysik 3 Musterlösung Montag 14. März 2011 1 Maxwell Wir bilden die Rotation der Magnetischen Wirbelbleichung mit j = 0: ( B) = +µµ 0 ɛɛ 0 ( E) t und verwenden wieder die Vektoridenditäet
Ferienkurs Experimentalphysik 3 Musterlösung Montag 14. März 2011 1 Maxwell Wir bilden die Rotation der Magnetischen Wirbelbleichung mit j = 0: ( B) = +µµ 0 ɛɛ 0 ( E) t und verwenden wieder die Vektoridenditäet
Optische Eigenschaften fester Stoffe. Licht im neuen Licht Dez 2015
 Licht und Materie Optische Eigenschaften fester Stoffe Matthias Laukenmann Den Lernenden muss bereits bekannt sein: Zahlreiche Phänomene lassen sich erklären, wenn man annimmt, dass die von Atomen quantisiert
Licht und Materie Optische Eigenschaften fester Stoffe Matthias Laukenmann Den Lernenden muss bereits bekannt sein: Zahlreiche Phänomene lassen sich erklären, wenn man annimmt, dass die von Atomen quantisiert
Physikalische Aufgaben
 Physikalische Aufgaben Bearbeitet von Helmut Lindner 34., verbesserte Auflage 2007. Buch. 339 S. Hardcover ISBN 978 3 446 41110 4 Format (B x L): 12,1 x 19,2 cm Gewicht: 356 g Zu Leseprobe schnell und
Physikalische Aufgaben Bearbeitet von Helmut Lindner 34., verbesserte Auflage 2007. Buch. 339 S. Hardcover ISBN 978 3 446 41110 4 Format (B x L): 12,1 x 19,2 cm Gewicht: 356 g Zu Leseprobe schnell und
Übungen zu Physik 1 für Maschinenwesen
 Physikdepartment E13 WS 2011/12 Übungen zu Physik 1 für Maschinenwesen Prof. Dr. Peter Müller-Buschbaum, Dr. Eva M. Herzig, Dr. Volker Körstgens, David Magerl, Markus Schindler, Moritz v. Sivers Vorlesung
Physikdepartment E13 WS 2011/12 Übungen zu Physik 1 für Maschinenwesen Prof. Dr. Peter Müller-Buschbaum, Dr. Eva M. Herzig, Dr. Volker Körstgens, David Magerl, Markus Schindler, Moritz v. Sivers Vorlesung
 Welche Aussage trifft zu? Schallwellen (A) sind elektromagnetische Wellen hoher Energie (B) sind infrarote, elektromagnetische Wellen (C) können sich im Vakuum ausbreiten (D) sind Schwingungen miteinander
Welche Aussage trifft zu? Schallwellen (A) sind elektromagnetische Wellen hoher Energie (B) sind infrarote, elektromagnetische Wellen (C) können sich im Vakuum ausbreiten (D) sind Schwingungen miteinander
(2 π f C ) I eff Z = 25 V
 Physik Induktion, Selbstinduktion, Wechselstrom, mechanische Schwingung ösungen 1. Eine Spule mit der Induktivität = 0,20 mh und ein Kondensator der Kapazität C = 30 µf werden in Reihe an eine Wechselspannung
Physik Induktion, Selbstinduktion, Wechselstrom, mechanische Schwingung ösungen 1. Eine Spule mit der Induktivität = 0,20 mh und ein Kondensator der Kapazität C = 30 µf werden in Reihe an eine Wechselspannung
Praktikums-Eingangsfragen
 Praktikums-Eingangsfragen Zu den Antworten: Bei Formelangaben müssen die Größensymbole erläutert werden. Notieren Sie z. B. F = m a, dann müssen die Erklärungen F : Kraft, m : Masse, a : Beschleunigung
Praktikums-Eingangsfragen Zu den Antworten: Bei Formelangaben müssen die Größensymbole erläutert werden. Notieren Sie z. B. F = m a, dann müssen die Erklärungen F : Kraft, m : Masse, a : Beschleunigung
Das führt zu einer periodischen Hin- und Herbewegung (Schwingung) Applet Federpendel (http://www.walter-fendt.de)
 Elastische SCHWINGUNGEN (harmonische Bewegung) Eine Masse sei reibungsfrei durch elastische Kräfte in einer Ruhelage fixiert Wenn aus der Ruhelage entfernt wirkt eine rücktreibende Kraft Abb. 7.1 Biologische
Elastische SCHWINGUNGEN (harmonische Bewegung) Eine Masse sei reibungsfrei durch elastische Kräfte in einer Ruhelage fixiert Wenn aus der Ruhelage entfernt wirkt eine rücktreibende Kraft Abb. 7.1 Biologische
Sessionsprüfung Elektromagnetische Felder und Wellen ( L)
 Sessionsprüfung Elektromagnetische Felder und Wellen (227-0052-10L) 22. August 2013, 14-17 Uhr, HIL F41 Prof. Dr. L. Novotny Bitte Beachten Sie: Diese Prüfung besteht aus 5 Aufgaben und hat 3 beidseitig
Sessionsprüfung Elektromagnetische Felder und Wellen (227-0052-10L) 22. August 2013, 14-17 Uhr, HIL F41 Prof. Dr. L. Novotny Bitte Beachten Sie: Diese Prüfung besteht aus 5 Aufgaben und hat 3 beidseitig
Einführung in die Kunststoffverarbeitung
 Walter Michaeli Einführung in die Kunststoffverarbeitung Unter Mitwirkung von Mitarbeitern des Institus für Kunststoffverarbeitung (IKV) an der RWTH Aachen und Mitarbeitern des Süddeutschen Kunststoff-Zentrums
Walter Michaeli Einführung in die Kunststoffverarbeitung Unter Mitwirkung von Mitarbeitern des Institus für Kunststoffverarbeitung (IKV) an der RWTH Aachen und Mitarbeitern des Süddeutschen Kunststoff-Zentrums
Inhaltsverzeichnis. Kurz, G�nther Strà mungslehre, Optik, Elektrizit�tslehre, Magnetismus digitalisiert durch: IDS Basel Bern
 Inhaltsverzeichnis I Strömungslehre 11 1 Ruhende Flüssigkeiten (und Gase) - Hydrostatik 11 1.1 Charakterisierung von Flüssigkeiten 11 1.2 Druck - Definition und abgeleitete 11 1.3 Druckänderungen in ruhenden
Inhaltsverzeichnis I Strömungslehre 11 1 Ruhende Flüssigkeiten (und Gase) - Hydrostatik 11 1.1 Charakterisierung von Flüssigkeiten 11 1.2 Druck - Definition und abgeleitete 11 1.3 Druckänderungen in ruhenden
