Teubner StudienbCtcher
|
|
|
- Martina Junge
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Teubner StudienbCtcher Physik Becher / Bbhm/ Joos: Eichtheorien der starken und elektroschwachen Wechselwirkung 2. Auf!. DM 39,80 Berry: Kosmologie und Gravitation. DM 26,80 Bopp: Kerne, Hadronen und Elementarteilchen. DM 34, Bourne/Kendall: Vektoranalysis. 2. Auf!. DM 28,80 Bultgenbach: Mikromechanik. DM 32,- Carlsson/Pipes: Hochleistungsfaserverbundwerkstoffe. DM 28,80 Constantinescu: Distributionen und ihre Anwendung in der Physik. DM23,80 Daniel: Beschleuniger. DM 28,80 Engelke: Aufbau der Molekiile. DM 38,- Fischer/Kaul: Mathematik fiir Physiker Band 1: Grundkurs. 2. Auf!. DM 48,- Goetzberger/Wittwer: Sonnenenergie. 2. Auf!. DM 29,80 GrosslRunge: Vielteilchentheorie. DM 39,80 GroBer: Einfiihrung in die Teilchenoptik. DM 26,80 GroBmann: Mathematischer Einfiihrungskurs fiir die Physik. 6. Aufl. DM 36,80 Grotz/Klapdor: Die schwache Wechselwirkung in Kern-, Teilchen- und Astrophysik. DM 45,- Heil/Kitzka: Grundkurs Theoretische Mechanik. DM 39, Henzler/Gbpel: Oberflachenphysik des Festkorpers. DM 59,80 Heinloth: Energie. DM 42,- Kamke/Kramer: Physikalische Grundlagen der MaBeinheiten. DM 26,80 Kleinknecht: Detektoren fiirteilchenstrahlung. 2. Auf!. DM 29,80 Kneubuhl: Repetitorium der Physik. 4. Auf!. DM 48,- Kneubuhl/Sigrist: Laser. 3. Auf!. DM 44,80 Kopitzki: Einfiihrung in die Festkorperphysik. 2. Auf!. DM 44, Kunze: Physikalische MeBmethoden. DM 28,80 Lautz: Elektromagnetische Felder. 3. Auf!. DM 32,- Lindner: Drehimpulse in der Quantenmechanik. DM 28,80 Lohrmann: Einfiihrung in die Elementarteilchenphysik. 2. Auf!. DM 26,80 Lohrmann: Hochenergiephysik. 3. Auf!. DM 34,- Mayer-Kuckuk: Atomphysik. 3. Auf!. DM 34,- B. G. Teubner Stuttgart
2 Zu diesem Buch Das vorliegende Skriptum gibt eine knappe, praxisbezogene und einfuhrende Ubersicht elektronischer Halbleiterbauelemente. Es basiert auf Unterlagen einer entsprechenden Vorlesung fur studierende der Elektrotechnik im Grundstudium. Deshalb greift es auch nur auf elektrophysikalische Grundkenntnisse zuruck, wie sie heute durchweg zu Beginn des Grundstudiums an Technischen Hochschulen, Universitaten und Fachhochschulen in elektrotechnischen Studienrichtungen geboten werden. Als Ubersicht ist es zum Gebrauch neben Vorlesungen auch zum Selbststudium gedacht, zumal der unvermindert rasche Fort schri tt auf den Gebieten der Halblei terbauelemente j eden Elektroniker von Zeit zu Zeit vor die Notwendigkei t stell t, sich weiterzubilden.
3 Elektronische Halbleiterbauelemente Von Prof. Dr.-Ing. habil. Reinhold Paul Technische Universitiit Hamburg-Harburg 3., durchgesehene Auflage Mit 277 Bildern und 30 Tafeln B. G. Teubner Stuttgart 1992
4 Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme Paul, Reinhold: Elektronische Halbleiterbauelemente / von Reinhold Paul. - 3., durchges. Auf!. - Stuttgart: Teubner, 1992 (Teubner-Studienskripten ; 112 : Angewandte Physik, Elektrotechnikl ISBN-13: e-isbn- 13: DOT: / NE: GT Das Werk einschlieblich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschlitzt. Jede Verwertung auberhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulassig und strafbar. Das gilt besonders fur Vervielfliltigungen, Obersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. B. G. Teubner Stuttgart 1989 Softcover reprint of the hardcover 1 st edition 1989 Gesamtherstellung: Druckhaus Beitz, Hemsbach/BergstraBe Umschlaggestaltung: W. Koch, Sindelfingen
5 Vorwort Die Elektronik wird heute durehgangig von ihren Bauelementen gepragt, von denen die wiehtigsten, stuekzahl- und kostenmabig dominierend, die Halbleiterbauelemente sind. Heute steht ein sehr breites Spektrum versehiedenartigster Bauelemente fur die Informationsteehnik und Leistungselektronik in Form teehniseh ausgereifter Produkte zur Verfugung. Noeh grober ist aber der Vorrat an neuen Funktionsprinzipien, unter denen sieh eine Reihe befindet, die dureh bestimmte Vorzuge sehr wohl zu teehniseh durehentwiekelten Bauelementen werden konnen. Diese Fulle ersehwert dem Anwender fraglos Uberbliek und Auswahl. Das vorliegende Skriptum verfolgt deshalb in erster Linie das Ziel, in systematiseher Weise Funktionsprinzipien, Aufbau und teehnisehe Eigensehaften der elektriseh gesteuerten Halbleiterbauelemente darzulegen. Den Ausgang dazu bilden die physikalisehen Grundlagen, soweit sie fur das Verstandnis der Funktionsprinzipien erforderlieh sind. Die Stoffdarstellung selbst bleibt bewubt elementar und ist stets auf das konzentriert, was fur eine einfuhrende Ubersieht notwendig ist. Effekte zweiter Ordnung und speziellere Probleme - von denen es gerade bei Halbleiterbauelementen so viele gibt wurden zuruekgestell t. So durfte das Skriptum geeignet sein, aufbauend auf Grundkenntnissen der Elektroteehnik und Elektrophysik, dem Studenten elektroteehniseher und wohl aueh tangierender niehtelektroteehniseher Faehriehtungen an Universitaten und Faehhoehsehulen eine Einfuhrung in das Verstandnis der Halblei terbauelemente zu ermogliehen. Aber aueh der in der Praxis stehende Ingenieur und Physiker durfte angesproehen sein, mub er sieh doeh angesiehts der permanenten Fortsehritte auf den Gebieten der Halblei terbauelemente von Zei t zu Zeit urn Neuentwieklungen kummern. Das Skriptum besehrankt sieh aus Umfangsgrunden auf elektriseh gesteuerte Halbleiterbauelemente. Sensoren und optoelektronisehe Bauelemente wurden weggelassen.
6 6 Bei der technischen Vorberei tung und Durchfuhrung des Manuskriptes hat mich meine Familie - wie schon so oft - nach besten Kraften unterstutzt, ihr danke ich deshalb ganz besonders. Dem B.G. Teubner Verlag, insbesondere Herrn Dr. Spuhler, danke ich fur die gute Zusammenarbeit. Munchen, im Fruhjahr 1986 Reinhold Paul Vorwort zur dritten Auflage Die freundliche Aufnahme, die die stark bearbei tete zwei te Auflage bei einem brei ten Leserkreis fand, veranlabte mich, in der vorliegenden dri tten Auflage nur geringfiigige Erganzungen einzuarbei ten. Ich iibergebe dami t auch das vorliegende Skript dem Leserkreis zum Nutzen. Autor und Verlag sind dabei - wie bisher - an Vorschlagen zu Verbesserungen in Inhalt, Form und Wichtung der Stoffgebiete stets interessiert und bitten urn entsprechende Hinweise. Herr Dr. P. Spuhler und das Team des B. G. Teubner Verlages haben das Vorhaben in bewahrter Weise unterstiitzt und rasch umgesetzt, wofiir ich recht herzlich danke. Meine Frau Ingrid sorgte - wie schon so oft - fiir die technische Umsetzung des Textes, wofiir ich ihr herzlich danke. Reinhold Paul Hamburg, Sommer 1991
7 Inhaltsverzeichnis Vorwort A Allgemeine Grundlagen elektronischer Halbleiterbauelemente 11 Grundprinzipien und Eigenschaften elektronischer Halbleiterbauelemente Ladungstrager in Festkorpern Bindungsmodell. Eigen- und storhalbleiter Bandermodell und Bandstruktur Strome und Ladungen in Halblei tern Tragertransport Kontinuitat der Tragerstrome Tragervernichtung Und -erzeugung Ladungstragertransportmechanismen an Grenzflachen Raumladungen in Halbleitern. Poissonsche Gleichung Poissonsche Gleichung Raumladungsfall. Verarmungsnaherung. Raumladungsbegrenzter StromfluB Neutral-, Quasineutralfall Ortliche und zeitliche Relaxation von Raumladungsstorungen Grundgleichungen der inneren Elektronik von Halbleiterbauelementen Quasiferminiveaus Halbleitergrundgleichungen Halbleiter mit raumlich veranderbarer Bandstruktur Allgemeine elektrische Eigenschaften von Halbleiterbauelementen Gleichstromverhalten Kleinsignalverhalten Impuls- und Schaltverhalten Thermisches Verhalten Rauschen Bauelementebezeichnungen, Gehause 89 B Grenzflachengesteuerte Halbleiterbauelemente 94 2 Grenzflachengesteuerte Zweipolbauelemente: Halbleiterdioden pn-ubergang. Universal- und Richtdioden 103
8 Wirkprinzip. Elektrische Eigenschaften Kennlinie Dynamische Eigenschaften Diodenmodell fur die Schaltungssimulation Diodenausfuhrungsformen Universal-, Richtdioden Schaltdioden Z-Dioden Kapazitatsdioden Tunneldiode Leistungsgleichrichter. pin-, psn-dioden pin-diode als Mikrowellenbauelement Heteroubergange Arten von Heteroubergangen StromfluB durch Heteroubergange Anwendungen von Heteroubergangen Metall-Halbleiter-Ubergang. Schottky-Diode Kennlinie Ohmscher Kontakt Laufzeitgesteuerte Bauelemente. Impatt-Dioden Laufzeitprinzip Impatt-Diode Tunnett-Diode Baritt-Dioden Qwitt-Diode Weitere Diodenarten. Volumenbarrierendioden Bipolartransistoren Transistoreigenschaften Kennlinien Der Basisraum Bipolartransistormodelle Kleinsignalverhalten. Ersatzschaltung Bau- und Ausfuhrungsforffien Universaltransistoren kleiner Leistung Mikrowellentransistoren Schalttransistoren Leistungstransistoren Leistungstransistoren fur tiefe Frequenzen Hochfrequenz- und Mikrowellenleistungstransistoren Verbundtransistoren Sonderformen von Bipolartransistoren Hetero-Bipolartransistor Unijunctiontransistor, Doppelbasisdiode 332
9 Permeable Base-Transistor 4 Thyristoren. Diacs, Triacs 4.1 Thyristor Kennlinien. Eigenschaften Bauformen Sonderformen von Thyristoren 4.2 Diac und Triac Diac Triac (Zweiwegthyristor) Thyristoren und Triacs im Grundstromkreis BeschaltungsmaBnahmen Zundschaltungen Abschalten des Thyristors Anwendungen Vergleich von Leistungshalbleiterbauelementen Feldeffekttransistoren Sperrschichtfeldeffekttransitor Wirkprinzip. Kennliniengleichung Kleinsignal- und Hochfrequenzverhalten Transistormodelle Bauformen Leistungs-Sperrschichtfeldeffekttransistor Schottky-Gate-Feldeffekttransistoren Selektiv dotierte Heterofeldeffekttransistoren, HEMT Anwendungen, Vergleich verschiedener Transistorarten MIS-Feldeffektbauelemente ~IOS-Kondensa tor Wirkprinzip MIS-Bauelemente MOS-Feldeffekttransistor Wirkprinzip. Aufbau Statische Eigenschaften. Kennlinien Kleinsignal-, Hochfrequenzverhalten. Ersatzschaltung MOSFET-Modellp Bau und Ausfuhrungsformen 6. 3 ~IOS-Leistungstransistoren Ausfuhrungsformen Kennwerte und Eigenschaften MOS-Verbundtransistoren
10 Vergleich von Leistungsbauelementen Speicher-MOS-Feldeffekttransistoren Ladungstransferelemente Wirkprinzipien und Eigenschaften Eimerkettenstruktur Oberflachenladungstransferelemente Volumenladungstransferelemente Weitere Ladungstransferstrukturen Anwendungen 499 C Bauelemente auf Basis von Volumeneffekten Dielektrische Diode. MIM-(MSM-)Struktur Volumenbegrenzte Vorgange Eintragerinjektion Doppelinjektion Kontaktbegrenzung Transferelektronenbauelemente Aufbau und Wirkprinzip Elektronentransfermechanismus, Raumladungsinstabilitaten Betriebsbereiche, Stabilitat Strom-Spannungs-Kennlinie des Gunnelementes Kleinsignalverhalten GroBsignalverhalten Dipoldomanen Oszillatorbetrieb, weitere Domanenarten LSA-Betrieb Bauelemente und Anwendungen Bauelemente, Bau- und Herstellungsformen Anwendungen 519 Literaturverzeichnis 522 Anhang A, B 523 Sachwortverzeichnis 525
11 A Allgemeine Grundlagen elektronischer Halbleiterbauelemente Grundprinzipien und Eigenschaften elektronischer Halbleiterbauelemente Ein elektronisches Bauelement ist schlechthin eine Anordnung, durch die eine elektronische Grundfunktion, namlich die Steuerung, Wand lung, Speicherung, Fortlei tung oder zei tweilige Unterbrechung eines Energieflusses unter Nutzung elektrophysikalischer Phanomene in einem abgegrenzten Volumen, - dem Steuerraum realisiert wird. Dementsprechend gibt es steuerbare Bauelemente, Wandler- und Speicherbauelemente, Leitungs- und Schalterbauelemente. Mit der Entdeckung des Transistorpr!nzips vor fast vier Jahrzehnten verlor das klassisch steuerbare Bauelement die Elektronenrohre - immer mehr an Bedeutung. Ihr verblieben einige Spezialbereiche wie z. B. Magnetrons, Klystrons, Rontgen- und Bildrohren. Statt des sen werden heute Kenntnisse der elektrischen Eigenschaften von Festkorpern, insbesondere Halblei termaterialien, immer wichtiger, urn die vielfal tigen Wirkprinzipien und Eigenschaften der uberaus groben Zahl derzeit bekannter Halbleiterbauelemente so zu verstehen, dab sie erfolgreich angewendet werden konnen. In der Tat beruht die Funktion elektronischer Halbleiterbauelemente - auf elektrophysikalischen Phanomenen im Volumen und an den Grenzflachen des Steuerraumes (z. B. Transport der Ladungstrager, Tragererzeugungs- und Vernichtungsvorgange), also eines raumlich abgegrenzten Halbleitergebietes, - auf Vorgangen an Grenzflachen zwischen "verschiedenen" Festkorper- und Halbleitermaterialien, - auf externen EinfluBgroBen (mechanische, thermische, magnetische, optische, chemische u. a.), die das elektrische Verhalten entscheidend beeinflussen konnen.
12 Deshalb ist eine Zusammenstellung der wiehtigsten elektrophysikalisehen Grundlagen der Halbleiterbauelemente im Absehnitt 1.1 sieher zweekmabig. Die Verbindung des "Steuer- oder Funktionsraumes" zur umgebenden elektrisehen Sehaltung erfolgt uber AnsehluBelektroden. Erst dadureh entsteht ein teehnisehes Sehalt- oder Bauelement. Oft wird die Zahl der AnsehluBklemmen als Einteilungsmerkmal benutzt und man sprieht von Zwei-, Drei- oder Vierpolelementen. Aus elektriseher Sieht hat jedes Bauelement typisehe Klemmeneigensehaften, die dureh eharakteristisehe Merkmale - die Kennwerte - unter ganz bestimmten Betriebsbedingungen besehrieben werden. Absehnitt 1.5 gibt eine kurze Zusammenstellung. 1.1 Ladungstrager in Festkorpern Elektronisehe Halbleiterbauelemente nutzen die elektronisehen Eigensehaften bestimmter Festkorper grundlegend aus. Diese konnen naeh der elektrisehen Leitfahigkeit grob in drei Gruppen eingeteilt werden: Leiter (Metalle), Halbleiter und Isolatoren. Obwohl heute aile drei in elektronisehen Bauelementen breit zum Einsatz kommen, haben die speziellen Eigensehaften kristalliner Halbleiter, wie Silizium, Gallium-Arsenid, Germanium und einige andere mehr, heute die grobte Bedeutung erlangt. Bild 1.1 vermittelt die Leitfahigkeiten einiger typiseher Materialien: Isolatoren Metalle Halbleiter CIt < 10-8 S/em ~ > 10 4 Stem, 10-8< ~ <10 3 Stem. Die Riehtwerte von Halbleitern gel ten fur "reine" Materialien bei Zimmertemperatur. Sie konnen dureh gezielte Verunreinigung - das sog. Dotieren - bis zur Leitfahigkeit von Metallen gesteigert werden. Dies wird in Halbleiterbauelementen ausge-
13 SI'I%. Widerstand j stem Ge ~g ~ OiCl,:ant Potystyrot GaAs G. P Si N~Cr ~u Pb. Al G~ainit ~t W W llr ' 10. lob Leitlahigkeit.. S em-1 Isolator Halb leiter Me to. t ~~~----~II.r! --~~~~----~I/! Bi1d 1.1 Leitfahigkeit und spezifischer Widerstand von Metallen, Ha1bleitern und Isolatoren bei Zimmertemperatur nutzt. Zwischen Metallen und Halblei tern gibt es bezuglich der Leitfahigkeit einige typische unterschiede: - Bei Halbleitern hangt die Leitfahigkeit sehr stark von Temperatur, Magnetfeld, Lichteinfall, mechanischer Belastung und gezielt zugesetzten Verunreinigungen ab (Metalle sind diesbezuglich wei t weniger empfindlich). Darauf beruht u. a. die Bedeutung der Halbleiter fur elektronische Bauelemente. - Bei sehr tiefen Temperaturen (T-O) werden Metalle sehr gut lei tend, Halblei ter nehmen dagegen Isolatoreigenschaften an. Eine tibersicht der typischsten Halbleiter enthalt Tafel 1.1. Die wichtigsten Materialien Germanium (mit abnehmender Bedeutung) und Silizium (dominierend) befinden sich in der vierten Gruppe des Periodischen Systems. Daneben haben zahlreiche Verbindungshalbleiter aus zwei oder mehr Elementen Bedeutung erlangt, die entsprechend der Zahl der beteiligten Elemente binare, ternare oder guaternare Halbleiter genannt werden.
14 Zn, Cd, Hg In, Ga AI, B C Sn, Ge Si Sb, As P Te Se ~ f I CdS CdSe, CdTe ZnS ZnSe, ZnTe HgTe ~ HgS AlP, AlAs, AISb GaAs, GaP, GaN GaSb InP, InAs, InSb Al x Ga 1 _ x As, GaAS 1 _ x P x Ga x ln 1 _ x As SiC PbS PbTe PbSe Tafel 1.1 Element-, binare und ternare Verbindungshalbleiter Von den Elementhalbleitern stellt Si das mit Abstand am verbreitetsten eingesetzte Halbleitermaterial fur diskrete und integrierte Halblei terbauelemente dar. Von den binaren Verbindungen dominieren derzeit die sog. AIII_BV_Halbleiter (bestehend aus der 111- und V-Elementgruppe) und dort besonders GaAs fur Mikrowellen- und optoelektronische Bauelemente, zunehmend auch fur schnelle integrierte Schaltungen. Fortschritte der Materialherstellung fuhrten zu einem vermehrten Einsatz von ternaren und quaternaren Verbindungen, z. B. AlxGa 1 _xas fur den sog. modulationsdotierten Feldeffekttransist~r (HEMT, s. Abschnitt 5.3), daruber hinaus fur Halbleiterlaser, wahrend GaAs 1 _ x p x derzeit als Standardmaterial fur lichtemittierende Dioden im sichtbaren Bereich gilt. Zu einer genaueren Kennzeichnung der elektronischen Vorgange in Halbleitern reicht die Leitfahigkeit naturlich nicht aus. Deshalb ist eine tiefere Analyse des Lei tungsvorganges von zunachst zwei scheinbar unterschiedlichen Ausgangspunkten erforderlich: dem Bindungsmodell und dem Bandermodell. 1m ersten Fall entstehen freie Elektronen durch Ionisation von Atomen des Kristallgitters. Dabei werden Gitterbindungen auf-
15 gebrochen. Die Grundlage fur die zweite Darstellung bilden die Welleneigenschaften des Elektrons /1/-/5/, /8/, /9/ Bindungsmodell. Eigen- und Storhalbleiter Bindungsmodell. Bausteine der Materie sind die Atome. Sie bestehen nach dem Bohrschen Atommodell aus dem positiv geladenen Kern und der umgebenden Elektronenhiille. Das sind Schalen, die mit einer bestimmten Anzahl von Elektronen besetzt sind. Diese Elektronenhiille bestimmt die chemischen und s;f.) 0~0 S; ~ \..V Si ~c.:.*" o ~ 6 " ~ II» II " /1 ~I»" ~ " 1/ \\ '", Bild 1.2 Bindungsstruktur (kovalente Bindung) des Eigenhalbleiters in zweidimensionaler Darstellung mit zunehmender zeichnerischer Abstraktion amorph ~ Halbleitermaterial (dunne Schichten z. T. in Bauelementen (Solarzellen) eingesetzt) kristallin einkristallin (Halbleiterbauelemente) polykristallin (Elektrodenschichten in der Mikroelektronik, Sonderbauelemente) Tafel 1.2 Unterteilung der Halbleitermaterialien nach dem kristallinen Zustand elektrischen Eigenschaften eines Stoffes, insbesondere legt die Zahl der auberen Elektronen die chemische Bindung der Atome untereinander fest. Das einzelne Silizium-Atom hat entsprechend der Stellung im Periodischen System vier Valenzelektronen (Bild 1.2). Die in Bauelementen angewendeten Halblei termaterialien werden hauptsachlich in kristalliner, ge-
16 nauer einkristalliner Form verwendet (Tafel 1.2). Kristalline Stoffe haben eine regelmabige, raumlich wiederkehrende Atomanordnung. Deshalb wiederholen sich in allen drei Richtungen bestimmte "Grundstrukturen", die sog. Elementarzellen. In polykristallinen Stoffen erstreckt sich dieser regelmabige Aufbau nur uber begrenzte Volumina - die sog. Kristallite -, was zu Abweichungen z. B. im Leitungsverhalten gegenuber einkristallinen Stoffen fuhrt. Amorphe Stoffe haben keinen Gitteraufbau. Silizium kann auch in polykristalliner oder amorpher Form hergestell t werden. Gerade diese Materialien haben in den letzten Jahren sehr an Bedeutung, z. B. fur Elektroden, Leiterbahnen und Kontaktgebiete in integrierten Schaltungen, ebenso fur Solarzellen und eine Reihe von Sonderbauelementen, gewonnen. Andere polykristalline Stoffe werden schon lange zu HeiB- und Kaltleitern, Fotozellen u. a. m. eingesetzt. QJ bj c J Bild 1.3 Kubische Elementarzelle a) einfach kubisch (basiszentriert), b) kubisch raurnzentriert, c) kubisch flachenzentriert. a Gitterkonstante (Richtwert 0,5 nm) In der Elementarzelle konnen die Atome in den Eckpunkten und/ oder Mi tte ausgezeichneter Ebenen si tzen. So entstehen basis-, flachen- oder raumzentrierte Gitter (Bild 1.3). Leitermaterialien (eu, Ag, Au) beispielsweise haben das sog. kubisch-flachenzentrierte Gitter. Die technisch wichtigen Halbleiter Si, Ge und GaAs kristallisieren im sog. Diamant- bzw. Zinkblendegitter (GaAs), das sich aus zwei verschachtelten
17 kubischfuichenzentrierten Gi ttern mit 8 Atomen in der Einheitszelle ergibt. Als Konsequenz haben Halbleiter in wichtigen Punkten isotrope, d. h. richtungsunabhangige Eigenschaften. Die Atome im Kristallgitter sind so angeordnet, so dab jedes von ihnen ein Valenzelektron mit jedem der vier Nachbaratomen teilt. Die dazu erforderlichen kovalenten Bindungen sind im Bild 1.2 eingetragen. z 1110) (111) Bild 1.4 Ausgezeichnete Ebenen im kubischen Kristall 1m kubischen Kristall gibt es verschiedene Flachen, von denen die wichtigsten drei lauten (Bild 1.4): Wurfelflachen (z. B. (100), (010) usw.), Raumdiagonalflachen (z. B. (111), (111) ) und Diagonalflachen (z. B. (110), (011)). Die Bezeichnung erfolgt dabei durch die Millerschen Indizes. Die Raumrichtungen senkrecht zu den Flachen haben die gleichen Indizes, jedoch in eckigen Klammern (z. B. [100J, x-achse im Bild 1.4). Manche Halbleitereigenschaften hangen von der kristallographischen Richtung abo Fur Si-Halbleiterbauelemente wird durchweg ['100] - und ['I11J-orientiertes Material verwendet. Bei Temperaturen in Nahe des absoluten Nullpunktes sind aile Valenzelektronen des Siliziums kovalent gebunden und freie Elektronen fur den Stromtransport nicht verfligbar. Damit verhalt sich der Halbleiter wie ein Isolator. Urn StromfluB zu ermoglichen, mlissen entweder Elektronen aus den Bindungen be-
18 freit oder andere "geschaffen" werden, die nicht aus Kristallbindungen stammen. Flihrt man dem Kristall Energie z. B. in Form von Licht oder Warme zu, so werden Bindungen aufgebrochen (Bild 1.5), und es entstehen freie Elektronen. Gleichzeitig bleibt eine Leerstelle, also ein Loch in der Originalbindung zurlick mit einer positiven Nettoladung. Flillt nun ein Valenzelektron aus einer Nachbarbindung dieses "Loch", so verschiebt es sich an den neu entstehenden Loch-Platz. Dies ist gleichbedeutend mit der Bewegung einer positiven Ladung durch den Kristall. bewegliches Elektron W a) a.ufgebrochene Ciitterblndung bew.glichu loch b) -x Wv Bild 1.5 Erzeugung freier E1ektronen und Locher im Eigenhalbleiter durch Aufbrechen von Gitterbindungen a) Bindungsmode11 (zweidimensional), b) Bandermodell Durch Aufbrechen von Bindungen entstehen somi t Locher und Elektronen, die beide z. B. durch ein elektrisches Feld im Kristall bewegt werden konnen und so den stromtransport ermoglichen. Die Erzeugung von Elektronen und Lochern durch Energiezufuhr (gleichgliltig ob thermisch, optisch o. a.) heibt Tragergeneration. Ihr steht ein zugeordneter, entgegenwirkender Vorgang gegenliber: die Rekombination. Dabei flillt ein freies Elektron ein Loch in der Valenzbindung wieder auf und beide Teilchen verschwinden. Bei einer gegebenen Temperatur werden nun kovalente Bindungen durch thermische Anregung standig aufgebrochen und gleichzei tig verschwinden Elektronen und Locher durch fortgesetzte Rekombination. Aus diesem thermodyna-
19 mischen Gleichgewicht bestimmen sich die Elektronen- und Locherdichten im idealen Halbleitermaterial (ohne Verunreinigung und Fehlstellen) zu (1.1 ) In. heibt Eiqenleitunqs- oder Intrinsicdichte. eine fur eine b~stimmte Temperatur charakteristische GroBe des sog. Eigenhalbleiters. Der Index bei den Tragerdichten no' Po deutet auf das thermodynamische Gleichgewicht hin. Auf das im Bild 1.5b dargestellte Bandermodell wird spater zuruckgegriffen. Weil zwischen der Elektronen-Loch-Paarbildung (Generation, Generationsrate gil und der Rekombination (Rekombinationsrate r i ) bei jeder Temperatur ein Gleichgewichtszustand herrscht, gilt r i = gi'" n i (T). (1.2 ) Quanti tati v hat die mi ttlere thermische Energie eines j eden Atoms und Elektrons im Kristall bei der (absoluten) Temperatur T den Wert kt (k Boltzmann-Konstante), das ergibt bei T = 300 K (Zimmertemperatur) etwa kt = 0,026 ev. Die kovalente Bindungsenergie betragt bei 8ilizium etwa 1,1 ev bei Raumtemperatur, d. h. rd. das 40fache von kt. Deshalb entstehen durch die thermische Anregung nur relativ wenig freie Elektronen-Loch-Paare, m. a. W. sind die Tragerdichten no und Po des eigenleitenden 8iliziums bei Raumtemperatur gering. Mit anderen Halbleitermaterialien verhalt es sich ahnlich: n. (T = 300 K) 1 Ge 2, cm 8i 1, cm -3 GaAs 2, cm
20 Die unterschiedlichen Werte hangen direkt mit der Bindungsenergie zusammen: ist die Eigenleitungsdichte. Je intensiver die Bindung, desto kleiner AuBer durch thermische Generation konnen auch Trager durch Einbau von Fremdatomen oder Storstellen - die sog. Dotanten - erzeugt werden. Dieser Vorgang heibt Dotierung und die so erzeugte Leitung Storstellenleitung. Dabei werden Elemente der Gruppe V des Periodischen Systems zur Erhohung der Elektronenkonzentration oder zur Erzeugung von n-leitung, solche der Gruppe III zur Erhohung der Locherkonzentration oder Erzeugung von p-leitung benutzt. Die zugehorigen Storstellen heiben Donatoren und Akzeptoren. u...-r-_ bewtg( iches p Elektron ~ positiv ionisierhs P-Atolll orhfest ( Dona. tor) Cl) b) w Leitband We awo:: I Ts--fiJ Wo ionisie:rt Oonatorniv.Qu ~Wv Valenzband -x Bild 1.6 Erzeugung freier Elektronen durch Donatoren (Storhalbleiter, n-leitend) a) Bindungsmodell (zweidimensional), b) Bandermodell (z. B. Sit We - Wv-:::J 1,1 ev; W v - W D a:: 0,05 ev) Bild 1.6 zeigt den Einbau einer 5wertigen Storstelle mit 5 Valenzelektronen in ein Si-Gitter. Nur vier der funf Valenzelektronen werden zum Auffullen der Bindungen benotigt. Das verbleibende funfte Bindungselektron kann aus der ursprunglichen Bindung durch Zufuhr einer relativ kleinen Ionisierungsenergie (typisch mev«im Vergleich zu 1,1 ev) freigesetzt werden. Allgemein ist die Bindungsenergie l:j. WD der Storstellen klein gegen kt. Deshalb entstehen beim Einbau von 5wertigen Storstellen in das Si-Gitter bereits bei Zimmertemperatur entsprechend viele freie Elektronen.
Elektronische Halbleiterbauelemente
 Elektronische Halbleiterbauelemente Von Prof. Dr.-Ing. habil. Reinhold Paul Technische Universität Hamburg-Harburg 3., durchgesehene Auflage Mit 277 Bildern und 30 Tafeln B. G. Teubner Stuttgart 1992 Inhaltsverzeichnis
Elektronische Halbleiterbauelemente Von Prof. Dr.-Ing. habil. Reinhold Paul Technische Universität Hamburg-Harburg 3., durchgesehene Auflage Mit 277 Bildern und 30 Tafeln B. G. Teubner Stuttgart 1992 Inhaltsverzeichnis
Physik der Halbleiterbauelemente
 Frank Thuselt Physik der Halbleiterbauelemente Einführendes Lehrbuch für Ingenieure und Physiker Mit 181 Abbildungen 4y Springer Inhaltsverzeichnis Kursiv gekennzeichnete Abschnitte können beim ersten
Frank Thuselt Physik der Halbleiterbauelemente Einführendes Lehrbuch für Ingenieure und Physiker Mit 181 Abbildungen 4y Springer Inhaltsverzeichnis Kursiv gekennzeichnete Abschnitte können beim ersten
Halbleiter und Transistoren - Prinzip und Funktionsweise
 Halbleiter und Transistoren - Prinzip und Funktionsweise Reine Halbleitermaterialien, wie Silizium (Si) oder Germanium (Ge) sind bei Zimmertemperatur fast Isolatoren: bzw. bei sinkender Temperatur HL Isolator
Halbleiter und Transistoren - Prinzip und Funktionsweise Reine Halbleitermaterialien, wie Silizium (Si) oder Germanium (Ge) sind bei Zimmertemperatur fast Isolatoren: bzw. bei sinkender Temperatur HL Isolator
Atom-, Molekül- und Festkörperphysik
 Atom-, Molekül- und Festkörperphysik für LAK, SS 2013 Peter Puschnig basierend auf Unterlagen von Prof. Ulrich Hohenester 10. Vorlesung, 27. 6. 2013 Halbleiter, Halbleiter-Bauelemente Diode, Solarzelle,
Atom-, Molekül- und Festkörperphysik für LAK, SS 2013 Peter Puschnig basierend auf Unterlagen von Prof. Ulrich Hohenester 10. Vorlesung, 27. 6. 2013 Halbleiter, Halbleiter-Bauelemente Diode, Solarzelle,
Mikroprozessor - und Chiptechnologie
 Mikroprozessor - und Chiptechnologie I 1 1 Halbleiterfunktionen 2 8 Halbleiterbauelemente 8 Halbleiterbauelemente 8.1 Grundlagen 8.2 Dioden 8.3 Transistoren 8.4 Einfache Grundschaltungen Als halbleitend
Mikroprozessor - und Chiptechnologie I 1 1 Halbleiterfunktionen 2 8 Halbleiterbauelemente 8 Halbleiterbauelemente 8.1 Grundlagen 8.2 Dioden 8.3 Transistoren 8.4 Einfache Grundschaltungen Als halbleitend
Halbleiterarten. Technische Universität Ilmenau Institut für Werkstofftechnik. Halbleiter. elektronische Halbleiter
 Halbleiterarten Halbleiter kristalline Halbleiter amorphe Halbleiter elektronische Halbleiter Ionenhalbleiter elektronische Halbleiter Ionenhalbleiter Element Halbleiter Verbindungshalbleiter Eigen Halbleiter
Halbleiterarten Halbleiter kristalline Halbleiter amorphe Halbleiter elektronische Halbleiter Ionenhalbleiter elektronische Halbleiter Ionenhalbleiter Element Halbleiter Verbindungshalbleiter Eigen Halbleiter
Freie Elektronen bilden ein Elektronengas. Feste positive Aluminiumionen. Abb. 1.1: Metallbindung: Feste Atomrümpfe und freie Valenzelektronen
 1 Grundlagen 1.1 Leiter Nichtleiter Halbleiter 1.1.1 Leiter Leiter sind generell Stoffe, die die Eigenschaft haben verschiedene arten weiterzuleiten. Im Folgenden steht dabei die Leitfähigkeit des elektrischen
1 Grundlagen 1.1 Leiter Nichtleiter Halbleiter 1.1.1 Leiter Leiter sind generell Stoffe, die die Eigenschaft haben verschiedene arten weiterzuleiten. Im Folgenden steht dabei die Leitfähigkeit des elektrischen
Halbleiter. Das Herz unserer multimedialen Welt. Bastian Inselmann - LK Physik
 Halbleiter Das Herz unserer multimedialen Welt Inhalt Bisherig Bekanntes Das Bändermodell Halbleiter und ihre Eigenschaften Dotierung Anwendungsbeispiel: Funktion der Diode Bisher Bekanntes: Leiter Isolatoren
Halbleiter Das Herz unserer multimedialen Welt Inhalt Bisherig Bekanntes Das Bändermodell Halbleiter und ihre Eigenschaften Dotierung Anwendungsbeispiel: Funktion der Diode Bisher Bekanntes: Leiter Isolatoren
Elektrizitätsleitung in Halbleitern
 Elektrizitätsleitung in Halbleitern Halbleiter sind chemische Elemente, die elektrischen Strom schlecht leiten. Germanium, Silicium und Selen sind die technisch wichtigsten Halbleiterelemente; aber auch
Elektrizitätsleitung in Halbleitern Halbleiter sind chemische Elemente, die elektrischen Strom schlecht leiten. Germanium, Silicium und Selen sind die technisch wichtigsten Halbleiterelemente; aber auch
Mikroprozessor - und Chiptechnologie
 Mikroprozessor - und Chiptechnologie I 1 1 Halbleiterfunktionen 2 8 Halbleiterbauelemente 8 Halbleiterbauelemente 8.1 Grundlagen 8.2 Dioden 8.3 Transistoren 8.4 Einfache Grundschaltungen Als halbleitend
Mikroprozessor - und Chiptechnologie I 1 1 Halbleiterfunktionen 2 8 Halbleiterbauelemente 8 Halbleiterbauelemente 8.1 Grundlagen 8.2 Dioden 8.3 Transistoren 8.4 Einfache Grundschaltungen Als halbleitend
P. Deus/W. Stolz. Physik in Übungsaufgaben
 P. Deus/W. Stolz Physik in Übungsaufgaben Physik in Ubu ngsaufgaben Von Dr. rer. nat. Peter Deus Freiberg Prof. Dr. rer. nat. Werner Stolz Technische Universität Bergakademie Freiberg B. G. Teubner Verlagsgesellschaft
P. Deus/W. Stolz Physik in Übungsaufgaben Physik in Ubu ngsaufgaben Von Dr. rer. nat. Peter Deus Freiberg Prof. Dr. rer. nat. Werner Stolz Technische Universität Bergakademie Freiberg B. G. Teubner Verlagsgesellschaft
Gleichstromkreis. 2.2 Messgeräte für Spannung, Stromstärke und Widerstand. Siehe Abschnitt 2.4 beim Versuch E 1 Kennlinien elektronischer Bauelemente
 E 5 1. Aufgaben 1. Die Spannungs-Strom-Kennlinie UKl = f( I) einer Spannungsquelle ist zu ermitteln. Aus der grafischen Darstellung dieser Kennlinie sind Innenwiderstand i, Urspannung U o und Kurzschlussstrom
E 5 1. Aufgaben 1. Die Spannungs-Strom-Kennlinie UKl = f( I) einer Spannungsquelle ist zu ermitteln. Aus der grafischen Darstellung dieser Kennlinie sind Innenwiderstand i, Urspannung U o und Kurzschlussstrom
Leistungsbauelemente
 I (Kurs-Nr. 21645), apl. Prof. Dr. rer. nat. Fakultät für Mathematik und Informatik Fachgebiet Elektrotechnik und Informationstechnik ( ) D-58084 Hagen 1 Gliederung Einleitung Physikalische Grundlagen
I (Kurs-Nr. 21645), apl. Prof. Dr. rer. nat. Fakultät für Mathematik und Informatik Fachgebiet Elektrotechnik und Informationstechnik ( ) D-58084 Hagen 1 Gliederung Einleitung Physikalische Grundlagen
Physik der Halbleiterbauelemente
 Physik der Halbleiterbauelemente Einführendes Lehrbuch für Ingenieure und Physiker Bearbeitet von Frank Thuselt 1. Auflage 2011. Buch. xv, 407 S. Hardcover ISBN 978 3 642 20031 1 Format (B x L): 15,5 x
Physik der Halbleiterbauelemente Einführendes Lehrbuch für Ingenieure und Physiker Bearbeitet von Frank Thuselt 1. Auflage 2011. Buch. xv, 407 S. Hardcover ISBN 978 3 642 20031 1 Format (B x L): 15,5 x
Drohaflttsveirzeklhiinifls
 Drohaflttsveirzeklhiinifls 1 Besonderheiten leistungselektronischer Halbleiterbauelemente 1 2 Halbleiterphysikalische Grundlagen 5 2.1 Eigenschaften der Halbleiter, physikalische Grundlagen 5 2.1.1 Kristallgitter
Drohaflttsveirzeklhiinifls 1 Besonderheiten leistungselektronischer Halbleiterbauelemente 1 2 Halbleiterphysikalische Grundlagen 5 2.1 Eigenschaften der Halbleiter, physikalische Grundlagen 5 2.1.1 Kristallgitter
TRANSISTORKENNLINIEN 1 (TRA 1) DANIEL DOLINSKY UND JOHANNES VRANA
 TRANSISTORKENNLINIEN 1 (TRA 1) DANIEL DOLINSKY UND JOHANNES VRANA Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 1 2. Messverfahren... 1 3. Bemerkung zur Fehlerrechnung... 1 4. Stromverstärkungsfaktor... 2 5. Eingangskennlinie...
TRANSISTORKENNLINIEN 1 (TRA 1) DANIEL DOLINSKY UND JOHANNES VRANA Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 1 2. Messverfahren... 1 3. Bemerkung zur Fehlerrechnung... 1 4. Stromverstärkungsfaktor... 2 5. Eingangskennlinie...
Inhaltsverzeichnis Grundlagen Kontakte
 1. Grundlagen... 1 1.1 Elektrische Netzwerke, CAD-Werkzeuge.... 1 1.2 Ideale Netzwerkelemente..... 3 1.2.1 Widerstände... 3 1.2.2 Kapazitäten... 5 1.2.3 Unabhängige und gesteuerte Quellen... 6 1.3 NetzwerkeauslinearenElementen...
1. Grundlagen... 1 1.1 Elektrische Netzwerke, CAD-Werkzeuge.... 1 1.2 Ideale Netzwerkelemente..... 3 1.2.1 Widerstände... 3 1.2.2 Kapazitäten... 5 1.2.3 Unabhängige und gesteuerte Quellen... 6 1.3 NetzwerkeauslinearenElementen...
3. Halbleiter und Elektronik
 3. Halbleiter und Elektronik Halbleiter sind Stoe, welche die Eigenschaften von Leitern sowie Nichtleitern miteinander vereinen. Prinzipiell sind die Elektronen in einem Kristallgitter fest eingebunden
3. Halbleiter und Elektronik Halbleiter sind Stoe, welche die Eigenschaften von Leitern sowie Nichtleitern miteinander vereinen. Prinzipiell sind die Elektronen in einem Kristallgitter fest eingebunden
6/2 Halbleiter Ganz wichtige Bauteile
 Elektronik 6/2 Seite 1 6/2 Halbleiter Ganz wichtige Bauteile Erforderlicher Wissensstand der Schüler Begriffe: Widerstand, Temperatur, elektrisches Feld, Ionen, Isolator Lernziele der Unterrichtssequenz
Elektronik 6/2 Seite 1 6/2 Halbleiter Ganz wichtige Bauteile Erforderlicher Wissensstand der Schüler Begriffe: Widerstand, Temperatur, elektrisches Feld, Ionen, Isolator Lernziele der Unterrichtssequenz
Grundlagen zum Versuch Aufbau einer Messkette für den Nachweis kleinster Ladungsmengen
 Grundlagen zum Versuch Aufbau einer Messkette für den Nachweis kleinster Ladungsmengen III.1 Halbleiter: Einzelne Atome eines chemischen Elements besitzen nach dem Bohrschen Atommodell einen positiv geladenen
Grundlagen zum Versuch Aufbau einer Messkette für den Nachweis kleinster Ladungsmengen III.1 Halbleiter: Einzelne Atome eines chemischen Elements besitzen nach dem Bohrschen Atommodell einen positiv geladenen
Geschichte der Halbleitertechnik
 Geschichte der Halbleitertechnik Die Geschichte der Halbleitertechnik beginnt im Jahr 1823 als ein Mann namens v. J. J. Berzellus das Silizium entdeckte. Silizium ist heute das bestimmende Halbleitermaterial
Geschichte der Halbleitertechnik Die Geschichte der Halbleitertechnik beginnt im Jahr 1823 als ein Mann namens v. J. J. Berzellus das Silizium entdeckte. Silizium ist heute das bestimmende Halbleitermaterial
Norbert Koch. Polymer gegen Silizium: Wer wird in der Elektronik gewinnen?
 Polymer gegen Silizium: Wer wird in der Elektronik gewinnen? Norbert Koch Humboldt Universität zu Berlin, Institut für Physik & IRIS Adlershof Helmholtz Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH
Polymer gegen Silizium: Wer wird in der Elektronik gewinnen? Norbert Koch Humboldt Universität zu Berlin, Institut für Physik & IRIS Adlershof Helmholtz Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH
Gliederung der Vorlesung Festkörperelektronik
 Gliederung der Vorlesung Festkörperelektronik 1. Grundlagen der Quantenphysik 2. Elektronische Zustände 3. Aufbau der Materie 4. Elektronen in Kristallen 5. Halbleiter 6. Quantenstatistik 7. Dotierte Halbleiter
Gliederung der Vorlesung Festkörperelektronik 1. Grundlagen der Quantenphysik 2. Elektronische Zustände 3. Aufbau der Materie 4. Elektronen in Kristallen 5. Halbleiter 6. Quantenstatistik 7. Dotierte Halbleiter
Aufgaben zum Skriptum Informatik
 Aufgaben zum Skriptum Informatik Andre Spiegel Universitat Stuttgart Prof. Dr. Jochen Ludewig Universitat Stuttgart Prof. Dr. Hans-JUrgen Appelrath Universitat Oldenburg 83 B. G.Teubner Stuttgart I,rillfl
Aufgaben zum Skriptum Informatik Andre Spiegel Universitat Stuttgart Prof. Dr. Jochen Ludewig Universitat Stuttgart Prof. Dr. Hans-JUrgen Appelrath Universitat Oldenburg 83 B. G.Teubner Stuttgart I,rillfl
Strom und Spannungsmessung, Addition von Widerständen, Kirchhoffsche Regeln, Halbleiter, p-n-übergang, Dioden, fotovoltaischer Effekt
 Versuch 27: Solarzellen Seite 1 Aufgaben: Vorkenntnisse: Lehrinhalt: Literatur: Messung von Kurzschlussstrom und Leerlaufspannung von Solarzellen, Messung der I-U-Kennlinien von Solarzellen, Bestimmung
Versuch 27: Solarzellen Seite 1 Aufgaben: Vorkenntnisse: Lehrinhalt: Literatur: Messung von Kurzschlussstrom und Leerlaufspannung von Solarzellen, Messung der I-U-Kennlinien von Solarzellen, Bestimmung
Halbleiter, Dioden. wyrs, Halbleiter, 1
 Halbleiter, Dioden Halbleiter, 1 Inhaltsverzeichnis Aufbau & physikalische Eigenschaften von Halbleitern Veränderung der Eigenschaften mittels Dotierung Vorgänge am Übergang von dotierten Materialen Verhalten
Halbleiter, Dioden Halbleiter, 1 Inhaltsverzeichnis Aufbau & physikalische Eigenschaften von Halbleitern Veränderung der Eigenschaften mittels Dotierung Vorgänge am Übergang von dotierten Materialen Verhalten
Detektoren in der Kern- und Teilchenphysik Szintillationsdetektoren Ionisationsdetektoren Halbleiterdetektoren
 Wechselwirkung geladener Teilchen in Materie Physik VI Sommersemester 2008 Detektoren in der Kern- und Teilchenphysik Szintillationsdetektoren Ionisationsdetektoren Halbleiterdetektoren Szintillationsdetektoren
Wechselwirkung geladener Teilchen in Materie Physik VI Sommersemester 2008 Detektoren in der Kern- und Teilchenphysik Szintillationsdetektoren Ionisationsdetektoren Halbleiterdetektoren Szintillationsdetektoren
Dotierung. = gezieltes Verunreinigen des Si-Kristalls mit bestimmten Fremdatomen. n-dotierung Einbau. von Atomen mit 3 Valenzelektronen
 Halbleiter Dotierung = gezieltes Verunreinigen des Si-Kristalls mit bestimmten Fremdatomen. n-dotierung Einbau von Atomen mit 5 Valenzelektronen = Donatoren Elektronengeber (P, Sb, As) p-dotierung Einbau
Halbleiter Dotierung = gezieltes Verunreinigen des Si-Kristalls mit bestimmten Fremdatomen. n-dotierung Einbau von Atomen mit 5 Valenzelektronen = Donatoren Elektronengeber (P, Sb, As) p-dotierung Einbau
1 Leitfähigkeit in Festkörpern
 1 Leitfähigkeit in Festkörpern Elektrische Leitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die die Fähigkeit eines Stoffes angibt, elektrischen Strom zu leiten. Bändermodell Die Leitfähigkeit verschiedener
1 Leitfähigkeit in Festkörpern Elektrische Leitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die die Fähigkeit eines Stoffes angibt, elektrischen Strom zu leiten. Bändermodell Die Leitfähigkeit verschiedener
Silizium- Planartechnologie
 Hans Günther Wagemann, Tim Schönauer Silizium- Planartechnologie Grundprozesse, Physik und Bauelemente Teubner B. G.Teubner Stuttgart Leipzig Wiesbaden Vorwort V Übersicht über den Stoff des Buches V Inhaltsverzeichnis
Hans Günther Wagemann, Tim Schönauer Silizium- Planartechnologie Grundprozesse, Physik und Bauelemente Teubner B. G.Teubner Stuttgart Leipzig Wiesbaden Vorwort V Übersicht über den Stoff des Buches V Inhaltsverzeichnis
Stromdichten in Halbleitermaterialien
 Stromdichten in Halbleitermaterialien Berechnung der Leitfähigkeit: j = qnµ E ρ(w), ρ(w), Mögliche Sprachverwirrungen und Fallstricke: Energien: E bzw. W Bandindizies: C bzw. L Zustandsdichten: N(W), ρ(w),
Stromdichten in Halbleitermaterialien Berechnung der Leitfähigkeit: j = qnµ E ρ(w), ρ(w), Mögliche Sprachverwirrungen und Fallstricke: Energien: E bzw. W Bandindizies: C bzw. L Zustandsdichten: N(W), ρ(w),
Leistungsbauelemente
 I (Kurs-Nr. 21645), apl. Prof. Dr. rer. nat. Fakultät für Mathematik und Informatik Fachgebiet Elektrotechnik und Informationstechnik ( ) D-58084 Hagen 1 Gliederung Einleitung Physikalische Grundlagen
I (Kurs-Nr. 21645), apl. Prof. Dr. rer. nat. Fakultät für Mathematik und Informatik Fachgebiet Elektrotechnik und Informationstechnik ( ) D-58084 Hagen 1 Gliederung Einleitung Physikalische Grundlagen
Die kovalente Bindung
 Die kovalente Bindung Atome, die keine abgeschlossene Elektronenschale besitzen, können über eine kovalente Bindung dieses Ziel erreichen. Beispiel: 4 H H + C H H C H H Die Wasserstoffatome erreichen damit
Die kovalente Bindung Atome, die keine abgeschlossene Elektronenschale besitzen, können über eine kovalente Bindung dieses Ziel erreichen. Beispiel: 4 H H + C H H C H H Die Wasserstoffatome erreichen damit
Kapitel 7 Halbleiter/Bauelemente
 Kapitel 7 Halbleiter/Bauelemente Bändermodel, Durch Wechselwirkung der Elektronen über mehrere Atomabstände kommt es zur Ausbildung von Energiebändern (vgl. diskrete Energien Bohr sche Atommodell) Valenzband=leicht
Kapitel 7 Halbleiter/Bauelemente Bändermodel, Durch Wechselwirkung der Elektronen über mehrere Atomabstände kommt es zur Ausbildung von Energiebändern (vgl. diskrete Energien Bohr sche Atommodell) Valenzband=leicht
Leiter, Halbleiter, Isolatoren
 eiter, Halbleiter, Isolatoren lektronen in Festkörpern: In einzelnem Atom: diskrete erlaubte nergieniveaus der lektronen. In Kristallgittern: Bänder erlaubter nergie: gap = Bandlücke, pot Positionen der
eiter, Halbleiter, Isolatoren lektronen in Festkörpern: In einzelnem Atom: diskrete erlaubte nergieniveaus der lektronen. In Kristallgittern: Bänder erlaubter nergie: gap = Bandlücke, pot Positionen der
1. Teil: ANALOGELEKTRONIK
 1. Teil: ANALOGELEKTRONIK 1. ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN DER FESTEN MATERIE 1.1. EINLEITUNG Um zu verstehen, wie Halbleiter als Bauteile der Elektronik funktionieren, ist es nützlich, sich mit dem Aufbau
1. Teil: ANALOGELEKTRONIK 1. ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN DER FESTEN MATERIE 1.1. EINLEITUNG Um zu verstehen, wie Halbleiter als Bauteile der Elektronik funktionieren, ist es nützlich, sich mit dem Aufbau
Physikalisches Grundpraktikum V13 PLANCKsches Wirkungsquantum & LED
 Aufgabenstellung: Bestimmen e die Schleusenspannungen verschiedenfarbiger Leuchtdioden aus den Strom- Spannungs-Kennlinien. Bestimmen e anhand der Emissionswellenlängen das PLANCKsche Wirkungsquantum h.
Aufgabenstellung: Bestimmen e die Schleusenspannungen verschiedenfarbiger Leuchtdioden aus den Strom- Spannungs-Kennlinien. Bestimmen e anhand der Emissionswellenlängen das PLANCKsche Wirkungsquantum h.
Spezifischer Widerstand fester Körper. Leiter Halbleiter Isolatoren. Kupferoxid
 R. Brinkmann http://brinkmann-du.de Seite 1 26.11.2013 Halbleiter Widerstandsbestimmung durch Strom - Spannungsmessung Versuch: Widerstandsbestimmung durch Strom und Spannungsmessung. 1. Leiter : Wendel
R. Brinkmann http://brinkmann-du.de Seite 1 26.11.2013 Halbleiter Widerstandsbestimmung durch Strom - Spannungsmessung Versuch: Widerstandsbestimmung durch Strom und Spannungsmessung. 1. Leiter : Wendel
Typische Eigenschaften von Metallen
 Typische Eigenschaften von Metallen hohe elektrische Leitfähigkeit (nimmt mit steigender Temperatur ab) hohe Wärmeleitfähigkeit leichte Verformbarkeit metallischer Glanz Elektronengas-Modell eines Metalls
Typische Eigenschaften von Metallen hohe elektrische Leitfähigkeit (nimmt mit steigender Temperatur ab) hohe Wärmeleitfähigkeit leichte Verformbarkeit metallischer Glanz Elektronengas-Modell eines Metalls
Halbleiterbauelemente
 Halbleiterbauelemente Von Dr.-Ing. Karl-Heinz Löcherer Professor an der Universität Hannover M 1 Mit 330 Biläern, 11 Tafeln und 36 Beispielen B. G. Teubner Stuttgart 1992 Inhalt 1 Übergänge zwischen Halbleitern,
Halbleiterbauelemente Von Dr.-Ing. Karl-Heinz Löcherer Professor an der Universität Hannover M 1 Mit 330 Biläern, 11 Tafeln und 36 Beispielen B. G. Teubner Stuttgart 1992 Inhalt 1 Übergänge zwischen Halbleitern,
VERBINDUNGSHALBLEITER
 VERBINDUNGSHALBLEITER VON EINEM AUTORENKOLLEKTIV UNTER LEITUNG VON PROF. DR. SC. NAT. KONRAD UNGER SEKTION PHYSIK DER KARL-MARX-UNIVERSITÄT LEIPZIG DR. RER. NAT. HABiL. HELMUT GÜNTHER SCHNEIDER VEB GALVANOTECHNIK
VERBINDUNGSHALBLEITER VON EINEM AUTORENKOLLEKTIV UNTER LEITUNG VON PROF. DR. SC. NAT. KONRAD UNGER SEKTION PHYSIK DER KARL-MARX-UNIVERSITÄT LEIPZIG DR. RER. NAT. HABiL. HELMUT GÜNTHER SCHNEIDER VEB GALVANOTECHNIK
Inhaltsverzeichnis. Inhaltsverzeichnis...VII. 1 Besonderheiten leistungselektronischer Halbleiterbauelemente...1
 VII Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis...VII 1 Besonderheiten leistungselektronischer Halbleiterbauelemente...1 2 Halbleiterphysikalische Grundlagen...5 2.1 Eigenschaften der Halbleiter, physikalische
VII Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis...VII 1 Besonderheiten leistungselektronischer Halbleiterbauelemente...1 2 Halbleiterphysikalische Grundlagen...5 2.1 Eigenschaften der Halbleiter, physikalische
Elektrische Leitung. Strom
 lektrische Leitung 1. Leitungsmechanismen Bändermodell 2. Ladungstransport in Festkörpern i) Temperaturabhängigkeit Leiter ii) igen- und Fremdleitung in Halbleitern iii) Stromtransport in Isolatoren iv)
lektrische Leitung 1. Leitungsmechanismen Bändermodell 2. Ladungstransport in Festkörpern i) Temperaturabhängigkeit Leiter ii) igen- und Fremdleitung in Halbleitern iii) Stromtransport in Isolatoren iv)
VLSI-Entwurf. Modelle und Schaltungen von Professor Dr.-Ing. Kurt Hoffmann 3., durchgesehene Auflage
 VLSI-Entwurf Modelle und Schaltungen von Professor Dr.-Ing. Kurt Hoffmann 3., durchgesehene Auflage Mit 307 Bildern, 15 Tabellen, 14 Beispielen und 77 Aufgaben R. Oldenbourg Verlag München Wien 1996 Inhaltsverzeichnis
VLSI-Entwurf Modelle und Schaltungen von Professor Dr.-Ing. Kurt Hoffmann 3., durchgesehene Auflage Mit 307 Bildern, 15 Tabellen, 14 Beispielen und 77 Aufgaben R. Oldenbourg Verlag München Wien 1996 Inhaltsverzeichnis
Bild 1.4 Wärmeschwingung des Kristallgitters bei T > 0K
 Bild 1.2 Das ideale Silizium-Gitter (Diamantgitterstruktur). Die großen Kugeln sind die Atomrümpfe; die kleinen Kugeln stellen die Valenzelektronen dar, von denen je zwei eine Elektronenpaarbrücke zwischen
Bild 1.2 Das ideale Silizium-Gitter (Diamantgitterstruktur). Die großen Kugeln sind die Atomrümpfe; die kleinen Kugeln stellen die Valenzelektronen dar, von denen je zwei eine Elektronenpaarbrücke zwischen
1. Systematik der Werkstoffe 10 Punkte
 1. Systematik der Werkstoffe 10 Punkte 1.1 Werkstoffe werden in verschiedene Klassen und die dazugehörigen Untergruppen eingeteilt. Ordnen Sie folgende Werkstoffe in ihre spezifischen Gruppen: Stahl Holz
1. Systematik der Werkstoffe 10 Punkte 1.1 Werkstoffe werden in verschiedene Klassen und die dazugehörigen Untergruppen eingeteilt. Ordnen Sie folgende Werkstoffe in ihre spezifischen Gruppen: Stahl Holz
Halbleiter- Optoelektronik
 Wolfgang Bludau Halbleiter- Optoelektronik Die physikalischen Grundlagen der LED's, Diodenlaser und pn-photodioden mit 114 Bildern Carl Hanser Verlag München Wien Inhaltsverzeichnis 1. Wellen- und Quantennatur
Wolfgang Bludau Halbleiter- Optoelektronik Die physikalischen Grundlagen der LED's, Diodenlaser und pn-photodioden mit 114 Bildern Carl Hanser Verlag München Wien Inhaltsverzeichnis 1. Wellen- und Quantennatur
= e kt. 2. Halbleiter-Bauelemente. 2.1 Reine und dotierte Halbleiter 2.2 der pn-übergang 2.3 Die Diode 2.4 Schaltungen mit Dioden
 2. Halbleiter-Bauelemente 2.1 Reine und dotierte Halbleiter 2.2 der pn-übergang 2.3 Die Diode 2.4 Schaltungen mit Dioden Zu 2.1: Fermi-Energie Fermi-Energie E F : das am absoluten Nullpunkt oberste besetzte
2. Halbleiter-Bauelemente 2.1 Reine und dotierte Halbleiter 2.2 der pn-übergang 2.3 Die Diode 2.4 Schaltungen mit Dioden Zu 2.1: Fermi-Energie Fermi-Energie E F : das am absoluten Nullpunkt oberste besetzte
Die Silizium - Solarzelle
 Die Silizium - Solarzelle 1. Prinzip einer Solarzelle Die einer Solarzelle besteht darin, Lichtenergie in elektrische Energie umzuwandeln. Die entscheidende Rolle bei diesem Vorgang spielen Elektronen
Die Silizium - Solarzelle 1. Prinzip einer Solarzelle Die einer Solarzelle besteht darin, Lichtenergie in elektrische Energie umzuwandeln. Die entscheidende Rolle bei diesem Vorgang spielen Elektronen
Funktionswerkstoffe. supraleitend. Halbleiter. Elektronische Eigenschaften - Einleitung
 Funktionswerkstoffe Elektronische Eigenschaften - Einleitung Bandstruktur Elektronenverteilung (Fermi-Dirac) Elektronenbeweglichkeit und Leitfähigkeit Metalle Elektronenanregung Leitfähigkeitsänderungen
Funktionswerkstoffe Elektronische Eigenschaften - Einleitung Bandstruktur Elektronenverteilung (Fermi-Dirac) Elektronenbeweglichkeit und Leitfähigkeit Metalle Elektronenanregung Leitfähigkeitsänderungen
Halbleiter-Leistungsbauelemente
 Halbleiter-Leistungsbauelemente Physik, Eigenschaften, Zuverlässigkeit Bearbeitet von Josef Lutz 1. Auflage 2012. Buch. xxii, 383 S. Hardcover ISBN 978 3 642 29795 3 Format (B x L): 16,8 x 24 cm Gewicht:
Halbleiter-Leistungsbauelemente Physik, Eigenschaften, Zuverlässigkeit Bearbeitet von Josef Lutz 1. Auflage 2012. Buch. xxii, 383 S. Hardcover ISBN 978 3 642 29795 3 Format (B x L): 16,8 x 24 cm Gewicht:
3 Halbleiter : pn-übergang, Solarzelle, Leuchtdiode. 3.1 Allgemeines F 3.1
 1 3 Halbleiter : pn-übergang, Solarzelle, Leuchtdiode 3.1 Allgemeines F 3.1 N isolierte Atome werden zum Festkörper (FK) zusammengeführt Wechselwirkung der beteiligten Elektronen Aufspaltung der Energieniveaus
1 3 Halbleiter : pn-übergang, Solarzelle, Leuchtdiode 3.1 Allgemeines F 3.1 N isolierte Atome werden zum Festkörper (FK) zusammengeführt Wechselwirkung der beteiligten Elektronen Aufspaltung der Energieniveaus
Kern. Elektronen. Atom. Elektronenpaar- Bindung. 2. Einführung in die Festkörper-Elektronik. 2.1 Energiebänder, Bandlücke
 2. Einführung in die Festkörper-Elektronik 2.1 bänder, Bandlücke Im Physik-Unterricht oder in grundlegenden Vorlesungen hat man (hoffentlich) gelernt, dass alle Materie aus Atomen aufgebaut ist (die Ausnahmen
2. Einführung in die Festkörper-Elektronik 2.1 bänder, Bandlücke Im Physik-Unterricht oder in grundlegenden Vorlesungen hat man (hoffentlich) gelernt, dass alle Materie aus Atomen aufgebaut ist (die Ausnahmen
HÖHERE PHYSIK SKRIPTUM VORLESUNGBLATT XII
 Prof. Dr. F. Koch Dr. H. E. Porteanu fkoch@ph.tum.de porteanu@ph.tum.de SS 2005 HÖHERE PHYSIK SKRIPTUM VORLESUNGBLATT XII 19.05.05 Festkörperphysik - Kristalle Nach unserem kurzen Ausflug in die Molekülphysik
Prof. Dr. F. Koch Dr. H. E. Porteanu fkoch@ph.tum.de porteanu@ph.tum.de SS 2005 HÖHERE PHYSIK SKRIPTUM VORLESUNGBLATT XII 19.05.05 Festkörperphysik - Kristalle Nach unserem kurzen Ausflug in die Molekülphysik
2.4 Metallische Bindung und Metallkristalle. Unterteilung in Metalle, Halbmetalle, Nicht metalle. Li Be B C N O F. Na Mg Al Si P S Cl
 2.4 Metallische Bindung und Metallkristalle Li Be B C N O F Na Mg Al Si P S Cl K Ca Ga Ge As Se Br Rb Sr In Sn Sb Te I Cs Ba Tl Pb Bi Po At Unterteilung in Metalle, Halbmetalle, Nicht metalle Metalle etwa
2.4 Metallische Bindung und Metallkristalle Li Be B C N O F Na Mg Al Si P S Cl K Ca Ga Ge As Se Br Rb Sr In Sn Sb Te I Cs Ba Tl Pb Bi Po At Unterteilung in Metalle, Halbmetalle, Nicht metalle Metalle etwa
VLSI-Entwurf. Modelle und Schaltungen von Professor Dr.-Ing. Kurt Hoffmann 4., durchgesehene Auflage
 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. VLSI-Entwurf Modelle und Schaltungen von Professor Dr.-Ing. Kurt
2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. VLSI-Entwurf Modelle und Schaltungen von Professor Dr.-Ing. Kurt
Hier: Beschränkung auf die elektrische Eigenschaften
 IV. Festkörperphysik Hier: Beschränkung auf die elektrische Eigenschaften 3 Aggregatzustände: fest, flüssig, gasförmig: Wechselspiel Anziehungskräfte der Teilchen gegen die thermische Energie kt. Zustand
IV. Festkörperphysik Hier: Beschränkung auf die elektrische Eigenschaften 3 Aggregatzustände: fest, flüssig, gasförmig: Wechselspiel Anziehungskräfte der Teilchen gegen die thermische Energie kt. Zustand
Grundlagen der Rechnerarchitektur
 Grundlagen der Rechnerarchitektur [CS3100.010] Wintersemester 2014/15 Tobias Scheinert / (Heiko Falk) Institut für Eingebettete Systeme/Echtzeitsysteme Ingenieurwissenschaften und Informatik Universität
Grundlagen der Rechnerarchitektur [CS3100.010] Wintersemester 2014/15 Tobias Scheinert / (Heiko Falk) Institut für Eingebettete Systeme/Echtzeitsysteme Ingenieurwissenschaften und Informatik Universität
Moderne Physik. von Paul A.Tipler und Ralph A. Liewellyn
 Moderne Physik von Paul A.Tipler und Ralph A. Liewellyn Aus dem Englischen von Dr. Anna Schleitzer Bearbeitet von Prof. Dr. Gerd Czycholl Prof. Dr. Cornelius Noack Prof. Dr. Udo Strohbusch 2., verbesserte
Moderne Physik von Paul A.Tipler und Ralph A. Liewellyn Aus dem Englischen von Dr. Anna Schleitzer Bearbeitet von Prof. Dr. Gerd Czycholl Prof. Dr. Cornelius Noack Prof. Dr. Udo Strohbusch 2., verbesserte
Originaldokument enthält an dieser Stelle eine Grafik! Original document contains a graphic at this position!
 FUNKTIONSWEISE Thema : HALBLEITERDIODEN Die Eigenschaften des PN-Überganges werden in Halbleiterdioden genutzt. Die p- und n- Schicht befinden sich einem verschlossenen Gehäuse mit zwei Anschlussbeinen.
FUNKTIONSWEISE Thema : HALBLEITERDIODEN Die Eigenschaften des PN-Überganges werden in Halbleiterdioden genutzt. Die p- und n- Schicht befinden sich einem verschlossenen Gehäuse mit zwei Anschlussbeinen.
F02. Bandabstand von Germanium
 F02 Bandabstand von Germanium Im Versuch wird der elektrische Widerstand eines Halbleiterstücks aus Germanium in Abhängigkeit von der Temperatur gemessen. Mit höherer Temperatur werden gemäß Gleichung
F02 Bandabstand von Germanium Im Versuch wird der elektrische Widerstand eines Halbleiterstücks aus Germanium in Abhängigkeit von der Temperatur gemessen. Mit höherer Temperatur werden gemäß Gleichung
E 2 Temperaturabhängigkeit elektrischer Widerstände
 E 2 Temperaturabhängigkeit elektrischer Widerstände 1. Aufgaben 1. Für die Stoffe - Metall (Kupfer) - Legierung (Konstantan) - Halbleiter (Silizium, Galliumarsenid) ist die Temperaturabhängigkeit des elektr.
E 2 Temperaturabhängigkeit elektrischer Widerstände 1. Aufgaben 1. Für die Stoffe - Metall (Kupfer) - Legierung (Konstantan) - Halbleiter (Silizium, Galliumarsenid) ist die Temperaturabhängigkeit des elektr.
4. Fehleranordnung und Diffusion
 4. Fehleranordnung und Diffusion 33 4. Fehleranordnung und Diffusion Annahme: dichtes, porenfreies Oxid Materialtransport nur durch Festkörperdiffusion möglich Schematisch: Mögliche Teilreaktionen:. Übergang
4. Fehleranordnung und Diffusion 33 4. Fehleranordnung und Diffusion Annahme: dichtes, porenfreies Oxid Materialtransport nur durch Festkörperdiffusion möglich Schematisch: Mögliche Teilreaktionen:. Übergang
Technische Grundlagen der Informatik
 Technische Grundlagen der Informatik WS 2008/2009 3. Vorlesung Klaus Kasper WS 2008/2009 Technische Grundlagen der Informatik Inhalt Wiederholung Kapazität, Induktivität Halbleiter, Halbleiterdiode Wechselspannung
Technische Grundlagen der Informatik WS 2008/2009 3. Vorlesung Klaus Kasper WS 2008/2009 Technische Grundlagen der Informatik Inhalt Wiederholung Kapazität, Induktivität Halbleiter, Halbleiterdiode Wechselspannung
1 Metallisierung. 1.1 Der Metall-Halbleiter-Kontakt Kontaktierung von dotierten Halbleitern. 1.1 Der Metall-Halbleiter-Kontakt
 1 isierung 1.1 Der -Halbleiter-Kontakt 1.1.1 Kontaktierung von dotierten Halbleitern Nach der Herstellung der Transistoren im Siliciumsubstrat müssen diese mittels elektrischer Kontakte miteinander verbunden
1 isierung 1.1 Der -Halbleiter-Kontakt 1.1.1 Kontaktierung von dotierten Halbleitern Nach der Herstellung der Transistoren im Siliciumsubstrat müssen diese mittels elektrischer Kontakte miteinander verbunden
Großintegrationstechnik
 Großintegrationstechnik TeiM: Vom Transistor zur Grundschaltung von Prof. Dr.-Ing. Karl Goser Hüthig Buch Verlag Heidelberg INHALTSVERZEICHNIS u:? -- t 0. Einführung l 0.1 Die Mikroelektronik als Basisinnovation
Großintegrationstechnik TeiM: Vom Transistor zur Grundschaltung von Prof. Dr.-Ing. Karl Goser Hüthig Buch Verlag Heidelberg INHALTSVERZEICHNIS u:? -- t 0. Einführung l 0.1 Die Mikroelektronik als Basisinnovation
-Dioden- -Strom- und Spannungsmessung bei einer Halbleiterdiode-
 -Dioden- Dioden sind Bauelemente, durch die der Strom nur in eine Richtung fliessen kann. Sie werden daher häufig in Gleichrichterschaltungen eingesetzt. Die Bezeichnung Diode ist aus der griechischen
-Dioden- Dioden sind Bauelemente, durch die der Strom nur in eine Richtung fliessen kann. Sie werden daher häufig in Gleichrichterschaltungen eingesetzt. Die Bezeichnung Diode ist aus der griechischen
DuE-Tutorien 17 und 18
 DuE-Tutorien 17 und 18 Tutorien zur Vorlesung Digitaltechnik und Entwurfsverfahren Christian A. Mandery TUTORIENWOCHE 5 AM 02.12.2011 KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum
DuE-Tutorien 17 und 18 Tutorien zur Vorlesung Digitaltechnik und Entwurfsverfahren Christian A. Mandery TUTORIENWOCHE 5 AM 02.12.2011 KIT Universität des Landes Baden-Württemberg und nationales Forschungszentrum
Vorlesung 3: Elektrodynamik
 Vorlesung 3: Elektrodynamik, georg.steinbrueck@desy.de Folien/Material zur Vorlesung auf: www.desy.de/~steinbru/physikzahnmed georg.steinbrueck@desy.de 1 WS 2015/16 Der elektrische Strom Elektrodynamik:
Vorlesung 3: Elektrodynamik, georg.steinbrueck@desy.de Folien/Material zur Vorlesung auf: www.desy.de/~steinbru/physikzahnmed georg.steinbrueck@desy.de 1 WS 2015/16 Der elektrische Strom Elektrodynamik:
3*" Bauelemente der Elektronik
 3*" Bauelemente der Elektronik Eigenschaften und Anwendung 13., bearbeitete Auf läge VEB VERLAG TECHNIK BERLIN Inhaltsverzeichnis 1. Grundlagen 15 1.1. Einführung 15 1.2. Eigenschaften von Bauelementen
3*" Bauelemente der Elektronik Eigenschaften und Anwendung 13., bearbeitete Auf läge VEB VERLAG TECHNIK BERLIN Inhaltsverzeichnis 1. Grundlagen 15 1.1. Einführung 15 1.2. Eigenschaften von Bauelementen
Grundlagen der Datenverarbeitung
 Grundlagen der Datenverarbeitung Bauelemente Mag. Christian Gürtler 5. Oktober 2014 Mag. Christian Gürtler Grundlagen der Datenverarbeitung 5. Oktober 2014 1 / 34 Inhaltsverzeichnis I 1 Einleitung 2 Halbleiter
Grundlagen der Datenverarbeitung Bauelemente Mag. Christian Gürtler 5. Oktober 2014 Mag. Christian Gürtler Grundlagen der Datenverarbeitung 5. Oktober 2014 1 / 34 Inhaltsverzeichnis I 1 Einleitung 2 Halbleiter
Inhaltsverzeichnis. Verzeichnis wichtiger Symbole... 13
 Inhaltsverzeichnis Verzeichnis wichtiger Symbole... 13 1.Stromfluß in Halbleiterbauelementen... 21 1.1. Energetische Verteilung der Ladungsträger... 21 1.1.1.Bandstruktur... 21 1.1.2. Bändermodell... 29
Inhaltsverzeichnis Verzeichnis wichtiger Symbole... 13 1.Stromfluß in Halbleiterbauelementen... 21 1.1. Energetische Verteilung der Ladungsträger... 21 1.1.1.Bandstruktur... 21 1.1.2. Bändermodell... 29
Halbleiter. pn-übergang Solarzelle Leuchtdiode
 Halbleiter pn-übergang Solarzelle Leuchtdiode Energie der Elektronenzustände von Natrium als Funktion des Abstandes a der Natriumatome a 0 ist der Abstand im festen Natrium 3.1a Spezifischer elektrischer
Halbleiter pn-übergang Solarzelle Leuchtdiode Energie der Elektronenzustände von Natrium als Funktion des Abstandes a der Natriumatome a 0 ist der Abstand im festen Natrium 3.1a Spezifischer elektrischer
Physik 4 Praktikum Auswertung Hall-Effekt
 Physik 4 Praktikum Auswertung Hall-Effekt Von J.W., I.G. 2014 Seite 1. Kurzfassung......... 2 2. Theorie.......... 2 2.1. Elektrischer Strom in Halbleitern..... 2 2.2. Hall-Effekt......... 3 3. Durchführung.........
Physik 4 Praktikum Auswertung Hall-Effekt Von J.W., I.G. 2014 Seite 1. Kurzfassung......... 2 2. Theorie.......... 2 2.1. Elektrischer Strom in Halbleitern..... 2 2.2. Hall-Effekt......... 3 3. Durchführung.........
8. Halbleiter-Bauelemente
 8. Halbleiter-Bauelemente 8.1 Reine und dotierte Halbleiter 8.2 der pn-übergang 8.3 Die Diode 8.4 Schaltungen mit Dioden 8.5 Der bipolare Transistor 8.6 Transistorschaltungen Zweidimensionale Veranschaulichung
8. Halbleiter-Bauelemente 8.1 Reine und dotierte Halbleiter 8.2 der pn-übergang 8.3 Die Diode 8.4 Schaltungen mit Dioden 8.5 Der bipolare Transistor 8.6 Transistorschaltungen Zweidimensionale Veranschaulichung
Ausarbeitung: MOSFET
 Ausarbeitung: MOSFET Inhaltverzeichnis: 1. Einleitung 2. Definition 3. Aufbau 4. Kennlinien 5. Anwendungen 6. Vor- & Nachteile 7. Quellen 1 1.Einleitung: Die erste begrifflich ähnliche MOSFET- Struktur
Ausarbeitung: MOSFET Inhaltverzeichnis: 1. Einleitung 2. Definition 3. Aufbau 4. Kennlinien 5. Anwendungen 6. Vor- & Nachteile 7. Quellen 1 1.Einleitung: Die erste begrifflich ähnliche MOSFET- Struktur
Medizinische Biophysik
 2. Gasförmiger Aggregatzustand Medizinische Biophysik c) Kinetische Deutung der Temperatur: d) Maxwell-Boltzmann-Verteilung e) Barometrische Höhenformel (Gas im Gravitationsfeld) f) Boltzmann-Verteilung
2. Gasförmiger Aggregatzustand Medizinische Biophysik c) Kinetische Deutung der Temperatur: d) Maxwell-Boltzmann-Verteilung e) Barometrische Höhenformel (Gas im Gravitationsfeld) f) Boltzmann-Verteilung
v. Nollau/L. Partzsch/R. Storm/C. Lange Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik in Beispielen und Aufgaben
 v. Nollau/L. Partzsch/R. Storm/C. Lange Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik in Beispielen und Aufgaben Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik in Beispielen und Aufgaben Von Prof. Dr. Volker Nollau
v. Nollau/L. Partzsch/R. Storm/C. Lange Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik in Beispielen und Aufgaben Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik in Beispielen und Aufgaben Von Prof. Dr. Volker Nollau
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE PHYSIK Physikalisches Praktikum für Studierende der Ingenieurswissenschaften Universität Hamburg, Jungiusstraße 11
 INSTITUT FÜR ANGEWANDTE PHYSIK Physikalisches Praktikum für Studierende der Ingenieurswissenschaften Universität Hamburg, Jungiusstraße 11 Halleffekt 1 Ziel Durch Messungen des Stroms und der Hallspannung
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE PHYSIK Physikalisches Praktikum für Studierende der Ingenieurswissenschaften Universität Hamburg, Jungiusstraße 11 Halleffekt 1 Ziel Durch Messungen des Stroms und der Hallspannung
Grundlagen-Vertiefung PW10. Ladungstransport und Leitfähigkeit Version
 Grundlagen-Vertiefung PW10 Ladungstransport und Leitfähigkeit Version 2007-10-11 Inhaltsverzeichnis 1 1.1 Klassische Theorie des Ladungstransports.................. 1 1.2 Temperaturabhängigkeit der elektrischen
Grundlagen-Vertiefung PW10 Ladungstransport und Leitfähigkeit Version 2007-10-11 Inhaltsverzeichnis 1 1.1 Klassische Theorie des Ladungstransports.................. 1 1.2 Temperaturabhängigkeit der elektrischen
Abb. 1 Solarzellen PHOTOVOLTAIK. Stefan Hartmann
 Abb. 1 Solarzellen PHOTOVOLTAIK Stefan Hartmann 1 Gliederung Einführung Grundlegendes zu Halbleitern Generation und Rekombination pn-übergang Zusammenfassung: Was läuft ab? Technisches 2 Einführung Abb.
Abb. 1 Solarzellen PHOTOVOLTAIK Stefan Hartmann 1 Gliederung Einführung Grundlegendes zu Halbleitern Generation und Rekombination pn-übergang Zusammenfassung: Was läuft ab? Technisches 2 Einführung Abb.
An welche Stichwörter von der letzten Vorlesung können Sie sich noch erinnern?
 An welche Stichwörter von der letzten Vorlesung können Sie sich noch erinnern? Entropieänderung f S = Sf Si = i dq T Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik: Carnot (ideale) Wärmemaschine Carnot Kältemaschine
An welche Stichwörter von der letzten Vorlesung können Sie sich noch erinnern? Entropieänderung f S = Sf Si = i dq T Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik: Carnot (ideale) Wärmemaschine Carnot Kältemaschine
Google-Ergebnis für
 Solarzellen Friedrich-Schiller-Realschule Böblingen Basiswissen Elektronik - Wissen Schaltzeichen einer Solarzelle Geschichte: Wann wurde die erste Solarzelle entwickelt? Der photovoltaische Effekt wurde
Solarzellen Friedrich-Schiller-Realschule Böblingen Basiswissen Elektronik - Wissen Schaltzeichen einer Solarzelle Geschichte: Wann wurde die erste Solarzelle entwickelt? Der photovoltaische Effekt wurde
Werkstoffe und Bauelemente der Elektrotechnik H. Schaumburg Halbleiter
 Werkstoffe und Bauelemente der Elektrotechnik H. Schaumburg Halbleiter Werkstoffe und Bauelemente der Elektrotechnik Herausgegeben von Prof. Dr. Hanno Schaumburg, Hamburg-Harburg Die Realisierung neuer
Werkstoffe und Bauelemente der Elektrotechnik H. Schaumburg Halbleiter Werkstoffe und Bauelemente der Elektrotechnik Herausgegeben von Prof. Dr. Hanno Schaumburg, Hamburg-Harburg Die Realisierung neuer
Handout. Der MosFET. Von Dominik Tuszyński. Tutor: Ulrich Pötter
 Handout Der MosFET Von Dominik Tuszyński Tutor: Ulrich Pötter 1 Inhaltsverzeichnis: 1. Geschichte S.3 2. Aufbau S.3 3. Funktionsweise S.4 4. Kennlinienfeld S.5 5. Verwendung S.6 6. Quellen S.7 2 1. Geschichte
Handout Der MosFET Von Dominik Tuszyński Tutor: Ulrich Pötter 1 Inhaltsverzeichnis: 1. Geschichte S.3 2. Aufbau S.3 3. Funktionsweise S.4 4. Kennlinienfeld S.5 5. Verwendung S.6 6. Quellen S.7 2 1. Geschichte
Grundlagen der Halbleiterphysik
 Rolf Enderlein Andreas Schenk Grundlagen der Halbleiterphysik Mit 125 Abbildungen und 15 Tabellen Akademie Verlag / VII INHALTSVERZEICHNIS ALLGEMEINE CHARAKTERISIERUNG DER HALBLEITER 1.1 Einführung 1.2
Rolf Enderlein Andreas Schenk Grundlagen der Halbleiterphysik Mit 125 Abbildungen und 15 Tabellen Akademie Verlag / VII INHALTSVERZEICHNIS ALLGEMEINE CHARAKTERISIERUNG DER HALBLEITER 1.1 Einführung 1.2
Transistor. Inhaltsverzeichnis... 1 Geschichte... 1 Funktionsweise... 2 Quellenverzeichnis... 5
 Transistor Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... 1 Geschichte... 1 Funktionsweise... 2 Quellenverzeichnis... 5 Geschichte Das erste Patent 1 für eine Art Transistor wurde 1925 von Julius Edgar Lilienfeld
Transistor Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis... 1 Geschichte... 1 Funktionsweise... 2 Quellenverzeichnis... 5 Geschichte Das erste Patent 1 für eine Art Transistor wurde 1925 von Julius Edgar Lilienfeld
Opto-elektronische. Materialeigenschaften VL # 4
 Opto-elektronische Materialeigenschaften VL # 4 Vladimir Dyakonov dyakonov@physik.uni-wuerzburg.de Experimental Physics VI, Julius-Maximilians-University of Würzburg und Bayerisches Zentrum für Angewandte
Opto-elektronische Materialeigenschaften VL # 4 Vladimir Dyakonov dyakonov@physik.uni-wuerzburg.de Experimental Physics VI, Julius-Maximilians-University of Würzburg und Bayerisches Zentrum für Angewandte
Bachelor-Studiengang Mechatronik und Informationstechnik (MIT) Modulvorstellung B-PE2 Bauelemente der Elektrotechnik
 Bachelor-Studiengang Mechatronik und Informationstechnik (MIT) der Fakultäten ETIT & MACH Modulvorstellung B-PE2 Bauelemente der Elektrotechnik FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK / FAKULTÄT
Bachelor-Studiengang Mechatronik und Informationstechnik (MIT) der Fakultäten ETIT & MACH Modulvorstellung B-PE2 Bauelemente der Elektrotechnik FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK / FAKULTÄT
7. Elektronendynamik
 7. Elektronendynamik Grundproblem: Bewegung der Elektronen in periodischem Potential Grundlegende Fragestellung Unterschiede in der Leitfähigkeit zwischen verschiedenen Materialien Grundprinzipien I Zweiter
7. Elektronendynamik Grundproblem: Bewegung der Elektronen in periodischem Potential Grundlegende Fragestellung Unterschiede in der Leitfähigkeit zwischen verschiedenen Materialien Grundprinzipien I Zweiter
1. Wärmelehre 1.1. Temperatur. Physikalische Grundeinheiten : Die Internationalen Basiseinheiten SI (frz. Système international d unités)
 1. Wärmelehre 1.1. Temperatur Physikalische Grundeinheiten : Die Internationalen Basiseinheiten SI (frz. Système international d unités) 1. Wärmelehre 1.1. Temperatur Ein Maß für die Temperatur Prinzip
1. Wärmelehre 1.1. Temperatur Physikalische Grundeinheiten : Die Internationalen Basiseinheiten SI (frz. Système international d unités) 1. Wärmelehre 1.1. Temperatur Ein Maß für die Temperatur Prinzip
Elektromechanik. Von Professor Dr.-Ing. JOrgen Meins Technische Universitiit Braunschweig. Mit 176 Bildern
 Elektromechanik Von Professor Dr.-Ing. JOrgen Meins Technische Universitiit Braunschweig Mit 176 Bildern B. G. Teubner Stuttgart 1997 Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme Meins, Jiirgen: Elektromechanik
Elektromechanik Von Professor Dr.-Ing. JOrgen Meins Technische Universitiit Braunschweig Mit 176 Bildern B. G. Teubner Stuttgart 1997 Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme Meins, Jiirgen: Elektromechanik
Werkstoffe der Elektrotechnik im Studiengang Elektrotechnik
 Werkstoffe der lektrotechnik im Studiengang lektrotechnik - Bändermodell der lektronen im Kristall - Prof. Dr. Ulrich Hahn WS 2008/2009 Orbitale für lektronen im Kristall Kristall: regelmäßige Anordnung
Werkstoffe der lektrotechnik im Studiengang lektrotechnik - Bändermodell der lektronen im Kristall - Prof. Dr. Ulrich Hahn WS 2008/2009 Orbitale für lektronen im Kristall Kristall: regelmäßige Anordnung
Aufgaben zum Skriptum Informatik
 Aufgaben zum Skriptum Informatik Andre Spiegel Universität Stuttgart Prof. Dr. Jochen Ludewig Universität Stuttgart Prof. Dr. Hans-Jürgen Appelrath Universität Oldenburg ä3 B. G.Teubner Stuttgart l,ijllfl
Aufgaben zum Skriptum Informatik Andre Spiegel Universität Stuttgart Prof. Dr. Jochen Ludewig Universität Stuttgart Prof. Dr. Hans-Jürgen Appelrath Universität Oldenburg ä3 B. G.Teubner Stuttgart l,ijllfl
h- Bestimmung mit LEDs
 h- Bestimmung mit LEDs GFS im Fach Physik Nicolas Bellm 11. März - 12. März 2006 Der Inhalt dieses Dokuments steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html Inhaltsverzeichnis
h- Bestimmung mit LEDs GFS im Fach Physik Nicolas Bellm 11. März - 12. März 2006 Der Inhalt dieses Dokuments steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html Inhaltsverzeichnis
Gerd Czycholl. Theoretische Festkörperphysik Band 1. Grundlagen: Phononen und Elektronen in Kristallen 4. Auflage
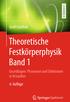 Theoretische Festkörperphysik Band 1 Grundlagen: Phononen und Elektronen in Kristallen 4. Auflage Theoretische Festkörperphysik Band 1 Theoretische Festkörperphysik Band 1 Grundlagen: Phononen und Elektronen
Theoretische Festkörperphysik Band 1 Grundlagen: Phononen und Elektronen in Kristallen 4. Auflage Theoretische Festkörperphysik Band 1 Theoretische Festkörperphysik Band 1 Grundlagen: Phononen und Elektronen
