Persönlichkeits- und Teamentwicklung im Sport
|
|
|
- Ida Dressler
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Persönlichkeits- und Teamentwicklung im Sport Ein sportartenorientiertes Rahmenkonzept für Schule und Verein Team und Trainer haben mir riesiges Selbstbewusstsein gegeben. Das hat mir zu den sensationellen Leistungen verholfen. (Gabi Weller, 4-fache deutsche Meisterin im Kunstturnen) Die Neukonzeption des Sportunterrichts [ ] stellt die Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler sowie ihre sportliches Selbstkonzept in den Vordergrund. (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 2001, 80) Sportliche Aktivität ist mit vielfältigen Anforderungen und Erfahrungen verbunden, die über den Bereich des motorischen Könnens hinausreichen. Z.B. müssen Handballer für ein erfolgreiches Handballspiel nicht nur decken, fangen und werfen können, sondern auch in der Abwehr mit ihren Mitspielern kooperieren und beim Sieben-Meter selbstbewusst auf ihr Können vertrauen. Turner sollten nicht nur den technischen Anforderungen genügen, sondern auch mit Druck, Nervosität und eigenen Unsicherheiten umgehen können. Auch im Schulsport fordert das gemeinsame Üben Verständigung, Unterstützung und Abstimmung mit den Mitschülern und Lehrern. Zur Bewältigung solcher psychischen und sozialen Anforderungen benötigen Sportler so genannte psychosoziale Ressourcen, z. B. Selbstbewusstsein, Kooperationsfähigkeit, Gruppenzusammenhalt. Diese werden in der Sportwissenschaft und der Sportpraxis unter zwei Perspektiven diskutiert: Wir sind als Mannschaft aufgetreten und deshalb waren wir die Besseren. (Christian Schwarzer zur WM 2007) Psychosoziale Ressourcen im Sport: Sport beinhaltet Anforderungen, zu deren Bewältigung psychosoziale Ressourcen beitragen können. In diesem Sinne sind psychosoziale Ressourcen ein Faktor der sportlichen und sportartspezifischen Handlungs- und Leistungsfähigkeit. 6 1 /2009
2 Bewegen und Bewegt sein - Im Sport für das Leben lernen (DJK Landesverband NRW, 2006) Psychosoziale Ressourcen durch Sport: Sport beinhaltet Erfahrungen, die zur Ausbildung allgemeiner psychosozialer Ressourcen beitragen können, die ihrerseits einen Beitrag zur Bewältigung von Alltagsanforderungen und Entwicklungsaufgaben leisten. In der Programmatik der Jugendsportverbände und in der Sportpädagogik ist man lange Zeit davon ausgegangen, dass sportliche Aktivität (z. B. im Sportverein oder im Schulsport) automatisch und beiläufig zur Stärkung psychosozialer Ressourcen beiträgt. Der aktuelle Forschungsstand der sportbezogenen Kindheits- und Jugendforschung bremst jedoch allzu optimistische Erwartungen. Zwar zeigt sich, dass Sportler eine positivere Einschätzung einzelner Ressourcen z. B. des Körperkonzepts oder der sozialen Einbindung als Nichtsportler besitzen (Schmidt, Hartmann-Tews & Brettschneider, 2003), bislang konnte aber nicht nachgewiesen werden, dass dies auf Sozialisationsleistungen des Sports zurückzuführen ist (Brettschneider & Gerlach, 2008). Offenbar tritt eine Stärkung psychosozialer Ressourcen im Kinder- und Jugendsport nicht generell ein. Wirkungen dürften in hohem Maße von der Qualität der sportlichen Gestaltung abhängig sein (Brettschneider & Kleine, 2002). In diesem Sinne fordert der Deutsche Kinder- und Jugendsportbericht eine Qualitätsentwicklung mit gezielten Konzepten und deren systematischer Evaluation (Schmidt et al., 2003). In der Praxis existieren nur wenige methodische Hinweise zur Trainierbarkeit psychosozialer Ressourcen, konkrete sportartspezifische Methoden gibt es im Grunde gar nicht. Hier setzt das vorliegende Rahmenkonzept Psychosoziale Ressourcen im Sport (Sygusch, 2007) an, das von der Deutschen Sportjugend unter dem Titel Persönlichkeits- und Teamentwicklung im Kinder- und Jugendsport (Deutsche Sportjugend, 2005) übernommen wurde [Mittlerweile liegen Transferkonzepte für die Schule Sygusch (2003) sowie für verschiedene Sportarten vor: Handball (Deutscher Handballbund, 2006), Gerätturnen (Deutsche Turnerjugend, 2005), Schwimmen (Deutscher Schwimmverband, 2006) und Basketball (Deutscher Basketball Bund, 2007) vor.]. Es versteht sich als Beitrag zur Entwicklung der sportlichen Handlungs- und Leistungsfähigkeit sowie zur allgemeinen Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen. Dabei geht das Konzept von folgender Grundidee aus: Eine systematische Förderung psychosozialer Ressourcen im und durch Sport muss an solchen Ressourcen ansetzen, die zur Bewältigung sportspezifischer Anforderungen von zentraler Bedeutung sind. Erst wenn die Förderung psychosozialer Ressourcen im Sport gelingt, können Transfereffekte in den Alltag (Psychosoziale Ressourcen durch Sport) erwartet werden. In diesem Sinne orientiert sich das Konzept am Gegenstand Sport bzw. Sportarten. Es definiert Kernziele (WOHIN) und Methoden (WIE) zur systematischen Förderung der ausgewählten Ressourcen Selbstwirksamkeit und Selbstkonzept, soziale Kompetenzen, sozialer Rückhalt und Gruppenzusammenhalt. 1. WOHIN soll gefördert werden welche Kernziele werden verfolgt? Das Rahmenkonzept begründet zu den oben genannten Ressourcen sechs Kernziele, die sich auf die sportnahen Aspekte der jeweiligen Ressourcen beziehen und für die ein Einfluss auf die sportliche Handlungs- und Leistungsfähigkeit angenommen und z. T. belegt werden können. K1 sportliche Selbstwirksamkeit Sportliche Selbstwirksamkeit beschreibt die Überzeugung, das eigene Können auch unter anspruchsvollen Bedingungen erfolgreich einsetzen zu können. Dazu gehören insbesondere die Überzeugung von der Wirksamkeit der allgemeinen motorischen Leistungsfähigkeit ( Auch gegen Ende des Wettkampfes bin ich noch schnell und spritzig! ) sowie die Überzeugung der sportartspezifischen Leistungsfähigkeit ( Auch gegen einen starken Gegenspieler kann ich mein Spiel durchsetzen! ). Eine positiv-realistische Selbstwirksamkeit gewährleistet ein gezieltes sportliches Handeln, kann zur Aufnahme und Bewältigung neuer und anspruchsvoller sportlicher Anforderungen beitragen und vor den Folgen von Selbstüberschätzung (z. B. Skianfänger befährt eine schwarze Piste) bewahren. K2 Beim Üben, Trainieren und Wettkämpfen soll das körperlich-sportliche Selbstkonzept Das Körperkonzept oder das körperlich-sportliche Selbstkonzept bezeichnet die Gesamtheit der Vorstellungen und Bewertungen, die eine Person im Hinblick auf ihren Körper sowie dessen Funktionen und Fähigkeiten entwickelt. Dazu zählen insbesondere das Selbstbild des allgemeinen motorischen Könnens ( Ich bin fit! ) sowie das Selbstbild der sportartspezifischen Leistungsfähigkeit ( Ich bin ein guter Schwimmer! Ich habe eine sehr saubere Kraultechnik! ). Ein positiv-realistisches körperlich-sportliches Selbstkonzept gilt als wichtige Voraussetzung, um sportliche Aktivitäten überhaupt aufzunehmen und sportliche Erfahrungen wie Siege, Niederlagen, Lernerfolg oder Misserfolg realistisch einzuordnen und zu bewerten. K3 kollektive Selbstwirksamkeit der Übungs- und Wettkampfgruppe gestärkt werden! Kollektive Selbstwirksamkeit beschreibt die von einer Gruppe geteilte Überzeugung in ihre Fähigkeiten, Handlungen zu organisieren und auszuführen, um gesetzte Ziele zu erreichen (Gerlach, 2004, 217). Kollektive Selbstwirksamkeit verbindet dabei Überzeugungen vom sportlich-motorischen Können des gesamten Teams ( Wir sind technisch und taktisch stark genug, um dieses Spiel zu gewinnen! ) und die Überzeugung vom Aufgabenzusammenhalt ( Wir funktionieren als Team sehr gut. Auch wenn es mal schlecht läuft, kämpft jeder für jeden! ). Sportpädagogik 1 /2009 7
3 2. WIE soll gefördert werden welche Methoden werden eingesetzt? Die Ansteuerung der sechs Kernziele erfolgt über Maßnahmen und Prinzipien zur Gestaltung von methodischen Rahmenbedingungen und von konkreten Lernsituationen. Die methodischen Rahmenbedingungen beziehen sich auf die handelnden Personen Lehrende (Lehrer bzw. Trainer) und Lerngruppe (Schulklasse bzw. Trainingsgruppe). Kern der methodischen Gestaltung sind die eigentlichen Lernsituationen, wobei hier unterschieden wird zwischen dem Aufgreifen, Inszenieren und Thematisieren von Lernsituationen. Lehrende K4 Beim Üben, Trainieren und Wettkämpfen soll der Aufgabenzusammenhalt der Übungs- und Wettkampfgruppe gestärkt werden! Aufgabenzusammenhalt beschreibt die Ausrichtung von Gruppen auf gemeinsame sportliche Ziele und deren kooperativen Bearbeitung ( Wir versuchen gemeinsam die angestrebten Ziele zu erreichen ). Dazu gehören insbesondere eine klare Aufgabenverteilung bei der Bearbeitung der Ziele, eine gemeinsame Verantwortung für die Erfolge und Misserfolge sowie gegenseitige funktionale und emotionale Unterstützung beim Üben und Wettkämpfen. Aufgabenzusammenhalt kann dazu beitragen, die Leistungsfähigkeit einer Gruppe zu aktivieren und auszuschöpfen. K5 Aufgabenzugehörigkeit Aufgabenzugehörigkeit des Einzelnen verbindet die Integration des Einzelnen in die Gruppe (Zuweisung von Aufgaben, Akzeptanz der Leistungsfähigkeit, Erhalt von Unterstützung) und die Identifikation des Einzelnen mit der Gruppe ( Mir sind die Ziele unseres Teams sehr wichtig! ). Die Aufgabenzugehörigkeit des Einzelnen in die Trainingsund Wettkampfgruppe kann zur Entwicklung und zur Ausschöpfung der individuellen Leistungsfähigkeit beitragen. K6 Kooperationsfähigkeit Aufgabenzusammenhalt und Aufgabenzugehörigkeit sind ohne ein Mindestmaß an Kooperationsfähigkeit des Einzelnen kaum denkbar. Ein Sportler benötigt die Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit anderen, d. h. der Fähigkeit zur Perspektivübernahme (sich in andere Hineindenken können), der Kommunikationsfähigkeit (sich in der Sprache des Sports verständigen können: Komm!, Zieh durch!, Durchschwingen! ) und der sozialen Verantwortung. In diesem Sinne wirkt Kooperationsfähigkeit zumindest indirekt auch auf die Handlungs- und Leistungsfähigkeit im Sport. Vorbild angstfreies Lernklima Aufgreifen Lernsituation Lerngruppe Abb.1: Methodische Gestaltung von Rahmenbedingungen und Lernsituationen (Sygusch, 2007) Grundhaltung Sportart XL: Anwenden in wettkampfnahen Situationen Sportart L: Festigen & Anwenden in sportartspezifischen Lernsituationen Sportart M: Anregen & Festigen in Sportarten Sportart S: Anregen in allgemeinen Bewegungsaufgaben Inszenieren soziales Wohlbefinden Im vorliegenden Beitrag geht es zunächst um die methodischen Rahmenbedingungen (Lehrende, Lerngruppe), anschließend werden methodische Prinzipien zum Aufgreifen von Lernsituationen (aktuelle Erfahrungen, Gelegenheiten des Übens und Trainierens, Mitverantwortung) ausgeführt. Mit dem Inszenieren und Thematisieren von Lernsituationen befasst sich ausführlich ein eigener Beitrag, der im Heft 2/2009 erscheinen wird. 2.1 WIE: Methodische Rahmenbedingungen Lehrende und Lerngruppe Psychosoziale Lernprozesse finden immer statt, sobald Personen in sportlichen Lern- und Leistungssituationen auftreten und miteinander interagieren (Balz, 2003). Dies kann sich sowohl ungeplant als auch geplant vollziehen. Für die geplante Förderung psychosozialer Ressourcen sind die Grundhaltung des Lehrenden, ihre Vorbildrolle sowie das Lernklima in der Trainings- und Wettkampfgruppe zentrale methodische Rahmenbedingungen, um die psychosoziale Entwicklung der Sportler positiv zu beeinflussen Grundhaltung: Der Lehrende als sportlicher Begleiter und Vorbild! Man kann einen Menschen nicht trainieren, man kann ihm nur helfen, es selbst zu tun (Barth & Baartz, 2004, 12) In diesem Sinne schaffen Lehrende mit einer Grundhaltung als sportliche Begleiter Rahmenbedingungen, Anregungen und Lernsituationen, die Sportler zu selbstständigem 8 1 /2009
4 Handeln sowie zur Bewältigung von Anforderungen und Belastungen befähigen. Lehrende als sportliche Entwicklungshelfer gehen von einem integrierten Sportverständnis aus, in dem sowohl motorische als auch psychosoziale Aspekte ihren Platz haben. stellen in der Übungs- und Wettkampfgruppe Bedingungen sozialen Wohlbefindens und angstfreien Lernens her. schaffen Gelegenheiten zur Mitverantwortung und beziehen Sportler in organisatorische, soziale und inhaltliche Entscheidungen ein. stellen weniger kurzfristige Ziele, als vielmehr die langfristige motorische und psychosoziale Entwicklung in den Vordergrund. üben einen kalkulierten Leistungsdruck aus, der dem Prinzip folgt: Fördern und fordern - nicht überfordern! (vgl. Sygusch, 2007, ) Weiterhin nehmen Lehrende eine wichtige Vorbildfunktion ein. Sie sind Modell dafür, wie man Sport treibt, wie motorisches Können und psychosoziale Ressourcen erlernt werden (Pühse, 1990). Dies macht eine bewusste Wahrnehmung und gezielte Gestaltung der Vorbildrolle notwendig, die Lehrende im motorischen und psychosozialen Bereich so vorleben, wie sie sie von ihren Sportlern einfordern. Die Lehrenden müssen die erwünschten (psychosozialen) Lernziele mit dem eigenen Handeln in Übereinstimmung bringen, um als Person authentisch zu sein. Wer z. B. gegenseitige Unterstützung fördern will, muss selbst Hilfsbereitschaft zeigen und Hilfe annehmen können (K 4); wer Selbstbewusstsein fördern will, sollte ein gefestigtes Selbstbild haben und dieses auch zeigen (K 1 & K 2)! Die Lerngruppe als lernförderlicher Rahmen! Üben und Trainieren in Gruppen verlangt nach Möglichkeiten, Fehler zu machen, Fragen zu stellen und sich aktiv in den Übungs- und Trainingsprozess der Gruppe einzubringen. Das setzt voraus, dass man sich in der Gruppe eingebunden, akzeptiert und angenommen fühlt (soziales Wohlbefinden). Jeder Sportler sollte sich trauen seine Leistungsfähigkeit zu zeigen, ohne ausgelacht zu werden und ohne Angst zu haben, dass vermeintliche Schwächen zu Nachteilen führen könnten. Zentrales Prinzip eines angstfreien Lernklimas ist damit, dass jeder von seinen Mitsportlern in seiner Leistungsfähigkeit und sozialen Position akzeptiert wird. Auch bei sehr hohen Leistungsansprüchen gilt: Wer keine Fehler macht, geht nicht an seine Grenzen! Lehrende können zu einem angstfreien Lernklima beitragen, indem sie ein vertrauensvolles Verhältnis zur gesamten Lerngruppe aufbauen, Vertrauen vorleben und ihre eigenen Entscheidungen (z. B. Nominierungen, Notengebung) transparent machen. In Lernsituationen sollten Fehler als produktive Bestandteile des Lernprozesses angesehen werden. Von den Lehrenden verlangt das, geduldig mit Fehlern umzugehen und Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen, statt negativ zu sanktionieren. Konkurrenzorientierte Leistungssituationen, in denen Leistungsvergleiche in der Lerngruppe dominieren (z. B. Wettkampf, Notengebung), schaffen dagegen ein Klima, das angstfreies Lernen erschwert. Da in Schule und Verein Leistungssituationen jedoch zum Sport dazugehören, sollte keineswegs darauf verzichtet werden. Wichtig ist es aber, Phasen der reinen Lernorientierung mindestens gleichwertig neben Phasen der Leistungsorientierung zu stellen. 2.2 WIE: Lernsituation aufgreifen, thematisieren und inszenieren Kern der methodischen Gestaltung ist die eigentliche Lernsituation (der Unterricht, das Training und der Wettkampf). Mit dem Anspruch einer systematischen Förderung psychosozialer Ressourcen verbindet sich die Aufgabe der Lehrenden, solche Lernsituationen aufzugreifen, zu inszenieren und zu thematisieren, um vorliegende Alltagssituationen in Training und Unterricht zu nutzen Mit Aufgreifen ist gemeint, vorliegende Situationen zu nutzen, um psychosoziale Lernprozesse gezielt anzustoßen. Inszenieren meint die Gestaltung von Situationen, in denen psychosoziale Anforderungen betont und damit gezielt psychosoziale Erfahrungen hergestellt werden. Thematisieren meint die gezielte sprachliche Begleitung von aufgegriffenen und inszenierten Lernsituationen durch Rückmelden, Hinweisen und Reflektieren. Aufgreifen, Inszenieren und Thematisieren von Lernsituationen sind dabei nicht als additive Einzelmaßnahmen zu betrachten, sondern als Netzwerk von Maßnahmen, die sich gegenseitig ergänzen und die aufeinander aufbauen Aufgreifen Psychosoziale Ressourcen können in handelnder Auseinandersetzung mit konkreten Anforderungssituationen im Sport gefördert werden. So kann sich z. B. Kooperationsfähigkeit (K6) innerhalb der Bearbeitung und Bewältigung von kooperativen Bewegungsaufgaben entwickeln. Ein körperlich-sportliches Selbstkonzept (K2) kann sich ausbilden, wenn Aufgaben vorliegen, die Rückmeldungen über Gelingen oder Misslingen ermöglichen. Die Aufgabe des Lehrenden ist es, im Sport häufig auftretende Situationen aufzugreifen. Im Folgenden werden methodische Prinzipien zum (1) Aufgreifen aktueller Erfahrungen, (2) zum Aufgreifen von Gelegenheiten des Übens und Trainierens sowie zum (3) Aufgreifen von Gelegenheiten der Mitverantwortung vorgestellt (Sygusch, 2007, ). a) Aktuelle Erfahrungen aufgreifen Dieses Prinzip zielt darauf, aktuelle, nicht planbare oder nicht vorhersehbare Ereignisse (z. B. Sieg und Niederlage, Emotionen, Konflikte) und Gruppenprozesse (z. B. Rituale) gezielt aufzugreifen, d. h. zu verstärken, zu forcieren, mit Regeln zu besetzen und zu thematisieren! Sieg und Niederlage relativieren! Sieg und Niederlage sind unverzichtbarer Bestandteil sportlicher Wettkämpfe und geben immer auch Rückmeldungen über die eigene Leistung. Da auch einer Niederlage gute Leistungen und einem Sieg schwächere Leistungen zugrunde liegen können, dürfen Sieg oder Niederlage Sportpädagogik 1 /2009 9
5 nicht überbewertet werden. Das Prinzip sollte lauten: Erfolgreich üben und wettkämpfen statt immer gewinnen müssen! In diesem Sinne werden gute Leistungen, Leistungsfortschritte oder einzelne gelungene Aktionen als Erfolg gewertet, auch unabhängig davon, ob gewonnen oder verloren wird. Gefühle zulassen! Sportliche Aktivitäten sind Auslöser und Ventil für Emotionen, z. B. Jubel, Ärger, Wut oder Traurigkeit. Diese sollten zumindest in gewissen Grenzen ausgelebt werden und falls notwendig auch thematisiert werden. Extreme Formen wie Aggressionen sollten dagegen ( ) in Frage gestellt, u. U. sanktioniert und mit Gegenerfahrungen konfrontiert werden (Balz, 2003, 163). Für Gruppenzusammenhalt, soziales Wohlbefinden und Selbstwert sind gemeinsame Freude und gemeinsamer Ärger wichtig. In diesem Sinne sollten besonders erfolgreiche Wettkämpfe und Aktionen (Torerfolg, persönliche Bestzeit etc.) gefeiert und mit Ritualen besetzt werden, die den Einzelnen hochleben lassen. Rituale unterstützen! Rituale (Abklatschen, Kreis bilden etc.) können Auslöser und Ausdruck einer lebendigen Gruppendynamik sein und sollten von den Lehrenden unterstützt werden. Von besonderer Bedeutung sind Rituale vor allem in Problemphasen, z. B. bei Konflikten, Motivationsproblemen oder Leistungs tiefs. Rituale symbolisieren in schwierigen Phasen: Trotz aller Probleme wir gehören zusammen! Konflikte thematisieren! Emotionen, Schiedsrichterentscheidungen und unterschiedliche Interessen bieten reichlich Konfliktpotenzial. Die Lösung solcher Konflikte kann zur Ausbildung von Konfliktfähigkeit beitragen. Dabei sollten Trainer Konflikte nicht voreilig regeln. Ihre Aufgabe besteht vielmehr darin, die Konfliktparteien zueinander zu führen und darin unterstützen, die Konfliktsituation auszuhalten, Konfliktursachen sowie die gegenseitigen Perspektiven zu erkennen und gemeinsam Lösungen zu finden. Übergreifendes Ziel ist es, die Lernenden zum zunehmend selbstständigen Umgang mit Konflikten zu befähigen (Balz, 2003). Ein gelöster Konflikt ermöglicht einen weiterhin unbelasteten Umgang miteinander und kann den Konfliktparteien und der gesamten Gruppe ein Stück gemeinsames soziales Selbstbewusstsein geben: Wir sind belastbar uns haut kein Konflikt so schnell um! b) Gelegenheiten des Übens und Trainierens aufgreifen Der Unterrichts- bzw. Trainingsalltag bietet wiederkehrende Gelegenheiten, die bei gezielter Gestaltung zur Entwicklung psychosozialer Ressourcen beitragen können, z. B. durch Erfolgserfahrungen oder Rückmeldungen. Aufgabe der Lehrenden ist es, solche Gelegenheiten aufzugreifen und zum Ausgangspunkt gezielter Inszenierungen zu machen. Über Nahziele Erfolgserfahrungen vermitteln! Eine systematische Festlegung von Nahzielen (z. B. kleinerer Trainingsziele) sowie regelmäßige Rückmeldungen über Leistungs- und Lernfortschritte sollen dazu beitragen, Einzelnen sowie der gesamten Lerngruppe Erfolgserfahrungen zu vermitteln. Diese sind wichtige Quellen für die Entwicklung von Selbstbewusstsein und Zusammenhalt innerhalb von Gruppen. Nahziele sollten gegebenenfalls gemeinsam mit den Sportlern so formuliert werden, dass sie auf Leistungszuwächse ausgerichtet sind (z. B. Verbesserung technischer Fertigkeiten) und nicht auf Ergebnisse oder Platzierungen. Hilfreich für den Prozess der Festlegung und Kontrolle von Zielen können Aktionsformen, wie das Prognosetraining, sein (vgl. Lernsituationen inszenieren in der nächsten Ausgabe). Mannschaften zusammenstellen statt wählen! Mannschaftswahlen enthalten indirekte Rückmeldungen über Leistungen, Beliebtheit und Ansehen in der Gruppe. Im klassischen Wahlprinzip der wechselnden Wahl von Teammitgliedern erhalten zuletzt Gewählte öffentlich negative Rückmeldungen über ihren Status in der Gruppe. Aus diesem Grund sollte auf diese Form verzichtet werden. Die Mannschaftszusammenstellung sollte auf dem Zufallsprinzip beruhen oder vom Lehrenden vorgenommen werden. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Mannschaftsführer zu ernennen, die in gemeinsamer und nicht öffentlicher Absprache die Teams untereinander aufteilen. Auf diese Weise erhalten die Mannschaftsführer Mitverantwortung, der Einzelne (auch der Leistungsschwächste) erhält die zumindest neutrale Rückmeldung: Du gehörst zu meinem Team! Vormachen lassen! Wer zum Vormachen ausgewählt wird, erhält auf diese Weise indirekte positive Rückmeldungen über seine Bewegungsfertigkeiten. Diese Rückmeldungen können zur Ausbildung der sportlichen Selbstwirksamkeit (K1) sowie zur Stärkung der sozialen Position in der Gruppe beitragen. Dabei sollte nicht immer auf dieselben Sportler zurückgegriffen werden, um eine negative Stigmatisierung ( Liebling des Lehrenden ) zu vermeiden und um die Fertigkeiten anderer nicht unter zu bewerten. Auf das Vormachen von Fehlerbildern bei Schwächeren sollte völlig verzichtet werden. Fotos: Peter Kol 10 1 /2009
6 b c) Gelegenheiten der Mitverantwortung aufgreifen Während bei motorischen Lernzielen lehrer- bzw. trainerzentrierte Methoden (z. B. Bewegungsansage, -korrektur) ihren Platz haben, erfordern soziale Lernziele auch solche Lernsituationen, in denen die Sportler aus ihrer Konsumentenrolle heraustreten und Mitverantwortung übernehmen. Unterricht bzw. Training bieten viele Gelegenheiten dafür. Im Folgenden geht es um die Verteilung von Rollen und Aufgaben, das Aufstellen und Umsetzen von Regeln sowie die Beteiligung an inhaltlichen Entscheidungen. Aufgabe der Lehrenden ist es, diese Gelegenheiten aufzugreifen und Mitverantwortung zu übertragen. Rollen- und Aufgabenverteilung! Lehrende verteilen solche Rollen und Aufgaben an die Sportler, die meist von ihnen selbst ausgeführt werden: Schiedsrichter, Auf- und Abbau von Geräten, Zeitnahme, Mannschaftseinteilung etc. (Balz, 2003). Die Sportler müssen in ihren Rollen und Aufgaben Verantwortung übernehmen, indem sie z. B. im Aufwärmteil oder bei der Vermittlung von motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten gezielt Coachingaufgaben übernehmen. Festlegung und Kontrolle von Regeln! Soziale und organisatorische Regeln (Gesprächsregeln, Umgang mit Verspätungen, Auf- und Abbauorganisation etc.) können zunehmend von den Sportlern selbst vereinbart und kontrolliert werden (Pühse, 2004). Anlässe dazu liegen zum einen in einfachen Organisationstätigkeiten (Gruppenbildung, Raum- und Zeiteinteilung etc.), zum anderen ergeben sie sich häufig aus solchen Situationen, in denen Lernende oder Lehrende unzufrieden mit sozialen Umgangsformen (Verspätungen o. Ä.) sind und Konflikte hervortreten. Beteiligung an inhaltlichen Entscheidungen! Bei der Unterrichts- bzw. Trainingsgestaltung sollten Lehrende auch inhaltliche und methodische Entscheidungen mit den Sportlern aushandeln und sich auf deren Bedürfnisse einlassen (Cachay & Kleindienst-Cachay, 1994). Sowohl Lehrende als auch die Sportler können inhaltliche und methodische Vorschläge einbringen, aushandeln, gegenseitig ergänzen und gemeinsam umsetzen. Freie Unterrichts- bzw. Trainingsphasen sollten gelegentlich den Wünschen und Interessen der Sportler zur Verfügung stehen. Für alle methodischen Prinzipien zum Aufgreifen gilt, dass die Lehrenden in dem Maß in den Hintergrund treten, in dem die Sportler Mitverantwortung übernehmen. Die Lehrenden konzentrieren sich auf ihre Funktion als Entwicklungshelfer. Insgesamt ist bei allen Gelegenheiten der Mitverantwortung immer zu berücksichtigen, was unter gegebenen Rahmenbedingungen (institutionelle Spielräume, Entwicklungsstand und Vorerfahrungen der Sportler) überhaupt möglich ist. Auch darf die Mitverantwortung der Sportler nicht zur Beliebigkeit von Unterricht und Training führen. Die übergreifende Verantwortung über Regeln, Inhalte und Methoden, über das Ausmaß der Mitbeteiligung sowie über Gelingen oder Scheitern bleibt immer beim Lehrenden. Literatur Balz, E. (2003). Wie kann man soziales Lernen fördern? In Bielefelder Sportpädagogen (Hrsg.). Methoden im Sportunterricht. Ein Lehrbuch in 14 Lektionen (4. Aufl., S ). Schorndorf: Hofmann. Barth, B. & Baartz, R. (2004). Schwimmen: modernes Nachwuchstraining. Aachen: Meyer & Meyer. Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus. (2001). Lehrplan für die sechsstufige Realschule in Bayern. München: Maiß. Brettschneider, W.-D. & Kleine, T. (2002). Jugendarbeit in Sportvereinen: Anspruch und Wirklichkeit. Eine Evaluationsstudie. (Sportpädagogik). Schorndorf: Hofmann. Cachay, K. & Kleindienst-Cachay, C. (1994). Soziales Lehren und Lernen im Sportunterricht.: Theoretische Überlegungen und unterrichtspraktisches Beispiel. In U. Pühse & D. Alfermann (Hrsg.). Soziales Handeln im Sport und Sportunterricht (S ). Schorndorf: Hofmann. Deutsche Sportjugend (2005). Eine Frage der Qualität - Persönlichkeits- & Teamentwicklung im Kinder- und Jugendsport: ein sportartenorientiertes Rahmenmodell zur Förderung psychosozialer Ressourcen (3. überarb. Aufl.). Frankfurt am Main: Deutsche Sportjugend. Deutsche Turnerjugend (2005). Persönlichkeits- und Teamentwicklung. Förderung psychosozialer Ressourcen im Gerätturnen. Frankfurt am Main: Deutsche Sportjugend. Deutscher Basketball Bund (2007. Spiele mit dem roten Ball. Persönlichkeits- und Teamentwicklung im Basketball. Hagen: Deutscher Basketball Bund. Deutscher Handballbund (2006). Persönlichkeits- und Teamentwicklung. Förderung psychosozialer Ressourcen im Handball. Frankfurt am Main: Deutsche Sportjugend. Deutscher Schwimmverband (2006). Schwimmen lernen. Kassel: Deutscher Schwimmverband. Gerlach, E. & Brettschneider, W.-D. (2008). Sportengagement, Persönlichkeit und Selbstkonzeptentwicklung im Kindesalter. In W. Schmidt (Hrsg.). Zweiter Deutscher Kinder- und Jugendsportbericht: Schwerpunkt: Kindheit (S ). Schorndorf: Hofmann. Gerlach, E. (2004). Selbstwirksamkeitserwartung im Fußball- Entwickung eines neuen Messinstruments. In R. Naul (Hrsg.). Nachwuchsförderung im Kinder- und Jugendfußball in Europa (S ). Aachen: Meyer & Meyer. Pühse, U. (1990). Soziales Lernen im Sport: Ein Beitrag zur sportpädagogischen Lernzieldiskussion. Bad Heilbrunn/Obb.: Klinkhardt. Pühse, U. (2004). Kindliche Entwicklung und soziales Handeln im Sport (Bd. 137). Schorndorf: Hofmann. Schmidt, W., Hartmann-Tews, I. & Brettschneider, W.-D. (2003). Erster deutscher Kinder- und Jugendsportbericht. Schorndorf: Hofmann. Sygusch, R. (2003). Soziale Ressourcen im Sportunterricht aus Sicht der Sportarten. Sportunterricht, 52(12), Sygusch, R. (2007). Psychosoziale Ressourcen im Sport. Ein sportartenorientiertes Förderkonzept für Schule und Verein. Schorndorf: Hofmann Verlag. Christian Herrmann ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sportwissenschaft Mainz; Abteilung Sportpädagogik/ -psychologie. Prof. Dr. Ralf Sygusch ist Professor am Institut für Sportwissenschaft Mainz; Leiter der Abteilung Sportpädagogik/ -psychologie. Sportpädagogik Der 2. Teil des Beitrags Schwerpunkt: Inszenieren und Thematisieren von Lernsituationen folgt im SportPraxis-Heft 2/ /
Stark im Team Soziale Kompetenzen im Kinder- & Jugendsport
 Stark im Team Soziale Kompetenzen im Kinder- & Jugendsport 29. sportmedizinisches sportwissenschaftliches Seminar Persönlichkeitsentwicklung im & durch Sport 05.11.2016 Prof. Dr. Ralf Sygusch Soziale Kompetenzen
Stark im Team Soziale Kompetenzen im Kinder- & Jugendsport 29. sportmedizinisches sportwissenschaftliches Seminar Persönlichkeitsentwicklung im & durch Sport 05.11.2016 Prof. Dr. Ralf Sygusch Soziale Kompetenzen
Persönlichkeits- & Teamentwicklung im Kinder- und Jugendsport Eine Frage der Qualität:
 Eine Frage der Qualität: Persönlichkeits- & Teamentwicklung im Kinder- und Jugendsport 2002-2012 Rahmenkonzept Sportartspezifische Konzepte Evalutationsstudie PRimus www.dsj.de Eine Frage der Qualität:
Eine Frage der Qualität: Persönlichkeits- & Teamentwicklung im Kinder- und Jugendsport 2002-2012 Rahmenkonzept Sportartspezifische Konzepte Evalutationsstudie PRimus www.dsj.de Eine Frage der Qualität:
Christian Herrmann, Verena Oesterhelt & Ralf Sygusch
 Christian Herrmann, Verena Oesterhelt & Ralf Sygusch Persönlichkeits- und Teamentwicklung im Schneesportunterricht. Förderung psychosozialer Ressourcen in Schule und Verein 1 Einleitung Schneesportler
Christian Herrmann, Verena Oesterhelt & Ralf Sygusch Persönlichkeits- und Teamentwicklung im Schneesportunterricht. Förderung psychosozialer Ressourcen in Schule und Verein 1 Einleitung Schneesportler
Persönlichkeits- & Teamentwicklung
 Profil Sportlich kompetent www.dsj.de Eine Frage der Qualität: Persönlichkeits- & Teamentwicklung Förderung psychosozialer Ressourcen im Basketball Arbeitshilfe für Trainer/-innen und Übungsleiter/-innen
Profil Sportlich kompetent www.dsj.de Eine Frage der Qualität: Persönlichkeits- & Teamentwicklung Förderung psychosozialer Ressourcen im Basketball Arbeitshilfe für Trainer/-innen und Übungsleiter/-innen
Methoden, methodische Inszenierungen und Organisationsformen im Sportunterricht
 Methoden, methodische Inszenierungen und Organisationsformen im Sportunterricht Ruhr-Universität Bochum Fakultät für Sportwissenschaften Sommersemester 2015 Seminar: Sprachförderung im Sportunterricht
Methoden, methodische Inszenierungen und Organisationsformen im Sportunterricht Ruhr-Universität Bochum Fakultät für Sportwissenschaften Sommersemester 2015 Seminar: Sprachförderung im Sportunterricht
Soziales Training der Klassen 5 / 6 und 7
 Soziales Training der Klassen 5 / 6 und 7 Seit 2006 arbeitet die offene Jugendarbeit / das Jugend- und Stadtteilhaus Nord eng mit der Realschule Eschenried zusammen. Damit ergänzen sich schulische und
Soziales Training der Klassen 5 / 6 und 7 Seit 2006 arbeitet die offene Jugendarbeit / das Jugend- und Stadtteilhaus Nord eng mit der Realschule Eschenried zusammen. Damit ergänzen sich schulische und
Sportengagement und Entwicklung im Kindesalter
 Zu den Autoren Prof. Dr. Wolf-Dietrich Brettschneider lehrt und forscht an der Universität Paderborn im Department Sport und Gesundheit, Arbeitsbereich Sport und Erziehung. Zuvor war er Professor an der
Zu den Autoren Prof. Dr. Wolf-Dietrich Brettschneider lehrt und forscht an der Universität Paderborn im Department Sport und Gesundheit, Arbeitsbereich Sport und Erziehung. Zuvor war er Professor an der
VFV Wölbitsch Mario, MSc
 KINDERfußball vs ERWACHSENENfußball 12.11.2012 VFV Wölbitsch Mario, MSc 1 Kinderfußball vs Erwachsenenfußball Zwei völlig verschiedene Welten! Leider: Viele Trainer im Kinderfußball orientieren sich am
KINDERfußball vs ERWACHSENENfußball 12.11.2012 VFV Wölbitsch Mario, MSc 1 Kinderfußball vs Erwachsenenfußball Zwei völlig verschiedene Welten! Leider: Viele Trainer im Kinderfußball orientieren sich am
Leitbild Jugend+Sport Kurzfassung
 Leitbild Jugend+Sport Kurzfassung BASPO 2532 Magglingen Bundesamt für Sport BASPO J+S-Philosophie Im Zentrum von Jugend+Sport stehen die Kinder und Jugendlichen. J+S-Leitsatz Jugend+Sport gestaltet und
Leitbild Jugend+Sport Kurzfassung BASPO 2532 Magglingen Bundesamt für Sport BASPO J+S-Philosophie Im Zentrum von Jugend+Sport stehen die Kinder und Jugendlichen. J+S-Leitsatz Jugend+Sport gestaltet und
E1/E2 Sport in Theorie und Praxis Einführung Schwerpunktkurs Sport 3-stündig
 Georg-Büchner-Gymnasium LK Profil Sport Oberstufe Schwerpunktkurs Sport 3-stündig Zur inhaltlichen und methodischen Vorbereitung auf die Arbeit in der Qualifikationsphase des Sport-Leistungskursfaches
Georg-Büchner-Gymnasium LK Profil Sport Oberstufe Schwerpunktkurs Sport 3-stündig Zur inhaltlichen und methodischen Vorbereitung auf die Arbeit in der Qualifikationsphase des Sport-Leistungskursfaches
Leitbild der OS Plaffeien
 Leitbild der OS Plaffeien Schritte ins neue Jahrtausend Unsere Schule ist Bestandteil einer sich rasch entwickelnden Gesellschaft. Dadurch ist sie laufenden Veränderungs- und Entwicklungsprozessen unterworfen.
Leitbild der OS Plaffeien Schritte ins neue Jahrtausend Unsere Schule ist Bestandteil einer sich rasch entwickelnden Gesellschaft. Dadurch ist sie laufenden Veränderungs- und Entwicklungsprozessen unterworfen.
Sicher und kompetent den eigenen Mut ausloten!
 1 Sicher und kompetent den eigenen Mut ausloten! Im Modul «Wagnis» stehen Aufgaben und Problemlösungen im Vordergrund, die Mut erfordern. Dabei wird durch den Umgang mit Angst das emotionale Selbstkonzept
1 Sicher und kompetent den eigenen Mut ausloten! Im Modul «Wagnis» stehen Aufgaben und Problemlösungen im Vordergrund, die Mut erfordern. Dabei wird durch den Umgang mit Angst das emotionale Selbstkonzept
Grundlagen der Sportpädagogik (WS 2004/05) Dietrich Kurz Universität Bielefeld Abteilung Sportwissenschaft
 Grundlagen der Sportpädagogik (WS 2004/05) (Doppel-)Lektion 11: Gesundheit Gesundheit ( Gesundheit fördern, Gesundheitsbewusstsein entwickeln ) 1. "Hauptsache: gesund!" wirklich? 2. Bewegung als Schutzfaktor
Grundlagen der Sportpädagogik (WS 2004/05) (Doppel-)Lektion 11: Gesundheit Gesundheit ( Gesundheit fördern, Gesundheitsbewusstsein entwickeln ) 1. "Hauptsache: gesund!" wirklich? 2. Bewegung als Schutzfaktor
Leitbild Jugend+Sport Kurzfassung
 Leitbild Jugend+Sport Kurzfassung BASPO 2532 Magglingen Bundesamt für Sport BASPO J+S-Philosophie J+S-Leitsatz Jugend+Sport gestaltet und fördert kinder- und jugend gerechten Sport. ermöglicht Kindern
Leitbild Jugend+Sport Kurzfassung BASPO 2532 Magglingen Bundesamt für Sport BASPO J+S-Philosophie J+S-Leitsatz Jugend+Sport gestaltet und fördert kinder- und jugend gerechten Sport. ermöglicht Kindern
Prof. Dr. Peter Kuhn ISS FAU Vorlesung Sportdidaktik
 Gemeinsam: Sportlichkeit und Bildung durch Sport und Bewegung Körpererfahrung (Funke-Wieneke) Bewegungskultur (Größing) Gesundheit (Kottmann & Küpper) Soziales Lernen (Pühse) Naturbegegnung (Kronbichler
Gemeinsam: Sportlichkeit und Bildung durch Sport und Bewegung Körpererfahrung (Funke-Wieneke) Bewegungskultur (Größing) Gesundheit (Kottmann & Küpper) Soziales Lernen (Pühse) Naturbegegnung (Kronbichler
Lernbiologische Axiome kooperativen Lernens: Lerninhalte werden behalten, wenn sie persönlich bedeutsam werden, wenn aktive Auseinandersetzung
 Lernbiologische Axiome kooperativen Lernens: Lerninhalte werden behalten, wenn sie persönlich bedeutsam werden, wenn aktive Auseinandersetzung erfolgt Auswirkungen kooperativen Lernens: zunehmende Leistungen
Lernbiologische Axiome kooperativen Lernens: Lerninhalte werden behalten, wenn sie persönlich bedeutsam werden, wenn aktive Auseinandersetzung erfolgt Auswirkungen kooperativen Lernens: zunehmende Leistungen
Leitbild Jugend+Sport Kurzfassung
 Leitbild Jugend+Sport Kurzfassung BASPO 2532 Magglingen Bundesamt für Sport BASPO J+S-Philosophie Im Zentrum von Jugend+Sport stehen die Kinder und Jugendlichen. J+S-Leitsatz Jugend+Sport gestaltet und
Leitbild Jugend+Sport Kurzfassung BASPO 2532 Magglingen Bundesamt für Sport BASPO J+S-Philosophie Im Zentrum von Jugend+Sport stehen die Kinder und Jugendlichen. J+S-Leitsatz Jugend+Sport gestaltet und
Univ.-Prof. Dr. Georg Wydra. Vorlesung Allgemeine Sportdidaktik Modul Didaktik/Methodik
 Univ.-Prof. Dr. Georg Wydra Vorlesung Allgemeine Sportdidaktik Modul Didaktik/Methodik Baustein 13: Unterrichtsvorbereitung als zentrale didaktische Tätigkeit Sportwissenschaftliches Institut der Universität
Univ.-Prof. Dr. Georg Wydra Vorlesung Allgemeine Sportdidaktik Modul Didaktik/Methodik Baustein 13: Unterrichtsvorbereitung als zentrale didaktische Tätigkeit Sportwissenschaftliches Institut der Universität
Themenübersicht. Folie 1
 Themenübersicht Rolle und Anforderungsprofil des Trainers Grundlagentraining als Lerntraining: Grundlagen des Lernens Kommunikation muss gelingen Grundeinstellungen des Trainers Folie 1 Rolle und Anforderungsprofil
Themenübersicht Rolle und Anforderungsprofil des Trainers Grundlagentraining als Lerntraining: Grundlagen des Lernens Kommunikation muss gelingen Grundeinstellungen des Trainers Folie 1 Rolle und Anforderungsprofil
Weitere Fächer Sport. 1 Stundendotation. 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr Weiteres Fach Allgemeines Bildungsziel
 Weitere Fächer Sport 1 Stundendotation 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr Weiteres Fach 3 3 3 2.1 Allgemeines Bildungsziel Dem Druck und den Belastungen des heutigen Alltags kann nur standhalten, wer selbst psychisch
Weitere Fächer Sport 1 Stundendotation 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr Weiteres Fach 3 3 3 2.1 Allgemeines Bildungsziel Dem Druck und den Belastungen des heutigen Alltags kann nur standhalten, wer selbst psychisch
Leitbild der Gesamtschule Kohlscheid
 Leitbild der Gesamtschule Kohlscheid Ganzheitliches Lernen Gemeinsam Miteinander Individualität lernen leben Partizipation Zusammen erwachsen werden Schule im Aufbau Persönlichkeit stärken Partizipation
Leitbild der Gesamtschule Kohlscheid Ganzheitliches Lernen Gemeinsam Miteinander Individualität lernen leben Partizipation Zusammen erwachsen werden Schule im Aufbau Persönlichkeit stärken Partizipation
Lehrplan Sport. genehmigt von der Schulkommission der Mittelschulen im Kanton Zug am 29. April 2015
 Lehrplan Sport genehmigt von der Schulkommission der Mittelschulen im Kanton Zug am 29. April 2015 Wirtschaftsmittelschule Zug Lüssiweg 24, 6302 Zug T 041 728 12 12 www.wms-zug.ch info@wms-zug.ch 29.4.2015
Lehrplan Sport genehmigt von der Schulkommission der Mittelschulen im Kanton Zug am 29. April 2015 Wirtschaftsmittelschule Zug Lüssiweg 24, 6302 Zug T 041 728 12 12 www.wms-zug.ch info@wms-zug.ch 29.4.2015
Fachbereich Sport des Georg- Friedrich- Händel- Gymnasiums. Schulinternes Fachcurriculum Sekundarstufe II
 Fachbereich Sport des Georg- Friedrich- Händel- Gymnasiums Schulinternes Fachcurriculum Sekundarstufe II 1. Allgemeine Grundlagen 2. Die Themenfelder und Kompetenzbezüge 1. Allgemeine Grundlagen Das Schulcurriculum
Fachbereich Sport des Georg- Friedrich- Händel- Gymnasiums Schulinternes Fachcurriculum Sekundarstufe II 1. Allgemeine Grundlagen 2. Die Themenfelder und Kompetenzbezüge 1. Allgemeine Grundlagen Das Schulcurriculum
Ein Leistungssportler/eine Leistungssportlerin in der Familie. Brandauer Thomas
 Ein Leistungssportler/eine Leistungssportlerin in der Familie Ausgangspunkt Allgemein gesellschaftlich: Leistungssport sehr positiv besetzt Positive Sozialisation Die Persönlichkeit der jugendlichen AthletInnen
Ein Leistungssportler/eine Leistungssportlerin in der Familie Ausgangspunkt Allgemein gesellschaftlich: Leistungssport sehr positiv besetzt Positive Sozialisation Die Persönlichkeit der jugendlichen AthletInnen
Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen Essen Hindenburgstraße 76-78, Essen. 5. Unterrichtsbesuch im Fach Sport
 Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen Essen Hindenburgstraße 76-78, 45127 Essen 5. Unterrichtsbesuch im Fach Sport Name: Schule: Lerngruppe: Ausbildungslehrer: Fachleiter: Hauptseminarleiter:
Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen Essen Hindenburgstraße 76-78, 45127 Essen 5. Unterrichtsbesuch im Fach Sport Name: Schule: Lerngruppe: Ausbildungslehrer: Fachleiter: Hauptseminarleiter:
ERZIEHUNG GELINGT. Wenn Sie diese 11 Punkte beachten. Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel. J.W.
 ERZIEHUNG GELINGT Wenn Sie diese 11 Punkte beachten Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel. J.W. von Goethe ERZIEHUNG GELINGT Liebe Leserin, lieber Leser Eltern ABC Eigentlich
ERZIEHUNG GELINGT Wenn Sie diese 11 Punkte beachten Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel. J.W. von Goethe ERZIEHUNG GELINGT Liebe Leserin, lieber Leser Eltern ABC Eigentlich
Kleine Spiele. Ralf Simon
 Kleine Spiele Ralf Simon Von Spiel zu Spiel (Robert Gernhardt) "Der Mensch ist da Mensch, wo er spielt" - Das triffts, Herr Schiller. Gut gezielt! Vom Vorspiel einmal abgesehen - ein Spiel wird erst durch
Kleine Spiele Ralf Simon Von Spiel zu Spiel (Robert Gernhardt) "Der Mensch ist da Mensch, wo er spielt" - Das triffts, Herr Schiller. Gut gezielt! Vom Vorspiel einmal abgesehen - ein Spiel wird erst durch
Sportgemeinschaft Orlen 1949 e.v. Abteilung Jugendfußball Das Wertesystem der Jugendarbeit
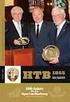 Sportgemeinschaft Orlen 1949 e.v. Abteilung Jugendfußball Das Wertesystem der Jugendarbeit Dieter Jakobi Oliver Körner Orlen, November 2010 Einleitung 1 2 3 4 5 6 7 Einleitung Übersicht/5-Säulen-Modell
Sportgemeinschaft Orlen 1949 e.v. Abteilung Jugendfußball Das Wertesystem der Jugendarbeit Dieter Jakobi Oliver Körner Orlen, November 2010 Einleitung 1 2 3 4 5 6 7 Einleitung Übersicht/5-Säulen-Modell
Unser Bild vom Menschen
 Das pädagogische Konzept t des ELKI Naturns: Unser Bild vom Menschen Wir sehen den Menschen als ein einzigartiges, freies und eigenständiges Wesen mit besonderen physischen, emotionalen, psychischen und
Das pädagogische Konzept t des ELKI Naturns: Unser Bild vom Menschen Wir sehen den Menschen als ein einzigartiges, freies und eigenständiges Wesen mit besonderen physischen, emotionalen, psychischen und
Kernlehrmittel Jugend+Sport
 Kernlehrmittel 2 3 Das Unterrichtsmodell von J+S 4 Die individuelle Lernbiografie Die quantitative Dimension beschreibt den Leistungsstand bezüglich der Sportart und des Sportart-Lehrplanes. Die qualitative
Kernlehrmittel 2 3 Das Unterrichtsmodell von J+S 4 Die individuelle Lernbiografie Die quantitative Dimension beschreibt den Leistungsstand bezüglich der Sportart und des Sportart-Lehrplanes. Die qualitative
Kinder brauchen Freunde Soziale Fertigkeiten fördern
 Kinder brauchen Freunde Soziale Fertigkeiten fördern Soziale Kontakte und gesunde Freundschaften sind für Kinder ein unermessliches Entwicklungspotenzial. Gemeinschaft fördert die Persönlichkeitsentwicklung
Kinder brauchen Freunde Soziale Fertigkeiten fördern Soziale Kontakte und gesunde Freundschaften sind für Kinder ein unermessliches Entwicklungspotenzial. Gemeinschaft fördert die Persönlichkeitsentwicklung
Leistung und ihre Bewertung Leistungskonzept
 Städtisches Gymnasium Gütersloh Fachschaft Sport Leistung und ihre Bewertung Leistungskonzept Im Gegensatz zu den anderen Fächern des Fächerkanons der Sekundarstufe I stehen im Sportunterricht motorische
Städtisches Gymnasium Gütersloh Fachschaft Sport Leistung und ihre Bewertung Leistungskonzept Im Gegensatz zu den anderen Fächern des Fächerkanons der Sekundarstufe I stehen im Sportunterricht motorische
Grundkenntnisse Maturandinnen und Maturanden erkennen die Vielfalt der körperlichen Leistungsfähigkeit als Teil ihrer Gesundheit
 Lehrplan Sport Grundlagenfach Sport A Allgemeine Bildungsziele Gesundes Bewegen, sportliches Handeln sowie das Verstehen dieser Tätigkeiten leisten einen wesentlichen Beitrag zur ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung.
Lehrplan Sport Grundlagenfach Sport A Allgemeine Bildungsziele Gesundes Bewegen, sportliches Handeln sowie das Verstehen dieser Tätigkeiten leisten einen wesentlichen Beitrag zur ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung.
* Andreas Singer * Sportfachberater Landkreis Miltenberg *
 * Andreas Singer * Sportfachberater Landkreis Miltenberg * info@sportprojekte.de Methodische Grundsätze 1. Allgemeine, vorbereitende Übungen und turnspezifische Vorübungen (vorbereiten): Ziel: Schaffen
* Andreas Singer * Sportfachberater Landkreis Miltenberg * info@sportprojekte.de Methodische Grundsätze 1. Allgemeine, vorbereitende Übungen und turnspezifische Vorübungen (vorbereiten): Ziel: Schaffen
Themen für Bachelor-Arbeiten (Betreuung S. Tittlbach) Motorische und psychosoziale Entwicklung von Nachwuchs-Fußballspielern
 INSTITUT FÜR SPORTWISSENSCHAFT Lehrstuhl Sportwissenschaft III Sozial- und Gesundheitswissenschaften des Sports Prof. Dr. Susanne Tittlbach Telefon Sekretariat: 0921/ 55-3461 Email: susanne.tittlbach@uni-bayreuth.de
INSTITUT FÜR SPORTWISSENSCHAFT Lehrstuhl Sportwissenschaft III Sozial- und Gesundheitswissenschaften des Sports Prof. Dr. Susanne Tittlbach Telefon Sekretariat: 0921/ 55-3461 Email: susanne.tittlbach@uni-bayreuth.de
2. Selbstbild und Rolle klar(e) Haltung zeigen Zusammenarbeit mit Eltern Problemverhalten in Fähigkeiten verwandeln 8
 Sie finden hier Ausschreibungen einiger Fortbildungsangebote für Tagespflegepersonen. Für eine endgültige Festlegung von Inhalten und Zielen, ist es mir wichtig, diese mit Ihnen zusammen auf der Grundlage
Sie finden hier Ausschreibungen einiger Fortbildungsangebote für Tagespflegepersonen. Für eine endgültige Festlegung von Inhalten und Zielen, ist es mir wichtig, diese mit Ihnen zusammen auf der Grundlage
Soziales Lernen fördern
 Studienseminar Koblenz Soziales Lernen fördern 29.05.2017 Soziales Lernen Übereinander lernen sich kennen lernen, Vorurteile abbauen, vertrauensvolle Beziehungen stiften Voneinander lernen eigene Fähigkeiten
Studienseminar Koblenz Soziales Lernen fördern 29.05.2017 Soziales Lernen Übereinander lernen sich kennen lernen, Vorurteile abbauen, vertrauensvolle Beziehungen stiften Voneinander lernen eigene Fähigkeiten
Lern- und Erfahrungsfeld BEWEGEN AN GERÄTEN, TURNEN - Betrachtung im Verlauf der kindlichen Entwicklung nach Inhaltsaspekten. Primarphase 6 10 Jahre
 Lern- und Erfahrungsfeld BEWEGEN AN GERÄTEN, TURNEN - Betrachtung im Verlauf der kindlichen Entwicklung nach en Welche Lernziele sind von Bedeutung? Dass die Kinder und/oder Jugendlichen Bildungsphase/Altersgruppe
Lern- und Erfahrungsfeld BEWEGEN AN GERÄTEN, TURNEN - Betrachtung im Verlauf der kindlichen Entwicklung nach en Welche Lernziele sind von Bedeutung? Dass die Kinder und/oder Jugendlichen Bildungsphase/Altersgruppe
Das Sportprofil am DG
 Das Sportprofil am DG Bewegung, Spiel und Sport Möglichkeiten und Grenzen des Sports in der modernen Gesellschaft 1 2 Ringen Raufen Verteidigen Wassersport betreiben Rollen Gleiten Schwimmen Sich fit halten
Das Sportprofil am DG Bewegung, Spiel und Sport Möglichkeiten und Grenzen des Sports in der modernen Gesellschaft 1 2 Ringen Raufen Verteidigen Wassersport betreiben Rollen Gleiten Schwimmen Sich fit halten
Gestaltung eines zweistündigen Sport-Grundkurses in der Jahrgangsstufe 12 am Beispiel des Bewegungsfeldes Spielen (Zielschussspiele)
 Gestaltung eines zweistündigen Sport-Grundkurses in der Jahrgangsstufe 12 am Beispiel des Bewegungsfeldes Spielen (Zielschussspiele) PS: Sportunterricht in der gymnasialen Oberstufe Leitung: Dr. Ralf Laging,
Gestaltung eines zweistündigen Sport-Grundkurses in der Jahrgangsstufe 12 am Beispiel des Bewegungsfeldes Spielen (Zielschussspiele) PS: Sportunterricht in der gymnasialen Oberstufe Leitung: Dr. Ralf Laging,
Wie wir im Sport und durch den Sport die mentale Stärke unserer Kinder fördern. Dr. Monika Niederstätter
 Wie wir im Sport und durch den Sport die mentale Stärke unserer Kinder fördern Dr. Monika Niederstätter Sport war und ist ein Teil von mir. Er hat mich grundlegend geprägt und mich gelehrt, auch im übertragenen
Wie wir im Sport und durch den Sport die mentale Stärke unserer Kinder fördern Dr. Monika Niederstätter Sport war und ist ein Teil von mir. Er hat mich grundlegend geprägt und mich gelehrt, auch im übertragenen
Jugendkonzept und Leitlinien für den Jugendfußball des SV Steinbach
 Jugendkonzept und Leitlinien für den Jugendfußball des SV Steinbach Mit dieser Konzeption sollen die Organisation, die Inhalte und die Ziele der Jugendarbeit des SV Steinbach deutlich und transparent gemacht
Jugendkonzept und Leitlinien für den Jugendfußball des SV Steinbach Mit dieser Konzeption sollen die Organisation, die Inhalte und die Ziele der Jugendarbeit des SV Steinbach deutlich und transparent gemacht
Kinder- undjugendschutz im Fussball. Fehlhandlungen - Übergriffe. Daher sprechen wir von
 Kinder- undjugendschutz im Fussball! Sicherheit, Schutz, Vertrauen! Persönlichkeitsentwicklung im Mittelpunkt! Klare Grenzen und gegenseitigen Respekt! Spielend, humorvoll, klar und zielstrebig im Umgang!
Kinder- undjugendschutz im Fussball! Sicherheit, Schutz, Vertrauen! Persönlichkeitsentwicklung im Mittelpunkt! Klare Grenzen und gegenseitigen Respekt! Spielend, humorvoll, klar und zielstrebig im Umgang!
Liebe Eltern, o es gibt kaum noch Flächen wo die Kinder Platz zum Spielen
 Jugendabteilung Liebe Eltern, wir freuen uns sehr, dass Sie Interesse an unserem Verein und somit an diesem Konzept zeigen und hoffen, dass Sie und Ihr Kind durch die nachfolgeneden Zeilen den Weg zu uns
Jugendabteilung Liebe Eltern, wir freuen uns sehr, dass Sie Interesse an unserem Verein und somit an diesem Konzept zeigen und hoffen, dass Sie und Ihr Kind durch die nachfolgeneden Zeilen den Weg zu uns
Ringvorlesung: Vermittlungsmethoden im Sport
 Ringvorlesung: Vermittlungsmethoden im Sport WS 2005/06 Dr. Andrea Menze-Sonneck u.a. 1 Wie kann man Mädchen und Jungen fördern? 2 Geschlecht als zentrale Bedingung für pädagogische Entscheidungsprozesse
Ringvorlesung: Vermittlungsmethoden im Sport WS 2005/06 Dr. Andrea Menze-Sonneck u.a. 1 Wie kann man Mädchen und Jungen fördern? 2 Geschlecht als zentrale Bedingung für pädagogische Entscheidungsprozesse
Leitfaden für Perspektivgespräche an der LES
 Leitfaden für Perspektivgespräche an der LES Liebe Kollegin, lieber Kollege, dieser Leitfaden gilt als Gesprächsgrundlage für Ihr Perspektivgespräch mit der Schulleitung. Er bietet eine Hilfestellung zur
Leitfaden für Perspektivgespräche an der LES Liebe Kollegin, lieber Kollege, dieser Leitfaden gilt als Gesprächsgrundlage für Ihr Perspektivgespräch mit der Schulleitung. Er bietet eine Hilfestellung zur
Umsetzung der Ausbildungsgespräche nach GPO II, 12 Absatz 4
 Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (GS) Pforzheim Umsetzung der Ausbildungsgespräche nach GPO II, 12 Absatz 4 Vorbemerkungen Die hier vorliegende Konzeption für das Seminar Pforzheim möchte
Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (GS) Pforzheim Umsetzung der Ausbildungsgespräche nach GPO II, 12 Absatz 4 Vorbemerkungen Die hier vorliegende Konzeption für das Seminar Pforzheim möchte
Jugendarbeit im DJK-DV Hildesheim
 Jugendarbeit im DJK-DV Hildesheim Anforderungen - Ansprüche - Aufträge Diözesantag des DJK-DV Hildesheim 8. März 2008 Dr. Peter-Ulrich Wendt Programm der Jugendarbeit im DV 1. Anforderungen (Kind und Jugendliche/r
Jugendarbeit im DJK-DV Hildesheim Anforderungen - Ansprüche - Aufträge Diözesantag des DJK-DV Hildesheim 8. März 2008 Dr. Peter-Ulrich Wendt Programm der Jugendarbeit im DV 1. Anforderungen (Kind und Jugendliche/r
NACHWUCHSKONZEPT WIR LIEBEN FUSSBALL! Sportvorstand FC Saalfeld e.v. Aufgaben und Kernziele der Nachwuchsarbeit des FC Saalfeld e.v.
 1 WIR LIEBEN FUSSBALL! Für das Kinder- und Jugendtraining werden anspruchsvolle Anforderungen und Ziele des großen Fußballs haben wir Schwerpunkte verabredet. Sie bauen systematisch aufeinander auf und
1 WIR LIEBEN FUSSBALL! Für das Kinder- und Jugendtraining werden anspruchsvolle Anforderungen und Ziele des großen Fußballs haben wir Schwerpunkte verabredet. Sie bauen systematisch aufeinander auf und
Leitlinien zum Lehren und Lernen an der Berner Fachhochschule
 Leitlinien zum Lehren und Lernen an der Berner Fachhochschule Kommission für Evaluation und Qualitätsentwicklung KEQ Aktualisierte Version August 2015 Berner Fachhochschule Ressort Qualitätsmanagement
Leitlinien zum Lehren und Lernen an der Berner Fachhochschule Kommission für Evaluation und Qualitätsentwicklung KEQ Aktualisierte Version August 2015 Berner Fachhochschule Ressort Qualitätsmanagement
Downloadmaterialien zum Buch
 Downloadmaterialien zum Buch Björn Migge Handbuch Coaching und Beratung Wirkungsvolle Modelle, kommentierte Falldarstellungen, zahlreiche Übungen ISBN 978-3-407-36539-2 Beltz Verlag 3. Auflag 2014, Weinheim
Downloadmaterialien zum Buch Björn Migge Handbuch Coaching und Beratung Wirkungsvolle Modelle, kommentierte Falldarstellungen, zahlreiche Übungen ISBN 978-3-407-36539-2 Beltz Verlag 3. Auflag 2014, Weinheim
Merkmale guten Unterrichts (nach Peter POSCH)
 (nach Peter POSCH) Neues Wissen anbieten und Vorwissen beachten: Mit neuen Inhalten werden den Schüler/innen neue Lernerfahrungen zugänglich gemacht, es wird jedoch auch ihr Vorwissen respektiert, weil
(nach Peter POSCH) Neues Wissen anbieten und Vorwissen beachten: Mit neuen Inhalten werden den Schüler/innen neue Lernerfahrungen zugänglich gemacht, es wird jedoch auch ihr Vorwissen respektiert, weil
Schönwalder SV 53 Jugendkonzept der Abteilung Fußball Kleinfeld
 Schönwalder SV 53 Jugendkonzept der Abteilung Fußball Kleinfeld Vorwort Dieses Jugendkonzept ist erst einmal das was es ist: Ein Konzept, ein Programm, ein Richtungsweiser. Dieses Jugendkonzept ist gedacht,
Schönwalder SV 53 Jugendkonzept der Abteilung Fußball Kleinfeld Vorwort Dieses Jugendkonzept ist erst einmal das was es ist: Ein Konzept, ein Programm, ein Richtungsweiser. Dieses Jugendkonzept ist gedacht,
Motorische Fitness oder pädagogische Spielchen? zum pädagogischen Auftrag des Schulsports. Dr. Michael Pfitzner. Dr.
 Arbeitsbereich Sportdidaktik 24. Internationaler Workshop Talent-förderung Schulsports in der Primarstufe? zum pädagogischen - Michael³ 1. Vorbemerkung - Schulsport im Jahr 2009 Motorische Fitness durch
Arbeitsbereich Sportdidaktik 24. Internationaler Workshop Talent-förderung Schulsports in der Primarstufe? zum pädagogischen - Michael³ 1. Vorbemerkung - Schulsport im Jahr 2009 Motorische Fitness durch
Das Coaching im Kinderfussball
 Das Coaching im Kinderfussball Wie Kinder unterstützend begleiten? Grundhaltungen des Trainers! Jedes Kind willkommen heissen! Gegenseitige Unterstützung und Zusammenarbeit! Schutz und Sicherheit anbieten!
Das Coaching im Kinderfussball Wie Kinder unterstützend begleiten? Grundhaltungen des Trainers! Jedes Kind willkommen heissen! Gegenseitige Unterstützung und Zusammenarbeit! Schutz und Sicherheit anbieten!
Ringvorlesung: Vermittlungsmethoden im Sport WS 2005/06
 Ringvorlesung: Vermittlungsmethoden im Sport WS 2005/06 1 Sport vermitteln: Auf das Wie? kommt es an! Einführung in die Methodik des Sportunterrichts 28.10.2005 2 Gliederung der Vorlesung 1. Was soll und
Ringvorlesung: Vermittlungsmethoden im Sport WS 2005/06 1 Sport vermitteln: Auf das Wie? kommt es an! Einführung in die Methodik des Sportunterrichts 28.10.2005 2 Gliederung der Vorlesung 1. Was soll und
RESILIENZ EINE GEHEIME KRAFT IN UNS..
 RESILIENZ EINE GEHEIME KRAFT IN UNS.. Resilienz beschreibt die Fähigkeit von Menschen, mit Leistungsdruck, Veränderungen und Krisen konstruktiv umzugehen, handlungsfähig zu bleiben & schlussendlich sogar
RESILIENZ EINE GEHEIME KRAFT IN UNS.. Resilienz beschreibt die Fähigkeit von Menschen, mit Leistungsdruck, Veränderungen und Krisen konstruktiv umzugehen, handlungsfähig zu bleiben & schlussendlich sogar
SELBSTEINSCHÄTZUNG 3. ALLTAGS- BEWÄLTIGUNG
 ARBEITSBLÄTTER SELBSTEINSCHÄTZUNG FÜR MITARBEITER_INNEN DIE ARBEITSBLÄTTER SIND IN FOLGENDE KATEGORIEN GEGLIEDERT: 1. KOMPETENZ ERWEITERUNG 2. IDENTITÄTS ENTWICKLUNG 3. ALLTAGS- BEWÄLTIGUNG 4. INTERESSEN
ARBEITSBLÄTTER SELBSTEINSCHÄTZUNG FÜR MITARBEITER_INNEN DIE ARBEITSBLÄTTER SIND IN FOLGENDE KATEGORIEN GEGLIEDERT: 1. KOMPETENZ ERWEITERUNG 2. IDENTITÄTS ENTWICKLUNG 3. ALLTAGS- BEWÄLTIGUNG 4. INTERESSEN
Sicherheitsregeln. 25. Tag des Schulsports. Julia Säger
 25. Tag des Schulsports Julia Säger Lacrosse Umsetzungsmöglichkeiten in der Schule, Anknüpfung an den Lehrplan Freilaufen und Körpertäuschungen erinnern an Basketball, die Schnelligkeit an Eishockey. Die
25. Tag des Schulsports Julia Säger Lacrosse Umsetzungsmöglichkeiten in der Schule, Anknüpfung an den Lehrplan Freilaufen und Körpertäuschungen erinnern an Basketball, die Schnelligkeit an Eishockey. Die
Impulsreferat: Mentaltraining im Leistungssport Die Rolle der Eltern.
 Impulsreferat: Mentaltraining im Leistungssport Die Rolle der Eltern Valentin Piffrader (geb. 25. Oktober 1971) Mentaltrainer Outdoor Trainer Sportoberschule Mals seit November 2011 für Schüler und Trainer
Impulsreferat: Mentaltraining im Leistungssport Die Rolle der Eltern Valentin Piffrader (geb. 25. Oktober 1971) Mentaltrainer Outdoor Trainer Sportoberschule Mals seit November 2011 für Schüler und Trainer
Bildung und informelles Lernen
 Institut für Sport und Sportwissenschaften Bildung und informelles Lernen Erin Gerlach Input zum Workshop beim idée sport-kongress Sport kann alles!? 20. September 2012 Warum Hintergrund 12. Kinder-
Institut für Sport und Sportwissenschaften Bildung und informelles Lernen Erin Gerlach Input zum Workshop beim idée sport-kongress Sport kann alles!? 20. September 2012 Warum Hintergrund 12. Kinder-
FUSSBALL. Ich bin gut! Wir sind besser! WIESO FUSSBALL?
 FUSSBALL Ich bin gut! Wir sind besser! Sozialkompetenz Durchsetzungsvermögen Kreativität Fitness WIESO FUSSBALL? Die Überzeugung, dass Fußball Sozialkompetenz und Kreativität, Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit,
FUSSBALL Ich bin gut! Wir sind besser! Sozialkompetenz Durchsetzungsvermögen Kreativität Fitness WIESO FUSSBALL? Die Überzeugung, dass Fußball Sozialkompetenz und Kreativität, Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit,
Workshop 2 Erfolgreich ausbilden, motivieren, fördern, Konflikte lösen
 Fachtag 07.Mai 2013 Aus den Augen verloren? Auszubildende der außerbetrieblichen Ausbildung im Fokus Workshop 2 Erfolgreich ausbilden, motivieren, fördern, Konflikte lösen Berlin 07.05.2013 Martin Schubert
Fachtag 07.Mai 2013 Aus den Augen verloren? Auszubildende der außerbetrieblichen Ausbildung im Fokus Workshop 2 Erfolgreich ausbilden, motivieren, fördern, Konflikte lösen Berlin 07.05.2013 Martin Schubert
Fortbildungsübersicht des Heilpädagogischen Fachdienstes für Kindertageseinrichtungen. Januar bis Juli 2013
 Fortbildungsübersicht des Heilpädagogischen Fachdienstes für Kindertageseinrichtungen Januar bis Juli 2013 1. Die kollegiale Fallbesprechung 2. Elterngespräche sicher führen 3. Förderung der sozial-emotionalen
Fortbildungsübersicht des Heilpädagogischen Fachdienstes für Kindertageseinrichtungen Januar bis Juli 2013 1. Die kollegiale Fallbesprechung 2. Elterngespräche sicher führen 3. Förderung der sozial-emotionalen
Die tägliche Sportstunde an Grundschulen in NRW
 Die tägliche Sportstunde an Grundschulen in NRW Prof. Dr. Miriam Seyda Juniorprofessorin für das Fach Bewegung, Spiel und Sport im Kindesalter Vortrag auf dem ÖISS-Kongress 2014: Schule-Sport-Sportstätte,
Die tägliche Sportstunde an Grundschulen in NRW Prof. Dr. Miriam Seyda Juniorprofessorin für das Fach Bewegung, Spiel und Sport im Kindesalter Vortrag auf dem ÖISS-Kongress 2014: Schule-Sport-Sportstätte,
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lerntagebücher im Sportunterricht. Eigene Leistungen reflektieren und Schlüsselkompetenzen stärken Das komplette Material finden Sie
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lerntagebücher im Sportunterricht. Eigene Leistungen reflektieren und Schlüsselkompetenzen stärken Das komplette Material finden Sie
Recovery: Wie werden psychisch kranke Menschen eigentlich wieder gesund?
 Recovery: Wie werden psychisch kranke Menschen eigentlich wieder gesund? 22. Treffen der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen im Landkreis Esslingen 13. November 2010, Esslingen Andreas Knuf www.gesundungswege.de
Recovery: Wie werden psychisch kranke Menschen eigentlich wieder gesund? 22. Treffen der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen im Landkreis Esslingen 13. November 2010, Esslingen Andreas Knuf www.gesundungswege.de
Vom Lernfeld zur Lernsituation
 Vom Lernfeld zur Lernsituation Daniela Lund Universität Hamburg Fachbereich Berufliche Bildung und Lebenslanges Lernen Institut für Berufs- und Wirtschaftspädagogik Sedanstraße 19 22041 Hamburg 040 42838
Vom Lernfeld zur Lernsituation Daniela Lund Universität Hamburg Fachbereich Berufliche Bildung und Lebenslanges Lernen Institut für Berufs- und Wirtschaftspädagogik Sedanstraße 19 22041 Hamburg 040 42838
Soziales Lernen Werte erfahren, entdecken, einprägen
 Soziales Lernen Werte erfahren, entdecken, einprägen "Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel." (Johann Wolfgang Goethe) Die Verankerung in verlässlichen Beziehungen und
Soziales Lernen Werte erfahren, entdecken, einprägen "Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel." (Johann Wolfgang Goethe) Die Verankerung in verlässlichen Beziehungen und
Seminar Emotionale Intelligenz *
 Seminar Emotionale Intelligenz * S. Scully, Cut Ground Orange and Pink, 2011 (Detail) Dieses zweiteilige Persönlichkeitstraining spricht Menschen an, die ihre Selbstführung verbessern wollen, mehr Unabhängigkeit
Seminar Emotionale Intelligenz * S. Scully, Cut Ground Orange and Pink, 2011 (Detail) Dieses zweiteilige Persönlichkeitstraining spricht Menschen an, die ihre Selbstführung verbessern wollen, mehr Unabhängigkeit
Ein Qualitätsmanagement im Dienste der Schul- und Unterrichtsentwicklung
 Ein Qualitätsmanagement im Dienste der Schul- und Unterrichtsentwicklung n haben jahrelang Reformen ihrer Strukturen und der Führung bewältigt. Nun kann das Kerngeschäft Guter Unterricht ins Zentrum der
Ein Qualitätsmanagement im Dienste der Schul- und Unterrichtsentwicklung n haben jahrelang Reformen ihrer Strukturen und der Führung bewältigt. Nun kann das Kerngeschäft Guter Unterricht ins Zentrum der
Berner Fachhochschule Gesundheit. Hochschuldidaktische Leitsätze im Bachelor of Science in Pflege
 Berner Fachhochschule Gesundheit Hochschuldidaktische Leitsätze im Bachelor of Science in Pflege Ausgangslage Das Leitbild der Berner Fachhochschule (BFH) vom 17. November 2009 bildet die Grundlage und
Berner Fachhochschule Gesundheit Hochschuldidaktische Leitsätze im Bachelor of Science in Pflege Ausgangslage Das Leitbild der Berner Fachhochschule (BFH) vom 17. November 2009 bildet die Grundlage und
Kompetenzorientierung in Unterricht und Leistungsmessung (RUL ) Eingangsdiagnose und Instruktionsdifferenzierung am Beispiel waveboard
 Kompetenzorientierung in Unterricht und Leistungsmessung (RUL 9.10.2013) Eingangsdiagnose und Instruktionsdifferenzierung am Beispiel waveboard 1 Was sind Kompetenzen? Kompetenzen stellen in der Lesart
Kompetenzorientierung in Unterricht und Leistungsmessung (RUL 9.10.2013) Eingangsdiagnose und Instruktionsdifferenzierung am Beispiel waveboard 1 Was sind Kompetenzen? Kompetenzen stellen in der Lesart
Entwicklung der Persönlichkeit im Fussball. Trainerausbildung C- Diplom
 Entwicklung der Persönlichkeit im Fussball Trainerausbildung C- Diplom In jedem Training sollte man lachen können die Spieler wollen lernen und sie möchten auch etwas leisten Grundlagen für die Entwicklung
Entwicklung der Persönlichkeit im Fussball Trainerausbildung C- Diplom In jedem Training sollte man lachen können die Spieler wollen lernen und sie möchten auch etwas leisten Grundlagen für die Entwicklung
Grundlagen der Sportpädagogik
 Grundlagen der Sportpädagogik Vorlesung zum Themenbereich Grundlagen des Schulsports (Modul 1.1 für f r RPO und GHPO) Do 9.30-11 Uhr im Seminarraum des Sportzentrums Sportzentrum der Pädagogischen Hochschule
Grundlagen der Sportpädagogik Vorlesung zum Themenbereich Grundlagen des Schulsports (Modul 1.1 für f r RPO und GHPO) Do 9.30-11 Uhr im Seminarraum des Sportzentrums Sportzentrum der Pädagogischen Hochschule
Die PS Uttwil achtet und fördert die physische Gesundheit aller Beteiligten.
 Lernkompetenz Ziele und Indikatoren Schule Beteiligte Bereich Subbereich Ziele (Merkmale) Indikatoren Selbstkompetenz Gesundheit Die PS Uttwil achtet und fördert die physische Gesundheit aller Beteiligten.
Lernkompetenz Ziele und Indikatoren Schule Beteiligte Bereich Subbereich Ziele (Merkmale) Indikatoren Selbstkompetenz Gesundheit Die PS Uttwil achtet und fördert die physische Gesundheit aller Beteiligten.
Ich Du Wir. gemeinsam am PG
 Ich Du Wir gemeinsam am PG Seite 2 Sozialcharta In dieser Präambel oder besser Vorwort zu unserem Vertrag stehen allgemeine Grundsätze, die für alle gelten sollen. Inhaltsübersicht Präambel Seite 3 Lehrer.innen
Ich Du Wir gemeinsam am PG Seite 2 Sozialcharta In dieser Präambel oder besser Vorwort zu unserem Vertrag stehen allgemeine Grundsätze, die für alle gelten sollen. Inhaltsübersicht Präambel Seite 3 Lehrer.innen
Entwicklungspsychologie
 Entwicklungspsychologie 1. Begriffsbestimmung Kindheit 2. Kindheit und geistige Entwicklung 3. Kindheit und Konzentration 4. Kindheit und Motivation 5. Spiel und kindliche Entwicklung Begriffsbestimmung
Entwicklungspsychologie 1. Begriffsbestimmung Kindheit 2. Kindheit und geistige Entwicklung 3. Kindheit und Konzentration 4. Kindheit und Motivation 5. Spiel und kindliche Entwicklung Begriffsbestimmung
Ist das Bewegungsfeld Bewegen an Geräten Turnen in der Qualifikationsphase Profil bildend, sind alle drei inhaltlichen Kerne verbindlich.
 Profil 3: BF/SB 5: Bewegen an Geräten - Turnen BF/SB 7: Spielen in und mit Regelstrukturen Sportspiele Inhaltsfeld a: Bewegungsstruktur und Bewegungslernen Inhaltsfeld e: Kooperation und Konkurrenz BF/SB
Profil 3: BF/SB 5: Bewegen an Geräten - Turnen BF/SB 7: Spielen in und mit Regelstrukturen Sportspiele Inhaltsfeld a: Bewegungsstruktur und Bewegungslernen Inhaltsfeld e: Kooperation und Konkurrenz BF/SB
Was Sie erwartet Multiprofessionelle Kooperation 7. Zielperspektive schulinterner Zusammenarbeit 8. Das Geheimnis des Könnens heißt Wollen. 9. K
 Schulentwicklung in der Ganztagsschule durch innerschulische Kooperation von der Lehrkräftekooperation zur multiprofessionellen Zusammenarbeit Was Sie erwartet... 1. Blick auf die Erlasslage 2. Begriffsbestimmung
Schulentwicklung in der Ganztagsschule durch innerschulische Kooperation von der Lehrkräftekooperation zur multiprofessionellen Zusammenarbeit Was Sie erwartet... 1. Blick auf die Erlasslage 2. Begriffsbestimmung
Die Schülerinnen und Schüler können Spiele spielen, weiterentwickeln und erfinden, indem sie gemeinsam Vereinbarungen treffen und einhalten.
 Fachbereichslehrplan Bewegung und Sport Kompetenzaufbau BS. Spielen A Bewegungsspiele. Die Schülerinnen und Schüler können Spiele spielen, weiterentwickeln und erfinden, indem sie gemeinsam Vereinbarungen
Fachbereichslehrplan Bewegung und Sport Kompetenzaufbau BS. Spielen A Bewegungsspiele. Die Schülerinnen und Schüler können Spiele spielen, weiterentwickeln und erfinden, indem sie gemeinsam Vereinbarungen
Grundlagen der Sportpädagogik
 Grundlagen der Sportpädagogik Vorlesung zum Themenbereich Grundlagen des Schulsports (Modul 1.1 für f r RPO und GHPO) Do 9.30-11 Uhr im Seminarraum des Sportzentrums Sportzentrum der Pädagogischen Hochschule
Grundlagen der Sportpädagogik Vorlesung zum Themenbereich Grundlagen des Schulsports (Modul 1.1 für f r RPO und GHPO) Do 9.30-11 Uhr im Seminarraum des Sportzentrums Sportzentrum der Pädagogischen Hochschule
Eine Trainingseinheit für unsere E-Junioren
 Eine Trainingseinheit für unsere E-Junioren Neben der Verbesserung der technischen und taktischen Fähigkeiten ist die Schulung der Spielkreativität ein wesentliches Ziel im Kindertraining. Mit der Ausbildung
Eine Trainingseinheit für unsere E-Junioren Neben der Verbesserung der technischen und taktischen Fähigkeiten ist die Schulung der Spielkreativität ein wesentliches Ziel im Kindertraining. Mit der Ausbildung
Konzept zur Förderung des Tennissports im TC RWR
 Konzept zur Förderung des Tennissports im TC RWR -Rahmenbedingungen -Generelle Ziele -Strukturen/Aufbau der Sportförderung -Trainingsziele und Umsetzung -Leistung und Gegenleistung -Leistungskatalog Rahmenbedingungen
Konzept zur Förderung des Tennissports im TC RWR -Rahmenbedingungen -Generelle Ziele -Strukturen/Aufbau der Sportförderung -Trainingsziele und Umsetzung -Leistung und Gegenleistung -Leistungskatalog Rahmenbedingungen
FC Raiffeisen Viktoria 62 Bregenz Leitbild des Nachwuchsfußballs
 FC Raiffeisen Viktoria 62 Bregenz Leitbild des Nachwuchsfußballs Soziale Aufgaben: - Hinführen der Nachwuchsspieler zu einer sozialen-sportlichen Gemeinschaft. - Anbieten einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung.
FC Raiffeisen Viktoria 62 Bregenz Leitbild des Nachwuchsfußballs Soziale Aufgaben: - Hinführen der Nachwuchsspieler zu einer sozialen-sportlichen Gemeinschaft. - Anbieten einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung.
Exkurs 2: Förderung sozialen Lernens
 Exkurs 2: Förderung sozialen Lernens Soziales Lernen: Definition Soziales Lernen bezeichnet diejenige Dimension des Lernens, die zwischenmenschliche Beziehungen und den Umgang mit darauf bezogenen Sinndeutungen,
Exkurs 2: Förderung sozialen Lernens Soziales Lernen: Definition Soziales Lernen bezeichnet diejenige Dimension des Lernens, die zwischenmenschliche Beziehungen und den Umgang mit darauf bezogenen Sinndeutungen,
Schulprogramm der Hermann-Hesse-Schule
 Erziehung An der Hermann-Hesse-Schule sollen sich alle wohlfühlen, um in Ruhe lernen, unterrichten und zusammenleben zu können. Dazu ist es notwendig, freundlich, höflich, offen und respektvoll miteinander
Erziehung An der Hermann-Hesse-Schule sollen sich alle wohlfühlen, um in Ruhe lernen, unterrichten und zusammenleben zu können. Dazu ist es notwendig, freundlich, höflich, offen und respektvoll miteinander
Grundlagen der Sportpädagogik (WS 2004/05) Dietrich Kurz Universität Bielefeld Abteilung Sportwissenschaft
 Grundlagen der Sportpädagogik (WS 2004/05) Grundlagen der Sportpädagogik (WS 2004/05) Lektion 12: Sport pädagogisch vermitteln Lektion 12: Sport pädagogisch vermitteln 1. Sport vermitteln nicht nur eine
Grundlagen der Sportpädagogik (WS 2004/05) Grundlagen der Sportpädagogik (WS 2004/05) Lektion 12: Sport pädagogisch vermitteln Lektion 12: Sport pädagogisch vermitteln 1. Sport vermitteln nicht nur eine
Drei einfache Verhaltensregeln, die die geltenden Spielregeln ergänzen, sollen dafür sorgen, den Kindern ihr Spiel zurückzugeben
 Die FairPlay-Turniere (Turnierform) sind eine innovative, leicht verständliche Spielform, deren Rahmenbedingungen einen kindgerechten Wettspielbetrieb ermöglichen. Auslöser für die FairPlay-Turniere waren
Die FairPlay-Turniere (Turnierform) sind eine innovative, leicht verständliche Spielform, deren Rahmenbedingungen einen kindgerechten Wettspielbetrieb ermöglichen. Auslöser für die FairPlay-Turniere waren
Albert-Schweitzer-Schule Sonderpädagogisches Förderzentrum Sonthofen. Leitbild
 Albert-Schweitzer-Schule Sonderpädagogisches Förderzentrum Sonthofen Leitbild "Die Zukunft liegt nicht darin, dass man an sie glaubt oder nicht an sie glaubt, sondern darin, dass man sie vorbereitet."
Albert-Schweitzer-Schule Sonderpädagogisches Förderzentrum Sonthofen Leitbild "Die Zukunft liegt nicht darin, dass man an sie glaubt oder nicht an sie glaubt, sondern darin, dass man sie vorbereitet."
- lernen mit Freude und Neugier.
 Schülerhandeln AKTIVES LERNEN Das Lernen der Schüler/innen steht im Mittelpunkt des Unterrichtsgeschehens. Die Schüler/innen lernen mit Freude und Neugier. zeigen Interesse und Engagement beim Lernen bringen
Schülerhandeln AKTIVES LERNEN Das Lernen der Schüler/innen steht im Mittelpunkt des Unterrichtsgeschehens. Die Schüler/innen lernen mit Freude und Neugier. zeigen Interesse und Engagement beim Lernen bringen
Differenzierung im Sportunterricht
 Sport Marlen Frömmel Differenzierung im Sportunterricht Studienarbeit Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Institut für Sportwissenschaft Differenzierung im Sportunterricht Ausarbeitung für den Grundkurs
Sport Marlen Frömmel Differenzierung im Sportunterricht Studienarbeit Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Institut für Sportwissenschaft Differenzierung im Sportunterricht Ausarbeitung für den Grundkurs
Kapitel 2, Führungskräftetraining, Kompetenzentwicklung und Coaching:
 Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? von Tanja Hollinger 1. Auflage Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? Hollinger schnell und portofrei
Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? von Tanja Hollinger 1. Auflage Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? Hollinger schnell und portofrei
KopS Kompetenzprofile für das Fach Sport auf Vorschul- und Primarschulstufe
 source: https://doi.org/10.7892/boris.64277 downloaded: 28.2.2017 KopS Kompetenzprofile für das Fach Sport auf Vorschul- und Primarschulstufe Dr. Stefan Valkanover Dr. Esther Oswald Markus Blum Expertenhearing
source: https://doi.org/10.7892/boris.64277 downloaded: 28.2.2017 KopS Kompetenzprofile für das Fach Sport auf Vorschul- und Primarschulstufe Dr. Stefan Valkanover Dr. Esther Oswald Markus Blum Expertenhearing
Schulentwicklung in der Ganztagsschule durch innerschulische Kooperation
 Schulentwicklung in der Ganztagsschule durch innerschulische Kooperation von der Lehrkräftekooperation zur multiprofessionellen Zusammenarbeit (Stand: 05.07.2017) Erlass 3.7 Erweiterung des Bildungsangebots
Schulentwicklung in der Ganztagsschule durch innerschulische Kooperation von der Lehrkräftekooperation zur multiprofessionellen Zusammenarbeit (Stand: 05.07.2017) Erlass 3.7 Erweiterung des Bildungsangebots
Ausführlicher Bericht zu einer ersten schulpraktischen Übung mit Hospitation und Planung und Reflexion der ersten Unterrichtserfahrungen
 Pädagogik Anika Weller Ausführlicher Bericht zu einer ersten schulpraktischen Übung mit Hospitation und Planung und Reflexion der ersten Unterrichtserfahrungen Unterrichtsentwurf Inhalt 1 Die Schule...
Pädagogik Anika Weller Ausführlicher Bericht zu einer ersten schulpraktischen Übung mit Hospitation und Planung und Reflexion der ersten Unterrichtserfahrungen Unterrichtsentwurf Inhalt 1 Die Schule...
Lern- und Erfahrungsfeld LAUFEN, SPRINGEN, WERFEN - Betrachtung im Verlauf der kindlichen Entwicklung nach Inhaltsaspekten. Primarphase 6-10 Jahre
 Lern- und Erfahrungsfeld LAUFEN, SPRINGEN, WERFEN - Betrachtung im Verlauf der kindlichen Entwicklung nach en Welche Lernziele sind von Bedeutung? Dass die Kinder und/oder Jugendlichen Bildungsphase/Altersgruppe
Lern- und Erfahrungsfeld LAUFEN, SPRINGEN, WERFEN - Betrachtung im Verlauf der kindlichen Entwicklung nach en Welche Lernziele sind von Bedeutung? Dass die Kinder und/oder Jugendlichen Bildungsphase/Altersgruppe
Bewegung, Spiel und Sport. Mehr als ein Fach!!!
 Bewegung, Spiel und Sport Mehr als ein Fach!!! Aufbau des Bildungsplans Vorwort Verankerung der Leitperspektiven für alle Fächer übergreifend Leitgedanken des Faches Prozessbezogene Kompetenzen Inhaltsbezogene
Bewegung, Spiel und Sport Mehr als ein Fach!!! Aufbau des Bildungsplans Vorwort Verankerung der Leitperspektiven für alle Fächer übergreifend Leitgedanken des Faches Prozessbezogene Kompetenzen Inhaltsbezogene
Ideen-Brunch Sportunterricht
 Ideen-Brunch Sportunterricht Praxisideen kompetenzorientierten Sportunterrichts im verbalen Doppelpass A Good Practice Project Atelier A I Ideen-Brunch 19.11.2011 Projektorientiertes Unterrichten am Beispiel
Ideen-Brunch Sportunterricht Praxisideen kompetenzorientierten Sportunterrichts im verbalen Doppelpass A Good Practice Project Atelier A I Ideen-Brunch 19.11.2011 Projektorientiertes Unterrichten am Beispiel
WIRkung entfalten - Selbstwirksamkeit stärken
 WIRkung entfalten - Selbstwirksamkeit stärken LdE als Instrument zur Resilienzförderung Anne Seifert Freudenberg Stiftung Überblick WIRkung entfalten? Resilienzforschung + Selbstwirksamkeit Wie kann Selbstwirksamkeit
WIRkung entfalten - Selbstwirksamkeit stärken LdE als Instrument zur Resilienzförderung Anne Seifert Freudenberg Stiftung Überblick WIRkung entfalten? Resilienzforschung + Selbstwirksamkeit Wie kann Selbstwirksamkeit
