Selbsthilfegruppen und Ärzte Kontakte, Erwartungen, Kooperationsnutzen
|
|
|
- Susanne Kohl
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Claudia Kretzschmar und Wolfgang Slesina Selbsthilfegruppen und Ärzte Kontakte, Erwartungen, Kooperationsnutzen 1. Stand und Entwicklungen Selbsthilfegruppen sind ein wesentlicher Teil des Gesundheitswesens. Ihre Arbeit und ihre Leistungen für Menschen mit chronischer Erkrankung oder Behinderung haben gesellschaftlich und politisch zunehmend Anerkennung gefunden. Überwiegend werden Gesundheits-Selbsthilfegruppen und das professionelle medizinische Versorgungssystem in einem Ergänzungsverhältnis gesehen, was auf die eigenständige Rolle der Selbsthilfe und die besondere Art ihrer Hilfen für chronisch Kranke und behinderte Menschen verweist. Nach verbreiteter Auffassung liegen in einer verstärkten Kooperation von Ärzten und Selbsthilfegruppen Potentiale für die weitere Verbesserung der Qualität der somatischen und psychosozialen Versorgung der Patienten (z. B. Stark 2001). Mehrfach waren in den letzten 20 Jahren die Einstellungen, Beziehungen und Kontakte zwischen Ärzten und Selbsthilfegruppen Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen (z. B. Trojan 1986; Röhrig 1989; Meye/Slesina 1990; Bachl et al. 1998; SEKIS 1999; Findeiß et al. 2001; Rau et al. 2003; Litschel 2004). Borgetto hat die z. T. heterogenen Studienergebnisse in einer hilfreichen Übersicht zusammengefasst (2002, 2003): Demnach lag in den Studien der 80er und 90er Jahre der Anteil der Ärzte mit Kontakt zu Selbsthilfegruppen fast stets unter 50%. Von den Selbsthilfegruppen teilten zwischen 50 bis nahezu 100% Kontakte zu Ärzten mit. Selbsthilfegruppen erwarteten von der Kooperation mit Ärzten in erster Linie fachmedizinische Informationen und Aufklärung, aber auch die Bekanntmachung und Empfehlung ihrer Gruppe bei Patienten sowie ggf. organisatorische Unterstützung. Ärzte sahen die Vorteile einer Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen primär in der arbeitsteiligen Entlastung und Ergänzung im Bereich der krankheitsbedingten psychosozialen Probleme der Patienten, in der Förderung der krankheitsbezogenen Patientenkompetenz und der Problembewältigung. Anhand ihrer Projektergebnisse empfehlen von Kardorff/Leisenheimer (1999) eine realistische Einschätzung der bisherigen Kooperationen zwischen Selbsthilfegruppen und Experten, da die meisten Kontakte in der Vergangenheit eher»indirekter«art waren (schriftliche Informationen, Auslegen von Informationsmaterial, Empfehlung zur Gruppenteilnahme). Auch bei den direkten Kontakten handelte es sich eher um»lose Verknüpfungen und punktuelle 121
2 Kontakte«. Die Voraussetzungen für eine künftige intensivierte, verstetigte Kooperation von Ärzten und Selbsthilfegruppen haben die Autoren differenziert herausgearbeitet (dies. 1999; auch Stötzner 1999; Findeiß et al. 2001). Eine eigene Studie untersuchte in den Jahren 2003/04 in der Region Bielefeld/Kreis Gütersloh die Kontakte sowie die Erwartungen und Erfahrungen von Ärzten und Selbsthilfegruppen zur wechselseitigen Zusammenarbeit. 1 Befragt wurden 140 niedergelassene Ärzte (= 47% Beteiligungsquote 2 ) und 167 Selbsthilfegruppen (= 69% Beteiligungsquote). 14 Jahre zuvor war in derselben Region eine thematisch ähnliche Untersuchung durchgeführt worden (Meye/Slesina 1990). Wie die neue Studie zeigt, hat sich die Anzahl der Gesundheits-Selbsthilfegruppen in Bielefeld/Kreis Gütersloh seit der früheren Untersuchung von ca. 160 auf gut 300 Gruppen verdoppelt. Der stärkste Zuwachs erfolgte im Bereich der Gruppen chronisch somatisch Kranker, deren Zahl sich vervierfachte. Im genannten Zeitraum stieg auch die Zahl der Ärzte, die schon einmal Kontakt zu Selbsthilfegruppen hatten: von 43,8% der niedergelassenen Ärzte im Jahr 1988, auf 52,2% im Jahre 1991 und auf 58,6% im Jahr Über Selbsthilfegruppen-Kontakte in den letzten 12 Monaten berichteten 35,7% der niedergelassenen Ärzte in der Befragung Die Intensität und Stetigkeit der Selbsthilfegruppen-Kontakte der Ärzte lässt sich wie folgt differenzieren: Eine Teilgruppe von ca. 11% aller niedergelassenen Ärzte ist in eine feste Beziehung mit Selbsthilfegruppen eingebunden, zumeist in Form der ständigen Begleitung und Betreuung einer Gruppe. Weitere 14% der niedergelassenen Ärzte kommunizieren und interagieren eher anlassbezogen, aber durchaus erheblich mit Selbsthilfegruppen (z. B. bei Anfragen oder Einladungen von Gruppen). Weitere ca. 11% der Ärzte verfügen nur über einen indirekten Kontakt zu Selbsthilfegruppen, meist indem Gruppen Informationsmaterial zusenden und die Ärzte es im Wartezimmer auslegen. 64% der Ärzte hatten keine SHG-Kontakte im letzten Jahr (s. auch Slesina/Kretzschmar 2004). Anhand der Befragungsdaten 2003/04 werden die folgenden Fragen aufgegriffen: In welcher Hinsicht unterscheidet sich die Gruppe der niedergelassenen Ärzte mit Selbsthilfegruppen-Kontakt in den letzten 12 Monaten von jenen ohne solchen Kontakt? Welches Kontaktnetz und welche Kontaktformen bestanden seitens der Selbsthilfegruppen zu niedergelassenen Ärzten in den letzten 12 Monaten? Welche Vorteile/Nutzen sehen die Gruppen in der Zusammenarbeit mit Ärzten? In welcher Weise könnten Ärzte nach Auffassung der Gruppen ihre Arbeit am besten unterstützen? Wo liegen aus Sicht der Gruppen die größten Erschwernisse der Kooperation mit Ärzten? 122 n DAG SHG (Hrsg.) selbsthilfegruppenjahrbuch 2005 / S / Gieße
3 2. Ärzte mit und ohne Kontakt zu Selbsthilfegruppen im letzten Jahr Ausgehend von den niedergelassenen Ärzten, die in den letzten 12 Monaten direkten oder zumindest schriftlichen Kontakt zu Selbsthilfegruppen hatten, sind mehrere graduelle Unterschiede zu den anderen Ärzten erkennbar. Dabei handelt es sich um teils geringere, teils größere Differenzen bei sozio-demographischen Merkmalen, der Art der ärztlichen Niederlassung, den Arztgebieten sowie den Vorstellungen und Sichtweisen von Ärzten über Selbsthilfegruppen: So umfasst die Gruppe der Ärzte mit Selbsthilfegruppen-Kontakt überdurchschnittlich viele Ärzte im Alter über 50 Jahre (sowohl bei Ärzten als auch bei Ärztinnen), einen höheren Anteil von Ärzten in Gemeinschaftspraxen sowie einen höheren Prozentsatz von Internisten, Allgemeinärzten, Gynäkologen und Nervenärzten im Vergleich zur Arztgruppe ohne SHG-Kontakt (Tab. 1). Nahezu alle Ärzte mit Selbsthilfegruppen-Kontakt in den letzten 12 Monaten haben Patienten in diesem Zeitraum zur Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe geraten (98%); bei den anderen Ärzten waren es 67,8%. Außerdem haben Ärzte mit Kontakt deutlich mehr Patienten diese Empfehlung ausgesprochen: z. B. haben 40% dieser Ärzte jeweils mehr als 10 Patienten im letzten Jahr zur SHG-Teilnahme geraten, bei den anderen Ärzten waren es 11,1%. Tabelle 1: Ärzte mit bzw. ohne SHG-Kontakt in den letzten 12 Monaten: soziodemographische Merkmale Alle Ärzte Ärzte ohne Kontakt zu Ärzte mit Kontakt zu SHGn in den SHGn in den letzten 12 Monaten letzten 12 Monaten n=140 % n=90 % n=50 % Alter: < 40 Jahre 14 10, ,1 4 8, Jahre 52 37, , ,0 50 Jahre 70 50, , ,0 keine Angabe 4 2,9 4 4,4 - - Geschlecht: weiblich 38 27, , ,0 männlich , , ,0 Praxisart: Einzelpraxis 81 57, , ,0 Gemeinsch. Praxis 58 41, , ,0 keine Angabe 1 0,7 1 1,1 - - Arztgebiet: Allg./Prakt. Ärzte 43 30, , ,0 Internisten 31 22, , ,0 weitere Gebietsärzte 66 47, , ,0 123
4 Diese häufigeren Teilnahmeempfehlungen von Ärzten mit SHG-Kontakt stehen auch in einem Zusammenhang mit einer besonders positiven Sichtweise über Selbsthilfegruppen (Tab. 2). So vertreten z. B. mehr Ärzte mit SHG-Kontakt im Vergleich zu den anderen Ärzten die Auffassung, dass Selbsthilfegruppen im Prinzip arztoffen, arztfreundlich eingestellt (84% vs. 55%) und kooperationsinteressiert sind (88% vs. 64%). Sie sehen die Gruppen nicht als eine Konkurrenz für den Arztberuf an (98% vs. 89%). Kein Unterschied jedoch besteht in der Auffassung einer gewissen Tendenz zu polemischem Verhalten bei Selbsthilfegruppen (jeweils um 50%). Ärzte mit SHG-Kontakt beurteilen außerdem den ärztlichen Nutzen einer Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen noch etwas günstiger als Ärzte ohne Kontakt (Tab. 3): die Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen schärfe den Blick für die Probleme chronisch Kranker und Behinderter (88% vs. 70%) und verbessere insbesondere die ärztliche Beratung der Patienten mit chronischer Erkrankung und Behinderung (86% vs. 60%). Den Nutzen von Selbsthilfegruppen für Patienten bewerten sowohl Ärzte mit als auch ohne SHG-Kontakt gleichermaßen sehr positiv mit Zustimmungswerten meist um 90%: durch die Gruppen verbessere sich die Informiertheit der Patienten über ihre Krankheit, die Patientenkompetenz im Umgang mit der Krankheit, ferner die Patienten-Compliance sowie die seelische Stabilisierung und Hilfe bei krankheitsbedingten Problemen. Auch die Wichtigkeit einer Zusammenarbeit von Ärzten und Selbsthilfegruppen und der Wunsch nach mehr Informationen über Selbsthilfegruppen kamen in beiden Arztgruppen annähernd gleich oft zum Ausdruck (jeweils Werte um 43%). Das mit Abstand bedeutsamste Hemmnis für eine künftige (oder verstärkte) Kooperation mit Selbsthilfegruppen bildet für die Ärzte der eigene Zeitmangel (74,3%). Ärzte ohne SHG-Kontakt führten etwas öfter auch als erschwerend an: eine geringe Zahl von Selbsthilfegruppen in der Umgebung (18,9% vs. 8%) und einen fehlenden finanziellen Ausgleich (26,7% vs. 16%). 124 n DAG SHG (Hrsg.) selbsthilfegruppenjahrbuch 2005 / S / Gieße
5 Tabelle 2: Ärzte mit bzw. ohne SHG-Kontakt in den letzten 12 Monaten: Sichtweisen über Selbsthilfegruppen Auffassungen Alle Ärzte Ärzte ohne Kontakt zu Ärzte mit Kontakt zu zu SHGn: SHGn in den SHGn in den letzten 12 Monaten letzten 12 Monaten n=140 % n=90 % n=50 % SHGn sind Ärzten gegenüber positiv eingestellt: Sehr/etwas 91 65, , ,0 SHGn sind an Kooperation mit Ärzten interessiert: Sehr/etwas , , ,0 SHGn sind eine Konkurrenz für Ärzte: Eher nicht/gar nicht , , ,0 SHGn verhalten sich oft polemisch: Sehr/etwas 65 46, , ,0 Tabelle 3: Ärzte mit bzw. ohne SHG-Kontakt in den letzten 12 Monaten: Nutzen einer Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen Die Zusammenarbeit Alle Ärzte Ärzte ohne Kontakt zu Ärzte mit Kontakt zu mit SHGn: SHGn in den SHGn in den letzten 12 Monaten letzten 12 Monaten n=140 % n=90 % n=50 % schärft den ärztlichen Blick für Probleme chronisch Kranker: Sehr/etwas , , ,0 verbessert ärztliche Beratung Sehr/etwas 97 69, , ,0 3. Kontaktnetz und Kontaktformen von Selbsthilfegruppen im letzten Jahr 80% der Selbsthilfegruppen hatten bereits einmal Kontakt zu Ärzten, 65% der Gruppen im Laufe der letzten 12 Monate (Tab. 4). Es sind besonders die Gruppen von chronisch somatisch Kranken (72,7%) und Abhängigkeitskranken (57,1%), die im letzten Jahr im Austausch mit Ärzten standen. Von den Gruppen Behinderter hatten 50% und von den Gruppen psychisch Kranker 38,5% Kontakt zu Ärzten im letzten Jahr. Bei manchen Gruppen beschränkte sich der 125
6 Arztkontakt in den letzten 12 Monaten entweder nur auf niedergelassene Ärzte (13,8% der Gruppen) oder nur auf Krankenhausärzte (14,4%). Es überwogen jedoch die Gruppen (35,9%) mit Kontakten sowohl zu niedergelassenen als auch zu Krankenhausärzten. Je nach der Krankheits-/Behinderungsart standen unterschiedliche Arztgruppen im Vordergrund der Kontakte: bei den Gruppen chronisch somatisch Kranker am häufigsten Internisten und Nervenärzte (Psychiatrie, Psychotherapie, Neurologie), bei den Gruppen Abhängigkeitskranker insbesondere Allgemeinärzte und Nervenärzte, bei den Gruppen psychisch Kranker ausschließlich Nervenärzte, bei den Gruppen von Behinderten in erster Linie Allgemeinärzte. Von festen, regelmäßigen Kontakten zu Ärzten berichteten 25,1% der Gruppen. Solche stabilen Gruppen-Arzt-Kontakte liegen insbesondere bei den Gruppen somatisch Kranker (31,8%), am wenigsten bei den Gruppen Abhängigkeitskranker vor (7,1%). Die Kontaktinitiative in den letzten 12 Monaten ging ganz überwiegend von den Gruppen aus (38,9% aller Gruppen), des öfteren sowohl von der Gruppe als auch von Ärzten (19,2%), selten ausschließlich von einem Arzt (3,0%). Tabelle 4: Kontakte von Selbsthilfegruppen zu Ärzten in den letzten 12 Monaten Alle Gruppenart Gruppen Chronische Behinderung Abhängigkeit Psychische Erkrankung Sucht Erkrankung n=167 % n=110 % n=16 % n=28 % n=13 % Arztkontakt in den letzten 12 Monaten , ,7 8 50, ,1 5 38,5 Fester/regelmäßiger Arztkontakt 42 25, ,8 3 18,8 2 7,1 2 15,4 Kontakt zu: niedergelassen Ärzten 23 13, ,4 2 12,5 3 10,7 - - Krankenhausärzten 24 14, ,6 2 12,5 4 14,3 3 23,1 sowohl als auch 60 35, ,9 4 25,0 9 32,1 2 15,4 Das häufigste Anliegen, mit dem Gruppen in den letzen 12 Monaten auf Ärzte zugingen, war der Wunsch eines ärztlichen Vortrags (44,3%), gefolgt von der Einladung an Ärzte zur Teilnahme an einem Treffen der Gruppe (39,5%). 37,1% der Gruppen haben Ärzte gebeten, das ihnen zugesandte oder ausgehändigte Informationsmaterial über die Gruppe bzw. Krankheit in der Praxis auszulegen. Weitere häufige Anlässe für die Kontaktherstellung zu einem Arzt waren eine konkrete medizinische Frage der Gruppe (32,9%) oder das Anliegen einer ärztlichen Betreuung der Gruppe (18,6%). 126 n DAG SHG (Hrsg.) selbsthilfegruppenjahrbuch 2005 / S / Gieße
7 Die faktischen Kooperationen von Ärzten und Selbsthilfegruppen im letzten Jahr entsprachen ungefähr der Reihenfolge der genannten Anliegen der Gruppen. Die häufigsten konkreten Kooperationsformen waren der Vortrag eines Arztes vor der Gruppe (40,7%), die Teilnahme eines Arztes an einem Gruppentreffen (29,3%), die ärztliche Beratung der Gruppe zu einer medizinischen Frage (29,9%), die ärztliche Betreuung einer Gruppe (11,4%) sowie eine Fülle weiterer Kooperationsaktivitäten (öffentliche Veranstaltungen, Aufbau einer neuen Gruppe, Patientenseminare, Internetumfrage u. a.). Neue Mitglieder kommen üblicherweise durch Hinweise von Bekannten/Freunden/Betroffenen zu den Gruppen (73,1%), ferner auf Anraten von Ärzten (38,3%) und durch Informationen in Zeitungen (35,9%). In den letzten 12 Monaten erhielten etwas mehr als die Hälfte (52,1%) der Selbsthilfegruppen aufgrund ärztlicher Patientenberatung neue Mitglieder. Dies war am häufigsten bei den Gruppen psychisch Kranker (69,2%) und den Gruppen chronisch somatisch Kranker (54,5%) der Fall, gefolgt von den Gruppen Abhängigkeitskranker (50,0%) und von Behindertengruppen (25%). Selbsthilfegruppen mit Arztkontakt in den letzten 12 Monaten berichteten wesentlich häufiger (62,4%) von ärztlich angeregten Mitgliederzugängen als Gruppen ohne Kontakt (32,1%). 4. Nutzen einer Zusammenarbeit mit Ärzten für die Gruppen Wie sehen die Selbsthilfegruppen den Nutzen, den eine Zusammenarbeit mit Ärzten für sie haben kann bzw. bereits hat? Im wesentlichen nannten die Gruppen die folgenden Aspekte. Die Zusammenarbeit mit Ärzten führe zu einem Informationsgewinn für die Gruppe (55,7%) durch ärztliche Information, Aufklärung und Beratung über vielfältige Themen wie Krankheitsbild, Therapien, Medikamente, Rehabilitation, Nachsorge, Patientenschulung, Versorgungseinrichtungen, Kostenübernahme usw., führe zu einem Informationsgewinn für Arzt und Gruppe durch gemeinsamen Wissens- und Erfahrungsaustausch (11,4%), z. B. über das Krankheitsbild und über Therapien, fördere bzw. verstärke den Zugang von Patienten zur Gruppe durch ärztliche Information und Beratung; damit ergebe sich auch ein Zugewinn neuer Mitglieder für die Gruppe (11,4%), trage durch den gemeinsamen Informations- und Erfahrungsaustausch zu einer verbesserten Versorgungsqualität tendenziell für alle Betroffenen bei (10,8%), z. B. durch gezieltere ärztliche Diagnostik, frühzeitigere Krankheitserkennung und ggf. Krankenhauseinweisung sowie durch verstärkte ärztliche Zuwendung zum Patienten, eröffne die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die sonst (wegen des empfundenen Zeitdrucks in der Sprechstunde oder aus Ängstlichkeit und Unsicherheit des Patienten) nicht gestellt werden. Darüber entwickle sich auch eine größere Selbstsicherheit im Kontakt mit Ärzten bzw. der Abbau von Kommunikationsangst (6,0%), 127
8 könne das ärztliche Verständnis für die betreffende Krankheit und die Erkrankten erhöhen, aber auch das ärztliche Interesse und die ärztliche Anerkennung für die Gruppe und ihre Arbeit fördern (6,0%), könne zu einem erweiterten Kontaktnetz für die Gruppe führen, etwa zur Gewinnung neuer Referenten (2,0%). Nur 3% der Gruppen sahen für sich keinen Nutzen durch eine Kooperation mit Ärzten. 5. Gewünschte Unterstützung durch Ärzte Die Selbsthilfegruppen benannten ein Bündel von Wünschen und Erwartungen, wie Ärzte ihre Gruppe am besten unterstützen könnten. Aus den vielfältigen Angaben schälen sich vor allem die folgenden gewünschten Verhaltensbereitschaften und Aktivitäten heraus: eine größere Bereitschaft von Ärzten zu konkreten Kooperationen (28,1%) wie: Bereitschaft zu Vorträgen, Info-Veranstaltungen, Extrasprechstunden für Betroffene, Patientenschulung, Auslegen von Informationsmaterial, Beantwortung von Fragen im Internet oder Vereinsjournal, Unterstützung bei Raumwünschen usw.; Aufklärung der Patienten über Selbsthilfegruppen und Motivierung zum Gruppenbesuch (19,2%); Aufklärung und Beratung über neue Behandlungsmethoden, Medikamente, Hilfsmittel, Nachsorge u.a. (19,2%); mehr oder weniger regelmäßige Kontakte zur Gruppe herstellen und halten (16,2%), z. B. durch Zugehen auf die Gruppe, durch regelmäßige oder sporadische Gruppenbesuche; ein verstärktes Interesse von Ärzten am Krankheitsbild der Gruppenmitglieder, gerade auch bei selteneren Erkrankungen (z. B. Borreliose, Sarkoidose, Hepatitis C, Poliospätfolgen, ADHS); entsprechend auch eine verstärkte ärztliche Bereitschaft zur Information und Fortbildung auf diesem Gebiet (6%); die ärztliche Bereitschaft, als Ansprechpartner für Fragen und Anliegen der Gruppe bei Bedarf, nicht unbedingt regelmäßig, zur Verfügung zu stehen (5,4%); eine finanzielle und politische Unterstützung der Gruppe durch die Ärzte (5,4%), z. B. durch Spenden, Hilfestellung bei Behörden und bei der Öffentlichkeitsarbeit; die Bereitschaft, sich bei Entscheidungsgremien und Kostenträgern (z. B. Krankenkassen) für Belange der Gruppe bzw. Betroffenen einzusetzen (»Anwaltsfunktion«). 6. Erschwernisse für eine stärkere Kooperation mit Ärzten Die größten Erschwernisse für eine (stärkere) Zusammenarbeit mit Ärzten sehen die Gruppen fast durchgängig extern, d.h. auf Seiten der Ärzte. Neben Sachzwängen kommen dabei auch kritische Beurteilungen zum Ausdruck. Als Haupthindernisse für eine verstärkte Kooperation nannten Selbsthilfe- 128 n DAG SHG (Hrsg.) selbsthilfegruppenjahrbuch 2005 / S / Gieße
9 gruppen vor allem den ärztlichen Zeitmangel (34,7%), aber teilweise auch ein Desinteresse bzw. eine mangelnde Kooperationsbereitschaft mancher Ärzte (16,8%), z. B. eine fehlende ärztliche Bereitschaft zur Teilnahme an Gruppentreffen. Eine weitere Kooperationsschwelle bildet nach Auffassung mancher Gruppen (10,2%) die mangelnde Anerkennung als gleichberechtigte Partner durch Ärzte, z. B. die geringe Akzeptanz des Erfahrungswissens der Gruppe. Einige Gruppen (6,6%) erachteten eine Kooperation als unergiebig wegen eines unzureichenden fachlichen Wissens von Ärzten über das betreffende Krankheitsbild und über Therapiemöglichkeiten. Auch finanzielle Vergütungswünsche von Ärzten für Vorträge (4,2%) und erhebliche Meinungsdifferenzen über krankheitsbedingte Beschwerden, Therapien, Medikamente zwischen Arzt und Gruppe oder zwischen mehreren Ärzten seien wenig kooperationsförderlich (3,6%). Als erschwerend wurden ferner eigene Ängste in der Gruppe (vor fehlender ärztlicher Akzeptanz), eine fehlende Vertrauensgrundlage, eine krankheitsbedingt eingeschränkte Kommunikationsfähigkeit und Organisationsfähigkeit sowie Schüchternheit von Mitgliedern genannt (6,6%). Keinerlei Kooperationsschwellen für eine (intensivere) Zusammenarbeit mit Ärzten teilten 7,8% der Gruppen mit, und zwar mehrere Gruppen somatisch Kranker und Abhängigkeitskranker. 7. Schlussfolgerungen, Ausblick Blickt man auf die Studien seit den 80er Jahren, vermitteln sie den Eindruck begrenzter, aber teilweise doch erheblicher Kontakte zwischen Selbsthilfegruppen und Ärzten. Dies entspricht auch den Ergebnissen unserer Untersuchung. Die Kontakte erfolgen häufig konkret anlassbezogen, meist bleiben sie diskontinuierlich oder sporadisch, vielfach auch indirekt. Ein Teil der Gruppen scheint an kontinuierlichen Kontakten auch weniger interessiert zu sein, viele Gruppen wünschen aber eine höhere Kontaktdichte oder doch eine stabile ärztliche Ansprechpartnerschaft. Matzat (2002) resümiert die Entwicklung dahingehend, dass inzwischen auf beiden Seiten, bei Betroffenen und den Gesundheitsberufen, eine kooperative Grundhaltung besteht, wobei die praktische Ausgestaltung noch unzureichend sei. Vielfältig sind die Kontaktanlässe und -inhalte im Einzelnen. Neben den in der Literatur oft beschriebenen ärztlichen Empfehlungen zum Gruppenkontakt, dem Zusenden und Auslegen von Informationsmaterial in der Arztpraxis, der ärztlichen Betreuung von Gruppen, der ärztlichen Teilnahme an Gruppenabenden und gemeinsamen Veranstaltungen sowie der Übernahme von Vorträgen fanden sich auch zahlreiche Beispiele für die Mitwirkung von Selbsthilfegruppen(-mitgliedern) an Patientenseminaren, an Krankenhausbesuchsprogrammen, an Kooperationen zur gemeinsamen Verbesserung bzw. dem Ausbau von Versorgungsstrukturen. Dass die Kontaktqualität noch zu steigern ist, legen die Statements eines Teils der befragten Gruppen nahe. 129
10 Abstrakt gesprochen, sind Selbsthilfegruppen als»intermediäre Instanzen«zwischen den von chronischer Erkrankung oder Behinderung betroffenen Menschen und dem professionellen Versorgungs- und Expertensystem zu sehen. Hier findet, wenn auch noch in begrenztem Ausmaß, ein wechselseitiger Fluss von Kommunikationen und Interaktionen in beide Richtungen mit Lerneffekten und praktischen Handlungsanstößen statt. Für das Ziel eines»institutionalisierten Austauschs von Expertenwissen und Betroffenenwissen«(s. Matzat 2002; Stark 2001), für die Einrichtung eines dauerhaften Diskurses, einer institutionalisierten Teilhabe von Betroffenen an Entscheidungsprozessen könnte aber diese Ebene der Einzelgruppen überfordert sein. Hier scheint die Ebene der Selbsthilfeorganisationen und -verbände sowie der bestehenden Institutionen des Gesundheitssystems bessere Möglichkeiten zu eröffnen. Neben schon bestehenden Gremien können auch weitere Foren geschaffen werden. So haben ab 2004 die KV Westfalen-Lippe und Selbsthilfe-Institutionen einen»round Table«eingerichtet (mit zusätzlichen, paritätisch moderierten Arbeitsgruppen) mit dem Ziel, die Sichtweisen der Gruppen und die ärztlichen Sichtweisen zu grundsätzlichen Fragen auszutauschen. Auf das erste Thema (»Arzt-Patienten-Beziehung nach der Gesundheitsreform«) wird als nächstes ein Treffen zum Thema»Neue Versorgungsformen«folgen. Auch das Beispiel der ärztlichen Fortbildung in Qualitätszirkeln in Kooperation mit Selbsthilfegruppen (Bahrs/Nave-Ahmad 1999; Bogenschütz 2004) verweist auf die vielfältigen Möglichkeiten zur Stärkung des Dialogs zwischen Selbsthilfe und dem professionellen medizinischen Versorgungssystem. Anmerkungen 1 Die in diesem Beitrag dargestellten Ergebnisse sind dem Projekt»Zusammenarbeit von Ärzten der ambulanten/stationären Versorgung und Selbsthilfegruppen Ziele, Formen, Erfahrungen. Eine Quer- und Längsschnittstudie«entnommen, das unter finanzieller Förderung und in Kooperation mit dem BKK-Bundesverband durchgeführt wird. Wir danken der Bielefelder und der Gütersloher Kontakt- und Informationsstelle (BIKIS, BIGS), der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe und dem Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland für ihre Unterstützung. Namentlich danken wir besonders Frau C. Steinhoff-Kemper (BIKIS), Frau J. von Borstel (BIGS), Frau Dr. C. Kramer (Leiterin KV-Bezirksstelle Bielefeld), Frau D. Schlömann (KOSA KV-WL) und Frau A. Kresula (BKK-Bundesverband). 2 Es gab graduelle Beteiligungsunterschiede zwischen den Arztgebieten: 43% Beteiligung bei den Allgemein-/Praktischen Ärzten, 37% bei den Internisten und 57% bei den weiteren Gebietsärzten. Nicht-Teilnahme bedeutet keineswegs fehlender Gruppenkontakt. Literaturverzeichnis Bahrs, O., Nave-Ahmad, M (1999): Selbsthilfegruppen im interdisziplinären Qualitätszirkel. In: Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen (Hrsg.): selbsthilfegruppenjahrbuch 1999, Bogenschütz, A. (2004): Ein Frankfurter Kooperationsmodell? Gemeinsame Fortbildungen des Qualitätszirkels Gastroenterologie Rhein-Main mit DCCV-Selbsthilfegruppen. In: Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen (Hrsg.): selbsthilfegruppenjahrbuch 2004, Borgetto, B. (2002): Gesundheitsbezogene Selbsthilfe in Deutschland. Baden-Baden: Nomos-Verlagsgesellschaft Borgetto, B. (2003): Selbsthilfe und Gesundheit. Bern, Verlag H. Huber Findeiß, P., Schachl, T., Stark, W. (2001): Projekt C2 «Modelle der Einbindung von Selbsthilfe-Initi- 130 n DAG SHG (Hrsg.) selbsthilfegruppenjahrbuch 2005 / S / Gieße
11 ativen in das gesundheitliche Versorgungssystem. Abschlußbericht. Bayerischer Forschungsverbund Public Health - Öffentliche Gesundheit. München Fischer, J.; Litschel, A.; Meye, M.; Schlömann, D.; Theiß, S.; Ueffing, G. (2004): Kooperationshandbuch ein Leitfaden für Ärzte, Psychotherapeuten und Selbsthilfe. Köln: Deutscher Ärzte-Verlag von Kardorff, E., Leisenheimer, C. (1999): Selbsthilfe im System der Gesundheitsversorgung Bestehende Formen der Kooperation und ihre Weiterentwicklung. In: Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen (Hrsg.): selbsthilfegruppenjahrbuch Gießen: Focus Verlag, Litschel, A. (2004): Nutzen der Selbsthilfe für den niedergelassenen Vertragsarzt am Beispiel der Rheumatologen. Aachen: Shaker Verlag Matzat, J. (2002): Die Selbsthilfe-Bewegung in Deutschland Eine real exisitierende Form der Beteiligung im Medizin- und Gesundheitssystem. In: Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen (Hrsg.): selbsthilfegruppenjahrbuch 2002, Meye, M., Slesina, W. (1990): Zusammenarbeit von Ärzten und Selbsthilfegruppen. Erprobung von Kooperationsformen im Bereich der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe. Köln: Deutscher Ärzte-Verlag Rau, R., Theiß, S., Meye, M. (2003): Befragung niedergelassener Ärzte/innen und Psychotherapeuten/innen zur Kooperation mit Selbsthilfegruppen im Bereich der KV Nordrhein, Kreis Wesel. Düsseldorf, unveröffentlichte Studie Röhrig, P. (1989): Kooperation von Ärzten mit Selbsthilfegruppen. Zwischenergebnisse eines Forschungsprojektes zur Effektivitätsverbesserung der ambulanten Versorgung. Köln: Brendan- Schmittmann-Stiftung des NAV Slesina, W., Kretzschmar, C. (2004): Formen und Häufigkeit der Zusammenarbeit von niedergelassenen Ärzten und Selbsthilfegruppen Ergebnisse einer Ärztebefragung und Längsschnittbetrachtung. In: Borgetto, B. (Hrsg.): Gesundheitswissenschaften und Gesundheitsselbsthilfe. Freiburg: druckwerkstatt im grün, Stark, W. (2001): Selbsthilfe und PatientInnenorientierung im Gesundheitswesen Abschied von der Spaltung zwischen Professionellen und Selbsthilfe? In: Borgetto, B.; v. Troschke, J. (Hrsg.): Entwicklungsperspektiven der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe im deutschen Gesundheitswesen. Freiburg: druckwerkstatt im grün, Stötzner, K. (1999): Anforderungen an die Kooperation zwischen dem System professioneller Gesundheitsversorgung und der Selbsthilfe. Forschungsbericht. Berlin: SEKIS Trojan, A. (Hrsg.) (1986): Wissen ist Macht. Eigenständig durch Selbsthilfe in Gruppen. Frankfurt/M.: Fischer-alternativ Claudia Kretzschmar arbeitet als Diplom-Soziologin an der Sektion Medizinische Soziologie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, deren Leiter Prof. Wolfgang Slesina ist. Dort wird das in den Anmerkungen erwähnte Projekt über die Zusammmenarbeit von Ärzten und Selbsthilfegruppen durchgeführt. 131
Keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit - 10 Folien zum 10. Geburtstag am
 Keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit - 10 Folien zum 10. Geburtstag am 10.10. Dr. Thomas Götz Landesbeauftragter für Psychiatrie Q: Eames Office Keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit aber
Keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit - 10 Folien zum 10. Geburtstag am 10.10. Dr. Thomas Götz Landesbeauftragter für Psychiatrie Q: Eames Office Keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit aber
Unterstützung der Selbsthilfe bei psychischen Erkrankungen Kirstin Fuß-Wölbert
 37. Jahrestagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.v. vom 1. bis 3. Juni 2015 in Berlin Aus dem Gleichgewicht Noch gesund oder schon krank? Workshop 1 am 2.6.2015 Unterstützung der
37. Jahrestagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.v. vom 1. bis 3. Juni 2015 in Berlin Aus dem Gleichgewicht Noch gesund oder schon krank? Workshop 1 am 2.6.2015 Unterstützung der
Die Inanspruchnahme ambulanter ärztlicher Leistungen durch ältere Menschen
 Die Inanspruchnahme ambulanter ärztlicher Leistungen durch ältere Menschen Mit der demographischen Alterung ist es absehbar, dass der Bedarf an medizinischen Leistungen weiter anwachsen wird. Eine wesentliche
Die Inanspruchnahme ambulanter ärztlicher Leistungen durch ältere Menschen Mit der demographischen Alterung ist es absehbar, dass der Bedarf an medizinischen Leistungen weiter anwachsen wird. Eine wesentliche
Empfehlung. der. Landeskommission AIDS. zur Verbesserung. der ambulanten ärztlichen Versorgung. von Menschen mit HIV und AIDS in. Nordrhein-Westfalen
 Empfehlung der Landeskommission AIDS zur Verbesserung der ambulanten ärztlichen Versorgung von Menschen mit HIV und AIDS in Nordrhein-Westfalen - verabschiedet 1999 - 2 I. Situationsanalyse/Stand der ambulanten
Empfehlung der Landeskommission AIDS zur Verbesserung der ambulanten ärztlichen Versorgung von Menschen mit HIV und AIDS in Nordrhein-Westfalen - verabschiedet 1999 - 2 I. Situationsanalyse/Stand der ambulanten
Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit
 Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit Grußwort von Frau Ministerialrätin Dr. Monika Kratzer bei der Fachveranstaltung zum Thema Patientenorientierung - Selbsthilfeorganisationen und Ärzte
Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit Grußwort von Frau Ministerialrätin Dr. Monika Kratzer bei der Fachveranstaltung zum Thema Patientenorientierung - Selbsthilfeorganisationen und Ärzte
Einleitung. Lebensqualität. Psychosomatik. Lebensqualität bei Contergangeschädigten Kruse et al. Abschlussbericht Bundesstudie 2012
 Psychosomatik Lebensqualität und psychische Begleiterkrankungen Prof. Dr. med. Christian Albus Einleitung Niethard, Marquardt und Eltze, 1994; Edworthy et al. 1999; Nippert et al., 2002; Kennelly et al.,
Psychosomatik Lebensqualität und psychische Begleiterkrankungen Prof. Dr. med. Christian Albus Einleitung Niethard, Marquardt und Eltze, 1994; Edworthy et al. 1999; Nippert et al., 2002; Kennelly et al.,
Kommentierung zur Statistik 2009
 Kommentierung zur Statistik 2009 Netzwerk Selbsthilfe und Ehrenamt Kreis Steinfurt Träger: Paritätischer Wohlfahrtsverband Kreisgruppe Steinfurt Die Arbeit des Netzwerks im Bereich Selbsthilfe Das Netzwerk
Kommentierung zur Statistik 2009 Netzwerk Selbsthilfe und Ehrenamt Kreis Steinfurt Träger: Paritätischer Wohlfahrtsverband Kreisgruppe Steinfurt Die Arbeit des Netzwerks im Bereich Selbsthilfe Das Netzwerk
Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen
 Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen Grußwort von Staatsministerin Christine Haderthauer 7. Bayerischer Selbsthilfekongress München, den 23.10.2009 Es gilt das
Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen Grußwort von Staatsministerin Christine Haderthauer 7. Bayerischer Selbsthilfekongress München, den 23.10.2009 Es gilt das
Empowerment durch Organisation Patientenverbände in Deutschland
 Empowerment durch Organisation Patientenverbände in Deutschland Alf Trojan, Christopher Kofahl, Susanne Kohler Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf Institut für Medizin-Soziologie, Sozialmedizin und
Empowerment durch Organisation Patientenverbände in Deutschland Alf Trojan, Christopher Kofahl, Susanne Kohler Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf Institut für Medizin-Soziologie, Sozialmedizin und
Volkskrankheit Depression
 Natalia Schütz Volkskrankheit Depression Selbsthilfegruppen als Unterstützung in der Krankheitsbewältigung Diplomica Verlag Natalia Schütz Volkskrankheit Depression: Selbsthilfegruppen als Unterstützung
Natalia Schütz Volkskrankheit Depression Selbsthilfegruppen als Unterstützung in der Krankheitsbewältigung Diplomica Verlag Natalia Schütz Volkskrankheit Depression: Selbsthilfegruppen als Unterstützung
Die Würde des Menschen ist unantastbar Eine Herausforderung moderner Palliativmedizin
 1 Die Würde des Menschen ist unantastbar Eine Herausforderung moderner Palliativmedizin Rede zur Eröffnung der Palliativstation am St.-Josef-Hospital in Bochum am 10.02.2016 Sehr geehrter Herr Dr. Hanefeld
1 Die Würde des Menschen ist unantastbar Eine Herausforderung moderner Palliativmedizin Rede zur Eröffnung der Palliativstation am St.-Josef-Hospital in Bochum am 10.02.2016 Sehr geehrter Herr Dr. Hanefeld
Untersuchungssteckbrief
 Untersuchungssteckbrief 3 4 Positive Einschätzung der Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems Basis: Bundesrepublik Deutschland, Bevölkerung ab 16 Jahre Quelle: MLP Gesundheitsreport 2009, IfD-Umfragen
Untersuchungssteckbrief 3 4 Positive Einschätzung der Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems Basis: Bundesrepublik Deutschland, Bevölkerung ab 16 Jahre Quelle: MLP Gesundheitsreport 2009, IfD-Umfragen
Leitfaden Experteninterview Selbsthilfekontaktstellen
 Leitfaden Experteninterview Selbsthilfekontaktstellen Fragen zur beruflichen Situation Wie lange sind Sie schon in Ihrer SKS tätig? Sind Sie ein/e hauptamtliche Mitarbeiter/in? Arbeiten Sie ehrenamtlich?
Leitfaden Experteninterview Selbsthilfekontaktstellen Fragen zur beruflichen Situation Wie lange sind Sie schon in Ihrer SKS tätig? Sind Sie ein/e hauptamtliche Mitarbeiter/in? Arbeiten Sie ehrenamtlich?
Unterversorgung psychisch kranker Kinder und Jugendlicher. Bestandsaufnahme/Handlungsbedarf
 Unterversorgung psychisch kranker Kinder und Jugendlicher Bestandsaufnahme/Handlungsbedarf Psychische Krankheiten bei Kindern und Jugendlichen Etwa jedes/r zwanzigste Kind und Jugendlicher in Deutschland
Unterversorgung psychisch kranker Kinder und Jugendlicher Bestandsaufnahme/Handlungsbedarf Psychische Krankheiten bei Kindern und Jugendlichen Etwa jedes/r zwanzigste Kind und Jugendlicher in Deutschland
Modellprojekt: Netzwerk Psychische Gesundheit. Gemeinsames Projekt der Selbsthilfekontaktstellen im Ennepe-Ruhr-Kreis
 Gemeinsames Projekt der Selbsthilfekontaktstellen im Ennepe-Ruhr-Kreis Selbsthilfekontaktstellen im Ennepe-Ruhr-Kreis KISS EN-Süd KISS Hattingen Sprockhövel Selbsthilfe-Kontaktstelle Witten, Wetter, Herdecke
Gemeinsames Projekt der Selbsthilfekontaktstellen im Ennepe-Ruhr-Kreis Selbsthilfekontaktstellen im Ennepe-Ruhr-Kreis KISS EN-Süd KISS Hattingen Sprockhövel Selbsthilfe-Kontaktstelle Witten, Wetter, Herdecke
Der potenzielle Beitrag der Selbsthilfegruppen im Gesundheits- und Sozialwesen der Länder
 Der potenzielle Beitrag der Selbsthilfegruppen im Gesundheits- und Sozialwesen der Länder Peter Nowak 3. Wiener Selbsthilfe Konferenz, 16.6.2014, Wien Überblick» Die Rolle der Bevölkerung und der Selbsthilfe
Der potenzielle Beitrag der Selbsthilfegruppen im Gesundheits- und Sozialwesen der Länder Peter Nowak 3. Wiener Selbsthilfe Konferenz, 16.6.2014, Wien Überblick» Die Rolle der Bevölkerung und der Selbsthilfe
Belastung in der Pflege Selbsthilfe entlastet
 Belastung in der Pflege Selbsthilfe entlastet Selbsthilfegruppen und Selbsthilfekontaktstellen in Bremen und Bremerhaven Bei aller Liebe... Belastung und Überlastung in der Pflege von Angehörigen - Und
Belastung in der Pflege Selbsthilfe entlastet Selbsthilfegruppen und Selbsthilfekontaktstellen in Bremen und Bremerhaven Bei aller Liebe... Belastung und Überlastung in der Pflege von Angehörigen - Und
Selbsthilfefreundliche Praxis NRW Projektbericht zum Dortmunder Pilot
 Selbsthilfefreundliche Praxis NRW Projektbericht zum Dortmunder Pilot Agentur Selbsthilfefreundlichkeit NRW Bielefeld, August 2011 Agentur Selbsthilfefreundlichkeit Nordrhein-Westfalen Christa Steinhoff-Kemper
Selbsthilfefreundliche Praxis NRW Projektbericht zum Dortmunder Pilot Agentur Selbsthilfefreundlichkeit NRW Bielefeld, August 2011 Agentur Selbsthilfefreundlichkeit Nordrhein-Westfalen Christa Steinhoff-Kemper
Grußwort Marion Reinhardt Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen Rheinland-Pfalz; Referatsleitung Pflege
 Grußwort Marion Reinhardt Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen Rheinland-Pfalz; Referatsleitung Pflege anlässlich der Veranstaltung Abschlussveranstaltung des Caritasprojektes
Grußwort Marion Reinhardt Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen Rheinland-Pfalz; Referatsleitung Pflege anlässlich der Veranstaltung Abschlussveranstaltung des Caritasprojektes
Trialogische Arbeit in einer ländlichen Region Entwicklung der Psychiatrischen Vernetzungsarbeit in Eichstätt
 8. Internationale Psychiatrietagung Südtirol Tirol Oberbayern 16.-17. Oktober 2015, Lichtenburg Nals 1 Trialogische Arbeit in einer ländlichen Region Entwicklung der Psychiatrischen Vernetzungsarbeit in
8. Internationale Psychiatrietagung Südtirol Tirol Oberbayern 16.-17. Oktober 2015, Lichtenburg Nals 1 Trialogische Arbeit in einer ländlichen Region Entwicklung der Psychiatrischen Vernetzungsarbeit in
Gesundheit von Menschen mit Behinderung Die Menschenrechtsperspektive. Vergessene Patienten, Düsseldorf, 17. April 2013 Susanne Schwalen 1
 Vergessene Patienten, Düsseldorf, 17. April 2013 Susanne Schwalen 1 Vergessene Patienten, Düsseldorf, 17. April 2013 Susanne Schwalen 2 Prof. Dr. med. Susanne Schwalen Geschäftsführende Ärztin der Ärztekammer
Vergessene Patienten, Düsseldorf, 17. April 2013 Susanne Schwalen 1 Vergessene Patienten, Düsseldorf, 17. April 2013 Susanne Schwalen 2 Prof. Dr. med. Susanne Schwalen Geschäftsführende Ärztin der Ärztekammer
Soziale Arbeit im Gesundheitswesen
 Qualifizierungsbereich im Gesundheitswesen Intention der ist es, (1) die Potentiale der Sozialen Arbeit wie auch das damit verbundene soziale Mandat für das Gesundheitssystem nutzbar zu machen; (2) für
Qualifizierungsbereich im Gesundheitswesen Intention der ist es, (1) die Potentiale der Sozialen Arbeit wie auch das damit verbundene soziale Mandat für das Gesundheitssystem nutzbar zu machen; (2) für
62. Gütersloher Fortbildungstage. Depression erkennen behandeln vorbeugen
 62. Gütersloher Fortbildungstage Depression erkennen behandeln vorbeugen Martin Henke, wertkreis Gütersloh ggmbh, 21.09.2011 Fakten über Depression 1. Depression ist eine Volkskrankheit. 5% der Bevölkerung
62. Gütersloher Fortbildungstage Depression erkennen behandeln vorbeugen Martin Henke, wertkreis Gütersloh ggmbh, 21.09.2011 Fakten über Depression 1. Depression ist eine Volkskrankheit. 5% der Bevölkerung
zu verbessern. Im Mittelpunkt steht dabei immer der betroffene Mensch.
 Pressemitteilung 10.10.2016 Beitritt der Stadt Mainz zur Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland anlässlich des Welthospiztages am 8. Oktober 2016 Oberbürgermeister
Pressemitteilung 10.10.2016 Beitritt der Stadt Mainz zur Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland anlässlich des Welthospiztages am 8. Oktober 2016 Oberbürgermeister
auch aus Sicht der Krankenkassen ist dies hier heute eine erfreuliche Veranstaltung.
 Es gilt das gesprochene Wort. Es gilt das gesprochene Wort. Es gilt das gesprochene Wort. Sehr geehrte Frau Ministerin, meine Damen und Herren, auch aus Sicht der Krankenkassen ist dies hier heute eine
Es gilt das gesprochene Wort. Es gilt das gesprochene Wort. Es gilt das gesprochene Wort. Sehr geehrte Frau Ministerin, meine Damen und Herren, auch aus Sicht der Krankenkassen ist dies hier heute eine
Versorgungssysteme für psychisch kranke Menschen
 Versorgungssysteme für psychisch kranke Menschen Das psychiatrische Hilfesystem stellt sich vielfach als Dschungel dar. Die Versorgungslandschaft ist sehr differenziert, weshalb wir Ihnen eine grobe Richtlinie
Versorgungssysteme für psychisch kranke Menschen Das psychiatrische Hilfesystem stellt sich vielfach als Dschungel dar. Die Versorgungslandschaft ist sehr differenziert, weshalb wir Ihnen eine grobe Richtlinie
NRW-Forum Rehabilitation sensomotorischer Störungen. Bedeutung der Rehabilitation für Parkinson-Patienten
 NRW-Forum Rehabilitation sensomotorischer Störungen Bedeutung der Rehabilitation für Parkinson-Patienten Die Krankheit Parkinson ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, die progredient verläuft
NRW-Forum Rehabilitation sensomotorischer Störungen Bedeutung der Rehabilitation für Parkinson-Patienten Die Krankheit Parkinson ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, die progredient verläuft
Patientenberatung für mehr Entscheidungsteilhabe und Gesundheit. Prof. Dr. Marie-Luise Dierks
 Patientenberatung für mehr Entscheidungsteilhabe und Gesundheit Prof. Dr. Marie-Luise Dierks Die neue Rolle der Nutzer Die Nutzer als Gegengewicht zur Dominanz der Anbieterinteressen auf der Mikro-, Mesound
Patientenberatung für mehr Entscheidungsteilhabe und Gesundheit Prof. Dr. Marie-Luise Dierks Die neue Rolle der Nutzer Die Nutzer als Gegengewicht zur Dominanz der Anbieterinteressen auf der Mikro-, Mesound
Sozialpsychiatrischer Dienst Aufgaben und Struktur Vorstellung im Pflegenetz Dresden
 Aufgaben und Struktur 16.10.2013 Vorstellung im Pflegenetz Dresden Landeshauptstadt Dresden Klientel Volljährige, von psych. Erkrankung bedrohte und betroffene Menschen Störungen aus dem schizophrenen
Aufgaben und Struktur 16.10.2013 Vorstellung im Pflegenetz Dresden Landeshauptstadt Dresden Klientel Volljährige, von psych. Erkrankung bedrohte und betroffene Menschen Störungen aus dem schizophrenen
OSTEOPOROSE SELBSTHILFE bei Osteoporose.
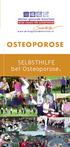 OSTEOPOROSE SELBSTHILFE bei Osteoporose. 9 SÄULEN DER OSTEOPOROSETHERAPIE EIGENVERANT WORTUNG Osteoporose ist kein altersbedingtes Schicksal, das man ohne Gegenmaßnahmen erdulden muss. Durch eine optimale
OSTEOPOROSE SELBSTHILFE bei Osteoporose. 9 SÄULEN DER OSTEOPOROSETHERAPIE EIGENVERANT WORTUNG Osteoporose ist kein altersbedingtes Schicksal, das man ohne Gegenmaßnahmen erdulden muss. Durch eine optimale
Förderung der Umsetzung demenzsensibler Versorgungskonzepte
 Informationsveranstaltung am 09.07.2013 Förderung der Umsetzung demenzsensibler Versorgungskonzepte Jochen Brink, Präsident der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e. V. KGNW 2013 Agenda I. Aktivitäten
Informationsveranstaltung am 09.07.2013 Förderung der Umsetzung demenzsensibler Versorgungskonzepte Jochen Brink, Präsident der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e. V. KGNW 2013 Agenda I. Aktivitäten
!" # $$ ) * #+, -,. & /
 !" # $$ %& '(& ) * #+, -,. & / 2 Die Bundesregierung hat Eckpunkte für eine große Gesundheitsreform vorgelegt. Aber können diese zur Lösung der bestehenden Probleme beitragen? ver.di will eine Gesundheitsreform,
!" # $$ %& '(& ) * #+, -,. & / 2 Die Bundesregierung hat Eckpunkte für eine große Gesundheitsreform vorgelegt. Aber können diese zur Lösung der bestehenden Probleme beitragen? ver.di will eine Gesundheitsreform,
Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier. Hallo, Ihr Team der Selbsthilfeunterstützung im Ennepe-Ruhr-Kreis
 Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier. Borderline Selbsthilfegruppe Gevelsberg freut sich über weitere Interessierte! Parkinsonerkrankung - Gründung einer Selbsthilfegruppe
Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier. Borderline Selbsthilfegruppe Gevelsberg freut sich über weitere Interessierte! Parkinsonerkrankung - Gründung einer Selbsthilfegruppe
Regionale Gesundheitskonferenzen und Gesundheitsregionen plus. Ministerialdirigentin Gabriele Hörl 2. KVB-Versorgungskonferenz München,
 Regionale Gesundheitskonferenzen und Gesundheitsregionen plus Ministerialdirigentin Gabriele Hörl 2. KVB-Versorgungskonferenz München, 10.03.2015 Agenda I. Notwendigkeit regionaler Ansätze II. Bisherige
Regionale Gesundheitskonferenzen und Gesundheitsregionen plus Ministerialdirigentin Gabriele Hörl 2. KVB-Versorgungskonferenz München, 10.03.2015 Agenda I. Notwendigkeit regionaler Ansätze II. Bisherige
Schicksal Demenz Was brauchen die Betroffenen und ihre Angehörigen
 Schicksal Demenz Was brauchen die Betroffenen und ihre Angehörigen Sabine Jansen Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.v. Selbsthilfe Demenz Kooperationstagung Demenz Gemeinsam für eine bessere Versorgung
Schicksal Demenz Was brauchen die Betroffenen und ihre Angehörigen Sabine Jansen Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.v. Selbsthilfe Demenz Kooperationstagung Demenz Gemeinsam für eine bessere Versorgung
Tourette-Gesellschaft Deutschland (TGD) e.v.
 Tourette-Gesellschaft Deutschland (TGD) e.v. Infoveranstaltung zum Tourette-Syndrom Vivantes Klinikum Berlin-Friedrichshain 24.09.2015 Realisierbar durch Projektförderung der Tourette-Gesellschaft Deutschland
Tourette-Gesellschaft Deutschland (TGD) e.v. Infoveranstaltung zum Tourette-Syndrom Vivantes Klinikum Berlin-Friedrichshain 24.09.2015 Realisierbar durch Projektförderung der Tourette-Gesellschaft Deutschland
Susanne Bäcker. Das Team. Das Team. Landesinitiative Demenz-Service NRW. Landesinitiative Demenz-Service NRW. Krankenschwester. 28 Jahre Neurologie
 Demenz-Servicezentrum für die Region Bergisches Land In Trägerschaft der Evangelischen Stiftung Tannenhof Landesinitiative Demenz-Service NRW Landesinitiative Demenz-Service NRW o Landesinitiative Demenz-Service
Demenz-Servicezentrum für die Region Bergisches Land In Trägerschaft der Evangelischen Stiftung Tannenhof Landesinitiative Demenz-Service NRW Landesinitiative Demenz-Service NRW o Landesinitiative Demenz-Service
Holger Adolph (DVSG)
 Holger Adolph (DVSG) SOZIALE ARBEIT: BERATUNGSSPEKTRUM, RESSOURCEN UND BELASTUNGEN IM VERGLEICH VON AKUT-UND REHABILITATIONSKLINIKEN Soziale Aspekte in der Gesundheitsversorgung 2. Dezember 2016 in Münster
Holger Adolph (DVSG) SOZIALE ARBEIT: BERATUNGSSPEKTRUM, RESSOURCEN UND BELASTUNGEN IM VERGLEICH VON AKUT-UND REHABILITATIONSKLINIKEN Soziale Aspekte in der Gesundheitsversorgung 2. Dezember 2016 in Münster
Ergebnisse eines umfassenden Dialogs zwischen Pflegenden, Zupflegenden und deren Angehörigen
 Ergebnisse eines umfassenden Dialogs zwischen Pflegenden, Zupflegenden und deren Angehörigen zur Qualität in der stationären und ambulanten Pflege in 1 Umfang der Beteiligung Es nahmen insgesamt teil:
Ergebnisse eines umfassenden Dialogs zwischen Pflegenden, Zupflegenden und deren Angehörigen zur Qualität in der stationären und ambulanten Pflege in 1 Umfang der Beteiligung Es nahmen insgesamt teil:
Der Besucherdienst der Deutschen ILCO
 Der Besucherdienst der Deutschen ILCO Das wichtigste Unterstützungsangebot der Deutschen ILCO für Mitbetroffene sind Gespräche mit gleich betroffenen ILCO-Mitarbeitern. Diese können am eigenen Beispiel
Der Besucherdienst der Deutschen ILCO Das wichtigste Unterstützungsangebot der Deutschen ILCO für Mitbetroffene sind Gespräche mit gleich betroffenen ILCO-Mitarbeitern. Diese können am eigenen Beispiel
Harl.e.kin-Frühchen-Nachsorge
 Harl.e.kin-Frühchen-Nachsorge Ein Versuch, Defizite des Gesundheitssystems zu heilen Hier: Frühgeborene, Risikoneugeborene R.Roos, A.Gehrmann, E.Hesse Prognose Spätmorbidität bei überlebenden Kindern:
Harl.e.kin-Frühchen-Nachsorge Ein Versuch, Defizite des Gesundheitssystems zu heilen Hier: Frühgeborene, Risikoneugeborene R.Roos, A.Gehrmann, E.Hesse Prognose Spätmorbidität bei überlebenden Kindern:
Kooperationsgemeinschaft Fakultät für Gesundheitswissenschaften, Universität Bielefeld Frauen helfen Frauen EN e.v.
 Kooperationsgemeinschaft Fakultät für Gesundheitswissenschaften, Universität Bielefeld Frauen helfen Frauen EN e.v., GESINE-Netzwerk Leitung: Prof. Dr. Claudia Hornberg Marion Steffens ZIELE Wissenschaftliche
Kooperationsgemeinschaft Fakultät für Gesundheitswissenschaften, Universität Bielefeld Frauen helfen Frauen EN e.v., GESINE-Netzwerk Leitung: Prof. Dr. Claudia Hornberg Marion Steffens ZIELE Wissenschaftliche
MedMobil Projekt MedMobil
 Projekt Ein Projekt der Stadt Stuttgart in Zusammenarbeit mit Ambulante Hilfe e.v. Ärzte der Welt e.v. Caritasverband Stuttgart e.v. Evangelische Gesellschaft e.v. Sozialberatung Stuttgart e.v. Sozialdienst
Projekt Ein Projekt der Stadt Stuttgart in Zusammenarbeit mit Ambulante Hilfe e.v. Ärzte der Welt e.v. Caritasverband Stuttgart e.v. Evangelische Gesellschaft e.v. Sozialberatung Stuttgart e.v. Sozialdienst
Psychosoziale Beratung im Kontext von pränataler Diagnostik
 Geisteswissenschaft Sandra Mette Psychosoziale Beratung im Kontext von pränataler Diagnostik Rolle und Aufgabe der Sozialen Arbeit Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Geisteswissenschaft Sandra Mette Psychosoziale Beratung im Kontext von pränataler Diagnostik Rolle und Aufgabe der Sozialen Arbeit Bachelorarbeit Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Projekt Zuhause im Quartier. Das Projekt wird unterstützt aus Mitteln:
 Projekt Zuhause im Quartier Das Projekt wird unterstützt aus Mitteln: 1 Verbundprojekt der Firmen vacances Mobiler Sozial- und Pflegedienst GmbH (Projektmanagement) Bremer Pflegedienst GmbH IPP Bremen,
Projekt Zuhause im Quartier Das Projekt wird unterstützt aus Mitteln: 1 Verbundprojekt der Firmen vacances Mobiler Sozial- und Pflegedienst GmbH (Projektmanagement) Bremer Pflegedienst GmbH IPP Bremen,
Ergebnisse früherer Studien
 Psychosoziale Belastungen und Gesundheitsstörungen Christian Albus, Alexander Niecke, Kristin Forster, Christina Samel Tagung des Interessenverbandes Contergangeschädigter NRW e.v. Köln, 09. April 2016
Psychosoziale Belastungen und Gesundheitsstörungen Christian Albus, Alexander Niecke, Kristin Forster, Christina Samel Tagung des Interessenverbandes Contergangeschädigter NRW e.v. Köln, 09. April 2016
Sicherstellung der wohnortnahen Gesundheitsversorgung
 Sicherstellung der wohnortnahen Gesundheitsversorgung Kooperation von HLT und KV Hessen / Mitgestaltungsmöglichkeiten der niedergelassenen Ärzte Geschäftsführender Direktor Dr. Jan Hilligardt Hessischer
Sicherstellung der wohnortnahen Gesundheitsversorgung Kooperation von HLT und KV Hessen / Mitgestaltungsmöglichkeiten der niedergelassenen Ärzte Geschäftsführender Direktor Dr. Jan Hilligardt Hessischer
AOK-Curaplan. Intensivbetreuung für chronisch Kranke. AOK Mecklenburg-Vorpommern UNI - Greifswald,
 AOK-Curaplan Intensivbetreuung für chronisch Kranke UNI - Greifswald, 03.12.2009 AOK-Curaplan Disease-Management-Programme bieten den Krankenkassen erstmals die Chance, Versicherte mit bestimmten Erkrankungen
AOK-Curaplan Intensivbetreuung für chronisch Kranke UNI - Greifswald, 03.12.2009 AOK-Curaplan Disease-Management-Programme bieten den Krankenkassen erstmals die Chance, Versicherte mit bestimmten Erkrankungen
Wie stellen sich die onkologischen Schwerpunktpraxen auf?
 Ressourcen - Strukturen - Konzepte Wie stellen sich die onkologischen Schwerpunktpraxen auf? Wissenschaftliches Institut der Niedergelassenen Hämatologen und Onkologen GmbH - WINHO Vor den Siebenburgen
Ressourcen - Strukturen - Konzepte Wie stellen sich die onkologischen Schwerpunktpraxen auf? Wissenschaftliches Institut der Niedergelassenen Hämatologen und Onkologen GmbH - WINHO Vor den Siebenburgen
BUCH ADHS THERAPIE GEMEINSAM BEGEGNEN MEDICE DIE ERSTE WAHL. Mein persönliches
 Autorin: Dr med Eveline Reich-Schulze leitet den Bereich Medizin am Berufsförderungswerk Hamburg, einer der größten Einrichtungen für berufliche Rehabilitation und Integration im norddeutschen Raum entwickelte
Autorin: Dr med Eveline Reich-Schulze leitet den Bereich Medizin am Berufsförderungswerk Hamburg, einer der größten Einrichtungen für berufliche Rehabilitation und Integration im norddeutschen Raum entwickelte
Gesund älter werden in Deutschland
 Gesund älter werden in Deutschland - Handlungsfelder und Herausforderungen - Dr. Rainer Hess Vorsitzender des Ausschusses von gesundheitsziele.de Gemeinsame Ziele für mehr Gesundheit Was ist gesundheitsziele.de?
Gesund älter werden in Deutschland - Handlungsfelder und Herausforderungen - Dr. Rainer Hess Vorsitzender des Ausschusses von gesundheitsziele.de Gemeinsame Ziele für mehr Gesundheit Was ist gesundheitsziele.de?
Patientenfragebogen zur Bedeutung der Betreuung durch den Hausarzt
 Patientenfragebogen zur Bedeutung der Betreuung durch den Hausarzt Sehr geehrter Patient, sehr geehrte Patientin, im Rahmen einer Doktorarbeit im Fach Medizin möchten wir Informationen zur hausärztlichen
Patientenfragebogen zur Bedeutung der Betreuung durch den Hausarzt Sehr geehrter Patient, sehr geehrte Patientin, im Rahmen einer Doktorarbeit im Fach Medizin möchten wir Informationen zur hausärztlichen
Fragebogen Zusammenarbeit von Eltern und Lehrer/innen (für Lehrer/innen)
 Fragebogen Zusammenarbeit von Eltern und Lehrer/innen (für Lehrer/innen) Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer! Eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrer/innen ist wichtig für die optimale Förderung
Fragebogen Zusammenarbeit von Eltern und Lehrer/innen (für Lehrer/innen) Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer! Eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrer/innen ist wichtig für die optimale Förderung
Psychische Gesundheit. Claudia Hornberg / Claudia Bürmann
 Psychische Gesundheit Claudia Hornberg / Claudia Bürmann Geschlechterspezifische Aspekte in der Psychischen Versorgung (I) Zunahme der Aufmerksamkeit für geschlechterspezifische Aspekte vielfältige Gründe,
Psychische Gesundheit Claudia Hornberg / Claudia Bürmann Geschlechterspezifische Aspekte in der Psychischen Versorgung (I) Zunahme der Aufmerksamkeit für geschlechterspezifische Aspekte vielfältige Gründe,
Landesverband NRW der Angehörigen psychisch Kranker e.v.
 Der Landesverband Nordrhein-Westfalen der Angehörigen psychisch Kranker e.v. Psychische Krankheiten verändern nicht nur die Lebenssituation der unmittelbar Betroffenen, sondern auch die ihrer Angehörigen
Der Landesverband Nordrhein-Westfalen der Angehörigen psychisch Kranker e.v. Psychische Krankheiten verändern nicht nur die Lebenssituation der unmittelbar Betroffenen, sondern auch die ihrer Angehörigen
Das Präventionsgesetz - Ablauf eines politischen Entscheidungsprozesses in Deutschland
 Medizin Lotte Habermann-Horstmeier Das Präventionsgesetz - Ablauf eines politischen Entscheidungsprozesses in Deutschland Studienarbeit Dr. med. Lotte Habermann- Horstmeier Ablauf des politischen Entscheidungsprozesses
Medizin Lotte Habermann-Horstmeier Das Präventionsgesetz - Ablauf eines politischen Entscheidungsprozesses in Deutschland Studienarbeit Dr. med. Lotte Habermann- Horstmeier Ablauf des politischen Entscheidungsprozesses
Zentrales Informationsportal über seltene Erkrankungen (ZIPSE)
 Zentrales Informationsportal über seltene Erkrankungen (ZIPSE) Ärztliche Informationsbedarfe bei der Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen So selten und doch so zahlreich V. Lührs 1, T. Neugebauer
Zentrales Informationsportal über seltene Erkrankungen (ZIPSE) Ärztliche Informationsbedarfe bei der Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen So selten und doch so zahlreich V. Lührs 1, T. Neugebauer
DMP-Realität nach 10 Jahren
 DMP-Realität nach 10 Jahren Dr. Maximilian Gaßner Präsident des Bundesversicherungsamtes Übersicht 1. Einführung der DMP 2. DMP in der Praxis Kritik und Würdigung 3. Ausblick in die Zukunft von DMP 4.
DMP-Realität nach 10 Jahren Dr. Maximilian Gaßner Präsident des Bundesversicherungsamtes Übersicht 1. Einführung der DMP 2. DMP in der Praxis Kritik und Würdigung 3. Ausblick in die Zukunft von DMP 4.
Unser Pflegeleitbild. Ev. Diakoniewerk Friederikenstift Hannover
 Unser Pflegeleitbild Ev. Diakoniewerk Friederikenstift Hannover Vorwort Wir, die Pflegenden des Ev. Diakoniewerkes Friederikenstift, verstehen uns als Teil einer christlichen Dienstgemeinschaft, die uns
Unser Pflegeleitbild Ev. Diakoniewerk Friederikenstift Hannover Vorwort Wir, die Pflegenden des Ev. Diakoniewerkes Friederikenstift, verstehen uns als Teil einer christlichen Dienstgemeinschaft, die uns
Ambulante Psychiatrische Pflege
 Loewe Stiftung &TAPP Grips Ambulante Psychiatrische Pflege Angebote für Menschen mit psychischer Erkrankung Themen Wer sind wir? Zielsetzung Leistungen Kooperationspartner Eigenanteil Kontaktaufnahme und
Loewe Stiftung &TAPP Grips Ambulante Psychiatrische Pflege Angebote für Menschen mit psychischer Erkrankung Themen Wer sind wir? Zielsetzung Leistungen Kooperationspartner Eigenanteil Kontaktaufnahme und
Akzeptanz- Motivation- Depression Dr Dr. med. Jolanda Schottenfeld-Naor 14. Düsseldorfer Diabetes-Tag 24. September 2016
 Akzeptanz- Motivation- Depression Dr 14. Düsseldorfer Diabetes-Tag 24. September 2016 Fallbeispiel 26-jährige Typ 1- Diabetikerin, berufstätig Diabetes mell. Typ 1 seit 7. Lebensjahr Insulinpumpentherapie
Akzeptanz- Motivation- Depression Dr 14. Düsseldorfer Diabetes-Tag 24. September 2016 Fallbeispiel 26-jährige Typ 1- Diabetikerin, berufstätig Diabetes mell. Typ 1 seit 7. Lebensjahr Insulinpumpentherapie
Palliative Basisversorgung
 Konzept Palliative Basisversorgung Altenpflegeheim St. Franziskus Achern Vernetzte palliative Basisversorgung in den Einrichtungen: Pflegeheim Erlenbad, Sasbach Altenpflegeheim St. Franziskus Sozialstation
Konzept Palliative Basisversorgung Altenpflegeheim St. Franziskus Achern Vernetzte palliative Basisversorgung in den Einrichtungen: Pflegeheim Erlenbad, Sasbach Altenpflegeheim St. Franziskus Sozialstation
Geriatrische Rehabilitation Chance für ein selbstbestimmtes Leben zu Hause oder Aufschieben der stationären Heimaufnahme?
 Geriatrische Rehabilitation Chance für ein selbstbestimmtes Leben zu Hause oder Aufschieben der stationären Heimaufnahme? 1 Übersicht I. Hinführung II. Charakteristika der älteren Generation III. MUG III
Geriatrische Rehabilitation Chance für ein selbstbestimmtes Leben zu Hause oder Aufschieben der stationären Heimaufnahme? 1 Übersicht I. Hinführung II. Charakteristika der älteren Generation III. MUG III
Sterbebegleitung bei Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung. Lazarus Hospiz-Forum 11. Februar 2013 Prof. Dr. Jeanne Nicklas-Faust
 Sterbebegleitung bei Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung Lazarus Hospiz-Forum 11. Februar 2013 Prof. Dr. Jeanne Nicklas-Faust Gliederung - Einführung - Behinderung in unterschiedlichen Ausprägungen
Sterbebegleitung bei Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung Lazarus Hospiz-Forum 11. Februar 2013 Prof. Dr. Jeanne Nicklas-Faust Gliederung - Einführung - Behinderung in unterschiedlichen Ausprägungen
Nutzenstiftende Anwendungen
 Nutzenstiftende Anwendungen Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten mit konkretem, greifbaren Nutzen und überschaubarer Komplexität Digitalisierung der persönlichen Gesundheitsdaten am Beispiel Elektronischer
Nutzenstiftende Anwendungen Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten mit konkretem, greifbaren Nutzen und überschaubarer Komplexität Digitalisierung der persönlichen Gesundheitsdaten am Beispiel Elektronischer
Psychosoziale Belastungen und Unterstützungsbedarf von Krebsbetroffenen
 Psychosoziale Belastungen und von Krebsbetroffenen Projektkoordination Haus der Krebs-Selbsthilfe, Bonn Im Haus der Krebs-Selbsthilfe sitzen folgende Krebs-Selbsthilfeorganisationen : Arbeitskreis der
Psychosoziale Belastungen und von Krebsbetroffenen Projektkoordination Haus der Krebs-Selbsthilfe, Bonn Im Haus der Krebs-Selbsthilfe sitzen folgende Krebs-Selbsthilfeorganisationen : Arbeitskreis der
Medizinische und pflegerische Versorgung im ländlichen Raum Gemeinsam für Lebensqualität. Andreas Böhm
 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie Medizinische und pflegerische Versorgung im ländlichen Raum Gemeinsam für Lebensqualität Andreas Böhm Referat 41: Grundsatzfragen der Gesundheitspolitik,
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie Medizinische und pflegerische Versorgung im ländlichen Raum Gemeinsam für Lebensqualität Andreas Böhm Referat 41: Grundsatzfragen der Gesundheitspolitik,
Aufbau von Seniorenund Generationenhilfen im Rahmen der Seniorenpolitische Initiative Hessen
 Aufbau von Seniorenund Generationenhilfen im Rahmen der Seniorenpolitische Initiative Hessen 1 Demographischer Wandel / Altersstruktur Wachsende Anzahl älterer Menschen Sinkende Anzahl erwerbstätiger Personen
Aufbau von Seniorenund Generationenhilfen im Rahmen der Seniorenpolitische Initiative Hessen 1 Demographischer Wandel / Altersstruktur Wachsende Anzahl älterer Menschen Sinkende Anzahl erwerbstätiger Personen
Entschließung des Bundesrates zur Umsetzung eines Nationalen Diabetesplans
 Bundesrat Drucksache 252/14 (Beschluss) 11.07.14 Beschluss des Bundesrates Entschließung des Bundesrates zur Umsetzung eines Nationalen Diabetesplans Der Bundesrat hat in seiner 924. Sitzung am 11. Juli
Bundesrat Drucksache 252/14 (Beschluss) 11.07.14 Beschluss des Bundesrates Entschließung des Bundesrates zur Umsetzung eines Nationalen Diabetesplans Der Bundesrat hat in seiner 924. Sitzung am 11. Juli
Wie und wo kann ich mich informieren?
 Wie und wo kann ich mich informieren? Selbsthilfegruppe Eierstock- und Gebärmutterkrebs für Frauen mit gynäkologischen Tumoren im Bauchbereich: Bauchfell-, Eierstock-, Eileiter-, Gebärmutter-, Gebärmutterhals-,
Wie und wo kann ich mich informieren? Selbsthilfegruppe Eierstock- und Gebärmutterkrebs für Frauen mit gynäkologischen Tumoren im Bauchbereich: Bauchfell-, Eierstock-, Eileiter-, Gebärmutter-, Gebärmutterhals-,
Nr. 158 Name: Kompetenznetz Parkinson - Benchmarking in der Patienten-Versorgung - Depression bei der Parkinson-Krankheit (KND)
 Quellen Informationsgrundlage für diesen Datensatz Name der Qualitätsinitiative Internetlink der Initiative nur aus Recherche Kompetenznetz Parkinson - Benchmarking in der Patienten-Versorgung - Depression
Quellen Informationsgrundlage für diesen Datensatz Name der Qualitätsinitiative Internetlink der Initiative nur aus Recherche Kompetenznetz Parkinson - Benchmarking in der Patienten-Versorgung - Depression
Gesundheitsbezogene Lebensqualität, körperliche Beschwerden, psychische Komorbidität und Interventionen bei Dyspepsie
 Medizinische Fakultät der Charité - Universitätsmedizin Berlin Campus Benjamin Franklin aus der Abteilung für Allgemeinmedizin mit Allgemeinpraxis Direktor: Prof. Dr. med. P. Mitznegg Gesundheitsbezogene
Medizinische Fakultät der Charité - Universitätsmedizin Berlin Campus Benjamin Franklin aus der Abteilung für Allgemeinmedizin mit Allgemeinpraxis Direktor: Prof. Dr. med. P. Mitznegg Gesundheitsbezogene
Kooperative Psychotherapie Das Herner Modell
 Kooperative Psychotherapie Das Herner Modell Zur erfolgreichen Bewältigung komplexer, diagnostischer und therapeutischen Aufgaben braucht man auch komplexe Lösungen, die nur durch Kooperation möglich werden
Kooperative Psychotherapie Das Herner Modell Zur erfolgreichen Bewältigung komplexer, diagnostischer und therapeutischen Aufgaben braucht man auch komplexe Lösungen, die nur durch Kooperation möglich werden
Fortschreibung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Neuss. Wissenschaftliche Begleitung
 Fortschreibung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Neuss Wissenschaftliche Begleitung 11.06.2015 Prof. Dr. Ulrich Deinet, Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften Bundesweit stellen sich ähnliche
Fortschreibung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Neuss Wissenschaftliche Begleitung 11.06.2015 Prof. Dr. Ulrich Deinet, Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften Bundesweit stellen sich ähnliche
Patientenbefragung zur Zufriedenheit mit der Beratung und Begleitung durch den Sozialdienst. am Universitätsklinikum Münster
 Patientenbefragung zur Zufriedenheit mit der Beratung und Begleitung durch den Sozialdienst am Universitätsklinikum Münster August 2008 Universitätsklinikum Münster Stabsstelle Sozialdienst / Case Management
Patientenbefragung zur Zufriedenheit mit der Beratung und Begleitung durch den Sozialdienst am Universitätsklinikum Münster August 2008 Universitätsklinikum Münster Stabsstelle Sozialdienst / Case Management
Kooperation von Ärzten und Selbsthilfegruppen für alle ein Gewinn
 8. Round Table der KV Nordrhein mit Selbsthilfeorganisationen am 10. Juni 2006 Kooperation von Ärzten und Selbsthilfegruppen für alle ein Gewinn Herausgeber Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein KOSA Tersteegenstr.
8. Round Table der KV Nordrhein mit Selbsthilfeorganisationen am 10. Juni 2006 Kooperation von Ärzten und Selbsthilfegruppen für alle ein Gewinn Herausgeber Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein KOSA Tersteegenstr.
Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin (LVG & AFS) Niedersachsen e. V.
 16.11.2011 Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin (LVG & AFS) Niedersachsen e. V. Projektziele Verbesserung von Qualität und Wirtschaftlichkeit Sicherstellung der medizinischen
16.11.2011 Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin (LVG & AFS) Niedersachsen e. V. Projektziele Verbesserung von Qualität und Wirtschaftlichkeit Sicherstellung der medizinischen
Referat Psychiatrie Pflege in der Ausbildung heute
 Referat Psychiatrie Pflege in der Ausbildung heute 05.11.2014 Ich heisse Sie herzlich willkommen zu meinen Betrachtungen zum Tagungsthema. Sie haben jetzt schon einiges über das Thema: Psychiatrische Situationen
Referat Psychiatrie Pflege in der Ausbildung heute 05.11.2014 Ich heisse Sie herzlich willkommen zu meinen Betrachtungen zum Tagungsthema. Sie haben jetzt schon einiges über das Thema: Psychiatrische Situationen
Entlastung und Orientierung für pflegende Angehörige. Dr. Gertrud Demmler, Berlin
 Entlastung und Orientierung für pflegende Angehörige Dr. Gertrud Demmler, Berlin Pflegende Angehörige im Spannungsfeld Anfang 2011 erstellte die SBK eine Studie aus Versichertendaten : Angehörige Pflegebedürftiger
Entlastung und Orientierung für pflegende Angehörige Dr. Gertrud Demmler, Berlin Pflegende Angehörige im Spannungsfeld Anfang 2011 erstellte die SBK eine Studie aus Versichertendaten : Angehörige Pflegebedürftiger
Potenzial der Geriatrie in Akutkrankenhäusern 109 SGB V im Hinblick auf Teilhabeförderung
 Potenzial der Geriatrie in Akutkrankenhäusern 109 SGB V im Hinblick auf Teilhabeförderung DVfR Tagung - Workshop 2 22.10.2012 Geschäftsführer Bundesverbandes Geriatrie Grundlage Ein grundlegendes Behandlungsziel
Potenzial der Geriatrie in Akutkrankenhäusern 109 SGB V im Hinblick auf Teilhabeförderung DVfR Tagung - Workshop 2 22.10.2012 Geschäftsführer Bundesverbandes Geriatrie Grundlage Ein grundlegendes Behandlungsziel
Antrag auf Ausführung und Abrechnung von Leistungen zur spezialisierten geriatrischen Diagnostik (Geriatrie)
 Antrag auf Ausführung Abrechnung von Kassenärztliche Vereinigung Berlin Abteilung Qualitätssicherung Masurenallee 6A 14057 Berlin Praxisstempel Telefon (030) 31003-242, Fax (030) 31003-305 Antrag auf Ausführung
Antrag auf Ausführung Abrechnung von Kassenärztliche Vereinigung Berlin Abteilung Qualitätssicherung Masurenallee 6A 14057 Berlin Praxisstempel Telefon (030) 31003-242, Fax (030) 31003-305 Antrag auf Ausführung
Altersstruktur- und Arztzahlenwicklung in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung der Rheumatologen Dr. Thomas Kopetsch
 Altersstruktur- und Arztzahlenwicklung in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung der Rheumatologen Dr. Thomas Kopetsch Kassenärztliche Bundesvereinigung Allgemeine Entwicklung in Deutschland Rheumatologen
Altersstruktur- und Arztzahlenwicklung in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung der Rheumatologen Dr. Thomas Kopetsch Kassenärztliche Bundesvereinigung Allgemeine Entwicklung in Deutschland Rheumatologen
Psychische und psychosomatische Erkrankungen von Beschäftigten zur Qualität der Zusammenarbeit an den Schnittstellen der Versorgung
 Psychische und psychosomatische Erkrankungen von Beschäftigten zur Qualität der Zusammenarbeit an den Schnittstellen der Versorgung Martina Michaelis, 2,1 Florian Junne 3 Eva Rothermund 4 Harald Gündel
Psychische und psychosomatische Erkrankungen von Beschäftigten zur Qualität der Zusammenarbeit an den Schnittstellen der Versorgung Martina Michaelis, 2,1 Florian Junne 3 Eva Rothermund 4 Harald Gündel
Interkulturelle Öffnung durch Kooperationen mit Migrantenorganisationen
 Interkulturelle Öffnung durch Kooperationen mit Migrantenorganisationen PD Dr. Uwe Hunger Westfälische Wilhelms-Universität Münster/ Universität Osnabrück Vortrag im Rahmen der Fachtagung Wie die interkulturelle
Interkulturelle Öffnung durch Kooperationen mit Migrantenorganisationen PD Dr. Uwe Hunger Westfälische Wilhelms-Universität Münster/ Universität Osnabrück Vortrag im Rahmen der Fachtagung Wie die interkulturelle
Diagnose Depression effektive Behandlung in der Hausarztpraxis
 Diagnose Depression effektive Behandlung in der Hausarztpraxis Prof. Dr. Göran Hajak Jede vierte Frau und jeder achte Mann erkranken in Deutschland bis zu Ihrem 65. Lebensjahr an einer behandlungsbedürftigen
Diagnose Depression effektive Behandlung in der Hausarztpraxis Prof. Dr. Göran Hajak Jede vierte Frau und jeder achte Mann erkranken in Deutschland bis zu Ihrem 65. Lebensjahr an einer behandlungsbedürftigen
Psychosoziale Onkologie - quo vadis?
 Universitätsklinikum Essen Psychosoziale Onkologie - quo vadis? 1. Brandenburger Krebskongress Wirklichkeiten und Visionen in der Onkologie Potsdam, 27. und 28. November 2009 Klaus F Röttger MA www.lebenszeiten.de
Universitätsklinikum Essen Psychosoziale Onkologie - quo vadis? 1. Brandenburger Krebskongress Wirklichkeiten und Visionen in der Onkologie Potsdam, 27. und 28. November 2009 Klaus F Röttger MA www.lebenszeiten.de
Die strukturelle Einbindung der Sozialen Arbeit in Palliative Care Teams
 Julia Bartkowski Die strukturelle Einbindung der Sozialen Arbeit in Palliative Care Teams Diplomica Verlag Julia Bartkowski Die strukturelle Einbindung der Sozialen Arbeit in Palliative Care Teams ISBN:
Julia Bartkowski Die strukturelle Einbindung der Sozialen Arbeit in Palliative Care Teams Diplomica Verlag Julia Bartkowski Die strukturelle Einbindung der Sozialen Arbeit in Palliative Care Teams ISBN:
DAK-Gesundheit im Dialog Patientenorientierung im Gesundheitswesen
 DAK-Gesundheit im Dialog Patientenorientierung im Gesundheitswesen Der aktive und informierte Patient Herausforderung für den Medizinbetrieb und Erfolgsfaktor für das Gesundheitswesen? Präsident der Bayerischen
DAK-Gesundheit im Dialog Patientenorientierung im Gesundheitswesen Der aktive und informierte Patient Herausforderung für den Medizinbetrieb und Erfolgsfaktor für das Gesundheitswesen? Präsident der Bayerischen
Betreuungs- und Nachsorgezentrum für krebs-, chronisch- und schwerkranke Kinder und deren Familien
 Betreuungs- und Nachsorgezentrum für krebs-, chronisch- und schwerkranke Kinder und deren Familien Nachsorge in Trier Die Villa Kunterbunt stellt sich vor Am Anfang war ein und eine Idee daraus wurde 1.
Betreuungs- und Nachsorgezentrum für krebs-, chronisch- und schwerkranke Kinder und deren Familien Nachsorge in Trier Die Villa Kunterbunt stellt sich vor Am Anfang war ein und eine Idee daraus wurde 1.
Generelle Einschätzung der zukünftigen Bedeutung von Telematik und Telemedizin
 I N S T I T U T F Ü R D E M O S K O P I E A L L E N S B A C H Der Einsatz von Telematik und Telemedizin im Gesundheitswesen aus Sicht der Ärzteschaft * - Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick - Breite
I N S T I T U T F Ü R D E M O S K O P I E A L L E N S B A C H Der Einsatz von Telematik und Telemedizin im Gesundheitswesen aus Sicht der Ärzteschaft * - Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick - Breite
Unabhängige Patientenberatung. Möglichkeiten und Grenzen der Patientenberatung in der RBS München für Oberbayern Carola Sraier
 Unabhängige Patientenberatung Möglichkeiten und Grenzen der Patientenberatung in der RBS München für Oberbayern Carola Sraier Gesellschafter der UPD ggmbh Sozialverband VdK Deutschland e.v. Verbraucherzentrale
Unabhängige Patientenberatung Möglichkeiten und Grenzen der Patientenberatung in der RBS München für Oberbayern Carola Sraier Gesellschafter der UPD ggmbh Sozialverband VdK Deutschland e.v. Verbraucherzentrale
Das St.Galler Bündnis gegen Depression nimmt Form an
 Das St.Galler Bündnis gegen Depression nimmt Form an Ausblick mit Dr. med. Thomas Meier Psychiatrie-Dienste Süd des Kantons St.Gallen Leiter Steuergruppe St.Galler Bündnis gegen Depression Inhalt Zahlen
Das St.Galler Bündnis gegen Depression nimmt Form an Ausblick mit Dr. med. Thomas Meier Psychiatrie-Dienste Süd des Kantons St.Gallen Leiter Steuergruppe St.Galler Bündnis gegen Depression Inhalt Zahlen
Co-Therapie in der Eltern-Kind-Reha
 Dr. Becker < Leben bewegen Co-Therapie in der Eltern-Kind-Reha Warum sie so bedeutend ist Nützliche Tipps von Dr. Volker Koch* *Dr. Volker Koch ist Leitender Arzt der Pädiatrie an der Dr. Becker Klinik
Dr. Becker < Leben bewegen Co-Therapie in der Eltern-Kind-Reha Warum sie so bedeutend ist Nützliche Tipps von Dr. Volker Koch* *Dr. Volker Koch ist Leitender Arzt der Pädiatrie an der Dr. Becker Klinik
Psychisch krank - ohne Arbeit, ohne Ausweg?
 Rainer Wedekind Sigrid Kuhnt Psychisch krank - ohne Arbeit, ohne Ausweg? Zur beruflichen und sozialen Lage entlassener psychiatrischer Krankenhauspatienten ientenundzu zum Bedarf an Arbeit und beruflicher
Rainer Wedekind Sigrid Kuhnt Psychisch krank - ohne Arbeit, ohne Ausweg? Zur beruflichen und sozialen Lage entlassener psychiatrischer Krankenhauspatienten ientenundzu zum Bedarf an Arbeit und beruflicher
Wenn Eltern psychisch krank sind: Forschungsstand und Erfordernisse der Praxis
 KatHO NRW Aachen Köln Münster Paderborn Wenn Eltern psychisch krank sind: Forschungsstand und Erfordernisse der Praxis Vortrag auf der 6. Fachtagung der Klinischen Sozialarbeit Workshop 1: Klinische Sozialarbeit
KatHO NRW Aachen Köln Münster Paderborn Wenn Eltern psychisch krank sind: Forschungsstand und Erfordernisse der Praxis Vortrag auf der 6. Fachtagung der Klinischen Sozialarbeit Workshop 1: Klinische Sozialarbeit
Best-AG (Beratungsstelle für Arbeit und Gesundheit) Kooperationsprojekt Algesiologikum+ Referat für Arbeit und Wirtschaft, München
 Best-AG (Beratungsstelle für Arbeit und Gesundheit) Kooperationsprojekt Algesiologikum+ Referat für Arbeit und Wirtschaft, München Best-AG (Beratungsstelle für Arbeit und Gesundheit) Algesiologikum + Kooperationsprojekt
Best-AG (Beratungsstelle für Arbeit und Gesundheit) Kooperationsprojekt Algesiologikum+ Referat für Arbeit und Wirtschaft, München Best-AG (Beratungsstelle für Arbeit und Gesundheit) Algesiologikum + Kooperationsprojekt
Konzeptbaustein. Ambulant Betreutes Wohnen für Menschen mit psychischen Behinderungen
 Konzeptbaustein Ambulant Betreutes Wohnen für Menschen mit psychischen Behinderungen Inhalt: 1 Zielgruppe 2 Spezifische Ziele der Leistungen 3 Leistungsanbote 4 Spezifisches zur Organisationsstruktur Anlagen:
Konzeptbaustein Ambulant Betreutes Wohnen für Menschen mit psychischen Behinderungen Inhalt: 1 Zielgruppe 2 Spezifische Ziele der Leistungen 3 Leistungsanbote 4 Spezifisches zur Organisationsstruktur Anlagen:
WELCHE NEUEN AKTEURE GIBT ES IM ARBEITSFELD DER GEMEINDEPSYCHIATRIE? BERLIN,
 WELCHE NEUEN AKTEURE GIBT ES IM ARBEITSFELD DER GEMEINDEPSYCHIATRIE? BERLIN, Gemeindepsychiatrie will Menschen dazu befähigen, mit ihrer seelischen Erkrankung in ihrem bisherigen Lebensumfeld zu leben
WELCHE NEUEN AKTEURE GIBT ES IM ARBEITSFELD DER GEMEINDEPSYCHIATRIE? BERLIN, Gemeindepsychiatrie will Menschen dazu befähigen, mit ihrer seelischen Erkrankung in ihrem bisherigen Lebensumfeld zu leben
