Schutzwaldkonzept Kanton Zug
|
|
|
- Frauke Schäfer
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Direktion des Innern Amt für Wald und Wild Schutzwaldkonzept Kanton Zug Konzept für Wälder mit besonderer Schutzfunktion gegen Naturgefahren Priorisierung im Schutzwald Waldbauliche Umsetzung mit Zieltypen Wirkungskontrolle durch Weiserflächen 4. Juli 2016
2 Impressum Direktion des Innern des Kantons Zug Amt für Wald und Wild Abteilung Schutzwald und Waldnaturschutz Martin Ziegler, Lea Bernath Foto Titelseite Lorzentobel, Gemeinde Menzingen Martin Ziegler, 21. Juni 2010 Amt für Wald und Wild Gever Schutzwaldkonzept Kanton Zug 2
3 Zusammenfassung Die Wälder mit besonderer Schutzfunktion gegen Naturgefahren (Schutzwälder) im Kanton Zug schützen Menschen und erhebliche Sachwerte vor Rutschungen, Erosion, Murgängen, Hochwasser und Steinschlag. Der Schutzwaldperimeter im Kanton Zug wurde 2010 auf Basis der Bundeskriterien sowie der Gefahrenhinweiskarte ausgeschieden und eigentümerverbindlich festgelegt. Das «Schutzwaldkonzept Kanton Zug» zeigt auf, wie die Wälder mit besonderer Schutzfunktion gegen Naturgefahren gepflegt werden sollen, damit sie ihre Schutzwirkung auch mit knappen f i- nanziellen Ressourcen nachhaltig erfüllen können. Dazu wird der Schutzwald je nach Höhe der Schutzwirkung in zwei unterschiedliche Prioritäten aufgeteilt. Diese Priorisierung dient dazu, die Pflege in Schutzwäldern, welche Menschen oder erhebliche Sachwerte überdurchschnittlich wi r- kungsvoll vor Naturgefahren schützen, vorrangig umzusetzen. Je nach Naturgefahr und Waldgesellschaft müssen bei der Umsetzung unterschiedliche waldbauliche Zielsetzungen angestrebt werden. Ähnliche Zielsetzungen werden in Zieltypen zusammeng e- fasst. Das Erreichen der Zieltyp-Anforderungen garantiert die optimale Schutzwirkung des Waldes gegen den jeweiligen Naturgefahrenprozess. Zieltypengerechte Schutzwaldpflegemassnahmen werden vom Bund und Kanton mit Beiträgen u n- terstütz. Die erhebliche Nutzungsbeschränkung von Schutzwäldern der ersten Priorität wird entschädigt. Die Wirkungskontrolle erfolgt gemäss Bundesvorgaben durch «Weiserflächen». Diese Kontrollflächen decken die wichtigsten Zieltypen ab und dokumentieren Veränderungen der Schutzwirkung des Waldes. Dank diesen Erfahrungswerten können Pflegemassnahmen im gesam ten Schutzwaldperimeter optimierter und zielgerichteter ausgeführt werden. Schutzwaldkonzept Kanton Zug 3
4 Inhalt 1. Einleitung 6 2. Rechtliche Rahmenbedingungen 6 3. Rückblick und Ausgangslage 7 4. Vision und Ziele Vision Ziele des Konzepts 8 5. Konzeption 9 6. Priorisierung im Schutzwald Begründung Kriterien Einteilung der Prioriäten Waldbauliche Umsetzung mit Zieltypen Kriterien zur Herleitung von Zieltypen Naturgefahren Standortsgruppen Zieltypenliste Umsetzung der Schutzwaldpflege Priorisierung der Massnahmen Allgemeine waldbauliche Vorgaben Vorgaben aufgrund des Zieltyps Umgang bei Überlagerungen von Waldfunktionen Arbeitssicherheit Beiträge und Entschädigungen Sanktionen Wirkungskontrolle durch Weiserflächen Nutzen der Wirkungskontrolle Weiserflächen Anzahl und Verteilung Einrichtung, Erst- und Folgeaufnahmen Weiterbildung auf Weiserflächen 19 Schutzwaldkonzept Kanton Zug 4
5 Anhang 1 - Mögliche Schutzwaldgebiete mit Priorität 1 20 Anhang 2 - Skizze zur Umsetzungsplanung 21 Anhang 3 - Anforderungen Zieltyp, Beispiel Zieltyp A 22 Anhang 4 - Checkliste NaiS «Verwendung von Holz an Ort und Stelle» 23 Anhang 5 - NaiS Formular 1A 24 Anhang 6 - NaiS Formular 2 25 Anhang 7 - Kontrollblatt für die jährliche Aufnahme der Weiserflächen 26 Schutzwaldkonzept Kanton Zug 5
6 1. Einleitung Der Wald im Kanton Zug erbringt diverse Leistungen für die Öffentlichkeit. Er dient der Holzproduktion, als Erholungswald, als Lebensraum für diverse Tier und Pflanzenarten und schützt vor Natu r- gefahren. Diese Waldfunktionen sind im kantonalen Richtplan 1 beschrieben und ihre flächige Ausdehnung festgelegt. Rund 45 % der Wälder im Kanton Zug schützen Menschen und erhebliche Sachwerte vor Rutschungen, Erosion, Murgängen, Hochwasser und Steinschlag 2. Diese Wälder mit besonderer Schutzfunktion gegen Naturgefahren (Schutzwald) wurden gemäss Bundeskriterien 3 und der Gefahrenhinweiskarte 4 ausgeschieden. Eine auf die Naturgefahr ausgerichtete Waldpflege verhindert Schäden an Menschen und Sachwerten. Aus diesem Grund unterstützen Bund und Kanton Massnahmen zur Schutzwaldpflege mit Beiträgen. Das Schutzwaldkonzept zeigt auf, nach welchen Kriterien die Schutzwaldpflege priorisiert wird, welche waldbaulichen Zielsetzungen erreicht werden müssen und wie die Wirkung der ausgeführten Massnahmen analysiert wird. Es garantiert, dass das Schutzpotenti al des Waldes unter Berücksichtigung finanzieller Ressourcen optimal ausgeschöpft wird und die Umsetzung sowie die Wirkungskontrolle den Bundesvorgaben 5 entsprechen. 2. Rechtliche Rahmenbedingungen Die Schutzwaldausscheidung, die Priorisierung des Schutzwaldes, die Umsetzung der Waldpflege, die Beiträge und Entschädigungen sowie die Wirkungskontrolle basieren auf folgenden rechtlichen Grundlagen: - Bundesgesetz über den Wald vom 4. Oktober 1991 (Waldgesetz WaG; SR 921.0): Art. 19, Art. 20, Abs. 5, Art. 37; - Verordnung über den Wald vom 30. November 1992 (Waldverordnung, WaV: SR ): Art. 19, Art. 40; - Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über den Wald vom 17. Dezember 1998 (EG Waldgesetz, BGS 931.1): 7, 24, 26; - Kantonaler Richtplan; beschlossen vom Kantonsrat am 28. Januar 2004; nachgeführte rechtskräftige Beschlüsse bis 2. Juli 2015 (BGS ), Kapitel L4; - Kantonaler Waldentwicklungsplan, beschlossen vom Regierungsrat am 22. Mai 2012, Kap i- tel 5.3, 5.6; 1 Kanton Zug, Amt für Raumplanung 2004: Kantonaler Richtplan; beschlossen vom Kantonsrat am 28. Januar 2004; nachgeführte rechtskräftige Beschlüsse bis 2. Juli Kanton Zug, Direktion des Innern 2012: Kantonaler Waldentwicklungsplan, Beschlossen vom Regierungsrat am 22. Mai 2012, Kapitel Bundesamt für Umwelt (BAFU): Harmonisierte Kriterien zur Schutzwald-Ausscheidung (SilvaProtect-CH, Phase II), Stand Kanton Zug, Baudirektion und Direktion des Innern, 2003: Gefahrenhinweiskarte des Kantons Zug 5 BUWAL 2005: Nachhaltigkeit und Erfolgskontrolle im Schutzwald (NaiS), Wegleitung für Pflegemassnahmen in Wäldern mit Schutzfunktion Schutzwaldkonzept Kanton Zug 6
7 - Programmvereinbarung betreffend die Programmziele im Bereich Schutzwald zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft vertreten durch das Bundesamt für U m- welt (BAFU) und dem Kanton Zug vertreten durch die Direktion des Innern ; - Bundesamt für Umwelt (BAFU) 2015: Handbuch Programmvereinbarungen im Umweltbereich Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehörde an Gesuchsteller, Teil 7; - BUWAL 2005, Nachhaltigkeit und Erfolgskontrolle im Schutzwald (NaiS), Wegleitung für Pflegemassnahmen in Wäldern mit Schutzfunktion. 3. Rückblick und Ausgangslage Damit ein Wald als Schutzwald ausgeschieden werden kann, muss der Wald nachweislich vor einem Naturgefahrenprozess (z.b. Rutschungen, Steinschlag) mit anerkanntem Schadenpotential (Menschen, erhebliche Sachwerte) schützen. Die erste Schutzwaldausscheidung aufgrund dieser Kriterien erfolgte 1994 gemäss dem Konzept «Wälder mit besonderer Schutzfunktion im Kanton Zug» 6. Darauf basierend wurden detaillierte Waldbau B und Waldbau C Projekte für Schutzwälder der Korporationen Zug, Walchwil und Oberägeri mit zehnjähriger Laufzeit erstellt. Diese umfassten teilweise über 200 Planungseinheiten, damit die Schutzwaldpflegemassnahmen zielgerichtet und nach Dringlichkeiten priorisiert ausgeführt werden konnten. Diese Projekte waren Voraussetzung für Kantons- und Bundesbeiträge in der Schutzwaldpflege bis zum Abschluss der ersten Programmvereinbarungen zwischen dem Bund und dem Kanton Zug im Jahr In der «Programmvereinbarung Schutzwald» 7 werden für jeweils vier Jahre Pflegeziele im Schutzwald vereinbart und mit dem Bund abgerechnet wurde die Schutzwaldfläche auf der Basis einheitlicher Bundeskriterien sowie der Gefahrenhinweiskarte überprüft und angepasst 8. Folglich wurden % der Waldfläche (2'878 ha) als Wald mit besonderer Schutzfunktion gegen Naturgefahren in den Kantonalen Richtplan aufgenommen. Dies ermöglichte dem Kanton Zug, Massnahmen zur Schutzwaldpflege im gesamten Schutzwaldperimeter mit Beiträgen zu unterstützen wurde im Waldentwicklungsplan die Priorisierung des Schutzwaldes, eine konsequente Umsetzung der Schutzwaldpflege gemäss «Nachhaltigkeit und Erfolgskontrolle im Schutzwald» (NaiS) sowie eine Wirkungskontrolle anhand von «Weiserflächen» festgeschrieben. Die gleichen Forderungen stellte der Bund nach der Stichprobenkontrolle zur Programmvereinbarung Schutzwald im Jahr Kantonsforstamt Zug 1994: Wälder mit besonderer Schutzfunktion im Kanton Zug 7 Programmvereinbarung betreffend die Programmziele im Bereich Schutzwald zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft vertreten durch das Bundesamt für Umwelt (BAFU) und dem Kanton Zug vertr e- ten durch die Direktion des Innern 8 Kantonsforstamt Zug 2010: Bericht zur Schutzwaldausscheidung Schutzwaldkonzept Kanton Zug 7
8 4. Vision und Ziele 4.1. Vision Das Potential der Schutzwirkung der Wälder mit besonderer Schutzfunktion gegen Naturgefahren ist in Abhängigkeit vom Schadenpotential ausgeschöpft. Es entstehen keine Schäden an Menschen oder erheblichen Sachwerten infolge falscher oder fehlender Schutzwaldpflege Ziele des Konzepts Folgende Ziele sollen mit diesem Konzept erreicht werden: - Die Schutzwaldpflege erfolgt bundeskonform gemäss NaiS-Vorgaben. - Die Schutzwaldpflege wird nach Schadenpotential, Gefahrenpotential und Dringlichkeit priorisiert. - Die Umsetzung der Massnahmen erfolgt gemäss dem jeweiligen aus der Naturgefahr und der Waldgesellschaft hergeleiteten Zieltyp. - Die Wirkungskontrolle erfolgt über «Weiserflächen». Diese decken die relevantesten Zieltypen ab. - Die Schutzwaldpflege und Wirkungskontrolle erfolgen mit hoher Fachkompetenz der Beteiligten. Mit der Umsetzung dieser Ziele werden die Bundes- und Kantonsvorgaben sowie die Festlegungen des Waldentwicklungsplans im Bereich Schutzwald erfüllt. Schutzwaldkonzept Kanton Zug 8
9 5. Konzeption A. Priorisierung im Schutzwald Die Schutzwaldfläche wird gemäss Kriterien in eine Priorität 1 und eine Priorität 2 aufgeteilt. Wälder der Priorität 1 schützen Menschen oder erhebliche Sachwerte bei entsprechender Waldpflege überdurchschnittlich wirkungsvoll vor Naturgefahren. Eine konsequente Umsetzung der Schutzwaldpflege ist in diesen Wäldern entscheidend. siehe Kapitel 6 B. Waldbauliche Umsetzung mit Zieltypen Die Naturgefahr und die Waldgesellschaft bestimmen die waldbauliche Zielsetzung. Diese Zielsetzungen werden in Zieltypen zusammengefasst. Die Umsetzung der Pflegemassnahmen nach Zieltypen garantiert die optimalste Schutzwirkung des Waldes gegen die entsprechende Naturgefahr. In der Priorität 1 werden Zieltypenkarten erstellt. siehe Kapitel 7 C. Weiserflächen zur Wirkungskontrolle Für jeden relevanten Zieltyp wird eine Weiserfläche ausgeschieden und im Wald eingerichtet. Die Ausgangslage und die waldbauliche Zielsetzung werden detailliert beschrieben, periodisch überprüft und wenn nötig angepasst. Diese Weiserflächen dienen neben der Wirkungskontrolle vor Ort auch als Vergleichsflächen für die waldbauliche Umsetzung in Gebieten mit gleichem Zieltyp. siehe Kapitel 8 Schutzwaldkonzept Kanton Zug 9
10 6. Priorisierung im Schutzwald 6.1. Begründung Um die zu Verfügung stehenden Ressourcen möglichst wirkungsvoll und zielgerichtet einzusetzen, wird der Schutzwald in zwei unterschiedlichen Prioritäten eingeteilt. Schutzwälder der Priorität 1 schützen Menschen oder erhebliche Sachwerte bei entsprechender Waldpflege überdurchschnit t- lich wirkungsvoll vor Naturgefahren. Eine detaillierte Massnahmenplanung und eine konsequente Umsetzung der Schutzwaldpflege sind in diesen Wäldern von zentraler Bedeutung. Schutzwälder der Priorität 2 wirken meist indirekt vor Naturgefahrenprozessen. Ihre Pflege ist ebenfalls von B e- deutung, wird jedoch zweitrangig umgesetzt Kriterien Anhand des «Ablaufschemas zur Priorisierung» (Abbildung 1) wird der Schutzwald in eine Priorität 1 und in eine Priorität 2 aufgeteilt. Die Gefahrenhinweiskarte, die Gefahrenkarten sowie der Ereigniskataster 9 werden als Grundlagen berücksichtigt. Neben dem Gefahrenprozess spielen der Geländeverlauf sowie Bodenfaktoren (Gründigkeit, Feuchte, Scherfestigkeit) eine wichtige Rolle bei der Beurteilung. Zudem muss die Erfahrung von ortskundigen Fachleuten miteinbezogen werden. 9 Kanton Zug, Direktion des Innern, Amt für Wald und Wild: Ereigniskataster, Stand 2010 Schutzwaldkonzept Kanton Zug 10
11 Abbildung 1: Ablaufschema zur Priorisierung 6.3. Einteilung der Prioriäten Die definitive Einteilung der Prioritäten erfolgt durch die Abteilung Schutzwald und Waldnaturschutz in enger Zusammenarbeit mit den Revierförstern und der Abteilung Naturgefahren und Waldrecht. Die Arrondierung muss berücksichtigt werden. Eine grobe Einschätzung ergibt einen Flächenanteil für die Priorität 1 von 20 bis 25 % an der gesamten Schutzwaldfläche (siehe Anhang 1). Für Waldflächen mit der Priorität 1 wird eine Umsetzungsplanung erstellt, auf welcher der genaue Perimeter, die Holzbringung, die Zieltypen sowie die Dringlichkeiten der nächsten 15 Jahre ersichtlich sind (siehe Anhang 2). Schutzwaldkonzept Kanton Zug 11
12 7. Waldbauliche Umsetzung mit Zieltypen Die Naturgefahr und die Waldgesellschaft bestimmen die waldbauliche Zielsetzung. Diese Zielse t- zungen werden in Zieltypen zusammengefasst. Die Umsetzung der Pflegemassnahmen gemäss Anforderung des Zieltyps garantiert die optimalste Schutzwirkung des Waldes gegen den entsprechenden Naturgefahrenprozess Kriterien zur Herleitung von Zieltypen Naturgefahren Mittels Schutzwaldpflege soll der Waldaufbau so gestaltet werden, dass er gegen den örtlichen N a- turgefahrenprozess die beste Schutzwirkung erzielt. Somit ist die Naturgefahr die wichtigste Eingangsgrösse bei der Festlegung der Pflegeziele. Folgende Naturgefahren sind für den Kanton Zug gemäss NaiS und der Naturgefahrenhinweiskarte relevant: Rutschungen, Erosion, Murgänge Rutschungen, Erosion und Murgänge sind die flächenmässig bedeutendsten Naturgefahren im Kanton Zug. Sie werden gemäss NaiS in folgende Kategorien unterteilt: flachgründige Rutschungen (Tiefe der Gleitfläche < 2 m) mittelgründige Rutschungen (Tiefe der Gleitfläche 2 bis 10 m) tiefgründige Rutschungen (Tiefe der Gleitfläche > 10 m) Der Einfluss des Pflegezustandes des Waldes ist bei mittel- bis tiefgründigen Rutschungen gering. Für eine vereinfachte Umsetzung und bestmögliche Wirkung, werden für die Festlegung der Zielt y- pen (Kap. 7.2) die flach-, mittel- und tiefgründigen Rutschungen zusammengefasst und deren waldbaulichen Zielsetzungen dem Gefahrenprozess mit der grössten Schutzwaldwirkung, das heisst den flachgründigen Rutschungen, angepasst. Steinschlag Steinschlagprozesse kommen im Kanton Zug nur stellenweise vor, sind aber aufgrund ihrer potentiellen Schadwirkung äusserst relevant. Der Steinschlag-Schutzwald wirkt bei entsprechender Pflege besonders wirkungsvoll. Abhängig von der Grösse der Steine wird er gemäss NaiS in folgende Kategorien unterteilt: Blockgrösse 0.05 m3 / bis 40 cm Ø Blockgrösse 0.05 bis 0.20 m3 / cm Ø Blockgrösse 0.20 bis 5.00 m3 / 60 bis 180 cm Ø Wildbach, Hochwasser Die Naturgefahr Wildbach, Hochwasser wird gemäss NaiS in folgende Kriterien unterteilt: Wald in Gerinneeinhängen Wald im Einzugsgebiet, Boden mittel- bis tiefgründig, gehemmt durchlässig Wald im Einzugsgebiet, Boden flach- bis mittelgründig, gehemmt durchlässig bzw. mittelbis tiefgründig, normal durchlässig Wald im Einzugsgebiet, Boden flach- bis mittelgründig, normal durchlässig Wald im Einzugsgebiet, Boden sehr flachgründig bzw. übermässig durchlässig Schutzwaldkonzept Kanton Zug 12
13 Die Durchlässigkeit von Böden im Einzugsgebiet Wildbach kann nur erschwert festgestellt werden und kann sich kleinstandörtlich ändern oder überlagern. Für die Festlegung der Zieltypen (Kap. 7.2) werden bei dieser Naturgefahr die Unterkategorien zusammengefasst und die waldbaulichen Zielsetzungen dem Gefahrenprozess mit der grössten Schutzwaldwirkung, das heisst den mittelbis tiefgründig, gehemmt durchlässigen Böden, angepasst. Gemäss der Gefahrenhinweiskarte ist die Lawinengefahr im Kanton Zug vernachlässigbar 10. Hinzu kommt, dass ein Wald, welcher nach den allgemeinen Schutzwaldvorgaben (Kap ) gepflegt wird, wirkungsvoll vor Lawinen schützt. Aus diesen Gründen wird nicht weiter auf Lawinen als Naturgefahren eingegangen Standortsgruppen Klima, Bodenaufbau, Wasserhaushalt und Nährstoffangebot sind grundlegende Standortsfaktoren, die das Aufkommen bestimmter Pflanzenarten begünstigen und somit Waldgesellschaften ausbilden. Während die grundlegenden Standortsfaktoren nicht verändert werden können, kann durch die Waldpflege der Bestandesaufbau, die Baumartenzusammensetzung sowie die Stabilität der einzelnen Bäume beeinflusst werden. Es ist weder praktikabel noch zielführend, für jede im Kanton Zug vorkommende Waldgesellschaft eine separate, schutzwaldspezifische und an die Naturgefahr angepasste Zielsetzung zu formulieren. Deshalb werden die relevanten Waldgesellschaften, in Anlehnung an das System des Kantons Luzern 11, in fünf Standortsgruppen eingeteilt. Die in einer Standortsgruppe eingeteilten Waldg e- sellschaften haben ähnliche ökologische Eigenschaften und können somit vergleichbar behandelt werden. Standortsgruppe 1a, extrem saure Buchenwälder 1, 1 ho, 2, 2 ho, 7*, 8* Standortsgruppe 1b, saure bis basenreiche Buchenwälder 6, 7a, 7a R, 7a s, 7b, 7d, 7e, 7f, 7g, 8a, 8a R, 8a s, 8b, 8d, 8e, 8f, 8g, 9a, 10a, 11, 12a, 12e, 12g, 14a, 15a, 17 Standortsgruppe 2, Tannen-Buchenwälder 18a, 18a s, 18a F, 18d, 18e, 18f, 18g, 19a, 19 ps, 20 Standortsgruppe 3, Ahorn-Eschenwälder und Eschenwälder 26a, 26f, 26g, 26 ho, 27a, 27f, 27 ho, 30 Standortsgruppe 4, Tannen- und Fichten-Tannenwälder 46a, 46e, 46s, 49a, 50a, 50d, 51 Sonderstandorte 12 können keiner Standortsgruppe zugeordnet werden. Ihre Behandlung erfolgt gemäss Kapitel Baudirektion und Direktion des Innern des Kantons Zug 2003, Gefahrenhinweiskarte des Kantons Zug, E r- läuterungsbericht 11 Kanton Luzern 2015, Weiserflächenkonzept Kanton Luzern 12 Sonderwaldstandorte sind wechselfeuchte Standorte, Schutt-Standorte und Auen-Standorte. Sie werden im Ökogramm separat dargestellt und weisen häufig kleinflächig variierende Eigenschaften auf. Schutzwaldkonzept Kanton Zug 13
14 7.2. Zieltypenliste Aufgrund der Naturgefahren (siehe Kap ) und der Standortsgruppen (siehe Kapitel 7.1.2) werden die Zieltypen definiert. Ein Verschnitt der Naturgefahren und der Standortgruppen zeigt auf, welche Kombinationen im Kanton Zug vorkommen und somit für die Schutzwaldpflege relevant sind (Tabelle 1): Zieltyp Naturgefahr Standortgruppe Häufigkeit A Rutschungen, Erosion, Murgänge 1a selten B Rutschungen, Erosion, Murgänge 1b sehr häufig C Rutschungen, Erosion, Murgänge 2 sehr häufig D Rutschungen, Erosion, Murgänge 3 gelegentlich E Rutschungen, Erosion, Murgänge 4 selten F Steinschlag, Blockgrösse 0.05 m3 / bis 40 cm Ø 1b selten G Steinschlag, Blockgrösse 0.05 m3 / bis 40 cm Ø 2 selten H Steinschlag, Blockgrösse 0.05 m3 / bis 40 cm Ø 3 sehr selten I Steinschlag, Blockgrösse 0.05 bis 0.20 m3 / cm Ø 1b selten J Steinschlag, Blockgrösse 0.05 bis 0.20 m3 / cm Ø 2 sehr selten K Steinschlag, Blockgrösse 0.05 bis 0.20 m3 / cm Ø 3 sehr selten L Steinschlag, Blockgrösse 0.20 bis 5.00 m3 / 60 bis 180 cm Ø 2 sehr selten M Wildbach, Hochwasser, Wald in Gerinneeinhängen 1b,2,3,4 gelegentlich N Wildbach, Hochwasser, Wald im Einzugsgebiet 1a,1b,2,3,4 sehr häufig Im Zieltyp M und N können mehrere Standortsgruppen zusammengefasst werden, da sich ihre waldbauliche Behandlung, sofern die Vorgaben auf der gesamten Schutzwaldfläche gemäss Kap. 7.3 eingehalten werden, nicht unterscheidet. Pro Zieltyp werden durch das Amt für Wald und Wild Anforderungen auf der Basis des NaiS - Formular 2 ausgearbeitet (siehe Anhang 3), welche als Zielsetzung für die Schutzwaldpflegemassnahmen dienen (siehe Kap ). Wenn der Standort keinem Zieltyp zugeordnet werden kann, werden die ortspezifischen Anford e- rungen in Absprache mit der Abteilung Schutzwald und Waldnaturschutz unter Berücksichtigun g der NaiS-Vorgaben festgelegt Umsetzung der Schutzwaldpflege Priorisierung der Massnahmen Die Priorisierung der Massnahmen richtet sich nach der walbaulichen Dringlichkeit zur Erfüllung der Schutzfunktion und der zu erwartenden Wirkung der Massnahme. Grundsätzlich werden Schutzwaldmassnahmen mit gleichwertiger Dringlichkeit zuerst in Wäldern der Priorität 1 ausgeführt. Wichtige Schutzwaldmassnahmen können durch das Amt für Wald und Wild angeordnet werden. Schutzwaldkonzept Kanton Zug 14
15 Allgemeine waldbauliche Vorgaben Grundsätzlich wird ein stufiger Waldaufbau angestrebt. Offene Flächen von mehr als 6 Aren sind unabhängig des Zieltyps zu vermeiden. Um gegen biotische und abiotische Gefahren optimal und nachhaltig gerüstet zu sein, muss der Schutzwald zwingend aus standortsgerechten Baumarten der jeweiligen Waldgesellschaft bestehen - wenn möglich als Mischwald mit zwei oder mehr Hauptbaumarten. Damit führt ein Ausfall einer Baumart z.b. aufgrund des Klimawandels oder einer Krankrankheit (z.b. Eschentriebsterben) nicht gleich zum Ausfall der gesamten Schutzwirkung eines Waldbestandes. Als Grundlage für die Baumartenwahl dienen die im Fachbuch «Waldgesellschaften des Kantons Zug» 13 unter der jeweiligen Waldgesellschaft aufgeführten standortstypischen Baumarten sowie die unter waldbaulicher Behandlung empfohlenen Arten. Instabile Bäume, die eine Gefährdung von Menschen oder von erheblichen Sachwerten darstellen, müssen entfernt werden. Andere waldbauliche Vorgaben wie Qualität und Baumart haben zweite Priorität. Das Belassen von Totholz im Bestand und der Umgang mit Ringeln erfolgt gemäss NaiS- Checkliste (siehe Anhang 4). Um Rutschungen und Steinschlag zu verhindern, dürfen Seillinien wenn möglich nicht in der Falllinie verlaufen. Wenn dies zwingend notwendig ist, ist der Linienaushieb möglichst gering zu halten und eine Bodennarbe durch Rücken zu verhindern. In Schutzwäldern der Priorität 1 können anderweitige Zielsetzungen nur umgesetzt werden, wenn durch sie die Schutzfunktion des Waldes gemäss Zieltyp (siehe Kap.7.2) in keiner Weise geschmälert wird. Dabei gilt der Grundsatz «Stabilität vor Qualität». Es dürfen also keine stabilen Bäume minderwertiger Qualität entnommen werden, um instabile Bäume mit Qualitätsmerkmalen zu b e- günstigen. In Schutzwäldern der Priorität 2 können anderweitige Zielsetzungen verfolgt werden, sofern die Minimalanforderungen gemäss Zieltyp eingehalten werden. Neophyten können die Schutzwaldfunktion negativ beeinflussen und sind bei waldbaulichen Massnahmen zu bekämpfen Vorgaben aufgrund des Zieltyps Die Pflegemassnahmen richten sich nach den Anforderungen des betreffenden Zieltyps. In Flächen der Priorität 1 wird der Zieltyp in der Umsetzungsplanung festgelegt (Kap 6.3). Auf Flächen der Priorität 2 wird dieser mit Hilfe der Gefahrenhinweiskarte und dem Fachbuch «Waldgesellschaften des Kantons Zug» im Wald festgelegt. Auf dem gleichen Standort können mehrere Naturgefahren und somit mehrere Zieltypen relevant sein. In diesem Fall ist es zwingend, dass die Minimalanforderungen der Naturgefahr mit dem grössten Gefahrenpotential erfüllt sind. 13 Kanton Zug, Direktion des Innern, Amt für Wald und Wild 2014: Waldgesellschaften des Kantons Zug, Bestimmung, Eigenschaften, waldbauliche Empfehlungen Schutzwaldkonzept Kanton Zug 15
16 Umgang bei Überlagerungen von Waldfunktionen Bei der Überlagerung von mehreren besonderen Waldfunktionen sind möglichst alle besonderen Waldfunktionen zu erfüllen. Dabei hat die Erfüllung der Schutzfunktion gegen Naturgefahren erste Priorität. 14 In Waldnaturschutzgebieten muss das Minimalprofil gemäss Zieltyp erfüllt sein. Bei weitergehe n- den betragsberechtigten Massnahmen sind die Naturschutzziele, unabhängig von der eigentümerverbindlichen Sicherung, umzusetzen. Die Abrechnung bei Überlagerung von Waldfunktionen erfolgt gemäss Kapitel Arbeitssicherheit Bei der Umsetzung der Schutzwaldpflege sind die Vorgaben der Arbeitssicherheit einzuhalten. Bei besonders gefährlichen Arbeiten müssen die Erhöhung der Schutzwirkung und das Arbeitsrisiko gegeneinander abgewogen werden (z.b. Pflege in felsigen Bacheinhängen). Werden waldbauliche Massnahmen aufgrund der nicht gegebenen Arbeitssicherheit unterlassen, sind allfällige alternative Massnahmen mit der Abteilung Schutzwald und Waldnaturschutz zu besprechen und zu dokumentieren Beiträge und Entschädigungen Aufwertungsmassnahmen zur Erfüllung der Schutzfunktion werden mit Beiträgen durch das Amt für Wald und Wild unterstützt 15. Alle Massnahmen werden vorgängig geplant, durch den Revierförster mit dem «Beitragsformular AFW» 16 unter Angabe des Zieltyps beim Amt für Wald und Wild eingereicht und nach Überprüfung durch das Amt zugesichert. Nach korrekter Ausführung gemäss Zusicherung erfolgt die Auszahlung allfälliger Beiträge. Grundsätzlich werden massnahmenbezogene Jungwaldpflegebeiträge ausbezahlt. Die Fläche n- pauschale «Stufige Bestände» 17 kann als Ersatz nur im Schutzwald der Priorität 2 und ausserhalb der Waldnaturschutzgebiete angewendet werden. Im Schutzwald ist die Handlungsfreiheit der Waldeigentumsberechtigten eingeschränkt. Dies gilt im erhöhten Masse in Schutzwäldern der Priorität 1. Deshalb werden in Schutzwäldern der Priorität 1 neben allfälligen Beiträgen an die Schutzwaldpflegemassnahmen auch die auferlegte Nutzungsbeschränkung entschädigt 18. Die im «Beitragsformular AFW» geltend gemachte Holzmenge gemäss Anzeichnungsprotokoll wird mit 10 Fr./m3 entschädigt. 14 Kantonaler Waldentwicklungsplan, beschlossen vom Regierungsrat am 22. Mai 2012, Kapitel 5.6, Festl e- gungen und Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Wald vom (EG Waldgesetz; BGS 931.1), 24 Abs. 1 Bst. a, b, c 16 Amt für Wald und Wild, "Beitragsformular AFW" in der jeweils aktuellen Fassung 17 Pauschale Abgeltung über die Holzschlagfläche in mit der Waldeigentümerschaft vereinbarten stufigen Beständen. 18 Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über den Wald vom 17. Dezember 1998 (EG Waldgesetz, BGS 931.1): 24, Abs.3 Schutzwaldkonzept Kanton Zug 16
17 Bei eigentümerverbindlich gesicherten Waldnaturschutzgebieten im Schutzwald erfolgt die Abrechnung der Beiträge und Entschädigungen über die Waldbiodiversität (nicht kumulierbar). Bei Waldnaturschutzgebieten ohne eigentümerverbindliche Sicherung sowie im Wald mit besonderer Erholungsfunktion wird die Schutzwaldpflege über den Schutzwald abgerechnet Sanktionen Werden die waldbaulichen Vorgaben für den Schutzwald nicht umgesetzt, kann die Direktion des Innern die Schutzwaldpflege gemäss Art. 29, Abs. 5 des Waldgesetzes (SR 921.0) gegen den Willen der Waldeigentümerschaft verfügen. Wird die Schutzfunktion des Waldes selbstverschuldet verringert, werden für die entsprechenden Wiederherstellungsmassnahmen weder Kantons- noch Bundesbeiträge ausbezahlt. Wiederherstellungsmassnahmen können durch die zuständige Behörde angeordnet werden. Die Kosten sind durch den Verursacher zu begleichen. Allfällige Strafanzeigen sind in diesem Fall vorbehalten. Werden die hoheitlichen Pflichten des Revierförsters vernachlässigt oder verletzt, richten sich die Sanktionen nach dem Pflichtenheft für den Forstdienst. Schutzwaldkonzept Kanton Zug 17
18 8. Wirkungskontrolle durch Weiserflächen 8.1. Nutzen der Wirkungskontrolle Die Wirkungskontrolle soll die mittel- bis langfristige Wirkung von Schutzwaldpflegemassnahmen aufzeigen. Dank den daraus gewonnen Erkenntnissen können zukünftige Massnahmen gezielter umgesetzt werden. Für die Wirkungskontrolle sieht NaiS die Ausscheidung von ca. 1 ha grossen Weiserflächen vor. Diese gemäss Zieltyp gepflegten Weiserflächen dienen neben der Wirkungskontrolle vor Ort auch als Vergleich für die waldbauliche Umsetzung in Gebieten mit gleichem Zieltyp. Zudem ermöglichen sie einen Erfahrungsaustausch zwischen den Fachleuten Weiserflächen Anzahl und Verteilung Mit Ausnahme der sehr selten vorkommenden Zieltypen wird für jeden Zieltyp gemäss Kap. 7.2 eine Weiserfläche ausgeschieden. Dies ergibt zehn Weiserflächen (Tabelle 2): Zieltyp / Naturgefahr Weiserfläche Standortgruppe Häufigkeit A Rutschungen, Erosion, Murgänge 1a selten B Rutschungen, Erosion, Murgänge 1b sehr häufig C Rutschungen, Erosion, Murgänge 2 sehr häufig D Rutschungen, Erosion, Murgänge 3 gelegentlich E Rutschungen, Erosion, Murgänge 4 selten F Steinschlag, Blockgrösse 0.05 m3 / bis 40 cm Ø 1b selten G Steinschlag, Blockgrösse 0.05 m3 / bis 40 cm Ø 2 selten I Steinschlag, Blockgrösse 0.05 bis 0.20 m3 / cm Ø 1b selten M Wildbach, Hochwasser, Wald in Gerinneeinhängen 1b,2,3,4 gelegentlich N Wildbach, Hochwasser, Wald im Einzugsgebiet 1a,1b,2,3,4 sehr häufig Die Weiserflächen müssen in Schutzwäldern der Priorität 1 oder in Gebieten mit schwierigen waldbaulichen Voraussetzungen ausgeschieden sein. Zudem ist eine gleichmässige Verteilung über die Forstreviere anzustreben Einrichtung, Erst- und Folgeaufnahmen Bei der Einrichtung wird eine Fläche von ca. 1 ha ausgeschieden und markiert. Die Eckpunkte werden mit dem GPS aufgenommen. Bei der Erstaufnahme beziehungsweise nach Ausführung von Waldpflegmassnahmen, jedoch mindestens alle fünf Jahre, wird pro Weiserfläche eine Situationsanalyse gemäss NaiS-Formular 1 (siehe Anhang 5) sowie ein Fotoprotokoll erstellt und der Handlungsbedarf mit Hilfe des NaiS- Formular 2 (siehe Anhang 6) hergeleitet. Schutzwaldkonzept Kanton Zug 18
19 Bei den jährlichen Folgeaufnahmen ist ein Kontrollblatt analog Urnermethode 19 auszufüllen (siehe Anhang 7). Die Erstaufnahme und die Folgeaufnahmen sowie deren Auswertung erfolgen durch den zuständigen Revierförster in Zusammenarbeit mit der Abteilung Schutzwald und Waldnaturschutz. Die gesamte Dokumentation wird durch die Abteilung Schutzwald und Waldnaturschutz auf der Weiserflächenplattform der Fachstelle für Gebirgswaldpflege 20 online gestellt und laufend aktualisiert Weiterbildung auf Weiserflächen Alle drei Jahre findet eine obligatorische Schutzwaldweiterbildung 21 für die Revierförster statt. Anhand von Weiserflächen werden waldbauliche Zielsetzungen und ausgeführte Massnahm en diskutiert und analysiert. Damit wird gewährleistet, dass die Erkenntnisse aus der Pflege der Weiserflächen in die Bewirtschaftung aller Schutzwaldflächen einfliessen. Ausserdem dient die Weiterbildung als Erfahrungsaustausch und erhöht die Fachkompetenz. 4. Juli 2016 Amt für Wald und Wild Raffaella Albione Amtsleiterin a.i. 19 Kanton Uri, Protokoll Jahreskontrolle, Schutzwald-Weiserflächen des Kantons Uri 20 SuisseNaiS Weiserflächen-Plattform, (abgerufen am 7. Juni 2016) 21 Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über den Wald vom 17. Dezember 1998 (EG Waldgesetz, BGS 931.1): 21, Abs.3 Schutzwaldkonzept Kanton Zug 19
20 Anhang 1 - Mögliche Schutzwaldgebiete mit Priorität 1
21 Anhang 2 - Skizze zur Umsetzungsplanung
22 Anhang 3 - Anforderungen Zieltyp, Beispiel Zieltyp A
23 Anhang 4 - Checkliste NaiS «Verwendung von Holz an Ort und Stelle»
24 Anhang 5 - NaiS Formular 1A
25 Anhang 6 - NaiS Formular 2
26 Anhang 7 - Kontrollblatt für die jährliche Aufnahme der Weiserflächen Protokoll Jahreskontrolle Schutzwald-Weiserflächen Ort: Datum: Weiserfläche: Bearbeiter: 1 Flächen-Eckpunkte Eckpunkte auffindbar? Alle Eckpunkte gut auffindbar Eckpunkte auffindbar, Markierung ungenügend Eckpunkte teilweise nicht auffindbar Eckpunkte nicht auffindbar Ausgeführte Massnahmen Keine Massnahmen Markierung aufgefrischt Neue Eckpunkte erstellt versichert und auf Skizze eingezeichnet 2 Fotostandorte Fotostandorte auffindbar? Alle Fotostandorte gut auffindbar Fotostandorte auffindbar, Markierung ungenügend Fotostandorte teilweise nicht auffindbar Fotostandorte nicht auffindbar Ausgeführte Massnahmen Keine Massnahmen Markierung aufgefrischt Neue Fotostandorte erstellt, versichert und auf Skizze eingezeichnet 3 Ereignisse seit letzter Kontrolle Ereignis Datum Schadholzmenge Davon liegenlassen Davon Bringung Windwurf Erosion Rutschung Steinschlag 4 Schädlinge Buchdrucker befallene Menge angeben (m 3 ) Weitere Schädlinge auf Rückseite Ursache angeben Kein Schädlingsbefall (unter Bemerkung) 5 Entwicklung der Verjüngung Ansamung (< 10 cm) Anwuchs (10-40 cm) Aufwuchs (> 40 cm) vorhanden Baumarten Flächenanteil in %
27 6 Wildverbiss Starker Verbiss Leichter Verbiss Kein Verbiss Errichtung Kontrollzaun sinnvoll? 7 Bemerkungen (z.b. genauere Angaben zu Ereignissen, Schädlingen, Verjüngung etc.) Wichtige Hinweise Die jährliche Begehung soll zwischen Juni und September erfolgen. Dieses Formular ist bis spätestens zum 1. Oktober der Abteilung Schutzwald und Waldnaturschutz abzugeben. Alle neu gemachten Fotos sind bis zum 1. Oktober der Abteilung Schutzwald und Waldnaturschutz in digitaler Form abzugeben. Visum Förster Datum: Unterschrift: Visum Abteilung Schutzwald und Waldnaturschutz Datum: Unterschrift:
Biodiversitätsziele im Zuger Wald
 Biodiversitätsziele im Zuger Wald 18. SVS - Naturschutztagung 17. November 2012 Martin Winkler, Kantonsförster Inhaltsverzeichnis Ausgangslage Gefahren für die Natur im Wald Waldnaturschutz im Kanton Zug
Biodiversitätsziele im Zuger Wald 18. SVS - Naturschutztagung 17. November 2012 Martin Winkler, Kantonsförster Inhaltsverzeichnis Ausgangslage Gefahren für die Natur im Wald Waldnaturschutz im Kanton Zug
Wald 2.7. Landschaft. 2.7 Wald. Planungsgrundsätze
 Der soll nachhaltig Nutz-, Schutz- und Wohlfahrtsfunktionen ausüben. Pflege und Nutzung des es sollen naturnah erfolgen. Die in den Regionalen plänen verankerten funktionen sind mit dem kantonalen sentwicklungskonzept
Der soll nachhaltig Nutz-, Schutz- und Wohlfahrtsfunktionen ausüben. Pflege und Nutzung des es sollen naturnah erfolgen. Die in den Regionalen plänen verankerten funktionen sind mit dem kantonalen sentwicklungskonzept
Anpassung kantonaler Richtplan Kapitel L 4 Wald
 Baudirektion Amt für Raumplanung Anpassung kantonaler Richtplan Kapitel L 4 Wald Synopse, November 2007 Verwaltungsgebäude 1 an der Aa Aabachstrasse 5, Postfach, 6301 Zug T 041 728 54 80, F 041 728 54
Baudirektion Amt für Raumplanung Anpassung kantonaler Richtplan Kapitel L 4 Wald Synopse, November 2007 Verwaltungsgebäude 1 an der Aa Aabachstrasse 5, Postfach, 6301 Zug T 041 728 54 80, F 041 728 54
Stand: Siehe auch Blätter Nr. E.5 / F.2 / F.3 / F.4 / F.10 / I.1. Dienststelle für Wald und Landschaft
 Kantonaler Richtplan - Koordinationsblatt Wald Natur, Landschaft und Wald Funktionen des Waldes Stand: 21.09.2005 Siehe auch Blätter Nr. E.5 / F.2 / F.3 / F.4 / F.10 / I.1 Instanzen zuständig für das Objekt
Kantonaler Richtplan - Koordinationsblatt Wald Natur, Landschaft und Wald Funktionen des Waldes Stand: 21.09.2005 Siehe auch Blätter Nr. E.5 / F.2 / F.3 / F.4 / F.10 / I.1 Instanzen zuständig für das Objekt
Landwirtschaft und Wald. Nachhaltiger Schutzwald entlang von Fliessgewässern im Kanton Luzern (NASEF)
 Landwirtschaft und Wald Nachhaltiger Schutzwald entlang von Fliessgewässern im Kanton Luzern (NASEF) 1 Situation nach Lothar Sofortmassnahme: Projekt Lothar und Naturgefahren 245 Objekte beurteilt 93 ausgeführt
Landwirtschaft und Wald Nachhaltiger Schutzwald entlang von Fliessgewässern im Kanton Luzern (NASEF) 1 Situation nach Lothar Sofortmassnahme: Projekt Lothar und Naturgefahren 245 Objekte beurteilt 93 ausgeführt
Übersichtskarte 1:
 Objekt 3: Pfäfers 3 Grot Gruppe A Übersichtskarte 1: 20 000 1 Objekt 3: Pfäfers 3 Grot Gruppe A Streuschaden mit "Vorverjüngung" / Belassen / Teilverbau Pflanzung Dokumentation Grundlagen (Raphael Schwitter)
Objekt 3: Pfäfers 3 Grot Gruppe A Übersichtskarte 1: 20 000 1 Objekt 3: Pfäfers 3 Grot Gruppe A Streuschaden mit "Vorverjüngung" / Belassen / Teilverbau Pflanzung Dokumentation Grundlagen (Raphael Schwitter)
Wald & Wild. Ansichten und Anliegen der Waldeigentümer
 HERZLICH WILLKOMMEN Wald & Wild Ansichten und Anliegen der Waldeigentümer Lyss, 20. April 2018 Jacqueline Bütikofer Die Waldeigentümer Wer sind sie und was sind ihre Ansichten? > 244 000 private Waldeigentümer
HERZLICH WILLKOMMEN Wald & Wild Ansichten und Anliegen der Waldeigentümer Lyss, 20. April 2018 Jacqueline Bütikofer Die Waldeigentümer Wer sind sie und was sind ihre Ansichten? > 244 000 private Waldeigentümer
Übersicht Strategie. Geschäftsfeld Wald. Amt für Wald (KAWA) Volkswirtschaftsdirektion (VOL)
 Übersicht Strategie Geschäftsfeld Wald Amt für Wald (KAWA) Volkswirtschaftsdirektion (VOL) Einleitung und Vision Die Strategie des Geschäftsfeldes Wald dient dazu, dem Handeln der fünf beteiligten Abteilungen
Übersicht Strategie Geschäftsfeld Wald Amt für Wald (KAWA) Volkswirtschaftsdirektion (VOL) Einleitung und Vision Die Strategie des Geschäftsfeldes Wald dient dazu, dem Handeln der fünf beteiligten Abteilungen
~Baudirektion. Kanton Zürich. Verfügung vom 14. Juli Schutzwald (Festsetzung)
 ~Baudirektion ALN Amt für Landschaft und Natur Walcheplatz 2, Postfach, 8090 Zürich Telefon: 043 259 27 31 Verfügung vom 14. Juli 2008 Schutzwald (Festsetzung) 1. Gesetzlicher Auftrag Wo es der Schutz
~Baudirektion ALN Amt für Landschaft und Natur Walcheplatz 2, Postfach, 8090 Zürich Telefon: 043 259 27 31 Verfügung vom 14. Juli 2008 Schutzwald (Festsetzung) 1. Gesetzlicher Auftrag Wo es der Schutz
über Anpassungen des Verordnungsrechts im Umweltbereich, insbesondere hinsichtlich der Programmvereinbarungen für die Programmperiode
 Nicht amtlich publizierte Fassung Verordnung über Anpassungen des Verordnungsrechts im Umweltbereich, insbesondere hinsichtlich der Programmvereinbarungen für die Programmperiode 2016 2019 vom 28.01.2015
Nicht amtlich publizierte Fassung Verordnung über Anpassungen des Verordnungsrechts im Umweltbereich, insbesondere hinsichtlich der Programmvereinbarungen für die Programmperiode 2016 2019 vom 28.01.2015
Amt für Wald Office des forêts du KS 6.2/2 des Kantons Bern canton de Berne Beilage 10
 Totalreservate Kriterien Grsätze Totalreservat: Sicherung mit Dienstbarkeitsvertrag (Grbucheintrag) Flächen auf welchen während mindestens n Keine forstlichen Eingriffe vorgenommen werden MSt, JS, PGr
Totalreservate Kriterien Grsätze Totalreservat: Sicherung mit Dienstbarkeitsvertrag (Grbucheintrag) Flächen auf welchen während mindestens n Keine forstlichen Eingriffe vorgenommen werden MSt, JS, PGr
Das Projekt "Ökonomie und Ökologie im Schutzwald" Der Schutzwald
 Das Projekt "Ökonomie und Ökologie im Schutzwald" Der Schutzwald Inhalt Das Projekt Die Ziele Der Schutzwald Die Schutzfunktion des Waldes ist keine Selbstverständlichkeit Lösungsansätze Die Rolle der
Das Projekt "Ökonomie und Ökologie im Schutzwald" Der Schutzwald Inhalt Das Projekt Die Ziele Der Schutzwald Die Schutzfunktion des Waldes ist keine Selbstverständlichkeit Lösungsansätze Die Rolle der
Vorbereitungsseminar Staatsprüfung Waldbau Gmunden
 04 05 2012 Vorbereitungsseminar Staatsprüfung Waldbau Gmunden Inhalt > Waldentwicklungsplan > Waldbauliche Planung mit unterschiedlichen Zielsetzungen > Waldbau - Klimaänderung Waldentwicklungsplan Der
04 05 2012 Vorbereitungsseminar Staatsprüfung Waldbau Gmunden Inhalt > Waldentwicklungsplan > Waldbauliche Planung mit unterschiedlichen Zielsetzungen > Waldbau - Klimaänderung Waldentwicklungsplan Der
Verordnung über Anpassungen des Verordnungsrechts im Umweltbereich,
 Verordnung über Anpassungen des Verordnungsrechts im Umweltbereich, insbesondere hinsichtlich der Weiterentwicklung der Programmvereinbarungen für die Programmperiode 2016-2019 vom Entwurf Der Schweizerische
Verordnung über Anpassungen des Verordnungsrechts im Umweltbereich, insbesondere hinsichtlich der Weiterentwicklung der Programmvereinbarungen für die Programmperiode 2016-2019 vom Entwurf Der Schweizerische
KANTON AARGAU D = o/oo SBR o/oo D = A1 = D =
 B 400 30 o/oo KANTON AARGAU (-500) 1252 D = 42574 142 o/oo 1253 D = 42618 E1 = 42389 A1 = 42387 08 o/oo 1254 D = 42586 E1 = 42397 A1 = 42395 1242 D = 42558 A1 = 42419 1161 D = 42616 E1 = 42418 A1 = 42416
B 400 30 o/oo KANTON AARGAU (-500) 1252 D = 42574 142 o/oo 1253 D = 42618 E1 = 42389 A1 = 42387 08 o/oo 1254 D = 42586 E1 = 42397 A1 = 42395 1242 D = 42558 A1 = 42419 1161 D = 42616 E1 = 42418 A1 = 42416
RICHTLINIEN FÜR BEITRÄGE AN NATURSCHUTZMASSNAHMEN
 Kanton Schaffhausen Kantonsforstamt Beckenstube 11 CH-8200 Schaffhausen www.sh.ch RICHTLINIEN FÜR BEITRÄGE AN NATURSCHUTZMASSNAHMEN vom 16. Januar 2018 ersetzt die RL vom 08. Februar 2016 1. GRUNDLAGEN
Kanton Schaffhausen Kantonsforstamt Beckenstube 11 CH-8200 Schaffhausen www.sh.ch RICHTLINIEN FÜR BEITRÄGE AN NATURSCHUTZMASSNAHMEN vom 16. Januar 2018 ersetzt die RL vom 08. Februar 2016 1. GRUNDLAGEN
Konzept Biber - Vollzugshilfe des BAFU zum Bibermanagement in der Schweiz. Rückmeldeformular. Name / Firma / Organisation / Amt
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Konzept Biber Vollzugshilfe des BAFU zum Bibermanagement in der Schweiz Rückmeldeformular Name
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Konzept Biber Vollzugshilfe des BAFU zum Bibermanagement in der Schweiz Rückmeldeformular Name
Informationen für Bewirtschafter
 Vorschriften zur Bodenerosionsschutz Informationen für Bewirtschafter Juni 2018 Service de l agriculture SAgri Amt für Landwirtschaft LwA Direction des institutions, de l agriculture et des forêts DIAF
Vorschriften zur Bodenerosionsschutz Informationen für Bewirtschafter Juni 2018 Service de l agriculture SAgri Amt für Landwirtschaft LwA Direction des institutions, de l agriculture et des forêts DIAF
Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen
 Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung) Änderung vom Der Schweizerische Bundesrat verordnet: I Die CO2-Verordnung vom 30. November 2012 1 wird wie folgt geändert: Art. 9 Abs.
Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung) Änderung vom Der Schweizerische Bundesrat verordnet: I Die CO2-Verordnung vom 30. November 2012 1 wird wie folgt geändert: Art. 9 Abs.
Inhalt. Thurgauer Wasserbau-Tagung Ereignisdokumentation im Kanton Thurgau Ereigniskataster StorMe
 asserbautagung 2016 2. as ist ein Naturereigniskataster? Thurgauer asserbau-tagung 2016 3. Ereigniskataster StorMe Referentin: Norina Steingruber Zweck der Ereignisdokumentation Zweck der Ereignisdokumentation,
asserbautagung 2016 2. as ist ein Naturereigniskataster? Thurgauer asserbau-tagung 2016 3. Ereigniskataster StorMe Referentin: Norina Steingruber Zweck der Ereignisdokumentation Zweck der Ereignisdokumentation,
DER WALDENTWICKLUNGSPLAN UND SEINE BEDEUTUNG IN DER ÖRTLICHEN RAUMPLANUNG. bmnt.gv.at
 DER WALDENTWICKLUNGSPLAN UND SEINE BEDEUTUNG IN DER ÖRTLICHEN RAUMPLANUNG 18.06.2018 --- 1 --- INHALT 1. GESETZLICHE GRUNDLAGEN UND INHALTE DES WALDENTWICKLUNGSPLANES 2. BEDEUTUNG DES WALDENTWICKLUNGSPLANES
DER WALDENTWICKLUNGSPLAN UND SEINE BEDEUTUNG IN DER ÖRTLICHEN RAUMPLANUNG 18.06.2018 --- 1 --- INHALT 1. GESETZLICHE GRUNDLAGEN UND INHALTE DES WALDENTWICKLUNGSPLANES 2. BEDEUTUNG DES WALDENTWICKLUNGSPLANES
Tagung Bundesamt für Umwelt
 Tagung Bundesamt für Umwelt Naturwerte im Wandel am Beispiel der Waldpolitik Bern, 16. März 2017 Bruno Röösli, Abteilungsleiter Wald lawa, Kanton Luzern Agenda v Waldfunktionen und Strukturen im Luzerner
Tagung Bundesamt für Umwelt Naturwerte im Wandel am Beispiel der Waldpolitik Bern, 16. März 2017 Bruno Röösli, Abteilungsleiter Wald lawa, Kanton Luzern Agenda v Waldfunktionen und Strukturen im Luzerner
Plenterwaldstudie im Bezirk Bregenz
 Plenterwaldstudie im Bezirk Bregenz Was versteht man unter einem Plenterwald? Bei einem Plenterwald existieren alle Entwicklungsstufen der Bäume nebeneinander. Dadurch entsteht auf kleinster Fläche eine
Plenterwaldstudie im Bezirk Bregenz Was versteht man unter einem Plenterwald? Bei einem Plenterwald existieren alle Entwicklungsstufen der Bäume nebeneinander. Dadurch entsteht auf kleinster Fläche eine
MULTIPLIKATORENSCHULUNG FÜR FORSTLICHE PROJEKTMAßNAHMEN LE 14-20
 MULTIPLIKATORENSCHULUNG FÜR FORSTLICHE PROJEKTMAßNAHMEN LE 14-20 VORHABENSART 8.5.1: INVESTITIONEN ZUR STÄRKUNG VON RESISTENZ UND ÖKOLOGISCHEM WERT DES WALDES SL-STV DI DR. JOHANNES SCHIMA LINZ, 19. APRIL
MULTIPLIKATORENSCHULUNG FÜR FORSTLICHE PROJEKTMAßNAHMEN LE 14-20 VORHABENSART 8.5.1: INVESTITIONEN ZUR STÄRKUNG VON RESISTENZ UND ÖKOLOGISCHEM WERT DES WALDES SL-STV DI DR. JOHANNES SCHIMA LINZ, 19. APRIL
Fachvortrag FW Mittelrheintal/Berneck-Au-Heerbrugg Au, 7. Januar 2014 Naturgefahrenprojekt
 Fachvortrag FW Mittelrheintal/Berneck-Au-Heerbrugg Au, 7. Januar 2014 Naturgefahrenprojekt Tiefbauamt, Sektion Naturgefahren/Talsperren Ralph Brändle Naturgefahrenprojekt Inhalt Ausgangslage Projekt Naturgefahren
Fachvortrag FW Mittelrheintal/Berneck-Au-Heerbrugg Au, 7. Januar 2014 Naturgefahrenprojekt Tiefbauamt, Sektion Naturgefahren/Talsperren Ralph Brändle Naturgefahrenprojekt Inhalt Ausgangslage Projekt Naturgefahren
Bewusst mit Naturgefahrenrisiken umgehen in der Schweiz eine Aufgabe der Raumplanung?
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Gefahrenprävention GeP Bewusst mit Naturgefahrenrisiken umgehen in der Schweiz eine Aufgabe
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Gefahrenprävention GeP Bewusst mit Naturgefahrenrisiken umgehen in der Schweiz eine Aufgabe
Synopse. KWaG. Kantonales Waldgesetz (KWaG) Der Kantonsrat des Kantons Luzern, nach Einsicht in die Botschaft. beschliesst:
 Synopse (ID: 76) KWaG Kantonales Waldgesetz (KWaG) Der Kantonsrat des Kantons Luzern, nach Einsicht in die Botschaft beschliesst: I. Kantonales Waldgesetz (KWaG) vom. Februar 999 (Stand. März 04) wird
Synopse (ID: 76) KWaG Kantonales Waldgesetz (KWaG) Der Kantonsrat des Kantons Luzern, nach Einsicht in die Botschaft beschliesst: I. Kantonales Waldgesetz (KWaG) vom. Februar 999 (Stand. März 04) wird
Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen
 Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO 2-Verordnung) Änderung vom 22. Juni 2016 Der Schweizerische Bundesrat verordnet: I Die CO 2-Verordnung vom 30. November 2012 1 wird wie folgt geändert:
Verordnung über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO 2-Verordnung) Änderung vom 22. Juni 2016 Der Schweizerische Bundesrat verordnet: I Die CO 2-Verordnung vom 30. November 2012 1 wird wie folgt geändert:
Ergebnisse der Forsteinrichtung im Gemeindewald Bingen
 Ergebnisse der Forsteinrichtung im Gemeindewald Bingen Multifunktionale Waldbewirtschaftung - Ausgleich von Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion - Naturnahe Waldwirtschaft, PEFC-Zertifizierung Waldbauliche
Ergebnisse der Forsteinrichtung im Gemeindewald Bingen Multifunktionale Waldbewirtschaftung - Ausgleich von Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion - Naturnahe Waldwirtschaft, PEFC-Zertifizierung Waldbauliche
Bundesgesetz über den Wald
 Bundesgesetz über den Wald (Waldgesetz, WaG) Entwurf Änderung vom Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 1, beschliesst: I Das Waldgesetz
Bundesgesetz über den Wald (Waldgesetz, WaG) Entwurf Änderung vom Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 1, beschliesst: I Das Waldgesetz
Seilkranhiebe. oder: Klaus Dinser. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kempten (Allgäu)
 Idee eines Bewertungssystem für Seilkranhiebe oder: Der forstliche Götterblick Klaus Dinser Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kempten (Allgäu) 2. ARGE ALP Workshop `Ökologie und Ökonomie im
Idee eines Bewertungssystem für Seilkranhiebe oder: Der forstliche Götterblick Klaus Dinser Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kempten (Allgäu) 2. ARGE ALP Workshop `Ökologie und Ökonomie im
DER SCHUTZWALD IN DER FORSTLICHEN RAUMPLANUNG
 DER SCHUTZWALD IN DER FORSTLICHEN RAUMPLANUNG RICHARD BAUER 29.01.15 --- 1 --- INHALT 1. AUFGABE DER RAUMPLANUNG 2. AUFGABE DER FORSTLICHEN RAUMPLANUNG 3. SCHUTZWALDDEFINITION 4. FLÄCHENAUSMAß DES SCHUTZWALDES
DER SCHUTZWALD IN DER FORSTLICHEN RAUMPLANUNG RICHARD BAUER 29.01.15 --- 1 --- INHALT 1. AUFGABE DER RAUMPLANUNG 2. AUFGABE DER FORSTLICHEN RAUMPLANUNG 3. SCHUTZWALDDEFINITION 4. FLÄCHENAUSMAß DES SCHUTZWALDES
WALDZERTIFIZIERUNG NACH ISO PILOTSTUDIE ZUR UMSETZUNG IN DER SCHWEIZ. Nachhaltige Nutzung der Wälder und umweltgerechte
 WALDZERTIFIZIERUNG NACH ISO 14001 - PILOTSTUDIE ZUR UMSETZUNG IN DER SCHWEIZ PD Dr. Peter Gresch Mit den Normen und Richtlinien zum Umweltmanagement der ISO und dem neuen Waldgesetz sind Instrumente verfügbar,
WALDZERTIFIZIERUNG NACH ISO 14001 - PILOTSTUDIE ZUR UMSETZUNG IN DER SCHWEIZ PD Dr. Peter Gresch Mit den Normen und Richtlinien zum Umweltmanagement der ISO und dem neuen Waldgesetz sind Instrumente verfügbar,
Bundesgesetz über den Wald
 Bundesgesetz über den Wald (Waldgesetz, WaG) Entwurf Änderung vom Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 28. März 2007 1, beschliesst:
Bundesgesetz über den Wald (Waldgesetz, WaG) Entwurf Änderung vom Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 28. März 2007 1, beschliesst:
Weisung über die Ausbildung von Waldarbeitern
 Kanton Zürich Baudirektion Amt für Landschaft und Natur Abteilung Wald Weisung über die Ausbildung von Waldarbeitern 1. Juni 2017 2/6 Inhalt Zweck 3 Rechtsgrundlagen 3 Geltungsbereich 4 Wer hat welchen
Kanton Zürich Baudirektion Amt für Landschaft und Natur Abteilung Wald Weisung über die Ausbildung von Waldarbeitern 1. Juni 2017 2/6 Inhalt Zweck 3 Rechtsgrundlagen 3 Geltungsbereich 4 Wer hat welchen
Helvetia Schutzwald Engagement. Baumpass. Jubiläumsedition Helvetia Schutzwald Engagements in der Schweiz. Ihre Schweizer Versicherung.
 Helvetia Schutzwald Engagement Baumpass Jubiläumsedition 2016. Über 100 000 Bäume gepflanzt. Gemeinsam für den Schutzwald. Schutzwälder sind eine wichtige Massnahme zum Schutz vor Elementarschäden. Sie
Helvetia Schutzwald Engagement Baumpass Jubiläumsedition 2016. Über 100 000 Bäume gepflanzt. Gemeinsam für den Schutzwald. Schutzwälder sind eine wichtige Massnahme zum Schutz vor Elementarschäden. Sie
Brennholz- und Schnitzellager im Wald
 Departement für Bau und Umwelt Richtlinie Nr. 4 / November 2009 Brennholz- und Schnitzellager im Wald Ausgangslage Diese Richtlinie setzt sich unter anderem mit der Frage auseinander, in welchen Fällen
Departement für Bau und Umwelt Richtlinie Nr. 4 / November 2009 Brennholz- und Schnitzellager im Wald Ausgangslage Diese Richtlinie setzt sich unter anderem mit der Frage auseinander, in welchen Fällen
Die Verantwortung der Kantone
 Die Verantwortung der Kantone Eine Frage der Möglichkeiten oder des Willens? Ueli Meier Leiter Amt für Wald beider Basel Präsident der Konferenz der Kantonsförster Die Verantwortung der Kantone KWL / CFP?
Die Verantwortung der Kantone Eine Frage der Möglichkeiten oder des Willens? Ueli Meier Leiter Amt für Wald beider Basel Präsident der Konferenz der Kantonsförster Die Verantwortung der Kantone KWL / CFP?
Kantonale Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen
 Kanton Zürich Baudirektion Amt für Raumentwicklung Geoinformation Referenz-Nr.: AREI-A6QMNK / ARE 16-017 31. März 016 1/15 Kantonale Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen
Kanton Zürich Baudirektion Amt für Raumentwicklung Geoinformation Referenz-Nr.: AREI-A6QMNK / ARE 16-017 31. März 016 1/15 Kantonale Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen
Amt für Umwelt Thurgau
 Programmvereinbarung 2020 2024 Schwerpunkte Bund und Kanton Handbuch BAFU 4. Programmperiode seit der Einführung der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung (NFA) 2008 2011 Neues Subventionsmodell
Programmvereinbarung 2020 2024 Schwerpunkte Bund und Kanton Handbuch BAFU 4. Programmperiode seit der Einführung der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung (NFA) 2008 2011 Neues Subventionsmodell
Schutzwald in Tirol im Spannungsfeld aller Landnutzer
 Schutzwald in Tirol im Spannungsfeld aller Dr. Hubert Kammerlander Gruppe Forst Waldfläche wächst langsam aber stetig 540 W aldfläche in [1.000 ha] 520 500 480 460 440 420 400 Quelle: ÖWI 61/70 71/80 81/85
Schutzwald in Tirol im Spannungsfeld aller Dr. Hubert Kammerlander Gruppe Forst Waldfläche wächst langsam aber stetig 540 W aldfläche in [1.000 ha] 520 500 480 460 440 420 400 Quelle: ÖWI 61/70 71/80 81/85
Gefahrendarstellung bei gravitativen Naturgefahren
 Gefahrendarstellung bei gravitativen Naturgefahren Ein Blick über die Grenzen Prof. Dr. Markus Stoffel Gravitative Naturgefahren Rechtlicher Rahmen Bearbeitungstiefe Suszeptibilität (Inventar) Kaum Intensität
Gefahrendarstellung bei gravitativen Naturgefahren Ein Blick über die Grenzen Prof. Dr. Markus Stoffel Gravitative Naturgefahren Rechtlicher Rahmen Bearbeitungstiefe Suszeptibilität (Inventar) Kaum Intensität
Der Regierungsrat des Kantons Thurgau. Festlegung des behördenverbindlichen Raumbedarfs der Gewässer
 Thurgau Der Regierungsrat des Kantons Thurgau Protokoll vom 18. Dezember 2018 Nr. 1074 Festlegung des behördenverbindlichen Raumbedarfs der Gewässer 1. Ausgangslage Mit den Änderungen des Bundesgesetzes
Thurgau Der Regierungsrat des Kantons Thurgau Protokoll vom 18. Dezember 2018 Nr. 1074 Festlegung des behördenverbindlichen Raumbedarfs der Gewässer 1. Ausgangslage Mit den Änderungen des Bundesgesetzes
Amt für Wald und Naturgefahren Fachbereich Naturgefahren
 Umweltdepartement Amt für Wald und Naturgefahren Fachbereich Naturgefahren Bahnhofstrasse 20 Postfach 1184 6431 Schwyz Telefon 041 819 18 35 Telefax 041 819 18 39 Integrale Naturgefahrenkarten Informationen
Umweltdepartement Amt für Wald und Naturgefahren Fachbereich Naturgefahren Bahnhofstrasse 20 Postfach 1184 6431 Schwyz Telefon 041 819 18 35 Telefax 041 819 18 39 Integrale Naturgefahrenkarten Informationen
Flexibilisierung der Waldflächenpolitik
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Wald Flexibilisierung der Waldflächenpolitik Inhalt Anpassung WaG Anpassung WaV Vollzugshilfe
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Wald Flexibilisierung der Waldflächenpolitik Inhalt Anpassung WaG Anpassung WaV Vollzugshilfe
Bestellte Schutzleistungen des Waldes entlang der Nationalstrasse Philippe Arnold, Fachspezialist Naturgefahren, ASTRA
 Bestellte Schutzleistungen des Waldes entlang der Nationalstrasse Philippe Arnold, Fachspezialist Naturgefahren, ASTRA Die Dokumentation ASTRA 89009 Naturgefahren auf Nationalstrassen; Schutzwaldpflege
Bestellte Schutzleistungen des Waldes entlang der Nationalstrasse Philippe Arnold, Fachspezialist Naturgefahren, ASTRA Die Dokumentation ASTRA 89009 Naturgefahren auf Nationalstrassen; Schutzwaldpflege
Naturgefahren Siedlung Naturgefahren. Planungsgrundsatz 1.11 A
 Dem Schutz von Menschen und Sachgütern vor ist grosse Bedeutung beizumessen. Dabei ist nach folgender Reihenfolge vorzugehen: Planungsgrundsatz A 1. Erkennen und Meiden von Gefahren 2. Bewusst mit Risiken
Dem Schutz von Menschen und Sachgütern vor ist grosse Bedeutung beizumessen. Dabei ist nach folgender Reihenfolge vorzugehen: Planungsgrundsatz A 1. Erkennen und Meiden von Gefahren 2. Bewusst mit Risiken
Umweltdepartement. Amt für Umweltschutz. USB-Tagung vom 5. Mai Invasive Organismen
 USB-Tagung vom 5. Mai 2013 Invasive Organismen Inhalt Stand TRev KVzUSG Aktivitäten 2013 Seite 2 TRev KVzUSG 17. April 2013 im Kantonsrat verschoben 25. April 2013 RUVKO-Besprechung Ziele: Erarbeitung
USB-Tagung vom 5. Mai 2013 Invasive Organismen Inhalt Stand TRev KVzUSG Aktivitäten 2013 Seite 2 TRev KVzUSG 17. April 2013 im Kantonsrat verschoben 25. April 2013 RUVKO-Besprechung Ziele: Erarbeitung
Fachordner Wasserbau 640 Unterhalts- und Pflegekonzept
 641 Grundsätze und Ziele Seite 1 Definition Gewässerunterhalt Der Gewässerunterhalt umfasst alle Massnahmen, die geeignet sind das Gewässer, die zugehörige Umgebung und die Wasserbauwerke in gutem Zustand
641 Grundsätze und Ziele Seite 1 Definition Gewässerunterhalt Der Gewässerunterhalt umfasst alle Massnahmen, die geeignet sind das Gewässer, die zugehörige Umgebung und die Wasserbauwerke in gutem Zustand
s Bundesgesetz über den Wald. Änderung (Differenzen)
 Nationalrat Frühjahrssession 06 e-parl 09.0.06 5: - - 4.046 s Bundesgesetz über den Wald. Änderung (Differenzen) Geltendes Recht Entwurf des Bundesrates Beschluss des es Beschluss des Nationalrates Beschluss
Nationalrat Frühjahrssession 06 e-parl 09.0.06 5: - - 4.046 s Bundesgesetz über den Wald. Änderung (Differenzen) Geltendes Recht Entwurf des Bundesrates Beschluss des es Beschluss des Nationalrates Beschluss
Ausführungsbestimmungen über die Rodung
 Ausführungsbestimmungen über die Rodung vom 8. März 07 (Stand. Mai 07) Der Regierungsrat des Kantons Obwalden, in Ausführung der Artikel 7 und 9 des Bundesgesetzes über den Wald (Waldgesetz, WaG) vom.
Ausführungsbestimmungen über die Rodung vom 8. März 07 (Stand. Mai 07) Der Regierungsrat des Kantons Obwalden, in Ausführung der Artikel 7 und 9 des Bundesgesetzes über den Wald (Waldgesetz, WaG) vom.
Anforderungen an den UVB
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Wald Anforderungen an den UVB Fokus Wald Übersicht 1) Ziele 2) Gesetzliche Grundlagen
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Wald Anforderungen an den UVB Fokus Wald Übersicht 1) Ziele 2) Gesetzliche Grundlagen
Forstrevier Schauenburg. Waldrandpflegekonzept. gemäss Anhang Betriebsplan Forstrevier Schauenburg
 Forstrevier Schauenburg Waldrandpflegekonzept gemäss Anhang Betriebsplan Forstrevier Schauenburg Im Auftrag des Forstrevier Schauenburg erarbeitet durch: Raphael Häner, Guaraci. raphael.haener@guaraci.ch
Forstrevier Schauenburg Waldrandpflegekonzept gemäss Anhang Betriebsplan Forstrevier Schauenburg Im Auftrag des Forstrevier Schauenburg erarbeitet durch: Raphael Häner, Guaraci. raphael.haener@guaraci.ch
Der Waldentwicklungsplan Information Wald Murtal
 Information Wald Murtal Der genehmigt durch den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft am 28.11.2014 Die Bezirkshauptmannschaft Murtal hat in Zusammenarbeit mit der
Information Wald Murtal Der genehmigt durch den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft am 28.11.2014 Die Bezirkshauptmannschaft Murtal hat in Zusammenarbeit mit der
Forstliches Gutachten zur Situation der Waldverjüngung 2018 gemäß Artikel 32 Absatz 1 des Bayerischen Jagdgesetzes (BayJG)
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Töging a. Inn Forstliches Gutachten zur Situation der Waldverjüngung 2018 gemäß Artikel 32 Absatz 1 des Bayerischen Jagdgesetzes (BayJG) Hochwildhegegemeinschaft/Hegegemeinschaft
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Töging a. Inn Forstliches Gutachten zur Situation der Waldverjüngung 2018 gemäß Artikel 32 Absatz 1 des Bayerischen Jagdgesetzes (BayJG) Hochwildhegegemeinschaft/Hegegemeinschaft
Standortgerechte Baumartenund Bestandeszieltypenwahl
 Standortgerechte Baumartenund Bestandeszieltypenwahl Dienstordnung Waldbau Anlage 6 Für die Wälder des Freistaats Thüringen auf Grundlage der forstlichen Standortskartierung unter Beachtung des Klimawandels
Standortgerechte Baumartenund Bestandeszieltypenwahl Dienstordnung Waldbau Anlage 6 Für die Wälder des Freistaats Thüringen auf Grundlage der forstlichen Standortskartierung unter Beachtung des Klimawandels
Raumplanung und Wald im Kanton Zürich
 Kanton Zürich Baudirektion Raumplanung und Wald im Kanton Zürich Überlegungen aus Sicht der Raumplanung Jahresversammlung des Schweizerischen Forstvereins 25. August 2016 Christian Leisi, Kanton Zürich
Kanton Zürich Baudirektion Raumplanung und Wald im Kanton Zürich Überlegungen aus Sicht der Raumplanung Jahresversammlung des Schweizerischen Forstvereins 25. August 2016 Christian Leisi, Kanton Zürich
Erläuternder Bericht zur Verordnung über Anpassungen des Verordnungsrechts an die Weiterentwicklung der Programmvereinbarungen
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU 27. April 2018 zur Verordnung über Anpassungen des Verordnungsrechts an die Weiterentwicklung der
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU 27. April 2018 zur Verordnung über Anpassungen des Verordnungsrechts an die Weiterentwicklung der
Amt für Wald, Jagd und Fischerei. Leitlinie zur naturnahen Waldbewirtschaftung im Kanton Solothurn
 Amt für Wald, Jagd und Fischerei Leitlinie zur naturnahen Waldbewirtschaftung im Kanton Solothurn November 2017 Einleitung... 2 1. Waldbau... 3 2. Natürliche Verjüngung... 4 3. Baumartenwahl... 5 4. Bodenschutz...
Amt für Wald, Jagd und Fischerei Leitlinie zur naturnahen Waldbewirtschaftung im Kanton Solothurn November 2017 Einleitung... 2 1. Waldbau... 3 2. Natürliche Verjüngung... 4 3. Baumartenwahl... 5 4. Bodenschutz...
Anhang 2C: Anforderungen auf Grund der Standortstypen im Überblick
 Anhang 2C: Anforderungen auf Grund der Standortstypen im Überblick 1 Einleitung 2 Arven- und Lärchenwälder der obersubalpinen Stufe 3 Nadelwälder der subalpinen Stufe (ohne Föhren- und Arvenwälder) 4 Fichtendominierte
Anhang 2C: Anforderungen auf Grund der Standortstypen im Überblick 1 Einleitung 2 Arven- und Lärchenwälder der obersubalpinen Stufe 3 Nadelwälder der subalpinen Stufe (ohne Föhren- und Arvenwälder) 4 Fichtendominierte
Schutzwaldbewirtschaftung unter betrieblichen und gesellschaftlichen Verpflichtungen. Bundesschutzwaldplattform Mariazell Dr.
 14 06 2012 Schutzwaldbewirtschaftung unter betrieblichen und gesellschaftlichen Verpflichtungen Bundesschutzwaldplattform Mariazell Dr. Georg Erlacher SCHUTZWALD BEI DER ÖBf AG Ausgangssituation Wild-
14 06 2012 Schutzwaldbewirtschaftung unter betrieblichen und gesellschaftlichen Verpflichtungen Bundesschutzwaldplattform Mariazell Dr. Georg Erlacher SCHUTZWALD BEI DER ÖBf AG Ausgangssituation Wild-
Weisung. ÖREB-Kataster Bundesabgeltungen. vom (Stand am )
 Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS Bundesamt für Landestopografie swisstopo Weisung vom 01.01.2016 (Stand am 31.05.2016) ÖREB-Kataster Bundesabgeltungen Herausgeber
Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS Bundesamt für Landestopografie swisstopo Weisung vom 01.01.2016 (Stand am 31.05.2016) ÖREB-Kataster Bundesabgeltungen Herausgeber
Keine wasserbauliche Bewilligung beim Gewässerunterhalt Was bedeutet dies für die Politischen Gemeinden?
 Keine wasserbauliche Bewilligung beim Gewässerunterhalt Was bedeutet dies für die Politischen Gemeinden? Roman Kistler, Amtsleiter Jagd- und Fischereiverwaltung Neue Situation durch 37 WBSNG Abs.1: Eingriffe
Keine wasserbauliche Bewilligung beim Gewässerunterhalt Was bedeutet dies für die Politischen Gemeinden? Roman Kistler, Amtsleiter Jagd- und Fischereiverwaltung Neue Situation durch 37 WBSNG Abs.1: Eingriffe
Vom Bund über den Kanton auf die Fläche:
 Seminar Waldnaturschutz Herausforderungen für den Berufstand der Förster, Freising, 22. Januar 2016 Vom Bund über den Kanton auf die Fläche: Umsetzung des Bundeskonzepts «Biodiversität im Wald» im Kanton
Seminar Waldnaturschutz Herausforderungen für den Berufstand der Förster, Freising, 22. Januar 2016 Vom Bund über den Kanton auf die Fläche: Umsetzung des Bundeskonzepts «Biodiversität im Wald» im Kanton
Erfahrungen bei der Holzmobilisierung aus dem Privatwald in der Schweiz
 Erfahrungen bei der Holzmobilisierung aus dem Privatwald in der Schweiz Holzlogistik: Wege zum Markt informiert, organisiert, finanziert 13.4.2011, Schloss Hundisburg bei Magdeburg Walter Marti, dipl.
Erfahrungen bei der Holzmobilisierung aus dem Privatwald in der Schweiz Holzlogistik: Wege zum Markt informiert, organisiert, finanziert 13.4.2011, Schloss Hundisburg bei Magdeburg Walter Marti, dipl.
Synopse zum Bericht und Antrag des Regierungsrats betreffend Anpassung 16/2 des Richtplans vom 8. November 2016
 Baudirektion Amt für Raumplanung Kantonalplanung und Grundlagen Synopse zum Bericht und Antrag des Regierungsrats betreffend Anpassung 16/2 des Richtplans vom 8. November 2016 S 2 L7 E 11 Siedlungsbegrenzung:
Baudirektion Amt für Raumplanung Kantonalplanung und Grundlagen Synopse zum Bericht und Antrag des Regierungsrats betreffend Anpassung 16/2 des Richtplans vom 8. November 2016 S 2 L7 E 11 Siedlungsbegrenzung:
Gemeindeinformation 24. Oktober 2012
 Inhalt Was sind invasive Neobiota Gesetzliche Grundlagen 6 prioritäre Neophytenarten im Kanton SH Neophyten-WebGIS Fazit Zusätzliche Dokumente 2 Was sind invasive Neobiota? Invasiv: effiziente, schwer
Inhalt Was sind invasive Neobiota Gesetzliche Grundlagen 6 prioritäre Neophytenarten im Kanton SH Neophyten-WebGIS Fazit Zusätzliche Dokumente 2 Was sind invasive Neobiota? Invasiv: effiziente, schwer
Anhang g) Inventar der Trinkwasserfassungen als Grundlage regionaler Planung. Inhalt
 Anhang g) Inventar der Trinkwasserfassungen als Grundlage regionaler Planungen 22.04.2016 / S.1 Anhang g) Inventar der Trinkwasserfassungen als Grundlage regionaler Planung Ein Beitrag des Bundesamts für
Anhang g) Inventar der Trinkwasserfassungen als Grundlage regionaler Planungen 22.04.2016 / S.1 Anhang g) Inventar der Trinkwasserfassungen als Grundlage regionaler Planung Ein Beitrag des Bundesamts für
Waldvision 2030 Eine neue Sicht für den Wald der Bürgerinnen und Bürger
 Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft Waldvision 2030 Eine neue Sicht für den Wald der Bürgerinnen und Bürger Michael Duhr, Karin Müller 1 2 Warum eine Waldvision 2030? Vision ist die Kunst,
Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft Waldvision 2030 Eine neue Sicht für den Wald der Bürgerinnen und Bürger Michael Duhr, Karin Müller 1 2 Warum eine Waldvision 2030? Vision ist die Kunst,
Verordnung über das Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz
 Verordnung über das Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (VIVS) vom 14. April 2010 Der Schweizerische Bundesrat, gestützt auf die Artikel 5 Absatz 1 und 26 des Bundesgesetzes vom 1.
Verordnung über das Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (VIVS) vom 14. April 2010 Der Schweizerische Bundesrat, gestützt auf die Artikel 5 Absatz 1 und 26 des Bundesgesetzes vom 1.
Vorarlberger Schutzwaldpreis 2019 Ausschreibung
 Vorarlberger Schutzwaldpreis 2019 Ausschreibung http://www.vorarlberg.at/forstwesen Allgemeines Vorarlberg hat einen sehr hohen Schutzwaldanteil: Rund 49.000 Hektar, fast die Hälfte des gesamten Waldbestandes,
Vorarlberger Schutzwaldpreis 2019 Ausschreibung http://www.vorarlberg.at/forstwesen Allgemeines Vorarlberg hat einen sehr hohen Schutzwaldanteil: Rund 49.000 Hektar, fast die Hälfte des gesamten Waldbestandes,
Nr. 710 Natur- und Landschaftsschutzverordnung * (NLV) vom 4. Juni 1991 (Stand 1. Januar 2017)
 Nr. 70 Natur- und Landschaftsschutzverordnung * (NLV) vom 4. Juni 99 (Stand. Januar 07) Der Regierungsrat des Kantons Luzern, gestützt auf 55 des Gesetzes über den Natur- und Landschaftsschutz vom 8. September
Nr. 70 Natur- und Landschaftsschutzverordnung * (NLV) vom 4. Juni 99 (Stand. Januar 07) Der Regierungsrat des Kantons Luzern, gestützt auf 55 des Gesetzes über den Natur- und Landschaftsschutz vom 8. September
Synopse zum Bericht und Antrag der Kommission für Raumplanung und Umwelt betreffend Anpassung 16/2 des Richtplans vom 20.
 Baudirektion Amt für Raumplanung Kantonalplanung und Grundlagen Synopse zum Bericht und Antrag der Kommission für Raumplanung und Umwelt betreffend Anpassung 1/2 des Richtplans vom 20. März 2017 S 2 L
Baudirektion Amt für Raumplanung Kantonalplanung und Grundlagen Synopse zum Bericht und Antrag der Kommission für Raumplanung und Umwelt betreffend Anpassung 1/2 des Richtplans vom 20. März 2017 S 2 L
Amt für Wald und Naturgefahren Fachbereich Naturgefahren
 Umweltdepartement Amt für Wald und Naturgefahren Fachbereich Naturgefahren Bahnhofstrasse 20 Postfach 1184 6431 Schwyz Telefon 041 819 18 35 Telefax 041 819 18 39 Naturgefahrenkarten: Das Wesentliche in
Umweltdepartement Amt für Wald und Naturgefahren Fachbereich Naturgefahren Bahnhofstrasse 20 Postfach 1184 6431 Schwyz Telefon 041 819 18 35 Telefax 041 819 18 39 Naturgefahrenkarten: Das Wesentliche in
Naturgefahren im Kanton Bern
 Naturgefahren im Kanton Bern Eine Analyse der gefährdeten Gebiete und Schadenpotenziale sowie der daraus abgeleiteten Risiken Auf Basis der integralen Gefahrenkarten Arbeitsgruppe Naturgefahren Interlaken,
Naturgefahren im Kanton Bern Eine Analyse der gefährdeten Gebiete und Schadenpotenziale sowie der daraus abgeleiteten Risiken Auf Basis der integralen Gefahrenkarten Arbeitsgruppe Naturgefahren Interlaken,
Nr. 710 Natur- und Landschaftsschutzverordnung. vom 4. Juni 1991* (Stand 1. Januar 2008)
 Nr. 70 Natur- und Landschaftsschutzverordnung vom 4. Juni 99* (Stand. Januar 008) Der Regierungsrat des Kantons Luzern, gestützt auf 55 des Gesetzes über den Natur- und Landschaftsschutz vom 8. September
Nr. 70 Natur- und Landschaftsschutzverordnung vom 4. Juni 99* (Stand. Januar 008) Der Regierungsrat des Kantons Luzern, gestützt auf 55 des Gesetzes über den Natur- und Landschaftsschutz vom 8. September
Leben mit Naturrisiken Integrales Risikomanagement als Schlüssel zum Erfolg
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Gefahrenprävention Leben mit Naturrisiken Integrales Risikomanagement als Schlüssel zum
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Abteilung Gefahrenprävention Leben mit Naturrisiken Integrales Risikomanagement als Schlüssel zum
Anträge auf Abschluss von Programmvereinbarungen und Verträgen zwischen dem Bundesamt für Umwelt BAFU und dem Kanton Freiburg
 Anträge auf Abschluss von Programmvereinbarungen und Verträgen zwischen dem Bundesamt für Umwelt BAFU und dem Kanton Freiburg (Art. 19 Abs. 3 Subventionsgesetz vom 5. Okt. 1990, SuG, SR 616.1) Bereich:
Anträge auf Abschluss von Programmvereinbarungen und Verträgen zwischen dem Bundesamt für Umwelt BAFU und dem Kanton Freiburg (Art. 19 Abs. 3 Subventionsgesetz vom 5. Okt. 1990, SuG, SR 616.1) Bereich:
Ziele des Bundes bei der. Gefahrenprävention
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Gefahrenprävention Ziele des Bundes bei der Gefahrenprävention Medienkonferenz SVV, Luzern - 22.
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Gefahrenprävention Ziele des Bundes bei der Gefahrenprävention Medienkonferenz SVV, Luzern - 22.
Interview Leitfaden StartClim.2015
 Interview Leitfaden StartClim.2015 Ziel des Interviews ist es, (a) allgemeine Information bezüglich Ihrer Einschätzung zu Schutzwald und Klimawandel in Ihrem Aufgabenbereich zu erhalten, und (b) Meinung
Interview Leitfaden StartClim.2015 Ziel des Interviews ist es, (a) allgemeine Information bezüglich Ihrer Einschätzung zu Schutzwald und Klimawandel in Ihrem Aufgabenbereich zu erhalten, und (b) Meinung
Einführung in raumrelevante
 Einführung in raumrelevante 1 Forstliche Raumplanung Einleitung Instrumente Waldentwicklungsplan Waldfachplan Gefahrenzonenplan 2 1 Waldland Österreich 281.000 Arbeitsplätze Schutzfunktion Tourismusfaktor
Einführung in raumrelevante 1 Forstliche Raumplanung Einleitung Instrumente Waldentwicklungsplan Waldfachplan Gefahrenzonenplan 2 1 Waldland Österreich 281.000 Arbeitsplätze Schutzfunktion Tourismusfaktor
Methodische Fallsteuerung
 Methodische Fallsteuerung 1 Methodisches Fallsteuerungsmodell: Ressourcen und Kooperation 2 Zielsetzung der methodischen Fallsteuerung 2 Hauptziele: Sozialarbeiterische Leistungen werden bedarfsgerecht
Methodische Fallsteuerung 1 Methodisches Fallsteuerungsmodell: Ressourcen und Kooperation 2 Zielsetzung der methodischen Fallsteuerung 2 Hauptziele: Sozialarbeiterische Leistungen werden bedarfsgerecht
Ökologie der Waldbewirtschaftung
 Ökologie der Waldbewirtschaftung Grundlage für erfolgreiche Wirtschaft Johann Zöscher Forstliche Ausbildungsstätte Ossiach des BFW Leiter Organisation des BFW Standorte Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum
Ökologie der Waldbewirtschaftung Grundlage für erfolgreiche Wirtschaft Johann Zöscher Forstliche Ausbildungsstätte Ossiach des BFW Leiter Organisation des BFW Standorte Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum
Der Wald Ihr Naherholungsgebiet
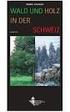 Der Wald Ihr Naherholungsgebiet Informationen über Nutzung und Pflege. Liebe Waldgeniesser Sie kennen und schätzen den Wald als Ort der Kraft, der Ruhe und natürlichen Stille. Manchmal wird diese Stille
Der Wald Ihr Naherholungsgebiet Informationen über Nutzung und Pflege. Liebe Waldgeniesser Sie kennen und schätzen den Wald als Ort der Kraft, der Ruhe und natürlichen Stille. Manchmal wird diese Stille
Forstorganisation im Kanton Solothurn
 Wald und Waldbewirtschaftung Forstorganisation im Kanton Solothurn Jürg Froelicher 29. April 2014 Feierabendveranstaltung BWSo 1 Forstorganisation im Kanton Solothurn Inhalt: Gesetzliche Grundlagen - Bund
Wald und Waldbewirtschaftung Forstorganisation im Kanton Solothurn Jürg Froelicher 29. April 2014 Feierabendveranstaltung BWSo 1 Forstorganisation im Kanton Solothurn Inhalt: Gesetzliche Grundlagen - Bund
Leitfaden der Schule Oberlunkhofen zum Umgang mit Beschwerden
 Leitfaden der Schule Oberlunkhofen zum Umgang mit Beschwerden Zum konstruktiven Umgang mit Beschwerden von nen, Eltern und Lehrpersonen 1 Wir arbeiten zielorientiert, evaluieren unsere Tätigkeit und leiten
Leitfaden der Schule Oberlunkhofen zum Umgang mit Beschwerden Zum konstruktiven Umgang mit Beschwerden von nen, Eltern und Lehrpersonen 1 Wir arbeiten zielorientiert, evaluieren unsere Tätigkeit und leiten
Verhältnis 1/3. Kantonaler Nachhaltigkeitsbericht Wald. Stand der Waldentwicklung und Prognosen. Amt für Wald und Wild.
 Direktion des Innern Amt für Wald und Wild Kantonaler Nachhaltigkeitsbericht Wald Verhältnis 1/3 Stand der Waldentwicklung und Prognosen Amt für Wald und Wild November 217 Aegeristrasse 56, 63 Zug T 41
Direktion des Innern Amt für Wald und Wild Kantonaler Nachhaltigkeitsbericht Wald Verhältnis 1/3 Stand der Waldentwicklung und Prognosen Amt für Wald und Wild November 217 Aegeristrasse 56, 63 Zug T 41
Zukunftswald. Umsetzung in den Bayerischen Staatsforsten. Florian Vogel Klimakongress 14. Juli 2016, Würzburg
 Zukunftswald Umsetzung in den Bayerischen Staatsforsten Florian Vogel Klimakongress 14. Juli 2016, Würzburg Vivian/Wiebke, Lothar, Kyrill, Niklas. Hochwasser, Feuer Eugen Lehle/www.wikipedia.org BaySF
Zukunftswald Umsetzung in den Bayerischen Staatsforsten Florian Vogel Klimakongress 14. Juli 2016, Würzburg Vivian/Wiebke, Lothar, Kyrill, Niklas. Hochwasser, Feuer Eugen Lehle/www.wikipedia.org BaySF
Erfahrungsbericht Greifensee - Praxis-Bericht zum Umgang mit Kreuzkra utern und Neophyten
 Erfahrungsbericht Greifensee - Praxis-Bericht zum Umgang mit Kreuzkra utern und Neophyten Lothar Schroeder und Thomas Winter Stiftung Wirtschaft und Ökologie SWO, Schweiz 40-jährige Praxiserfahrung mit
Erfahrungsbericht Greifensee - Praxis-Bericht zum Umgang mit Kreuzkra utern und Neophyten Lothar Schroeder und Thomas Winter Stiftung Wirtschaft und Ökologie SWO, Schweiz 40-jährige Praxiserfahrung mit
ArgeAlp Ökonomie und Ökologie im Schutzwald
 ArgeAlp Ökonomie und Ökologie im Schutzwald Bemerkungen zur Eingriffsstärke im Gebirgs- und Schutzwald 16.01.2014 Raphael Schwitter Fachstelle für Gebirgswaldpflege ibw-bildungszentrum Wald CH-7304 Maienfeld
ArgeAlp Ökonomie und Ökologie im Schutzwald Bemerkungen zur Eingriffsstärke im Gebirgs- und Schutzwald 16.01.2014 Raphael Schwitter Fachstelle für Gebirgswaldpflege ibw-bildungszentrum Wald CH-7304 Maienfeld
Lernthema 12: Reflexion Berufsfachschule (BFS)
 Lernthema 12: Reflexion Berufsfachschule (BFS) LT 12: Gleis- und Weichenkontrollen durchführen Nach jedem Fachkurs schätzen Sie sich bezüglich der behandelten Leistungsziele zur Gleis- und Weichenkontrolle
Lernthema 12: Reflexion Berufsfachschule (BFS) LT 12: Gleis- und Weichenkontrollen durchführen Nach jedem Fachkurs schätzen Sie sich bezüglich der behandelten Leistungsziele zur Gleis- und Weichenkontrolle
Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer
 Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Renaturierung) Vorentwurf Änderung vom... Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, nach Einsicht in den Bericht der Kommission für Umwelt,
Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Renaturierung) Vorentwurf Änderung vom... Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, nach Einsicht in den Bericht der Kommission für Umwelt,
Schutzwaldausweisung Hinweise aus der Standortskunde
 Schutzwaldausweisung Hinweise aus der Standortskunde Schutzwaldausweisung & Standortskunde Alois Simon, Abt. Forstplanung 1 Einführung Schutzwald? Schutzwaldausweisung & Standortskunde Alois Simon, Abt.
Schutzwaldausweisung Hinweise aus der Standortskunde Schutzwaldausweisung & Standortskunde Alois Simon, Abt. Forstplanung 1 Einführung Schutzwald? Schutzwaldausweisung & Standortskunde Alois Simon, Abt.
Lärmschutz-Verordnung des Kantons Solothurn (LSV-SO)
 Lärmschutz-Verordnung des Kantons Solothurn (LSV-SO) 8.6 RRB vom. Dezember 987 Der Regierungsrat des Kantons Solothurn gestützt auf Artikel 6 des Bundesgesetzes über den Umweltschutz (USG) vom 7. Oktober
Lärmschutz-Verordnung des Kantons Solothurn (LSV-SO) 8.6 RRB vom. Dezember 987 Der Regierungsrat des Kantons Solothurn gestützt auf Artikel 6 des Bundesgesetzes über den Umweltschutz (USG) vom 7. Oktober
Melde- und bewilligungspflichtige Veranstaltungen gemäss Waldgesetz - Merkblatt Schutzgebiete im Geoportal
 Kanton St.Gallen Volkswirtschaftsdepartement Kantonsforstamt St.Gallen, November 2014 Melde- und bewilligungspflichtige Veranstaltungen gemäss Waldgesetz - Merkblatt Schutzgebiete im Geoportal Die Melde-
Kanton St.Gallen Volkswirtschaftsdepartement Kantonsforstamt St.Gallen, November 2014 Melde- und bewilligungspflichtige Veranstaltungen gemäss Waldgesetz - Merkblatt Schutzgebiete im Geoportal Die Melde-
Wald in Schutzgebieten ein Überblick
 Heino Polley / Landbauforschung - vti Agriculture and Forestry Research Sonderheft 327 2009: 75-82 75 Wald in Schutzgebieten ein Überblick von Heino Polley 1 1 Einleitung Wie viel Naturschutz braucht der
Heino Polley / Landbauforschung - vti Agriculture and Forestry Research Sonderheft 327 2009: 75-82 75 Wald in Schutzgebieten ein Überblick von Heino Polley 1 1 Einleitung Wie viel Naturschutz braucht der
Strategie Invasive gebietsfremde Arten : Umsetzung und konkrete Massnahmen
 Strategie Invasive gebietsfremde Arten : Umsetzung und konkrete Massnahmen Sibyl Rometsch, Info Flora 3. Naturschutz-Kafi Münsigen, 15.02.2013 Inhalt Kurze Präsentation der Stiftung Info Flora Invasive
Strategie Invasive gebietsfremde Arten : Umsetzung und konkrete Massnahmen Sibyl Rometsch, Info Flora 3. Naturschutz-Kafi Münsigen, 15.02.2013 Inhalt Kurze Präsentation der Stiftung Info Flora Invasive
Auf dem Weg zum Erfolg
 12. Waldökonomisches Seminar, 7. und 8. November 2016, Schloss Münchenwiler Block II : Organisatorische Antworten auf politisch ökonomische Anforderungen Die Walliser Forstorganisation Auf dem Weg zum
12. Waldökonomisches Seminar, 7. und 8. November 2016, Schloss Münchenwiler Block II : Organisatorische Antworten auf politisch ökonomische Anforderungen Die Walliser Forstorganisation Auf dem Weg zum
Erfolgreiche Forstbetriebe gestern heute morgen
 DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT Erfolgreiche Forstbetriebe gestern heute morgen 26. Januar 2018 Inhalt Einleitung Gestern: Strukturwandel bis 2018 Heute: Forstreviere im Jahr 2018 Morgen: Erfolgreiche
DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT Erfolgreiche Forstbetriebe gestern heute morgen 26. Januar 2018 Inhalt Einleitung Gestern: Strukturwandel bis 2018 Heute: Forstreviere im Jahr 2018 Morgen: Erfolgreiche
