Indizierte Prävention schizophrener Erkrankungen Joachim Klosterkötter
|
|
|
- Richard Geier
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 ÜBERSICHTSARBEIT Indizierte Prävention schizophrener Erkrankungen Joachim Klosterkötter ZUSAMMENFASSUNG Einleitung: Schizophrene Störungen gehören auch unter den heutigen verbesserten Behandlungsbedingungen immer noch zu den das Leben am meisten belastenden Erkrankungen. Deshalb bemüht man sich in neu entstandenen Früherkennungszentren inzwischen weltweit um die Entwicklung und Überprüfung von geeigneten Präventionsstrategien. Methoden: Der Beitrag gibt eine selektive Literaturübersicht zu den bislang geschaffenen Möglichkeiten der Abschätzung des individuellen Erkrankungsrisikos und der Verhinderung drohender Ersterkrankungen. Ergebnisse: Die heute bekannten neurobiologischen und psychosozialen Risikofaktoren besitzen noch keine Vorhersagekraft, die für selektive Präventionsmaßnahmen bei noch symptomfreien Dispositionsträgern ausreichend wäre. Sobald jedoch im 5-jährigen initialen Prodrom zunächst psychoseferne kognitive Risiko- und später psychosenahe Hochrisikosymptome hinzutreten, kann der bevorstehende Erkrankungsausbruch mit hoher Treffsicherheit vorhergesagt und einer differenziellen Strategie der indizierten Prävention mit kognitiver Verhaltenstherapie, atypischen Antipsychotika in Niedrigdosierung sowie neuroprotektiven Substanzen zugänglich gemacht werden. Diskussion: Der derzeitige Entwicklungsstand dieser innovativen Forschungsrichtung lässt erwarten, dass in absehbarer Zeit allen Rat- und Hilfesuchenden mit Frühwarnzeichen ein auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes Präventionsangebot unterbreitet werden kann. Dtsch Arztebl 2008; 105(30): DOI: /arztebl Schlüsselwörter: Schizophrenie, Risikofaktor, Frühverlauf, Risikosymptom, indizierte Prävention Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Universität zu Köln, Früherkennungsund Therapiezentrum für psychische Krisen (FETZ) an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Universität zu Köln: Prof. Dr. med. Klosterkötter A ls das Medizinische Institut in Washington Mitte der 1990er Jahre im Auftrag des Kongresses der Vereinigten Staaten von Amerika erstmals damit begann, systematisch Empfehlungen für die Prävention psychischer Erkrankungen auszuarbeiten, wurden dabei drei Ansätze zur Absenkung der Neuerkrankungsrate voneinander unterschieden (1). Der universale Ansatz bezieht sich auf die Bevölkerung insgesamt (2), der selektive auf Gesunde mit erhöhtem Erkrankungsrisiko und der indizierte auf Personen, die auch schon behandlungsbedürftige Risikosymptome ( at-risk-mental-states ; ARMS) bieten (3) (Grafik 1). Beispiele für die drei Ansätze aus der Körpermedizin, etwa Reihenimpfungen (universal), präventive Medikationen bei erhöhtem Infarktrisiko (selektiv) oder chirurgische Interventionen bei präkanzerösen Symptomen (indiziert), sind jedem Arzt vertraut. Zur Verhinderung psychischer Erkrankungen könnten dementsprechend etwa multimodale Schulprogramme (universal), psychotherapeutische Interventionen nach psychischer Traumatisierung (selektiv) oder Demenz-präventive Medikationen bei milder kognitiver Störung (indiziert) zum Einsatz kommen. Der vorliegende Beitrag knüpft an den ersten WHO-Bericht zur Prävention mentaler Störungen (4) an und gibt eine selektive Literaturübersicht speziell zu dem Entwicklungsstand, der bei den Bemühungen um eine Inzidenzreduktion schizophrener Erkrankungen inzwischen erreicht worden ist. Epidemiologie Schizophrene Störungen sind mit 15 bis 20 Neuerkrankungen auf Einwohner pro Jahr (jährliche Inzidenz 0,01 bis 0,02 %) und mindestens einmaliger Erkrankung im Leben bei bis Bundesbürgern (Lebenszeitprävalenz 0,5 bis 1 %) keine sehr häufigen Erkrankungen. Gleichwohl gehören sie zu den das Leben der Betroffenen und ihrer Bezugspersonen am meisten belastenden Krankheiten und sind hinsichtlich der global burden of disease durchaus mit großen Volksleiden wie Schlaganfall oder Diabetes mellitus zu vergleichen (5). Das hängt mit dem frühen Ersterkrankungsalter zwischen dem 18. und 35. Lebensjahr sowie dem auch heute oft noch ungünstigen Langzeitverlauf zusammen. Die vorrangig für die Diagnosestellung verwandten Wahnphänomene, Ich-Erlebnis-Störungen und akustischen Halluzinationen treten zwar oft Deutsches Ärzteblatt PP Heft 8 August
2 GRAFIK 1 Förderung der psychischen Gesundheit (nach Mrazek & Haggerty 1994): Universale Prävention: Angebote an die Bevölkerung zum Beispiel Schwangerschafts- und Geburtsvorsorge oder multimodale Schulprogramme. Selektive Prävention: Angebote an Personen mit Risikofaktoren zum Beispiel Interventionen nach psychischer Traumatisierung, Frühförderprogramme, Angebote an Kinder von psychisch Kranken. Indizierte Prävention: Angebote an Personen mit Risikosymptomen zum Beispiel Interventionen bei subklinischen Angst- oder Depressionssymptomen, Demenz-präventive Medikationen bei milder kognitiver Störung. hochdramatisch, beängstigend und gefahrvoll in Erscheinung, bilden sich dann aber im meist episodischen Verlauf dieser psychotischen Positivsymptomatik in der Regel auch wieder zurück. Dagegen besteht eine heute als Negativsymptomatik bezeichnete Verarmung des Denkens, Fühlens, Handelns und der sozialen Kontaktfähigkeit häufig dauerhaft fort und führt zur psychosozialen Behinderung mit Erwerbsunfähigkeit schon in jungen Jahren. Wenn man die daraus resultierenden volkswirtschaftlichen Verluste noch zu den direkten Kosten der medizinischen und psychosozialen Versorgung addiert, ergibt sich für die schizophrenen Störungen eine dementsprechend hohe finanzielle Gesamtbelastung der Solidargemeinschaft von etwa 10 Milliarden Euro in der BRD pro Jahr (6). Ätiopathogenese In der Ursachenforschung beginnt sich die Schizophrenie mehr und mehr als eine komplexe Störung mit polygenem Erbgang und starker pathogener Prägung durch Gen-Gen- sowie Gen-Umwelt-Interaktionen herauszustellen. Mittlerweile konnten genetische Assoziationen zu verschiedenen Varianten in den Genen für Dysbindin und Neuregulin-1 sowie des Genorts G 72 und dem mit diesem Genort interagierenden Gen für DAOA (D-Aminosäure-Oxidase-Aktivator) mehrfach bestätigt werden (Grafik 2). Bei einer komplexen Störung lässt sich diesen ersten Genbefunden allerdings keine kausale, sondern nur eine dispositionelle, das Erkrankungsrisiko modulierende Bedeutung zuschreiben. Außerdem sind sie noch als vorläufig zu betrachten und dürften auch, wenn tatsächlich direkt pathogen wirkende Genvarianten identifiziert werden, vorerst nur einen sehr kleinen Ausschnitt einer dispositionellen Grundlage repräsentieren, die zahlreiche weitere, heute noch unbekannte Gene mit einschließt. Gleichwohl ist dieser erste molekular-neurogenetische Einblick schon sehr aufschlussreich, weil die gefundenen Kandidatengene Proteine von der Hirnentwicklung bis hin zur Aufrechterhaltung der glutamatergen Synapse im reifen Gehirn kodieren, also neuronale Proliferation, Migration, terminale Differenzierung und synaptische Funktionen regulieren. Diese funktionelle Relevanz passt gut zu der übrigen mit neuropathologischen Untersuchungsmethoden, Läsions-Tiermodellen, funktioneller und struktureller Hirnbildgebung erarbeiteten Befundlage, die insgesamt heute am ehesten für eine Störung plastischer Prozesse der Hirnentwicklung mit dem Ergebnis von Diskonnektionen in einem Netzwerk kortikaler und subkortikaler Zentren spricht (7). Risikofaktoren und Frühverlauf In Grafik 2 sind zusätzlich die bislang gesicherten umweltbedingten Risikofaktoren mit aufgeführt, die bereits früh vor oder unmittelbar nach der Geburt sowie später während der weiteren Entwicklung in Kindheit und Jugend gegeben sein können. Sie erhöhen allerdings nach dem derzeitigen Kenntnisstand die lebenslange Erkrankungswahrscheinlichkeit jeder für sich genommen nur bis zu höchstens 4 Prozent. Ohne Kenntnis der kompletten dispositionellen Grundlage und der wahrscheinlich zahlreichen Gen-Gen- und Gen-Umwelt-Interaktionen lassen sich somit die bisher erfassten Risikofaktoren einzeln und auch in ihrer Gesamtheit noch nicht für Früherkennung und Prävention nutzen. Dazu bedarf es vielmehr der zusätzlichen Berücksichtigung des Frühverlaufs, in dem sich die pathophysiologisch wirksame Hirnentwicklungsstörung über frühe Verhaltensauffälligkeiten hinaus je nach der individuell gegebenen Konstellation von Stressoren und protektiven Faktoren etwa ab dem 16. Lebensjahr auch in definierbaren Risiko- und Hochrisikosymptomen bemerkbar zu machen beginnt. Die Erst-Episoden-Forschung hat gezeigt, dass dem Ausbruch der Erkrankung in drei Viertel aller Fälle ein durchschnittlich fünf Jahre langes initiales Prodrom vorausgeht. Auch in hoch entwickelten Gesundheitssystemen verstreicht dann nach der erstmaligen Manifestation der diagnoserelevanten psychotischen Positivsymptomatik noch einmal durchschnittlich mehr als ein Jahr, bis eine adäquate Behandlung beginnt. Die Zeitdauer, über die eine erste psychotische Episo- 364 Deutsches Ärzteblatt PP Heft 8 August 2008
3 GRAFIK 2 Indikatoren für ein erhöhtes Schizophrenierisiko. de unbehandelt bleibt ( duration of untreated psychosis ; DUP), korreliert mit Verzögerter und unvollständiger Remission der Symptomatik Längerer stationärer Behandlungsbedürftigkeit und höherem Rückfallrisiko Geringerer Compliance, höherer Belastung der Familie und höherem expressed-emotion -Niveau Erhöhtem Depressions- und Suizidrisiko Größerer Belastung der Arbeits- und Ausbildungssituation Erhöhtem Substanzmissbrauch und delinquentem Verhalten sowie Deutlich höheren Behandlungskosten (8). Präventionsprogrammatik Diese inzwischen auch durch eine aussagekräftige Metaanalyse (9) abgesicherten Zusammenhänge mit Korrelationskoeffizienten von 0,285 bis 0,434 (95-%- Konfidenzintervall [KI]) haben nicht nur starke Argumente für eine möglichst frühe Behandlung der ersten psychotischen Episode geliefert, sondern auch zur Gründung spezialisierter Früherkennungs- und Frühbehandlungszentren, zuerst in Melbourne, Australien, und in Köln sowie in der Folge auch an zahlreichen weiteren Standorten international und in Deutschland geführt. Immerhin gab es Hinweise dafür, dass auch die initialen Prodromalsymptome die Betroffenen und ihre Bezugspersonen schon schwer belasten und Hilfe suchen lassen, es auch im initialen Prodrom schon zu einem massiven Einbruch der psychosozialen Leistungsfähigkeit kommen kann und parallel dazu möglicherweise zerebrale pathophysiologische Veränderungen bis hin zum vollen Ausbruch der Erkrankung fortschreiten. Vor diesem Hintergrund wurden für die von allen Zentren mit ihren Informationskampagnen in der Öffentlichkeit und ihren Angeboten zur individuellen Risikoabschätzung bedarfsgerecht angestrebten indizierten Prävention die drei folgenden Zielsetzungen formuliert: Verbesserung der aktuell belastenden Prodromalsymptomatik Vermeidung oder doch Verzögerung sich abzeichnender psychosozialer Behinderung und vor allem Verhinderung oder zumindest doch Verzögerung und Abschwächung drohender psychotischer Ersterkrankungen (10). Erkrankungsvorhersage mit frühen Risikokriterien In den beiden bisher wichtigsten Studien zum Frühverlauf vor der psychotischen Erstmanifestation, einer retrospektiven mit optimierter Methodik (11) und einer längerfristigen prospektiven über knapp 10 Jahre (12), hat sich herausgestellt, dass die frühesten und häufigsten, im initialen Prodrom insgesamt dominierenden Symptombildungen uncharakteristisch und insbesondere von den Stimmungs-, Antriebs-, Kontakt- und Konzentrationsbeeinträchtigungen bei depressiven Episoden nicht unterscheidbar sind. Es fielen dann aber auch kognitive Beeinträchtigungen in Form von selbst erlebten Denk-, Sprach- und Wahrnehmungsstörungen auf, die ebenfalls noch bei mehr als einem Viertel der Betroffenen vorkamen, Spezifitäten von 0,85 und höher sowie positive prädiktive Stärken von mindestens 0,70 besaßen und nur geringfügige falsch positive Vorhersageraten von unter 7,5 % boten. Hilfesuchende mit solchen, heute durch standardisierte Untersuchungsinstrumente zuverlässig erfassbaren Basissymptomen hatten in der auf 160 Personen bezogenen Initialstudie nach 12 Monaten zu 20 %, nach 24 Monaten zu weiteren 17 %, nach 36 Monaten zu weiteren 13 % und nach durchschnittlich 4,5 Jahren schließlich in 70 % der Fälle Deutsches Ärzteblatt PP Heft 8 August
4 Ansatzpunkte der indizierten Prävention. GRAFIK 3 eine schizophrene Störung entwickelt. In einer unabhängigen weiteren Stichprobe von 146 Risikopersonen, die alle mindestens eines dieser im Kasten angeführten prädiktiven Basissymptome boten, waren nach nur 12- monatiger Beobachtungsdauer dann schon 29,5 % der Betroffenen in eine Psychose geraten (13). Unter dem Eindruck dieser Befunde wurden die prädiktiven Basissymptome in mehreren Modifikationen als Kriteriensatz für die Risikoabschätzung in der nationalen und internationalen Psychose-Früherkennungsforschung etabliert. Insbesondere im Deutschen Kompetenznetz Schizophrenie (KNS) hat man sie dann auch im Sinne eines clinical staging zusammen mit dem aus dem Kasten zu ersehenden Funktionsverlust bei bestehenden Risikofaktoren für die Definition noch psychoseferner Prodromalstadien benutzt (Grafik 3). Erkrankungsvorhersage mit Hochrisikokriterien Interessanterweise kündigen sich auch schizophrenietypische Positivsymptome wie Wahnideen, Halluzinationen oder formale Denkstörungen gegen Ende des initialen Prodroms oft in zunächst noch abgeschwächter und dann auch voll ausgebildeter, jedoch noch flüchtiger Form schon an. Da zu erwarten war, dass sie eine vergleichsweise sichere Vorhersage besonders kurzfristig zu erwartender Übergänge in die psychotische Erstmanifestation zulassen würden, hat man sich solche Vorankündigungen als ultra-highrisk (UHR)-Kriterien zunutze gemacht (Grafik 3). Wenn diese UHR-Kriterien erfüllt sind, kann man nach inzwischen 11 diesbezüglich aussagekräftigen Früherkennungsstudien nationaler Arbeitsgruppen und internationaler Konsortien bei durchschnittlich knapp 40 % der Betroffenen bereits innerhalb der nächsten 12 Monate mit dem Ausbruch einer ersten psychotischen Episode rechnen (4, 8, 14). Da die Jahresinzidenz für alle Formen von Psychose in der Allgemeinbevölkerung nur etwa 0,034 % beträgt, bedeutet dies eine in der Tat sehr dramatische Steigerung des relativen Erkrankungsrisikos. Dementsprechend wurden die UHR-Kriterien auch in leicht veränderter Form in das KNS mit eingebracht und im Projektverbund Früherkennung und Frühintervention für die Definition psychosenaher Prodromalstadien benutzt (Kasten). Alle groß angelegten Aktivitäten der Psychosepräventionsforschung, die gerade abgeschlossene, im 5. Rahmenprogramm der Europäischen Kommission geförderte EPOS-Studie ( European Prediction of Psychosis ) (15), die derzeit anlaufende siebenzentrige Parallelgruppenstudie PRE- VENT im Sonderprogramm Klinische Studien der Deutschen Forschungsgemeinschaft und die multinationale, in nordamerikanischen, europäischen und australischen Zentren geplante Prodrom-Interventionsstudie NEURAPRO (16), arbeiten inzwischen mit einem integrativen Kriteriensatz für die Risikoeinschätzung, der die im Kasten gezeigten Merkmale gemeinsam umfasst. 366 Deutsches Ärzteblatt PP Heft 8 August 2008
5 Differenzielle Präventionsstrategie Ob und inwieweit sich die drei oben genannten Zielsetzungen der indizierten Prävention erreichen lassen, hat man bisher international in fünf Interventionsstudien (17 22) herauszufinden versucht (Tabelle). Dabei kamen als präventive Maßnahmen zweimal neu entwickelte, auf die Bedürfnisse der Risikopersonen zugeschnittene, kognitiv ausgerichtete verhaltenstherapeutische Programme (KVT) und dreimal atypische Antipsychotika, nämlich Risperidon, Olanzapin und Amisulprid, in der niedrigsten möglichen Dosierung zur Anwendung. Da es sich durchweg um randomisierte kontrollierte Studien handelte, könnte man für die nachgewiesenen Effekte dieser Maßnahmen eigentlich schon die Evidenz-Kategorie 1b in Anspruch nehmen (randomisierte Interventionsstudie). Bei den beiden KVT-Interventionen gab es jedoch Schwierigkeiten mit der Blindheitsbedingung und bei der Intervention mit Risperidon erhielt die Experimentalgruppe zugleich KVT, sodass sich keine eindeutige Differenzierung zwischen pharmakologischen und psychotherapeutischen Effekten vornehmen ließ. Solche und andere methodologische Unzulänglichkeiten schränken die Aussagekraft vorläufig noch ein und haben die auf diesem Forschungsgebiet tätigen Arbeitsgruppen dazu veranlasst, neue optimierte Interventionsstudien aufzulegen und beispielsweise in dem anlaufenden Großprojekt PREVENT sorgfältige Vergleichsanalysen sowie Unter- und Überlegenheitsprüfungen hinsichtlich der psychologischen und pharmakologischen Präventionsangebote durchzuführen. Das Staging zwischen unterschiedlichen Risikostufen und wahrscheinlich auch unterschiedlicher Nähe zur psychotischen Erstmanifestation (Grafik 3) wurde vor allem in den beiden deutschen innerhalb des KNS durchgeführten Interventionsstudien beachtet, von denen sich die eine auf psychoseferne Prodromalstadien bezog und nur KVT als Präventionsmaßnahme anbot (20, 21), während die andere auf psychosenahe Prodromalstadien ausgerichtet war und nur auf dieser hohen fortgeschrittenen Risikostufe das Antipsychotikum Amisulprid präventiv einsetzte (20, 22). Diese, inzwischen in deutschen Früherkennungszentren durchgängig verfolgte differenzielle Präventionsstrategie, beginnt sich aber inzwischen auch international durchzusetzen. So soll beispielsweise in NEURA- PRO ein Antipsychotikum, hier das Quetiapin, erst dann zum Einsatz kommen, wenn zuvor bei milderer Risikosymptomatik wirksame Interventionsstrategien, hier mit neuroprotektivem Fischöl (14, 23), ohne Präventionseffekt blieben. KASTEN Frühe Risikokriterien und Hochrisikokriterien Frühe Risikokriterien* 1 psychosefernes Prodrom: 1.) Prädiktive Basissymptome (mindestens eines während der letzten drei Monate mehrmals wöchentlich) Gedankeninterferenzen, -drängen, -jagen, -blockierung Zwangähnliches Perseverieren Störung der rezeptiven Sprache (Verständnis von Gehörtem und Gelesenem) Störung der Diskrimination von Vorstellung und Wahrnehmungen Eigenbeziehungstendenz Derealisation Optische Wahrnehmungsstörungen Akustische Wahrnehmungsstörungen oder 2.) Deutlicher Einbruch im Leistungs- und Funktionsniveau bei vorbestehendem Risiko Reduktion des Global Assessment of Functioning Scores (nach DSM IV) um mindestens 30 Punkte über mindestens einen Monat und Mindestens einer der folgenden Risikofaktoren: Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis bei Blutsverwandten 1. Grades oder Geburtskomplikationen beim Betroffenen Hochrisikokriterien* 1 psychosenahes Prodrom: 1.) Attenuierte psychotische Symptome (APS) (Vorliegen von mindestens einem der folgenden Symptome und mehrfaches Auftreten über einen Zeitraum von mindestens einer Woche) Beziehungsideen Eigentümliche Vorstellungen oder magisches Denken Ungewöhnliche Wahrnehmungserlebnisse Eigenartige Denk- und Sprechweise Paranoide Ideen oder 2.) Transiente psychotische Symptome ( brief limited intermittent psychotic symptoms ; BLIPS) (Dauer der BLIPS weniger als sieben Tage und nicht häufiger als zwei Mal pro Woche in einem Monat, spontane Remission, mindestens eines der folgenden Symptome) Halluzinationen (PANSS* 2 P3 4) Wahn (PANSS* 2 P1, P5 oder P6 4) Formale Denkstörungen (PANSS* 2 P2 4) * 1 Erfassung mit reliablen und validen Früherkennungsinstrumenten; * 2 PANSS, Positive and Negative Syndrome Scale Ethische Fragen In den neu entstandenen Früherkennungszentren werden ethische und rechtliche Fragen weltweit sehr ernst genommen und in jedem Einzelfall mit Blick auf die konkrete Lebenssituation der Betroffenen und ihrer Bezugspersonen durch geregelte Beratungs- und Entscheidungsverfahren zu beantworten versucht. Dem Problem einer möglicherweise zusätzlichen psychischen Belastung durch das Ergebnis der Risikoabschätzung begegnet man durch eine vollständige Vermeidung des Schizophreniebegriffs, solange er nicht im Erfahrungsfeld der Betroffenen schon im Raum steht und dann in zugleich sachlicher und beruhigender Weise zu erläutern ist. Stattdessen wird immer von den Beschwerden der Rat- und Hilfesuchenden ausgegangen und bei Erfüllung der Risikokriterien davon gesprochen, dass hieraus eine Psychose ( early psychosis ) Deutsches Ärzteblatt PP Heft 8 August
6 TABELLE Prospektive, randomisierte, kontrollierte Präventionsstudien bei Personen mit erhöhtem Psychoserisiko Studie Einschlusskriterien: Übergangs- Stich- Design Experimental- Kontroll- Katamnese Ergebnisse Frühe Risiko- und kriterien probe bedingung bedingung (seit Hochrisikokriterien (n) Einschluss) McGorry APS* 1 Mehr als eine 59 Randomisierte, 6 Monate Einzel-KVT 6 Monate 12 Monate Verbesserung der Symptome et al. (17) und/oder Woche durch- kontrollierte, und Risperidon supportive und der sozialen Anpassung BLIPS* 2 gehend Positiv- nicht geblindete (durchschnittliche psycho- in beiden Bedingungen; und/oder Symptomatik Studie Dosierung 1,3 mg/tag) soziale signifikante Reduktion der Reduktion des sozialen Intervention Übergangsrate in Exp.- Funktionsniveaus Bedingung nach 6 Monaten und Verwandte Ersten bei Intention-to-treat- Grades mit Schizophrenie Analyse (6 Monate: oder Indexperson hat Exp.: 10 % vs. Kontr.: 36 %; Diagnose schizotype p = 0,026; 12 Monate: Exp.: Persönlichkeitsstörung 20 % vs. Kontr.: 36 %; p = 0,24) und nach 12 Monaten bei per-protokoll- Analyse (Exp.: 7 % vs. Kontr.: 36 %; p = 0,017) (NNT = 4) Morrison APS* 1 Mehr als eine 58 Randomisierte, 6 Monate 6 Monate 12 Monate Signifikante Verbesserung et al. (18) und/oder Woche durch- kontrollierte Einzel-KVT Monitoring der Positiv-Symptomatik BLIPS* 2 gehend Positiv- Studie in der KVT; und/oder Symptomatik Bedingung verglichen mit Reduktion des sozialen Monitoring; Verbesserung Funktionsniveaus der sozialen Anpassung in und Verwandte Ersten beiden Bedingungen; Grades mit Schizophrenie signifikante Reduktion der oder Indexperson hat Übergangsrate nach Diagnose schizotype 12 Monaten (Exp.: 6 % Persönlichkeitsstörung vs. Kontr.: 22 %; p = 0,028) McGlashan APS (modifiziert)* 1 4 Wochen 60 Randomisierte, 12 Monate 12 Monate 24 Monate 12-Monatsergebnisse: et al. (19) und/oder durchgehende placebo- Olanzapin Placebo, Verbesserung der Positiv-, BLIPS (modifiziert)* 2 Positiv- kontrollierte, (5 15 mg/tag), supportiv- Negativ- und Allgemeinund/oder Symptomatik, doppel-blinde supportiv-psycho- psycho- Psychopathologie signifikant Reduktion des sozialen desorgani- Studie edukative Einzel- und edukative größer in Olanzapin- als in Funktionsniveaus siertes oder Familienintervention Einzel- und Placebo-Gruppe; statistische und Verwandte Ersten selbst-/fremd- Familien- Tendenz bei Reduktion Grades mit Schizophrenie gefährdendes intervention der Übergangsrate nach oder Indexperson hat Verhalten 12 Monaten (Exp.: 16 % vs. Diagnose schizotype Kontr.: 38 %; p = 0,08); Persönlichkeitsstörung unerwünschte Wirkungen: Gewichtszunahme, Tachykardie Häfner Psychoseprädiktive APS* Randomisierte, 12 Monate Einzel-KVT, 12 Monate 24 Monate Zwischenauswertung: et al. (20); Basissymptome und/oder kontrollierte Gruppen-KVT, supportive signifikante Verbesserung Bechdolf und/oder BLIPS* 2 Studie Kognitives Training, Einzelbe- der Prodomalsymptome und et al. (21) Reduktion des sozialen und/oder Psychoedukation handlung des sozialen Funktions- Funktionsniveaus bei mehr als eine bei Angehörigen niveaus im prä-postgenetischen und/oder Woche durch- Vergleich; große Effektobstretischen Risiko- gehend Positiv- stärken (d = 1,85 3,80) in faktoren symptome Pilot-Exp.-Sample (n = 12); nach 12 Monaten; Übergangsraten: Exp.: 5 %, Kontr.: 15 % (p = 0,008) in Subsample (n = 126) mit heterogenen Beoachtungsdauern (NNT = 8) Häfner APS* 1 mehr als eine 124 Randomisierte, 24 Monate Amilsulprid 24 Monate 24 Monate Zwischenauswertung: et al. (20); und/oder Woche durch- kontrollierte ( mg/tag), supportiv signifikante Verbesserung Ruhrmann BLIPS* 2 gehend offene Studie supportiv-psycho- psycho- der Prodromalsymptome et al. (22) Positiv- edukative Einzel- und edukative und des sozialen symptome Familienpsycho- Einzel- und Funktionsniveaus im edukation Familien- prä-post-vergleich nach psycho- 6 und 12 Monaten; nach edukation 6 Monaten Übergangsraten: Exp.: 5 %, Kontr.: 21 % (p = 0,019) in Subsample (n = 102) * 1 Attenuierte Positivsymptomatik; * 2 Brief Limited Intermittent Psychotic Symptoms; KVT, Kognitive Verhaltenstherapie; p, Signifikanzniveau; d, Effektstärke; NNT, number-needed-to-treat; Exp., Experimentalgruppe; Kontr., Kontrollgruppe 368 Deutsches Ärzteblatt PP Heft 8 August 2008
7 erwachsen könnte, die sich mit den jeweils infrage kommenden Maßnahmen möglicherweise verhindern ließe. Dementsprechend wählt man auch die Präventionsangebote im Zuge der skizzierten differenziellen Strategie in erster Linie unter dem Gesichtspunkt aus, dass sie die jeweils gebotene Risikosymptomatik bessern und dadurch psychosozialen Behinderungen entgegenwirken sollen. Die Abwägung der Vor- und Nachteile erfolgt somit immer schon im Hinblick auf eine aktuelle Indikation, die auch bei solchen Rat- und Hilfesuchenden bereits klar gegeben wäre, die im spontanen Verlauf keine psychotische Störung entwickeln würden. Wenn zudem im psychosefernen Prodrom nur ganz belastungsfreie, von den Betroffenen gerne wahrgenommene, vorwiegend psychotherapeutische Verfahren in Betracht kommen und beim Auftreten der ersten abgeschwächten oder flüchtigen psychotischen Symptome noch viel Spielraum für die Auswahl nebenwirkungsfrei vertragener Antipsychotika bleibt, wenn sich weiter die Anzahl falsch positiver Vorhersagen unter 10 Prozent halten lässt und nur sehr wenige Betroffene behandelt werden müssen, um eine Neuerkrankung zu verhindern ( number needed to treat ; NNT = 4 bis 8), dann schneidet das Programm auch bei strenger ethischer Beurteilung sehr günstig ab (Tabelle). Fazit Insgesamt befindet sich die indizierte Prävention schizophrener Erkrankungen bei der dargestellten Studienlage sicherlich noch im Stadium der wissenschaftlichen Erprobung. Wenn die Entwicklung auf diesem innovativen Gebiet aber weiter so rasant voranschritte wie bisher, ließen sich schon in den nächsten Jahren evidenzbasierte Ergebnisse in der Versorgungspraxis umsetzen und möglichst jedem Ratsuchenden mit Frühwarnzeichen auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Präventionsangebote unterbreiten. Bei komplexen Erkrankungen mit langem Vorlauf und vorbestehender dispositioneller Grundlage käme dies möglicherweise für eine durchgreifende Inzidenzreduktion im großen Stil schon zu spät. Je nach dem Fortschritt der Grundlagenforschung müsste der hier vorgestellte Ansatz, der ja neben den Risikosymptomen auch bereits Risikofaktoren in die Indikationsstellung mit einschließt (Kasten), in die Richtung einer selektiven Prävention bei noch symptomfreien Dispositionsträgern weiterentwickelt werden. Beim gegenwärtigen Wissensstand bietet aber gerade der Bezug auf Risikosymptome sowohl in wissenschaftlicher als auch in ethischer und rechtlicher Hinsicht ganz erhebliche umsetzungsrelevante Vorteile und erweist den Ansatz als aussichtsreichen Schritt auf dem Wege zu einer präventiven Psychiatrie (4, 10, 14, 24). Interessenkonflikt Der Autor erklärt, dass kein Interessenkonflikt im Sinne der Richtlinien des International Committee of Medical Journal Editors besteht. Manuskriptdaten eingereicht: , revidierte Fassung angenommen: LITERATUR 1. Mrazek PJ, Haggerty RJ: Reducing risks for mental disorders: frontiers for preventive intervention research. Washington: National Academy Press Cuijpers P: Examining the effects of prevention programs on the incidence of new cases of mental disorders: the lack of statistical power. Am J Psychiatry 2003; 160: Phillips LJ, McGorry PD, Yung AR, McGlashan TH, Cornblatt B, Klosterkötter J: Prepsychotic phase of schizophrenia and related disorders: recent progress and future opportunities. Br J Psychiatry 2005; 48 (Suppl.): WHO: Prevention of Mental Disorders. Effective Interventions and Policy Options. Summary Report. World Health Organization of_mental_disorders.pdf 5. Murray CJ, Lopez AD, Mathers CD, Stein C: The global burden of disease 2000 project: aims, methods and data sources. Cambridge, MA 2001: Harvard Burden of Disease Unit. 6. Kissling W, Höffler J, Seemann U, Müller P, Rüther E, Trenckmann U et al.: Direct and indirect costs of schizophrenia. Fortschr Neurol Psychiatr 1999; 67: Harrison PJ, Weinberger DR: Schizophrenia genes, gene expression, and neuropathology: on the matter of their convergence. Mol Psychiatry 2005; 10 (Suppl. 3): Ruhrmann S, Schultze-Lutter F, Klosterkötter J: Early detection and intervention in the initial prodromal phase of schizophrenia. Pharmacopsychiatry 2003; 3: Marshall M, Lewis S, Lockwood A, Drake R, Jones P, Croudace R: Association between duration of untreated psychosis and outcome in cohorts of first-episode patients: a systematic review. Arch Gen Psychiatry 2005; 62: Bechdolf A, Ruhrmann S, Wagner M, Kuhn KU, Janssen B, Bottlender R et al.: Interventions in the initial prodromal states of psychosis in Germany: concept and recruitment. Br J Pschiatry 2005; 48 (Suppl.): Häfner H, Maurer K, Löffler W, an der Heiden W, Könnecke R, Hambrecht M: The early course of schizophrenia. In: Häfner H (ed): Risk and protective factors in schizophrenia towards a conceptual model of the disease process. Darmstadt: Steinkopff 2002; Klosterkötter J, Hellmich M, Steinmeyer EM, Schultze-Lutter F: Diagnosing schizophrenia in the initial prodromal phase. Arch Gen Psychiatr 2001; 58: Schultze-Lutter F, Wieneke A, Picker H, Rolff Y, Steinmeyer EM, Ruhrmann S et al.: The Schizophrenia Prediction Instrument, Adult Version (SPI-A). Schizophr Res 2004; 70/1: Yung AR, Killackey E, Hetrick SE, Parker AG, Schultze-Lutter F, Klosterkötter J et al.: The prevention of schizophrenia. Int Rev Psychiatry 2007; 19: Klosterkötter J, Ruhrmann S, Schultze-Lutter F, Salokangas RK, Linszen D, Birchwood M et al.: The European Prediction of Psychosis Study (EPOS): integrating early recognition and intervention in Europe. World Psychiatry 2005; 3: Nelson B, McGorry PD, Yung AR et al.: The NEURAPO (North America, Europe, Australia Prodrome) study: a multicenter rct of treatment stategies for symptomatic patients at ultra-high risk for progression to schizophrenia and related disorders. Design and study plan. Schizophr Res 2008; 102/ 1 3 (Suppl. 2): McGorry PD, Yung AR, Phillips LJ, Yuen HP, Francey S, Cosgrave EM et al.: Randomized controlled trial of interventions designed to reduce the risk of progression to first-episode psychosis in a clinical sample with subthreshold symptoms. Arch Gen Psychiatry 2002; 59: Deutsches Ärzteblatt PP Heft 8 August
8 18. Morrison AP, French P, Walford L, Lewis SW, Kilcommons A, Green J et al.: A randomized controlled trial of early detection and cognitive therapy for the prevention of psychosis in people at ultra-high risk. Br J Psychiatry 2004; 185: McGlashan TH, Zipursky RB, Perkins DO, Addington J, Woods SW, Miller TJ et al.: The PRIME North America randomized doubleblind clinical trial of olanzapine versus placebo in patients at risk of being prodromally symptomatic for psychosis: I. Study rational and design. Schizophr Res 2003; 61: Häfner H, Maurer K, Ruhrmann S, Bechdolf A, Klosterkötter J, Wagner M et al.: Are early detection and secondary prevention feasible? Facts and visions. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2004; 254: Bechdolf A, Veith V, Schwarzer D, Schormann M, Stamm E, Janssen B et al.: Cognitive-behavioural therapy in the pre-psychotic phase: an exploratory pilot study. Psychiatry Res 2005; 136: Ruhrmann S, Schultze-Lutter F, Maier W, Klosterkötter J: Pharmacological intervention in the initial prodromal phase of psychosis. Eur Psychiatry 2005; 20: Amminger G, Schaefer MR, Papageorgiou K, Becker J, Mossaheb N, Harrigan SM et al.: Omega-3 fatty acids reduce the risk of early transition to psychosis in ultra-high risk individuals: a doubleblind randomized, placebo-controlled treatment study. Schizophr Bull 2007; 33: Klosterkötter J: Auf dem Wege zu einer präventiven Psychiatrie. In: Schneider F (Hrsg.): Entwicklungen der Psychiatrie. Heidelberg: Springer Medizin Verlag Anschrift für den Verfasser Prof. Dr. med. Joachim Klosterkötter Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Uniklinik Köln Kerpener Straße 62, Köln joachim.klosterkoetter@uk-koeln.de SUMMARY Indicated Prevention of Schizophrenia Introduction: Despite recent advances in their treatment, schizophrenic disorders are still among the diseases that most severely impair patients' quality of life. For this reason, centers for the early recognition of schizophrenic disorders have come into existence worldwide. In these centers, much effort is devoted to the development and testing of suitable preventive strategies. Methods: In this article, we selectively review the literature on the currently available means of assessing the individual risk of becoming ill with schizophrenia and of preventing the imminent onset of the disease. Results: The currently recognized neurobiological and psychosocial risk factors are not predictive enough to enable the development and application of selective prevention measures for asymptomatic persons at risk. The imminent onset of schizophrenia can be predicted with high accuracy, however, in cases where an initially non-psychotic patient develops early cognitive symptoms that imply a risk of schizophrenia and then, later on in the prodrome of the disease (which typically lasts about five years), goes on to develop high-risk symptoms with mild psychosis. At this point, a differential strategy of indicated prevention can be put into action, including cognitive behavioral therapy, atypical antipsychotics in low doses, and neuroprotective agents. Discussion: The current state of knowledge in this innovative field of research leads us to expect that it will soon be possible to offer individually tailored preventive measures to persons seeking medical help and advice because of the early warning signs of schizophrenia. Dtsch Arztebl 2008; 105(30): DOI: /arztebl Key words: schizophrenia, risk factor, early course, risk symptom, indicated prevention The English version of this article is available REFERIERT TRAUMATISIERTE FRAUEN Gründe für Therapiewahl US-amerikanische Wissenschaftler wollten herausfinden, welche Therapie traumatisierte Frauen, die sich nicht in Therapie befanden, bevorzugen würden. Sie zeigten 74 Frauen Videos, in denen ein Therapeut sachlich über eine psychotherapeutische Behandlung mit verlängerter Exposition und über eine medikamentöse Behandlung mit Sertraline informierte. Anschließend wurden die Frauen befragt, welche Therapie sie wählen würden. Die Mehrzahl der Frauen zog eine Psychotherapie dem Medikament vor, so die Wissenschaftler. Zum einen lag dies am Wirkmechanismus: Die Frauen glaubten, dass ihre Probleme psychologischer Natur seien und daher auch nur eine psychologische Behandlung helfen könnte. Außerdem fürchteten sie sich vor Nebenwirkungen und einer Abhängigkeit vom Medikament. Sie unterstellten der medikamentösen Therapie, dass sie nur die Symptome, nicht aber die Ursachen beseitigen würde und dass sie damit nicht lernen könnten, mit ihren Problemen umzugehen. Zum anderen entsprachen die Methoden der Psychotherapie den Vorstellungen der Patientinnen davon, was in ihrem Fall effektiv wäre. Sie glaubten, dass es ihnen besonders helfen würde, wenn sie über ihre Erlebnisse sprechen und sich mit ihnen konfrontierten. Ein Medikament würde hingegen ihrem Bedürfnis, sich mitzuteilen, nicht entgegenkommen. Es gab aber auch einige Patientinnen, die beide Therapieformen ablehnten, weil sie negative Folgen befürchteten oder mit Außenstehenden nicht über ihre Probleme reden wollten. ms Angelo F, Miller H, Zoellner L, Feeny N: I need to talk about it: A qualitative analysis of trauma-exposed women s reasons for treatment choice. Behavior Therapy 2008; 1: Lori Zoellner, Department of Psychology, University of Washington, Box , Seattle, WA , USA, zoellner@u.washington.edu 370 Deutsches Ärzteblatt PP Heft 8 August 2008
Indizierte Prävention schizophrener Erkrankungen Joachim Klosterkötter
 ÜBERSICHTSARBEIT Indizierte Prävention schizophrener Erkrankungen Joachim Klosterkötter ZUSAMMENFASSUNG Einleitung: Schizophrene Störungen gehören auch unter den heutigen verbesserten Behandlungsbedingungen
ÜBERSICHTSARBEIT Indizierte Prävention schizophrener Erkrankungen Joachim Klosterkötter ZUSAMMENFASSUNG Einleitung: Schizophrene Störungen gehören auch unter den heutigen verbesserten Behandlungsbedingungen
Früherkennung und Frühintervention wie kann man den Ausbruch von Psychosen verhindern?
 Früherkennung und Frühintervention wie kann man den Ausbruch von Psychosen verhindern? Joachim Klosterkötter Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Universität zu Köln Früherkennung und Frühintervention
Früherkennung und Frühintervention wie kann man den Ausbruch von Psychosen verhindern? Joachim Klosterkötter Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Universität zu Köln Früherkennung und Frühintervention
Langzeitverläufe der Schizophrenie
 Langzeitverläufe der Schizophrenie Herbstsymposium 04.12.2014 PD Dr. med. Sebastian Walther Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Bern Inhalt Epidemiologie Verlaufsmuster Formen Prodrom
Langzeitverläufe der Schizophrenie Herbstsymposium 04.12.2014 PD Dr. med. Sebastian Walther Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Bern Inhalt Epidemiologie Verlaufsmuster Formen Prodrom
Erhöhtes Schizophrenierisiko. Früherkennung auf. Ina Deppe Ann-Kristin Kömmling Jacob Loeckle
 Erhöhtes Schizophrenierisiko Früherkennung auf de em Prüfstand Ina Deppe Ann-Kristin Kömmling Jacob Loeckle 1 Was bedeutet Früherkennung der Schizophrenie? Erkennung in einer Zeit, in der die Erkrank kung
Erhöhtes Schizophrenierisiko Früherkennung auf de em Prüfstand Ina Deppe Ann-Kristin Kömmling Jacob Loeckle 1 Was bedeutet Früherkennung der Schizophrenie? Erkennung in einer Zeit, in der die Erkrank kung
Prävention bei Psychosen Priv.-Doz. Dr. med. Katarina Stengler
 Prävention bei Psychosen Priv.-Doz. Dr. med. Katarina Stengler Klinik und Poliklinik für Psychiatrie (Direktor: Prof. Dr. med. Ulrich Hegerl) Prävention & Gesundheitsförderung Prävention (Reduktion von...)
Prävention bei Psychosen Priv.-Doz. Dr. med. Katarina Stengler Klinik und Poliklinik für Psychiatrie (Direktor: Prof. Dr. med. Ulrich Hegerl) Prävention & Gesundheitsförderung Prävention (Reduktion von...)
Die erste psychotische Episode
 Die erste psychotische Episode Dr. med. Robert Bittner Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie Universitätsklinikum Frankfurt, Goethe-Universität robert.bittner@kgu.de Das Konzept Schizophrenie
Die erste psychotische Episode Dr. med. Robert Bittner Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie Universitätsklinikum Frankfurt, Goethe-Universität robert.bittner@kgu.de Das Konzept Schizophrenie
Das «Insight»-Phänomen in der Schizophrenie
 Das «Insight»-Phänomen in der Schizophrenie Überblick Definition Prävalenz Folgekorrelate von Insight Insight als Prädiktor Studie Ätiologie Einige andere mit Insight verbundene Aspekte Definition des
Das «Insight»-Phänomen in der Schizophrenie Überblick Definition Prävalenz Folgekorrelate von Insight Insight als Prädiktor Studie Ätiologie Einige andere mit Insight verbundene Aspekte Definition des
Schizophrene Spektrumserkrankungen und Prodromalsymstome im Spiegel der neuen Klassifikationssysteme DSM-V und ICD-11
 Schizophrene Spektrumserkrankungen und Prodromalsymstome im Spiegel der neuen Klassifikationssysteme DSM-V und ICD-11 Joachim Klosterkötter Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Universität zu Köln
Schizophrene Spektrumserkrankungen und Prodromalsymstome im Spiegel der neuen Klassifikationssysteme DSM-V und ICD-11 Joachim Klosterkötter Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Universität zu Köln
Die Schizophrenie ist eine Erkrankung
 Früherkennung beginnender schizophrener Erkrankungen Georg Juckel Georg Juckel 1, Frauke Schultze-Lutter 2, Stephan Ruhrmann 2 1 Früherkennungs- und Therapiezentrum (FETZ) für beginnende Psychosen Berlin-Brandenburg,
Früherkennung beginnender schizophrener Erkrankungen Georg Juckel Georg Juckel 1, Frauke Schultze-Lutter 2, Stephan Ruhrmann 2 1 Früherkennungs- und Therapiezentrum (FETZ) für beginnende Psychosen Berlin-Brandenburg,
Der Langzeitverlauf akuter vorübergehender Psychosen. im Vergleich zur Schizophrenie
 Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. Dr. h.c. Andreas Marneros) Der Langzeitverlauf akuter
Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. Dr. h.c. Andreas Marneros) Der Langzeitverlauf akuter
Früherkennung von Psychosen
 Früherkennung von Psychosen Eine adoleszentenmedizinische Perspektive Prof. Benno G. Schimmelmann, Bern Früherkennung von Psychosen Die Rationale Psychose-Entstehung Prä-morbid Prodrom DUP EB Depression
Früherkennung von Psychosen Eine adoleszentenmedizinische Perspektive Prof. Benno G. Schimmelmann, Bern Früherkennung von Psychosen Die Rationale Psychose-Entstehung Prä-morbid Prodrom DUP EB Depression
PD Dr. A. Bechdolf, M. Sc., Associate Professor. <Datum> <Verfasser>
 Früherkennung Mastertitelformat und Frühintervention bearbeitenbei schizophrenen Auftaktveranstaltung Unterzeile Störungen zum Titel PREVENT PD Dr. A. Bechdolf, M. Sc., Associate Professor
Früherkennung Mastertitelformat und Frühintervention bearbeitenbei schizophrenen Auftaktveranstaltung Unterzeile Störungen zum Titel PREVENT PD Dr. A. Bechdolf, M. Sc., Associate Professor
Früherkennung und -intervention bei Personen mit erhöhtem Psychoserisiko* kommt es zu einem massiven Einbruch der sozialen Leistungsfähigkeit
 Prävention der Schizophrenie Früherkennung und -intervention bei Personen mit erhöhtem Psychoserisiko* Andreas Bechdolf 1, Stephan Ruhrmann 1, Birgit Janssen 3, Ronald Bottlender 4, Michael Wagner 2, Kurt
Prävention der Schizophrenie Früherkennung und -intervention bei Personen mit erhöhtem Psychoserisiko* Andreas Bechdolf 1, Stephan Ruhrmann 1, Birgit Janssen 3, Ronald Bottlender 4, Michael Wagner 2, Kurt
1. Einleitung Was ist Stress?...28
 Inhaltsverzeichnis Abstract...21 1. Einleitung...23 2. Was ist Stress?...28 2.1 Der Stressbegriff Ein historischer Überblick...28 2.2 Dimensionale Stress-Definition...30 2.2.1 Akuter versus chronischer
Inhaltsverzeichnis Abstract...21 1. Einleitung...23 2. Was ist Stress?...28 2.1 Der Stressbegriff Ein historischer Überblick...28 2.2 Dimensionale Stress-Definition...30 2.2.1 Akuter versus chronischer
Schizophrenie: Herausforderung für den kranken Menschen. Was muss die Therapie leisten?
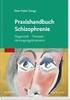 Presse Round Table 27.11.09 Psychische Störungen und Erkrankungen in der Lebensspanne. Neue Wege in Versorgung und Forschung. Schizophrenie: Herausforderung für den kranken Menschen. Was muss die Therapie
Presse Round Table 27.11.09 Psychische Störungen und Erkrankungen in der Lebensspanne. Neue Wege in Versorgung und Forschung. Schizophrenie: Herausforderung für den kranken Menschen. Was muss die Therapie
Klinische Hochrisikokriterien und -symptome in der Allgemeinbevölkerung: Prävalenz, Krankheitswertigkeit und Entwicklungsspezifika
 Klinische Hochrisikokriterien und -symptome in der Allgemeinbevölkerung: Prävalenz, Krankheitswertigkeit und Entwicklungsspezifika PD Dr. phil. Frauke Schultze-Lutter, Dipl.-Psych. Klinik und Poliklinik
Klinische Hochrisikokriterien und -symptome in der Allgemeinbevölkerung: Prävalenz, Krankheitswertigkeit und Entwicklungsspezifika PD Dr. phil. Frauke Schultze-Lutter, Dipl.-Psych. Klinik und Poliklinik
Ambulante Verhaltenstherapie zeigt gute Wirkung
 Behandlung von Psychosen Ambulante Verhaltenstherapie zeigt gute Wirkung Berlin (19. Januar 2016) - Patienten mit Psychosen profitieren von einer ambulanten Verhaltenstherapie. Das zeigt eine klinische
Behandlung von Psychosen Ambulante Verhaltenstherapie zeigt gute Wirkung Berlin (19. Januar 2016) - Patienten mit Psychosen profitieren von einer ambulanten Verhaltenstherapie. Das zeigt eine klinische
Früherkennung von Psychosen in der Schweiz. - Potential für interkantonale Zusammenarbeit. Potential für interkantonale Zusammenarbeit &
 Früherkennung von Psychosen in der Schweiz - Potential für interkantonale Zusammenarbeit Benno Schimmelmann, Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie Universität Bern Psychosen & was ist Früherkennung?
Früherkennung von Psychosen in der Schweiz - Potential für interkantonale Zusammenarbeit Benno Schimmelmann, Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie Universität Bern Psychosen & was ist Früherkennung?
ADHS und Persönlichkeitsentwicklung
 ADHS und Persönlichkeitsentwicklung Basel 31.10.2013 Klaus Schmeck Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel www.upkbs.ch
ADHS und Persönlichkeitsentwicklung Basel 31.10.2013 Klaus Schmeck Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel www.upkbs.ch
Ist eine Behandlung mit Antipsychotika gerechtfertigt?
 In Zusammenarbeit mit der Bayerischen Landesärztekammer Lucian Milasan / Fotolia.com Erhöhtes Psychose-Risiko Ist eine Behandlung mit Antipsychotika gerechtfertigt? Hendrik Müller¹, Köln, und Andreas Bechdolf¹,
In Zusammenarbeit mit der Bayerischen Landesärztekammer Lucian Milasan / Fotolia.com Erhöhtes Psychose-Risiko Ist eine Behandlung mit Antipsychotika gerechtfertigt? Hendrik Müller¹, Köln, und Andreas Bechdolf¹,
Prävention posttraumatischer Belastung bei jungen brandverletzten Kindern: Erste Ergebnisse einer randomisiert-kontrollierten Studie
 Prävention posttraumatischer Belastung bei jungen brandverletzten Kindern: Erste Ergebnisse einer randomisiert-kontrollierten Studie M.Sc. Ann-Christin Haag CCMH Symposium 26.01.2017 Einleitung Ca. 80%
Prävention posttraumatischer Belastung bei jungen brandverletzten Kindern: Erste Ergebnisse einer randomisiert-kontrollierten Studie M.Sc. Ann-Christin Haag CCMH Symposium 26.01.2017 Einleitung Ca. 80%
Kosten und Nutzen ambulanter Psychotherapie
 Kosten und Nutzen ambulanter Psychotherapie Jürgen Margraf Fakultät für Psychologie der Universität Basel und Nationaler Forschungsschwerpunkt sesam sesam 2006, Seite 1 Gesundheit und Kosten Gesundheit
Kosten und Nutzen ambulanter Psychotherapie Jürgen Margraf Fakultät für Psychologie der Universität Basel und Nationaler Forschungsschwerpunkt sesam sesam 2006, Seite 1 Gesundheit und Kosten Gesundheit
Früherkennung und - behandlung von Psychosen
 Früherkennung und - behandlung von Psychosen Prof. Dr. med. Benno G. Schimmelmann, Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Bern Früherkennung von Psychosen Die Rationale
Früherkennung und - behandlung von Psychosen Prof. Dr. med. Benno G. Schimmelmann, Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Bern Früherkennung von Psychosen Die Rationale
Wie wirkt Laufen gegen Depression? Prof. Dr. Gerhard Huber Institut für Sport und Sportwissenschaft Universität Heidelberg
 Wie wirkt Laufen gegen Depression? Prof. Dr. Gerhard Huber Institut für Sport und Sportwissenschaft Universität Heidelberg Sport is one part, but is probably not a large part of lifetime physical activity.
Wie wirkt Laufen gegen Depression? Prof. Dr. Gerhard Huber Institut für Sport und Sportwissenschaft Universität Heidelberg Sport is one part, but is probably not a large part of lifetime physical activity.
Patientensicherheit in der Psychiatrie: Die Position der DGPPN
 Seit über 175 Jahren PROF. DR. GERHARD GRÜNDER LEITER REFERAT PSYCHOPHARMAKOTHERAPIE DGPPN Patientensicherheit in der Psychiatrie: Die Position der DGPPN 5. Deutscher Kongress für Patientensicherheit bei
Seit über 175 Jahren PROF. DR. GERHARD GRÜNDER LEITER REFERAT PSYCHOPHARMAKOTHERAPIE DGPPN Patientensicherheit in der Psychiatrie: Die Position der DGPPN 5. Deutscher Kongress für Patientensicherheit bei
10 Jahre herkennungs- und Therapiezentren -- eine Erfolgsstory?
 10 Jahre Früherkennungs herkennungs- und Therapiezentren -- eine Erfolgsstory? Dr. Frauke Schultze-Lutter, Dipl.-Psych. Wissenschaftlich-psychologische Leiterin des Früh-Erkennungs Erkennungs- & Therapie-Zentrum
10 Jahre Früherkennungs herkennungs- und Therapiezentren -- eine Erfolgsstory? Dr. Frauke Schultze-Lutter, Dipl.-Psych. Wissenschaftlich-psychologische Leiterin des Früh-Erkennungs Erkennungs- & Therapie-Zentrum
Zeitige kognitive Verhaltenstherapie bei Hochrisikopersonen für die Entwicklung einer Bipolaren Störung (EarlyCBT) Maren Rottmann-Wolf
 Zeitige kognitive Verhaltenstherapie bei Hochrisikopersonen für die Entwicklung einer Bipolaren Störung (EarlyCBT) Maren Rottmann-Wolf Georg Juckel, Andreas Bechdolf, Martin Holtmann, Martin Lambert, Karolina
Zeitige kognitive Verhaltenstherapie bei Hochrisikopersonen für die Entwicklung einer Bipolaren Störung (EarlyCBT) Maren Rottmann-Wolf Georg Juckel, Andreas Bechdolf, Martin Holtmann, Martin Lambert, Karolina
Psychosen bei Jugendlichen
 Psychosen bei Jugendlichen Prof. Dr. Tobias Renner Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter Universitätsklinik Tübingen Wintersemester 2016/2017 24.10.2017 Psychosen im Kindes-
Psychosen bei Jugendlichen Prof. Dr. Tobias Renner Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter Universitätsklinik Tübingen Wintersemester 2016/2017 24.10.2017 Psychosen im Kindes-
Kann lebenslanges Lernen das Demenzrisiko verringern?
 Kann lebenslanges Lernen das Demenzrisiko verringern? Prof. Dr. Daniel Zimprich Universität Ulm IN FORM-Symposium Gesunder und aktiver Lebensstil ein Beitrag zur Prävention von Demenz? Bundesministerium
Kann lebenslanges Lernen das Demenzrisiko verringern? Prof. Dr. Daniel Zimprich Universität Ulm IN FORM-Symposium Gesunder und aktiver Lebensstil ein Beitrag zur Prävention von Demenz? Bundesministerium
FETZ Früherkennungs- und Therapieprogramm
 FETZ Früherkennungs- und Therapieprogramm Dr. Frauke Schultze-Lutter Früh-Erkennungs Erkennungs- & Therapie-Zentrum für psychische Krisen (FETZ) Uniklinik Köln, Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und
FETZ Früherkennungs- und Therapieprogramm Dr. Frauke Schultze-Lutter Früh-Erkennungs Erkennungs- & Therapie-Zentrum für psychische Krisen (FETZ) Uniklinik Köln, Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und
UPKE. 1. BEATS Symposium Frühintervention von Psychosen Donnerstag, 28. März bis Uhr, Basel
 UPKE 1. BEATS Symposium Frühintervention von Psychosen Donnerstag, 28. März 2019 9.15 bis 16.00 Uhr, Basel Sehr geehrte Damen und Herren Liebe Kolleginnen und Kollegen Seit etwa zwei Jahrzehnten stellt
UPKE 1. BEATS Symposium Frühintervention von Psychosen Donnerstag, 28. März 2019 9.15 bis 16.00 Uhr, Basel Sehr geehrte Damen und Herren Liebe Kolleginnen und Kollegen Seit etwa zwei Jahrzehnten stellt
Evidenz in der Präventionsmedizin
 Evidenz in der Präventionsmedizin Symposium Ist Vorsorgen Immer Besser als Heilen? 20. und 21. Februar 2008 Dr. Gerald Gartlehner, MPH, Department für evidenzbasierte Medizin und klinische Epidemiologie
Evidenz in der Präventionsmedizin Symposium Ist Vorsorgen Immer Besser als Heilen? 20. und 21. Februar 2008 Dr. Gerald Gartlehner, MPH, Department für evidenzbasierte Medizin und klinische Epidemiologie
Früherkennung bipolarer Störungen Was wir bisher wissen. Andrea Pfennig
 Früherkennung bipolarer Störungen Was wir bisher wissen Andrea Pfennig Wir erkennen und behandeln zu spät! Behandlungsverzögerung in Jahren Lambert et al., Fortschritte Neurol Psychiat 2013 Zeit von ersten
Früherkennung bipolarer Störungen Was wir bisher wissen Andrea Pfennig Wir erkennen und behandeln zu spät! Behandlungsverzögerung in Jahren Lambert et al., Fortschritte Neurol Psychiat 2013 Zeit von ersten
Homepage: Online-Datenbank mit Autoren- und Stichwortsuche
 Früherkennung und Frühintervention bei Psychosen Mossaheb N, Amminger GP Journal für Neurologie Neurochirurgie und Psychiatrie 2011; 12 (3), 294-298 Homepage: www.kup.at/ JNeurolNeurochirPsychiatr Online-Datenbank
Früherkennung und Frühintervention bei Psychosen Mossaheb N, Amminger GP Journal für Neurologie Neurochirurgie und Psychiatrie 2011; 12 (3), 294-298 Homepage: www.kup.at/ JNeurolNeurochirPsychiatr Online-Datenbank
Stellungnahme der Bundesärztekammer
 Stellungnahme der Bundesärztekammer zur Änderung der Psychotherapie-Richtlinie: Indikation Schizophrenie (Anfrage des Gemeinsamen Bundesausschusses vom 17. April 2013) Berlin, 15.05.2013 Bundesärztekammer
Stellungnahme der Bundesärztekammer zur Änderung der Psychotherapie-Richtlinie: Indikation Schizophrenie (Anfrage des Gemeinsamen Bundesausschusses vom 17. April 2013) Berlin, 15.05.2013 Bundesärztekammer
Die Behandlung des Tourette-Syndroms mit Aripiprazol
 Vortragzusammenfassung Die Behandlung des Tourette-Syndroms mit Aripiprazol Professor Dr. med. Mathias Bartels Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Tübingen Das Tourette-Syndrom ist eine
Vortragzusammenfassung Die Behandlung des Tourette-Syndroms mit Aripiprazol Professor Dr. med. Mathias Bartels Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Tübingen Das Tourette-Syndrom ist eine
Depression, Burnout. und stationäre ärztliche Versorgung von Erkrankten. Burnout I Depression Volkskrankheit Nr. 1? 1. Oktober 2014, Braunschweig
 Burnout I Depression Volkskrankheit Nr. 1? 1. Oktober 2014, Braunschweig Depression, Burnout und stationäre ärztliche Versorgung von Erkrankten Privatdozent Dr. med. Alexander Diehl M.A. Arzt für Psychiatrie
Burnout I Depression Volkskrankheit Nr. 1? 1. Oktober 2014, Braunschweig Depression, Burnout und stationäre ärztliche Versorgung von Erkrankten Privatdozent Dr. med. Alexander Diehl M.A. Arzt für Psychiatrie
Effektivität psychiatrischer Therapien
 Effektivität psychiatrischer Therapien Wie wirksam sind medikamentöse und psychotherapeutische Verfahren? Dr med. Maximilian Huhn Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Klinikum Rechts der Isar Vortrag
Effektivität psychiatrischer Therapien Wie wirksam sind medikamentöse und psychotherapeutische Verfahren? Dr med. Maximilian Huhn Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Klinikum Rechts der Isar Vortrag
Wenn die Welt Wogen wirft Eine Einführung in aktuelle Früherkennungskonzepte für psychotische Störungen
 Wenn die Welt Wogen wirft Eine Einführung in aktuelle Früherkennungskonzepte für psychotische Störungen PIA-Fachtagung Seeon 2016 Dr. T. Skuban-Eiseler Agenda 1. Prävention in der Psychiatrie?! 2. Frühverlauf
Wenn die Welt Wogen wirft Eine Einführung in aktuelle Früherkennungskonzepte für psychotische Störungen PIA-Fachtagung Seeon 2016 Dr. T. Skuban-Eiseler Agenda 1. Prävention in der Psychiatrie?! 2. Frühverlauf
BipoLife A DGBS Jahrestagung, 17. September Dipl.-Psych. Jana Fiebig, Charité Universitätsmedizin Berlin
 BipoLife A1 VERBESSERUNG DER FRÜHERKENNUNG UND FRÜHINTERVENTION BEI PERSONEN MIT ERHÖHTEM RISIKO FÜR DIE ENTWICKLUNG EINER BIPOLAREN STÖRUNG 16. DGBS Jahrestagung, 17. September 2016 Dipl.-Psych. Jana
BipoLife A1 VERBESSERUNG DER FRÜHERKENNUNG UND FRÜHINTERVENTION BEI PERSONEN MIT ERHÖHTEM RISIKO FÜR DIE ENTWICKLUNG EINER BIPOLAREN STÖRUNG 16. DGBS Jahrestagung, 17. September 2016 Dipl.-Psych. Jana
FRÜHINTERVENTION IN RISIKOSTADIEN - EIN ÜBERBLICK
 FRÜHINTERVENTION IN RISIKOSTADIEN - EIN ÜBERBLICK Stephan Ruhrmann stephan.ruhrmann@uk-koeln.de LEBENSZEITPRÄVALENZ VON PSYCHOTISCHEN STÖRUNGEN 4 Lebenszeit-Prävalenz [%] 3 2 1 3.1 1.9 0.9 2.5 0.6 0.4
FRÜHINTERVENTION IN RISIKOSTADIEN - EIN ÜBERBLICK Stephan Ruhrmann stephan.ruhrmann@uk-koeln.de LEBENSZEITPRÄVALENZ VON PSYCHOTISCHEN STÖRUNGEN 4 Lebenszeit-Prävalenz [%] 3 2 1 3.1 1.9 0.9 2.5 0.6 0.4
Informations- und Wissensstand der Mütter von Kindern mit angeborenem Herzfehler
 Informations- und Wissensstand der Mütter von Kindern mit angeborenem Herzfehler A Löbel 1, U Grosser 2, A Wessel 2, S Geyer 1 1 Medizinische Soziologie, Medizinische Hochschule Hannover 2 Pädiatrische
Informations- und Wissensstand der Mütter von Kindern mit angeborenem Herzfehler A Löbel 1, U Grosser 2, A Wessel 2, S Geyer 1 1 Medizinische Soziologie, Medizinische Hochschule Hannover 2 Pädiatrische
Deutsche Multicenter-Studien erforschen die Wirksamkeit der Psychotherapie chronischer Depression und ihre neurobiologischen Wirkmechanismen
 UniversitätsKlinikum Heidelberg Heidelberg, den 31. Juli 2012 PRESSEMITTEILUNG Deutsche Multicenter-Studien erforschen die Wirksamkeit der Psychotherapie chronischer Depression und ihre neurobiologischen
UniversitätsKlinikum Heidelberg Heidelberg, den 31. Juli 2012 PRESSEMITTEILUNG Deutsche Multicenter-Studien erforschen die Wirksamkeit der Psychotherapie chronischer Depression und ihre neurobiologischen
Gesellschaftliche Ungleichheit, Exklusion und die Sozialpsychiatrie
 DGSP Jahrestagung Berlin, 06.10.2016 Gesellschaftliche Ungleichheit, Exklusion und die Sozialpsychiatrie 2007 Wolfgang Pehlemann Wiesbaden PICT3221 Reinhold Kilian, Maja Stiawa, Thomas Becker Klinik für
DGSP Jahrestagung Berlin, 06.10.2016 Gesellschaftliche Ungleichheit, Exklusion und die Sozialpsychiatrie 2007 Wolfgang Pehlemann Wiesbaden PICT3221 Reinhold Kilian, Maja Stiawa, Thomas Becker Klinik für
Berechnung von Konfidenzintervallen für Impact Numbers aus Fall-Kontroll und Kohorten-Studien
 Berechnung von Konfidenzintervallen für Impact Numbers aus Fall-Kontroll und Kohorten-Studien Mandy Hildebrandt 1,2, Ralf Bender 1 und Maria Blettner 2 1 Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im
Berechnung von Konfidenzintervallen für Impact Numbers aus Fall-Kontroll und Kohorten-Studien Mandy Hildebrandt 1,2, Ralf Bender 1 und Maria Blettner 2 1 Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im
Kasuistische Beiträge zur modernen Pharmakotherapie mit Quetiapin
 Kasuistische Beiträge zur modernen Pharmakotherapie mit Quetiapin Hans-Peter Volz Siegfried Kasper Hans-Jürgen Möller Inhalt Vorwort 17 A Allgemeiner Teil Stürmiücn (I l.-.l. 1.1 Extrapyramidal-motorische
Kasuistische Beiträge zur modernen Pharmakotherapie mit Quetiapin Hans-Peter Volz Siegfried Kasper Hans-Jürgen Möller Inhalt Vorwort 17 A Allgemeiner Teil Stürmiücn (I l.-.l. 1.1 Extrapyramidal-motorische
Psychoonkologie und Supportivtherapie
 Psychoonkologie und Supportivtherapie Rudolf Weide Praxisklinik für Hämatologie und Onkologie Koblenz PSO+SUPP: Metastasiertes Mammakarzinom Metastasiertes Mammakarzinom: Therapie versus BSC! 57 rumänische
Psychoonkologie und Supportivtherapie Rudolf Weide Praxisklinik für Hämatologie und Onkologie Koblenz PSO+SUPP: Metastasiertes Mammakarzinom Metastasiertes Mammakarzinom: Therapie versus BSC! 57 rumänische
Neues zum evidenzbasierten Einsatz von Antipsychotika in Psychiatrie und Neurologie
 Neues zum evidenzbasierten Einsatz von Antipsychotika in Psychiatrie und Neurologie Univ.-Prof. Dr. Oliver Tüscher Univ.-Prof. Dr. Klaus Lieb UNIVERSITÄTSMEDIZIN der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Neues zum evidenzbasierten Einsatz von Antipsychotika in Psychiatrie und Neurologie Univ.-Prof. Dr. Oliver Tüscher Univ.-Prof. Dr. Klaus Lieb UNIVERSITÄTSMEDIZIN der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Schizophrenie im Kindes- und Jugendalter aktuelle Entwicklungen
 Vortrag im Rahmen des kinder- und jugendpsychiatrischen Festkongresses zum 100jährigen Bestehen der psychiatrischen Klinik in Brandenburg an der Havel 03./04.12.2014 Hans Willner Übersicht Einleitung 1.
Vortrag im Rahmen des kinder- und jugendpsychiatrischen Festkongresses zum 100jährigen Bestehen der psychiatrischen Klinik in Brandenburg an der Havel 03./04.12.2014 Hans Willner Übersicht Einleitung 1.
Psychotherapie bei bipolaren Störungen - Erkenntnisstand
 MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT Fachbereich Psychologie Psychotherapie bei bipolaren Störungen - Erkenntnisstand 17.09.2016, DGBS Tagung, Symposium W VIII, Dr. Dipl.-Psych. Raphael Niebler
MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT Fachbereich Psychologie Psychotherapie bei bipolaren Störungen - Erkenntnisstand 17.09.2016, DGBS Tagung, Symposium W VIII, Dr. Dipl.-Psych. Raphael Niebler
Biologische Marker und validierte Schweregradeinschätzung von Basissymptomen
 Biologische Marker und validierte Schweregradeinschätzung von Basissymptomen Gerd Huber-Forschungsförderpreis für Arbeiten zur Präventionsforschung im Bereich Schizophrenie und Bipolare Störung verliehen
Biologische Marker und validierte Schweregradeinschätzung von Basissymptomen Gerd Huber-Forschungsförderpreis für Arbeiten zur Präventionsforschung im Bereich Schizophrenie und Bipolare Störung verliehen
Wie wirksam sind Psychotherapien bei Bipolaren Störungen im Vergleich: Ergebnisse einer Cochrane-Analyse [18 Min]
![Wie wirksam sind Psychotherapien bei Bipolaren Störungen im Vergleich: Ergebnisse einer Cochrane-Analyse [18 Min] Wie wirksam sind Psychotherapien bei Bipolaren Störungen im Vergleich: Ergebnisse einer Cochrane-Analyse [18 Min]](/thumbs/94/118663376.jpg) Wie wirksam sind Psychotherapien bei Bipolaren Störungen im Vergleich: Ergebnisse einer Cochrane-Analyse [18 Min] Stephan Mühlig Christina Bernd Frederik Haarig Professur für Klinische Psychologie Hintergrund
Wie wirksam sind Psychotherapien bei Bipolaren Störungen im Vergleich: Ergebnisse einer Cochrane-Analyse [18 Min] Stephan Mühlig Christina Bernd Frederik Haarig Professur für Klinische Psychologie Hintergrund
Asenapin: unabhängig von der Depressionsschwere bei mixed specifier wirksam?
 Neue Daten vom APA 2013 Asenapin: unabhängig von der Depressionsschwere bei mixed specifier wirksam? San Francisco, Cal., USA (27. Juni 2013) - Die Vorstellung der fünften Ausgabe des Diagnostic and Statistical
Neue Daten vom APA 2013 Asenapin: unabhängig von der Depressionsschwere bei mixed specifier wirksam? San Francisco, Cal., USA (27. Juni 2013) - Die Vorstellung der fünften Ausgabe des Diagnostic and Statistical
Schizophrenien ist die Familie schuld? nein. nein. ja nein. nein
 Schizophrenien ist die Familie schuld? ja ja ja ja Epidemiologie Prävalenz: 0,6 und 1% (Eggers und Röpcke 2004) Prävalenz mit Beginn vor dem 12. Lebensjahr: (Very Early Onset Schizophrenia, VEOS) 0,01%
Schizophrenien ist die Familie schuld? ja ja ja ja Epidemiologie Prävalenz: 0,6 und 1% (Eggers und Röpcke 2004) Prävalenz mit Beginn vor dem 12. Lebensjahr: (Very Early Onset Schizophrenia, VEOS) 0,01%
Vorlesung Psychiatrie WS 2011/2012 Schizophrenie I Symptomatik, Epidemiologie
 Vorlesung Psychiatrie WS 2011/2012 Schizophrenie I Symptomatik, Epidemiologie Michael Kluge Symptomatik Michael Kluge Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie 2 Emil Kraepelin (1856 1926)
Vorlesung Psychiatrie WS 2011/2012 Schizophrenie I Symptomatik, Epidemiologie Michael Kluge Symptomatik Michael Kluge Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie 2 Emil Kraepelin (1856 1926)
Anlage zur Vereinbarung gemäß 118 Abs. 28GB V vom
 Anlage zur Vereinbarung gemäß 118 Abs. 28GB V vom 30.04.2010 Spezifizierung der Patientengruppe gemäß 3 der Vereinbarung: 1. Einschlusskriterien für die Behandlung Erwachsener in der Psychiatrischen Institutsambulanz
Anlage zur Vereinbarung gemäß 118 Abs. 28GB V vom 30.04.2010 Spezifizierung der Patientengruppe gemäß 3 der Vereinbarung: 1. Einschlusskriterien für die Behandlung Erwachsener in der Psychiatrischen Institutsambulanz
Wege aus der Depression
 Wege aus der Depression Thomas Pollmächer Zentrum für psychische Gesundheit Klinikum Ingolstadt Ingolstadt, am 7. Oktober 2017 Zunahme von Fehlzeiten durch psychische Erkrankungen http://www.tk.de/tk/broschueren-und-mehr/studien-und-auswertungen/gesundheitsreport-2012/449296
Wege aus der Depression Thomas Pollmächer Zentrum für psychische Gesundheit Klinikum Ingolstadt Ingolstadt, am 7. Oktober 2017 Zunahme von Fehlzeiten durch psychische Erkrankungen http://www.tk.de/tk/broschueren-und-mehr/studien-und-auswertungen/gesundheitsreport-2012/449296
Prävention & Frühintervention bei psychischen Erkrankungen
 Prävention & Frühintervention bei psychischen Erkrankungen XII. Tagung: Die Subjektive Seite der Schizophrenie Schizophrenie in Bewegung Prof. Dr. med. Steffi G. Riedel-Heller, MPH Leipzig Agenda 1. Warum
Prävention & Frühintervention bei psychischen Erkrankungen XII. Tagung: Die Subjektive Seite der Schizophrenie Schizophrenie in Bewegung Prof. Dr. med. Steffi G. Riedel-Heller, MPH Leipzig Agenda 1. Warum
Integrierte Sucht-Psychose Station
 Integrierte Sucht-Psychose Station Priv. Doz. Dr. Iris Maurer Friedrich-Schiller Schiller-Universität Jena Nomenklatur Substanzgebrauch mit psychischer Erkrankung Psychisch Kranke mit Substanzgebrauch
Integrierte Sucht-Psychose Station Priv. Doz. Dr. Iris Maurer Friedrich-Schiller Schiller-Universität Jena Nomenklatur Substanzgebrauch mit psychischer Erkrankung Psychisch Kranke mit Substanzgebrauch
Subklinische Schilddrüsenkrankheiten in der Psychiatrie - Beeinträchtigungen der Psyche?
 Subklinische Schilddrüsenkrankheiten in der Psychiatrie - Beeinträchtigungen der Psyche? Jürgen Deckert Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Münster, 11.12.2004 Subklinische Schilddrüsenkrankheiten
Subklinische Schilddrüsenkrankheiten in der Psychiatrie - Beeinträchtigungen der Psyche? Jürgen Deckert Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Münster, 11.12.2004 Subklinische Schilddrüsenkrankheiten
Stationäre Psychosenpsychotherapie
 Stationäre Psychosenpsychotherapie Tagung Gute Praxis psychotherapeutischer Versorgung: Psychosen Berlin, 18. April 2012 Bert Hager LVR-Klinik Bonn Überblick Bedeutung der stationären Ps.-Th. in der Klinik
Stationäre Psychosenpsychotherapie Tagung Gute Praxis psychotherapeutischer Versorgung: Psychosen Berlin, 18. April 2012 Bert Hager LVR-Klinik Bonn Überblick Bedeutung der stationären Ps.-Th. in der Klinik
Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Borwin Bandelow: Medikamentöse Therapie der generalisierten Angststörung
 Medikamentöse Therapie der generalisierten Angststörung Von Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Borwin Bandelow Frankfurt am Main (17. November 2005) - Angststörungen sind die häufigsten psychiatrischen Erkrankungen.
Medikamentöse Therapie der generalisierten Angststörung Von Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Borwin Bandelow Frankfurt am Main (17. November 2005) - Angststörungen sind die häufigsten psychiatrischen Erkrankungen.
Seelische Gesundheit in der Kindheit und Adoleszenz
 Seelische Gesundheit in der Kindheit und Adoleszenz Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf Forschungssektion Child Public Health Auszug aus dem Vortrag in Stade am 09.10.2013 1 Public Health Relevanz In
Seelische Gesundheit in der Kindheit und Adoleszenz Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf Forschungssektion Child Public Health Auszug aus dem Vortrag in Stade am 09.10.2013 1 Public Health Relevanz In
Psychosozialer Dienst Burgenland GmbH. in Zahlen. Sabine Birner
 Psychosozialer Dienst Burgenland GmbH in Zahlen 2012 Sabine Birner 1 Aktuelle Leistungszahlen Im PSD Burgenland wurden im Vorjahr insgesamt 4312 Personen mit mehr als 39195 Leistungen behandelt und betreut.
Psychosozialer Dienst Burgenland GmbH in Zahlen 2012 Sabine Birner 1 Aktuelle Leistungszahlen Im PSD Burgenland wurden im Vorjahr insgesamt 4312 Personen mit mehr als 39195 Leistungen behandelt und betreut.
Priv.- Doz. Dr. A. Bechdolf, M. Sc., Associate Professor
 1. Klinscher und wissenschaftlicher Werdegang: Studium: 10/1987 bis 12/1994 Humanmedizin an der Rheinisch Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen und an der Freien Universität (FU) Berlin Approbation:
1. Klinscher und wissenschaftlicher Werdegang: Studium: 10/1987 bis 12/1994 Humanmedizin an der Rheinisch Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen und an der Freien Universität (FU) Berlin Approbation:
Kognitive Verhaltenstherapie bei Personen mit erhöhtem Psychoserisiko
 Klinische Praxis Andreas Bechdolf Verena Pützfeld Jörn Güttgemanns Sonja Groß Kognitive Verhaltenstherapie bei Personen mit erhöhtem Psychoserisiko Ein Behandlungsmanual Mit Geleitworten von Prof. Patrick
Klinische Praxis Andreas Bechdolf Verena Pützfeld Jörn Güttgemanns Sonja Groß Kognitive Verhaltenstherapie bei Personen mit erhöhtem Psychoserisiko Ein Behandlungsmanual Mit Geleitworten von Prof. Patrick
Aripiprazol-Depot Vorteile von Depot-Antipsychotika frühzeitig nutzen
 Aripiprazol-Depot Vorteile von Depot-Antipsychotika frühzeitig nutzen Berlin (27. November 2015) - Der wahrscheinliche Therapieerfolg bei Schizophrenie sinkt sukzessive, je länger die Erkrankung unbehandelt
Aripiprazol-Depot Vorteile von Depot-Antipsychotika frühzeitig nutzen Berlin (27. November 2015) - Der wahrscheinliche Therapieerfolg bei Schizophrenie sinkt sukzessive, je länger die Erkrankung unbehandelt
Schizophrenie. Symptomatik
 Schizophrenie Symptomatik Diagnostik Krankheitsverlauf Ätiologie Prävention und Intervention von Christoph Hopfner Symptomatik Fundamentale Störung des Denkens, Wahrnehmens, Handelns und Affekts Positive
Schizophrenie Symptomatik Diagnostik Krankheitsverlauf Ätiologie Prävention und Intervention von Christoph Hopfner Symptomatik Fundamentale Störung des Denkens, Wahrnehmens, Handelns und Affekts Positive
Psychosozial oder Neurobiologisch: Was hat Zukunft? Einführung in die Thematik
 Institut für evidenzbasierte Psychopharmakotherapie (IEP) Psychosozial oder Neurobiologisch: Was hat Zukunft? Einführung in die Thematik Prof. Dr.med. Dipl.-Psych. Gerd Laux Wasserburg am Inn / München
Institut für evidenzbasierte Psychopharmakotherapie (IEP) Psychosozial oder Neurobiologisch: Was hat Zukunft? Einführung in die Thematik Prof. Dr.med. Dipl.-Psych. Gerd Laux Wasserburg am Inn / München
Schizophrenie: früh h erkennen optimal behandeln
 10 Jahre Kompetenznetze in der Medizin Schizophrenie: früh erkennen optimal behandeln Gefördert vom Schizophrenie: früh h erkennen optimal behandeln Univ.-Prof. Dr. med. Wolfgang Gaebel Sprecher des KNS
10 Jahre Kompetenznetze in der Medizin Schizophrenie: früh erkennen optimal behandeln Gefördert vom Schizophrenie: früh h erkennen optimal behandeln Univ.-Prof. Dr. med. Wolfgang Gaebel Sprecher des KNS
Zur Evidenzlage der psychotherapeutischen Akut und Erhaltungsbehandlung Bipolarer Störungen erste Ergebnisse eines neuen Cochrane Reviews
 Zur Evidenzlage der psychotherapeutischen Akut und Erhaltungsbehandlung Bipolarer Störungen erste Ergebnisse eines neuen Cochrane Reviews Hintergrund Psychotherapie hat sich als eine Säule der (adjuvanten)
Zur Evidenzlage der psychotherapeutischen Akut und Erhaltungsbehandlung Bipolarer Störungen erste Ergebnisse eines neuen Cochrane Reviews Hintergrund Psychotherapie hat sich als eine Säule der (adjuvanten)
Prävention von schizophrenen Erkrankungen. Geht das?
 Prävention von schizophrenen Erkrankungen. Geht das? Prof. Dr. A. Bechdolf Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik Vivantes Klinikum am Urban und Vivantes Klinikum im Friedrichshain Akademische
Prävention von schizophrenen Erkrankungen. Geht das? Prof. Dr. A. Bechdolf Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik Vivantes Klinikum am Urban und Vivantes Klinikum im Friedrichshain Akademische
2016 Kuske, B. Kuske, B. Kuske, B. Kuske, B. Kuske, B.
 2016 Kuske, B., Wolff, C., Gövert, U. & Müller, S.V. (under review). Early detection of dementia in people with an intellectual disability A German pilot study. Müller, S.V., Kuske, B., Gövert, U. & Wolff,
2016 Kuske, B., Wolff, C., Gövert, U. & Müller, S.V. (under review). Early detection of dementia in people with an intellectual disability A German pilot study. Müller, S.V., Kuske, B., Gövert, U. & Wolff,
Online Therapien. für PatientInnen mit Depressionen, Posttraumatischer Belastungsstörung und schwerer Trauer
 Online Therapien für PatientInnen mit Depressionen, Posttraumatischer Belastungsstörung und schwerer Trauer Prof. Dr. Dr. Andreas Maercker Psychopathologie und Klinische Intervention Psychotherapie Forschung
Online Therapien für PatientInnen mit Depressionen, Posttraumatischer Belastungsstörung und schwerer Trauer Prof. Dr. Dr. Andreas Maercker Psychopathologie und Klinische Intervention Psychotherapie Forschung
Plazebo: Risiko in klinischen Prüfungen und ethisch bedenklich?
 Plazebo: Risiko in klinischen Prüfungen und ethisch bedenklich? Dr. Karl Broich Bundesinstitut für Arzneimittel Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 38, D-53175 Bonn Schein-OP (Sham-Procedures) Ideales Arzneimittel
Plazebo: Risiko in klinischen Prüfungen und ethisch bedenklich? Dr. Karl Broich Bundesinstitut für Arzneimittel Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 38, D-53175 Bonn Schein-OP (Sham-Procedures) Ideales Arzneimittel
Bipolare Störungen frühzeitig therapieren. Überblick. Überblick
 Bipolare frühzeitig therapieren Bedeutung von Früherkennung und Frühintervention Andrea Pfennig Symposium DGBS JT 2010 Frühzeitige Diagnose und früher Therapiebeginn Seite 1 Seite 2 Seite 3 Seite 4 1 Zeit
Bipolare frühzeitig therapieren Bedeutung von Früherkennung und Frühintervention Andrea Pfennig Symposium DGBS JT 2010 Frühzeitige Diagnose und früher Therapiebeginn Seite 1 Seite 2 Seite 3 Seite 4 1 Zeit
Schizophrenie. Krankheitsbild und Ursachen
 Schizophrenie Krankheitsbild und Ursachen Inhalt Definition Zahlen und Daten Symptomatik Positivsymptome Negativsymptome Ursachen Diagnostik Klassifikation Verlauf und Prognose 2 Schizophrenie - Krankheitsbild
Schizophrenie Krankheitsbild und Ursachen Inhalt Definition Zahlen und Daten Symptomatik Positivsymptome Negativsymptome Ursachen Diagnostik Klassifikation Verlauf und Prognose 2 Schizophrenie - Krankheitsbild
Harlich H. Stavemann (Hrsg.) KVT update. Neue Entwicklungen und Behandlungsansätze in der Kognitiven Verhaltenstherapie
 Harlich H. Stavemann (Hrsg.) KVT update Neue Entwicklungen und Behandlungsansätze in der Kognitiven Verhaltenstherapie Vorwort 11 Einleitung 12 1 Kognitive Psychodiagnostik: Diagnose Problemanalyse - Behandlungsplanung
Harlich H. Stavemann (Hrsg.) KVT update Neue Entwicklungen und Behandlungsansätze in der Kognitiven Verhaltenstherapie Vorwort 11 Einleitung 12 1 Kognitive Psychodiagnostik: Diagnose Problemanalyse - Behandlungsplanung
Früherkennung schizophrener Psychosen
 Früherkennung schizophrener Psychosen Fortbildungsveranstaltung der LV Baden und Rheinland-Pfalz des VDBW PD Dr. M. Zink mathias.zink@zi-mannheim.de Früherkennung schizophrener Psychosen - Das Zentralinstitut
Früherkennung schizophrener Psychosen Fortbildungsveranstaltung der LV Baden und Rheinland-Pfalz des VDBW PD Dr. M. Zink mathias.zink@zi-mannheim.de Früherkennung schizophrener Psychosen - Das Zentralinstitut
Psychiatrische Versorgung für traumatisierte Flüchtlinge
 Psychiatrische Versorgung für traumatisierte Flüchtlinge Dr. Michael Brune Psychiater haveno - Psychotherapie und interkulturelle Kommunikation - www.haveno.de Traumatisierte Flüchtlinge sind fast nie
Psychiatrische Versorgung für traumatisierte Flüchtlinge Dr. Michael Brune Psychiater haveno - Psychotherapie und interkulturelle Kommunikation - www.haveno.de Traumatisierte Flüchtlinge sind fast nie
Depression. Was ist das eigentlich?
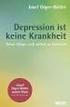 Depression Was ist das eigentlich? Marien Hospital Dortmund Kath. St.-Johannes-Gesellschaft Dr. med. Harald Krauß Chefarzt Tel: 0231-77 50 0 www.marien-hospital-dortmund.de 1 Selbsttest Leiden Sie seit
Depression Was ist das eigentlich? Marien Hospital Dortmund Kath. St.-Johannes-Gesellschaft Dr. med. Harald Krauß Chefarzt Tel: 0231-77 50 0 www.marien-hospital-dortmund.de 1 Selbsttest Leiden Sie seit
Psychologische Interventionen bei Personen mit erhöhtem Psychoserisiko
 Psychotherapeut 2013 DOI 10.1007/s00278-013-0996-2 Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013 Hendrik Müller 1 Andreas Bechdolf 2 1 Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Universitätsklinik
Psychotherapeut 2013 DOI 10.1007/s00278-013-0996-2 Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013 Hendrik Müller 1 Andreas Bechdolf 2 1 Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Universitätsklinik
Psychosoziale Beratung in der Suchttherapie Welche Zukunft hat die Soziale Arbeit?
 Psychosoziale Beratung in der Suchttherapie Welche Zukunft hat die Soziale Arbeit? Beat Kläusler M.A. beat.klaeusler@puk.zh.ch Übersicht Wie es war Wie es ist Wie es sein könnte Erstgespräch Tag 1 Herr
Psychosoziale Beratung in der Suchttherapie Welche Zukunft hat die Soziale Arbeit? Beat Kläusler M.A. beat.klaeusler@puk.zh.ch Übersicht Wie es war Wie es ist Wie es sein könnte Erstgespräch Tag 1 Herr
Ulrich Schweiger Oliver Korn Lotta Winter Kai Kahl Valerija Sipos
 Inhaltsübersicht Vorwort Einleitung 11 12 1 Problemorientierte Kognitive Psychodiagnostik: Diagnose - Problemanalyse - Behandlungsplanung Harlich H. Stavemann 19 2 KVT bei Kindern und Jugendlichen Angelika
Inhaltsübersicht Vorwort Einleitung 11 12 1 Problemorientierte Kognitive Psychodiagnostik: Diagnose - Problemanalyse - Behandlungsplanung Harlich H. Stavemann 19 2 KVT bei Kindern und Jugendlichen Angelika
Ursachen für abusive behaviour in der häuslichen Pflege Ergebnisse der Angehörigenforschung. Prof. Dr. med. Elmar Gräßel
 Ursachen für abusive behaviour in der häuslichen Pflege Ergebnisse der Angehörigenforschung Prof. Dr. med. Elmar Gräßel Zentrum für Medizinische Versorgungsforschung, Psychiatrische Universitätsklinik
Ursachen für abusive behaviour in der häuslichen Pflege Ergebnisse der Angehörigenforschung Prof. Dr. med. Elmar Gräßel Zentrum für Medizinische Versorgungsforschung, Psychiatrische Universitätsklinik
Was ist eine Psychose?... eine komplexe Störung des Selbst- und Weltbezuges bzw. eine fundamentale Störung des Realitätsbezuges.
 Was ist eine Psychose?... eine komplexe Störung des Selbst- und Weltbezuges bzw. eine fundamentale Störung des Realitätsbezuges. Was ist eine Psychose?...komplexe Störung des Selbst- und Weltbezuges Produktive
Was ist eine Psychose?... eine komplexe Störung des Selbst- und Weltbezuges bzw. eine fundamentale Störung des Realitätsbezuges. Was ist eine Psychose?...komplexe Störung des Selbst- und Weltbezuges Produktive
Epidemiologie. Vorlesung Klinische Psychologie, WS 2009/2010
 Epidemiologie Prof. Tuschen-Caffier Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie Universität Freiburg Sprechstunde: Mi, 14.00 15.00 Uhr, Raum 1013 Vorlesung Klinische Psychologie, WS 2009/2010
Epidemiologie Prof. Tuschen-Caffier Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie Universität Freiburg Sprechstunde: Mi, 14.00 15.00 Uhr, Raum 1013 Vorlesung Klinische Psychologie, WS 2009/2010
Fortschritt in der Schizophrenietherapie INVEGA stark wirksam gegen die Symptome der Schizophrenie
 Fortschritt in der Schizophrenietherapie INVEGA stark wirksam gegen die Symptome der Schizophren Fortschritt in der Schizophrenietherapie INVEGA stark wirksam gegen die Symptome der Schizophrenie Köln
Fortschritt in der Schizophrenietherapie INVEGA stark wirksam gegen die Symptome der Schizophren Fortschritt in der Schizophrenietherapie INVEGA stark wirksam gegen die Symptome der Schizophrenie Köln
Interventionsstudien
 Interventionsstudien Univ.-Prof. DI Dr. Andrea Berghold Institut für Med. Informatik, Statistik und Dokumentation Medizinische Universität Graz Vorgangsweise der EBM 1. Formulierung der relevanten und
Interventionsstudien Univ.-Prof. DI Dr. Andrea Berghold Institut für Med. Informatik, Statistik und Dokumentation Medizinische Universität Graz Vorgangsweise der EBM 1. Formulierung der relevanten und
Seminar: Schizophrenie: Intervention. Dr. V. Roder, FS 2009. Psychoedukation. Nadine Wolfisberg
 Seminar: Schizophrenie: Intervention Dr. V. Roder, FS 2009 Psychoedukation Nadine Wolfisberg 28. April 2009 Definition Psychoedukation Ziele der Psychoedukation Verschiedene Methoden Praktische Durchführung:
Seminar: Schizophrenie: Intervention Dr. V. Roder, FS 2009 Psychoedukation Nadine Wolfisberg 28. April 2009 Definition Psychoedukation Ziele der Psychoedukation Verschiedene Methoden Praktische Durchführung:
Herzinsuffizienz und Depression was ist notwendig zu beachten
 Herzinsuffizienz und Depression was ist notwendig zu beachten 1 8. 1 1. 2 0 1 6 D R E S D E N H I L K A G U N O L D H E R Z Z E N T R U M L E I P Z I G U N I V E R S I T Ä T L E I P Z I G Hintergründe
Herzinsuffizienz und Depression was ist notwendig zu beachten 1 8. 1 1. 2 0 1 6 D R E S D E N H I L K A G U N O L D H E R Z Z E N T R U M L E I P Z I G U N I V E R S I T Ä T L E I P Z I G Hintergründe
Erhaltungstherapie mit Erlotinib verlängert Gesamtüberleben bei fortgeschrittenem NSCLC
 SATURN-Studie: Erhaltungstherapie mit Erlotinib verlängert Gesamtüberleben bei fortgeschrittenem NSCLC Grenzach-Wyhlen (13. August 2009) - Aktuelle Daten der SATURN-Studie bestätigen eine signifikante
SATURN-Studie: Erhaltungstherapie mit Erlotinib verlängert Gesamtüberleben bei fortgeschrittenem NSCLC Grenzach-Wyhlen (13. August 2009) - Aktuelle Daten der SATURN-Studie bestätigen eine signifikante
Diabetes mellitus Relevante Qualitätsdaten mit Blick auf Prävention und Therapie
 Diabetes mellitus Relevante Qualitätsdaten mit Blick auf Prävention und Therapie Qualitätsdaten im Gesundheitswesen allianzq- Stoos VIII 16. Juni, 2017 Prof. Dr. Michael Brändle, M.Sc. Chefarzt Allgemeine
Diabetes mellitus Relevante Qualitätsdaten mit Blick auf Prävention und Therapie Qualitätsdaten im Gesundheitswesen allianzq- Stoos VIII 16. Juni, 2017 Prof. Dr. Michael Brändle, M.Sc. Chefarzt Allgemeine
Informationstag 2017 Schweizerische Gesellschaft für Zwangsstörungen
 Informationstag 2017 Schweizerische Gesellschaft für Zwangsstörungen Diagnostik und Therapie der Zwangsstörungen bei Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen Michael Rufer, Susanne Walitza Merkmale von Zwangsgedanken,
Informationstag 2017 Schweizerische Gesellschaft für Zwangsstörungen Diagnostik und Therapie der Zwangsstörungen bei Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen Michael Rufer, Susanne Walitza Merkmale von Zwangsgedanken,
Lichttherapie hilft bei Depression in der Schwangerschaft
 Lichttherapie hilft bei Depression in der Schwangerschaft Basel, Schweiz (7. April 2011) - Schwangeren, die an einer Depression leiden und aus Angst vor Nebenwirkungen auf die Einnahme von antidepressiven
Lichttherapie hilft bei Depression in der Schwangerschaft Basel, Schweiz (7. April 2011) - Schwangeren, die an einer Depression leiden und aus Angst vor Nebenwirkungen auf die Einnahme von antidepressiven
Psychotherapie: Manuale
 Psychotherapie: Manuale Frank Petrak Diabetes und Depression Ein kognitiv-verhaltenstherapeutisches Manual Mit 12 Abbildungen Unter Mitarbeit von Stephan Herpertz und Matthias J. Müller 123 Frank Petrak
Psychotherapie: Manuale Frank Petrak Diabetes und Depression Ein kognitiv-verhaltenstherapeutisches Manual Mit 12 Abbildungen Unter Mitarbeit von Stephan Herpertz und Matthias J. Müller 123 Frank Petrak
BARMER ARZTREPORT Psychische Gesundheit bei Studierenden und anderen jungen Erwachsenen
 BARMER ARZTREPORT Psychische Gesundheit bei Studierenden und anderen jungen Erwachsenen Dr. rer. nat. habil. David Daniel Ebert Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Institut für Gesundheitstrainings
BARMER ARZTREPORT Psychische Gesundheit bei Studierenden und anderen jungen Erwachsenen Dr. rer. nat. habil. David Daniel Ebert Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Institut für Gesundheitstrainings
Überlegungen zu einer individualisierten Therapie bei Demenzen
 Überlegungen zu einer individualisierten Therapie bei Demenzen Prof. Dr. med. Elmar Gräßel Zentrum für Medizinische Versorgungsforschung und Bereich Med. Psychologie und Med. Soziologie, Psychiatrische
Überlegungen zu einer individualisierten Therapie bei Demenzen Prof. Dr. med. Elmar Gräßel Zentrum für Medizinische Versorgungsforschung und Bereich Med. Psychologie und Med. Soziologie, Psychiatrische
Jenseits des Denkens in Täter- und Opferprofilen
 Jenseits des Denkens in Täter- und Opferprofilen Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Michael Huss Kognitive versus emotionale Empathie - Mobbing war inbesondere mit kogntiver Empathie negativ assoziiert Van Noorden
Jenseits des Denkens in Täter- und Opferprofilen Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Michael Huss Kognitive versus emotionale Empathie - Mobbing war inbesondere mit kogntiver Empathie negativ assoziiert Van Noorden
