Wolfram Hiebsch Bier und Brauwesen von den Anfängen bis in die Frühe Neuzeit
|
|
|
- Frieder Becke
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Abbildung 1: Bild aus einem Pharaonengrab: Zuerst wird Brot halb gar gebacken, dann zerbröckelt und mit Dattelmus vermengt, mit Wasser aufgegossen, gefiltert und im Bottich zu Ende gegoren. Wolfram Hiebsch Bier und Brauwesen von den Anfängen bis in die Frühe Neuzeit 1. Eine kurze Geschichte des Bieres 9000 v. Chr. In Anatolien wurden Jahre alte Bierrückstände in 240 Liter fassenden Steinkrügen für kultische Handlungen (wegen der berauschenden Wirkung) gefunden. Wegen seiner heilenden Wirkung (da keimfrei) und da es verdauungsfördernd ist und günstig sein soll für Schwangere, wurde Bier zu allen Zeiten geschätzt. Natürlich wurde es insbesondere wegen der berauschenden Wirkung von Anfang an zu kultischen Zwecken verwendet und lustig geht s dabei ja auch zu. Hildegard von Bingen (um 1100) sagt dazu: Das Bier macht das Fleisch des Mannes fett und gibt seinem Antlitz eine schöne Farbe durch die Kraft und den guten Saft des Getreides v. Chr. Die Sumerer hinterlassen ein schriftliches Bierrezept: aus feuchten Emmerfladen mit Honig, Zimt, Safran und Anis. Iss das Brot, das gehört zum Leben, trinke das Bier, wie es im Leben Brauch ist. Gilgamesch Epos, sumerisch, 3. Jhtsd. v. Chr 1500 v. Chr. Die Babylonier haben 20 verschiedene Biersorten. Schmidmeier/Hiebsch (Hrsg.), Deuerlinger Brau- und Wirtshausgeschichte seit
2 1500 v. Chr. Die ägyptischen Herrscher bezahlen ihre Beamten und Soldaten mit Brot und Bier (Bier ist Grundnahrungsmittel). 500 v. Chr. Bei den Griechen, Juden und Römern trinken die Armen Bier in großen Mengen, die Reichen dagegen Wein. 100 v. Chr. Die Römer (Cäsar) lernen bei den Kelten (die in dieser Zeit auch Bayern und unser Gebiet besiedeln) im heutigen Frankreich gutes Bier kennen und schätzen. Um Chr. Geburt Die Germanen brauen ihr Bier nicht mehr wie bisher aus gärenden Brotfladen, sondern wie heute aus keimendem und dann getrocknetem Getreide (= Malz) mit Myrte, Eschenlaub und Eichenrinde. Sie glauben, dass ihre Götter Wotan, Frigga und Thor Bier brauen, wenn sie dicke Wolken am Himmel sehen. 5. bis 9. Jhdt. Bierbrauen in unbegrenzter Menge war ein Brauch und ein Recht für jeden Germanen (743 festgehalten im Lex Baiuvariorum = Gesetz der Bayern unter Herzog Odilo). Auch in den Königshöfen und Königsstationen (wie Deuerling) wurde viel gebraut und getrunken, so trank auch Kaiser Karl der Große (um 800) erhebliche Mengen Bier. In den Klöstern wurde dickes und kräftiges Bier, auch gegen den Hunger in der Fastenzeit, von spezialisierten Mönchen gebraut und hatte deshalb eine bessere Qualität als das der Bauern, die damals sicher noch mehr Heiden als Christen waren. Trink opfer an ihren Gott Wotan waren noch lange üblich. Ende des 7. Jahrhunderts dichteten deshalb die Mönche des heiligen Columbans: Ihr opfert Bier den Göttern? Ei, was ficht Euch an? Schickt s lieber uns ins Kloster! So ruft Sankt Columban! 10 Regensburger kleine Beiträge zur Heimatforschung, Heft 7 Abbildung 2: Bildliche Darstel lung der Getreideernte im Aug(ust), Monatsbilder in der Salzburger Handschrift Clm 210, um 818.
3 Abbildung 3: Winzer bei der Arbeit, um (aus: Anger, Mittelalterliche Berufe) (aus: Hausbuch der Mendelsch. Zw., Bd. 1) Im Kloster St. Gallen galt um 900 die Regel: Täglich 7 Essen mit reichlich Brot und nicht mehr als 5 Mass Bier und ein Essen mit einer Mass Wein. Da auch Reisende und Pilger versorgt wurden, entstanden Klosterschenken. Im Benediktinerkloster Weihenstephan, gegründet im Jahr 725, existierte nachgewiesener Maßen bereits im 9. Jhdt. eine Klosterbrauerei mit Schenke. Um diese Zeit verkaufte das Benediktinerkloster in Nürnberg 4500 Eimer Bier pro Jahr, was 3000 Hektolitern entspricht ist die Brauerei im Kloster Weltenburg schriftlich bezeugt, auch wenn dort schon viel früher gebraut wurde. Etwas später gab es dann ca. 300 Klosterbrauereien in Bayern. Um 1200 erteilte der Landesherr, im Gegensatz zu früher, als jeder brauen durfte, das Braurecht gegen Abgaben. So entstanden auch einige weltliche Brauereien, die aber wegen Steuern und Arbeitslöhnen viel teurer produzierten als die Klosterbrauereien. Erstere wurden aber von den Landesherren gefördert, da sie damit Einnahmen erzielen konnten, weshalb sogar einige Klosterbrauereien als lästige Konkurrenten durch die Landes herren verboten wurden. Im Süden Deutschlands wurde aber trotzdem wesentlich mehr Wein bzw. Birnenmost getrunken, weil die Wasserqualität insbesondere in den Städten schlecht war und wegen des wärmeren Klimas der Wein besser gedieh als in Norddeutschland, wo zu dieser Zeit das Schmidmeier/Hiebsch (Hrsg.), Deuerlinger Brau- und Wirtshausgeschichte seit
4 Brauereiwesen deshalb erheblich tärker ausgeprägt war. Trotzdem lebten die einfachen Leute meist von Brot und Bier; oft gegessen wurde auch die Bier- Brot-Suppe. In solchen Häusern wurde für den Eigenverbrauch gebacken und gebraut (schon Rumpelstilzchen sagt: heute back ich, morgen brau ich... ). Aus Sicherheitsgründen wurde dies aber in den Holzhäusern der Dörfer und den eng bebauten Städten im 13. Jhdt. untersagt, so dass Gemeinschaftsbacköfen und Brauereien in Steingebäuden benutzt werden mussten. Man teilte sich diese in einer festgelegten Reihenfolge und brachte die entsprechenden Rohstoffe mit. Auch das lag im Interesse der Landesherren, für Deuerling jetzt der bayerische Wittelsbacher Herzog, da diese die Braurechte an einzelne Untertanen gegen Gebühren vergaben. Kaiser Friedrich II. gewährte seiner freien Reichsstadt Regensburg im Jahr 1250 das volle Braurecht und damit jedem Bürger. Bier aus Norddeutschland, auch aus Dortmund, wurde bis ins 16. Jhdt. in ganz Europa gehandelt. Damit verbunden ist der Aufstieg der Hansestädte, die insbesondere Bier nach Skandinavien verkauften. Einem Matrosen standen z. B. 12 Mass Bier pro Tag zu. Die Brauer einer Stadt schlossen sich zu Zünften zusammen. Das bedeutete einen Bierzwang: Kein fremdes Bier durfte eingeführt oder getrunken werden, was die Qualität wegen der Spezialisierung einerseits steigerte, andererseits aber auch senkte, da keine echte Konkurrenz vorhanden war. Abbildung 4: Bierprobe im 15. Jahrhundert: Das Fastenbier war stark genug, wenn nach zweistündigem Sitzen der Ratsherren die Bank beim gleichzeitigen Aufstehen kleben blieb. 12 Regensburger kleine Beiträge zur Heimatforschung, Heft 7
5 In Süddeutschland wurde aber auch, wie schon erwähnt, viel Wein getrunken. Auch Deuerling ist vom Thema Wein betroffen: So wird bei der ersten schriftlichen Nennung Deuerlings um 1150 auch der Weinbau mit erwähnt. In den Traditionen des Klosters Prüfening ist folgende Besitzübertragung zu finden: Eberhart de Scorgaste acceptis a fratribus XL talentis et carada vini tradidit monasterio sancti Georgii predium quale in Tuerlingin habere visus est 2 (zu Deutsch: Nachdem Eberhart von Schorgaste von den Mönchen 40 Talente und 40 Weinstöcke erhalten hatte, übergab er dem Klosters des hl. Georg (Prüfening) ein Anwesen den Stegenhof, das er in Deuerling besaß). Der Deuerlinger Pfarrer Johannes Grasser, später Abt des Klosters Prüfening, besaß einen Weinberg zu (Maria-) Ort, den er 1495 verkaufte. 3 Schließlich erfahren wir noch vom Weinanbau hinterm Stegenhof, der sogar noch 1849 existierte, ebenso wie ein Hopfengarten. 4 Deshalb forderte der bayerische Herzog Stephan II seine Untertanen sogar extra zum privaten Bierbrauen auf, da er an den Einnahmen beteiligt sein wollte erlässt der Rat der Stadt Regensburg eine Brauordnung nach der die Brauer schwören mussten, dass weder Samen noch Gewürz oder Gestrüpp verwendet werden. Bei Zuwiderhandlung war als Strafe das Trinken des eigenen elenden Biers angedroht. Solche Gebote waren notwendig, da die Brauer ihr Bier mit Ochsengalle, Pech, Schlangenkraut, Eiern, Ruß, Kreide und Ähnlichem versetzten, um es haltbarer zu machen und den Geschmack sauer gewordenen Biers zu überdecken. Auf einem Marterl aus dieser Zeit ist die Inschrift zu finden: Bet Wandersmann, bet drei Vaterunser, hier liegt ein arger Bierverhunzer. Menschen erkrankten und starben sogar nach dem Trinken solchen Bieres. Schmidmeier/Hiebsch (Hrsg.), Deuerlinger Brau- und Wirtshausgeschichte seit
6 Am 3. Juli 1473 wird das Wirtshaus in Steinerbrückl erstmals schriftlich erwähnt 5, als sich der Bruder Ludwig von Ingolstadt des bayerischen Herzogs Albrecht bei diesem wegen einer steuerlichen Auseinandersetzung in Bezug auf Deuerling und die Wirtschaft Steinerbrückl beschwert ( die Irrung, so Herzog Albrecht des Wirthes zu der Steinerbrucken halber, thut ). Auf der Karte von Christoph Vogel (oben) taucht es 1598 wieder auf. Vom Rat der Stadt München wurde 1447 in einer Brauordnung vorgeschrieben, nur noch Gerste, Hopfen und Wasser 6 beim Brauen zu verwenden; das gleiche Gebot wird 1493 für das Teilherzogtum Bayern-Landshut (Niederbayern) erlassen und schließlich in dieser Form am als Reinheitsgebot durch beide bayerischen Herzöge für Ober- und Niederbayern. Abbildung 5: Kopie des Reinheitsgebots aus der bayerischen Landesordnung von Da ab 1505 das Teilherzogtum Pfalz-Neuburg von Bayern getrennt worden war, galt es wohl dort zunächst nicht holte dann Pfalzgraf Friedrich dies für die Obere Pfalz nach. Dadurch wurde die Bierqualität in Bayern allmählich besser, insbesondere weil Bierschauer, auch Bierkieser 7 genannt, diese ständig kontrollierten. Weizen durfte nicht verwendet werden, da er für das Brot gebraucht wurde wird zum ersten Mal die Tafern (= Großwirtschaft) in Deuerling (heutige Brauerei Goss) schriftlich im Salbuch des Pflegamts Laber bezeugt. 14 Regensburger kleine Beiträge zur Heimatforschung, Heft 7
7 Ab 1550 importierten die bayerische Herzöge regelmäßig gutes Bier aus Einbeck in Niedersachsen, wegen des Stadtnamens auch Bock genannt. Aber auf Dauer war dies wegen des großen Bierkonsums am Hof zu teuer. Die Münchner spotteten: Es war ein Herzog in Bayern, den dürstete gar sehr; er hatte auch viele Diener, die dürstete noch mehr! Deswegen betrieben die Herzöge ihre eigene Brauerei, das Münchner Hofbräuhaus, ab 1604 auch das Regensburger Hofbräuhaus wurde der Erlass veröffentlicht, dass untergäriges Bier in der Kühle herzustellen sei. Wegen der Haltbarkeit wurde es im März kräftiger gebraut und war im kühlen Sommerkeller (6 C bis 9 C) zu lagern und heißt deswegen bis heute Märzen. Davor wurde meist nur im Winter Bier hergestellt. Abbildung 6: Auf einer der Karten, die Christoph Vogel zur Bestandsaufnahme des Herzogtums Pfalz-Neuburg 1598 anfertigte, ist Deuerling dargestellt: Im Zentrum die Laberbrücke und darunter die ehemalige Tafernwirtschaft (heute Goss) mit der Fahne. Am Bildrand ganz rechts ist die Steinerbrückler Schenkstadt gezeichnet. Schmidmeier/Hiebsch (Hrsg.), Deuerlinger Brau- und Wirtshausgeschichte seit
8 Ab 1610 wurde in den Hofbräuhäusern auch für Wirte und Privatleute gebraut und damit viel Geld verdient, da extrem viel getrunken wurde. Max I. bezahlte von diesen Einnahmen sogar den 30-jährigen Krieg. Dieser zerstörte in Norddeutschland die Brauereien, in Süddeutschland die immer noch zahlreichen Weinberge. In Deuerling erhielt 1607 Paul Meisinger von der Pfalz-Neuburgschen Regierung das Recht, Bier für den Eigenverbrauch seiner immer durstigen Hammerknechte zu brauen (... wurde auf das Meüsingersches Hammerguett Von Weylandt Pfalzgawen Phillips Ludtwig die Gerechtigkeit pir zu preüen sovill es zur Hausnotürfft Consumiren kann) 8. Den Kupferhammer selbst hatte er 1580 erbaut. Wie lange diese kleine Brauerei überlebte, ist nicht bekannt. Da die in den eigenen Wohnhäusern für den Eigenbedarf brauende Bevölkerung eine erhebliche Brandgefahr hervorrief, bauten die größeren Kommunen, z. B. Hemau oder Laaber, steinerne Brauereien. Für Laaber ist ein solches Kommunbrauhaus bereits 1435 bezeugt 9, für Hemau Das Laaberer stand auf der Westseite des Marktplatzes unterhalb der Burg und war mit der Amtsstube (Rathaus) zusammengebaut. Auch die Wirte ließen dort von einem von der Kommune angestellten Braumeister ihr Bier brauen, so dass ab dieser Zeit in großen Gemeinden mit Kommunbrauhaus keine privaten Brauereien existierten. 16 Regensburger kleine Beiträge zur Heimatforschung, Heft 7 Abbildung 7: Darstellung des Laaberer Kommunbrauhauses (K), um 1800, auf dem Marktplatz direkt unter der Burg 11
9 Abbildung 8: Stich von Ludwig Richter: Tafern im Jahr 1512, also wie die Deuerlinger Tafern, Biertrinker mit Wirt, der Kranz zeigt an, dass es Bier gibt. Der Kamin der Brauerei raucht. Dazu brachten die Wir te die Rohstoffe und das Brennmaterial mit und fuhren dann den frischen Sud (ca. 20 Hek to liter) im Fass nach hause, wo er im Keller gärte, mindestens 14 Tage, so war es vor geschrieben. Für die kalte Jahreszeit wurde obergäriges Bier bei höheren Temperaturen hergestellt, während für den Sommer das, wie schon erwähnt, stärkere Märzen gebraut und bei 6 C bis 9 C im Sommerkeller gelagert wurde. Für unsere Tafern befand sich dieser wohl im nahe gelegenen Felsen gegenüber dem Geigeranwesen. Auch wenn ein Wirt einer Schenkstatt im Gegensatz zum Tafernwirt nicht selbst brauen durfte, musste er wegen des Bierzwangs sein Bier aus der Kommunbrauerei seines Pflegamts beziehen. Solche gemeindeeigenen Kommunbrauereien entstanden im 16. Jhdt. in der ganzen Oberpfalz in vielen Orten. An den Tafernwirtschaften wurden Bierzeiger (Fahnen, Sterne oder Kränze) angebracht als Zeichen dafür, dass es Bier gab: Deshalb auch der Name Zoiglbier. Die Schenkstädten (also ohne eigene Brauerei) hatten keine solchen Bierzeichen (vgl. Vogelkarte: Die Tafern in Deuerling mit Bierfahne und die Schenkstatt in Steinerbrückl ohne Bierzeiger). Die zwei Schornsteine auf dem Gebäude zeigen an, dass bei der Tafern vermutlich Bier gebraut wurde. Die Wirtschaft in Steinerbrückl gehörte im 16. Jhdt. zur Hofmark Eichhofen und musste deshalb das Bier wegen des Bierzwangs aus der dortigen Brauerei beziehen; ebenso die mindestens seit dem 16. Jhdt. existierende Schenkstadt in der Deuerlinger Bodenhill, die aber auch zur Hofmark Eichhofen gehörte. Schmidmeier/Hiebsch (Hrsg.), Deuerlinger Brau- und Wirtshausgeschichte seit
10 Aus dem Jahr 1615 stammt eine Bierbrauordnung für He mau, die aber sicher so ähnlich für das Amt Laaber galt, zu dem ja auch der Deuerlinger Wirt gehörte. Bei einem Sud entstanden ca. 20 Hektoliter. Eine durchschnittliche Tafernwirtschaft schenkte etwa 100 Hektoliter aus. Da Deuerling an der Hauptverkehrsstraße Regensburg, Hemau, Nürnberg lag, ist wegen des Fuhrverkehrs für Salz, Vieh und Wein ein noch höherer Verbrauch von durchschnittlich 200 Maß pro Tag zu erwarten. Es wurde nicht nur zuhause, sondern auch in den Wirtschaften viel getrunken, so dass der Deuerlinger Wirt ca. zehn Mal im Jahr brauen musste. Für Laaber lässt sich für das 18. Jhdt. aus Brauereiaufzeichnungen errechnen, dass jeder Laaberer Bürger im Durchschnitt, also Kind oder Erwachsener, weiblich oder männlich, 4 Mass Bier pro Tag trank 12. Ein normaler, erwachsener Mann trank sicher wesentlich mehr. Eine Maß kostete einen Kreuzer, wobei der übliche Tageslohn für einen Handwerker bei 22 Kreuzern lag begann der Dreißigjährige Krieg. Im für Deuerling folgenschwersten Jahr 1633 zogen auf der Landstraße viele Truppenteile mit mehreren Tausend Soldaten der 18 Regensburger kleine Beiträge zur Heimatforschung, Heft 7 Abbildung 9: Pferdefuhrwerk vor Tafern (mit Fahne), dazu Hafertrog. (aus: Mühlheim, Geschichte und mehr) Abbildung 10 und 11: Umherziehende, brandschatzende und modernde Landsknechte. (aus: Landsknechte von Thomas Hilwig).
11 Abbildung 11: katholischen Liga und anschließend der Schweden durch Deuerling, machten auch teilweise Station, brandschatzten u. a. den Pfarrhof, verursachten also Elend und Chaos. Auch durch Armutsabwanderung und die Pest wird die Deuerlinger Bevölkerung auf ein Zehntel dezimiert. Ab 1655 wird aber der Großwürth Hanns Hunger mit seiner Frau mehrmals erwähnt, d.h. die Tafern hatte den Krieg überstanden, ebenso wie die zwei Schenkstädten Bodenhill und Steinerbrückl. Der Deuerlinger Chronist Joseph Pöppel schreibt im Jahr 1850, dass zu dieser Zeit der Tafernbrief, der 1770 von der Regierung ausgestellt worden war, noch existierte. 13 Zu Beginn des 19. Jhdts. wurde den Bürgern eine Reihe von Freiheiten als Folge der französischen Revolution gewährt. So galten die alten Tafernrechte, die den Wirten viel Geschäft und Macht gaben, nur bis Außerdem wurde in zwei Erlassen 1807 und 1811 die Aufhebung des Kommunbrauens durchgesetzt, so dass jetzt als Form der neuen Gewerbefreiheit Privatbrauereien errichtet werden konnten. Der Markt Laaber versteigerte sein Kommunbrauhaus 1808 an zwei Laaberer Wirte, die ab da privat weiter brauten. Schmidmeier/Hiebsch (Hrsg.), Deuerlinger Brau- und Wirtshausgeschichte seit
12 Der Bierzwang war aufgehoben, so dass jetzt auch von außerhalb der Kommunen bzw. der Pflegämter Bier von den Wirten für den Schankbetrieb gekauft werden konnte. Woher die Deuerlinger Taverne, die ja im 17. oder 18. Jhdt. die Brauerei aufgegeben hatte, das Bier jetzt bezog, ist nicht bekannt. Vielleicht aus Eichhofen, von wo auch die Wirtschaft in Steinerbrückl ihr Bier erhielt oder aus Hemau. Jedenfalls gab es in der Umgebung von Deuerling nur Brauereien in Laaber, Eichhofen, Etterzhausen und Hohenschambach. Der Deuerlinger Tafernwirt Salzhuber stellte 1844 deshalb den ersten Antrag auf eine eigene Brauerei, der aber von der Verwaltung wie meist in solchen Fällen, da der ablehnenden Haltung der umliegenden Brauereien stattgegeben wurde abgelehnt wurde. Durch die beginnende Industrialisierung in Bayern, in Deuerling durch zwei Spiegelglasschleifen, stieg der Handelsverkehr, auch auf der Straße durch Deuerling. Der Anteil der armen Leute stieg und damit die Nachfrage nach einem billigen und nahrhaften Lebensmittel, also dem Bier, dem Brot der armen Leute. Also stellte Salzhuber 1862 seinen zweiten Antrag, eine Brauerei errichten zu dürfen, dem diesmal stattgegeben wurde. 2. Die Klosterschenke in Pollenried Auch in der Nähe von und im Zusammenhang mit Deuerling gab es einst eine Klosterschenke gründete Ritter Konrad von Hohenfels im Auftrag des Regensburger Bischofs Konrad und des Bayerischen Herzogs Ludwig der Kelheimer in Pulenrieth (Pollenried) zum Heil seiner Seele ein Hospital als Vorläufer des Klosters Pielenhofen, welche beide von Zisterzienserinnen betrieben wurden. Dort wurden Kaufleute, Pilger, Wanderer und Arme und Bettler 1 mit Nahrung versorgt, wozu natürlich eine Klosterschenke nötig war. Das Hospital lag an der Hauptverkehrsstraße, auch als Königsstraße bezeichnet, von Regensburg über Deuerling und Hemau nach Nürnberg. Dazu verzichteten der Regensburger Bischof und der bayerische Herzog 20 Regensburger kleine Beiträge zur Heimatforschung, Heft 7
13 auf ihre Rechte in Pollenried, welches bis dahin zur Pfarrei Deuerling gehört hatte und zu dieser zehentpflichtig war, während die Pfarrei Deuerling eine Manse (Gut) im Tausch erhielt, die vorher Konrad von Ehrenfels als Reichslehen inne hatte. 2 So ganz nebenbei erfahren wir also auch, dass es in Deuerling ein ehemaliges Reichsgut, also königlichen Besitz gab. Einen Teil der Wiesen, die zum ehemaligen Reichsgut gehörten, übergab er an die Pfarrei (Pfaffenberg, Pfarrerplatte), während er den anderen Teil für das Hospitz in Pollenried zurückbehielt (Pollenrieder Höh). Dies wird durch den Deuerlinger Chronisten Pöppel bestätigt, der ca.1850 schreibt: Ursprünglich befand sich daselbst (in Pollenried), wie alte Männer von ihren Vorfahren sich erzählen ließen, ein Nonnenkloster, samt Kirche und Friedhof, dann eine dazugehörige Schenke (gegenwärtig das alte Wirtshaus genannt). Pöppel schreibt, dass es zu seiner Zeit noch die Gebäudereste gab Was ist eine Tafern (Tafernwirtschaft, wie früher unser Goss)? Das Wort Tafern geht auf das lateinische taberna zurück und wurde von den Römern über Europa verbreitet. Es bedeutet ursprünglich Hütte, dann aber Lokal an den römischen Fernstraßen, auch im besetzten Bayern. Als das römische Reich Ende des 5. Jhdts. zusammenbrach und die Römer abzogen, blieben die jetzt Abbildung 12: Die Bauernhochzeit von P. Bruegel, Das flämische Gemälde zeigt das Innere einer Tafern und wie die Gäste feiern. So ähnlich hat die Deuerlinger Tafern auch ausgesehen. von Germanen bzw. von Baiuvaren geführten Gastwirtschaften. Da sowieso jeder zu Hause Brot backte und Bier braute, tat man dies Schmidmeier/Hiebsch (Hrsg.), Deuerlinger Brau- und Wirtshausgeschichte seit
14 eben auch für Reisende und Gäste, so dass Brauerei und Wirtschaft im selben Gebäude lagen. Die Möglichkeit, privat Bier zu brauen, brachte überall Wirtschaften hervor, in denen auch übermäßig getrunken wurde. In einer Schankordnung von 1250 legte Herzog Ludwig der Strenge für Bayern u. a. fest, dass die Wirte nur mit behördlicher Genehmigung anschreiben durften und zwar bis zu 2 Gulden für Bauern und Arbeitsleute, bis zu 5 Gulden für Bürger, aber bis zu 10 für einen Geistlichen. 1 Damit sollte verhindert werden, dass die Menschen Haus und Hof vertranken. Abbildung 13: Der Wirt animiert Gäste, einzutreten. Holzschnitt, 1536, von Erhard Schön, gut zu erkennen sind die Reisenden zu Fuß und mit Karren. Erasmus von Rotterdam schrieb im 16. Jhdt. erstaunt: Es ist zum Verwundern, welches Lärmen und Schreien sich erhebt, wenn die Köpfe vom Trinken warm werden. Keiner versteht den anderen. Häufig mischen sich Possenreißer und Schalksnarren in diesen Tumult. Kaum glaublich, welche Freude die Deutschen an solchen Leuten finden, die durch ihren Gesang, ihr Geschwätz und Geschrei, ihre Sprünge und Prügeleien solch ein Getöse machen, dass die Wirtsstube einzustürzen droht. Keiner hört, was der andere sagt. Und doch glauben die Deutschen, so recht angenehm zu leben. 2 Große Wirtschaften, die auch Übernachtungen mit Speisen und Pferdeunterstände anboten, hießen Tafern oder vollkommene Wirtschaft mit einem Großwirt, denen ihre Rechte, aber auch Pflichten, durch einen Tafernbrief des Landesherrn vorgeschrieben wurden. Die Inhalte waren in ganz Mitteleuropa ähnlich. Zu den Rechten gehörte in der 22 Regensburger kleine Beiträge zur Heimatforschung, Heft 7
15 Regel der Ausschank von Bier, Wein und Branntwein, die Ausgabe von Speisen, auch das Bierbrauen und Brandweinbrennen, aber auch die Backgerechtigkeit. Hier ein Beispiel für einen solchen Brief von (Für unsere Gegend sind solche nicht erhalten): Leopold Carl. Frh. vom Stain, Herr zu Niderstotzingen, Bechenhaim und Bühel, verleiht dem Simon Beckhenstein seine Taferne mit dem Recht, darauf zu schenken, zu würthen, gemerz und huggerey mit Salz, Schmalz und dem damit Verbundenen zu treiben und den Flecken mit Brot zu versehen, dazu ein Feldlehen, beides auf Lebenszeit nach Tafern-, Schenken-, Huckerei- oder merzlin -Recht, mit allen Zugehörden (zu Dorf, Holz und Feld, an Äckern und Wiesen). Wegen Schenkstatt, Huckerei und Lehen hat Beckhensteindem A getreu, gehorsam, gerichts-, bot-, vogt-, reis- und steuerbar zu sein und ist dem Amit aller weltlichen Obrigkeit unterworfen. Er ist dem A auch zu täglichen Diensten mit Leuten und Rossen gesessen. Taferngeld und Herrengült (auf Martini zu Kasten und Behausung des A): 2 [Pfund] h in Münz, je 2 M Roggen, Vesen und Haber, 1 Henne, 100 Eier, 2 ß aus dem Krautgarten, von jedem ausgeschenkten Esßlinger Eimer Wein die 15. Maß oder 2 fl für Ungeld, alles Gienger Meß, Maß, Gewicht und Währung. Bei Nichtbezahlung von Gült, Zins, Ungeld, bei Nachlässigkeit (an Diensten, Maß und Gewicht), bei Wüstung, bei Versetzung von Taferne und Lehen ohne Wissen des A kann Beckhenstein vom A in Monatsfrist davon abgeboten werden. Nach Tod des Beckhenstein kann die Taferne von dessen Ehefrau oder einem mindestens 14 Jahre alten Kind (Sohn oder Tochter) gegen Zahlung von je 100 fl Bestandgeld und Abfahrt bestanden werden. Stirbt aber auch die Witwe ohne Hinterlassung eines mindestens 14 Jahre alten Kindes, fällt die Taferne heim. Beckhenstein kann die Taferne zu Lebzeiten verkaufen. Z[eugen]: Herr Conrad Daur und Wolff Dietterich Miller, Stadtschreiber zuhaidenheim; dazu: Wirt Simon Beckhenstein, Michel, Thoman und Hanß die Beckhenstein und Barthel Gauggenmeyer, alle aus Suntheim, Leonhard Buckh aus Prenz Schmidmeier/Hiebsch (Hrsg.), Deuerlinger Brau- und Wirtshausgeschichte seit
16 und Zimprecht Schwarz aus Bechenheim (Eltern, Brüder, Schwäger bzw. Beistände des Beckhenstein). Beckhenstein erstattet handgelobte Treue und Eid lt. Reversbrief. Geben und geschehen an sant Martins tag 1611 In kleinen Orten war der Wirt meist auch der Vertreter des Landesherren. In Deuerling wohl 1514 nicht, da neben der Tafern mit dem Wirt Ulrich Sigl im Laberer Salbuch auch der, wie oben beschrieben, größte Hof im Pflegamt Laber mit dem Bauern Schmiedmaister genannt wird. Die Zinsen (Abgaben) der anderen Deuerlinger Höfe und der Tafern mussten in diesen Hof 4 gezahlt werden, so dass dem Bauern Schmiedmaister die Rolle des Dorfoberen zukam. Später wurde die Tafern dem Hof einverleibt. In der Tafern wurden Gerichtsverhandlungen und Bürgerversammlungen abgehalten. Außerdem hatte der Wirt meist den Anspruch, dass Verlöbnisse, Hochzeiten, Taufen, der Leichen- Abbildung 14: Der Bauerntanz von P. Bruegel, Der Tanz findet vor der Tafern mit Fahne statt. 24 Regensburger kleine Beiträge zur Heimatforschung, Heft 7
17 schmaus und die Nachlassverhandlungen mit Testaments eröffnung bei ihm stattfanden sowie Tanzveranstaltungen. Aus sozialer Verantwortung heraus musste er aber auch wandernde Handwerksgesellen ohne Bezahlung unterbringen. Schenken, wie die in Steinerbrückl und die Bodenhill, die erst im 18. Jhdt. zu Tafernen erklärt wurden, hatten diese Rechte und Pflichten nicht, sondern schenkten meist nur Getränke aus. Deshalb hatten sie auch nicht, wie die Tafern, eine Fahne als äußeres Zeichen. Dieses Tafernrecht galt in Bayern bis Die Deuerlinger Tafernwirtschaft (heute Brauerei Goss) 1514 wird erstmals die Deuerlinger Tafern im Salbuch (Steuer- und Besitzbuch) des Pflegamts Laber schriftlich erwähnt 1, wobei von einem wesentlich früheren Entstehen an dem Laberübergang auszugehen ist. Das Salbuch wurde erstellt, um die Besitz- und Zins (Steuer)-Verhältnisse nach dem Entstehen des bayerischen Teilherzogtums Pfalz-Neuburg im Jahr 1505 nach dem Landshuter Erfolgekrieg festzuhalten. Die damalige Infrastruktur Deuerlings wird folgendermaßen beschrieben: Zum Pflegamt Laber gehörig: Hof (Bauer Schmidmaister); dieser hatte als Zins u. a. 2 Schaff Korn (Roggen), je 1 Schaff Weizen und Gerste und 3 Schaff Hafer zu entrichten und war damit der größte Hof im Pflegamt Laber; Schmiede (Gilg Schmid); Tafern (Sigl); Mühle (Wolfgang Mullner), 8 Sölden (kleine Höfe); Zum Pflegamt Kehlheim (Bayern) gehörig: 1 Amtshaus, 1 Pfarrhof, 1 Sölden, Stegenhof; Deuerling hatte also 16 Anwesen. Ulrich Sigl (der Tafernwirt) taucht schon 1506 in einer Verkaufsurkunde für Gilg Schmid als Zeuge neben Jorg Müller aus Deuerling 2 auf. In einem später ausgestellten Tafernbrief wird das (falsche) Gründungsdatum 1554 genannt. In der Grenzbeschreibung des Amts Kelheim von Schmidmeier/Hiebsch (Hrsg.), Deuerlinger Brau- und Wirtshausgeschichte seit
18 Abbildung 15: Im Zentrum, unterhalb der Laberbrücke, liegt die Tafern (mit Fahne und einem oder zwei großen Kaminen, im Vergleich der ebenfalls große Kamin des Kupferhammers mit den drei Wasserrädern oberhalb), ganzrechts die Steinerbrückler Wirtschaft ohne Fahne tauchen die Felder des Wirths zu Theuerling 3 als beim Wutzenfelsen liegend auf, ebenso wie mehrmals in der Grenzbeschreibung von ,5 Hans Hunger, Würth zu Theuerling. Im Jahr 1598 erstellt Christoph Vogel seine Landkarte des Pflegamts Laber, in die er Grenzen, Dörfer, Straßen und Wälder einzeichnet. Da er wichtige Häuser einzeln darstellt, lässt sich sogar die Deuerlinger Tafernwirtschaft an der Fahne (Bierzeiger) erkennen, wobei der große Kamin (eventuell auch zwei) auffällt. Diese Einzelheit ist insofern wichtig als auch die Wirtschaft in Steinerbrückl eingezeichnet ist, aber ohne Kamin. Das lässt sich wohl nur so deuten, dass das bei jeder Tafern liegende Recht, Bier zu brauen, in Deuerling ausgeübt wurde, während in der Schenkstatt Steinerbrückl dies eben nicht der Fall war. 26 Regensburger kleine Beiträge zur Heimatforschung, Heft 7
19 1599 stirbt eine Magd ( Dirn ) des Deuerlinger Wirts an der Pest, festgehalten in den Pfarrbüchern der Pfarrei Nittendorf, zu der damals auch Deuerling gehörte. 6 Irgendwann später wird die Brauerei aufgegeben, nicht aber die Tafern, denn 1844 stellt der damalige Wirt Wolfgang Salzhuber den Antrag, eine Brauerei errichten zu dürfen, da es in Deuerling keine gebe. Möglicherweise wurde die erste Brauerei durch die Gemeinde Deuerling wegen Feuersgefahr verboten, da sie dem Deuerlinger Eisenhammer jedenfalls 1693 die Errichtung eines zweiten Schmelzfeuers auch aus diesem Grund untersagte. 7 Das Bier musste aber wegen des Bierzwangs aus dem Pflegamt Laber bezogen werden, also aus dem Kommunbrauhaus in Laber. Der Sud wurde dann zurück nach Deuerling gebracht und in einem Bierkeller gelagert. Selbst brauen durfte der Deuerlinger Großwirt aber nicht, da dies den Laberer Bürgern vorbehalten war. Diese sind auch namentlich bekannt. 8 Somit musste das Bier wohl von diesen gekauft werden. Allerdings beantragt und erhält Paul Meisinger 1607 die Erlaubnis, Bier für den Eigenverbrauch seiner Hammerknechte zu brauen 9, so dass es kaum vorstellbar ist, dass zur damaligen Zeit die gegenüberliegende Tafern keine eigene Brauerei gehabt hätte. Also muss der Bierkauf aus Laber später begonnen worden sein, vielleicht in Zusammenhang mit dem 30-jährigen Krieg ab In den Jahren 1656 bis 1688 tauchen in den Pfarrbüchern der Deuerlinger Kirche St. Martin immer wieder die Namen der beiden pfälzischen Wirtsleute Eva und Hanns Hunger im Zusammenhang mit Schenkungen auf, so z. B. im Jahr 1656: Dies Jahr an dem hl. Pfingst Sonntag hat Frau Eva Hungerin, die gros Würthin zu Teurling ein neyes althartuch in dem werth bey 3 fl (Gulden) in die kürchen zu Teuerling zu Ehren des hl. Martini Pischoffs und beichtigers machen lassen stellt Pfalz-Neuburg einen Tafernbrief aus und erwähnt dabei das schon oben genannte falsche Gründungsjahr 1554 der Tafern. 11 Schmidmeier/Hiebsch (Hrsg.), Deuerlinger Brau- und Wirtshausgeschichte seit
20 Damit ist gezeigt, dass es in Deuerling durchgängig von vor 1514 bis heute die Deuerlinger Tafern gibt, die Brauerei auf dem Anwesen allerdings mit Unterbrechungen. 5. Die Wirtschaft Bodenhill, das Bayerische Bäckerhaus und der Pfälzische Wirt In der Grenzbeschreibung, die nach einer Begehung der Grenze zwischen den Ämtern Kelheim und Laber bzw. Hemau im Jahr 1585 verfasst wurde 1, wird erwähnt, dass das Amt Kelheim in Deuerling ain Sölden hat, so ein Schenkstadt (Schenke, aber keine Taferne, d. V.) ist, Zapfenrecht auf Kasten (Finanzkasse, d. V.) Kelheim, in Hofmark Schönhofen gehörig. 2,3 Schon im Salbuch des Pflegamts Laber von 1514 wird für Deuerling ein Anwesen als 1 Sölden (kleiner Bauernhof), zum Amt Kelheim gehörig bezeichnet, so dass es sich um dieselbe Schenkstadt handeln könnte. Sie war allerdings damals wohl recht unbedeutend, da sie in Vogels Karte von 1598 nicht zu finden ist. Ihr Name könnte daher rühren, dass sie am Weg der Boten nach Laaber lag (das Haus, an der nördlichen Einmündung der Regensburger Straße in die B 8 gelegen, wurde 2014 abgerissen). Die Route nach Nürnberg über Laaber wurde nämlich meist nur von berittenen Boten und Fußgängern benutzt, wie wir aus dem 16. Jhdt. wissen 4. Diese Schenke wird auch 1655 wieder bezeugt durch die Nennung ihres Wirts: Hans Strobl zu Theurling auf der Schenkstadt, 50 Jahr. 5 Hans Strobl ist als Zeuge bei der erneuten Grenzbereitung 1655 als Kelheimer Untertan genannt, wobei er wohl ausgewählt wurde, weil er einerseits ortskundig und andererseits auch angesehen war. 28 Regensburger kleine Beiträge zur Heimatforschung, Heft 7
21 Abbildung 16: Die heutige Regensburger Straße in der Uraufnahme von 1835 mit Bodenhill (Nr. 1, Pfeil) und Bayerischem Bäcker (Nr. 9, Pfeil), das heutige Bräustüberl; Entnommen aus Bayernatlas/ Historische Karte 1752 werden in einer Zusammenfassung aller Untertanen des Pflegamts Kelheim für Deuerling ein Anwesen 1/16 Rödlmözger und ein 1/32 Bayerisches Gütl (Wirt und Bäcker) zur Hofmark Eichhofen gehörend 7 genannt. Die zweite Erwähnung bezieht sich jedoch nicht auf die Bodenhill, denn in einem Verzeichnis des Amtes Laber von wird für Deuerling u. a. angegeben: Mit Hoch- und Niedergerichtsbarkeit zum Landgericht Kelheim: 1/16, 1 Haus, Hofmark Eichhofen: 1 Bausölden (kleiner Hof, d.v.). Also ist das größere Anwesen (1/16) die Bodenhill, während das kleinere (1/32) mit Wirt und Bäcker das heutige Bräustüberl in der Regensburgerstraße ist wird das Anwesen mit der Hausnummer 1, die Bodenhill, in der Beschreibung zur Uraufnahme mit einer radizierten Taferngerechtigkeit 9 aufgeführt und war damit eine respektable Gaststätte. Die kleinere Wirtschaft mit Bäckerei, in der Uraufnahme von 1835 die Hausnummer 9, wurde damals als der bayerische Bäcker bezeichnet. Es gehörte zur Hofmark Eichhofen und damit zu Niederbayern, wäh- Schmidmeier/Hiebsch (Hrsg.), Deuerlinger Brau- und Wirtshausgeschichte seit
22 rend die große Tafern (heute Goss) zu Pfalz-Neuburg gehörte und dieser Wirt somit der pfälzische Wirt genannt wurde. 6. Das Wirtshaus Steinerbrückl Steinerbrückl hat seinen Namen von der, für damalige Zeiten besonderen, steinernen Brücke über die Laber, die vor 1080 gebaut wurde, um den Schwerlastverkehr von Regensburg über Undorf, Hemau nach Nürnberg zu bewältigen wird der Ministeriale, der mit der Aufsicht über diesen Übergang vom Burggrafen in Regensburg betraut wurde, zum ersten Mal schriftlich als Egilof von Steininbruck benannt. Da es für die Fuhrleute und Reisenden an dieser Stelle öfters Aufenthalte gab, liegt die Existenz einer Wirtschaft an dieser Stelle nahe. Am 3. Juli 1473 wird sie zum ersten Mal schriftlich genannt: Im Gebiet südlich von Deuerling griffen die Ämter Kelheim und Laber seit 1435, dem Verkauf der Herrschaft Laber an Bayern Landshut ineinander und die Zugehörigkeiten der Bewohner von Schönhofen, Eichhofen, Loch und Steinerbrückl wurden erst durch mehrere Verträge zwischen 1522 und 1576 geregelt. 1 So nimmt es nicht Wunder, dass sich Herzog Ludwig, zu dessen Einflussgebiet das Amt Laber gehörte, bei seinem Vetter Albrecht, dem Herzog von Oberbayern, dem Herrn über das Pflegamt Kelheim, beklagt wegen der Irrung, die uns unser Vetter Albrecht des Dorfes Teuerling, und des Wirthes zu der Steinerbrucken halber, die in das Gericht Laber gehören, thut. 2 Die Lehensrechte lagen zu dieser Zeit eindeutig bei Laber, trotzdem gehören vier der sechs Anwesen in Steinerbrückl zur Hofmark Eichhofen, darunter auch die Wirtschaft, die aber noch keine Tafernrechte besaß. Die Hofmark gelangt per Vertrag im Jahr 1556 zum Amt Kelheim, und damit auch die Wirtschaft wird auch das Bräuhaus in Eichhofen 30 Regensburger kleine Beiträge zur Heimatforschung, Heft 7
23 Abbildung 17: Kopie der Vogel - karte durch G. Pez von 1772: Gut zu erkennen ist die Fahne an der Steinerbrückler Wirtschaft. erstmals erwähnt. 4 Wegen des Bierzwangs musste somit unsere Wirtschaft das Bier aus dieser Brauerei beziehen wird das Wirtshaus erneut nachgewiesen, denn Christof Vogels Karte enthält dieses Gebäude an der heutigen Stelle, allerdings ohne die Fahne wie bei der Deuerlinger Tafern, weil es das Bier eben nicht selbst braute heißt es in der Steuerbeschreibung des Amtes Kehlheim: Steinerbrückl: 4 Anwesen: 1/8 Gut, Mayr (Wirt) erstellt G. Pez eine Kopie der Karte von Christoph Vogel, wobei er aber einige wesentliche Änderungen vornimmt, so zeichnet er jetzt das Wirtshaus mit der Fahne, das heißt, es hatte jetzt Tafernrechte erworben. Schmidmeier/Hiebsch (Hrsg.), Deuerlinger Brau- und Wirtshausgeschichte seit
24 Fußnoten: 1. Eine kurze Geschichte des Bieres 1 GÖLLER, Elmar: Braukunst Frankens. Ansbach 2007, S SCHWARZ, Andrea: Die Traditionen des Klosters Prüfening (= Quellen und Erörterungen zur bayerischen Geschichte, Bd. 39). München 1991, S SCHMID, Joseph: Entwurf einer Geschichte der Pfarrei Deuerling (Archiv des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg MS O 982) [sc Deuerling 1894], S PÖPPEL, Joseph: Monographie oder historisch-topographische Ortsbeschreibung des Schulsprengels Deuerling (Archiv des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg MS O 313), S MÜLLER, Johann Nepomuk: Chronik der Stadt Hemau nach den verläßlichen archivalischen Quellen bearbeitet. Regensburg 1861 [ND Hemau 1973], S LOHBERG, Rolf: Das große Lexikon vom Bier. Wiesbaden 1982, S BRUNNER, Joseph: Bier in der Oberpfalz (1933) 21, S. 143 S. 155, hier: S. 151f. 8 PÖPPEL, Monographie, S. 4 9 SCHWAIGER, Dieter; HAMMERL, Karl: Brauereien im Labertal (III). Das Brauwesen im Markt Laaber, in: Die Oberpfalz (2004) 92, S , hier: S DERS.: Die Entwicklung des Brauwesens in der Stadt Hemau, in: BÖHM, Ernst (Hrsg.): das man hinfüro guettes Pier gnueg habe Brauereien, Wirtshäuser und Bierkeller in Hemau und Umgebung, S , hier: S DERS., Brauwesen im Markt Laaber, S Ebda. S FEUERER, Thomas: Die Brauereien in Hohenschambach, Kollersried und Neukirchen, in: DERS; SCHWAIGER, Dieter; BÖHM, Ernst (Hrsg.): das man hinfüro guettes Pier gnueg habe Brauereien, Wirtshäuser und Bierkeller in Hemau und Umgebung, S , hier: S JEHLE, Manfred: Parsberg (= Historischer Atlas von Bayern, Heft 51). München 1981, S Die Klosterschenke in Pollenried 1 JEHLE, Parsberg, S Ebda., S PÖPPEL, Monographie, S Was ist eine Tafern ( )? 1 LOHBERG, Rolf: Das große Lexikon vom Bier. Wiesbaden 1982, S Ebda., S Reinhard Seitz, BÄCHINGER URKUNDENBUCH, Augsburg 1981, Nr JEHLE, Parsberg, S Regensburger kleine Beiträge zur Heimatforschung, Heft 7
25 4. Die Deuerlinger Tafernwirtschaft 1 JEHLE, Parsberg, S Staatsarchiv Amberg, staatseigene Urkunden 2251: Veit Rammelsteiner und sein Sohn Ruprecht zum Loch verkaufen 1 ½ Tagwerk Wiese aus der sogenannten Angerwiese oberhalb der Breitenwiese neben der Katharinenwiese von Nittendorf dem Gilg Schmid zu Deuerling. Zeugen: Ulrich Sigl und Jorg Müller von Deuerling. 3 Paulus, Georg, StALa, Rentkastenamt, B22: Hohenwarth, 2007, S Ebda., Grenzbeschreibung, S Ebda., S SATTLER, Doris; PAULUS, Georg: Die Pest von 1599 in den Pfarreien Nittendorf/ Deuerling und Laaber, in: Die Oberpfalz (2007), S , hier: S GÖTSCHMANN, Ernst: Oberpfälzer Eisen. Weiden 1986, S SCHWAIGER, Brauwesen im Markt Laaber, S PÖPPEL, Monographie, S SCHMID, Geschichte der Pfarrei Deuerling, S PÖPPEL, Monographie, S SCHWAIGER, Dieter: Brauereien im Labertal (II). Die Brauhäuser von Schönhofen, Loch, Eichhofen und Deuerling, in: Die Oberpfalz (2002) 90, S , hier: S Die Wirtschaft Bodenhill, das Bayerische Bäckerhaus und der Pfälzische Wirt 1 Paulus, Georg, StALa, Rentkastenamt, B22: Verzaichnus, Hohenwarth, 2007, S Ebda., S Große Teile der Hofmark Schönhofen gehören bereits im 16. Jhdt. zwar zum Pflegamt Laber, der Rest aber nach Kelheim und dabei auch die Schenkstadt. 4 Paulus, Georg/Frank, BayHStA, Pfalz-Neuburg Akten Nr Die Nordgauische Straßenbereitung, Regensburg 2014, S Wie Anm. 1, S MAGES, Emma: Kelheim (= Historisches Atlas für Altbayern, Bd. 64). München 2010, S Der Eigentümer ist ein gewisser Rödlmözger. Also führte damals diese Wirtschaft ein Metzger namens Rödl. 7 Ebda., S JEHLE, Parsberg, S GIESL, Hans: Deuerling. Gemeinde und Pfarrei Anno dazumal. Horb am Neckar 1999, S. 18f. 6. Das Wirtshaus Steinerbrückl 1 JEHLE, Parsberg, S KRENNER, Franz von: Landtagshandlungen, Bd. 8. München 1804, S JEHLE, Parsberg, S SCHWAIGER, Dieter: Gasthaus und Brauerei Eichhofen, in: Die Oberpfalz (2008) 96, S MAGES, Kelheim, S GIESL, Pfarrei Deuerling, S. 92. Schmidmeier/Hiebsch (Hrsg.), Deuerlinger Brau- und Wirtshausgeschichte seit
Sebastian Schmidmeier Wolfram Hiebsch (Hrsg.)
 Regensburger kleine Beiträge zur Heimatforschung Heft 7 RkBH 7 Deuerlinger Brau- und Wirtshausgeschichte seit 1473 Sebastian Schmidmeier Wolfram Hiebsch (Hrsg.) Impressum 2016 Verlag Th. Feuerer, An der
Regensburger kleine Beiträge zur Heimatforschung Heft 7 RkBH 7 Deuerlinger Brau- und Wirtshausgeschichte seit 1473 Sebastian Schmidmeier Wolfram Hiebsch (Hrsg.) Impressum 2016 Verlag Th. Feuerer, An der
Die heutzutage so berühmte Passage wird erst seit gut 100 Jahren mit dem eingängigen Begriff Reinheitsgebot bezeichnet.
 Sperrfrist: 28. April 2016, 15.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Eröffnung der Bayerischen
Sperrfrist: 28. April 2016, 15.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Eröffnung der Bayerischen
Das Dorf Wiedikon. Aufgabe: Suche das Wort VViedinchova auf der Urkunde. Kleiner Tipp: es steht am Anfang einer Zeile.
 Das Dorf Wiedikon Als Geburtsschein einer Ortschaft wird ihre erste schriftliche Erwähnung be- zeichnet. Der Name existiert schon früher, sonst hätte er nicht aufgeschrieben werden können. Der Geburtsschein
Das Dorf Wiedikon Als Geburtsschein einer Ortschaft wird ihre erste schriftliche Erwähnung be- zeichnet. Der Name existiert schon früher, sonst hätte er nicht aufgeschrieben werden können. Der Geburtsschein
B Gelübde C Nonne D Augustiner-Orden. A Mönch C Nonne D Augustiner-Orden
 1 A Kloster: Mönch Wie nennt man einen männlichen Bewohner eines Klosters? 1 B Kloster: Gelübde Wie nennt man das Versprechen, das jemand beim Eintritt in ein Kloster gibt? B Gelübde C Nonne D Augustiner-Orden
1 A Kloster: Mönch Wie nennt man einen männlichen Bewohner eines Klosters? 1 B Kloster: Gelübde Wie nennt man das Versprechen, das jemand beim Eintritt in ein Kloster gibt? B Gelübde C Nonne D Augustiner-Orden
Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6
 HINTERGRUNDINFOS FÜR LEHRER Lange Tradition der Braukunst Bier wird in Deutschland schon seit über tausend Jahren hergestellt. Zum ersten Mal wird das Getränk in Schriftstücken im Jahr 736 erwähnt. Die
HINTERGRUNDINFOS FÜR LEHRER Lange Tradition der Braukunst Bier wird in Deutschland schon seit über tausend Jahren hergestellt. Zum ersten Mal wird das Getränk in Schriftstücken im Jahr 736 erwähnt. Die
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt: Mittelalter. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Mittelalter Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Lernwerkstatt: Mittelalter Bestellnummer:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Mittelalter Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Lernwerkstatt: Mittelalter Bestellnummer:
LANGE NACHT DER KIRCHEN Unterlagen und Tipps aus der Pfarre Waidhofen/Thaya zum Programmpunkt Rätselralley für Kinder (2014)
 Ulrike Bayer Wir haben nach dem Motto Ich seh ich seh was du nicht siehst! die Kinder raten und suchen lassen. An Hand der Merkmale der Statuen und Besonderheiten in unserer Pfarrkirche haben wir unser
Ulrike Bayer Wir haben nach dem Motto Ich seh ich seh was du nicht siehst! die Kinder raten und suchen lassen. An Hand der Merkmale der Statuen und Besonderheiten in unserer Pfarrkirche haben wir unser
Bayerns Könige privat
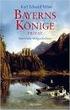 Karl Eduard Vehse Bayerns Könige privat Bayerische Hofgeschichten Herausgegeben von Joachim Delbrück Anaconda Vehses Geschichte der deutschen Höfe seit der Reformation (48 Bände), Vierte Abteilung (Bd.
Karl Eduard Vehse Bayerns Könige privat Bayerische Hofgeschichten Herausgegeben von Joachim Delbrück Anaconda Vehses Geschichte der deutschen Höfe seit der Reformation (48 Bände), Vierte Abteilung (Bd.
Die, Witteisbacher in Lebensbildern
 Hans und Marga Rall Die, Witteisbacher in Lebensbildern Verlag Styria Verlag Friedrich Pustet INHALT Inhalt 'ort II fe Kurstimmen 13 LYERN: Otto I. 1180-1183 15 ilzgraf und Herzog Ludwig I. der Kelheimer
Hans und Marga Rall Die, Witteisbacher in Lebensbildern Verlag Styria Verlag Friedrich Pustet INHALT Inhalt 'ort II fe Kurstimmen 13 LYERN: Otto I. 1180-1183 15 ilzgraf und Herzog Ludwig I. der Kelheimer
St. Maria Magdalena. Vorgängerkapelle(n) in (Ober)Bergstraße. Teil 1 -bis 1390-
 St. Maria Magdalena Vorgängerkapelle(n) in (Ober)Bergstraße Teil 1 -bis 1390- Seit wann gab es in (Ober)-Bergstraße eine Kapelle? Wo hat sie gestanden? Wie hat sie ausgesehen? Größe? Einfacher Holzbau
St. Maria Magdalena Vorgängerkapelle(n) in (Ober)Bergstraße Teil 1 -bis 1390- Seit wann gab es in (Ober)-Bergstraße eine Kapelle? Wo hat sie gestanden? Wie hat sie ausgesehen? Größe? Einfacher Holzbau
Hildegard von Bingen
 Jugendgottesdienst 17. September Hildegard von Bingen Material: (http://home.datacomm.ch/biografien/biografien/bingen.htm) Bilder Begrüßung Thema Typisch für die Katholische Kirche ist, das wir an heilige
Jugendgottesdienst 17. September Hildegard von Bingen Material: (http://home.datacomm.ch/biografien/biografien/bingen.htm) Bilder Begrüßung Thema Typisch für die Katholische Kirche ist, das wir an heilige
für Ihre Heiligkeit Papst Benedikt XVI Seehausen am Staffelsee Eine Kurzvorstellung unseres Ortes
 für Ihre Heiligkeit Papst Benedikt XVI Seehausen am Staffelsee Eine Kurzvorstellung unseres Ortes Seehausen am Staffelsee Der Name Seehausen wird im 6./7.Jahrh. entstanden sein. Er ist eine Bezeichnung
für Ihre Heiligkeit Papst Benedikt XVI Seehausen am Staffelsee Eine Kurzvorstellung unseres Ortes Seehausen am Staffelsee Der Name Seehausen wird im 6./7.Jahrh. entstanden sein. Er ist eine Bezeichnung
Didaktisches Material Teil 1: Bavaria
 Teil 1: Bavaria Abbildung 1 Abbildung 2 Bavaria mit überschäumenden Maßkrügen Zeichnung: Eugen von Baumgarten, um 1905, Augsburg Plakatmotiv der Bayerischen Landesausstellung 2016 Bier in Bayern Entwurf:
Teil 1: Bavaria Abbildung 1 Abbildung 2 Bavaria mit überschäumenden Maßkrügen Zeichnung: Eugen von Baumgarten, um 1905, Augsburg Plakatmotiv der Bayerischen Landesausstellung 2016 Bier in Bayern Entwurf:
ACHTUNG FALLE Das Mittelalter (Alltagsleben damals), Tessloff
 Medienpaket: Mittelalter 1 Achtung Falle ACHTUNG FALLE Das Mittelalter (Alltagsleben damals), Tessloff In den folgenden Sachtexten haben sich Fehler eingeschlichen. Mit Hilfe des Sachbuches Alltagsleben
Medienpaket: Mittelalter 1 Achtung Falle ACHTUNG FALLE Das Mittelalter (Alltagsleben damals), Tessloff In den folgenden Sachtexten haben sich Fehler eingeschlichen. Mit Hilfe des Sachbuches Alltagsleben
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Unterrichtsmethoden: Lernposter: erarbeitete Lerninhalte in kreativer Form lernwirksam aufbereiten Das komplette Material finden Sie
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Unterrichtsmethoden: Lernposter: erarbeitete Lerninhalte in kreativer Form lernwirksam aufbereiten Das komplette Material finden Sie
Wir feiern heute ein ganz außergewöhnliches Jubiläum. Nur sehr wenige Kirchengebäude
 Sperrfrist: 19.4.2015, 12.45 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Festakt zum 1200- jährigen
Sperrfrist: 19.4.2015, 12.45 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Festakt zum 1200- jährigen
BLICKWINKEL BLICK AUF DAS RATHAUS PFAFFENHOFEN IM WANDEL DER ZEIT
 BLICK AUF DAS RATHAUS Obwohl erst aus dem Jahr 20 stammend, zeigt die Aufnahme des Rathauses die vielfältigen Veränderungen am Gebäude wie im direkten Umfeld. Nach der umfassenden Renovierung des Rathauses
BLICK AUF DAS RATHAUS Obwohl erst aus dem Jahr 20 stammend, zeigt die Aufnahme des Rathauses die vielfältigen Veränderungen am Gebäude wie im direkten Umfeld. Nach der umfassenden Renovierung des Rathauses
Impressionen aus Alt-Freusburg im Siegtal
 Impressionen aus Alt-Freusburg im Siegtal 1. Zur Geschichte der Burg und Siedlung Freusburg Im Früh- und Hochmittelalter gehörten die Wälder entweder dem König oder den hohen weltlichen und geistlichen
Impressionen aus Alt-Freusburg im Siegtal 1. Zur Geschichte der Burg und Siedlung Freusburg Im Früh- und Hochmittelalter gehörten die Wälder entweder dem König oder den hohen weltlichen und geistlichen
Eine Bieridee: am 23. April feiert Deutschland den Tag des Bieres!
 Eine Bieridee: am 23. April feiert Deutschland den Tag des Bieres! In der Schweiz gibt es (noch) keinen solchen Feiertag. Doch auch bei uns ist Bier ein beliebtes und traditionsreiches Gebräu. Der Bierkonsum
Eine Bieridee: am 23. April feiert Deutschland den Tag des Bieres! In der Schweiz gibt es (noch) keinen solchen Feiertag. Doch auch bei uns ist Bier ein beliebtes und traditionsreiches Gebräu. Der Bierkonsum
Bayerische Hauptstädte im Mittelalter: Landshut
 Geschichte Rudi Loderbauer Bayerische Hauptstädte im Mittelalter: Landshut Studienarbeit Ludwig-Maximilians-Universität München Institut für Bayerische Geschichte Sommersemester 2004 Proseminar: Bayerns
Geschichte Rudi Loderbauer Bayerische Hauptstädte im Mittelalter: Landshut Studienarbeit Ludwig-Maximilians-Universität München Institut für Bayerische Geschichte Sommersemester 2004 Proseminar: Bayerns
P R E S S I N F O R M A T I O N
 Frisches, vor Ort gebrautes Bier, beste Küche und bayerische Lebensart: Die internationale Erfolgsgeschichte der inzwischen weltweit beliebten Paulaner Bräuhäuser begann in China München, im Mai 2012.
Frisches, vor Ort gebrautes Bier, beste Küche und bayerische Lebensart: Die internationale Erfolgsgeschichte der inzwischen weltweit beliebten Paulaner Bräuhäuser begann in China München, im Mai 2012.
Lektion Kann Besitz uns von Sünde, Tod und Satan befreien? - Nein. 3. Was geschah mit dem reichen Bauern? - Gott ließ ihn sterben.
 Lektion 64 1. Angenommen ein Mann besäße alle Reichtümer dieser Welt. Würden ihm diese Reichtümer etwas nützen, wenn er in den Pfuhl des ewigen Feuers eingehen würde? 2. Kann Besitz uns von Sünde, Tod
Lektion 64 1. Angenommen ein Mann besäße alle Reichtümer dieser Welt. Würden ihm diese Reichtümer etwas nützen, wenn er in den Pfuhl des ewigen Feuers eingehen würde? 2. Kann Besitz uns von Sünde, Tod
Die Stadt Gernsbach in Mittelalter und Früher Neuzeit Freiheit und Demokratie?
 Die Stadt Gernsbach in Mittelalter und Früher Neuzeit Freiheit und Demokratie? Machte Stadtluft in Gernsbach frei? In Städten, die direkt und nur dem Kaiser unterstanden (in so genannten Reichsstädten
Die Stadt Gernsbach in Mittelalter und Früher Neuzeit Freiheit und Demokratie? Machte Stadtluft in Gernsbach frei? In Städten, die direkt und nur dem Kaiser unterstanden (in so genannten Reichsstädten
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Mittelalter - Das Leben von Bauern, Adel und Klerus kennen lernen Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Mittelalter - Das Leben von Bauern, Adel und Klerus kennen lernen Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Martin von. Tours. Martin von. Tours. ZAUBERmini - Martin von Tours. ZAUBERmini - Martin von Tours. gelesen und bearbeitet von: am:
 Martin von Tours gelesen und bearbeitet von: am: Martin von Tours gelesen und bearbeitet von: am: Martin von Tours Der heute bei uns als ƒheiliger Martin" bekannte Martin von Tours wurde 316 oder 317 geboren
Martin von Tours gelesen und bearbeitet von: am: Martin von Tours gelesen und bearbeitet von: am: Martin von Tours Der heute bei uns als ƒheiliger Martin" bekannte Martin von Tours wurde 316 oder 317 geboren
PREDIGT: Epheser Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
 PREDIGT: Epheser 2.17-22 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde! In den letzten Jahre sind viele Menschen
PREDIGT: Epheser 2.17-22 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde! In den letzten Jahre sind viele Menschen
3. Der heilige Disibod und das Kloster Disibodenberg
 3. Der heilige Disibod und das Kloster Disibodenberg Disibod war ein Mönch und auch ein Einsiedler. Er kam aus Irland. Dort lebte er in einem Kloster. Disibod kam um das Jahr 640 als Glaubensbote aus seinem
3. Der heilige Disibod und das Kloster Disibodenberg Disibod war ein Mönch und auch ein Einsiedler. Er kam aus Irland. Dort lebte er in einem Kloster. Disibod kam um das Jahr 640 als Glaubensbote aus seinem
DAS ANDERE BEZIRKSBUCH DER FÜNFTE BEZIRK 2011 Hilla M. Faseluka
 DAS ANDERE BEZIRKSBUCH DER FÜNFTE BEZIRK 2011 Hilla M. Faseluka Dieses Bezirksbuch beschreibt die einzelnen Bezirke von Wien. Es beginnt mit es waren einmal ein paar kleine Dörfer, sie bildeten die Vorstädte
DAS ANDERE BEZIRKSBUCH DER FÜNFTE BEZIRK 2011 Hilla M. Faseluka Dieses Bezirksbuch beschreibt die einzelnen Bezirke von Wien. Es beginnt mit es waren einmal ein paar kleine Dörfer, sie bildeten die Vorstädte
Die Sonne im Laufe des Jahres
 B1 DER HERBST IST DA Die Sonne im Laufe des Jahres Informations- und Arbeitshilfe Winter Dezember, Januar, Februar: Die Sonne steht tief am Himmel Die Tage sind kurz. In dieser Zeit ist die nördliche Halbkugel
B1 DER HERBST IST DA Die Sonne im Laufe des Jahres Informations- und Arbeitshilfe Winter Dezember, Januar, Februar: Die Sonne steht tief am Himmel Die Tage sind kurz. In dieser Zeit ist die nördliche Halbkugel
Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6 Ein Herz für München
 Übung 1: Was siehst du? Im Musikvideo siehst du den Rapper Kurt und den Cellisten Jakob von der Band EINSHOCH6 in der Stadt musizieren. Du siehst einige bekannte Gebäude aus der Münchner Innenstadt. Kannst
Übung 1: Was siehst du? Im Musikvideo siehst du den Rapper Kurt und den Cellisten Jakob von der Band EINSHOCH6 in der Stadt musizieren. Du siehst einige bekannte Gebäude aus der Münchner Innenstadt. Kannst
Arzneipflanze Hopfen. Stephanie und Kathrin Meyer, Brau-Manufactur Allgaeu 1
 Arzneipflanze Hopfen Stephanie und Kathrin Meyer, Brau-Manufactur Allgaeu 1 Die Anfänge Die Völker zwischen Euphrat und Tigris im heutigen Irak die Wiege der Menschheit brauen 6000 v. Chr. ein alkoholisch
Arzneipflanze Hopfen Stephanie und Kathrin Meyer, Brau-Manufactur Allgaeu 1 Die Anfänge Die Völker zwischen Euphrat und Tigris im heutigen Irak die Wiege der Menschheit brauen 6000 v. Chr. ein alkoholisch
Was heißt Bibel übersetzt? a Heilige Schrift b Buch c Buch der Bücher d Heiliges Wort
 13 Was heißt Bibel übersetzt? a Heilige Schrift b Buch c Buch der Bücher d Heiliges Wort 14 Wer darf getauft werden? a nur Kinder b wer über 18 ist c jeder, der sich zu Jesus Christus bekennt d ausgewählte
13 Was heißt Bibel übersetzt? a Heilige Schrift b Buch c Buch der Bücher d Heiliges Wort 14 Wer darf getauft werden? a nur Kinder b wer über 18 ist c jeder, der sich zu Jesus Christus bekennt d ausgewählte
predigt am , zu johannes 2,1-11
 predigt am 15.1.17, zu johannes 2,1-11 1 am dritten tag fand in kana in galiläa eine hochzeit statt und die mutter jesu war dabei. 2 auch jesus und seine jünger waren zur hochzeit eingeladen. 3 als der
predigt am 15.1.17, zu johannes 2,1-11 1 am dritten tag fand in kana in galiläa eine hochzeit statt und die mutter jesu war dabei. 2 auch jesus und seine jünger waren zur hochzeit eingeladen. 3 als der
Das moderne Bayern. Noch viele weitere Reformen sorgten dafür, dass Bayern politisch gesehen zu einem der fortschrittlichsten Staaten Europas wurde.
 Das moderne Bayern Durch das Bündnis mit Napoleon konnte sich das Königreich Bayern zu einem der modernsten Staaten Europas wandeln. Das Staatsgebiet vergrößerte sich, am Ende der napoleonischen Ära ist
Das moderne Bayern Durch das Bündnis mit Napoleon konnte sich das Königreich Bayern zu einem der modernsten Staaten Europas wandeln. Das Staatsgebiet vergrößerte sich, am Ende der napoleonischen Ära ist
2. Der Dreißigjährige Krieg:
 2. Der Dreißigjährige Krieg: 1618 1648 Seit der Reformation brachen immer wieder Streitereien zwischen Katholiken und Protestanten aus. Jede Konfession behauptete von sich, die einzig richtige zu sein.
2. Der Dreißigjährige Krieg: 1618 1648 Seit der Reformation brachen immer wieder Streitereien zwischen Katholiken und Protestanten aus. Jede Konfession behauptete von sich, die einzig richtige zu sein.
MANUSKRIPT. PROF. DR. KUNERT: Grüße Sie! KURT: Servus. Für was sind Sie denn Professor?
 MANUSKRIPT Deutsches Bier ist weltberühmt. In Weihenstephan bei München kann man das Brauen von Bier sogar studieren. Kurt erfährt dort nicht nur, wie man Bier herstellt, sondern lernt auch einen ganz
MANUSKRIPT Deutsches Bier ist weltberühmt. In Weihenstephan bei München kann man das Brauen von Bier sogar studieren. Kurt erfährt dort nicht nur, wie man Bier herstellt, sondern lernt auch einen ganz
Petrus und die Kraft des Gebets
 Bibel für Kinder zeigt: Petrus und die Kraft des Gebets Text: Edward Hughes Illustration: Janie Forest Adaption: Ruth Klassen Deutsche Übersetzung 2000 Importantia Publishing Produktion: Bible for Children
Bibel für Kinder zeigt: Petrus und die Kraft des Gebets Text: Edward Hughes Illustration: Janie Forest Adaption: Ruth Klassen Deutsche Übersetzung 2000 Importantia Publishing Produktion: Bible for Children
Wortgottesdienst-Entwurf für März 2014
 Wortgottesdienst März 2014 Seite 1 Bistum Münster und Bistum Aachen Wortgottesdienst-Entwurf für März 2014 2. Sonntag der Fastenzeit Lesejahr A (auch an anderen Sonntagen in der Fastenzeit zu gebrauchen)
Wortgottesdienst März 2014 Seite 1 Bistum Münster und Bistum Aachen Wortgottesdienst-Entwurf für März 2014 2. Sonntag der Fastenzeit Lesejahr A (auch an anderen Sonntagen in der Fastenzeit zu gebrauchen)
Familie. Meine Mutter
 Familie Meine Mutter Meine Mutter war sehr fürsorglich. Am Wochenende wurde stets ein großer Kuchen gebacken und wenn wir sonntags morgens noch im Bett lagen, bekamen wir große Stücke Streusel- oder Zuckerkuchen
Familie Meine Mutter Meine Mutter war sehr fürsorglich. Am Wochenende wurde stets ein großer Kuchen gebacken und wenn wir sonntags morgens noch im Bett lagen, bekamen wir große Stücke Streusel- oder Zuckerkuchen
Aus der Chronik von Hohenreinkendorf - wahrscheinlich um 1230 von dem Westphalener Reinike Wessel gegründet worden - er gründete auch noch andere
 Aus der Chronik von Hohenreinkendorf - wahrscheinlich um 1230 von dem Westphalener Reinike Wessel gegründet worden - er gründete auch noch andere alte slawische Dörfer wie Krekow, Tantow und Klein-Reinkendorf
Aus der Chronik von Hohenreinkendorf - wahrscheinlich um 1230 von dem Westphalener Reinike Wessel gegründet worden - er gründete auch noch andere alte slawische Dörfer wie Krekow, Tantow und Klein-Reinkendorf
Feste feiern in Deutschland
 Seite 1 von 9 Feste feiern in Deutschland WIESNZEIT Unterrichtsvorschlag und Arbeitsblatt Abkürzungen LK: Lehrkraft L: Lernende UE: Unterrichtseinheiten AB: Arbeitsblatt Seite 2 von 9 UNTERRICHTSVORSCHLAG
Seite 1 von 9 Feste feiern in Deutschland WIESNZEIT Unterrichtsvorschlag und Arbeitsblatt Abkürzungen LK: Lehrkraft L: Lernende UE: Unterrichtseinheiten AB: Arbeitsblatt Seite 2 von 9 UNTERRICHTSVORSCHLAG
Bibel für Kinder zeigt: Die Geburt Jesu
 Bibel für Kinder zeigt: Die Geburt Jesu Text: Edward Hughes Illustration: M. Maillot Adaption: E. Frischbutter und Sarah S. Übersetzung: Siegfried Grafe Produktion: Bible for Children www.m1914.org 2013
Bibel für Kinder zeigt: Die Geburt Jesu Text: Edward Hughes Illustration: M. Maillot Adaption: E. Frischbutter und Sarah S. Übersetzung: Siegfried Grafe Produktion: Bible for Children www.m1914.org 2013
19 SL. Die Bauern im Mittelalter. Auftrag. Fragen. Material
 19 SL Die Bauern im Mittelalter Auftrag Lies zuerst die Fragen durch. Hast du schon eine Ahnung, wie die Antworten heissen? Wenn du willst, darfst du deine Antworten stichwortartig auf die Tafel notieren.
19 SL Die Bauern im Mittelalter Auftrag Lies zuerst die Fragen durch. Hast du schon eine Ahnung, wie die Antworten heissen? Wenn du willst, darfst du deine Antworten stichwortartig auf die Tafel notieren.
Der Vorabend der Reformation
 Der Vorabend der Reformation A1: Vorstellung der Menschen vom Leben nach dem Tod a) Beschreibe kurz, wie die Menschen im Mittelalter sich das Leben nach dem Tod vorstellten! b) Entscheide, ob folgende
Der Vorabend der Reformation A1: Vorstellung der Menschen vom Leben nach dem Tod a) Beschreibe kurz, wie die Menschen im Mittelalter sich das Leben nach dem Tod vorstellten! b) Entscheide, ob folgende
Video-Thema Begleitmaterialien
 BIER MEHR ALS NUR EIN GETRÄNK In der bayerischen Gegend Oberfranken hat die Bierproduktion eine lange Tradition. Es gibt dort viele kleine Brauereien, die für ihre eigene Gaststätte das Bier herstellen.
BIER MEHR ALS NUR EIN GETRÄNK In der bayerischen Gegend Oberfranken hat die Bierproduktion eine lange Tradition. Es gibt dort viele kleine Brauereien, die für ihre eigene Gaststätte das Bier herstellen.
Predigt am Voller Freude Johannes 3,1-12. Liebe Gemeinde!
 Predigt am 27.08.2017 Voller Freude Johannes 3,1-12 Liebe Gemeinde! Gestern das Schatzbibelbuch, heute die Frauen- Mönche hörten wir Isa sagen. - Eine spannende Geschichte! Der Brief der Nonnen an Martin
Predigt am 27.08.2017 Voller Freude Johannes 3,1-12 Liebe Gemeinde! Gestern das Schatzbibelbuch, heute die Frauen- Mönche hörten wir Isa sagen. - Eine spannende Geschichte! Der Brief der Nonnen an Martin
Der Bauer und der Herzog
 Der Bauer und der von Hildegard Berthold-Andrae PERSONEN Probst Reuchlin Stöffler Hutten 1 Vorspiel: Schwäbischer Tanz von Mozart, während der einleitenden Erzählung tafelt die Runde, Pagen schenken ein,
Der Bauer und der von Hildegard Berthold-Andrae PERSONEN Probst Reuchlin Stöffler Hutten 1 Vorspiel: Schwäbischer Tanz von Mozart, während der einleitenden Erzählung tafelt die Runde, Pagen schenken ein,
Bibel für Kinder zeigt: Der Feuermensch
 Bibel für Kinder zeigt: Der Feuermensch Text: Edward Hughes Illustration: Lazarus Adaption: E. Frischbutter Deutsche Übersetzung 2000 Importantia Publishing Produktion: Bible for Children www.m1914.org
Bibel für Kinder zeigt: Der Feuermensch Text: Edward Hughes Illustration: Lazarus Adaption: E. Frischbutter Deutsche Übersetzung 2000 Importantia Publishing Produktion: Bible for Children www.m1914.org
Kurze Geschichte des Dekanates Fürth
 Kurze Geschichte des Dekanates Fürth Durch die Übernehme der Reformation wurde die Bevölkerung Fürths evangelischlutherisch; zudem wanderten im 16. und 17. Jahrhundert reformierte Bevölkerungsgruppen in
Kurze Geschichte des Dekanates Fürth Durch die Übernehme der Reformation wurde die Bevölkerung Fürths evangelischlutherisch; zudem wanderten im 16. und 17. Jahrhundert reformierte Bevölkerungsgruppen in
Laternenumzüge. Martinigänse
 Laternenumzüge Am Martinstag feiert man den Abschluss des Erntejahres. Für die Armen war das eine Chance, einige Krümel vom reichgedeckten Tisch zu erbetteln. Aus diesem Umstand entwickelten sich vermutlich
Laternenumzüge Am Martinstag feiert man den Abschluss des Erntejahres. Für die Armen war das eine Chance, einige Krümel vom reichgedeckten Tisch zu erbetteln. Aus diesem Umstand entwickelten sich vermutlich
Petrus und die Kraft des Gebets
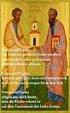 Bibel für Kinder zeigt: Petrus und die Kraft des Gebets Text: Edward Hughes Illustration: Janie Forest Adaption: Ruth Klassen Deutsche Übersetzung 2000 Importantia Publishing Produktion: Bible for Children
Bibel für Kinder zeigt: Petrus und die Kraft des Gebets Text: Edward Hughes Illustration: Janie Forest Adaption: Ruth Klassen Deutsche Übersetzung 2000 Importantia Publishing Produktion: Bible for Children
Schrift. Dem Gruppenpartner einen kurzen Brief oder eine Mitteilung in Hieroglyphen schreiben.
 Schrift Posten 2 Anleitung LP Ziel: Die Schüler wissen, wie sich die verschiedenen Schriften in Ägypten entwickelt haben, und können einfache Wörter in Hieroglyphen schreiben. Sie üben ihr Gedächtnis,
Schrift Posten 2 Anleitung LP Ziel: Die Schüler wissen, wie sich die verschiedenen Schriften in Ägypten entwickelt haben, und können einfache Wörter in Hieroglyphen schreiben. Sie üben ihr Gedächtnis,
Bibel für Kinder. zeigt: Die Geburt Jesu
 Bibel für Kinder zeigt: Die Geburt Jesu Text: Edward Hughes Illustration: M. Maillot Adaption: E. Frischbutter und Sarah S. Übersetzung: Siegfried Grafe Produktion: Bible for Children www.m1914.org BFC
Bibel für Kinder zeigt: Die Geburt Jesu Text: Edward Hughes Illustration: M. Maillot Adaption: E. Frischbutter und Sarah S. Übersetzung: Siegfried Grafe Produktion: Bible for Children www.m1914.org BFC
Die Dreikönigskirche Bad Bevensen
 Die Dreikönigskirche Bad Bevensen Ein kleiner Kirchenführer Herzlich willkommen in der Dreikönigskirche Bad Bevensen! Auch wenn es auf den ersten Blick nicht den Eindruck macht; sie befinden sich an einem
Die Dreikönigskirche Bad Bevensen Ein kleiner Kirchenführer Herzlich willkommen in der Dreikönigskirche Bad Bevensen! Auch wenn es auf den ersten Blick nicht den Eindruck macht; sie befinden sich an einem
ERSTE LESUNG Jes 62, 1-5 Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich Lesung aus dem Buch Jesaja
 ERSTE LESUNG Jes 62, 1-5 Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich Lesung aus dem Buch Jesaja Um Zions willen kann ich nicht schweigen, um Jerusalems willen nicht still
ERSTE LESUNG Jes 62, 1-5 Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich Lesung aus dem Buch Jesaja Um Zions willen kann ich nicht schweigen, um Jerusalems willen nicht still
Die Heilig-Blut-Legende
 Die Heilig-Blut-Legende Der kostbarste Schatz der Basilika ist das Heilige Blut. Es wird in einem prachtvollen Gefäß aufbewahrt. Schon vor Hunderten von Jahren fragten sich die Menschen und die Mönche
Die Heilig-Blut-Legende Der kostbarste Schatz der Basilika ist das Heilige Blut. Es wird in einem prachtvollen Gefäß aufbewahrt. Schon vor Hunderten von Jahren fragten sich die Menschen und die Mönche
Herzlich willkommen!
 BräuRup Seit 1681 Herzlich willkommen! Machen Sie es sich bequem beim Bräurup. Egal, was Sie darunter verstehen. Für den Einen ist es Verwöhntwerden mit kulinarischen Schätzen, gemütliche Stunden in einem
BräuRup Seit 1681 Herzlich willkommen! Machen Sie es sich bequem beim Bräurup. Egal, was Sie darunter verstehen. Für den Einen ist es Verwöhntwerden mit kulinarischen Schätzen, gemütliche Stunden in einem
Komm mit zu St. Adelheid
 Komm mit zu St. Adelheid Das ist die Vilicher Kirche St. Peter, die vor ca. 1000 Jahren erbaut worden ist. Hier befindet sich im Adelheidis-Chörchen das Grab der Heiligen Adelheid. 2 Nun mache einen Rundgang
Komm mit zu St. Adelheid Das ist die Vilicher Kirche St. Peter, die vor ca. 1000 Jahren erbaut worden ist. Hier befindet sich im Adelheidis-Chörchen das Grab der Heiligen Adelheid. 2 Nun mache einen Rundgang
Verlauf Material Klausuren Glossar Literatur. Streit um Macht und Religion eine Unterrichts - einheit zum Dreißigjährigen Krieg
 Reihe 10 S 1 Verlauf Material Streit um Macht und Religion eine Unterrichts - einheit zum Dreißigjährigen Krieg Silke Bagus, Nohra OT Ulla Von einer Defenestration berichtet sogar schon das Alte Testament.
Reihe 10 S 1 Verlauf Material Streit um Macht und Religion eine Unterrichts - einheit zum Dreißigjährigen Krieg Silke Bagus, Nohra OT Ulla Von einer Defenestration berichtet sogar schon das Alte Testament.
Erntedankfest = Laubhüttenfest Danken für Materielles und Geistliches ( )
 Kirchengemeinde Golgatha Melle Impuls für s Leben Seite 1 von 5 Alexander Bloch Begrüßung Einen wunderschönen guten Morgen liebe Freunde und Geschwister. Ich heiße euch alle Willkommen an diesem Morgen.
Kirchengemeinde Golgatha Melle Impuls für s Leben Seite 1 von 5 Alexander Bloch Begrüßung Einen wunderschönen guten Morgen liebe Freunde und Geschwister. Ich heiße euch alle Willkommen an diesem Morgen.
Das Leben auf dem Dorf im Mittelalter
 Das Leben auf dem Dorf im Mittelalter A1: Das mittelalterliche Dorf Entscheide, ob folgende Aussagen wahr (w) oder falsch (f) sind! 1. Die meisten Bauerndörfer entstanden zwischen dem 11. und dem 14. Jahrhundert.
Das Leben auf dem Dorf im Mittelalter A1: Das mittelalterliche Dorf Entscheide, ob folgende Aussagen wahr (w) oder falsch (f) sind! 1. Die meisten Bauerndörfer entstanden zwischen dem 11. und dem 14. Jahrhundert.
Regensburger Fernhandel im Mittelalter
 Unterrichtsmaterialien in Themenpaketen Regensburger Fernhandel im Mittelalter Folien: Einstiegsfolie: Was könnte das sein? Silber in Barrenform und aus einem Münzschatz, der in Barbing bei Regensburg
Unterrichtsmaterialien in Themenpaketen Regensburger Fernhandel im Mittelalter Folien: Einstiegsfolie: Was könnte das sein? Silber in Barrenform und aus einem Münzschatz, der in Barbing bei Regensburg
34. Sonntag im Jahreskreis - Christkönigssonntag - Lk 23, C - Jesus, denk an mich, wenn du in deiner Macht als König kommst
 34. Sonntag im Jahreskreis - Christkönigssonntag - Lk 23, 35-43 - C - Jesus, denk an mich, wenn du in deiner Macht als König kommst Wir hören König und denken an Macht und Glanz auf der einen, gehorsame
34. Sonntag im Jahreskreis - Christkönigssonntag - Lk 23, 35-43 - C - Jesus, denk an mich, wenn du in deiner Macht als König kommst Wir hören König und denken an Macht und Glanz auf der einen, gehorsame
Städte in Bayern Überblick
 Städte in Bayern Überblick Erstellt von Banu Gollnick Schriftart: SchulVokalDotless Bilder von pixabay und Wikipedia, https://pixabay.com/de/frauenkirche-bayernlandeshauptstadt-1530530 Namensnennung nicht
Städte in Bayern Überblick Erstellt von Banu Gollnick Schriftart: SchulVokalDotless Bilder von pixabay und Wikipedia, https://pixabay.com/de/frauenkirche-bayernlandeshauptstadt-1530530 Namensnennung nicht
Bibel für Kinder zeigt: Geschichte 36 von 60.
 Bibel für Kinder zeigt: Die Geburt Jesu Text: Edward Hughes Illustration: M. Maillot Übersetzung: Siegfried Grafe Adaption: E. Frischbutter und Sarah S. Deutsch Geschichte 36 von 60 www.m1914.org Bible
Bibel für Kinder zeigt: Die Geburt Jesu Text: Edward Hughes Illustration: M. Maillot Übersetzung: Siegfried Grafe Adaption: E. Frischbutter und Sarah S. Deutsch Geschichte 36 von 60 www.m1914.org Bible
PERSONEN MARIA: lebt mit ihrer Familie in Astenberg/
 VON ROSMARIE THÜMINGER Sie wurde am 6.7.1939 in Laas, in Südtirol, geboren. Zehn Tage im Winter war ihr drittes Jugendbuch. Es entstand auf Grund eigener Erlebnisse. PERSONEN MARIA: lebt mit ihrer Familie
VON ROSMARIE THÜMINGER Sie wurde am 6.7.1939 in Laas, in Südtirol, geboren. Zehn Tage im Winter war ihr drittes Jugendbuch. Es entstand auf Grund eigener Erlebnisse. PERSONEN MARIA: lebt mit ihrer Familie
Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Gottesdienst zum Fest Peter und Paul in der Münchner Liebfrauenkirche am 29.
 Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Gottesdienst zum Fest Peter und Paul in der Münchner Liebfrauenkirche am 29. Juni 2011 Heute vor 60 Jahren wurde der Heilige Vater Papst Benedikt
Predigt des Erzbischofs em. Friedrich Kardinal Wetter beim Gottesdienst zum Fest Peter und Paul in der Münchner Liebfrauenkirche am 29. Juni 2011 Heute vor 60 Jahren wurde der Heilige Vater Papst Benedikt
Harte Fragen an die Bibel: Gott, sein Charakter, seine Entscheidungen 29
 Inhaltsverzeichnis Das Alte und Neue Testament 9 1. Kann man der Bibel heute noch glauben? 11 2. Wie verbindlich ist das Alte Testament? 13 3. Wenn Kain und Abel nach Adam und Eva die ersten Menschen waren,
Inhaltsverzeichnis Das Alte und Neue Testament 9 1. Kann man der Bibel heute noch glauben? 11 2. Wie verbindlich ist das Alte Testament? 13 3. Wenn Kain und Abel nach Adam und Eva die ersten Menschen waren,
So lebten die Menschen im Mittelalter
 So lebten die Menschen im Mittelalter Rekonstruktionszeichnung des Klosters Sankt Gallen nach dem Grundriss des Sankt Galler Klosterplans aus dem frühen 9. Jahrhundert. Aus: J. Rudolf Rahn: Geschichte
So lebten die Menschen im Mittelalter Rekonstruktionszeichnung des Klosters Sankt Gallen nach dem Grundriss des Sankt Galler Klosterplans aus dem frühen 9. Jahrhundert. Aus: J. Rudolf Rahn: Geschichte
+HJDXHU%XUJHQ 'HUREHUH7HLOGHU)HVWXQJ +RKHQWZLHO
 Hegauer Burgen 'HUREHUH7HLOGHU)HVWXQJ +RKHQWZLHO Hohenkrähen...2 Hohentwiel...3 Mägdeberg...4 Hohenhewen...5 Hohenstoffeln...6 In Riedheim...8 Riedheim...8 Binningen...9 Staufen...9 Hohenkrähen Noch im
Hegauer Burgen 'HUREHUH7HLOGHU)HVWXQJ +RKHQWZLHO Hohenkrähen...2 Hohentwiel...3 Mägdeberg...4 Hohenhewen...5 Hohenstoffeln...6 In Riedheim...8 Riedheim...8 Binningen...9 Staufen...9 Hohenkrähen Noch im
Sinnzeichen für Ostern
 Gruppe 1 Sinnzeichen für Palmsonntag Gründonnerstag Karfreitag Ostersonntag 1 Es gibt eine Menge Osterbräuche. Welche kennt ihr? 2 Zeichnet die Sinnzeichen vom Blattanfang in Euer Heft. Überlegt Euch,
Gruppe 1 Sinnzeichen für Palmsonntag Gründonnerstag Karfreitag Ostersonntag 1 Es gibt eine Menge Osterbräuche. Welche kennt ihr? 2 Zeichnet die Sinnzeichen vom Blattanfang in Euer Heft. Überlegt Euch,
Ein Engel besucht Maria
 Ein Engel besucht Maria Eines Tages vor ungefähr 2000 Jahren, als Maria an einem Baum Äpfel pflückte, wurde es plötzlich hell. Maria erschrak fürchterlich. Da sagte eine helle Stimme zu Maria: «Ich tu
Ein Engel besucht Maria Eines Tages vor ungefähr 2000 Jahren, als Maria an einem Baum Äpfel pflückte, wurde es plötzlich hell. Maria erschrak fürchterlich. Da sagte eine helle Stimme zu Maria: «Ich tu
Auf dem Weg zum guten Karlsberg Bier.
 Auf dem Weg zum guten Karlsberg Bier. Rohstoffe Der Hopfen das grüne Gold Edler Hopfen verleiht den Karlsberg Bieren ihr typisches Aroma, ihren charakteristischen, frischen Geschmack sowie die Festigkeit
Auf dem Weg zum guten Karlsberg Bier. Rohstoffe Der Hopfen das grüne Gold Edler Hopfen verleiht den Karlsberg Bieren ihr typisches Aroma, ihren charakteristischen, frischen Geschmack sowie die Festigkeit
90 Jahre St. Martin Verein Dorthausen 1926
 90 Jahre St. Martin Verein Dorthausen 1926 Am 20. November 1926 wurde der St.Martin Verein Dorthausen in der Gastwirtschaft Eckers heute Dorthausener Hof gegründet. Gewählt wurde damals Johann Eckers zum
90 Jahre St. Martin Verein Dorthausen 1926 Am 20. November 1926 wurde der St.Martin Verein Dorthausen in der Gastwirtschaft Eckers heute Dorthausener Hof gegründet. Gewählt wurde damals Johann Eckers zum
Bistum Münster und Bistum Aachen Wortgottesdienst für Januar 2013 Die Hochzeit in Kana (vom 2. Sonntag im Jahreskreis C auch an anderen Tagen möglich)
 WGD Januar 2013 Seite 1 Bistum Münster und Bistum Aachen Wortgottesdienst für Januar 2013 Die Hochzeit in Kana (vom 2. Sonntag im Jahreskreis C auch an anderen Tagen möglich) L = Leiter des Wortgottesdienstes
WGD Januar 2013 Seite 1 Bistum Münster und Bistum Aachen Wortgottesdienst für Januar 2013 Die Hochzeit in Kana (vom 2. Sonntag im Jahreskreis C auch an anderen Tagen möglich) L = Leiter des Wortgottesdienstes
14 Mitspieler: 1 Ausrufer, Maria, Josef, 1 Kind, 1 Vater, 1 Wirt, 4 Hirten, 1 Engel, 3 Könige
 Der Heiland ist geboren Ein Krippenspiel für Kinder 14 Mitspieler: 1 Ausrufer, Maria, Josef, 1 Kind, 1 Vater, 1 Wirt, 4 Hirten, 1 Engel, 3 Könige Der Ausrufer betritt die Bühne, er liest den Text aus einer
Der Heiland ist geboren Ein Krippenspiel für Kinder 14 Mitspieler: 1 Ausrufer, Maria, Josef, 1 Kind, 1 Vater, 1 Wirt, 4 Hirten, 1 Engel, 3 Könige Der Ausrufer betritt die Bühne, er liest den Text aus einer
1. Bierkonsum führt zum Bierbauch
 1. Bierkonsum führt zum Bierbauch Tatsache ist: Ein Pilsbier zum Beispiel hat weniger Kalorien als eine vergleichbare Menge Apfelsaft, Milch, Wein, Sekt oder Spirituosen. Eine Studie des Londoner University
1. Bierkonsum führt zum Bierbauch Tatsache ist: Ein Pilsbier zum Beispiel hat weniger Kalorien als eine vergleichbare Menge Apfelsaft, Milch, Wein, Sekt oder Spirituosen. Eine Studie des Londoner University
Die Ägypter stellten schon vor über 5.000 Jahren Brot her, es war ihr Hauptnahrungsmittel. So gab man den Ägyptern in der Antike auch den Beinamen
 Einst haben auch in Bremerhaven und umzu viele Windmühlen gestanden. Einige haben als Museum den Sprung in die Gegenwart geschafft, andere sind längst in Vergessenheit geraten. Nur noch die Namen von Straßen
Einst haben auch in Bremerhaven und umzu viele Windmühlen gestanden. Einige haben als Museum den Sprung in die Gegenwart geschafft, andere sind längst in Vergessenheit geraten. Nur noch die Namen von Straßen
Bild: Wikicommons, , 13.50h.
 Ostern 2017 Bild: Wikicommons, 10.04.2017, 13.50h. 1 Liebe Schwestern und Brüder im Herrn 'Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.' (Joh. 20.29) Am Tag nach seiner Kreuzigung kommt Maria von Magdala
Ostern 2017 Bild: Wikicommons, 10.04.2017, 13.50h. 1 Liebe Schwestern und Brüder im Herrn 'Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.' (Joh. 20.29) Am Tag nach seiner Kreuzigung kommt Maria von Magdala
Welches 1Trio überquerte als erstes die
 Welches 1Trio überquerte als erstes die Steinerne Brücke? Ein Hahn, eine Henne und ein Hund. Einer Sage zufolge sollen die Baumeister des Doms und der Brücke gewettet haben, wessen Bauwerk als erstes fertiggestellt
Welches 1Trio überquerte als erstes die Steinerne Brücke? Ein Hahn, eine Henne und ein Hund. Einer Sage zufolge sollen die Baumeister des Doms und der Brücke gewettet haben, wessen Bauwerk als erstes fertiggestellt
Ernst Klett Schulbuchverlag Leipzig
 Asmut Brückmann Rolf Brütting Peter Gautschi Edith Hambach Uwe Horst Georg Langen Peter Offergeid Michael Sauer Volker Scherer Franz-Josef Wallmeier Ernst Klett Schulbuchverlag Leipzig Leipzig Stuttgart
Asmut Brückmann Rolf Brütting Peter Gautschi Edith Hambach Uwe Horst Georg Langen Peter Offergeid Michael Sauer Volker Scherer Franz-Josef Wallmeier Ernst Klett Schulbuchverlag Leipzig Leipzig Stuttgart
Sie lebten in Geislingen.
 Sie lebten in Geislingen. Kurzbiografien namhafter Geislinger Persönlichkeiten aus neun Jahrhunderten 16. Jahrhundert: Maria Holl aus Altenstadt Eine tapfere Frau und vermeintliche Hexe in Nördlingen Impressum:
Sie lebten in Geislingen. Kurzbiografien namhafter Geislinger Persönlichkeiten aus neun Jahrhunderten 16. Jahrhundert: Maria Holl aus Altenstadt Eine tapfere Frau und vermeintliche Hexe in Nördlingen Impressum:
Bibel für Kinder zeigt: Reicher Mann, Armer Mann
 Bibel für Kinder zeigt: Reicher Mann, Armer Mann Text: Edward Hughes Illustration: M. Maillot und Lazarus Adaption: M. Maillot und Sarah S. Übersetzung: Siegfried Grafe Produktion: Bible for Children www.m1914.org
Bibel für Kinder zeigt: Reicher Mann, Armer Mann Text: Edward Hughes Illustration: M. Maillot und Lazarus Adaption: M. Maillot und Sarah S. Übersetzung: Siegfried Grafe Produktion: Bible for Children www.m1914.org
Unsere Hausgebrauten Biere. Golding. Hersbrucker. Malling. Und noch 4 Saisonbiere. Hallo liebe Gäste
 Unsere Hausgebrauten Biere Golding Ein helles Märzenbier bei dem zur Hauptwürze unser Golding Hopfen verwendet wird, der ihm seine Hopfennote gibt. 4,8-5,0% Alkohol 0,5l.3,20 0.3l.2,70 0,2l.2,30 Hersbrucker
Unsere Hausgebrauten Biere Golding Ein helles Märzenbier bei dem zur Hauptwürze unser Golding Hopfen verwendet wird, der ihm seine Hopfennote gibt. 4,8-5,0% Alkohol 0,5l.3,20 0.3l.2,70 0,2l.2,30 Hersbrucker
Die 42 rheinischen Sätze
 Die Wenkersätze Die 42 rheinischen Sätze... 2 Die 38 westfälischen Sätze... 4 Die 40 Sätze Nord- und Mitteldeutschlands sowie der späteren Erhebung Süddeutschlands... 6 Die 42 rheinischen Sätze 1. Thu
Die Wenkersätze Die 42 rheinischen Sätze... 2 Die 38 westfälischen Sätze... 4 Die 40 Sätze Nord- und Mitteldeutschlands sowie der späteren Erhebung Süddeutschlands... 6 Die 42 rheinischen Sätze 1. Thu
Zum Archivale der Vormonate bitte scrollen!
 Archivale des Monats Juni 2013 Wohnungsvermietung vor 700 Jahren Dechant und Domkapitel zu Köln vermieten dem Goswin gen. von Limburch gen. Noyge auf Lebenszeit ihr Haus, das zwei Wohnungen unter seinem
Archivale des Monats Juni 2013 Wohnungsvermietung vor 700 Jahren Dechant und Domkapitel zu Köln vermieten dem Goswin gen. von Limburch gen. Noyge auf Lebenszeit ihr Haus, das zwei Wohnungen unter seinem
Predigt am 11. Januar 2009 zu Matthäus 3, 13 17
 Predigt am 11. Januar 2009 zu Matthäus 3, 13 17 Zu jener Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wollte ihn davon abhalten und sagte: Ich hätte
Predigt am 11. Januar 2009 zu Matthäus 3, 13 17 Zu jener Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wollte ihn davon abhalten und sagte: Ich hätte
Predigt zum Israelsonntag Am 10. Sonntag nach dem Trinitatisfest (31. Juli 2016) Predigttext: Johannes 4,19-25
 Predigt zum Israelsonntag Am 10. Sonntag nach dem Trinitatisfest (31. Juli 2016) Predigttext: Johannes 4,19-25 Friede sei mit euch und Gnade von dem, der da ist und der da war und der da kommen wird. Amen.
Predigt zum Israelsonntag Am 10. Sonntag nach dem Trinitatisfest (31. Juli 2016) Predigttext: Johannes 4,19-25 Friede sei mit euch und Gnade von dem, der da ist und der da war und der da kommen wird. Amen.
Franken im 10. Jahrhundert - ein Stammesherzogtum?
 Geschichte Christin Köhne Franken im 10. Jahrhundert - ein Stammesherzogtum? Studienarbeit Inhaltsverzeichnis Einleitung... 2 1) Kriterien für ein Stammesherzogtum... 3 2) Die Bedeutung des Titels dux
Geschichte Christin Köhne Franken im 10. Jahrhundert - ein Stammesherzogtum? Studienarbeit Inhaltsverzeichnis Einleitung... 2 1) Kriterien für ein Stammesherzogtum... 3 2) Die Bedeutung des Titels dux
Das Kindermuseum im Fischaturm
 Das Kindermuseum im Fischaturm Hallo, hier bin ich wieder! KIMU, das Maskottchen vom Kindermuseum. Die Fragen beginnen im ersten Stock und führen dich bis unters Dach des Turmes auf 30m Höhe. Natürlich
Das Kindermuseum im Fischaturm Hallo, hier bin ich wieder! KIMU, das Maskottchen vom Kindermuseum. Die Fragen beginnen im ersten Stock und führen dich bis unters Dach des Turmes auf 30m Höhe. Natürlich
Der Hammer bis zum 19. Jahrhundert
 Der Hammer bis zum 19. Jahrhundert P Beim Hammerwerk N M L A K J B Christoph-Carl-Platz I O H C D E F G Die erste urkundliche Erwähnung Hammers als Mühl zu Laufenholz ist von 1372 überliefert. 1492 wird
Der Hammer bis zum 19. Jahrhundert P Beim Hammerwerk N M L A K J B Christoph-Carl-Platz I O H C D E F G Die erste urkundliche Erwähnung Hammers als Mühl zu Laufenholz ist von 1372 überliefert. 1492 wird
München 9 - ein stadtgeschichtlicher Durchzieher
 München 9 - ein stadtgeschichtlicher Durchzieher 1349-2009 Um sich ohne hohen wissenschaftlichen Anspruch einen ungefähren Eindruck von den Bestimmungsfaktoren der Geschichte Münchens zu verschaffen, kann
München 9 - ein stadtgeschichtlicher Durchzieher 1349-2009 Um sich ohne hohen wissenschaftlichen Anspruch einen ungefähren Eindruck von den Bestimmungsfaktoren der Geschichte Münchens zu verschaffen, kann
3.Missionsreise Paulus aus Korinth Gläubige in Rom Wunsch dorthin zu reisen den Gläubigen dienen Reise nach Spanien
 Während der 3.Missionsreisevon Paulusim Jahr 56/57 aus Korinth geschrieben (Röm15,25-28; 16,1+23; Apg 20,3). an Gläubige in Rom; Gemeinde dort wurde nicht durch Paulus gegründet, er ist bislang nichtdort
Während der 3.Missionsreisevon Paulusim Jahr 56/57 aus Korinth geschrieben (Röm15,25-28; 16,1+23; Apg 20,3). an Gläubige in Rom; Gemeinde dort wurde nicht durch Paulus gegründet, er ist bislang nichtdort
Manchmal geben uns die Leute einen Spitznamen.
 8 Lektion Ein neuer Name und ein neuer Freund Apostelgeschichte 11,19-26; Das Wirken der Apostel, S.129-131,155-164 Manchmal geben uns die Leute einen Spitznamen. Vielleicht hast du auch so einen Spitznamen.
8 Lektion Ein neuer Name und ein neuer Freund Apostelgeschichte 11,19-26; Das Wirken der Apostel, S.129-131,155-164 Manchmal geben uns die Leute einen Spitznamen. Vielleicht hast du auch so einen Spitznamen.
Gottes Gnade PS 50 GNADE DURCH GEDULD
 Gottes Gnade PS 50 GNADE DURCH GEDULD Ps 50: 1-6 Ein Lied Asafs. Gott, der Herr, der Mächtige, spricht; er ruft die Welt vom Osten bis zum Westen. Auf dem Zion, dem schönsten Berg, erscheint Gott in strahlendem
Gottes Gnade PS 50 GNADE DURCH GEDULD Ps 50: 1-6 Ein Lied Asafs. Gott, der Herr, der Mächtige, spricht; er ruft die Welt vom Osten bis zum Westen. Auf dem Zion, dem schönsten Berg, erscheint Gott in strahlendem
Kirchenführer. Westerham
 Kirchenführer der Filialkirche St. Johannes, Westerham Filialkirche St. Johannes Westerham Etwa zur gleichen Zeit, in der der Streit zwischen dem Bischof von Freising und dem Abt von Herrenchiemsee entschieden
Kirchenführer der Filialkirche St. Johannes, Westerham Filialkirche St. Johannes Westerham Etwa zur gleichen Zeit, in der der Streit zwischen dem Bischof von Freising und dem Abt von Herrenchiemsee entschieden
Kinder kennen Koblenz
 Kinder kennen Koblenz 1. Zuerst ein paar Sätze zur Geschichte der Stadt Koblenz Die Römer gründeten vor über 2000 Jahren Koblenz. Die Franken brachten den christlichen Glauben mit und bauten die Kastorkirche
Kinder kennen Koblenz 1. Zuerst ein paar Sätze zur Geschichte der Stadt Koblenz Die Römer gründeten vor über 2000 Jahren Koblenz. Die Franken brachten den christlichen Glauben mit und bauten die Kastorkirche
Inhalt I. Die Gesellschaft zur Zeit Karls des Großen II. Herkunft und Ansehen der Karolinger
 Inhalt I. Die Gesellschaft zur Zeit Karls des Großen 1. Wie groß war das Frankenreich Karls, und wie viele Menschen lebten darin? 11 2. Sprachen die Franken französisch? 13 3. Wie war die fränkische Gesellschaft
Inhalt I. Die Gesellschaft zur Zeit Karls des Großen 1. Wie groß war das Frankenreich Karls, und wie viele Menschen lebten darin? 11 2. Sprachen die Franken französisch? 13 3. Wie war die fränkische Gesellschaft
Kindheit im Kloster. Das Beispiel Sankt Gallen im 8. / 9. Jahrhundert
 Geschichte Julia Schriewer Kindheit im Kloster. Das Beispiel Sankt Gallen im 8. / 9. Jahrhundert Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung S. 3 2. Der Weg ins Kloster S. 5 3. Das Leben im Kloster
Geschichte Julia Schriewer Kindheit im Kloster. Das Beispiel Sankt Gallen im 8. / 9. Jahrhundert Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung S. 3 2. Der Weg ins Kloster S. 5 3. Das Leben im Kloster
Es gibt Fragen, die sich im Kreis drehen.
 Es gibt Fragen, die sich im Kreis drehen. Lieber Leser Die Welt ist voll von Menschen, die sich die Frage ihrer Existenz stellen. Es gibt viele gute Ansätze, wie man darüber nachsinnt, was nach dem Tode
Es gibt Fragen, die sich im Kreis drehen. Lieber Leser Die Welt ist voll von Menschen, die sich die Frage ihrer Existenz stellen. Es gibt viele gute Ansätze, wie man darüber nachsinnt, was nach dem Tode
