Numerische Simulation der Strömungsvorgänge in einem Belebungsbecken der Kläranlage Ottweiler
|
|
|
- Jürgen Kohler
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 FACHBERICHTE Abwasserbehandlung Numerische Simulation der Strömungsvorgänge in einem Belebungsbecken der Kläranlage Ottweiler Joachim Dettmar, Marco Günther, Ralf Hasselbach, Jan Steinhausen und Mattis Marzell Abwasserbeahndlung, Abwasserreinigung, Energieoptimierung, Belüftung, Durchmischung, Mehrphasenströmung, numerische Strömungsmechanik Mit dem Ziel, weitere energetische Einsparpotenziale auf der saarländischen Kläranlage Ottweiler zu detektieren, wurden numerische Strömungssimulationen aktueller Betriebszustände mithilfe eines dreidimensionalen Mehrphasenmodells durchgeführt. Im Mittelpunkt der Betrachtung stand die Strömungsstruktur im Belebungsbecken, die vornehmlich durch die Belüftungselemente und Durchmischungsaggregate induziert wird. Die gewonnenen Simulationsergebnisse bestätigen, dass es trotz kontinuierlicher Durchmischung des Abwasserkörpers im Belebungsbecken zu Ablagerungen kommt. Zudem stellt sich aufgrund des vertikalen Belüftungsstromes eine Umkehr der durch ein Rührwerk erzeugten horizontalen Strömung ein. Um den Strombedarf weiter zu senken, sollen die Prozesse der Belüftung und Durchmischung zukünftig besser aufeinander abgestimmt werden. Numerical Flow Simulation in a Biological Reactor of Sewage Treatment Plant Ottweiler With the objective to detect more energy savings on the treatment plant Ottweiler of Saarland, computational fluid dynamics of current operating state were carried out using a three-dimensional multiphase model. Focus of attention is the flow structure in the aeration tank biological reactor, which is mainly induced by the aeration and stirring devices. The simulation results obtained confirm that it comes to deposits in spite of continuous mixing of the wastewater in the aeration tank. In addition, due to the vertical aeration flow generated a reversal of the horizontal flow of a stirring device. In order to reduce the demand for electricity further, the processes of aeration and mixing should be better coordinated in future. 1. Einleitung Seit vielen Jahren gehören die Energieanalyse und die Energieoptimierung von Kläranlagen zu den Schwerpunktthemen der Abwasserfachwelt [1]. Kläranlagen zählen mit einem durchschnittlichen Anteil von rund 20 % zu den größten kommunalen Stromverbrauchern [2], sodass die stetig steigenden Energiepreise einen großen Einfluss auf die Kosten der Abwasserreinigung und damit auf die Abwassergebühren haben. Die Belüftung und Durchmischung von Belebungsanlagen haben mit Abstand den größten Energiebedarf einer Kläranlage. Je nach verfahrenstechnischer Auslegung liegt ihr Stromverbrauch zwischen 50 % und 80 % des Gesamtenergiebedarfs der Abwasserreinigung [3]. Daher kommt dem energieeffizienten Betrieb von Belüftungs- und Durchmischungseinrichtungen in Belebungsanlagen eine große Bedeutung zu. Die Entwicklung wirksamer Maßnahmen zur Energieoptimierung bei Belüftung und Durchmischung setzt jedoch detaillierte Kenntnisse über den aktuellen Betriebszustand voraus. Die Kläranlage Ottweiler mit einer Anschlussgröße von EW = E (Größenklasse 4) wies im Jahr 2004 einen hohen Energieverbrauch von 856 MWh/a bzw. bezogen 1264 gwf-wasser Abwasser 12/2015
2 Abwasserbehandlung FACHBERICHTE auf die mittlere CSB-Zulaufbelastung von 71,6 kwh/(e a) auf. Durch mehrere Optimierungsmaßnahmen wurde der Energiebezug schrittweise auf 650 MWh/a bzw. 56,5 kwh/ (E d) reduziert [4]. Der Richtwert des spezifischen Energieverbrauches für Kläranlagen mit Anschlussgrößen von bis E und simultaner aerober Schlammstabilisierung liegt gemäß dem Handbuch Energie in Kläranlagen des Landes Nordrhein-Westfalen [5] unter Berücksichtigung der Förderhöhe des Zulaufpumpwerks bei 47 kwh/(e a). Ein noch wenig beachtetes Einsparpotenzial besteht beim Betrieb der Umwälzaggregate in den Belebungsbecken, der mit einem Stromverbrauch von rund kwh/a nicht zu vernachlässigen ist. Als Grundlage für eine weitere energetische Verbesserung werden die aktuellen Strömungsverhältnisse in den Belebungsbecken der Kläranlage Ottweiler (Bild 1) mit Hilfe einer dreidimensionalen numerischen Modellierung untersucht. Ziel der numerischen Betrachtung ist es, die Einflüsse der Rührwerksbewegung und des Lufteintrags auf die derzeitigen Strömungsverhältnisse sowie die Luftverteilung im Belebungsbecken zu ermitteln. Bild 1: Kläranlage Ottweiler, oben: Foto von Belebungs- und Nachklärbecken, unten: Übersichtslageplan (modifiziert) [6] 2. Kläranlage Ottweiler Die Kläranlage Ottweiler wurde im Frühjahr 2001 vom Entsorgungsverband Saar (EVS) in Betrieb genommen. Das Kläranlageneinzugsgebiet entwässert vornehmlich im Mischverfahren. Bei Trockenwetter fließt der Anlage ein maximaler Abwasserstrom von Q T,h,max = 242 m³/h und im Regenwetterfall von Q M = 432 m³/h zu. Das behandelte Abwasser wird in die Blies geleitet. Die Bauwerke der Kläranlage zeichnen sich durch eine kompakte Anordnung und Gestaltung aus. Der schematische Übersichtslageplan in Bild 1 verdeutlicht die wesentlichen Komponenten der Abwasserreinigungs- und Schlammbehandlungsstufen der Kläranlage. Die mechanische Reinigungsstufe der Kläranlage besteht aus einem Grobrechen (1), Zulaufpumpwerk (2), Feinrechen (3, Funktionalgebäude) sowie Rundsand- und Fettfang (4). Zur zweistraßigen biologischen Reinigungsstufe gehören zwei sogenannte Kombibecken, die sich jeweils aus einem äußeren Belebungsbeckenring (6) und einem inneren runden Nachklärbecken (7) zusammensetzen. Die beiden Belebungsbecken werden über ein Verteilerbauwerk zu gleichen Teilen mit Abwasser beschickt (5). In der Belebung erfolgt eine simultane aerobe Schlammstabilisierung. Darüber hinaus gehören ein Eindicker, ein Schlammsilo und eine maschinelle Entwässerungsanlage zur Schlammbehandlungsstufe. Die Verfahrenstechnik der biologischen Stufe ist für eine Elimination von Kohlenstoff-, Stickstoff- (Nitrifikation, Denitrifikation) und Phosphorverbindungen konzipiert. Die Entfernung von Phosphorverbindungen erfolgt durch eine simultane Phosphatfällung mit Eisenchlorid. 3. Grundlagen des Strömungsmodells 3.1 Allgemeine Grundlagen Hauptaugenmerk der Modellierung liegt auf der exakten Beschreibung der aktuellen Strömungsverhältnisse. Biochemische Prozesse werden nicht betrachtet. Grundlage einer verlässlichen numerischen Simulation ist die möglichst genaue Abbildung aller strömungsrelevanten Geometrien und Einflussfaktoren im Untersuchungsraum. Im Einzelnen gehören hierzu: die Kreisringform des Belebungsbeckens, der Zulauf- und Ablauf des Belebungsbeckens, die Konstruktion, Anordnung sowie der Betrieb der Belüftungs- und Durchmischungseinrichtungen. Für die numerische Berechnung ist die Erstellung eines Gitters (Vernetzung) erforderlich. Da die Anforderungen an die geometrische Abbildung einzelner Bereiche und die Genauigkeit der Abbildungen unterschiedlich sind, wird der Untersuchungsraum aufgeteilt und für jeden Bereich ein separates Gitter erstellt. Die Vernetzung der Bereiche erfolgt unter Anwendung der Software ANSYS ICEM CFD. Vor der Berechnung werden die einzelnen Gitter über sogenannte Interfaces miteinander verbunden und den äußeren Berandungen entsprechende Randbedingungen zugeordnet. Die Zuordnung der Randbedingungen und gwf-wasser Abwasser 12/
3 FACHBERICHTE Abwasserbehandlung die numerische Berechnung erfolgen mit dem Softwaretool ANSYS Fluent [7], das sich im Bereich Computational Fluid Dynamics (CFD) etabliert hat. Um die turbulenten Effekte zu erfassen, wird das Strömungsmodell um das k-e-modell erweitert. Für die Ergebnisvisualisierung wird ANSYS CFD-Post verwendet. 3.2 Modelltechnische Grundlagen Das Strömungsmodell beinhaltet zwei (Fluid-)Phasen, um die Abwasser- und Luftströmungen sowie deren Interaktionen beschreiben zu können. Zum einen werden der Lufteintrag in das Belebungsbecken sowie der Aufstieg kleiner Luftblasen von der Beckensohle zur Wasseroberfläche abgebildet. Zum anderen wird die Grenzfläche zwischen Wasseroberfläche und Umgebungsluft mithilfe der Methode Volume-of-Fluid (VoF) als sogenannte freie Oberfläche modelliert. Zur mathematischen Beschreibung dieser Mehrphasenströmung im Belebungsbecken dient das Eulerian Multiphase (EMP) Modell [7]. Es ermöglicht die Kombination jeden Phasentyps in unbegrenzter Anzahl. Dafür werden für jede Phase und in jeder Zelle die Erhaltungsgleichungen für Masse, Impuls- und Energie gelöst. Es wird keine gemittelte Dichte berechnet. Die Bestimmung der beiden Phasenanteile in einer Zelle erfolgt mit der EMP-Methode. Somit wird die Durchmischung der Gasphase innerhalb der Flüssigkeit korrekt abgebildet. Die exakte Darstellung der Durchmischung von Abwasser- und Luftstrom ist für die Analyse der Prozesse im Belebungsbecken von übergeordneter Bedeutung. Eine separate Abbildung der Schlammphase ist bei einem mittleren Trockensubstanzgehalt (Median) im Belebungsbecken von 2,4 g/l nicht erforderlich, da sich gemäß [3] die Viskosität bei üblichen Feststoffkonzentrationen von 2 g/l bis 5 g/l nur unwesentlich verändert. 3.3 Merkmale der Belebungsbecken Die beiden Belebungsbecken (BB) der Kläranlage Ottweiler haben die Form eines Kreisringes mit einem rechteckigen Durchflussquerschnitt. Jedes der Becken besitzt bei einer mittleren Wassertiefe von h BB = 6 m und einer Querschnittsbreite von b BB = 5,55 m ein Fassungsvermögen von V BB = 2223 m³. Die Becken sind mit Rohrbelüfter-Elementen (Belüftungsgittern) für die Sauerstoffversorgung und mit zwei Tauchmotorrührwerken für die Durchmischung des Abwasserkörpers ausgerüstet. Ein Foto der Belüftungseinrichtung und die Anordnung der technischen Ausrüstungsgegenstände sind in Bild 2 dargestellt. Die Stickstoffelimination erfolgt durch eine intermittierende Denitrifikation, bei der belüftete Nitrifikationsphasen und nicht belüftete Denitrifikationsphasen wechseln. Die Belüftung des Belebungsbeckens wird über eine Messung des Redoxpotenzials und des Sauerstoffgehaltes geregelt. Etwa alle drei Stunden wird für eine Dauer von ein bis zwei Stunden Luftsauerstoff mit einem maximalen Volumenstrom von Q L,N = 1000 m N ³/h in das Belebungsbecken eingetragen. Bei den Durchmischungsaggregaten handelt es sich um langsam laufende Propeller-Rührwerke mit zwei Rotorblättern, die in der Mitte der Wassertiefe positioniert sind und permanent laufen. Mit einem spezifischen Leistungseintrag von insgesamt 3,06 W/m³ werden derzeit jeweils ein altes und ein neues Rührwerk betrieben. Die Aggregate unterscheiden sich in der Propellerform, der Aufnahmeleistung, der Drehzahl und im Schub. Wesent liche Merkmale sind in Tabelle 1 zusammengefasst. 3.4 Abbildung der Belüfter-Elemente Der Eintrag von Luftsauerstoff in die Belebungsbecken geschieht jeweils über neun Rohrbelüfter-Elemente, die an der Beckensohle einer Ringhälfte angeordnet sind (Bild 2). Da der numerische Aufwand für eine exakte Abbildung der Rohrbelüfter-Elemente im Vergleich zu einer höheren Modellgenauigkeit unverhältnismäßig ist, wird nicht die tatsächlich vorhandene Geometrie abgebildet, sondern nur deren Einfluss auf den darüber liegenden Wasserkörper. Eine getreue Abbildung der Luftzuführung ist nicht erforderlich. Die Belüfter-Elemente werden näherungsweise durch rechteckige Flächen dargestellt und mit angepassten Randbedingungen versehen (Bild 3). In Wirklichkeit bestehen diese Rechtecke aus einzelnen Rohren, die eine lamellenförmige Belüftungsstruktur erzeugen. Um diese Belüftungsstruktur modellieren zu können, wird jedes Rechteck in einzelne Lamellen unterteilt. Netzbereiche ohne Belüftungsfunktion erhalten eine Einströmgeschwindigkeit von v L = 0 m/s (kein Luftstrom) und Netzbereiche mit Belüftungsfunktion von v L = 0,01 m/s. 3.5 Abbildung der Rührwerke Wesentliche Aufgaben der Rührwerke sind eine Homogenisierung und Suspendierung des Abwasserkörpers sowie eine Verhinderung von Kurzschlussströmungen und die Erzeugung einer gerichteten Strömung [3]. Durch eine realitätsnahe Abbildung der Rührwerke (Konstruktion, Betrieb) können der Energieeintrag in den Abwasserkörper und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Strömungsstruktur mit hoher Genauigkeit abgebildet werden. Auf ein Ersatzmodell wird verzichtet. Daher erfolgte eine räumliche Aufnahme der Propeller der im Belebungsbecken betriebenen Rührwerke mithilfe der 3D-Laser-Scan-Technik. Es wurde zunächst die Oberflächengestalt der Propeller durch eine Daten-Punktwolke erfasst und anschließend eine Dreiecksflächenbildung (Triangulation) aus den Punktdaten vorgenommen. Die Technik wird in der Baubranche üblicherweise zum dreidimensionalen Aufmaß von Bauwerken eingesetzt. Bild 4 zeigt ein Foto und die aufgenommene Punktwolke des neuen Rührwerks gwf-wasser Abwasser 12/2015
4 Abwasserbehandlung FACHBERICHTE Tabelle 1: Merkmale der aktuell betriebenen Rührwerke Antriebswelle, Propeller- Motoraufnahmleistung Drehzahl Schub 1 Maximale Maximaler Abströmwinkel Abströmebene Durchmesser Rührwerk, alt horizontal 105 1,8 m 4,8 kw 35 U/min 889 N Rührwerk, neu horizontal 105 1,8 m 2,0 kw 50 U/min 708 N 1 berechnet. Bild 2: Foto der getauchten Belüftungsgitter (links), Schema der Anordnung der Belüftungsgitter und Rührwerke im Belebungsbecken (rechts) Bild 3: Vernetzte Belüfter-Elemente (links) und Luftvolumenanteil der modellierten lamellenförmigen Belüftungsstruktur (rechts) Bild 4: Foto des neuen Rührwerkes (links) und Punktwolke der 3D-Laser-Scan-Aufnahme (rechts) gwf-wasser Abwasser 12/
5 FACHBERICHTE Abwasserbehandlung In Bild 5 sind der aus der Punktwolke rekonstruierte und der für das Strömungsmodell vernetzte Propeller des neuen Rührwerks dargestellt. Für die realitätsnahe Modellierung der Drehbewegung der Propeller werden diese in zylindrische Teilbereiche gesetzt (Bild 5, rechts). So sind sie in einem eigenen kleinen Raum vernetzt, der sich später relativ zum Gitter des ganzen Beckens dreht. Aufgrund der Komplexität der Propellergeometrie erfolgt eine automatische Raum-Diskretisierung mit Tetraeder-Zellen. 3.6 Abbildung von Zu- und Ablauf Über den Zulauf werden das zufließende Abwasser und der erforderliche Rücklaufschlamm dem Belebungsbecken zugeführt. Der Ablauf leitet ein Gemisch aus Abwasser und Belebtschlamm aus dem Belebungsbecken in das Nachklärbecken. Zu- und Ablaufströme fließen durch Rohrleitungen mit einer Nennweite DN 500, die etwa drei Meter unter dem Beckenwasserspiegel liegen. Die Abbildung von Zu- und Ablauf erfolgt entsprechend der konstruktiven Ausbildung der angeschlossenen Rohrleitungen durch kreisrunde Flächen. Als hydraulische Randbedingung ist ihnen jeweils ein Volumenstrom von 200 m³/h zugewiesen. Er setzt sich aus dem mittleren Trockenwetterabfluss Q T,aM und dem mittleren Rücklaufschlammstrom Q RS zusammen. 3.7 Modell des gesamten Untersuchungsraumes Das Zusammenfügen der vernetzten Einzelelemente (Einzelbereiche) des Untersuchungsraumes sowie die Zuweisung mit entsprechenden Randbedingungen führen zum Gesamtmodell (Bild 6). Das Volumen des Belebungsbeckens wird manuell mit Hexaeder-Zellen vernetzt. Die Abbildung der Grenzen des Abwasservolumenkörpers erfolgt im Sohl- und Wandbereich mit einem festen Rand und zur Atmosphäre mit einer freien Oberfläche (Kap. 3.2). Im Modell wird für die oberen Zellen des vernetzten Untersuchungsraumes (Atmosphäre) ein 100-prozentiger Luftvolumenanteil angenommen. Oberhalb der mit Luft gefüllten Zellenschicht wird ein Luftauslass (Pressure Outlet) mit dem Umgebungsdruck als Randbedingung definiert. Durch diesen Auslass kann die in das Modell eingetragene Luft wieder entweichen. Bild 5: Rekonstruierter (links) und vernetzter (rechts) Propeller des neuen Rührwerks Bild 6: Vernetzter Untersuchungsraum des Gesamt modells 1268 gwf-wasser Abwasser 12/2015
6 Abwasserbehandlung FACHBERICHTE Bild 7: Berechnete Umfangsgeschwindigkeiten in einem horizontalen Schnitt durch die Rührwerke (links) und Geschwindigkeiten (Betrag) in einem horizontalen Schnitt 0,2 m über der Sohle (rechts) in der Denitrifikationsphase 4. Simulationsergebnisse und Analyse Das entwickelte Gesamtmodell des Belebungsbeckens wird nunmehr verwendet, um zwei Betriebszustände zu betrachten. Der Zustand ohne Belüftung (Denitrifikationsphase) und der Zustand mit Belüftung (Nitrifikationsphase) werden simuliert. Die Strömung in der Denitrifikationsphase wird vornehmlich durch den Betrieb der beiden Rührwerke induziert. Bei ausgeschalteter Belüftung findet eine Durchmischung des Abwasserkörpers mit einer durchschnittlichen Umfangsgeschwindigkeit von 0,3 m/s statt. In Abhängigkeit von den Absetzeigenschaften des Schlammes (Schlammindex) und Feststoffkonzentrationen im Belebungsbecken ist davon auszugehen, dass der Betrag der kleinsten bodennahen Geschwindigkeiten zwischen 0,1 m/s und 0,25 m/s liegen soll, um Sohlablagerungen zu vermeiden [3]. Bild 7 zeigt die berechneten Umfangsgeschwindigkeiten in einem horizontalen Schnitt durch die Rührwerke und den Betrag der berechneten Geschwindigkeiten in einem horizontalen Schnitt 0,2 m über der Sohle für einen stationären Zustand. Da auf der Kläranlage Ottweiler die Schlammindices zwischen 90,6 ml/g und 215,1 ml/g und die Feststoffkonzentrationen zwischen 2,0 g/l und 3,9 g/l schwanken, wird in Anlehnung an [3] 0,25 m/s als Grenzwert für die erforderliche bodennahe Geschwindigkeit gewählt. Es wird deutlich, dass die Strömungsstruktur vornehmlich durch die Aufstellungs- und Betriebsmerkmale der Rührwerke bestimmt wird. Die durch das neue Aggregat erzeugte geradlinige Strömung wird erst beim Auftreffen auf die Beckenaußenwand umgelenkt. Beeinflusst durch den Strömungsstrahl des neuen Rührwerks wird die Strömung des alten Aggregates in Richtung der inneren Beckenwand geführt, ohne dass sie auf die Wand trifft. Seitlich des umgelenkten Rührwerkstrahls liegt eine strömungstechnische Totzone (Bild 7, linke Darstellung), in der zumindest während der Denitrifikation Sedimentationsvorgänge stattfinden. Die rechte Darstellung von Bild 7 zeigt im gesamten sohlnahen Bereich (0,2 m über der Sohle) sehr geringe Fließgeschwindigkeiten ( 0,25 m/s), die an der inneren Berandung und in unmittelbare Nähe zum neuen Rührwerk auf einen Betrag bis unter 0,1 m/s absinken. Die kleinsten Geschwindigkeiten treten an der Innenwand vor dem alten Rührwerk auf. Daher sind dort am ehesten Ablagerungen zu erwarten. Die Ablagerungsgefahr ist entlang der Außenwand deutlich geringer, da hier fast vollständig höhere Geschwindigkeiten (> 0,1 m/s) zu erkennen sind. Der Einfluss der Drehbewegung und der Antrieb der Strömung werden sichtbar. Die abgesetzten Abwasserinhaltsstoffe werden auch in der Nitrifikationsphase nicht vollständig remobilisiert (Bild 8) und führen zu höheren Wartungskosten. Die Strömung in der Nitrifikationsphase ist vornehmlich durch den Betrieb der beiden Rührwerke und der Belüftungseinrichtung gekennzeichnet. Die Zu- und Ablaufströme üben sowohl in der Nitrifikation als auch in der Denitrifikation nur einen untergeordneten, lokal begrenzten Einfluss auf die Beckenströmung aus. Eine Auswertung der Strömungslinien schließt eine Kurzschlussströmung zwischen Zu- und Ablauf aus. Bild 8: Foto von Ablagerungen in der berechneten Totzone des Belebungsbeckens gwf-wasser Abwasser 12/
7 FACHBERICHTE Abwasserbehandlung Bild 9: Simulierte Strömung der Nitrifikationsphase in einem Schnitt in der Mitte des Belebungsbeckens (links) und Luftvolumenverteilung in einer dreidimensionalen Ansicht (rechts) Bild 9 zeigt, dass die durch das alte Rührwerk nahezu horizontal erzeugte Wasserströmung auf die vertikale Luftströmung der Belüfter-Elemente trifft und sie erheblich beeinflusst. Am dritten Belüfter-Element kommt es zur Umkehr der Fließrichtung, bei der die Abwasserströmung eine Rezirkulation beschreibt. Die Strömungsumkehr kann auch im operativen Betrieb an der Wasseroberfläche beobachtet werden. Folgen dieses Prozesses sind eine unerwünschte Umlenkung der eingebrachten Bewegungsrichtung sowie eine Behinderung bei Homogenisierung und Suspendierung des Abwasserkörpers. Infolge des Einflusses der Belüftung auf die Wasserströmung beträgt die mittlere (berechnete) Umfangsgeschwindigkeit nur noch 0,13 m/s. Obwohl der spezifische Leistungseintrag von 3,06 W/m³ deutlich über dem unteren Grenzwert von 2 W/m³ [3] liegt und die Rührwerke dauerhaft betrieben werden, kommt es in den Belebungsbecken der Kläranlage zu Sohlablagerungen. Diese Feststellung bestätigt die Aussage in [3], dass allein aus der Größe des spezifischen Leistungseintrags (Leistungsaufnahme), keine Schlussfolgerung auf das Rührergebnis getroffen werden kann. 5. Zusammenfassung und Ausblick Die saarländische Kläranlage Ottweiler ist für eine Anschlussgröße von EW = E (Größenklasse 4) und für eine simultane aerobe Schlammstabilisierung ausgelegt. Ihr besonderes Merkmal sind zwei parallel angeordnete Kombibecken der biologischen Reinigungsstufe. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht der Betrieb der ringförmigen Belebungsbecken, die mit Rohrbelüftungs- und Durchmischungsaggregaten (Tauchrührwerken) ausgerüstet sind. Mit dem Ziel, energetische Einsparpotenziale im Belebungsbecken zu detektieren und die Stromkosten zu senken, wurden numerische Strömungssimulationen aktueller Betriebszustände mithilfe eines dreidimensionalen Mehrphasenmodells durchgeführt. Die Modellentwicklung und numerische Strömungsberechnung erfolgte mit der kommerziellen Software ANSYS-Fluent. Die erzielten Simulationsergebnisse bestätigen gewonnene betriebliche Erfahrungen. Trotz des spezifischen Leistungseintrags von 3,06 W/m³ und des kontinuierlichen Betriebs der Rührwerke kommt es zu Ablagerungen im Belebungsbecken. Zudem stellt sich aufgrund des vertikalen Belüftungsstromes eine Umkehr der durch das alte Rührwerk erzeugten horizontalen Strömung ein. Somit wird ein Teil der eingebrachten Bewegungsenergie nicht zielgerichtet eingesetzt. Zukünftig sollen Belüftung und Durchmischung unter Beibehaltung oder Erhöhung der aktuellen Reinigungsleistung der Kläranlage besser aufeinander abgestimmt werden. Die Totzone soll beseitigt bzw. minimiert werden. Dazu muss untersucht werden, in welchen Konstellationen von Betrieb, Positionierung und Ausrichtung der Rühr werke sowie von Betrieb und Anordnung der Belüfter-Elemente der Strombedarf unter Beachtung der Reinigungsziele minimal wird. Literatur [1] Dohmann, M. und Schröder, M.: Energie in der Abwasserentsorgung-Rückschau und Ausblick. Korrespondenz Abwasser, Abfall 58 (2011) Nr. 6, S [2] Fricke, K.: Energieeffizienz kommunaler Kläranlagen. Herausgeber: Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau [3] DWA-M 229: Systeme zur Belüftung und Durchmischung von Belebungsanlagen Teil 1: Planung, Ausschreibung und Ausführung. Ausgabe 05/2013. DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V., Hennef gwf-wasser Abwasser 12/2015
8 Abwasserbehandlung FACHBERICHTE [4] Hasselbach, R.: Energiekostenmanagement beim Entsorgungsverband Saar (EVS), Fachtagung des DWA-Landesverbands Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland Optimierungspotenziale auf Kläranlagen am in Emmelshausen. [5] Müller, E., Kobel, B., Pinnekamp, J. und Böcker, K.: Handbuch Energie in Kläranlagen. Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen [6] EVS: Infobroschüre der Kläranlage Ottweiler, Entsorgungsverband Saar, August [7] ANSYS: Fluent Theory Guide, Release 15.0, ANSYS Inc., November Eingereicht: Korrektur: Im Peer-Review-Verfahren begutachtet Autoren Prof. Dr.-Ing. Joachim Dettmar (Korrespondenz-Autor) Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes University of Applied Sciences Goebenstraße 40 D Saarbrücken Prof. Dr. rer. nat. Marco Günther B. Eng. Mattis Marzell Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes University of Applied Sciences Goebenstraße 40 D Saarbrücken Dr.-Ing. Ralf Hasselbach Entsorgungsverband Saar (EVS) Mainzer Straße 261 D Saarbrücken B. Eng. Jan Steinhausen Zeitschrift KA Korrespondenz Abwasser Abfall In der Ausgabe 12/2015 lesen Sie u. a. folgende Beiträge: Suligowski/Tuszyńska: Niederschlagswasser-Management in Polen Aufgaben und organisatorische Strukturen am Beispiel der Stadt Danzig Miehe u. a.: Vergleich von Desinfektionsverfahren für eine landwirtschaftliche Wasserwiederverwendung in Braunschweig Kulisch: Messtechnische Untersuchung eines Kanalrohr-Wärmetauschers Fahrenkrug u. a.: Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Siedlungswasserwirtschaft in Brandenburg Teil 2: Erstellung eines Leitbildes Reinheimer/Fritz: Wasser- und Abwasserprojekt Korça Vorzeigeprojekt in Albanien nach 15 Jahren erfolgreich abgeschlossen gwf-wasser Abwasser 12/
Strömungen in Wasser und Luft
 Strömungen in Wasser und Luft Strömungssimulationen im UZWR Daniel Nolte März 2009 Mathematische Strömungsmodelle Navier Stokes Gleichungen (Massenerhaltung, Impulserhaltung, Energieerhaltung) ρ + (ρ U)
Strömungen in Wasser und Luft Strömungssimulationen im UZWR Daniel Nolte März 2009 Mathematische Strömungsmodelle Navier Stokes Gleichungen (Massenerhaltung, Impulserhaltung, Energieerhaltung) ρ + (ρ U)
Energiecheck und Energieanalysedas DWA A 216
 Energiecheck und Energieanalysedas DWA A 216 Energieeffizente Abwasserreinigung Verden 14.03.16 Peter Schmellenkamp Funktionsbereichsleiter Abwasserreinigung Zur Person Dipl.-Ing.(FH) Peter Schmellenkamp
Energiecheck und Energieanalysedas DWA A 216 Energieeffizente Abwasserreinigung Verden 14.03.16 Peter Schmellenkamp Funktionsbereichsleiter Abwasserreinigung Zur Person Dipl.-Ing.(FH) Peter Schmellenkamp
Dynamische Schlammalterregelung mit Fuzzy-Logic DWA/VDI Tagung Mess- und Regelungstechnik in abwassertechnischen Anlagen Fulda 2011
 Dynamische Schlammalterregelung mit Fuzzy-Logic DWA/VDI Tagung Mess- und Regelungstechnik in abwassertechnischen Anlagen Fulda 2011 Dr. Martin Michel Mensch Beckentiefe Hydraulik C N Kohlenstoff, Stickstoff
Dynamische Schlammalterregelung mit Fuzzy-Logic DWA/VDI Tagung Mess- und Regelungstechnik in abwassertechnischen Anlagen Fulda 2011 Dr. Martin Michel Mensch Beckentiefe Hydraulik C N Kohlenstoff, Stickstoff
Energieverbrauch von Rührwerken auf Belebungsanlagen
 Institut für Wassergüte Ressourcenmanagement und Abfallwirtschaft Energieverbrauch von Rührwerken auf Belebungsanlagen Klemens Füreder, Karl Svardal, Jörg Krampe Institut für Wassergüte, TU Wien Hagenberg,
Institut für Wassergüte Ressourcenmanagement und Abfallwirtschaft Energieverbrauch von Rührwerken auf Belebungsanlagen Klemens Füreder, Karl Svardal, Jörg Krampe Institut für Wassergüte, TU Wien Hagenberg,
Energieeffizienz auf Kläranlagen in Mecklenburg - Vorpommern
 Nutzung der Energiepotenziale aus dem Abwasser 25.08.2011 Grevesmühlen Energieeffizienz auf Kläranlagen in Mecklenburg - Vorpommern Inhalt 1. Projektvorstellung 2. Stand der Energieeffizienz auf Kläranlagen
Nutzung der Energiepotenziale aus dem Abwasser 25.08.2011 Grevesmühlen Energieeffizienz auf Kläranlagen in Mecklenburg - Vorpommern Inhalt 1. Projektvorstellung 2. Stand der Energieeffizienz auf Kläranlagen
In der einfachsten Form wird der Rücklaufschlamm der ersten Kaskade zugeführt, der Zulauf wird gleichmäßig auf alle Kaskaden verteilt.
 Erhöhung der Kläranlagenkapazität durch Kaskadendenitrifikation Nachdem in Deutschland ein sehr hoher Anschlussgrad erreicht ist, tritt der Neubau von Kläranlagen in den Hintergrund. Ins Blickfeld gerät
Erhöhung der Kläranlagenkapazität durch Kaskadendenitrifikation Nachdem in Deutschland ein sehr hoher Anschlussgrad erreicht ist, tritt der Neubau von Kläranlagen in den Hintergrund. Ins Blickfeld gerät
Beantragung des wasserrechtlichen Bescheides bei der Bezirksregierung Neustadt.
 Kurze Entstehungsgeschichte der 27.08.1985 Beantragung des wasserrechtlichen Bescheides bei der Bezirksregierung Neustadt. 28.11.1990 "1. Spatenstich" für den Bau der Kläranlage. 26.11.1993 Einweihung
Kurze Entstehungsgeschichte der 27.08.1985 Beantragung des wasserrechtlichen Bescheides bei der Bezirksregierung Neustadt. 28.11.1990 "1. Spatenstich" für den Bau der Kläranlage. 26.11.1993 Einweihung
Qualitätssicherung für numerische Berechnungen Beispiel Wärmeübertrager
 Qualitätssicherung für numerische Berechnungen Beispiel Wärmeübertrager Veröffentlichung der Tintschl BioEnergie und Strömungstechnik AG Christoph Lodes Serhat Samar Dr.-Ing. Rolf Sieber Februar 2016 Kurzfassung
Qualitätssicherung für numerische Berechnungen Beispiel Wärmeübertrager Veröffentlichung der Tintschl BioEnergie und Strömungstechnik AG Christoph Lodes Serhat Samar Dr.-Ing. Rolf Sieber Februar 2016 Kurzfassung
Trennen Reinigen Erhalten
 BIO-NET / SESSIL Trennen Reinigen Erhalten NSW-Trägermaterialien Sessil und bio-net NSW seit Jahren eines der führenden Unternehmen im Bereich der trägergebundenen Abwasserreinigungstechnik liefert maßgeschneiderte
BIO-NET / SESSIL Trennen Reinigen Erhalten NSW-Trägermaterialien Sessil und bio-net NSW seit Jahren eines der führenden Unternehmen im Bereich der trägergebundenen Abwasserreinigungstechnik liefert maßgeschneiderte
Hydraulische Auslegung von Erdwärmesondenanlagen - Grundlage für effiziente Planung und Ausführung
 Hydraulische Auslegung von Erdwärmesondenanlagen - Grundlage für effiziente Planung und Ausführung Christoph Rosinski, Franz Josef Zapp GEFGA mbh, Gesellschaft zur Entwicklung und Förderung von Geothermen
Hydraulische Auslegung von Erdwärmesondenanlagen - Grundlage für effiziente Planung und Ausführung Christoph Rosinski, Franz Josef Zapp GEFGA mbh, Gesellschaft zur Entwicklung und Förderung von Geothermen
20. ÖWAV Kläranlagenleistungsvergleich Rückblick Ergebnisse 2012
 20. ÖWAV Kläranlagenleistungsvergleich Rückblick Ergebnisse 2012 Gerhard Spatzierer 20 Jahre Gewässerschutz Entwicklung der Abwasserreinigung in Österreich Information für die Öffentlichkeit Motivation
20. ÖWAV Kläranlagenleistungsvergleich Rückblick Ergebnisse 2012 Gerhard Spatzierer 20 Jahre Gewässerschutz Entwicklung der Abwasserreinigung in Österreich Information für die Öffentlichkeit Motivation
Abwasser. Rundgang Kläranlage
 Abwasser Rundgang Kläranlage Mit dem Bau der Kläranlage Geiselbullach wurde 1964 begonnen und über Jahrzehnte entstand eine hochmoderne, innovative Anlage, ausgelegt für 250.000 Einwohner der 10 Verbandskommunen.
Abwasser Rundgang Kläranlage Mit dem Bau der Kläranlage Geiselbullach wurde 1964 begonnen und über Jahrzehnte entstand eine hochmoderne, innovative Anlage, ausgelegt für 250.000 Einwohner der 10 Verbandskommunen.
Kläranlage Bubach- Calmesweiler. Entsorgungsverband Saar, Tel , Postfach , Saarbrücken,
 Kläranlage Bubach- Calmesweiler Entsorgungsverband Saar, Tel. 06 81 50 00-0, Postfach 10 01 22, 66001 Saarbrücken, www.evs.de Die Kläranlage Bubach-Calmesweiler Die am Ortsende von Bubach gelegene Kläranlage
Kläranlage Bubach- Calmesweiler Entsorgungsverband Saar, Tel. 06 81 50 00-0, Postfach 10 01 22, 66001 Saarbrücken, www.evs.de Die Kläranlage Bubach-Calmesweiler Die am Ortsende von Bubach gelegene Kläranlage
Kläranlage Dirmingen. Entsorgungsverband Saar, Tel , Postfach , Saarbrücken,
 Kläranlage Dirmingen Entsorgungsverband Saar, Tel. 06 81 50 00-0, Postfach 10 01 22, 66001 Saarbrücken, www.evs.e 1 Die Kläranlage Dirmingen Die Kläranlage Dirmingen liegt im Eppelborner Ortsteil Dirmingen,
Kläranlage Dirmingen Entsorgungsverband Saar, Tel. 06 81 50 00-0, Postfach 10 01 22, 66001 Saarbrücken, www.evs.e 1 Die Kläranlage Dirmingen Die Kläranlage Dirmingen liegt im Eppelborner Ortsteil Dirmingen,
Biologische Kläranlage der Marktgemeinde Himberg
 Biologische Kläranlage der Marktgemeinde Himberg Errichtet 1978 1980 Die Marktgemeinde HIMBERG verfügt derzeit über eine Kläranlage, die für die mechanische und biologische Reinigung der Abwässer aus den
Biologische Kläranlage der Marktgemeinde Himberg Errichtet 1978 1980 Die Marktgemeinde HIMBERG verfügt derzeit über eine Kläranlage, die für die mechanische und biologische Reinigung der Abwässer aus den
Numerische Berechnungen der Windumströmung des ZENDOME 150. Dr.-Ing. Leonid Goubergrits Dipl.-Ing. Christoph Lederer
 Numerische Berechnungen der Windumströmung des ZENDOME 150 Dr.-Ing. Leonid Goubergrits Dipl.-Ing. Christoph Lederer 03.08.2007 1. Hintergrund Die Windlast auf den ZENDOME 150 bei Windgeschwindigkeiten
Numerische Berechnungen der Windumströmung des ZENDOME 150 Dr.-Ing. Leonid Goubergrits Dipl.-Ing. Christoph Lederer 03.08.2007 1. Hintergrund Die Windlast auf den ZENDOME 150 bei Windgeschwindigkeiten
Moderne ARA im Brennpunkt: Energieeffizient und Energieproduktiv
 Moderne ARA im Brennpunkt: Energieeffizient und Energieproduktiv Reto Manser Abteilungsleiter Siedlungswasserwirtschaft des Kantons Bern Energieeffizient «Das machen wir schon lange.» Situation Abwasserentsorgung
Moderne ARA im Brennpunkt: Energieeffizient und Energieproduktiv Reto Manser Abteilungsleiter Siedlungswasserwirtschaft des Kantons Bern Energieeffizient «Das machen wir schon lange.» Situation Abwasserentsorgung
Hydromechanik Teilaufgabe 1 (Pflicht)
 Teilaufgabe 1 (Pflicht) Für die Bemessung eines Sielbauwerkes sollen zwei verschiedene Varianten für einen selbsttätigen Verschluss der Breite t untersucht werden. Beide sind im Punkt A drehbar gelagert:
Teilaufgabe 1 (Pflicht) Für die Bemessung eines Sielbauwerkes sollen zwei verschiedene Varianten für einen selbsttätigen Verschluss der Breite t untersucht werden. Beide sind im Punkt A drehbar gelagert:
Bestimmung der feuchte- und temperaturabhängigen Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen
 Bestimmung der feuchte- und temperaturabhängigen Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen F. Ochs 1), H. Stumpp 1), D. Mangold 2), W. Heidemann 1) 1) 2) 3), H. Müller-Steinhagen 1) Universität Stuttgart, Institut
Bestimmung der feuchte- und temperaturabhängigen Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen F. Ochs 1), H. Stumpp 1), D. Mangold 2), W. Heidemann 1) 1) 2) 3), H. Müller-Steinhagen 1) Universität Stuttgart, Institut
CFD-Simulation der Strömungsbildung in anaeroben und anoxischen Becken
 1 CFD-Simulation der Strömungsbildung in anaeroben und anoxischen Becken Hintergrund Der Zweck der CFD-Simulation besteht darin, die Strömungsbildung in anaeroben und anoxischen Becken zu untersuchen,
1 CFD-Simulation der Strömungsbildung in anaeroben und anoxischen Becken Hintergrund Der Zweck der CFD-Simulation besteht darin, die Strömungsbildung in anaeroben und anoxischen Becken zu untersuchen,
Vergleichende Untersuchungen zum Einsatz
 ISSN 0178-0980 ISBN 3-9810255-6-3 ISBN 978-3-9810255-6-9 Schriftenreihe Siedlungswasserwirtschaft Bochum 60 Vergleichende Untersuchungen zum Einsatz von Mess-, Steuer- und Regeitechnik auf Kläranlagen
ISSN 0178-0980 ISBN 3-9810255-6-3 ISBN 978-3-9810255-6-9 Schriftenreihe Siedlungswasserwirtschaft Bochum 60 Vergleichende Untersuchungen zum Einsatz von Mess-, Steuer- und Regeitechnik auf Kläranlagen
Kläranlage Fürweiler. Entsorgungsverband Saar, Tel. 06 81/ 60 00-0, Postfach 10 0122, 66001 Saarbrücken, www.entsorgungsverband.
 Kläranlage Fürweiler Entsorgungsverband Saar, Tel. 06 81/ 60 00-0, Postfach 10 0122, 66001 Saarbrücken, www.entsorgungsverband.de 1 Die Kläranlage Fürweiler In der Kläranlage Fürweiler werden die Abwässer
Kläranlage Fürweiler Entsorgungsverband Saar, Tel. 06 81/ 60 00-0, Postfach 10 0122, 66001 Saarbrücken, www.entsorgungsverband.de 1 Die Kläranlage Fürweiler In der Kläranlage Fürweiler werden die Abwässer
DER ABWASSERREINIGUNGSPROZESS IM KLÄRWERK HANNOVER-HERRENHAUSEN
 DER ABWASSERREINIGUNGSPROZESS IM KLÄRWERK HANNOVER-HERRENHAUSEN LUFTBILD VON DER KLÄRANLAGE EINGANGSPUMPWERK Aus den tief liegenden Hauptsammlern wird das Abwasser mit Hilfe von Pumpen auf den Wasserspiegel
DER ABWASSERREINIGUNGSPROZESS IM KLÄRWERK HANNOVER-HERRENHAUSEN LUFTBILD VON DER KLÄRANLAGE EINGANGSPUMPWERK Aus den tief liegenden Hauptsammlern wird das Abwasser mit Hilfe von Pumpen auf den Wasserspiegel
Aufgaben Hydraulik I, 21. August 2009, total 150 Pkt.
 Aufgaben Hydraulik I, 21. August 2009, total 150 Pkt. Aufgabe 1: Klappe (13 Pkt.) Ein Wasserbehälter ist mit einer rechteckigen Klappe verschlossen, die sich um die Achse A-A drehen kann. Die Rotation
Aufgaben Hydraulik I, 21. August 2009, total 150 Pkt. Aufgabe 1: Klappe (13 Pkt.) Ein Wasserbehälter ist mit einer rechteckigen Klappe verschlossen, die sich um die Achse A-A drehen kann. Die Rotation
Ingenieure. Energieeffiziente Planung von Belüftungssystemen am Beispiel des VKW Erdinger Moos
 Ingenieure Energieeffiziente Planung von Belüftungssystemen am Beispiel des VKW Erdinger Moos Dr. Born - Dr. Ermel GmbH - Ingenieure Dipl.-Ing. Oliver Fricke 25. September 2012 Überblick Definition: Energieeffiziente
Ingenieure Energieeffiziente Planung von Belüftungssystemen am Beispiel des VKW Erdinger Moos Dr. Born - Dr. Ermel GmbH - Ingenieure Dipl.-Ing. Oliver Fricke 25. September 2012 Überblick Definition: Energieeffiziente
THOMAS BUER ENTWICKLUNG VON EINLAUF ABSCHEIDERN
 ISSN 0342-6068 GEWÄSSERSCHUTZ WASSER ABWASSER 182 W.A.R.-BibHottusK THOMAS BUER ENTWICKLUNG VON EINLAUF ABSCHEIDERN Wasserversorgung, Abwassertechnik Abfalltcchnik und Raumplanung Tschnische Universität
ISSN 0342-6068 GEWÄSSERSCHUTZ WASSER ABWASSER 182 W.A.R.-BibHottusK THOMAS BUER ENTWICKLUNG VON EINLAUF ABSCHEIDERN Wasserversorgung, Abwassertechnik Abfalltcchnik und Raumplanung Tschnische Universität
Klärschlamm wird Dünger. sewage sludge becomes fertiliser
 Klärschlamm wird Dünger. sewage sludge becomes fertiliser Vom Klärschlamm zum Dünger! Abwassertechnik von heute belastet die Umwelt! Kläranlagen von heute legen den Fokus ausschließlich auf die Reinigung
Klärschlamm wird Dünger. sewage sludge becomes fertiliser Vom Klärschlamm zum Dünger! Abwassertechnik von heute belastet die Umwelt! Kläranlagen von heute legen den Fokus ausschließlich auf die Reinigung
Rührwerke im Faul- Stapelraum
 Rührwerke im Faul- Stapelraum Wie bekannt kam es in der Vergangenheit zu Wellenbrüchen an Vertikalrührwerken. Dies ist nicht nur in der Schweiz, sondern überall wo diese Technik eingebaut wurde. Es ist
Rührwerke im Faul- Stapelraum Wie bekannt kam es in der Vergangenheit zu Wellenbrüchen an Vertikalrührwerken. Dies ist nicht nur in der Schweiz, sondern überall wo diese Technik eingebaut wurde. Es ist
Rührwerke für Regen- und Abwasser. Baureihe 4000
 ührwerke für egen- und Abwasser Baureihe 4000 Flygt ührwerke Baureihe 44xx, 4530, 4600, 4800 Flygt Tauchmotor-ührwerke sind sehr flexibel in Positionierung und Ausrichtung. Der ührwerksschub kann so ausgerichtet
ührwerke für egen- und Abwasser Baureihe 4000 Flygt ührwerke Baureihe 44xx, 4530, 4600, 4800 Flygt Tauchmotor-ührwerke sind sehr flexibel in Positionierung und Ausrichtung. Der ührwerksschub kann so ausgerichtet
Hydraulik für Bauingenieure
 Hydraulik für Bauingenieure Grundlagen und Anwendungen von Robert Freimann 1. Auflage Hydraulik für Bauingenieure Freimann schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG Hanser
Hydraulik für Bauingenieure Grundlagen und Anwendungen von Robert Freimann 1. Auflage Hydraulik für Bauingenieure Freimann schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG Hanser
Untersuchung der DurchstrÄmung eines Radialventilators mit nicht rotationssymmetrischen Laufrad
 Untersuchung der DurchstrÄmung eines Radialventilators mit nicht rotationssymmetrischen Laufrad Albert Jeckel, Alexander Fischer, Ludwig Berger CFD Schuck Ingenieurgesellschaft mbh, D-89518 Heidenheim
Untersuchung der DurchstrÄmung eines Radialventilators mit nicht rotationssymmetrischen Laufrad Albert Jeckel, Alexander Fischer, Ludwig Berger CFD Schuck Ingenieurgesellschaft mbh, D-89518 Heidenheim
Lektion 5: Dachebenen - von der Spline-Linie zur Gaube
 Advanced 3D Lektion 5: Dachebenen - von der Spline-Linie zur Gaube 79 Lektion 5: Dachebenen - von der Spline-Linie zur Gaube Was für Fensterformen gilt, trifft im CAD-System auch auf Dachgauben zu: Funktionen
Advanced 3D Lektion 5: Dachebenen - von der Spline-Linie zur Gaube 79 Lektion 5: Dachebenen - von der Spline-Linie zur Gaube Was für Fensterformen gilt, trifft im CAD-System auch auf Dachgauben zu: Funktionen
2D - Strömungssimulation einer dreiblättrigen Vertikalachs-Windkraftanlage
 2D - Strömungssimulation einer dreiblättrigen Vertikalachs-Windkraftanlage Inhalt: 1 Einleitung 3 2 Technische Daten 4 3 Geometrie unter PRO Engineer 5 4 Vernetzung der Geometrie 9 5 Simulation des stationären
2D - Strömungssimulation einer dreiblättrigen Vertikalachs-Windkraftanlage Inhalt: 1 Einleitung 3 2 Technische Daten 4 3 Geometrie unter PRO Engineer 5 4 Vernetzung der Geometrie 9 5 Simulation des stationären
MESH Integrierte Abwasserreinigung mittels Gewebefiltration zur direkten Belebtschlamm-Abtrennung
 MESH Integrierte Abwasserreinigung mittels Gewebefiltration zur direkten Belebtschlamm-Abtrennung Werner Fuchs Dept. IFA-Tulln Inst. f. Umweltbiotechnologie Anforderungen an die Kläranlage der Zukunft
MESH Integrierte Abwasserreinigung mittels Gewebefiltration zur direkten Belebtschlamm-Abtrennung Werner Fuchs Dept. IFA-Tulln Inst. f. Umweltbiotechnologie Anforderungen an die Kläranlage der Zukunft
Energieeffizienter Betrieb des Gesamtsystems Klär-/ Biogasanlage
 Energieeffizienter Betrieb des Gesamtsystems Klär-/ Biogasanlage W. Lindenthal 1 *,. Uhlenhut 1, S. Steinigeweg 1, A. Borchert 1 1 EUTEC achbereich Technik, Hochschule Emden/Leer Constantiaplatz 4, D-26723
Energieeffizienter Betrieb des Gesamtsystems Klär-/ Biogasanlage W. Lindenthal 1 *,. Uhlenhut 1, S. Steinigeweg 1, A. Borchert 1 1 EUTEC achbereich Technik, Hochschule Emden/Leer Constantiaplatz 4, D-26723
Fluidmechanik. Thema Erfassung der Druckverluste in verschiedenen Rohrleitungselementen. -Laborübung- 3. Semester. Namen: Datum: Abgabe:
 Strömungsanlage 1 Fachhochschule Trier Studiengang Lebensmitteltechnik Fluidmechanik -Laborübung-. Semester Thema Erfassung der Druckverluste in verschiedenen Rohrleitungselementen Namen: Datum: Abgabe:
Strömungsanlage 1 Fachhochschule Trier Studiengang Lebensmitteltechnik Fluidmechanik -Laborübung-. Semester Thema Erfassung der Druckverluste in verschiedenen Rohrleitungselementen Namen: Datum: Abgabe:
Aufgaben Hydraulik I, 26. August 2010, total 150 Pkt.
 Aufgaben Hydraulik I, 26. August 2010, total 150 Pkt. Aufgabe 1: Luftdichter Behälter (17 Pkt.) Ein luftdichter Behälter mit der Querschnittsfläche A = 12 m 2 ist teilweise mit Wasser gefüllt. Um Wasser
Aufgaben Hydraulik I, 26. August 2010, total 150 Pkt. Aufgabe 1: Luftdichter Behälter (17 Pkt.) Ein luftdichter Behälter mit der Querschnittsfläche A = 12 m 2 ist teilweise mit Wasser gefüllt. Um Wasser
DGUV Fachgespräch. Rud. Otto Meyer Technik Ltd. & Co. KG. Berlin, den V6. Forschung und Entwicklung, Simulation, M.Eng.
 Rud. Otto Meyer Technik Ltd. & Co. KG DGUV Fachgespräch Konzeptentwicklung eines lufttechnisch aktiven Präpariertisches inkl. des Luftführungssystems für Präpariersäle zur Expositionsminderung (Teil 2
Rud. Otto Meyer Technik Ltd. & Co. KG DGUV Fachgespräch Konzeptentwicklung eines lufttechnisch aktiven Präpariertisches inkl. des Luftführungssystems für Präpariersäle zur Expositionsminderung (Teil 2
Vertikale Flygt Rührwerke ZUVERLÄSSIG UND EFFIZIENT
 Vertikale Flygt Rührwerke ZUVERLÄSSIG UND EFFIZIENT EINFÜHRUNG Herausragende Energieeffizienz Vorteile der vertikalen Flygt Rührwerke Die Herausforderung des Rührens Für alle Rührwerksanwendungen sind
Vertikale Flygt Rührwerke ZUVERLÄSSIG UND EFFIZIENT EINFÜHRUNG Herausragende Energieeffizienz Vorteile der vertikalen Flygt Rührwerke Die Herausforderung des Rührens Für alle Rührwerksanwendungen sind
Bachelor- und Masterarbeiten im Sommersemester Numerische Simulation ausgewählter Testfälle mit OpenFOAM
 3 Numerische Simulation ausgewählter Testfälle mit OpenFOAM 3.1 Vorentwicklung von Routinen und Verfahren zur automatisierten Erstellung von Rechengittern Für ein zufriedenstellendes Rechenergebnis der
3 Numerische Simulation ausgewählter Testfälle mit OpenFOAM 3.1 Vorentwicklung von Routinen und Verfahren zur automatisierten Erstellung von Rechengittern Für ein zufriedenstellendes Rechenergebnis der
Erarbeitung und Umsetzung des Energiekonzeptes der Kläranlage Ebersbach. Michael Kuba - SOWAG Zittau
 Erarbeitung und Umsetzung des Energiekonzeptes der Kläranlage Ebersbach Michael Kuba - SOWAG Zittau Inhalt Einleitung Maßnahmepläne Energie Qualitäts- und Umweltziele Optimierung RLS- Pumpen Kläranlage
Erarbeitung und Umsetzung des Energiekonzeptes der Kläranlage Ebersbach Michael Kuba - SOWAG Zittau Inhalt Einleitung Maßnahmepläne Energie Qualitäts- und Umweltziele Optimierung RLS- Pumpen Kläranlage
Wiens Kläranlage wird zum Öko-Kraftwerk
 Wiens Kläranlage wird zum Öko-Kraftwerk Markus Reichel Energiegespräche 29. November 2016, Technisches Museum Wien Gliederung 1. Einleitung: Vorstellung der ebswien hauptkläranlage 2. Steigerung der Energieeffizienz
Wiens Kläranlage wird zum Öko-Kraftwerk Markus Reichel Energiegespräche 29. November 2016, Technisches Museum Wien Gliederung 1. Einleitung: Vorstellung der ebswien hauptkläranlage 2. Steigerung der Energieeffizienz
Bedarfsgerechte Lösungen der kommunalen Abwasserreinigung mit Fokus Energieeffizienz
 Platzhalter für Bild, Bild auf Titelfolie hinter das Logo einsetzen Bedarfsgerechte Lösungen der kommunalen Abwasserreinigung mit Fokus Energieeffizienz Turkish GWP-Day 2012 Istanbul 17. 18.04.2012 Prof.
Platzhalter für Bild, Bild auf Titelfolie hinter das Logo einsetzen Bedarfsgerechte Lösungen der kommunalen Abwasserreinigung mit Fokus Energieeffizienz Turkish GWP-Day 2012 Istanbul 17. 18.04.2012 Prof.
Wir klären alles! Alles klar?
 Kläranlage Milda Stufe (Rechen) Ausbaugröße.000 EW Abwasser fließt durch Freigefälleleitung zum Rechen von Grob- und Faserstoffen durch einen Siebrechen Organische Bestandteile des Rechengutes werden ausgewaschen
Kläranlage Milda Stufe (Rechen) Ausbaugröße.000 EW Abwasser fließt durch Freigefälleleitung zum Rechen von Grob- und Faserstoffen durch einen Siebrechen Organische Bestandteile des Rechengutes werden ausgewaschen
Aufgaben Hydraulik I, 10. Februar 2011, total 150 Pkt.
 Aufgaben Hydraulik I, 10. Februar 2011, total 150 Pkt. Aufgabe 1: Hydrostatik (13 Pkt.) Eine senkrechte Wand trennt zwei mit unterschiedlichen Flüssigkeiten gefüllte Behälter der selben Grundfläche (Breite
Aufgaben Hydraulik I, 10. Februar 2011, total 150 Pkt. Aufgabe 1: Hydrostatik (13 Pkt.) Eine senkrechte Wand trennt zwei mit unterschiedlichen Flüssigkeiten gefüllte Behälter der selben Grundfläche (Breite
P R E S S E I N F O R M A T I O N. Saubere Flüsse durch effiziente Kläranlagen
 P R E S S E I N F O R M A T I O N 25/2010 Saubere Flüsse durch effiziente Kläranlagen DWA-Leistungsvergleich kommunaler Kläranlagen stellt Phosphor in den Mittelpunkt Bonn/Hennef, 24. November 2010 Algenwachstum,
P R E S S E I N F O R M A T I O N 25/2010 Saubere Flüsse durch effiziente Kläranlagen DWA-Leistungsvergleich kommunaler Kläranlagen stellt Phosphor in den Mittelpunkt Bonn/Hennef, 24. November 2010 Algenwachstum,
Bestimmung der Ausbreitung luftgetragener Keime mittels Strömungssimulation. Stefan Barp. Schweizer Hygienetagung, 27./28.
 Vortrag_Hygienetagung_2011_01_17.ppt Bestimmung der Ausbreitung luftgetragener Keime mittels Strömungssimulation Stefan Barp Schweizer Hygienetagung, 27./28. Januar 2011 Firmenportrait Keyfigures von AFC
Vortrag_Hygienetagung_2011_01_17.ppt Bestimmung der Ausbreitung luftgetragener Keime mittels Strömungssimulation Stefan Barp Schweizer Hygienetagung, 27./28. Januar 2011 Firmenportrait Keyfigures von AFC
Freileitungen und Errichtung von Windenergieanlagen
 Freileitungen und Errichtung von Windenergieanlagen Dr. Thomas Hahm F2E Fluid & Energy Engineering GmbH & Co. KG, Hamburg F2E - fluid & energy engineering 1 F2E Fluid & Energy Engineering GmbH & Co. KG
Freileitungen und Errichtung von Windenergieanlagen Dr. Thomas Hahm F2E Fluid & Energy Engineering GmbH & Co. KG, Hamburg F2E - fluid & energy engineering 1 F2E Fluid & Energy Engineering GmbH & Co. KG
BASt-Kolloquium Luftreinhaltung durch Photokatalyse am in Bergisch Gladbach
 BASt-Kolloquium Luftreinhaltung durch Photokatalyse am 23.09.2015 in Bergisch Gladbach -1- Modellrechnungen zur Abschätzung der maximalen Wirkung einer LSW mit photokatalytischer Oberfläche - Vergleich
BASt-Kolloquium Luftreinhaltung durch Photokatalyse am 23.09.2015 in Bergisch Gladbach -1- Modellrechnungen zur Abschätzung der maximalen Wirkung einer LSW mit photokatalytischer Oberfläche - Vergleich
Materialien WS 2014/15 Dozent: Dr. Andreas Will.
 Master Umweltingenieur, 1. Semester, Modul 42439, Strömungsmechanik, 420607, VL, Do. 11:30-13:00, R. 3.21 420608, UE, Do. 13:45-15:15, R. 3.17 Materialien WS 2014/15 Dozent: Dr. Andreas Will will@tu-cottbus.de
Master Umweltingenieur, 1. Semester, Modul 42439, Strömungsmechanik, 420607, VL, Do. 11:30-13:00, R. 3.21 420608, UE, Do. 13:45-15:15, R. 3.17 Materialien WS 2014/15 Dozent: Dr. Andreas Will will@tu-cottbus.de
Lösungen. S. 167 Nr. 6. S. 167 Nr. 8. S.167 Nr.9
 Lösungen S. 167 Nr. 6 Schätzung: Es können ca. 5000 Haushaltstanks gefüllt werden. Man beachte die Dimensionen der Tanks: Der Haushaltstank passt in ein kleines Zimmer, der große Öltank besitzt jedoch
Lösungen S. 167 Nr. 6 Schätzung: Es können ca. 5000 Haushaltstanks gefüllt werden. Man beachte die Dimensionen der Tanks: Der Haushaltstank passt in ein kleines Zimmer, der große Öltank besitzt jedoch
5. Numerische Ergebnisse. 5.1. Vorbemerkungen
 5. Numerische Ergebnisse 52 5. Numerische Ergebnisse 5.1. Vorbemerkungen Soll das thermische Verhalten von Verglasungen simuliert werden, müssen alle das System beeinflussenden Wärmetransportmechanismen,
5. Numerische Ergebnisse 52 5. Numerische Ergebnisse 5.1. Vorbemerkungen Soll das thermische Verhalten von Verglasungen simuliert werden, müssen alle das System beeinflussenden Wärmetransportmechanismen,
- Anschlussfertiges Komplettgerät, beinhaltet alle Bauteile zur Komfortklimatisierung, Regelorgane - Intensive Qualitätsprüfung mit Werksprobelauf
 Komfort-Klimagerät mit Kreuz-Gegen-Kreuzstrom-Wärmeübertrager 59 26 0 - vereinfachte Darstellung Wählt automatisch die wirtschaftlichste Betriebsweise! 52 und 59 LUFTVOLUMENSTROM:.200 5.000 m 3 /h Auf
Komfort-Klimagerät mit Kreuz-Gegen-Kreuzstrom-Wärmeübertrager 59 26 0 - vereinfachte Darstellung Wählt automatisch die wirtschaftlichste Betriebsweise! 52 und 59 LUFTVOLUMENSTROM:.200 5.000 m 3 /h Auf
VORTRAG ÖFHF AM HINTERLÜFTETE FASSADEN WÄRME- UND SCHALLSCHUTZ A-4600 WELS
 VORTRAG ÖFHF AM 05.05.2010 HINTERLÜFTETE FASSADEN WÄRME- UND SCHALLSCHUTZ MESSEZENTRUM NEU A-4600 WELS Wärme- und feuchtetechnische Betrachtung hinterlüfteter Fassaden Gewährleistung einer feuchtetechnischen
VORTRAG ÖFHF AM 05.05.2010 HINTERLÜFTETE FASSADEN WÄRME- UND SCHALLSCHUTZ MESSEZENTRUM NEU A-4600 WELS Wärme- und feuchtetechnische Betrachtung hinterlüfteter Fassaden Gewährleistung einer feuchtetechnischen
Wie hängen beim Kreis Durchmesser und Umfang zusammen?
 Euro-Münzen und die Kreiszahl Ulla Schmidt, Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Lünen Steckbrief der Aufgabe Sekundarstufe I (Kreisberechnungen) Dauer: 2 Unterrichtsstunden Notwendige Voraussetzungen: Schülerinnen
Euro-Münzen und die Kreiszahl Ulla Schmidt, Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Lünen Steckbrief der Aufgabe Sekundarstufe I (Kreisberechnungen) Dauer: 2 Unterrichtsstunden Notwendige Voraussetzungen: Schülerinnen
CFX Berlin Software GmbH Simulationskompetenz aus Berlin
 Anwendungsbeispiele Simulation Simulation eines Schrägbalkenrührers mit ANSYS CFX CFX Berlin Software GmbH Simulationskompetenz aus Berlin CFX Berlin Software GmbH Tel.: +49 30 293 811 30 E-Mail: info@cfx-berlin.de
Anwendungsbeispiele Simulation Simulation eines Schrägbalkenrührers mit ANSYS CFX CFX Berlin Software GmbH Simulationskompetenz aus Berlin CFX Berlin Software GmbH Tel.: +49 30 293 811 30 E-Mail: info@cfx-berlin.de
Berücksichtigung von Wärmebrücken im Energieeinsparnachweis
 Flankendämmung Dieser Newsletter soll auf die Thematik der Flankendämmung in Kellergeschossen und Tiefgaragen zu beheizten Bereichen hinweisen. Hierfür wird erst einmal grundsätzlich die Wärmebrücke an
Flankendämmung Dieser Newsletter soll auf die Thematik der Flankendämmung in Kellergeschossen und Tiefgaragen zu beheizten Bereichen hinweisen. Hierfür wird erst einmal grundsätzlich die Wärmebrücke an
Versuch V1 - Viskosität, Flammpunkt, Dichte
 Versuch V1 - Viskosität, Flammpunkt, Dichte 1.1 Bestimmung der Viskosität Grundlagen Die Viskosität eines Fluids ist eine Stoffeigenschaft, die durch den molekularen Impulsaustausch der einzelnen Fluidpartikel
Versuch V1 - Viskosität, Flammpunkt, Dichte 1.1 Bestimmung der Viskosität Grundlagen Die Viskosität eines Fluids ist eine Stoffeigenschaft, die durch den molekularen Impulsaustausch der einzelnen Fluidpartikel
b ) den mittleren isobaren thermischen Volumenausdehnungskoeffizienten von Ethanol. Hinweis: Zustand 2 t 2 = 80 C = 23, kg m 3
 Aufgabe 26 Ein Pyknometer ist ein Behälter aus Glas mit eingeschliffenem Stopfen, durch den eine kapillarförmige Öffnung führt. Es hat ein sehr genau bestimmtes Volumen und wird zur Dichtebestimmung von
Aufgabe 26 Ein Pyknometer ist ein Behälter aus Glas mit eingeschliffenem Stopfen, durch den eine kapillarförmige Öffnung führt. Es hat ein sehr genau bestimmtes Volumen und wird zur Dichtebestimmung von
Kläranlage Zermatt. Die grösste Membranbiologieanlage der Schweiz. im Interesse einer sauberen Vispa
 Kläranlage Zermatt Die grösste Membranbiologieanlage der Schweiz im Interesse einer sauberen Vispa Funktionsweise der Kläranlage Prozesse Belebtschlamm gereinigtes Abwasser Membranfiltration In der Membranfiltration
Kläranlage Zermatt Die grösste Membranbiologieanlage der Schweiz im Interesse einer sauberen Vispa Funktionsweise der Kläranlage Prozesse Belebtschlamm gereinigtes Abwasser Membranfiltration In der Membranfiltration
Entwicklung einer netzbasierten Methodik zur Modellierung von Prozessen der Verdunstungskühlung
 Institut für Energietechnik - Professur für Technische Thermodynamik Entwicklung einer netzbasierten Methodik zur Modellierung von Prozessen der Verdunstungskühlung Tobias Schulze 13.11.2012, DBFZ Leipzig
Institut für Energietechnik - Professur für Technische Thermodynamik Entwicklung einer netzbasierten Methodik zur Modellierung von Prozessen der Verdunstungskühlung Tobias Schulze 13.11.2012, DBFZ Leipzig
Fachartikel. Telezentrische Objektive für Kameras größer 1 Zoll
 Vision & Control GmbH Mittelbergstraße 16 98527 Suhl. Germany Telefon: +49 3681 / 79 74-0 Telefax: +49 36 81 / 79 74-33 www.vision-control.com Fachartikel Telezentrische Objektive für Kameras größer 1
Vision & Control GmbH Mittelbergstraße 16 98527 Suhl. Germany Telefon: +49 3681 / 79 74-0 Telefax: +49 36 81 / 79 74-33 www.vision-control.com Fachartikel Telezentrische Objektive für Kameras größer 1
Gutachten zum System WINARO WINESAVER (Auszug)
 Gutachten zum System WINARO WINESAVER (Auszug) 1. Unbedenklichkeit des Schutzgases Zum Schutz vor oxidativer Schädigung von Wein in teilentleerten Flaschen wird vorgeschlagen, den Restwein mit einem Schutzgas
Gutachten zum System WINARO WINESAVER (Auszug) 1. Unbedenklichkeit des Schutzgases Zum Schutz vor oxidativer Schädigung von Wein in teilentleerten Flaschen wird vorgeschlagen, den Restwein mit einem Schutzgas
Grundlagen der Siedlungswasserwirtschaft. Bearbeiter: Zhang, Hui-Min
 Grundlagen der Siedlungswasserwirtschaft Bearbeiter: Zhang, Hui-Min G r u n d b e g r i f f Siedlungswasserwirtschaft ist Teil der Wasserwirtschaft und umfasst den gesamten Wasserkreislauf in besiedelten
Grundlagen der Siedlungswasserwirtschaft Bearbeiter: Zhang, Hui-Min G r u n d b e g r i f f Siedlungswasserwirtschaft ist Teil der Wasserwirtschaft und umfasst den gesamten Wasserkreislauf in besiedelten
Vergleich zwischen Systemen der getrennten und der gekoppelten Erzeugung von Strom und Wärme bei unterschiedlichen Bedarfsstrukturen
 KWK-Systemvergleich 1 Vergleich zwischen Systemen der getrennten und der gekoppelten Erzeugung von Strom und Wärme bei unterschiedlichen Bedarfsstrukturen Aufgabe 1: Verschiedene Systeme der getrennten
KWK-Systemvergleich 1 Vergleich zwischen Systemen der getrennten und der gekoppelten Erzeugung von Strom und Wärme bei unterschiedlichen Bedarfsstrukturen Aufgabe 1: Verschiedene Systeme der getrennten
In einem kartesischen Koordinatensystem ist der Körper ABCDPQRS mit A(28 0 0),
 IQB-Aufgabe Analytische Geometrie I In einem kartesischen Koordinatensystem ist der Körper ABCDPQRS mit A(28 0 0), B(28 10 0), C(0 10 0), D(0 0 0) und P(20 0 6) gegeben. Der Körper ist ein schiefes Prisma,
IQB-Aufgabe Analytische Geometrie I In einem kartesischen Koordinatensystem ist der Körper ABCDPQRS mit A(28 0 0), B(28 10 0), C(0 10 0), D(0 0 0) und P(20 0 6) gegeben. Der Körper ist ein schiefes Prisma,
Aufgabe 11. Laminaren Rohrströmung. (Analyse mit ANSYS CFX)
 Aufgabe 11 Laminaren Rohrströmung (Analyse mit ANSYS CFX) Arbeitsschritte: 1. Starte AnsysWB und lege ein Fluid-Flow-(CFX)-Projekt an. 2. Doppelklicke auf [Geometry ] im Projektfluss um den DesignModeller
Aufgabe 11 Laminaren Rohrströmung (Analyse mit ANSYS CFX) Arbeitsschritte: 1. Starte AnsysWB und lege ein Fluid-Flow-(CFX)-Projekt an. 2. Doppelklicke auf [Geometry ] im Projektfluss um den DesignModeller
Pumpenkennlinie. Matthias Prielhofer
 Matthias Prielhfer 1. Zielsetzung Im Rahmen der Übung sllen auf einem dafür eingerichteten Pumpenprüfstand Parameter gemessen werden um eine erstellen zu können. Weiters sll vn einem Stellglied, in diesem
Matthias Prielhfer 1. Zielsetzung Im Rahmen der Übung sllen auf einem dafür eingerichteten Pumpenprüfstand Parameter gemessen werden um eine erstellen zu können. Weiters sll vn einem Stellglied, in diesem
Energieeffiziente Komponenten für die biologische Abwasserreinigung
 WATER NEEDS RESPONSIBILITY Energieeffiziente Komponenten für die biologische Abwasserreinigung Dr.-Ing. Marcus Höfken München, 2. Juni 2016 VDMA Pressekonferenz, IFAT 2016 Slide 1 21.07.2016 INHALT Der
WATER NEEDS RESPONSIBILITY Energieeffiziente Komponenten für die biologische Abwasserreinigung Dr.-Ing. Marcus Höfken München, 2. Juni 2016 VDMA Pressekonferenz, IFAT 2016 Slide 1 21.07.2016 INHALT Der
Vergleich Auslaufbecher und Rotationsviskosimeter
 Vergleich Auslaufbecher und Rotationsviskosimeter Die Viskositätsmessung mit dem Auslaufbecher ist, man sollte es kaum glauben, auch in unserer Zeit der allgemeinen Automatisierung und ISO 9 Zertifizierungen
Vergleich Auslaufbecher und Rotationsviskosimeter Die Viskositätsmessung mit dem Auslaufbecher ist, man sollte es kaum glauben, auch in unserer Zeit der allgemeinen Automatisierung und ISO 9 Zertifizierungen
Verbesserung der Energieeffizienz auf mittelhessischen Kläranlagen - erste Ergebnisse
 Regierungspräsidium Gießen Verbesserung der Energieeffizienz auf mittelhessischen Kläranlagen - erste Ergebnisse Frank Reißig, RP Gießen 13.03.2013 Verbesserung der Energieeffizienz auf mittelhessischen
Regierungspräsidium Gießen Verbesserung der Energieeffizienz auf mittelhessischen Kläranlagen - erste Ergebnisse Frank Reißig, RP Gießen 13.03.2013 Verbesserung der Energieeffizienz auf mittelhessischen
Möglichkeiten und Potenziale der. Energieerzeugung mittels Abwasser
 Möglichkeiten und Potenziale der Energieerzeugung mittels Abwasser PD Dr.-Ing. habil. Thomas Dockhorn Potenziale für die Energieerzeugung 1. Klärschlamm 2. Co-Substrate (z.b. Fett, Bioabfall) 3. Abwasser
Möglichkeiten und Potenziale der Energieerzeugung mittels Abwasser PD Dr.-Ing. habil. Thomas Dockhorn Potenziale für die Energieerzeugung 1. Klärschlamm 2. Co-Substrate (z.b. Fett, Bioabfall) 3. Abwasser
Ökologische und ökonomische Bewertung der zentralen Enthärtung von Trinkwasser
 1 Ökologische und ökonomische Bewertung der zentralen Enthärtung von Trinkwasser Zusammenfassung Die Versorgung mit hartem Wasser, d.h. Wasser im Härtebereich 3 oder 4, kann für den Verbraucher deutliche
1 Ökologische und ökonomische Bewertung der zentralen Enthärtung von Trinkwasser Zusammenfassung Die Versorgung mit hartem Wasser, d.h. Wasser im Härtebereich 3 oder 4, kann für den Verbraucher deutliche
Probe zur Lösung der Berechnungsbeispiele BB_14.x: - Fortsetzung -
 Prof. Dr.-Ing. Rainer Ose Elektrotechnik für Ingenieure Grundlagen. Auflage, 2008 Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel -niversity of Applied Sciences- Probe zur Lösung der Berechnungsbeispiele BB_1.x:
Prof. Dr.-Ing. Rainer Ose Elektrotechnik für Ingenieure Grundlagen. Auflage, 2008 Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel -niversity of Applied Sciences- Probe zur Lösung der Berechnungsbeispiele BB_1.x:
Mathematik B-Tag Freitag, 20. November, 8:00 15:00 Uhr. Um die Ecke. Mathematik B-Tag Seite 1 von 9 -
 Mathematik B-Tag 2015 Freitag, 20. November, 8:00 15:00 Uhr Um die Ecke Mathematik B-Tag 2015 - Seite 1 von 9 - Erkundung 1 (Klavier) Ein Klavier soll durch einen 1 m breiten Gang um die Ecke (rechter
Mathematik B-Tag 2015 Freitag, 20. November, 8:00 15:00 Uhr Um die Ecke Mathematik B-Tag 2015 - Seite 1 von 9 - Erkundung 1 (Klavier) Ein Klavier soll durch einen 1 m breiten Gang um die Ecke (rechter
Fragebogen zu Rührwerken auf Belebungsanlagen ("analoge" Verison)
 Fragebogen zu Rührwerken auf Belebungsanlagen ("analoge" Verison) Wir bitten Sie die "analoge" Version des ExcelFragebogens nur zur Hilfestellung bei der Datensalung zu verwenden. Die Zusendung des vorliegenden
Fragebogen zu Rührwerken auf Belebungsanlagen ("analoge" Verison) Wir bitten Sie die "analoge" Version des ExcelFragebogens nur zur Hilfestellung bei der Datensalung zu verwenden. Die Zusendung des vorliegenden
CFD-Simulation von Störkörpern
 CFD-Simulation von Störkörpern Arbeitsgruppe 7.52 Neue Verfahren der Wärmemengenmessung Fachgebiet Fluidsystemdynamik - Strömungstechnik in Maschinen und Anlagen Vor-Ort-Kalibrierung von Durchflussmessgeräten
CFD-Simulation von Störkörpern Arbeitsgruppe 7.52 Neue Verfahren der Wärmemengenmessung Fachgebiet Fluidsystemdynamik - Strömungstechnik in Maschinen und Anlagen Vor-Ort-Kalibrierung von Durchflussmessgeräten
SCHRIFTLICHE ABSCHLUSSPRÜFUNG 2011 REALSCHULABSCHLUSS MATHEMATIK. Arbeitszeit: 180 Minuten
 Arbeitszeit: 180 Minuten Es sind die drei Pflichtaufgaben und zwei Wahlpflichtaufgaben zu bearbeiten. Seite 1 von 8 Pflichtaufgaben Pflichtaufgabe 1 (erreichbare BE: 10) a) Bei einem Experiment entstand
Arbeitszeit: 180 Minuten Es sind die drei Pflichtaufgaben und zwei Wahlpflichtaufgaben zu bearbeiten. Seite 1 von 8 Pflichtaufgaben Pflichtaufgabe 1 (erreichbare BE: 10) a) Bei einem Experiment entstand
Experimentelle Hydromechanik Wehrüberfall und Ausfluss am Planschütz
 UNIVERSITÄT DER BUNDESWEHR MÜNCHEN Fakultät für Bauingenieur- und Vermessungswesen Institut für Wasserwesen Dr.-Ing. H. Kulisch Universitätsprofessor Dr.-Ing. Andreas Malcherek Hydromechanik und Wasserbau
UNIVERSITÄT DER BUNDESWEHR MÜNCHEN Fakultät für Bauingenieur- und Vermessungswesen Institut für Wasserwesen Dr.-Ing. H. Kulisch Universitätsprofessor Dr.-Ing. Andreas Malcherek Hydromechanik und Wasserbau
Objektorientierte Modellierung (1)
 Objektorientierte Modellierung (1) Die objektorientierte Modellierung verwendet: Klassen und deren Objekte Beziehungen zwischen Objekten bzw. Klassen Klassen und Objekte Definition Klasse Eine Klasse ist
Objektorientierte Modellierung (1) Die objektorientierte Modellierung verwendet: Klassen und deren Objekte Beziehungen zwischen Objekten bzw. Klassen Klassen und Objekte Definition Klasse Eine Klasse ist
Erste Erfahrungen über den Betrieb und die Wirtschaftlichkeit von Festbettreaktoren auf deutschen Kläranlagen
 Erste Erfahrungen über den Betrieb und die Wirtschaftlichkeit von Festbettreaktoren auf deutschen Kläranlagen von Dr. Michael Gassen, Hydro-Ingenieure, Düsseldorf Vortrag auf der 31. Essener Tagung für
Erste Erfahrungen über den Betrieb und die Wirtschaftlichkeit von Festbettreaktoren auf deutschen Kläranlagen von Dr. Michael Gassen, Hydro-Ingenieure, Düsseldorf Vortrag auf der 31. Essener Tagung für
Branchenenergiekonzept Alten- und Pflegeheime NRW Energiekennzahlen
 Projektträger Energie, Technologie und Nachhaltigkeit (ETN) Branchenenergiekonzept Alten- und Pflegeheime NRW Energiekennzahlen Bewohner l Bett kwh C m 3 a m 3 kwh 2 m 26.11.2012 Berlin Stefan Kirschbaum
Projektträger Energie, Technologie und Nachhaltigkeit (ETN) Branchenenergiekonzept Alten- und Pflegeheime NRW Energiekennzahlen Bewohner l Bett kwh C m 3 a m 3 kwh 2 m 26.11.2012 Berlin Stefan Kirschbaum
Kraft- und Arbeitsmaschinen Klausur zur Diplom-Hauptprüfung, 26. Juli 2006
 Kraft- und Arbeitsmaschinen Klausur zur Diplom-Hauptprüfung, 26. Juli 2006 Bearbeitungszeit: 120 Minuten Umfang der Aufgabenstellung: 7 nummerierte Seiten; Die Foliensammlung, Ihre Mitschrift der Vorlesung
Kraft- und Arbeitsmaschinen Klausur zur Diplom-Hauptprüfung, 26. Juli 2006 Bearbeitungszeit: 120 Minuten Umfang der Aufgabenstellung: 7 nummerierte Seiten; Die Foliensammlung, Ihre Mitschrift der Vorlesung
Das stationäre Magnetfeld Ein sehr langer Leiter mit dem Durchmesser D werde von einem Gleichstrom I durchflossen.
 Das stationäre Magnetfeld 16 4 Stationäre Magnetfelder 4.1 Potentiale magnetischer Felder 4.1 Ein sehr langer Leiter mit dem Durchmesser D werde von einem Gleichstrom I durchflossen. a) Berechnen Sie mit
Das stationäre Magnetfeld 16 4 Stationäre Magnetfelder 4.1 Potentiale magnetischer Felder 4.1 Ein sehr langer Leiter mit dem Durchmesser D werde von einem Gleichstrom I durchflossen. a) Berechnen Sie mit
Anaerobe Schlammstabilisierung kleiner Anlagen Pilotprojekt Bad Abbach
 Lehrerbesprechung 2014 der Kanal- und Kläranlagennachbarschaften 13. Februar 2014 Anaerobe Schlammstabilisierung kleiner Anlagen Pilotprojekt Bad Abbach Prof. Dr.-Ing. Oliver Christ, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
Lehrerbesprechung 2014 der Kanal- und Kläranlagennachbarschaften 13. Februar 2014 Anaerobe Schlammstabilisierung kleiner Anlagen Pilotprojekt Bad Abbach Prof. Dr.-Ing. Oliver Christ, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
Verwandte Begriffe Maxwell-Gleichungen, elektrisches Wirbelfeld, Magnetfeld von Spulen, magnetischer Fluss, induzierte Spannung.
 Verwandte Begriffe Maxwell-Gleichungen, elektrisches Wirbelfeld, Magnetfeld von Spulen, magnetischer Fluss, induzierte Spannung. Prinzip In einer langen Spule wird ein Magnetfeld mit variabler Frequenz
Verwandte Begriffe Maxwell-Gleichungen, elektrisches Wirbelfeld, Magnetfeld von Spulen, magnetischer Fluss, induzierte Spannung. Prinzip In einer langen Spule wird ein Magnetfeld mit variabler Frequenz
Mathematik. Zentrale schriftliche Abiturprüfung Kurs auf erhöhtem Anforderungsniveau mit CAS. Aufgabenvorschlag Teil 2. Aufgabenstellung 2
 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft Zentrale schriftliche Abiturprüfung 2016 Kurs auf erhöhtem Anforderungsniveau mit CAS Aufgabenvorschlag Teil
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft Zentrale schriftliche Abiturprüfung 2016 Kurs auf erhöhtem Anforderungsniveau mit CAS Aufgabenvorschlag Teil
Aufgaben aus den Vergleichenden Arbeiten im Fach Mathematik Verschiedenes Verschiedenes
 2012 A 1e) Verschiedenes Schreiben Sie die Namen der drei Vierecke auf. 2011 A 1e) Verschiedenes Wie heißen diese geometrischen Objekte? Lösungen: Aufgabe Lösungsskizze BE 2012 A 1e) Rechteck Parallelogramm
2012 A 1e) Verschiedenes Schreiben Sie die Namen der drei Vierecke auf. 2011 A 1e) Verschiedenes Wie heißen diese geometrischen Objekte? Lösungen: Aufgabe Lösungsskizze BE 2012 A 1e) Rechteck Parallelogramm
Modellbasierte Optimierung von Biogasanlagen
 Modellbasierte Optimierung von Biogasanlagen Biernacki, P. a ; Steinigeweg, S. a ; Borchert, A. a ; Siefert, E. a ; Uhlenhut, F. a ; Stein, I. a ; Wichern, M. b a Hochschule Emden/Leer, EUTEC Institut,
Modellbasierte Optimierung von Biogasanlagen Biernacki, P. a ; Steinigeweg, S. a ; Borchert, A. a ; Siefert, E. a ; Uhlenhut, F. a ; Stein, I. a ; Wichern, M. b a Hochschule Emden/Leer, EUTEC Institut,
Reichen die heutigen Technologien für eine nachhaltige Abwasserreinigung aus?
 Reichen die heutigen Technologien für eine nachhaltige Abwasserreinigung aus? Harald Horn (TU München) Franz Bischof (Hochschule Amberg-Weiden) Einführung Weltwassermarkt Wie entwickelt sich neue (nachhaltige)
Reichen die heutigen Technologien für eine nachhaltige Abwasserreinigung aus? Harald Horn (TU München) Franz Bischof (Hochschule Amberg-Weiden) Einführung Weltwassermarkt Wie entwickelt sich neue (nachhaltige)
Simulation der Pendelrampe des Scherlibaches. 1 Einführung in Computed Fluid Dynamics (CFD)
 Simulation der Pendelrampe des Scherlibaches Lukas Moser: ProcEng Moser GmbH 1 Einführung in Computed Fluid Dynamics (CFD) 1.1 Grundlagen der numerischen Strömungssimulation CFD steht für computed fluid
Simulation der Pendelrampe des Scherlibaches Lukas Moser: ProcEng Moser GmbH 1 Einführung in Computed Fluid Dynamics (CFD) 1.1 Grundlagen der numerischen Strömungssimulation CFD steht für computed fluid
Stellen Sie für die folgenden Reaktionen die Gleichgewichtskonstante K p auf: 1/2O 2 + 1/2H 2 OH H 2 + 1/2O 2 H 2 O
 Klausur H2004 (Grundlagen der motorischen Verbrennung) 2 Aufgabe 1.) Stellen Sie für die folgenden Reaktionen die Gleichgewichtskonstante K p auf: 1/2O 2 + 1/2H 2 OH H 2 + 1/2O 2 H 2 O Wie wirkt sich eine
Klausur H2004 (Grundlagen der motorischen Verbrennung) 2 Aufgabe 1.) Stellen Sie für die folgenden Reaktionen die Gleichgewichtskonstante K p auf: 1/2O 2 + 1/2H 2 OH H 2 + 1/2O 2 H 2 O Wie wirkt sich eine
DEUS 21: Wasser im Kreislauf
 DEUS 21: Wasser im Kreislauf Frankfurt am Main, 18.01.2013 Dr.-Ing. Marius Mohr Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB 280 Mitarbeiter Betriebshaushalt 2011 von 18 Mio Ca. 7200
DEUS 21: Wasser im Kreislauf Frankfurt am Main, 18.01.2013 Dr.-Ing. Marius Mohr Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB 280 Mitarbeiter Betriebshaushalt 2011 von 18 Mio Ca. 7200
Messung der Schallabsorption im Hallraum gemäß EN ISO parasilencio Akustiknutpaneele Typ Prüfbericht VOL0309
 FACH HOCHSCHULE LÜBECK University of Applied Sciences Prof. Dr. Jürgen Tchorz Mönkhofer Weg 239 23562 Lübeck T +49 451 300-5240 F +49 451 300-5477 tchorz@fh-luebeck.de Messung der Schallabsorption im Hallraum
FACH HOCHSCHULE LÜBECK University of Applied Sciences Prof. Dr. Jürgen Tchorz Mönkhofer Weg 239 23562 Lübeck T +49 451 300-5240 F +49 451 300-5477 tchorz@fh-luebeck.de Messung der Schallabsorption im Hallraum
Grundwasserhydraulik Und -erschließung
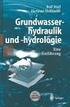 Vorlesung und Übung Grundwasserhydraulik Und -erschließung DR. THOMAS MATHEWS TEIL 5 Seite 1 von 19 INHALT INHALT... 2 1 ANWENDUNG VON ASMWIN AUF FALLBEISPIELE... 4 1.1 BERECHNUNGSGRUNDLAGEN... 4 1.2 AUFGABEN...
Vorlesung und Übung Grundwasserhydraulik Und -erschließung DR. THOMAS MATHEWS TEIL 5 Seite 1 von 19 INHALT INHALT... 2 1 ANWENDUNG VON ASMWIN AUF FALLBEISPIELE... 4 1.1 BERECHNUNGSGRUNDLAGEN... 4 1.2 AUFGABEN...
Strahlensätze anwenden. ähnliche Figuren erkennen und konstruieren. ähnliche Figuren mit Hilfe zentrischer Streckung konstruieren.
 MAT 09-01 Ähnlichkeit 14 Doppelstunden Leitidee: Raum und Form Thema im Buch: Zentrische Streckung (G), Ähnlichkeit (E) Strahlensätze anwenden. ähnliche Figuren erkennen und konstruieren. ähnliche Figuren
MAT 09-01 Ähnlichkeit 14 Doppelstunden Leitidee: Raum und Form Thema im Buch: Zentrische Streckung (G), Ähnlichkeit (E) Strahlensätze anwenden. ähnliche Figuren erkennen und konstruieren. ähnliche Figuren
Bewässerungstechnik im Freiland. - Druckverluste und Energieeinsparung - Jürgen Kleber, Institut für Gemüsebau
 Hessischer Gemüsebautag 2016 Bewässerungstechnik im Freiland - Druckverluste und Energieeinsparung - Jürgen Kleber Institut für Gemüsebau Planung von Bewässerungsanlagen Wichtige Fragen: 1. Wo muss bewässert
Hessischer Gemüsebautag 2016 Bewässerungstechnik im Freiland - Druckverluste und Energieeinsparung - Jürgen Kleber Institut für Gemüsebau Planung von Bewässerungsanlagen Wichtige Fragen: 1. Wo muss bewässert
Klausur 12/1 Physik LK Elsenbruch Di (4h) Thema: elektrische und magnetische Felder Hilfsmittel: Taschenrechner, Formelsammlung
 Klausur 12/1 Physik LK Elsenbruch Di 18.01.05 (4h) Thema: elektrische und magnetische Felder Hilfsmittel: Taschenrechner, Formelsammlung 1) Ein Kondensator besteht aus zwei horizontal angeordneten, quadratischen
Klausur 12/1 Physik LK Elsenbruch Di 18.01.05 (4h) Thema: elektrische und magnetische Felder Hilfsmittel: Taschenrechner, Formelsammlung 1) Ein Kondensator besteht aus zwei horizontal angeordneten, quadratischen
FSEC Free Stream Energy Converter Forschungsergebnisse & Weiterentwicklungspotentiale
 Projekt HYLOW - Hydropower converters for very low head differences FSEC Free Stream Energy Converter Forschungsergebnisse & Weiterentwicklungspotentiale Mathias Paschen, Christian Semlow & Thomas Miethe
Projekt HYLOW - Hydropower converters for very low head differences FSEC Free Stream Energy Converter Forschungsergebnisse & Weiterentwicklungspotentiale Mathias Paschen, Christian Semlow & Thomas Miethe
