Faseroptische Temperaturmessungen in Untergrundspeichern
|
|
|
- Hildegard Hermann
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Faseroptische Temperaturmessungen in Untergrundspeichern S.Großwig, E.Hurtig, K.Kühn, GESO GmbH, Löbstedter Straße 47 b, Jena F.Rudolph, Ruhrgas AG, Huttropstraße 60, Essen Die Temperaturverteilung in einem unterirdischen Gasspeicher und deren zeitliche Änderungen sind Schlüsselparameter, um die Betriebsbedingungen zu erfassen und zu überwachen. So hängt die Speicherkapazität (Gasvolumen und Einspeise-Ausspeiseraten) ganz wesentlich von der Temperatur ab. Dasselbe gilt für den Taupunkt, den Dampfdruck und chemische Reaktionen. Die Optimierung der Betriebsbedingungen wie z.b. auch des Methanol-Inhibitionsregimes erfordern genaue Kenntnisse über die Temperaturverteilung in Abhängigkeit von Tiefe und Zeit in Gasspeichersonden und im Innern von Kavernen. Bei bekanntem Kopfdruck kann über die gemessene Temperatur-Tiefenverteilung das Druckprofil berechnet werden. Der Joule-Thomson-Effekt bildet die physikalische Grundlage für die Kontrolle und Überwachung des Rohrstranges und technischer Einbauten. Er definiert die Beziehungen zwischen Druckänderungen und Temperaturänderungen. Unregelmäßigkeiten im Druckverlauf und insbesondere ein leckagebedingter lokaler Druckabfall führen zu Temperaturänderungen und lassen sich durch Temperaturmessungen einfach detektieren und lokalisieren. Aus Temperaturmessungen, die zeitgleich über die gesamte Strecke einer Bohrung unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen im Steigrohr oder im Ringraum durchgeführt werden, lassen sich detaillierte Aussagen über die Lage und Größe einer Leckage im Rohrstrang (z.b. an Korrosionsstellen, Verschraubungen, Dichtungseinheiten oder Schiebestücken) oder in der Verrohrung ableiten. Auch Hinterrohreffekte (z.b. Gasfluss hinter der Verrohrung) beeinflussen das Temperaturfeld in dem Rohrstrang. An einem Flüssigkeitsspiegel treten Temperaturänderungen auf, die durch eine kurzzeitige Druckentlastung verstärkt werden können, so dass die Lage eines Flüssigkeitsspiegel in Bohrungen oder in einer Kaverne bestimmt und überwacht werden kann. Die Erfassung und Überwachung der Temperaturverteilung geben daher dem Betreiber eines unterirdischen Speichers wichtige Informationen. Allerdings ist es erforderlich, dass die Messungen zeitgleich über die gesamte Messstrecke bei hoher Temperatur- und Ortsauflösung und einem dichten Zeitraster (z.b. 1 min) erfolgen können, um schnell ablaufende Prozesse zu erfassen und zu lokalisieren. Die konventionellen Bohrlochtemperaturmessungen können diese Anforderungen nicht erfüllen. Das Verfahren der faseroptischen Temperaturmessung eröffnet hier ganz neue Möglichkeiten, da es die zeitgleiche Temperaturmessung über lange Strecken mit der geforderten Ortsund Temperaturauflösung auch in kurzer Messabfolge ermöglicht. Dieses Verfahren bietet sich daher für Untersuchungen in unterirdischen Gasspeichern (Kavernen und Produktionssonden von Aquiferspeichern) an. Seit fast 10 Jahren liegen Erfahrungen mit faseroptischen Messungen in Kavernen und Aquiferspeichern vor. Erste Messungen erfolgten 1992 in der Bohrung Mwd 5 des Kavernenfeldes Mittenwalde [Hurtig u.a.,1993] und 1993 in der Bohrung B41 des Aquiferspeichers Buchholz [Brumlich und Hurtig, 1995; Hurtig u.a., 1994; Großwig, u.a., 1998]. MESSMETHODIK Das verteilte faseroptische Laserradar-Temperaturmessverfahren (DTS: Distributed Fibre Optic Temperature Sensing) nutzt die Temperaturabhängigkeit bestimmter optischer Eigenschaften von Lichtwellenleitern zur Messung der Temperatur entlang eines Lichtwellenleiters [Großwig u.a.,2001]. Dazu werden kurze Laserlichtimpulse in den Lichtwellenleiter eines Sensorkabels eingekoppelt. Bei der Ausbreitung des Laserlichtimpulses wird das Licht an den Molekülen des Lichtwellenleiters gestreut. Die Intensität des Ramanrückstreulichtes zeigt eine
2 2 deutliche Temperaturabhängigkeit. Das Messprinzip der faseroptischen Temperaturmessung besteht darin, die beiden Komponenten des Ramanrückstreulichtes, die Stokes- und die Anti- Stokes-Linie, aus dem Rückstreuspektrum auszufiltern. Durch Bildung des Quotienten der jeweiligen Intensitäten (I a /I s T) kann in eindeutiger Weise die Temperatur des Lichtwellenleiterabschnitts, in dem das Licht zurückgestreut wurde, berechnet werden. Der Lichtwellenleiter wird dadurch selbst zum sensitiven Element. Da die Lichtgeschwindigkeit in der optischen Faser bekannt ist, kann aus der Laufzeit des rückgestreuten Ramanlichtes die zugehörige Ortskoordinate ermittelt werden. Damit wird es möglich, Temperatur und Ortszuordnung entlang einer optischen Faser zeitgleich zu messen. Mit der DTS-Technik kann die Temperatur über Strecken von mehreren Kilometern Länge mit einer genauen Ortszuordnung der Messwerte über lange Zeiträume bestimmt werden. Entlang des Messkabels gibt es keine elektrischen Bauelemente oder Baugruppen. Das System ist völlig unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Feldern und kann auch bei extremen Anforderungen an den Explosionsschutz eingesetzt werden. Für die Messungen wird ein faseroptisches Temperatursensorkabel entweder permanent im Ringraum oder für temporäre Messungen im Rohrstrang installiert. Temperaturveränderungen im Ringraum oder im Hinterrohrbereich (z.b. auch im Bereich der Zementation) beeinflussen auch die Temperatur innerhalb des Steigrohrstranges und können dort detektiert und lokalisiert werden. Einspeisung oder Ausspeisung von Gas sowie eine Ringraumentlastung können genutzt werden, um das Temperaturfeld zu verändern und Temperatureffekte durch Druckänderungen im Steigrohrstrang oder im Ringraum zu stimulieren. Für die Messungen in Innern von Sonden muss das faseroptische Temperatursensorkabel sehr hohen mechanischen Anforderungen entsprechen. In das Messkabel kann ein CCL-Tool zur genauen Teufenmarkierung integriert werden. Abb. 1 zeigt eine typische Situation für den Einbau eines faseroptischen Sensorkabels in einer Kaverne bzw. in einem Aquiferspeicher. ERGEBNISSE Dichtigkeitskontrolle der Bohrlochkomplettierung Die physikalische Grundlage für eine Dichtigkeitskontrolle durch Temperaturmessungen ist der Joule-Thomson Effekt, der den Zusammenhang zwischen Druckentlastung und Temperaturabnahme angibt. Für Methan ist der Temperatureffekt ca. 0,5 K pro bar Druckentlastung, für Erdgas der H-Gasfamilie ca. 0,4 K pro bar. Eine lokale Druckentlastung und damit eine Temperaturabnahme kann an Defekten der Bohrlochkomplettierung auftreten. Schematisch sind die Bedingungen in Abb. 2 dargestellt. Zur Detektion und Lokalisierung von Undichtigkeiten wird ein faseroptisches Temperatursensorkabel im Innern des Steigrohres installiert. Bei einem Leck im Förderrohr strömt Gas in den Ringraum und erhöht den Ringraumdruck. Bei einem Leck in der Verrohrung (Casing) kann Gas auch in die Zementation bzw. in das umgebende Gebirge überströmen. Ein Druckaufbau im Ringraum ist daher ein typisches Anzeichen für eine Leckage in dem Steigrohr oder im Bereich von technischen Einbauten. Wenn der Ringraum entlastet wird, beginnt das Gas aus dem Steigrohr in den Ringraum überzutreten. Dabei erfolgt eine lokale Druckentlastung, so dass die Temperatur im Bereich der Leckage absinkt. Abb. 3 zeigt die Ergebnisse von faseroptischen Temperaturmessungen in der Fördersonde einer Gaskaverne in Norddeutschland. Zur Verdeutlichung der Effekte ist die Temperaturdifferenz zwischen dem mittleren geothermischen Gradienten und den Messwerten dargestellt. Deutlich ist die Temperaturabsenkung um über 6 K an der Leckagestelle zu erkennen. Abb. 4 zeigt die Temperaturkurven für einen kurzen Abschnitt der Kaverne S10 des Ruhrgas- Untertagespeichers Epe. Die Details der Bohrlochkomplettierung sind auf der linken Seite dargestellt. Die Temperaturkurve bei t = t 0 zeigt den Ausgangszustand und spiegelt in diesem Abschnitt den geothermischen Gradienten wider. Die Ringraumentlastung begann bei t = t 0. Die Temperatur
3 3 nimmt im Bereich der Undichtigkeit in Abhängigkeit von der Ringraumentlastung mit der Zeit ab. Die maximale Temperaturabsenkung beträgt ca. 3,5 K (von 42,5 bis 39,0 C). Das Temperaturminimum ist deutlich ausgeprägt und kann exakt einem Punkt der Bohrlochkomplettierung zugeordnet werden. Abb. 1: Installation eines faseroptischen Temperatursensorkabels in einem Bohrloch eines untertägigen Gasspeichers (links: Kavernenspeicher; rechts: Aquiferspeicher) Abb. 2: Temperatureffekt auf Grund einer Leckage im Förderrohr oder in der Verrohrung Bohrlochbild Temperatur [ C] t = to + 63 min t = to + 87 min Polish Bore Receptacle (Fa. Brown) 945 t = to min t = to min t = to 950 Verhindert Bewegung nach oben) 8 5/8" x 11 3/4" Boll Weevil Packer 955 t = to min Abb. 3: Leckage-Detektion durch faseroptische Temperaturmessungen Abb.4: Bohrlochkomplettierung und Temperatur-verteilung in der Kavernenbohrung Epe S10 Abb. 5a und b zeigen die Temperaturänderungen in Abhängigkeit von Zeit und Teufe während der Ein- und Ausspeisung von Erdgas in der Kaverne Epe S 10. Die Ein- und die Aus-
4 4 speisung von Gas begannen jeweils bei t = t 0. Entsprechend der Temperatur des Einspeisegases fällt bei der Gaseinspeisung die Temperatur im Steigrohr schnell ab (Abb. 5a). Ein quasistationärer Zustand wird erst nach über 4 Stunden erreicht. Ganz deutlich markiert sich die Oberkante der Kaverne, in der nur sehr geringfügige Temperaturänderungen auftreten. Abb. 5a: Veränderung der Temperatur in Abhängigkeit von Zeit und Teufe während der Injektion von Gas Abb. 5b: Veränderung der Temperatur in Abhängigkeit von Zeit und Teufe während der Gasausspeisung Bei der Gasausspeisung (Abb. 5b) steigt die Temperatur deutlich an, die Oberkante der Kaverne bildet sich nur schwach ab. Bestimmung der Gebirgstemperatur Der Betrieb eines Aquiferspeichers beeinflusst langfristig die Gebirgstemperatur sowohl im Bereich der Speicherhorizonte als auch des Deckgebirges. Die aktuelle Gebirgstemperatur im Umfeld einer Bohrung kann mit Hilfe des HORNER-Verfahrens bestimmt werden. Hierfür ist es notwendig, dass Gas über eine bestimmte bekannte Zeit ausgespeist und damit die Temperatur im Umfeld der Bohrung deutlich gestört wird. Nach Beendigung der Ausspeisung müssen die Temperaturmessungen sofort beginnen und sich dann in größeren zeitlichen Abständen über einen längeren Zeitraum fortsetzen bis die Gleichgewichtstemperatur extrapoliert werden kann. Auf dieser Grundlage kann dann die aktuelle Gebirgstemperatur ermittelt werden. Abb. 6 verdeutlicht die Veränderung der Gebirgstemperatur im Umfeld der Bohrung B 41 des Erdgasspeichers Buchholz im Laufe von 17 Jahren. Reservoirdynamische Prozesse Temperaturmessungen können wichtige Informationen über die Raum-Zeit-Verteilung des Gases und über die ablaufenden dynamischen Prozesse in Aquiferspeichern geben. Hierzu gehören z.b. Aussagen über die Hauptzuflussbereiche innerhalb eines Speicherhorizontes und über Zustrombereiche in Sonden, die schichtparallel verlaufen (Schräg- oder Horizontalbohrungen). Wenn Filterbereiche durch Salzausfällung verstopft sind, können konventionelle Flowmetermessungen zu
5 5 falschen Ergebnissen führen. Auch in diesen Fällen kann mit Hilfe der faseroptischen Temperaturmessungen eine Klärung erfolgen. Temperaturmessungen in einer oder in mehreren Bohrungen um eine Einspeisesonde ermöglichen die Bestimmung der räumlichen Verteilung der Temperatur im Speicherhorizont und damit die Bestimmung dynamischer Vorgänge im Speicher. Abb. 7 zeigt die Ergebnisse in einer Bohrung des Untergrundspeichers Ketzin während der Gaseinspeisung in eine Nachbarsonde in einer Entfernung von ca. 500 m. Die drei Kurven stellen die Temperatur in unterschiedlichen Tiefen des Speicherhorizontes dar. Bereits 2 Stunden nach Beginn der Gaseinspeisung gibt es einen nachweisbaren Temperaturanstieg. In Abhängigkeit von der Messteufe im Speicherhorizont erreicht der Temperaturanstieg nach 6 Stunden Werte bis 1 K. Abb.6: Veränderung der Gebirgstemperatur im Zeitraum von 17 Jahren, Bohrung B 41 Speicher Buchholz Abb. 7: Änderung der Temperatur in unterschiedlichen Tiefen des Speicherhorizontes bei Gaseinspeisung in einer Nachbarbohrung Bestimmung des Flüssigkeitsspiegels In Aquiferspeichern ändert sich die Lage des Flüssigkeitsspiegels in Abhängigkeit von der Gaseinspeisung oder Gasausspeisung. Am deutlichsten ist dieser Effekt in Sonden im Bereich des Strukturrandes. Mit Hilfe von faseroptischen Temperaturmessungen ist eine eindeutige Erfassung des Flüssigkeitsspiegels möglich ist. Der Effekt lässt sich stimulieren, wenn eine Druckentlastung der Gassäule erfolgt. In gleicher Weise kann bei einer Ringraumentlastung der Spiegel der Ringraumflüssigkeit bestimmt werden. Abb. 8 zeigt die Ergebnisse von Messungen in der Sonde Epe S 10. Überwachung von Injektionsmaßnahmen zur Stimulation von Gas- bzw. Ölzuflüssen Die Injektion von Flüssigkeiten oder Dampf im Rahmen von Stimulationsmaßnahmen verursacht Temperaturänderungen. Temperaturveränderungen in Beobachtungssonden, die um eine Injektionssonde angeordnet sind, können erfasst; der Injektionsprozess kann daher ü- berwacht werden (s. auch Abb. 7). Damit ist es möglich, auch den Durchbruch einer thermischen Front oder hydraulische Verbindungen zwischen der Injektionssonde und Beobachtungssonden zu detektieren und teufenmäßig exakt zu lokalisieren.
6 6 Abb. 8: Bestimmung des Spiegels der Ringraumschutzflüssigkeit, Bohrung Epe S 10 ZUSAMMENFASSUNG Faseroptische Temperaturmessungen ermöglichen eine zeitgleiche Bestimmung der Temperatur mit hoher Orts- und Temperaturauflösung für das Gesamtprofil einer Bohrung oder einer Kaverne und eröffnen damit neue Möglichkeiten für die Betriebsführung und die Betriebsüberwachung von Untertagespeichern. Undichtigkeiten in der Bohrlochkomplettierung und Hinterrohrströmungen können detektiert und teufenmäßig exakt lokalisiert werden. Prozessabläufe und Hauptgaswegsamkeiten in einem Porenspeicher lassen sich erfassen und überwachen. In Kavernen kann das faseroptische Temperatursensorkabel bis in den Sumpf am Boden der Kaverne eingehängt werden, so dass eine zeitlich variable Temperaturschichtung in der Kaverne und Prozesse bei der Ein- oder Ausspeisung erfasst werden können. Die Langzeitänderung der Gebirgstemperatur im Deckgebirge von Untertagespeichern wird unter Nutzung des HORNER- Verfahrens bestimmt. Auch der Nachweis einer Wasserzirkulation im Deckgebirge, die letztlich zu einer Schädigung der Zementation führen kann, ist möglich. Es wurde weiterhin der Nachweis geführt, dass die Lage des Flüssigkeitsspiegel in Sonden und der Schutzflüssigkeit im Ringraum eindeutig bestimmt werden kann. Die Erfahrungen zeigen, dass faseroptische Temperaturmessungen ohne Umbauten oder technische Veränderungen am Bohrkopf bzw. im Steigrohrstrang und ohne lange Unterbrechungen des Speicherbetriebes möglich sind. Mit dem in einer Bohrung eingebauten Messkabel lassen sich ohne besonderen Aufwand Langzeitmessungen durchführen, ohne dass der Ein- und Ausspeisebetrieb nachhaltig eingeengt wird. Das faseroptische Temperaturmessverfahren ist damit ein kostengünstiges Diagnoseverfahren und für den Betrieb und die Überwachung von Untertagespeichern von großem Wert. LITERATUR Hurtig, E.; Schrötter, J.; Großwig, S.; Kühn, K.; Harjes, B.; Wieferig, W.; Orrell, R.P.: Borehole temperature measurements using distributed fibre optic sensing; Scientific Drilling 3, 1993, S Brumlich, H.; Hurtig, E.: Faseroptische Temperaturmessungen - High Tech im VNG- Untergrundspeicher Buchholz; Das GAS-Medium, Verbundnetz Gas AG, Heft 4, 1995, S Hurtig, E.; Brumlich, H.; Großwig, S.; Kühn, K.: Faseroptische Temperaturmessungen zur Überwachung der Prozesse in einer geothermischen Lagerstätte, dargestellt am Beispiel eines Aquiferuntergrundspeichers, 3. Geothermische Fachtagung, Schwerin 1994, S Großwig, S.; Hurtig, E.; Kasch, M.; Kühn, K.: Die ortsaufgelöste Temperaturmesstechnik- Leistungsfähigkeit und Anwendungsmöglichkeiten im Umwelt- und Geobereich anhand ausgewählter Beispiele, Temperatur 98, Verein Deutscher Ingenieure - VDI - Berichte Nr. 1379, VDI Verlag Düsseldorf 1998, S
7 7 Großwig, S.; Hurtig, E.; Kühn, K. und Rudlph, F.: Faseroptische Temperaturmessungen in unterirdischen Gasspeichern; Erdöl, Erdgas, Kohle 117, 2001, S
Flüssigkeitsspiegelbestimmung mit faseroptischen Temperaturmessungen
 Flüssigkeitsspiegelbestimmung mit faseroptischen Temperaturmessungen Eckart Hurtig, Andrea Graupner, Stephan Großwig, Kurt Nawrotzki, Bernhard Vogel, Geso Jena/Germany 7. Workshop Bohrlochgeophysik und
Flüssigkeitsspiegelbestimmung mit faseroptischen Temperaturmessungen Eckart Hurtig, Andrea Graupner, Stephan Großwig, Kurt Nawrotzki, Bernhard Vogel, Geso Jena/Germany 7. Workshop Bohrlochgeophysik und
Licht ins Dunkel Ein Blick in die Tiefe -
 GESO DIN EN ISO 9001:2000/SCC** Zertifikate Nr. 15 100 42209 Zertifikate Nr. 15 106 4030 Ein Blick in die Tiefe - faseroptische Temperaturmessung zur Überwachung mitteltiefer und tiefer Geothermieanlagen
GESO DIN EN ISO 9001:2000/SCC** Zertifikate Nr. 15 100 42209 Zertifikate Nr. 15 106 4030 Ein Blick in die Tiefe - faseroptische Temperaturmessung zur Überwachung mitteltiefer und tiefer Geothermieanlagen
Langzeitmonitoring von geotechnischen Bauwerken Temperaturentwicklung in Tagebaukippen und Aschedepots
 Langzeitmonitoring von geotechnischen Bauwerken Temperaturentwicklung in Tagebaukippen und Aschedepots Long-Term Monitoring of Geotechnical Constructions Temperature Monitoring in Dumps and Ash Depots
Langzeitmonitoring von geotechnischen Bauwerken Temperaturentwicklung in Tagebaukippen und Aschedepots Long-Term Monitoring of Geotechnical Constructions Temperature Monitoring in Dumps and Ash Depots
Bohrungsintegrität: Voraussetzung für erfolgreiches und sicheres Fracking
 Bohrungsintegrität: Voraussetzung für erfolgreiches und sicheres Fracking Kurt M. Reinicke 1 FLUIDBERGBAU 0 Kavernen Bohrung Gas Bohrung Öl Bohrung Mehrfach gefrackte Schiefergas Bohrung Gefrackte Tight
Bohrungsintegrität: Voraussetzung für erfolgreiches und sicheres Fracking Kurt M. Reinicke 1 FLUIDBERGBAU 0 Kavernen Bohrung Gas Bohrung Öl Bohrung Mehrfach gefrackte Schiefergas Bohrung Gefrackte Tight
Annährungssensoren. Induktive Sensoren. Kapazitive Sensoren. Ultraschall-Sensoren. Optische Anährungssensoren
 Annährungssensoren Zum Feststellen der Existenz eines Objektes innerhalb eines bestimmten Abstands. In der Robotik werden sie für die Nah-Gebiets-Arbeit, Objekt-Greifen oder Kollisionsvermeidung verwendet.
Annährungssensoren Zum Feststellen der Existenz eines Objektes innerhalb eines bestimmten Abstands. In der Robotik werden sie für die Nah-Gebiets-Arbeit, Objekt-Greifen oder Kollisionsvermeidung verwendet.
Funktionsansprüche an die Hinterfüllung einer Erdwärmesonde
 Vorstellung aktueller Messmethoden bei der Überprüfung der Zementationsgüte von Erdwärmesonden Qualitätsansprüche an eine EWS Messtechnik Temperaturprofile Kurz TRT in Kombination mit Temperaturprofilen
Vorstellung aktueller Messmethoden bei der Überprüfung der Zementationsgüte von Erdwärmesonden Qualitätsansprüche an eine EWS Messtechnik Temperaturprofile Kurz TRT in Kombination mit Temperaturprofilen
Physikalisches Grundpraktikum Taupunktmessung. Taupunktmessung
 Aufgabenstellung: 1. Bestimmen Sie den Taupunkt. Berechnen Sie daraus die absolute und relative Luftfeuchtigkeit. 2. Schätzen Sie die Messunsicherheit ab! Stichworte zur Vorbereitung: Temperaturmessung,
Aufgabenstellung: 1. Bestimmen Sie den Taupunkt. Berechnen Sie daraus die absolute und relative Luftfeuchtigkeit. 2. Schätzen Sie die Messunsicherheit ab! Stichworte zur Vorbereitung: Temperaturmessung,
Kapitel 11 Temperaturberechnungen in Bohrungen und Pipelines
 Kapitel Temperaturberechnungen in Bohrungen und Pipelines Die Temperatur des Erdreichs wird bis zu einer Teufe von 0 m bis 5 m von der Sonne beeinflusst, wie es Abb.. zeigt. So kommt es, dass es in einer
Kapitel Temperaturberechnungen in Bohrungen und Pipelines Die Temperatur des Erdreichs wird bis zu einer Teufe von 0 m bis 5 m von der Sonne beeinflusst, wie es Abb.. zeigt. So kommt es, dass es in einer
Dampfdruck von Flüssigkeiten (Clausius-Clapeyron' sche Gleichung)
 Versuch Nr. 57 Dampfdruck von Flüssigkeiten (Clausius-Clapeyron' sche Gleichung) Stichworte: Dampf, Dampfdruck von Flüssigkeiten, dynamisches Gleichgewicht, gesättigter Dampf, Verdampfungsenthalpie, Dampfdruckkurve,
Versuch Nr. 57 Dampfdruck von Flüssigkeiten (Clausius-Clapeyron' sche Gleichung) Stichworte: Dampf, Dampfdruck von Flüssigkeiten, dynamisches Gleichgewicht, gesättigter Dampf, Verdampfungsenthalpie, Dampfdruckkurve,
ERFA Betriebs- und Überwachungsoptimierung von Solarwärmeanlagen Warum ein Monitoring-Konzept
 ERFA Betriebs- und Überwachungsoptimierung von Solarwärmeanlagen Warum ein Monitoring-Konzept Jürg Marti/5.12.2014 Themen Einführung Was heisst Monitoring Typische Anlagenprobleme Anforderungen an ein
ERFA Betriebs- und Überwachungsoptimierung von Solarwärmeanlagen Warum ein Monitoring-Konzept Jürg Marti/5.12.2014 Themen Einführung Was heisst Monitoring Typische Anlagenprobleme Anforderungen an ein
Ist eine langfristige g und sichere Speicherung von CO 2 möglich?
 Chancen und Risiken der CO 2-Speicherung Erfahrungen vom Pilotprojekt Ketzin PD Dr. Michael Kühn Leiter des Zentrums für CO 2 -Speicherung Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum Brunnen
Chancen und Risiken der CO 2-Speicherung Erfahrungen vom Pilotprojekt Ketzin PD Dr. Michael Kühn Leiter des Zentrums für CO 2 -Speicherung Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum Brunnen
1. Bestimmen Sie die Phasengeschwindigkeit von Ultraschallwellen in Wasser durch Messung der Wellenlänge und Frequenz stehender Wellen.
 Universität Potsdam Institut für Physik und Astronomie Grundpraktikum 10/015 M Schallwellen Am Beispiel von Ultraschallwellen in Wasser werden Eigenschaften von Longitudinalwellen betrachtet. Im ersten
Universität Potsdam Institut für Physik und Astronomie Grundpraktikum 10/015 M Schallwellen Am Beispiel von Ultraschallwellen in Wasser werden Eigenschaften von Longitudinalwellen betrachtet. Im ersten
Temperaturmessungen mit Widerstandsthermometern. Allgemeine Informationen
 Temperaturmessungen mit Widerstandsthermometern Allgemeine Informationen Temperaturmessungen mit Widerstandsthermometern Das Messprinzip der Temperaturmessung mit Widerstandsthermometern beruht auf der
Temperaturmessungen mit Widerstandsthermometern Allgemeine Informationen Temperaturmessungen mit Widerstandsthermometern Das Messprinzip der Temperaturmessung mit Widerstandsthermometern beruht auf der
Grundlagen der Modellierung von Wärmetransport im Grundwasser. `ÉåíÉê=Ñçê=dêçìåÇï~íÉê=jçÇÉäáåÖ=áå=íÜÉ=aef=dêçìé
 Grundlagen der Modellierung von Wärmetransport im Grundwasser `ÉåíÉê=Ñçê=dêçìåÇï~íÉê=jçÇÉäáåÖ=áå=íÜÉ=aef=dêçìé Geothermische Energie Geothermische Energie gewinnt zunehmend an Bedeutung. Sei es im Bereich
Grundlagen der Modellierung von Wärmetransport im Grundwasser `ÉåíÉê=Ñçê=dêçìåÇï~íÉê=jçÇÉäáåÖ=áå=íÜÉ=aef=dêçìé Geothermische Energie Geothermische Energie gewinnt zunehmend an Bedeutung. Sei es im Bereich
Geophysikalische Messverfahren zur Zustandsbewertung von Verrohrungen
 Referent: Dipl. Geophys. Alexander Ringelhan Coautoren: VNG Gasspeicher GmbH W/T Geoingenieure BLM GmbH - Überblick: BLM GmbH - Überblick: Zertifiziertes Unternehmen nach ISO 9001:2008 und SCC*: 2011 BLM
Referent: Dipl. Geophys. Alexander Ringelhan Coautoren: VNG Gasspeicher GmbH W/T Geoingenieure BLM GmbH - Überblick: BLM GmbH - Überblick: Zertifiziertes Unternehmen nach ISO 9001:2008 und SCC*: 2011 BLM
Basiskenntnistest - Physik
 Basiskenntnistest - Physik 1.) Welche der folgenden Einheiten ist keine Basiseinheit des Internationalen Einheitensystems? a. ) Kilogramm b. ) Sekunde c. ) Kelvin d. ) Volt e. ) Candela 2.) Die Schallgeschwindigkeit
Basiskenntnistest - Physik 1.) Welche der folgenden Einheiten ist keine Basiseinheit des Internationalen Einheitensystems? a. ) Kilogramm b. ) Sekunde c. ) Kelvin d. ) Volt e. ) Candela 2.) Die Schallgeschwindigkeit
D i p l o m a r b e i t
 D i p l o m a r b e i t Auswirkung von Tiefbauwerken auf die Grundwassertemperatur in Dresden Inhalt 1 Einleitung 2 Methodik 3 Auswertung 4 Zusammenfassung/ Schlussfolgerungen Von Linda Wübken Betreuer:
D i p l o m a r b e i t Auswirkung von Tiefbauwerken auf die Grundwassertemperatur in Dresden Inhalt 1 Einleitung 2 Methodik 3 Auswertung 4 Zusammenfassung/ Schlussfolgerungen Von Linda Wübken Betreuer:
Inhalt. 1. Erläuterungen zum Versuch 1.1. Aufgabenstellung und physikalischer Hintergrund 1.2. Messmethode und Schaltbild 1.3. Versuchdurchführung
 Versuch Nr. 02: Bestimmung eines Ohmschen Widerstandes nach der Substitutionsmethode Versuchsdurchführung: Donnerstag, 28. Mai 2009 von Sven Köppel / Harald Meixner Protokollant: Harald Meixner Tutor:
Versuch Nr. 02: Bestimmung eines Ohmschen Widerstandes nach der Substitutionsmethode Versuchsdurchführung: Donnerstag, 28. Mai 2009 von Sven Köppel / Harald Meixner Protokollant: Harald Meixner Tutor:
Kühlt der Kühlschrank schlechter, wenn die Sonne auf die Lüftungsgitter scheint?
 Kühlt der Kühlschrank schlechter, wenn die Sonne auf die Lüftungsgitter scheint? Diese Untersuchung wurde an einem Kühlschrank durchgeführt, an dem ein Lüfter zur Verbesserung der Kühlwirkung eingebaut
Kühlt der Kühlschrank schlechter, wenn die Sonne auf die Lüftungsgitter scheint? Diese Untersuchung wurde an einem Kühlschrank durchgeführt, an dem ein Lüfter zur Verbesserung der Kühlwirkung eingebaut
Drücke Messen direkt in der Busklemme
 Keywords Differenzdruck Absolutdruck Staudruck Druckmessung KM3701 KM3702 KM3712 Drücke Messen direkt in der Busklemme Diese Application Example stellt die Busklemmen von Beckhoff vor, mit denen der Druck
Keywords Differenzdruck Absolutdruck Staudruck Druckmessung KM3701 KM3702 KM3712 Drücke Messen direkt in der Busklemme Diese Application Example stellt die Busklemmen von Beckhoff vor, mit denen der Druck
Zentralabitur 2011 Physik Schülermaterial Aufgabe I ga Bearbeitungszeit: 220 min
 Thema: Eigenschaften von Licht Gegenstand der Aufgabe 1 ist die Untersuchung von Licht nach Durchlaufen von Luft bzw. Wasser mit Hilfe eines optischen Gitters. Während in der Aufgabe 2 der äußere lichtelektrische
Thema: Eigenschaften von Licht Gegenstand der Aufgabe 1 ist die Untersuchung von Licht nach Durchlaufen von Luft bzw. Wasser mit Hilfe eines optischen Gitters. Während in der Aufgabe 2 der äußere lichtelektrische
Umgang mit Diagrammen Was kann ich?
 Umgang mit Diagrammen Was kann ich? Aufgabe 1 (Quelle: DVA Ph 2008 14) Tom führt folgendes Experiment aus: Er notiert in einer Tabelle die Spannstrecken x, um die er das Auto rückwärts schiebt, und notiert
Umgang mit Diagrammen Was kann ich? Aufgabe 1 (Quelle: DVA Ph 2008 14) Tom führt folgendes Experiment aus: Er notiert in einer Tabelle die Spannstrecken x, um die er das Auto rückwärts schiebt, und notiert
Die Temperatur als wichtiges Klimaelement
 Die Temperatur als wichtiges Klimaelement Ein paar physikalische Anmerkungen... Die Temperatur ist in der Statistischen Mechanik ein Maß für die mittlere kinetische Energie eines Ensembles sehr vieler
Die Temperatur als wichtiges Klimaelement Ein paar physikalische Anmerkungen... Die Temperatur ist in der Statistischen Mechanik ein Maß für die mittlere kinetische Energie eines Ensembles sehr vieler
Praktikum I PE Peltier-Effekt
 Praktikum I PE Peltier-Effekt Florian Jessen, Hanno Rein, Benjamin Mück Betreuerin: Federica Moschini 27. November 2003 1 Ziel der Versuchsreihe Der Peltier Effekt und seine Umkehrung (Seebeck Effekt)
Praktikum I PE Peltier-Effekt Florian Jessen, Hanno Rein, Benjamin Mück Betreuerin: Federica Moschini 27. November 2003 1 Ziel der Versuchsreihe Der Peltier Effekt und seine Umkehrung (Seebeck Effekt)
Versuch 41: Viskosität durchgeführt am
 Physikalisch-chemisches Grundpraktikum Gruppe 6 Philipp von den Hoff Andreas J. Wagner Versuch 4: Viskosität durchgeführt am 26.05.2004 Zielsetzung: Ziel des Versuches ist es, die Viskosität von n-butan-2-ol
Physikalisch-chemisches Grundpraktikum Gruppe 6 Philipp von den Hoff Andreas J. Wagner Versuch 4: Viskosität durchgeführt am 26.05.2004 Zielsetzung: Ziel des Versuches ist es, die Viskosität von n-butan-2-ol
TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg
 TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg PROTOKOLL SEKUNDARSTUFE II Modul: Versuch: Elektrochemie 1 Abbildung 1:
TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg PROTOKOLL SEKUNDARSTUFE II Modul: Versuch: Elektrochemie 1 Abbildung 1:
UGS sicherer Betrieb und effiziente Technologien. Alternative Komplettierungs- und Reparaturtechnologien für Gasspeicherkavernen.
 Alternative Komplettierungs- und Reparaturtechnologien für Gasspeicherkavernen Andreas Brecht Folie 10 Gliederung A) Ausgangssituation B) Konventionelle Reparaturmöglichkeiten C) Alternatives Reparaturkonzept
Alternative Komplettierungs- und Reparaturtechnologien für Gasspeicherkavernen Andreas Brecht Folie 10 Gliederung A) Ausgangssituation B) Konventionelle Reparaturmöglichkeiten C) Alternatives Reparaturkonzept
ENERGIE AUS DER TIEFE Untertagespeicher Betrieb und Engineering
 ENERGIE AUS DER TIEFE Untertagespeicher Betrieb und Engineering ESK GmbH, 29.10.2013 Unternehmensprofil 100 %ige Tochtergesellschaft der RWE Netzservice GmbH Die Ingenieure, Geowissenschaftler Geologen
ENERGIE AUS DER TIEFE Untertagespeicher Betrieb und Engineering ESK GmbH, 29.10.2013 Unternehmensprofil 100 %ige Tochtergesellschaft der RWE Netzservice GmbH Die Ingenieure, Geowissenschaftler Geologen
Kavernenspeicher Empelde Runder Tisch
 Anlage 1 Kavernenspeicher Empelde Runder Tisch Stadt Ronnenberg, 27.01.2016 Ulrich Windhaus Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie Clausthal-Zellerfeld Agenda: Vorstellung LBEG Untertagespeicherung
Anlage 1 Kavernenspeicher Empelde Runder Tisch Stadt Ronnenberg, 27.01.2016 Ulrich Windhaus Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie Clausthal-Zellerfeld Agenda: Vorstellung LBEG Untertagespeicherung
Physikalische Chemie Physikalische Chemie I SoSe 2009 Prof. Dr. Norbert Hampp 1/9 1. Das Ideale Gas. Thermodynamik
 Prof. Dr. Norbert Hampp 1/9 1. Das Ideale Gas Thermodynamik Teilgebiet der klassischen Physik. Wir betrachten statistisch viele Teilchen. Informationen über einzelne Teilchen werden nicht gewonnen bzw.
Prof. Dr. Norbert Hampp 1/9 1. Das Ideale Gas Thermodynamik Teilgebiet der klassischen Physik. Wir betrachten statistisch viele Teilchen. Informationen über einzelne Teilchen werden nicht gewonnen bzw.
4 Thermodynamik mikroskopisch: kinetische Gastheorie makroskopisch: System:
 Theorie der Wärme kann auf zwei verschiedene Arten behandelt werden. mikroskopisch: Bewegung von Gasatomen oder -molekülen. Vielzahl von Teilchen ( 10 23 ) im Allgemeinen nicht vollständig beschreibbar
Theorie der Wärme kann auf zwei verschiedene Arten behandelt werden. mikroskopisch: Bewegung von Gasatomen oder -molekülen. Vielzahl von Teilchen ( 10 23 ) im Allgemeinen nicht vollständig beschreibbar
Neuartiges optisches Messverfahren für Schall. Applikationsbeispiel: Ermüdungsprüfung
 21. Kolloquium Schallemission Vortrag 10 More info about this article: http://www.ndt.net/?id=21576 Neuartiges optisches Messverfahren für Schall. Applikationsbeispiel: Ermüdungsprüfung Kurzfassung Thomas
21. Kolloquium Schallemission Vortrag 10 More info about this article: http://www.ndt.net/?id=21576 Neuartiges optisches Messverfahren für Schall. Applikationsbeispiel: Ermüdungsprüfung Kurzfassung Thomas
Aufgaben zur Elektrizitätslehre
 Aufgaben zur Elektrizitätslehre Elektrischer Strom, elektrische Ladung 1. In einem Metalldraht bei Zimmertemperatur übernehmen folgende Ladungsträger den Stromtransport (A) nur negative Ionen (B) negative
Aufgaben zur Elektrizitätslehre Elektrischer Strom, elektrische Ladung 1. In einem Metalldraht bei Zimmertemperatur übernehmen folgende Ladungsträger den Stromtransport (A) nur negative Ionen (B) negative
APPLICATION NOTE. Einfache Handhabung bis hin zur leistungsfähigen Auswertung: TG-FT-IR-Messung an Diclofenac-Natrium. Claire Strasser.
 APPLICATION NOTE Einfache Handhabung bis hin zur leistungsfähigen Auswertung: TG-FT-IR-Messung an Claire Strasser Messergebnisse 1 Chemische Formel von [1] Einleitung Diclofenac ist ein entzündungshemmendes
APPLICATION NOTE Einfache Handhabung bis hin zur leistungsfähigen Auswertung: TG-FT-IR-Messung an Claire Strasser Messergebnisse 1 Chemische Formel von [1] Einleitung Diclofenac ist ein entzündungshemmendes
Deponien und Isotope WASSER GEOTHERMIE MARKIERVERSUCHE SCHADSTOFFE FILTERTECHNIK LEBENSMITTEL NACHWACHSENDE ROHSTOFFE ISOTOPE
 Deponien und Isotope WASSER GEOTHERMIE MARKIERVERSUCHE SCHADSTOFFE FILTERTECHNIK LEBENSMITTEL NACHWACHSENDE ROHSTOFFE HYDROISOTOP GMBH Woelkestraße 9 85301 Schweitenkirchen Tel. +49 (0)8444 / 92890 Fax
Deponien und Isotope WASSER GEOTHERMIE MARKIERVERSUCHE SCHADSTOFFE FILTERTECHNIK LEBENSMITTEL NACHWACHSENDE ROHSTOFFE HYDROISOTOP GMBH Woelkestraße 9 85301 Schweitenkirchen Tel. +49 (0)8444 / 92890 Fax
Nutzung des unterirdischen Speicher- und Wirtschaftsraumes in Deutschland Optionen im Salz
 Nutzung des unterirdischen Speicher- und Wirtschaftsraumes in Deutschland Optionen im Salz Johannes Peter Gerling, Christian Müller, Jörg Hammer, Stefan Heusermann & Friedrich Kühn Bundesanstalt für Geowissenschaften
Nutzung des unterirdischen Speicher- und Wirtschaftsraumes in Deutschland Optionen im Salz Johannes Peter Gerling, Christian Müller, Jörg Hammer, Stefan Heusermann & Friedrich Kühn Bundesanstalt für Geowissenschaften
Praktikum. Technische Chemie. Europa Fachhochschule Fresenius, Idstein. Versuch 05. Wärmeübergang in Gaswirbelschichten
 Praktikum Technische Chemie Europa Fachhochschule Fresenius, Idstein SS 2010 Versuch 05 Wärmeübergang in Gaswirbelschichten Betreuer: Michael Jusek (jusek@dechema.de, Tel: +49-69-7564-339) Symbolverzeichnis
Praktikum Technische Chemie Europa Fachhochschule Fresenius, Idstein SS 2010 Versuch 05 Wärmeübergang in Gaswirbelschichten Betreuer: Michael Jusek (jusek@dechema.de, Tel: +49-69-7564-339) Symbolverzeichnis
Geologischer Hintergrund als Entscheidungsgrundlage
 Geologischer Hintergrund als Entscheidungsgrundlage des gültigen für ein Verwaltungsverfahrens zum Standort von Erdwärmenutzungen (oberflächennahe Geothermie) findet die Erdwärmenutzung ausschließlich
Geologischer Hintergrund als Entscheidungsgrundlage des gültigen für ein Verwaltungsverfahrens zum Standort von Erdwärmenutzungen (oberflächennahe Geothermie) findet die Erdwärmenutzung ausschließlich
6.2.2 Mikrowellen. M.Brennscheidt
 6.2.2 Mikrowellen Im vorangegangen Kapitel wurde die Erzeugung von elektromagnetischen Wellen, wie sie im Rundfunk verwendet werden, mit Hilfe eines Hertzschen Dipols erklärt. Da Radiowellen eine relativ
6.2.2 Mikrowellen Im vorangegangen Kapitel wurde die Erzeugung von elektromagnetischen Wellen, wie sie im Rundfunk verwendet werden, mit Hilfe eines Hertzschen Dipols erklärt. Da Radiowellen eine relativ
Mathematische Grundlagen der dynamischen Simulation
 Mathematische Grundlagen der dynamischen Simulation Dynamische Systeme sind Systeme, die sich verändern. Es geht dabei um eine zeitliche Entwicklung und wie immer in der Informatik betrachten wir dabei
Mathematische Grundlagen der dynamischen Simulation Dynamische Systeme sind Systeme, die sich verändern. Es geht dabei um eine zeitliche Entwicklung und wie immer in der Informatik betrachten wir dabei
Versuch Nr.53. Messung kalorischer Größen (Spezifische Wärmen)
 Versuch Nr.53 Messung kalorischer Größen (Spezifische Wärmen) Stichworte: Wärme, innere Energie und Enthalpie als Zustandsfunktion, Wärmekapazität, spezifische Wärme, Molwärme, Regel von Dulong-Petit,
Versuch Nr.53 Messung kalorischer Größen (Spezifische Wärmen) Stichworte: Wärme, innere Energie und Enthalpie als Zustandsfunktion, Wärmekapazität, spezifische Wärme, Molwärme, Regel von Dulong-Petit,
BOXPLOT 1. Begründung. Boxplot A B C
 BOXPLOT 1 In nachstehender Tabelle sind drei sortierte Datenreihen gegeben. Zu welchem Boxplot gehört die jeweilige Datenreihe? Kreuze an und begründe Deine Entscheidung! Boxplot A B C Begründung 1 1 1
BOXPLOT 1 In nachstehender Tabelle sind drei sortierte Datenreihen gegeben. Zu welchem Boxplot gehört die jeweilige Datenreihe? Kreuze an und begründe Deine Entscheidung! Boxplot A B C Begründung 1 1 1
Thermodynamische Prozesse in Untergrundspeichern für Gase
 Thermodynamische Prozesse in Untergrundspeichern für Gase Prof. Dr.-Ing. Reinhard Scholz, TU Clausthal Prof. Dr.-Ing. Michael Beckmann, TU Dresden Prof. Dr.-Ing. Uwe Gampe, TU Dresden Prof. Dr.-Ing. Hans
Thermodynamische Prozesse in Untergrundspeichern für Gase Prof. Dr.-Ing. Reinhard Scholz, TU Clausthal Prof. Dr.-Ing. Michael Beckmann, TU Dresden Prof. Dr.-Ing. Uwe Gampe, TU Dresden Prof. Dr.-Ing. Hans
Ohmscher Spannungsteiler
 Fakultät Technik Bereich Informationstechnik Ohmscher Spannungsteiler Beispielbericht Blockveranstaltung im SS2006 Technische Dokumentation von M. Mustermann Fakultät Technik Bereich Informationstechnik
Fakultät Technik Bereich Informationstechnik Ohmscher Spannungsteiler Beispielbericht Blockveranstaltung im SS2006 Technische Dokumentation von M. Mustermann Fakultät Technik Bereich Informationstechnik
E 1. Entwicklungssystem Störfestigkeit. Neue Strategie zur Burst- und ESD-Fehlerbeseitigung auf Flachbaugruppen. LANGER EMV-Technik E1 MESSSTRATEGIEN
 E1 MESSSTRATEGIEN LANGER EMV-Technik E 1 Entwicklungssystem Störfestigkeit Störstromeinspeisung Störfeldeinspeisung Magnetfeldmessung Signalüberwachung Neue Strategie zur Burst- und ESD-Fehlerbeseitigung
E1 MESSSTRATEGIEN LANGER EMV-Technik E 1 Entwicklungssystem Störfestigkeit Störstromeinspeisung Störfeldeinspeisung Magnetfeldmessung Signalüberwachung Neue Strategie zur Burst- und ESD-Fehlerbeseitigung
Schmelzdiagramme Kornelia Schmid & Jelena Cikoja Gruppe 150. Schmelzdiagramme
 Schmelzdiagramme 1. Aufgabenstellung: Im Versuch sollen die Schmelzpunkte von 7 Gemischen unterschiedlicher Zusammensetzung aus den Komponenten Biphenyl (A) und Naphthalin (B) bestimmt werden. Anschließend
Schmelzdiagramme 1. Aufgabenstellung: Im Versuch sollen die Schmelzpunkte von 7 Gemischen unterschiedlicher Zusammensetzung aus den Komponenten Biphenyl (A) und Naphthalin (B) bestimmt werden. Anschließend
Erdgas-Porenspeicher. in Betrieb. Krummhörn Jemgum/ Holtgaste. Erdgas-Kavernenspeicher. in Planung. Xanten
 ERDGASSPEICHER Um eine bedarfsgerechte Erdgasversorgung abzusichern, gibt es in Deutschland gut 40 Untertage-Erdgasspeicher. Erdgas-Porenspeicher in Betrieb in Planung oder Bau Erdgas-Kavernenspeicher
ERDGASSPEICHER Um eine bedarfsgerechte Erdgasversorgung abzusichern, gibt es in Deutschland gut 40 Untertage-Erdgasspeicher. Erdgas-Porenspeicher in Betrieb in Planung oder Bau Erdgas-Kavernenspeicher
Dissoziationsgrad und Gefrierpunkterniedrigung (DIS) Gruppe 8 Simone Lingitz, Sebastian Jakob
 Dissoziationsgrad und Gefrierpunkterniedrigung (DIS) Gruppe Simone Lingitz, Sebastian Jakob . Versuch. Versuchsaufbau Durch die Bestimmung der Gefrierpunktserniedrigung beim Lösen von KNO bzw. NaNO in
Dissoziationsgrad und Gefrierpunkterniedrigung (DIS) Gruppe Simone Lingitz, Sebastian Jakob . Versuch. Versuchsaufbau Durch die Bestimmung der Gefrierpunktserniedrigung beim Lösen von KNO bzw. NaNO in
4.6.5 Dritter Hauptsatz der Thermodynamik
 4.6 Hauptsätze der Thermodynamik Entropie S: ds = dq rev T (4.97) Zustandsgröße, die den Grad der Irreversibilität eines Vorgangs angibt. Sie ist ein Maß für die Unordnung eines Systems. Vorgänge finden
4.6 Hauptsätze der Thermodynamik Entropie S: ds = dq rev T (4.97) Zustandsgröße, die den Grad der Irreversibilität eines Vorgangs angibt. Sie ist ein Maß für die Unordnung eines Systems. Vorgänge finden
Power-2-Gas: Zukünftige Nutzung von Gaskavernen und Umwandlung gasförmiger Medien in elektrische Energie. Fritz Crotogino + Sabine Donadei, KBB UT
 Power-2-Gas: Zukünftige Nutzung von Gaskavernen und Umwandlung gasförmiger Medien in elektrische Energie Fritz Crotogino + Sabine Donadei, KBB UT 1. Übergang auf Erneuerbare Energien + resultierender Speicherbedarf
Power-2-Gas: Zukünftige Nutzung von Gaskavernen und Umwandlung gasförmiger Medien in elektrische Energie Fritz Crotogino + Sabine Donadei, KBB UT 1. Übergang auf Erneuerbare Energien + resultierender Speicherbedarf
Rightrax Korrosions- und Erosionsüberwachung mit Ultraschall
 DACH-Jahrestagung 2008 in St.Gallen - Mi.2.B.3 Rightrax Korrosions- und Erosionsüberwachung mit Ultraschall Werner ROYE, GE Inspection Technologies, Hürth Kurzfassung. Durch Korrosion und Erosion ist die
DACH-Jahrestagung 2008 in St.Gallen - Mi.2.B.3 Rightrax Korrosions- und Erosionsüberwachung mit Ultraschall Werner ROYE, GE Inspection Technologies, Hürth Kurzfassung. Durch Korrosion und Erosion ist die
Ein Auge auf s Graue Mehr als Abstufungen erkennen
 Ein Auge auf s Graue Mehr als 4.000 Abstufungen erkennen Bei der Überwachung von farbigen Objekten in Produktionsprozessen geht es selten um die Selektion eindeutiger Farben. Viel öfter gelten die feinen
Ein Auge auf s Graue Mehr als 4.000 Abstufungen erkennen Bei der Überwachung von farbigen Objekten in Produktionsprozessen geht es selten um die Selektion eindeutiger Farben. Viel öfter gelten die feinen
Herzlich Willkommen. Grundlagen zur Leitfähigkeitsmessung. Dipl.-Ing. Manfred Schleicher
 Herzlich Willkommen Grundlagen zur Leitfähigkeitsmessung Dipl.-Ing. Manfred Schleicher Übersicht Allgemeines Zellenkonstante Relative Zellenkonstante Kalibrierung Kalibrierung mit Kalibrierlösung 25 C
Herzlich Willkommen Grundlagen zur Leitfähigkeitsmessung Dipl.-Ing. Manfred Schleicher Übersicht Allgemeines Zellenkonstante Relative Zellenkonstante Kalibrierung Kalibrierung mit Kalibrierlösung 25 C
Quantenobjekte Welle? Teilchen?
 1 Quantenobjekte Welle? Teilchen? Bezug zu den Schwerpunkten / RRL Fragestellung(en) Experiment(e) Hintergrund Benutze die Links, um zu den einzelnen Kategorien zu gelangen! Simulationen Übungen / Aufgaben
1 Quantenobjekte Welle? Teilchen? Bezug zu den Schwerpunkten / RRL Fragestellung(en) Experiment(e) Hintergrund Benutze die Links, um zu den einzelnen Kategorien zu gelangen! Simulationen Übungen / Aufgaben
Partikel-Dampf-Gemische am Arbeitsplatz - Grundlagen zur Messung -
 Partikel-Dampf-Gemische am Arbeitsplatz - Grundlagen zur Messung - 3. Symposium Gefahrstoffe am Arbeitsplatz, Dr. Dietmar Breuer, IFA Dortmund, 25. 09. 2012 Die einfache Welt der Dampf oder Aerosolprobenahme
Partikel-Dampf-Gemische am Arbeitsplatz - Grundlagen zur Messung - 3. Symposium Gefahrstoffe am Arbeitsplatz, Dr. Dietmar Breuer, IFA Dortmund, 25. 09. 2012 Die einfache Welt der Dampf oder Aerosolprobenahme
Leitfaden über den Schutz - Teil 12: Kondensatorschutz
 Leitfaden über den Schutz - Teil 12: Kondensatorschutz Kondensatorbatterien werden zur Kompensation der von den Lasten im Netz aufgenommenen Blindleistung eingesetzt, und manchmal zum Herstellen von Filtern
Leitfaden über den Schutz - Teil 12: Kondensatorschutz Kondensatorbatterien werden zur Kompensation der von den Lasten im Netz aufgenommenen Blindleistung eingesetzt, und manchmal zum Herstellen von Filtern
Multiple-Choice Test. Alle Fragen können mit Hilfe der Versuchsanleitung richtig gelöst werden.
 PCG-Grundpraktikum Versuch 8- Reale Gas Multiple-Choice Test Zu jedem Versuch im PCG wird ein Vorgespräch durchgeführt. Für den Versuch Reale Gas wird dieses Vorgespräch durch einen Multiple-Choice Test
PCG-Grundpraktikum Versuch 8- Reale Gas Multiple-Choice Test Zu jedem Versuch im PCG wird ein Vorgespräch durchgeführt. Für den Versuch Reale Gas wird dieses Vorgespräch durch einen Multiple-Choice Test
Spezifischer elektrischer Widerstand und TK R -Wert von Leiter- und Widerstandswerkstoffen
 Fachbereich 1 Laborpraktikum Physikalische Messtechnik/ Werkstofftechnik Spezifischer elektrischer Widerstand und TK R -Wert von Leiter- und Widerstandswerkstoffen Bearbeitet von Herrn M. Sc. Christof
Fachbereich 1 Laborpraktikum Physikalische Messtechnik/ Werkstofftechnik Spezifischer elektrischer Widerstand und TK R -Wert von Leiter- und Widerstandswerkstoffen Bearbeitet von Herrn M. Sc. Christof
2 Grundbegriffe der Thermodynamik
 2 Grundbegriffe der Thermodynamik 2.1 Thermodynamische Systeme (TDS) Aufteilung zwischen System und Umgebung (= Rest der Welt) führt zu einer Klassifikation der Systeme nach Art der Aufteilung: Dazu: adiabatisch
2 Grundbegriffe der Thermodynamik 2.1 Thermodynamische Systeme (TDS) Aufteilung zwischen System und Umgebung (= Rest der Welt) führt zu einer Klassifikation der Systeme nach Art der Aufteilung: Dazu: adiabatisch
Infrarot - Thermografie
 Infrarot - Thermografie Berührungsfrei und sicher prüfen Die Infrarot Thermografie ist ein modernes, bildgebendes Messverfahren zur schnellen Beurteilung der thermografierten Objekte. In der Regel sind
Infrarot - Thermografie Berührungsfrei und sicher prüfen Die Infrarot Thermografie ist ein modernes, bildgebendes Messverfahren zur schnellen Beurteilung der thermografierten Objekte. In der Regel sind
Wie funktionieren Sensoren? -Fotowiderstand-
 Wie funktionieren Sensoren? -Fotowiderstand- Sinnesorgane und Sensoren erfüllen die gleichen Aufgaben Wir Menschen können mit Hilfe unserer Sinnesorgane Umwelteinflüsse (Reize) wahrnehmen. Unsere Augen
Wie funktionieren Sensoren? -Fotowiderstand- Sinnesorgane und Sensoren erfüllen die gleichen Aufgaben Wir Menschen können mit Hilfe unserer Sinnesorgane Umwelteinflüsse (Reize) wahrnehmen. Unsere Augen
Bestimmung der Dämpfung an einem Lichtwellenleiter
 Fachbereich 1 Laborpraktikum Physikalische Messtechnik/ Werkstofftechnik Bestimmung der Dämpfung an einem Lichtwellenleiter Bearbeitet von Herrn M. Sc. Christof Schultz christof.schultz@htw-berlin.de Inhalt
Fachbereich 1 Laborpraktikum Physikalische Messtechnik/ Werkstofftechnik Bestimmung der Dämpfung an einem Lichtwellenleiter Bearbeitet von Herrn M. Sc. Christof Schultz christof.schultz@htw-berlin.de Inhalt
Anwendungen. der Thermografie im Facility- Management.
 5 Anwendungen der Thermografie im Facility- Management. Undichtigkeiten, hohe Übergangswiderstände und andere Auffälligkeiten haben eine Temperaturveränderung zur Folge und lassen sich mithilfe des bildgebenden
5 Anwendungen der Thermografie im Facility- Management. Undichtigkeiten, hohe Übergangswiderstände und andere Auffälligkeiten haben eine Temperaturveränderung zur Folge und lassen sich mithilfe des bildgebenden
Skript zur Vorlesung
 Skript zur Vorlesung 1. Wärmelehre 1.1. Temperatur Physikalische Grundeinheiten : Die Internationalen Basiseinheiten SI (frz. Système international d unités) 1. Wärmelehre 1.1. Temperatur Ein Maß für
Skript zur Vorlesung 1. Wärmelehre 1.1. Temperatur Physikalische Grundeinheiten : Die Internationalen Basiseinheiten SI (frz. Système international d unités) 1. Wärmelehre 1.1. Temperatur Ein Maß für
Klaus Heißenberg. Folie 2/31. LTM Universität Paderborn. Universität Paderborn. Klaus Heißenberg
 Entwicklung eines interaktiven, plattformunabhängigen und frei programmierbaren Messdatenerfassungs-, Analyse- und Visualisierungssystems am Beispiel eines Druckmessfolien-Sensors Folie 2/31 Inhalt Einleitung
Entwicklung eines interaktiven, plattformunabhängigen und frei programmierbaren Messdatenerfassungs-, Analyse- und Visualisierungssystems am Beispiel eines Druckmessfolien-Sensors Folie 2/31 Inhalt Einleitung
3. Diffusion und Brechungsindex
 3. Diffusion und Brechungsinde Die Diffusion in und aus einer Schicht ist die Grundlage vieler Sensoreffekte, wobei sich die einzelnen Sensoren dann nur noch in der Art der Übersetzung in ein meßbares
3. Diffusion und Brechungsinde Die Diffusion in und aus einer Schicht ist die Grundlage vieler Sensoreffekte, wobei sich die einzelnen Sensoren dann nur noch in der Art der Übersetzung in ein meßbares
Erkunder-Simulation. Realitätsnahe Übungen mit dem ABC-Erkunder. Beispiele für die Einstellung von Ausbreitungen
 Erkunder-Simulation Realitätsnahe Übungen mit dem ABC-Erkunder Beispiele für die Einstellung von Ausbreitungen Inhalt Einfache Ausbreitungsfahne...5 Ablenkung einer Ausbreitungsfahne...5 Durchzug einer
Erkunder-Simulation Realitätsnahe Übungen mit dem ABC-Erkunder Beispiele für die Einstellung von Ausbreitungen Inhalt Einfache Ausbreitungsfahne...5 Ablenkung einer Ausbreitungsfahne...5 Durchzug einer
2.4 Kinetische Gastheorie - Druck und Temperatur im Teilchenmodell
 2.4 Kinetische Gastheorie - Druck und Temperatur im Teilchenmodell Mit den drei Zustandsgrößen Druck, Temperatur und Volumen konnte der Zustand von Gasen makroskopisch beschrieben werden. So kann zum Beispiel
2.4 Kinetische Gastheorie - Druck und Temperatur im Teilchenmodell Mit den drei Zustandsgrößen Druck, Temperatur und Volumen konnte der Zustand von Gasen makroskopisch beschrieben werden. So kann zum Beispiel
Fragen zum Versuch 11a Kinetik Rohrzuckerinversion:
 Fragen zum Versuch 11a Kinetik Rohrzuckerinversion: 1. Die Inversion von Rohrzucker ist: a. Die Umwandlung von Rohrzucker in Saccharose b. Die katalytische Spaltung in Glucose und Fructose c. Das Auflösen
Fragen zum Versuch 11a Kinetik Rohrzuckerinversion: 1. Die Inversion von Rohrzucker ist: a. Die Umwandlung von Rohrzucker in Saccharose b. Die katalytische Spaltung in Glucose und Fructose c. Das Auflösen
JUIIL PISS DO. Johanna Riech. Herausgegeben von Herbert Gebier und Christiane Eckert-Lill GOVI-VERLAG
 JUIIL PISS DO Johanna Riech Herausgegeben von Herbert Gebier und Christiane Eckert-Lill GOVI-VERLAG 1 Allgemeiner Teil 13 1.1 Physikalische Größen 13 Basisgrößen und ihre Einheiten 13 Abgeleitete SI-Größen
JUIIL PISS DO Johanna Riech Herausgegeben von Herbert Gebier und Christiane Eckert-Lill GOVI-VERLAG 1 Allgemeiner Teil 13 1.1 Physikalische Größen 13 Basisgrößen und ihre Einheiten 13 Abgeleitete SI-Größen
Zuordnungen. 2 x g: y = x + 2 h: y = x 1 4
 Zuordnungen Bei Zuordnungen wird jedem vorgegebenen Wert aus einem Bereich ein Wert aus einem anderen Bereich zugeordnet. Zuordnungen können z.b. durch Wertetabellen, Diagramme oder Rechenvorschriften
Zuordnungen Bei Zuordnungen wird jedem vorgegebenen Wert aus einem Bereich ein Wert aus einem anderen Bereich zugeordnet. Zuordnungen können z.b. durch Wertetabellen, Diagramme oder Rechenvorschriften
Notwendigkeit & Potenzial der geologischen Speicherung Erneuerbarer Energien in Deutschland
 9. Niedersächsische Energietage Goslar 1. & 2. November.2016 Notwendigkeit & Potenzial der geologischen Speicherung Erneuerbarer Energien in Deutschland DIPL.-ING. SEBASTIAN BOOR KBB Underground Technologies
9. Niedersächsische Energietage Goslar 1. & 2. November.2016 Notwendigkeit & Potenzial der geologischen Speicherung Erneuerbarer Energien in Deutschland DIPL.-ING. SEBASTIAN BOOR KBB Underground Technologies
1. Wärmelehre 1.1. Temperatur. Physikalische Grundeinheiten : Die Internationalen Basiseinheiten SI (frz. Système international d unités)
 1. Wärmelehre 1.1. Temperatur Physikalische Grundeinheiten : Die Internationalen Basiseinheiten SI (frz. Système international d unités) 1. Wärmelehre 1.1. Temperatur Ein Maß für die Temperatur Prinzip
1. Wärmelehre 1.1. Temperatur Physikalische Grundeinheiten : Die Internationalen Basiseinheiten SI (frz. Système international d unités) 1. Wärmelehre 1.1. Temperatur Ein Maß für die Temperatur Prinzip
Brechung des Lichts Arbeitsblatt
 Brechung des Lichts Arbeitsblatt Bei den dargestellten Strahlenverläufen sind einige so nicht möglich. Zur Erklärung kannst du deine Kenntnisse über Brechung sowie über optisch dichtere bzw. optisch dünnere
Brechung des Lichts Arbeitsblatt Bei den dargestellten Strahlenverläufen sind einige so nicht möglich. Zur Erklärung kannst du deine Kenntnisse über Brechung sowie über optisch dichtere bzw. optisch dünnere
2 Elektrostatik. 2.1 Coulomb-Kraft und elektrische Ladung. 2.1 Coulomb-Kraft und elektrische Ladung
 2.1 Coulomb-Kraft und elektrische Ladung 2 Elektrostatik 2.1 Coulomb-Kraft und elektrische Ladung Abb. 2.1 Durch Reiben verschiedener Stoffe aneinander verbleiben Elektronen der Atomhüllen überwiegend
2.1 Coulomb-Kraft und elektrische Ladung 2 Elektrostatik 2.1 Coulomb-Kraft und elektrische Ladung Abb. 2.1 Durch Reiben verschiedener Stoffe aneinander verbleiben Elektronen der Atomhüllen überwiegend
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005
 Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19513-02-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 Gültigkeitsdauer: 13.04.2016 bis 27.03.2019 Ausstellungsdatum: 13.04.2016 Urkundeninhaber:
Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19513-02-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 Gültigkeitsdauer: 13.04.2016 bis 27.03.2019 Ausstellungsdatum: 13.04.2016 Urkundeninhaber:
Kernlehrplan (KLP) für die Klasse 9 des Konrad Adenauer Gymnasiums
 Kernlehrplan (KLP) für die Klasse 9 des Konrad Adenauer Gymnasiums Zentrale Inhalte in Klasse 9 1. Inhaltsfeld: Elektrizität Schwerpunkte: Elektrische Quelle und elektrischer Verbraucher Einführung von
Kernlehrplan (KLP) für die Klasse 9 des Konrad Adenauer Gymnasiums Zentrale Inhalte in Klasse 9 1. Inhaltsfeld: Elektrizität Schwerpunkte: Elektrische Quelle und elektrischer Verbraucher Einführung von
Bitte finden Sie das richtige Wort oder den richtige Satz und markieren Sie auf dem Antwortfeld, ob die Lösung a, b, c oder d richtig ist
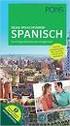 Teil 1 Bitte finden Sie das richtige Wort oder den richtige Satz und markieren Sie auf dem Antwortfeld, ob die Lösung a, b, c oder d richtig ist Beispiel: Wenn ihr Zeit habt, komme ich heute a. an euch
Teil 1 Bitte finden Sie das richtige Wort oder den richtige Satz und markieren Sie auf dem Antwortfeld, ob die Lösung a, b, c oder d richtig ist Beispiel: Wenn ihr Zeit habt, komme ich heute a. an euch
 Bei vernachlässigbaren Ionenverlusten und Verwendung der linearen Näherung für die Exponentialfunktion d.h. bei kleinen Reaktionsraten ergibt sich sowohl aus Gleichung 3.6 wie auch aus Gleichung 3.7 also
Bei vernachlässigbaren Ionenverlusten und Verwendung der linearen Näherung für die Exponentialfunktion d.h. bei kleinen Reaktionsraten ergibt sich sowohl aus Gleichung 3.6 wie auch aus Gleichung 3.7 also
Möglichkeiten zum Erfassen der Schraubenvorspannung mit Dehnungsmessstreifen
 Möglichkeiten zum Erfassen der Schraubenvorspannung mit Dehnungsmessstreifen Hofmann, S. Für die Messung der Schraubenvorspannung mit Dehnungsmessstreifen (DMS) im Versuch und laufendem Betrieb existieren
Möglichkeiten zum Erfassen der Schraubenvorspannung mit Dehnungsmessstreifen Hofmann, S. Für die Messung der Schraubenvorspannung mit Dehnungsmessstreifen (DMS) im Versuch und laufendem Betrieb existieren
Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg, Department F + F
 1 Versuchsdurchführung 1.1 Bestimmung des Widerstands eines Dehnungsmessstreifens 1.1.1 Messung mit industriellen Messgeräten Der Widerstandswert R 0 eines der 4 auf dem zunächst unbelasteten Biegebalken
1 Versuchsdurchführung 1.1 Bestimmung des Widerstands eines Dehnungsmessstreifens 1.1.1 Messung mit industriellen Messgeräten Der Widerstandswert R 0 eines der 4 auf dem zunächst unbelasteten Biegebalken
Liebigkühler. Rundkolben Vorstoß. Becherglas
 Die Destillation 1 1 Allgemeines Bei der Destillation werden Stoffe mit unterschiedlichen Siedetemperaturen durch Erhitzen voneinander getrennt. Aus Rotwein kann auf diese Weise der Alkohol (Ethanol, Sdp.
Die Destillation 1 1 Allgemeines Bei der Destillation werden Stoffe mit unterschiedlichen Siedetemperaturen durch Erhitzen voneinander getrennt. Aus Rotwein kann auf diese Weise der Alkohol (Ethanol, Sdp.
Vakuum-Pufferspeicher Heizen mit Sonne ohne Wärmeverlust
 Vakuum-Pufferspeicher Heizen mit Sonne ohne Wärmeverlust in Kooperation mit öffentlich gefördert von Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Fkz: 0325964A) Warum ein Sonnenhaus?
Vakuum-Pufferspeicher Heizen mit Sonne ohne Wärmeverlust in Kooperation mit öffentlich gefördert von Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Fkz: 0325964A) Warum ein Sonnenhaus?
Physik 4 Praktikum Auswertung Hall-Effekt
 Physik 4 Praktikum Auswertung Hall-Effekt Von J.W., I.G. 2014 Seite 1. Kurzfassung......... 2 2. Theorie.......... 2 2.1. Elektrischer Strom in Halbleitern..... 2 2.2. Hall-Effekt......... 3 3. Durchführung.........
Physik 4 Praktikum Auswertung Hall-Effekt Von J.W., I.G. 2014 Seite 1. Kurzfassung......... 2 2. Theorie.......... 2 2.1. Elektrischer Strom in Halbleitern..... 2 2.2. Hall-Effekt......... 3 3. Durchführung.........
8. Mehrkomponentensysteme. 8.1 Partielle molare Größen. Experiment 1 unter Umgebungsdruck p:
 8. Mehrkomponentensysteme 8.1 Partielle molare Größen Experiment 1 unter Umgebungsdruck p: Fügen wir einer Menge Wasser n mit Volumen V (molares Volumen v m =V/n) bei einer bestimmten Temperatur T eine
8. Mehrkomponentensysteme 8.1 Partielle molare Größen Experiment 1 unter Umgebungsdruck p: Fügen wir einer Menge Wasser n mit Volumen V (molares Volumen v m =V/n) bei einer bestimmten Temperatur T eine
Wasserstoffspeicherung im geologischen Untergrund Stand der Technik und Potential
 Fachkonferenz Energiespeicher für Deutschland Wasserstoffspeicherung im geologischen Untergrund Stand der Technik und Potential Fritz Crotogino KBB Underground Technologies GmbH Hannover FCrotogino@kbbnet.de
Fachkonferenz Energiespeicher für Deutschland Wasserstoffspeicherung im geologischen Untergrund Stand der Technik und Potential Fritz Crotogino KBB Underground Technologies GmbH Hannover FCrotogino@kbbnet.de
Die richtige Analysemethode für filmische und partikuläre Verunreinigungen finden. Prof. Dr. Juliane König-Birk
 Die richtige Analysemethode für filmische und partikuläre Verunreinigungen finden Prof. Dr. Juliane König-Birk Ziele Grenzen und Einsatzgebiete verschiedener Analysemethoden kennenlernen Probleme bei der
Die richtige Analysemethode für filmische und partikuläre Verunreinigungen finden Prof. Dr. Juliane König-Birk Ziele Grenzen und Einsatzgebiete verschiedener Analysemethoden kennenlernen Probleme bei der
Bestimmung der Molekularen Masse von Makromolekülen
 Bestimmung der Molekularen Masse von Makromolekülen Größenausschlußchromatographie Gelfiltration, SEC=size exclusion chromatography Größenausschlußchromatographie Gelfiltration, SEC=size exclusion chromatography
Bestimmung der Molekularen Masse von Makromolekülen Größenausschlußchromatographie Gelfiltration, SEC=size exclusion chromatography Größenausschlußchromatographie Gelfiltration, SEC=size exclusion chromatography
Multiple-Choice Test. Alle Fragen können mit Hilfe der Versuchsanleitung richtig gelöst werden.
 PCG-Grundpraktikum Versuch 1- Dampfdruckdiagramm Multiple-Choice Test Zu jedem Versuch im PCG wird ein Vorgespräch durchgeführt. Für den Versuch Dampfdruckdiagramm wird dieses Vorgespräch durch einen Multiple-Choice
PCG-Grundpraktikum Versuch 1- Dampfdruckdiagramm Multiple-Choice Test Zu jedem Versuch im PCG wird ein Vorgespräch durchgeführt. Für den Versuch Dampfdruckdiagramm wird dieses Vorgespräch durch einen Multiple-Choice
Freie Elektronen bilden ein Elektronengas. Feste positive Aluminiumionen. Abb. 1.1: Metallbindung: Feste Atomrümpfe und freie Valenzelektronen
 1 Grundlagen 1.1 Leiter Nichtleiter Halbleiter 1.1.1 Leiter Leiter sind generell Stoffe, die die Eigenschaft haben verschiedene arten weiterzuleiten. Im Folgenden steht dabei die Leitfähigkeit des elektrischen
1 Grundlagen 1.1 Leiter Nichtleiter Halbleiter 1.1.1 Leiter Leiter sind generell Stoffe, die die Eigenschaft haben verschiedene arten weiterzuleiten. Im Folgenden steht dabei die Leitfähigkeit des elektrischen
Fernerkundung der Erdatmosphäre
 Fernerkundung der Erdatmosphäre Dr. Dietrich Feist Max-Planck-Institut für Biogeochemie Jena Max Planck Institut für Biogeochemie Foto: Michael Hielscher Max Planck Institut für
Fernerkundung der Erdatmosphäre Dr. Dietrich Feist Max-Planck-Institut für Biogeochemie Jena Max Planck Institut für Biogeochemie Foto: Michael Hielscher Max Planck Institut für
John Daltons Atomhypothese. 1. Wie kommt Dalton auf die Atomhypothese? a. Die Eigenschaften des Wassers
 John Daltons Atomhypothese 1. Wie kommt Dalton auf die Atomhypothese? a. Die Eigenschaften des Wassers 2. Welche Aussagen trifft Dalton mit Hilfe des Atommodells? A. Verhalten von Stoffen bei chem. Reaktionen
John Daltons Atomhypothese 1. Wie kommt Dalton auf die Atomhypothese? a. Die Eigenschaften des Wassers 2. Welche Aussagen trifft Dalton mit Hilfe des Atommodells? A. Verhalten von Stoffen bei chem. Reaktionen
Ortsverteilte faseroptische Messtechnik im Extrembereich des Spezialtiefbaus
 Ortsverteilte faseroptische Messtechnik im Extrembereich des Spezialtiefbaus Dr.-Ing. Arne Kindler M.Sc. Karolina Nycz Stump Spezialtiefbau GmbH, Berlin, Germany Dipl.-Ing. Maria-Barbara Schaller Jürgen
Ortsverteilte faseroptische Messtechnik im Extrembereich des Spezialtiefbaus Dr.-Ing. Arne Kindler M.Sc. Karolina Nycz Stump Spezialtiefbau GmbH, Berlin, Germany Dipl.-Ing. Maria-Barbara Schaller Jürgen
Name: Punkte: Note Ø: Achtung! Es gibt Abzüge für schlechte Darstellung: Klasse 7b Klassenarbeit in Physik
 Name: Punkte: Note Ø: Achtung! Es gibt Abzüge für schlechte Darstellung: Klasse 7b 16. 1. 01 1. Klassenarbeit in Physik Bitte auf gute Darstellung und lesbare Schrift achten. Aufgabe 1) (4 Punkte) Bei
Name: Punkte: Note Ø: Achtung! Es gibt Abzüge für schlechte Darstellung: Klasse 7b 16. 1. 01 1. Klassenarbeit in Physik Bitte auf gute Darstellung und lesbare Schrift achten. Aufgabe 1) (4 Punkte) Bei
DIN 19700: Betrieb und Überwachung von Talsperren
 Erfahrungsaustausch Talsperren, ZW Kleine Kinzig, 28.1.2009 DIN 19700:2004-07 07 Betrieb und Überwachung von Talsperren Dr.-Ing. Karl Kast Ingenieurgemeinschaft für Umwelt- und Geotechnik, Ettlingen Teil
Erfahrungsaustausch Talsperren, ZW Kleine Kinzig, 28.1.2009 DIN 19700:2004-07 07 Betrieb und Überwachung von Talsperren Dr.-Ing. Karl Kast Ingenieurgemeinschaft für Umwelt- und Geotechnik, Ettlingen Teil
Umweltdetektiv für Treibhausgase: CarbonSat-Messkonzept der Uni Bremen erfolgreich getestet
 Umweltdetektiv für Treibhausgase: CarbonSat-Messkonzept der Uni Bremen erfolgreich getestet Bremen, 5.3.2014 Im Rahmen einer erfolgreichen Forschungsmesskampagne im Auftrag der europäischen Weltraumbehörde
Umweltdetektiv für Treibhausgase: CarbonSat-Messkonzept der Uni Bremen erfolgreich getestet Bremen, 5.3.2014 Im Rahmen einer erfolgreichen Forschungsmesskampagne im Auftrag der europäischen Weltraumbehörde
Thermodynamik Wärmestrom
 Folie 1/11 Werden zwei Körper mit unterschiedlichen Temperaturen in thermischen Kontakt miteinander gebracht, so strömt Wärme immer vom Körper mit der höheren Temperatur auf den Körper mit der niedrigen
Folie 1/11 Werden zwei Körper mit unterschiedlichen Temperaturen in thermischen Kontakt miteinander gebracht, so strömt Wärme immer vom Körper mit der höheren Temperatur auf den Körper mit der niedrigen
LEE2: 2. Messung der Molrefraktion der Flüssigkeiten für die Bestimmung der Qualität des Rohmaterials
 ŠPŠCH Brno Erarbeitung berufspädagogischer Konzepte für die beruflichen Handlungsfelder Arbeiten im Chemielabor und Operator Angewandte Chemie und Lebensmittelanalyse LEE2: 2. Messung der Molrefraktion
ŠPŠCH Brno Erarbeitung berufspädagogischer Konzepte für die beruflichen Handlungsfelder Arbeiten im Chemielabor und Operator Angewandte Chemie und Lebensmittelanalyse LEE2: 2. Messung der Molrefraktion
Chemie Protokoll. Versuch 2 3 (RKV) Reaktionskinetik Esterverseifung. Stuttgart, Sommersemester 2012
 Chemie Protokoll Versuch 2 3 (RKV) Reaktionskinetik Esterverseifung Stuttgart, Sommersemester 202 Gruppe 0 Jan Schnabel Maximilian Möckel Henri Menke Assistent: Durmus 20. Mai 202 Inhaltsverzeichnis Theorie
Chemie Protokoll Versuch 2 3 (RKV) Reaktionskinetik Esterverseifung Stuttgart, Sommersemester 202 Gruppe 0 Jan Schnabel Maximilian Möckel Henri Menke Assistent: Durmus 20. Mai 202 Inhaltsverzeichnis Theorie
"Zeitlicher Zusammenhang von Schadenshäufigkeit und Windgeschwindigkeit"
 22. FGW-Workshop am 06. Mai 1997 "Einfluß der Witterung auf Windenergieanlagen" am Institut für Meteorologie, Leipzig Dipl.-Ing. Berthold Hahn, Institut für Solare Energieversorgungstechnik e.v., Kassel
22. FGW-Workshop am 06. Mai 1997 "Einfluß der Witterung auf Windenergieanlagen" am Institut für Meteorologie, Leipzig Dipl.-Ing. Berthold Hahn, Institut für Solare Energieversorgungstechnik e.v., Kassel
