Lebendige Dörfer in Brandenburg Bürgerbeteiligung im Alltag
|
|
|
- Minna Kolbe
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Brandenburg 21 Verein zur nachhaltigen Lokal- und Regionalentwicklung im Land Brandenburg e.v. Lebendige Dörfer in Brandenburg Bürgerbeteiligung im Alltag Ergebnisse einer Bürgerbefragung in 5 Dörfern 2006
2
3 Humboldt Universität Berlin Landwirtschaftlich- Gärtnerische Fakultät Institut für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaus Fachgebiet Landwirtschaftliche Beratung und Kommunikationslehre Prof. Dr. Dr. h.c. Uwe Jens Nagel Lebendige Dörfer in Brandenburg Bürgerbeteiligung im Alltag Ergebnisse einer Befragung in 5 Dörfern Potsdam und Berlin 2006 Projektteam Sommersemester 2006 Silke Stöber (Projektleitung und Gesamtbericht, HU) Bianca Jedamzik (Tutorin) Dr. Stephan Beetz (Wissenschaftliche Unterstützung, HU) Dr. Karl Martin Born (Betreuung von Hausarbeiten, FU) Marek Birkholz (Studiengang Diplom-Geografie FU) Dennis Dalter (Studiengang Diplom-Geografie FU) Janina Grabowsky (Studiengang Diplom-Geografie FU) Dana Gröper (Studiengang Diplom-Geografie FU) Andrea Hirt (Studiengang Diplom-Geografie FU) Nicole Jachmann (Studiengang Diplom-Geografie FU) Julia Jahnke (Studiengang Master Nachhaltige Landnutzung HU) (Kapitel 4.2) Robert Klichowicz (Studiengang Diplom-Geografie FU) Katrin Köhler (Studiengang Master Agrarökonomik HU) Vanessa Köppe (Studiengang Diplom-Geografie FU) Henrike Rieken (Studiengang Master Agrarökonomik HU) Stefan Schimpf (Studiengang Diplom-Geografie FU) Janin Spigalski (Studiengang Diplom-Geografie FU) Kontakt silke.stoeber@agrar.hu-berlin.de
4 Dieser Bericht wurde im Auftrag der AG Dorf, einer Arbeitsgruppe der Brandenburgischen Werkstatt Lokale Agenda 21 erstellt. Mittlerweile hat sich aus dieser Arbeitsgruppe ein Verein in Gründung entwickelt (Brandenburg 21 - Verein zur nachhaltigen Lokale- und Regionalentwicklung im Land Brandenburg e.v.). Für die Antragstellung der Mittel für die vorliegende Studie wurde die Grün-Bürgerbewegte Kommunalpolitik Brandenburg e.v. (GBK) gewonnen. Gefördert wurde das Projekt durch das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz (MLUV) Brandenburg aus Mitteln der Konzessionsabgabe Lotto im Rahmen der Aktion Nachhaltige Entwicklung Lokale Agenda 21 in Brandenburg. Über die Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung Brandenburg e.v. (ANU) wurde das Projekt bewilligt. Die Verantwortung der Inhalte liegt bei der Autorin und des Autors. Die Studie ist im Internetportal veröffentlicht. Eine CD-Rom Version kann über die GBK Brandenburg (rappaport@freenet.de) bestellt werden. Autoren: Lebendige Dörfer in Brandenburg Bürgerbeteiligung im Alltag Silke Stöber Anhang Grundaussagen zu einer Strategie zur Förderung lebendiger und zukunftsfähiger Dörfer - Prof. Dr. Kurt Krambach 2006, Potsdam und Berlin
5 Inhalt Inhalt Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Vorwort Danksagung Urlaub in der Wüste? Mehr Bürger - weniger Staat Ziele der Studie und Fragestellungen Lebendige Dörfer Begriffsabgrenzung Bürgerengagement und Zivilgesellschaft in Ostdeutschland In welchen Bereichen trifft man auf Lebendigkeit? Akteure: Wer trägt Lebendigkeit? Wie stellt sich Lebendigkeit im Prozess dar? Vorgehensweise Vorbereitung des Themas und der Feldforschung Teilnehmende Dörfer Partizipation Lernen - Aktion Küchentischgespräche und Experteninterviews Ergänzender Fragebogen Kurzprofile der Dörfer Identität und Engagement Wahrnehmungen des Dorfes Wenn die Bürger entscheiden dürften Bewertung der Lebendigkeit in den untersuchten Dörfern Aspekte der Lebendigkeit Zwölf Aktive retten einen Landschaftspark Gutscheine für die Dorf-Sauna Work Camps, Motocross und Beach Parties Öko fängt vor der eigenen Haustür an Wenn der Storch nicht pünktlich kommt, ist das ganze Dorf krank Ohne Vereine wäre das Dorf tot Es gibt eine Lokomotive, Waggons und ein paar, die hinten schieben Unsere Großgemeinde Märchen versus reales Leben Indikatoren zur Bewertung von Lebendigkeit Zusammenfassung und Schlussfolgerungen Ergebnisbezogene Aussagen der untersuchten Dörfer Reflexion der angewandten Methodik Empfehlungen Literaturverzeichnis Anhang
6 Grundaussagen zu einer Strategie zur Förderung lebendiger und zukunftsfähiger Dörfer Prof. Dr. Kurt Krambach Seite 1. Dörfer als dauerhafte sozialräumliche Existenzformen auf dem Lande Europäische Dorfbewegungen als Erfahrungsquelle für zukunftsfähige Dörfer Die Gestaltung des Verhältnisses von Dorf und Gemeinde (Kommune) bedarf neuer und konstruktiver Lösungen Lebendigkeit als Gradmesser sozialer Aktivitätsniveaus Zukunftsfähigkeit des Dorfes als erstrebenswertes Ziel Mobilisierung lokaler Akteure als Kernaufgabe
7 Abbildungsverzeichnis Abbildung 1 Einübung der Küchentischgespräche Abbildung 2 Lage der untersuchten Dörfer Abbildung 3 Präsentation der Zwischenergebnisse in Maasdorf Abbildung 4 Ablauf einer PLA Projektwoche Abbildung 5 Küchentischgespräch mit Bootsausbauerfamilie in Deetz Abbildung 6 Auswertung der Interviews in Fürstlich Drehna Abbildung 7 Analyse der Kernaussagen in Kroppen Abbildung 8 Gestaltung der Poster Wulkow Abbildung 9 Beispielposter: Maasdorfer Miteinander Abbildung 10 Leben in Maasdorf Abbildung 11 Leben in Deetz Abbildung 12 Leben in Fürstlich Drehna Abbildung 13 Leben in Kroppen Abbildung 14 Leben in Wulkow Abbildung 15 Dorfprofil - Deetz aus der Sicht seiner Bewohner Abbildung 16 Dorfprofil - Kroppen aus der Sicht seiner Bewohner Abbildung 17 Dorfprofil - Wulkow aus der Sicht seiner Bewohner Abbildung 18 Dorfprofil Fürstlich Drehna aus der Sicht seiner Bewohner Abbildung 19 Wichtige Einrichtungen und Aktivitäten Abbildung 20 Posterbeispiel Stärken der Maasdorfer Abbildung 21 Posterbeispiel Jung sein in Wulkow Abbildung 22 Pavillon Landschaftspark Fürstlich Drehna Abbildung 23 Windmühle in Fürstlich Drehna Abbildung 24 Gaststätte Zur Eiche in Kroppen Abbildung 25 Sägewerk in Kroppen Abbildung 26 Schafe in den Vorgärten zeigen landwirtschaftliche Tradition Abbildung 27 FC Deetz mit Nachwuchsgruppen Abbildung 28 Beach Party in Kroppen Abbildung 29 Motocross über die Pulsnitz Abbildung 30 Motocross MX Masters in der Bergbaufolgelandschaft Abbildung 31 Niedrigenergiehaus in Wulkow (Ufo) Abbildung 32 Garten des Natoureum in Maasdorf Abbildung 33 Jugend-Rockfestival in Maasdorf Rock am Wald Abbildung 34 Ökospeicher in Wulkow Abbildung 35 Beschilderung der Natur-Besonderheiten Abbildung 36 Natur-Kita Grashüpfer seit Abbildung 37 Storchennest in Maasdorf Abbildung 38 Aufruf zur 12.Waldsäuberungsaktion Abbildung 39 Ehrenamtlich geführte Gemeindebibliothek in Kroppen Abbildung 40 Heimatverein Deetz im Heimatmuseum Abbildung 41 Maasdorfer Entwicklungsweg: Kontinuierliche starke Führung Abbildung 42 Wulkower Entwicklungsweg: Team-Neuanfang nach großem Bruch? Abbildung 43 Handlungsunfähigkeit der Großgemeinde wirkt demotivierend Tabellenverzeichnis Tabelle 1 Untersuchte Dörfer im Land Brandenburg Tabelle 2 Anzahl der Interviews in den Dörfern Tabelle 3 Siedlungsstrukturtypen und Demographietypen Tabelle 4 Werden Sie in den nächsten Jahren das Dorf verlassen? Tabelle 5 Engagieren Sie sich im Dorf? Tabelle 6 Wo erfolgt das Engagement? Tabelle 7 Übersicht der Bereiche und Akteure von Lebendigkeit Tabelle 8 Übersicht über den Bereich Umwelt- und Naturschutz
8 Abkürzungsverzeichnis ANU Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung BBR Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung DAV Deutscher Anglerverband EE Elbe-Elster ELER Entwicklung der ländlichen Räume ETH Eidgenössische Technische Hochschule Zürich FU Freie Universität Berlin GBK Grün-Bürgerbewegte Kommunalpolitik e.v. HU Humboldt Universität INKAR Indikatoren und Karten zur Raumentwicklung LBL Landwirtschaftliche Beratungszentrale Lindau LDS Landkreis Dahme-Spreewald MLUV Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz MOL Märkisch Oderland Nabu Naturschutzbund Deutschland e.v. ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr OSL Oberspreewald-Lausitz OT Ortsteil PISA Programme for International Student Assessment PLA Partizipation-Lernen-Aktion PM Potsdam-Mittelmark WSL Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft - 4 -
9 Vorwort Zampern, Frühstückstreffen in der Kirchengemeinde, ein Dorfclub, der den Ort zusammenhält, ein Jugendclub, der open-air Konzerte veranstaltet und eine Fußballmannschaft, die in der Kreisliga spielt wer hätte gedacht, dass das nur ein Ausschnitt von den Höhepunkten des Lebens in einem Dorf in der letzten Ecke von Brandenburg ist. Nachdem die Landesregierung festgelegt hat, dass nur noch bestimmte Zentren und Branchen Entwicklungspotential hätten, spielen Dörfer in der Landespolitik keine Rolle mehr. Das ist fatal. Vor allem aber wird es weder den Dörfern noch den dort lebenden Menschen gerecht. Während in den politischen Reden der ländliche Raum zum Jammertal des demografischen Wandels verkommt, wird in den Dörfern geplant, organisiert, aufgebaut und Erreichtes gefeiert. Die Landbevölkerung hat ihr Schicksal längst selbst in die Hand genommen. Die vorliegende Studie über lebendige Dörfer in Brandenburg beschreibt das dörfliche Engagement - vom durch Vereine organisierten Kulturleben über Projekte für die lokale Wirtschaft bis zur Nachbarschaftshilfe, die dort einspringt, wo der Staat sich zurückgezogen hat. In ihr ist nachzulesen, dass Jugendarbeit und Kinderbetreuung genauso wie die vielfältigen Service- und Kulturangebote für die Senioren im Mittel der Diskussionen und Aktivitäten stehen. Auch für die lokale Wirtschaft werden Projekte diskutiert und umgesetzt. Die Studie widerlegt die Behauptung, dass regionale Entwicklungspotentiale nur in den von der Landesregierung bestimmten Zentren lägen. Sie zeigt auf, dass die Menschen außerhalb dieser die Potentiale ihrer Orte und Region kennen und wissen, wie Synergieeffekte entwickelt und wo Arbeitsplätze geschaffen werden können. Hier werden Maßnahmen diskutiert, die den Abwanderungstrends von jungen Leuten entgegenwirken sollen. Hier werden die Rückkehrerprogramme entwickelt. Der Demografiecheck für die Infrastrukturmaßnahmen wurde bereits vollzogen. Es liegen ganz konkrete Lösungsvorschläge und Erwartungen an die Landespolitik vor. Dazu gehören z.b. dezentrale Abwassersysteme oder die Finanzierung eines Wochenendnachtbusses für junge Leute. Solche Forderungen sind maßvoll und fundiert, denn sie sind Teil einer konzeptionellen Gesamtschau. Einmalig an dieser Studie ist, wie die Menschen in den Dörfern selbst zu Wort kommen. Ihre Berichte, Analysen und Visionen finden hier Raum. Sie ergeben ein nüchternes, jedoch gleichzeitig optimistisches Bild über die Entwicklungschancen in Brandenburger Dörfern. Gleichzeitig zeigt die Studie auf, welches enorme ehrenamtliche Engagement für den Erhalt der Lebensfähigkeit, zur Gestaltung des Lebensumfeldes und zur Verbesserung der Wohnqualität in den Dörfern aufgebracht wird. Die hier beschriebenen Orte sind weit davon entfernt, nur auf die Gaben der Politik zu warten. Sie leisten eigene Beiträge, um ihr Dorf lebendig und attraktiv zu gestalten. Wo sie Unterstützung der Landesregierung einklagen, um die vielfältigen Probleme der Daseinsvorsorge, insbesondere die medizinische Grundversorgung und die Sicherung einer angemessenen Schulbildung, aber auch die Arbeitsplatzsituation in den Griff zu bekommen, hat dies wegen geleisteter Vorarbeit seine volle Berechtigung. Ich kann nur hoffen, dass diese Studie zum Umdenken in der Landespolitik beträgt. Die Menschen dürfen mit ihrem Engagement nicht allein gelassen werden. Sie haben gerade deswegen Anspruch auf adäquate Konzepte in den landespolitischen Förderstrategien. Elisabeth Schroedter MdEP Fraktion Grüne/EFA - 5 -
10 Danksagung Für die großartige Erfahrung, die wir mit Ihnen in den Dörfern machen konnten, möchten wir uns bei den Bürgermeistern, Ortsbürgermeistern, Kontaktpersonen und Interviewpartnern aller beteiligten Dörfer herzlich bedanken. Auf ihren Problemen und Ideen fußen viele Ergebnisse dieses Berichtes. Beim Koordinator der AG Dorf, Herrn Jens-Uwe Siebert, bedanken wir uns, dass er bei der Mittelbeantragung einen wesentlichen Beitrag geleistet und uns mit fachlichen Inputs hilfreich versorgt hat. Carola Werner von der KooperationsAnstiftung hat lebendige Dörfer in Südbrandenburg aufgespürt und uns immer dazu angeregt, praxisnah und zielgruppenrelevant zu arbeiten. Prof. Dr. Kurt Krambach brachte uns mit seinen Visionen zu Dorfaktionsbewegungen in Brandenburg auf eine innovative Spur. Vielen Dank auch dafür. Der Grün-Bürgerbewegten Kommunalpolitik Brandenburg e.v. (GBK), Herrn Chris Rappaport, danken wir, dass er das Projekt beantragt hat und dass eine effiziente Kooperation bei der Finanzmittelabrechnung stattfand. Ermöglicht wurde das Projekt durch eine Förderung des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz (MLUV) Brandenburg, die diese Studie aus Mitteln der Konzessionsabgabe Lotto im Rahmen der Aktion Nachhaltige Entwicklung Lokale Agenda 21 in Brandenburg gefördert haben. Die Projektförderung wurde über die Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung Brandenburg e.v. (ANU) beantragt und bewilligt. Wir freuen uns, dass wir die Förderung bekommen haben und danken für die großzügige Unterstützung. Das Untersuchungsteam - 6 -
11 1. Urlaub in der Wüste? Schreiben Sie etwas, was unserem Image gut tut, [...] wir leben gerne hier bittet Arnim Beduhn, Beigeordneter des Landkreises Uecker-Randow, die Journalistin 1. Der über 300 Zeilen umfassende Artikel über den ländlichen Raum in den Potsdamer Neuesten Nachrichten steht an exponierter Stelle. Doch auf eine positive Aussage stößt man erst in den letzten 27 Zeilen. Dort geht es um eine Wildtierstiftung, die Abenteuerurlaub für Schulklassen anbietet und eine engagierte Lehrerin, die Kindern in Mini-Klassen Lesen, Schreiben und Rechnen beibringt. Das klingt wirklich gut, man assoziiert sofort: Wildtierstiftung: spannend, natürlich, etwas Besonderes. Kleine Klassen: Finnland, PISA-Sieger, Weltklasse. Und diese Assoziationen tun dem Image gut. Doch insgesamt bleibt in den Köpfen hängen: Im ländlichen Raum herrscht Öde, Perspektivlosigkeit, Überalterung und Verwüstung. Die Infrastruktur ist veraltet, die Jugend wandert ab und es regieren Hoffnungslosigkeit und Stagnation. So wie man es eben immer liest. Aber ist das die Wirklichkeit, oder ist es das, was die Potsdamer gerne hören wollen? Wenn ich nach Hause fahre, fahre ich in den Urlaub lacht Carsten Schulz, Streetworker in Potsdam-Babelsberg, der im kleinen Dorf Deetz in Potsdam-Mittelmark lebt. Bei Euch ist doch andauernd und immer etwas los bestätigt jemand aus der Nachbargemeinde. Gibt es also Dörfer, die den Teufelskreis der Abwanderung und Überalterung durchbrechen können? Die es durch eigenes Engagement schaffen, Lebendigkeit und Aktivitäten in das Dorf hineinzutragen? Also lebendige Dörfer? Die Menschen in der Provinz überwinden tagtäglich viele Durststrecken. Die Jugend sieht keine Perspektive und wandert ab, Ärzte schließen ihre Praxen, die Dorfbäckerei hat zu wenig Kunden, um zu überleben. Doch es gibt Dörfer, in denen mit Bürgerengagement etwas dagegen unternommen wird. Wie reagieren solche Dörfer auf diesen Strukturwandel? Bleiben die Dörfer lebendig, weil sie bessere Voraussetzungen haben? Sind etwa Kontakte zu Politik und Verwaltung für die Lebendigkeit ausschlaggebend? Welche Akzente setzen Vereine, ehrenamtliche Bürgermeister, engagierte Bürgerinnen und Bürger und wie schaffen sie es, Konflikte konstruktiv zu lösen, Risiken auszuschalten und verrückte Ideen auszuprobieren? Wer sind eigentlich die Drahtzieher in diesen Dörfern und auf welche Unterstützung hoffen sie? 1 Potsdamer Neueste Nachrichten, 26.Mai 2006, Seite 3: Geschichten vom Verschwinden von Antje Sirleschtov, Leopoldshagen
12 2. Mehr Bürger - weniger Staat Vor dem Hintergrund knapper öffentlicher Mittel müsste die Politik und kommunale Verwaltung besonderes Interesse an einer lebendigen Bürgerkommune haben. MAGEL (2004) definiert die Bürgerkommune als eine dem Leitbild des aktivierenden Staates vertrauende Verantwortungsgemeinschaft zwischen 1. Stadt/Gemeinderat, 2. Bürgern und zivilgesellschaftlichen Organisationen (Kirche, Vereine, Verbände, Wirtschaft) und der 3. Kommunalverwaltung. MAGEL (2004) und DETTLING (2003) räumen ein, dass die Kommunalverwaltung noch sehr zurückhaltend gegenüber der Rolle von aktiven gestaltenden Bürgern innerhalb einer solchen Bürgerkommune ist. Dies ist zum einen in den noch nicht kalkulierbaren Kosten, die durch die Externalisierung der Aufgaben entstehen, zu begründen. Nicht außer Acht zu lassen sei aber auch der einhergehende Machtverlust der Kommunen. Denn Teilnahme führt letztendlich auch zu Teilhabe und einer stärkeren Zivilgesellschaft. Eine lebendige Bürgerkommune wird als eine Strategie gesehen, die Lebensqualität aufrecht zu erhalten. Denn Grundgesetz und Länderverfassungen gewähren immer noch die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in den verschiedenen Regionen. Angesichts des demografischen Wandels ist jedoch die Gleichwertigkeit im klassischen Sinne (gleiche Lebens-, Wohn-, Arbeits- und Freizeitbedingungen) nicht mehr haltbar. Laut BBR werden die bisherigen Standards öffentlicher Daseinsvorsorge vor allem in dünn besiedelten ländlichen Regionen nicht aufrechtzuerhalten sein. Deshalb ist eine Beschränkung öffentlicher Infrastrukturangebote auf unabdingbare Kernfunktionen angezeigt. (BBR 2005). Den Bewohnern des ländlichen Raumes ist dies längst bewusst. Sie entwickeln schon seit Jahrzehnten Anpassungsstrategien, die mehr oder weniger nachhaltig wirken. Sie ersetzen die klassischen Arbeitsplätze in der Landwirtschaft durch Arbeitsplätze im Tourismus. Sie probieren Einkommensschaffende Maßnahmen in der Regionalvermarktung. Zum Kinderarzt fahren sie durchaus 20 Kilometer und warten dort Stunden auf die Behandlung. Eine weitere Strategie ist die Landflucht, die Abwanderung jüngerer Menschen in die wirtschaftlich attraktiveren Städte... (FAHRENKRUG & MELZER 2005). Für SCHÖNBOHM scheint die Landflucht keine nachhaltige Anpassungsstrategie zu sein. Sie ist gesellschaftlich nicht gewollt. Auf dem kommunalen Demografiekongress betont er, dass gerade die Abwanderung in ländlichen Räumen des äußeren Entwicklungsraumes Brandenburgs es notwendig macht, für attraktive Kommunen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu kämpfen, die auch junge Menschen zum Bleiben veranlassen können. (KOM- MUNALER DEMOGRAFIEKONGRESS 2006) SCHÖNBOHM will auch die Aufgaben der Kommunalverwaltung neu diskutieren. Auch der Aufgabenverzicht und die Aufgabenprivatisierung gehören besonders in Zeiten knapper Kassen zu dem üblichen Instrumentarium zur Herstellung und Sicherung leistungsfähiger und bezahlbarer Verwaltungen. (KOMMUNALER DEMOGRAFIEKONGRESS 2006). Der Staat zieht sich zurück. Die Rolle und Aufgaben der Bürger und zivilgesellschaftlichen Organisationen innerhalb der Bürgerkommune sind daher neu zu definieren. Damit die Bürger und ihre ehrenamtlichen Strukturen nicht als billiger Jakob des reduzierten Wohlfahrtstaates (OSNER 2005) missbraucht werden, ist im gleichen Atemzug zu fragen, welche Aufgaben und Rollen Gemeinderat und Kommunalverwaltung spielen, um die am Gestaltungsprozess teilhabenden Bürger in ihrem Engagement zu unterstützen. Um Bürgerengagement als Chance für die Gestaltung der ländlichen Räume in Brandenburg effizient zu nutzen, ist eine gewisse kommunale und überregionale Unterstützung nötig. Dies wird am Beispiel der untersuchten lebendigen Dörfer erkennbar
13 3. Ziele der Studie und Fragestellungen Aber was sind eigentlich lebendige Dörfer? Wie wohl fühlen sich die Menschen in lebendigen Dörfern? Und wie schaffen es die Dorfbewohner, vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, der Strukturveränderungen in der Landwirtschaft und der Gemeindegebietsreform, ihre Dörfer zu entwickeln? Was tun die Menschen, wie bündeln sie ihre Kräfte, finden sie Unterstützer von außen, in der Kommunalverwaltung, um innovative Ideen umzusetzen und ihr Dorf für sich selbst, für Kinder und Jugendliche und für Gäste lebenswert zu gestalten? Diese Fragen interessieren nicht nur die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Dorf (AG Dorf) der Brandenburgischen Werkstatt lokale Agenda 21 ( und die Grün-Bürgerbewegte Kommunalpolitik (GBK) e.v. Brandenburg. Es wurde eine Studie in Auftrag gegeben, um die Bewohner von fünf Dörfern zu den o.g. Aspekten zu befragen. Eine Projektförderung wurde über die Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung Brandenburg e.v. (ANU) beantragt und bewilligt. Die Studie wurde aus Mitteln der Konzessionsabgabe Lotto im Rahmen der Aktion nachhaltige Entwicklung Lokale Agenda 21 in Brandenburg durch das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz (MLUV) gefördert. Die Ergebnisse der Studie sind nicht nur für die befragten Dörfer selbst, sondern auch für andere Dörfer von Interesse, um aus den Erfahrungen und Aktivitäten des bürgerschaftlichen Engagements ( good practices ) zu lernen. Mit der Befragung in den fünf ausgewählten Dörfern zu bürgerschaftlichem Engagement soll ein Beitrag zu den Zielen und dem Programm der Brandenburgischen Werkstätten Lokale Agenda 21 geleistet werden, um folgendes zu erreichen: Die nachhaltige Entwicklung von Dörfern soll dahingehend gefördert werden, dass die lokalen Akteure eines Dorfes sich in die Lage versetzen, ihre lokalen Interessen selbst zu artikulieren, die Zukunft des Dorfes selbst zu planen und die eigenen sozialen Kräfte und sonstigen Ressourcen für die Lebendigkeit und Lebensfähigkeit ihres Dorfes zu nutzen. Die AG Dorf verfolgt mit der Studie das Ziel, möglichst gemeinsame Positionen hinsichtlich der Visionen und Leitbilder zu entwickeln die allgemein bekannten Problemlagen (Abwanderung, Überalterung, Infrastrukturdefizite usw.) differenzierter zu analysieren und Beispiele für Dorfaktivierung zu schaffen. Konkrete Fragestellungen der Studie sind: Worin bestehen die Unterschiede zwischen lebendigen und lebensfähigen Dörfern? Was sind die Erfolgskriterien für Lebendigkeit? Welchen Bedarf an Unterstützung hat ein lebendiges Dorf? - 9 -
14 4. Lebendige Dörfer Im folgenden Abschnitt werden die verschiedenen Blickwinkel unter denen man lebendige Dörfer betrachten kann und ihre theoretischen Ausprägungen dargestellt. Nach einer Definition für Dorf und lebendiges Dorf wird aufgearbeitet, in welchen Bereichen sich Lebendigkeit manifestiert. Wer die Lebendigkeit trägt, wird im Abschnitt Akteure behandelt. Abschließend wird aufgezeigt, wie die Prozesse idealerweise gestaltet werden können. In der realen Welt gibt es lebendige Dörfer nicht in ihrer Reinform. Die in der Studie untersuchten Dörfer haben in den verschiedensten Bereichen, bei den unterschiedlichsten Akteuren und dem Prozess der Lebendigkeit an sich ganz unterschiedliche Ausprägungen. Anhand ausgewählter Beispiele wird dies in Kapitel 7 dargestellt. 4.1 Begriffsabgrenzung ''Palmström reist, mit einem Herrn v. Korf, in ein so genanntes Böhmisches Dorf. Unverständlich bleibt ihm alles dort, von dem ersten bis zum letzten Wort. Auch v. Korf (der nur des Reimes wegen ihn begleitet) ist um Rat verlegen. Doch just dieses macht ihn blass vor Glück. Tief entzückt kehrt unser Freund zurück. Und er schreibt in seine Wochenchronik: Wieder ein Erlebnis, voll von Honig!'' Christian Morgenstern ( ) Das Dorf bezeichnet eine kleine ländlich strukturierte Siedlung, die durch eine früher vorherrschende, heute nur noch zum Teil agrarisch geprägte Siedlungs-, Wirtschafts- und Sozialstruktur gekennzeichnet ist. In der Bundesrepublik Deutschland sind die meisten Dörfer in Landgemeinden zusammengefasst. Die Landgemeinde ist eine der untersten Formen der kommunalen Gliederung. Sie kann aus einem Ort oder mehreren Ortsteilen bestehen. Dörfer und Landgemeinden grenzen sich über Einwohnerschwellenwerte oder historischen bzw. verwaltungsrechtlichen (Stadttitel) Gesichtspunkten von Landstädten oder Kleinstädten ab. In Deutschland liegt der Schwellenwert bei Einwohnern (BAER 2001). Für die Typologie traditioneller ländlicher Siedlungen sind die Haus- und Hofformen, die Siedlungslagen, Flurformen und die Siedlungsgrößen und -formen von Bedeutung (HENKEL 2005). Das Dorf ist eine große Gruppensiedlung (im Gegensatz zur Einzelsiedlung). Das Wachstum der Dorfsiedlungen beruht heute auf der Ausweitung der Pendelwanderung und oft auf der Entstehung von Ortsteilen mit reinem Wohncharakter. Um lebendige Dörfer abzugrenzen, bietet sich ein Vergleich mit Dörfern an, denen andere Attribute zugeordnet werden. Im Folgenden werden die Begriffe traditionelles, anonymes, sterbendes und schlafendes Dorf definiert. 2 2 Die Begriffsdefinitionen wurden dem Web-Paket der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) Wege zu einem lebendigen Dorf Wie Bewohnerinnen und Bewohner ihr Dorf mitgestalten können entnommen. Die WSL ist Teil des ETH (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich) Bereichs und nimmt als Forschungsanstalt eine wichtige Brückenfunktion zwischen Wissenschaft und Umsetzung («Praxis») wahr
15 Traditionelles Dorf 1 Die überlieferten Strukturen und Normen bestimmen das Leben im traditionellen Dorf. Die BewohnerInnen müssen sich anpassen und versuchen, ihre Bedürfnisse im vorgegebenen Rahmen zu erfüllen. Die einschränkenden Normen entsprechen der gegenseitigen existenziellen Abhängigkeit und werden deshalb von allen akzeptiert. Das Dorf gibt den BewohnerInnen Sicherheit durch eine beständige Ordnung. Mit der gesellschaftlichen Veränderung und neuen Lebensformen verliert diese Ordnung jedoch ihren existenziellen Sinn. Wird sie dennoch aufrechterhalten, blockiert dies die Erneuerung des Zusammenlebens im Dorf. Qualitäten: normengeleiteter Austausch Anpassung Sicherheit, langsame Innovation Beziehung Anonymes Dorf Im anonymen Dorf bestehen keine verbindlichen Strukturen mehr. Die BewohnerInnen sind auf sich gestellt und haben untereinander kaum Austausch; es herrschen Anonymität und Einzelkämpfertum. Die Leute sind jedoch frei, ihr Leben ganz nach ihren Bedürfnissen zu gestalten. Sie können den dörflichen Lebensraum und seine Funktionen frei nutzen, haben aber kaum Einfluss auf dessen Entwicklung. Sie haben deshalb nur einen schwachen Bezug zu ihrer Umgebung und fühlen sich nicht verantwortlich dafür. Qualitäten: minimaler Austausch frei (Normen) anonym funktional, beziehungslos Lebendiges Dorf Ein lebendiges Dorf zeichnet sich besonders durch zwei Qualitäten aus: engagierte Bewohner und Bewohnerinnen geeignete Möglichkeiten, innovative Ideen auszutauschen und neue Wege der Zusammenarbeit zu finden Im lebendigen Dorf treten neue Formen des Zusammenlebens und der Zusammenarbeit an die Stelle der alten, überkommenen dörflichen Strukturen. Sie bieten den BewohnerInnen die Möglichkeit, ihre Bedürfnisse offen zu äußern und ihren Lebensraum aktiv mitzugestalten. Dadurch entsteht ein laufender Austausch, der das Bewährte mit Innovationen verbindet und das Dorf lebendig erhält. Qualitäten: kommunikativer Austausch frei innovativ Beziehung Quelle: WSL (2006)
16 In den strukturschwachen ländlichen Gebieten, die durch hohe Abwanderung geprägt sind, spricht man auch von sterbenden Dörfern. Sterbende Dörfer können irgendwann tote Dörfer sein. In der Vergangenheit waren dies Dörfer, die aufgrund ihrer Bevölkerungsstruktur und extrem schlechten Wirtschaftsbedingungen nicht mehr in der Lage sind, sich dem Strukturwandel pro-aktiv zu stellen. Sterbende Dörfer sind tendenziell eher im äußeren Verflechtungsraum Brandenburgs anzufinden. Sie weisen eine schrumpfende und alternde Bevölkerung auf. Ein Schlafdorf würde sich im Gegenzug eher im engeren Verflechtungsraum finden. Es verfügt über Neubaugebiete, in denen sich Berufstätige (Familien) ansiedeln, die in den nahe gelegenen (Groß)-Städten arbeiten, sich dort versorgen, und dort zur Schule gehen. Das Dorf hat somit nur noch reine Wohnfunktion. Ein Schlafdorf wird tendenziell die Qualitäten des anonymen Dorfes aufweisen, d.h. geringe Kommunikation untereinander und ein geringes Beziehungsgeflecht. Ein lebendiges Dorf kommuniziert miteinander und lässt innovative und ungewöhnliche Ideen verschiedener sozialer Gruppen zu. Die Bewohner identifizieren sich stark mit dem Dorf. Es erscheint in der realen Welt in großer Vielfalt und Differenziertheit, da sich Lebendigkeit unterschiedlich ausprägt. Diese Formen des Austauschs sind eine Vorraussetzung dafür, das endogene Entwicklungspotenzial auszuschöpfen. LASCHEWSKI, NEU, FOCK ET AL. (2006) nennen vier soziale und institutionelle Entwicklungsfaktoren, die den Erfolg für ein soziales und aktives Dorf bestimmen: zivilgesellschaftliches Engagement, Kooperation zwischen Staat und Bürgern, Lebensqualität (Wohnen, Natur, soziales Leben) und eine unternehmerische Kultur. Ein lebendiges Dorf ist nicht unbedingt lebensfähig, sowie ein lebensfähiges Dorf nicht immer lebendig ist. Lebensfähige Dörfer sind in erster Linie zukunftsfähige Dörfer, deren Dorfentwicklung auf den Erhalt und Stabilität der sechs Funktionen der Daseinsvorsorge ausgelegt ist, d.h. wohnen, arbeiten, sich versorgen, sich bilden, sich erholen, kommunizieren und mobil sein. Zur Lebensfähigkeit gehören eine ausgewogene demografische und soziale Struktur. Dies wird erreicht über Zuzüge. Menschen ziehen aufs Dorf wegen der familienfreundlichen Dorfinfrastruktur und wenn Arbeits- und Ausbildungsplätze verfügbar o- der erreichbar sind
17 4.2 Bürgerengagement und Zivilgesellschaft in Ostdeutschland Insbesondere Bürgerengagement, aber auch Zivilgesellschaft sind Schlüsselthemen im Studienprojekt Lebendige Dörfer in Brandenburg Bürgerbeteiligung im Alltag. Denn was die untersuchten Dörfer so lebendig macht, ist vor allem die freiwillige, [ ] auf das Gemeinwohl hin orientierte, im öffentlichen Raum stattfindende, kooperativ ausgeführte Arbeit (ENQUETE KOMMISSION 2002). Diese Tätigkeiten stellen sich in großer Vielfalt bezüglich Form, Themen, Einsatz und Zielen dar, die sich nicht in eine einzige Schublade stecken lassen. Im Freiwilligen-Survey der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages wird versucht, bürgerschaftliches Engagement zu kategorisieren und deutschlandweit zu erfassen. Der politische Aspekt, der den Begriff der Zivilgesellschaft charakterisiert, ist allerdings in ganz Ostdeutschland und auch in den untersuchten Orten schwach ausgeprägt (BEETZ 2006). Die Art und das Ausmaß des persönlichen Engagements hängen stark von gewissen Rahmenbedingungen ab. So ist die wichtigste Vorraussetzung eine materielle Grundsicherung, die von Ängsten und Nöten des Überlebens befreit (GROTTIAN nach SCHUMACHER 2004). Auch der Zeitfaktor spielt naturgemäß eine wichtige Rolle. Außerdem beeinflussen auch Möglichkeiten der Einflussnahme, die soziale Infrastruktur und auch die Anerkennung des Engagements den Einsatz der Individuen. Vor dem Hintergrund der Rahmenbedingungen betrachtet, leuchten auch die beobachteten Akteursgruppen ein. Mitglieder von Parteien, Verbänden, Vereinen und Kirchen sind besonders stark vertreten. Auch Angehörige der Mittelschicht in besseren beruflichen Positionen und Angestellte im öffentlichen Dienst engagieren sich überproportional. Schwächer vertreten im Bürgerengagement generell sind dagegen Ausländer, Jugendliche, Frauen, ältere Arbeitnehmer, untere Einkommensschichten und Menschen mit wenig Zeit. Hierzu muss bemerkt werden, dass Frauen vielleicht statistisch weniger präsent sind, jedoch in manchen Bereichen, besonders in sozialen Bereichen wesentlich stärker engagiert sind als Männer. Besonders interessant ist neben einem Vergleich zwischen städtischem und ländlichem Umfeld auch der Unterschied zwischen den Alten und den Neuen Bundesländern. Zu DDR-Zeiten wurden bestimmte soziale Aktivitäten stark gefördert. Viele Freizeitaktivitäten wurden im Rahmen der Betriebe organisiert. Heute kann man zum einen beobachten, dass dieses enge Mit- und Füreinander von vielen Menschen stark vermisst wird. Auf den Dörfern hat besonders die personenbezogene Nachbarschaftshilfe noch einen hohen Stellenwert (KUNZ 2003). Insgesamt liegt das Engagement in den Neuen Bundesländern rund 20 % niedriger als in den Alten Ländern (GENSICKE 2005). In den Neuen Ländern ist im Gegensatz zum gesamtdeutschen Trend das bürgerschaftliche Engagement in ländlichen Gebieten (30%) 2 Prozentpunkte niedriger als in den Städten (32%), jedoch etwas höher als in Kleinstädten (28%) (RÜCKERT-JOHN 2005). Der Einzelne profitiert vom Engagement auf vielfältige Weise: durch den Spaß an der Sache, eine intensivere Sozialisation, die Anerkennung, die er oder sie für seine Arbeit erfährt, nicht zuletzt auch durch die Möglichkeiten zu lernen und seine Kompetenzen und Qualifikationen zu erweitern (GENSICKE 2005). SCHUMACHER (2004) hat untersucht, welche Rolle freiwilliges Engagement für den Einzelnen spielt, in welchem Verhältnis es zur Erwerbstätigkeit steht, welche Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Arbeitsformen stattfinden und welcher berufliche und private Nutzen aus dem Engagement gezogen wird. Die Ausprägungen hat sie mit den Begriffen Verstärkung, Ergänzung, Überbrückung, Ausgleich und Alternative Aufgabe bezeichnet
18 Auch für die Gesellschaft als Ganzes ist das bürgerschaftliche Engagement von großem Wert auf verschiedenen Ebenen. Durch die Förderung des Gemeinsinnes wird zur Steigerung des Sozialkapitals beigetragen. Die Plattform für die Entstehung einer kritischen Öffentlichkeit wird erweitert und dadurch auch für den gesellschaftlichen Entwicklungsprozess verfügbar. Durch die Übernahme von bestimmten sozialen Funktionen kann bürgerschaftliches Engagement auch eine Entlastung des Wohlfahrtstaates bedeuten. Auch wenn hier die Gefahr der Instrumentalisierung besteht, ist es sowohl im Interesse des Staates als auch des Einzelnen, Bürgerschaftsengagement zu fördern, und zwar sowohl durch finanzielle Unterstützung als auch durch Verminderung bürokratischer Hürden und Einbindung in (kommunal-) politische Entscheidungen. Gerade in unseren Zeiten des Abbaus des Sozialstaates wird das Thema Bürgerengagement immer mehr an Bedeutung gewinnen
19 4.3 In welchen Bereichen trifft man auf Lebendigkeit? Dorfinfrastruktur Zu lebendigen Dörfern gehört eine gut funktionierende Dorfinfrastruktur. Mit lebendiger Dorfinfrastruktur ist im Kontext der Studie gemeint: das Vorhandensein einer baulichen oder naturräumlichen Besonderheit, sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal, welches ein Publikumsmagnet für das Dorf und die Region sein kann, das Vorhandensein einer Bildungseinrichtung (Kindertagesstätte, Schule), die durch ihre hohe Qualität über die Dorfgrenzen hinaus bekannt und damit ein Magnet für potentielle Neubürger ist, die Bausubstanz der Häuser (wenig Bauruinen), die Nutzung der bestehenden Altbauten (wenig Leerstand), die Umnutzung von Altbausubstanz für mehrere Wohneinheiten (z.b. für Ältere), die Umnutzung und multifunktionale (öffentliche) Nutzung von Altbauten, das Vorhandensein angemessener öffentlicher Räumlichkeiten für alle sozialen Gruppen (Vereine, Jugend, Senioren, Kinder), speziell für die Jugend gibt es einen selbst gestalteten Raum für Kommunikation jenseits der Welt der Erwachsenen, das Vorhandensein einer Gemeinschaftseinrichtung (Saal, Museum, Gemeindehaus), das für gemeinsame Aktivitäten (Feste o.ä.) genutzt werden kann, ein zentraler Platz im Dorfkern, der von der Dorfbevölkerung selbst gestaltet ist und genutzt wird (z.b. als Wochenmarkt, Saisonaler Markt), eine genutzte bzw. nutzbare Kirche. Nahversorgung und Dorfökonomie Lebendige Dörfer haben eine funktionierende Nahversorgung und bemühen sich um eine lebendige Dorfökonomie. Die Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe durch Produzenten (lokale Gewerbetreibende) und Konsumenten (Dorfbewohner) ist ein Kernstück zur Ausnutzung dieses Entwicklungspotenzials. Dazu gehört beispielsweise die bewusste Unterstützung lokaler Gewerbetreibende und deren Kreativität, ihr Angebot nachfrageorientiert zu diversifizieren. Lebendigkeit drückt sich in diesem Bereich wie folgt aus: Angebotsseite Es gibt einen (touristisch) vermarktbaren Trägerstoff, der das Dorf zusammenhält, z.b. eine lokal produzierte Wurst, Textilien, Obstprodukte, (Kunst)-Handwerk, Musik, Theater, Bier, besondere Kräuter etc., Die Dorfgaststätte lockt mit vielseitigen Angeboten und guter (regionaler) Küche sowohl Touristen als auch Dorfbewohner und Vereine an, Gewerbetreibende sind Sponsoren für Aktivitäten im Dorf, Gewerbetreibende engagieren sich bei der Organisation von Dorffesten bzw. bieten ihre lokalen Produkte und Dienstleistungen auf Wochenmärkten, Dorffesten etc. an, Gewerbetreibende rekrutieren ihre Angestellten - soweit möglich - aus dem Dorf, Gewerbetreibende bieten Ausbildungsplätze an,
20 Dorfläden, Dorfbäcker und Gewerbe bieten lokale Produkte an und sind in Bezug auf Angebotsdiversifizierung kreativ und innovativ, Gewerbetreibende nutzen die Dorfhomepage, Innovative Projekte zur Einkommensschaffung sind vorhanden bzw. werden ausprobiert, Tourismus-Potentiale werden erkannt und genutzt. Nachfrageseite Eine lebendige Dorfökonomie und Nahversorgung kann nur dauerhaft existieren, wenn die Verbraucher, in erster Linie die Dorfbewohner und die Vereine, das Angebot wertschätzen und entsprechend honorieren. Die Bewohner haben ein ausgeprägtes Verbraucherbewusstsein für lokal angebotene Produkte und Dienstleistungen und verhalten sich entsprechend. Beispiele dafür sind: Vereine betreiben keine Vereinswirtshäuser, sondern treffen sich in lokalen Gaststätten, Vereine bessern ihre Vereinskasse nicht durch den Verkauf von Getränken, Kuchen und anderen Speisen auf, sondern greifen bei Festen auf die Angebote der lokalen Gewerbetreibenden, Handwerker und Dienstleister zurück, Vereine klüngeln nicht mit einzelnen Gewerbetreibenden, sondern geben jedem prinzipiell die Chance zu profitieren (z.b. Rotationsprinzip), Dorfbewohner identifizieren sich mit lokalen Produkten und wertschätzen diese (sie kaufen in Dorfläden oder beim Dorfbäcker ein), Dorfbewohner bieten eigene Produkte aus dem Garten zum Tausch bzw. am Straßenrand an, tauschen Dienstleistungen und Produkte im Rahmen der Nachbarschaftshilfe Wochenmärkte, Saisonale Märkte und Dorffeste werden von Dorfbewohnern und Verwandten/Bekannten stark frequentiert. Kultur und Bildung Lebendige Kultur- und Bildungsangebote im Dorf sind Anziehungsfaktoren für potentielle Neubürger. Für die ansässige Jugend ist ein interessantes Kulturprogramm ein wichtiger Bleibefaktor. Jugendliche, auch wenn sie woanders Ausbildungsplätze haben, kommen gerne wieder zu Besuch nach Hause, wenn entsprechendes geboten wird. Es verwurzelt mit der Region und erhöht die Chancen, dass sie wieder in ihren Ort zurückkehren. Lebendige Dörfer schaffen es, über eigenes Engagement Kultur- und Bildungsangebote in ihr Dorf zu holen, beispielsweise Kultur- und Bildungsaktivitäten, die alte Traditionen bewahren (Dorfchronik, Heimatmuseum, Fasching, Landwirtschaftliche Produktion und Verarbeitung, Kunsthandwerk, Chor), Kultur und Bildungsangebote für die Jugendlichen (Disco, Pop/Rockkonzerte, Abenteuersport, Openair, Kino etc.), Bildungsangebote, um die organisatorischen Kompetenzen der Engagierten zu verbessern (Zeitmanagement, Finanzierungsmöglichkeiten, rechtliche Regelungen, Organisations- und Kooperationsformen), Bildungsangebote, um die Medien Kompetenz der Dorfbewohner zu verbessern (Neue Medien nutzen lernen, Medien herstellen, Dorfhomepage, Schreibwerkstätten für Presseartikel),
21 Bildungsangebote, um die soziale Kompetenz der Engagierten zu verbessern (Konfliktmanagement, Teamfähigkeit, Vereinsführung, Umgang mit Grenzerfahrungen und Frustration, Motivation, Kommunikation). Natur- und Umweltschutz Lebendige Dörfer sind nachhaltig wirtschaftende Dörfer. Dies drückt sich nicht nur in einem erstarkenden lokalen Kreislaufdenken in der Dorfökonomie und Nahversorgung aus, sondern auch im Umgang mit Energie, Wasser und einheimischen Ressourcen. Da Dörfer im ländlichen Raum meist von schöner vielseitiger Kulturlandschaft umgeben sind, wird die Natur von der ländlichen Bevölkerung wertgeschätzt. Ganz selbstverständlich werden durch eigenes Engagement Grünstreifen auf der Straße, an Dorfplätzen und Hausgärten gepflegt und gestaltet. Darüber hinaus entstehen Projekte, die zu einem lebendigen Umwelt- und Naturschutz beitragen. Folgende Beispiele sind denkbar: Naturnahe Gestaltung der Grünflächen, Parks und Dorfgemeinschaftsflächen, Renaturierung der Flüsse, Ausgeprägtes Umwelt- und Naturschutzverhalten durch Aufstellen von Hinweisschildern, Energiesparendes Bauen (Niedrigenergiehäuser), Nutzung von regenerativer Energie (Solaranlagen, Hackschnitzelheizungen), Dezentralisierung von Abwasserentsorgung, Bewusstseinsschaffende Aktivitäten (Naturwanderungen, Naturkindergarten, Anradeln der Fahrradwege, Bildungsmaßnahmen)
22 4.4 Akteure: Wer trägt Lebendigkeit? Bürger Die spezifischen Merkmale einer traditionellen bäuerlichen Dorfgemeinschaft sind die stark ausgeprägten sozialen Beziehungen (Nachbarschaftsbeziehungen, soziale Kontrolle), starre gesellschaftliche Strukturen, wirtschaftlich sowie sozial, kulturell und religiös verankerte Normensysteme (Bräuche, Sitten, Feste, Vereinswesen, Familienleben). In Familienverbänden und der Nachbarschaft herrschte durch ausgeprägte Nachbarschaftshilfe und rege Austauschbeziehungen ein starkes Vertrauen untereinander. Im Lauf der letzten Jahrhunderte wurde die dörfliche Gemeinschaft in mehreren Entwicklungsperioden einem Wandel unterworfen. Durch Zuzug von jungen Familien aus den Städten kommen neue Menschen mit anderen teilweise konträren Ideen ins Dorf. Alteingesessene Bürger pendeln täglich zu ihren Arbeitsstellen in die nahe gelegene Stadt und sind dort anderen Normen und Werten ausgesetzt. Touristen kommen ins Dorf und bringen neue Umgangsformen mit. Die Auseinandersetzung mit Strukturen außerhalb des Dorfes bewirkt, dass der seit Jahrhunderten entstandene enge Zusammenhalt nicht in gleicher Weise aufrechterhalten bleibt, sondern neue Formen den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit prägen: In lebendigen Dörfern wohnen Menschen, die mit Offenheit und Toleranz auf andere zugehen. Sie bemühen sich, die Eigenarten und Besonderheiten anderer zu akzeptieren und mit den dabei aufkommenden Konflikten konstruktiv umgehen ( Tradition als Veränderung ). Die Menschen bemühen sich um einen kommunikativen Austausch und zwar unabhängig von Alter, Arbeitssituation und Herkunft. Sie zeigen Bereitschaft, miteinander zu arbeiten und zu gestalten und schaffen sich dadurch ein sicheres soziales Netz, in dem sie sich aufgehoben fühlen. Freiwilliges Engagement wird in angemessener Form honoriert und wirkt sich positiv auf die persönliche Lebenssituation im Dorf aus, z.b. durch bessere Integration und hohe Anerkennung der Engagierten durch die Dorfgemeinschaft. Ehrenamtliche Strukturen (Vereine und Kirche) Für die Lebendigkeit eines Dorfes stehen in erster Linie die Vereine und die Kirche. Es gibt aus der Tradition heraus in Dörfern ein reges Vereinsleben, deren Aktivitäten sich auf den politischen, sozialen, kulturellen oder wirtschaftlichen Kontext konzentrieren. Man unterscheidet Vereine, die stark zielgruppenspezifisch und aufgabenfokussiert arbeiten (Jagdverein, Anglerverein, Sportverein, Seniorengruppe) und Vereine, die breiter fokussiert und dorfübergreifend einbringen. Dorfübergreifende Vereine haben einen Anspruch an die allgemeine Dorfentwicklung. Es handelt sich um Vereine wie Jugendclubs, Heimatvereine, Dorfclubs oder ähnliches. Diese entwickeln neue Normen, Werte und Umsetzungsstrategien für das gesamte Dorf. Die Kirchengemeindeaktivitäten sind insbesondere im sozialen und kulturellen Bereich angesiedelt. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei den Aktivitäten für die ältere Bevölkerung, die Jugend und die Kinder. Entscheidend für ein lebendiges Dorf ist, ob die Vereine und Interessengruppen gut zusammen arbeiten und sich gegenseitig unterstützen,
23 es im Dorf einen Dachverein oder Arbeitskreis für Dorfentwicklung gibt, dieser Arbeitskreis/Dachverein eine breite Akzeptanz seitens der Bürger, der Kommunalverwaltung, des Ortsbeirates und höherer Verwaltungsebenen gewinnen kann, ein solcher Dachverein oder Arbeitskreis in der Lage ist, als generationsübergreifende Plattform die Interessen aller Vereine, Initiativen und Generationen zu bündeln und damit Synergien zu nutzen, die Kirche ihre soziale Aufgaben im Bereich der Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit wahrnimmt, die Kirche auch zu innerdörflicher Kommunikation, Wissensvermittlung und Integration über ihre sozialen Aufgaben hinaus beiträgt (aktive Kirchengemeindearbeit). Zugpferde Zugpferde, Pioniere, menschliche Leuchttürme, Innovatoren und Impulsgeber sind nur einige treffende Ausdrücke für die Menschen im Dorf, die zum harten Kern der Engagierten gehören. Sie besetzen verantwortungsvolle Positionen in der Dorfgemeinschaft und verfügen über eine hohe intrinsische Motivation. Ohne sie geht gar nichts. Manchmal geht es trotz ihnen auch nicht voran. Viele Zugpferde haben nach einigen Jahren burn out Syndrome, da sie sich mit vielen freiwillig geleisteten Arbeitsstunden teilweise unter hohem persönlichen Risiko einsetzen. Ihr Einsatz wird von der Dorfgemeinschaft nicht überall anerkannt. Lebendige Dörfer brauchen diese Impulsgeber, die Prozesse tragen und Verantwortung ü- bernehmen. Folgende Beispiele zeigen, was für den Erfolg ihrer Arbeit notwendig ist. Zugpferde arbeiten zumeist ehrenamtlich, daher hängt ihre Motivation von der Anerkennung der Bewohner ab, Es ist lebenswichtig, das Gefühl der Ausgebranntheit erst gar nicht aufkommen zu lassen. Dazu müssen sie in der Lage sein, die breite Masse potentiell Engagierter zu motivieren, zu integrieren, Verantwortung abzugeben, Prozesse anzuregen, zukunftsweisend zu planen und Ressourcen einzuwerben, Der Erfolg eines Zugpferdes hängt von vier Kompetenzfeldern ab: Die fachliche Kompetenz, Medien-Kompetenz, soziale Kompetenz und organisatorische Kompetenz, Da diese Kompetenzen nur selten in einem Menschen komplett vereint sind, spielt es eine Rolle, inwieweit Zugpferde von Außen unterstützt werden bzw. in wie weit sie Unterstützung suchen: von anderen Aktiven aus der Dorfgemeinschaft, von externen Beratern, Kommunaler Verwaltung und Fachleuten aus Politik und Wirtschaft, Hilfreich, aber nicht unbedingt notwendig, ist, wenn der Ortsbürgermeister selbst sich als solches Zugpferd versteht und sich den Hut für den Dorfentwicklungsprozess aufsetzt
24 Kommunale Strukturen Kommunale Strukturen als legitimierter Vertreter der Gesellschaft motivieren die Dörfer zu bürgerschaftlichem Engagement. Sie verstehen sich als Katalysatoren und bieten ihre Dienstleistungen an, um das Engagement konstruktiv zu unterstützen. Das könnte wie folgt aussehen: Sie kümmern sich, in dem sie Foren für überdörflichen Austausch bieten, Gesetzliche Auflagen und Vorschriften werden unkompliziert und zugunsten der Dörfer ausgelegt, Gemeindehäuser werden ohne bürokratische Hindernisse zur Nutzung überlassen, Sie fördern einen transparenten und fairen Mittelvergabeprozess
25 4.5 Wie stellt sich Lebendigkeit im Prozess dar? Im vorigen Abschnitt 4.3 und 4.4 wurden Bereiche und Akteure von Lebendigkeit in Dörfern betrachtet. Dort wurde analysiert, welche konkreten Ergebnisse durch Bürgerengagement geschaffen werden und wer den Prozess der Lebendigkeit trägt. Im folgenden Abschnitt werden die dynamischen Aspekte eines lebendigen Prozesses umschrieben. Die gewählten Indikatoren basieren auch auf Analysen aus Bayern (REICHENBACH-KLINKE & ZEITLER 2005), Österreich (NÖ DORF & STADTERNEUERUNG 2005) und Mecklenburg-Vorpommern (LASCHEWSKI, NEU, FOCK ET AL. 2006). ZEITLER hat mit Hilfe verschiedener Prozessindikatoren die soziale Ebene von vier Dörfern, die in verschiedenen Dorfentwicklungswettbewerben 3 ausgezeichnet wurden, bewertet. Die Niederösterreichische Dorf & Stadterneuerung blickt zurück auf eine 20 Jährige Erfolgsgeschichte der Dorferneuerung. Die Bewegung ist eine von der großen Mehrheit der Bewohner anerkannte Bewegung und wird als die größte Bürgerinitiative Niederösterreichs bezeichnet, und ist auch heute noch äußerst lebendig, so der Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll, ein Gründungsvater dieser Bewegung (NÖ DORF & STADTER- NEUERUNG 2005). LASCHEWSKI, NEU, FOCK ET AL. (2006) berücksichtigen in ihren Handlungsempfehlungen für Dörfer in Mecklenburg-Vorpommern sowohl einzelne Bereiche und Akteure als auch einige von den in der vorliegenden Studie aufgegriffenen Prozessindikatoren für ein lebendiges Dorf. Beteiligungsorientierung Für den Prozess der informellen Raumplanung im ländlichen Raum und seinen Instrumenten (z.b. Dorferneuerung, Leader+ und Regionen Aktiv) sind Partizipation und bottom up Planung mittlerweile eine conditio sine qua non. Mancherorts entsteht jedoch der Eindruck, dass die Beteiligung nur ein abzuhakender Punkt auf der Checkliste ist. Aus dem Zeitmangel heraus wird Partizipation nicht immer im gewünschten Maße umgesetzt. Denn Beteiligung kostet wertvolle Zeit. Zeit, die auch für die Erwerbsarbeit, die Familien oder das eigene Haus benötigt wird. Das Leben in der Provinz ist sowieso schon härter als in der Stadt. Hier muss man mehr leisten und besser sein als in der Stadt. Eine ausgewogene Beteiligung trotz deren Zeitintensität anzustreben ist dennoch wichtig. Gute Projekte sind nicht diejenigen, die viel Geld kosten, sondern jene, die viele Menschen einbinden sind sich die 60 Bürgermeister, Dorferneuerer und Bürger auf dem Themenabend der niederösterreichischen Dorf&Stadterneuerung einig (NÖ DORF & STADTERNEUERUNG 2005). Viele Menschen aus vielen verschiedenen sozialen Gruppen sollen die Möglichkeit haben, sich am Dorfentwicklungs- und Gestaltungsprozess zu beteiligen. Eine Minimalanforderung an Partizipation ist die Informationsbereitstellung. Entscheidungsträger informieren über den Entwicklungsprozess, um Transparenz und damit Fairness zu schaffen. Ein transparenter Prozess, z.b. während eines Dorferneuerungsprogrammes ist für die Beteiligten wichtiger, als das, was letztlich für sie persönlich dabei herausspringt. Zumindest sind die Reaktionen derjenigen, die von dem Programm nicht profitieren konnten, weniger heftig als die Reaktionen der Nichtbeteiligten in einem Prozess, der in ihrem Sinne ein Fair play war. Identitätsbildung Jeder Platz im Dorf und jeder Gegenstand ist mit einer sozialen Bedeutung beladen. [...], alles hat seinen Ursprung[...]. Diese Art Verdichtung von Werten und Bedeutungen ist nur in 3 Die im Rahmen der Studie untersuchten Wettbewerbe waren Unser Dorf soll schöner werden, Europäischer Dorferneuerungspreis, Bürgerorientierte Kommune und Agenda
26 einer kleinen Gemeinschaft möglich, deren innere Wechselwirkungen ein enormes Maß an Wissen vermitteln, welches man unglücklicherweise Traditionen nennt. Als ob es sich um etwas Altes und Vergangenes handele. Vielleicht das auch. Doch befinden wir uns in einer Zeit des Umbruchs, in der uns auf einmal der Wert des Wissens aus den Regionen klar wird. schreibt Juha KUISMA in einem Fotoband über ein kleines Dorf in Finnland (KOIVIKKO 2002). Identitätsbildung in einer modernen globalisierten Welt geht also nicht einher mit Tradition im Sinne von Bewahrung sondern von Veränderung. Identität und Bindung entstehen in einem Prozess der (innerdörflichen) Kommunikation. Identität entsteht zwischen Menschen, die ihre aktuellen Bedürfnisse artikulieren. Für die Identitätsbildung ist es entscheidend, die Zugezogenen in die Dorfgemeinschaft mit einzubeziehen und sich ihnen nicht zu verschließen. Die Neuen sind aufgefordert, ihre neuen, innovativen und sogar widersprüchlichen I- deen mitzuteilen. Wenn sie dies nicht tun oder nicht erhört werden, identifizieren sie sich nicht mit dem Dorf. Wenn der Identifikationsprozess ausbleibt, engagieren sie sich auch nicht im vollen Maße. Der Blick über den Tellerrand hilft. In Italien freut man sich, wie das traditionelle Weinlokal zu einem Kunsthof mutiert oder die jahrelang vernachlässigte Dorf-Ölmühle wieder Olivenöl presst. Und man muss schmunzeln, wenn die Alten des Dorfes, auf ihren Tuffsteinen sitzend, neugierig kommentieren, was die junge Generation mit ihrem Dorf jetzt alles so anstellt. Akzeptanz Für die Umsetzung von Projekten braucht man eine breite Akzeptanz. Entscheidungsträger, kommunale Verwaltung und Bürger bilden eine gemeinsame Position hinsichtlich der Projekte. Um Akzeptanz zu gewinnen, findet ein intensiver Austausch zwischen den Akteuren statt. Wertesysteme werden abgeglichen und Normen gesetzt. Im Bereich Umwelt- und Naturschutz ist breite Akzeptanz sehr wichtig. Hier treffen oftmals konträre Zielvorstellungen aufeinander (z.b. grüne Gentechnik versus Ökologischer Landbau). Dies kann die Dorfgemeinschaft spalten bzw. ein geschlossenes Dorf in der Region zu einer einsamen Insel werden lassen. Öffentlichkeitswirksamkeit ( Visibility ) Lebendige Dörfer machen ihr Engagement sichtbar. Sie verfügen über eine informative und aktualisierte Homepage. Die Präsenz drückt sich in häufigen Berichten in der Lokalpresse oder fernsehen aus. Sie erkennen, dass auch gut ausgearbeitete Broschüren und Materialien über das Dorf zu Öffentlichkeitswirksamkeit beitragen. Zukunftsorientierung Pläne, Visionen und Leitbilder gehören zum Standardinstrumentarium eines lebendigen Dorfes. Pläne werden nicht nur auf Fördermittelanträge zugeschnitten. Auch kleinere kostenextensive Maßnahmen erlangen in der Dorfentwicklungsplanung Bedeutung. Selbsthilfeaktivitäten ohne Förderung sind ein guter Schritt in Richtung Zukunftsorientierung. Ganz ohne Fördermittel ist jedoch kein Entwicklungsprozess langfristig erfolgreich. Daher werden Förderungen (z.b. für den Ausbau eines Gemeindehauses) mit sinnvollen Nutzungskonzepten verbunden, für die jeweils auch ein Plan B vorgelegt werden kann. Die Fördermittel werden sparsam (effizient) verwandt und durch Eigenleistungen ersetzt, damit für Nachfolgemaßnahmen (Unterhalt, Vereinstätigkeiten) noch Geld übrig ist. Kontinuität der Aktivitäten und Lernfähigkeit Unter diesem Blickwinkel wird betrachtet, wie das Dorf auf Brüche oder Rückschläge reagiert, wie mit Konflikten während der Planung und Umsetzung umgegangen und ob die Men
27 schen bei der Umsetzung von Maßnahmen Kontinuität zeigen. Besteht im Dorf eine hohe Lernfähigkeit, so werden Konflikte als positiver Anstoß für notwendige Veränderungen gesehen. Bei gering ausgeprägter Lernfähigkeit besteht im Falle von Konflikten und Umsetzungsschwierigkeiten die Tendenz zur Stagnation. Es findet ein Rückzug auf Bewährtes und Vertrautes statt. Diese Stagnation kann dazu führen, dass Konflikte, die nicht ausgetragen werden, Gräben und eine gespaltene Dorfgemeinschaft hinterlassen. Diese Gräben wieder aufzubrechen ist eine sehr schwierige Aufgabe. Überörtliche Vernetzung Die Gründe für verstärkte Kooperation liegen angesichts der angespannten Haushaltslage auf der Hand. Es geht nicht nur um Vernetzung der Kommunen, sondern um die Vernetzung der Graswurzelebene wie der Ortsteile oder Dörfer. Durch Dorf-Kooperationen können Fördermittel gemeinsam akquiriert und gerechter verteilt werden. Das eine Dorf baut den Jugendclub aus, das Andere erweitert den Kindergarten. Somit werden Überkapazitäten verhindert und ein spannender Austausch durch gemeinsame Aktivitäten geschaffen. In lebendigen Dörfern herrscht kein Kirchturmdenken. Überdörfliche Lösungen werden den rein Dörflichen vorgezogen. Nachbarorte konsultieren sich bei der Erarbeitung von neuen Projekten und unterstützen sich in der Problembearbeitung. Der Ausgangspunkt für effektive Kooperation ist ein gemeinsam definiertes Problem und eine Zweck/Ergebnisdiskussion, wie das Problem zu lösen ist. Kooperationen können sehr projektbezogen und kurzfristig sein (wie z.b. die Absprache von Terminen für Dorffeste) oder einen längerfristigen Zweck verfolgen (z.b. die dezentrale Abwasserversorgung gemeinsam zu planen oder eine Musikschule aufzubauen). Es könnte ein gemeinsames Interesse bestehen, sich projektspezifisch zu vernetzen (z.b. Erfahrungsaustausch im Kultur- und Bildungsbereich oder im Umweltschutz). Der Austausch mit der Region, mit Europa und anderen Teilen der Welt bereichern das Dorfleben. Mit Achtung schaut man auf die Schweden, die es geschafft haben (sowie andere Länder wie Finnland, Dänemark, Estland, etc.) eine schlagkräftige Dorfaktionsbewegung zu bilden, die mehr als Dorfaktionsgruppen zu einem Netzwerk zusammenfasst, welches sogar auf nationaler Ebene in form eines ländlichen Parlamentes Einfluss nimmt (KRAMBACH 2005)
28 5. Vorgehensweise 5.1 Vorbereitung des Themas und der Feldforschung Die Projektverantwortlichen planen die Befragungswoche mit den Ansprechpartnern in den Dörfern (Ansprechpartner sind i.d.r. die Bürgermeisterin oder die Vorstände der Vereine). Im südlichen Brandenburg koordiniert und begleitet Frau Carola Werner (KooperationsAnstiftung Lauchhammer) das Gespräch mit drei Dörfern. Organisatorische Aspekte (Werbung der Interviewpartner, Arbeitsraum, etc.) werden geklärt. Im Sinne der Partizipativen Aktionsforschung werden die Inhalte der Befragung mit den Dörfern abgestimmt und die Befragungsergebnisse mit den Dörfern geteilt. So fließen in die Befragung die spezifischen Wünsche der Dörfer zu bestimmten Fragestellungen ein. Die Ausrichtung einer stabilen Jugendarbeit sind z.b. für Fürstlich Drehna und Wulkow von besonderem Interesse. In Deetz und Wulkow liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit der Vereine. In Kroppen will man mit Hilfe der Befragungen auch die Gründe für abnehmendes Engagement genauer erfasst wissen. Alle Dörfer erhalten nach der Befragung eine Vor-Ort-Präsentation und einen ca. 50 Seiten starken Dorfergebnisbericht. Während einer Vorbereitungswoche werden Impulsreferate gehalten und im Hinblick auf die Bedeutung des jeweiligen Themas für lebendige Dörfer reflektiert. Die Studierenden verfassen Hausarbeiten zu folgenden Themen: 1. Formelle Raumplanung in Brandenburg 2. Informelle Raumplanungsstrukturen in Brandenburg 3. Bürgerschaftliches Engagement in Ostdeutschland 4. Praxisbeispiele der Dorfentwicklung in Brandenburg 5. Dorfentwicklung: Erfahrungen aus skandinavischen Ländern 6. Demographie, Beschäftigung und Bildung in Brandenburg 7. Daseinsgrundfunktionen im ländlichen Raum Brandenburgs 8. Innovationen und Innovativität im ländlichen Raum 9. Landnutzung und Landwirtschaft in Brandenburg Neben inhaltlichen Diskussionen werden methodische Übungen zu Interviewtechniken eingeübt. Dorfsteckbriefe werden analysiert, um sich mit der geografischen und demographischen Struktur der Dörfer vertraut zu machen. Abbildung 1 Einübung der Küchentischgespräche
29 5.2 Teilnehmende Dörfer Die an der Studie teilnehmenden Dörfer werden über Mitglieder der AG Dorf ausgewählt. Es werden solche Dörfer gewählt, die sich durch Formen des bürgerschaftlichen Engagements in Presse, Veranstaltungen o.ä. dargestellt haben, mit denen bereits intensive bzw. lose Kontakte bestehen, und die annehmen, aus der Bürgerbefragung einen Nutzen ziehen zu können. Selbstverständlich gibt es noch viele andere lebendige Dörfer in Brandenburg, aus denen man ebenso viel hätte lernen können. Die Studie beschränkt sich jedoch auf diese fünf Dörfer. Folgende Dörfer nahmen an der Studie teil. 4 Tabelle 1 Untersuchte Dörfer im Land Brandenburg Dorf/Ortsteil Gemeindeverwaltung Landkreis Einwohner 2006 Deetz Fürstlich Drehna OT Gemeinde Groß Kreutz (Havel) (Orts) BürgermeisterIn Potsdam-Mittelmark 989 Herr Süring OT Stadt Luckau Dahme-Spreewald 294 Frau Haupt Kroppen Gemeinde Kroppen Oberspreewald- Lausitz Maasdorf OT Stadt Bad Liebenwerda 762 Frau Bodack Elbe-Elster 478 Herr Lehmann Wulkow OT Stadt Lebus Märkisch-Oderland 232 Herr Gerlach Abbildung 2 Lage der untersuchten Dörfer Deetz Wulkow Fürstlich Drehna Maasdorf Kroppen 4 Detaillierte Informationen zu den Dörfern befinden sich in den Dorfberichten, welche jedoch eher für das Dorf selbst von Interesse sind
30 5.3 Partizipation Lernen - Aktion In Anlehnung an die Schweizer Dorfentwicklungsmethodik der Landwirtschaftlichen Beratungszentrale Lindau (LBL) wird eine PLA Projektwoche (aktivierende Befragung) durchgeführt. PLA steht dabei für Partizipation Lernen Aktion. Da die Ergebnisse vor Ort analysiert und präsentiert werden, haben die Dörfer die Möglichkeit, direkt und zeitnah mit dem Interviewerteam die Ergebnisse zu reflektieren. Abbildung 3 Präsentation der Zwischenergebnisse in Maasdorf Der überwiegende Teil des Interviews beschäftigt sich mit der Wahrnehmung der Situation des Dorfes im Sinne einer Stärken-Schwächen-Analyse. Das Interview wird nach kurzer Zeit auf die Zukunft gelenkt. Es wird gefragt, welche Möglichkeiten die Bewohner sehen, ihre Geschicke selbst in die Hand zu nehmen. Dieser Teil der Befragung, der Grundlage für weitere Planungs- und Entwicklungsprozesse sein kann, nimmt ca. 1/3 der Gesprächsdauer ein. In der Schweiz wird die PLA Projektwoche als Methode der Dorfentwicklung seit 1991 eingesetzt (LBL 2001). Das gesamte Projekt verläuft (Abbildung 4) in drei Phasen. Nach der Befragungsphase (PLA Projektwoche) erfolgt ein Evaluierungstreffen zusammen mit Kommunalverwaltung, Vertretern des Dorfes, interessierten Bürgern, Studierenden und dem PLA Berater. Im Rahmen des Treffens wird diskutiert, in welcher Weise die Befragung aktiviert hat und welche Aktivitäten oder Kleinprojekte eventuell durchgeführt werden. Im Anschluss daran erfolgt die eigentliche Arbeit (Durchführungsphase). Hier treffen sich Interessengruppen bzw. Vereine des Dorfes mit kommunalen Vertretern und arbeiten die Projekte aus. Dabei ist es zunächst unerheblich, ob Fördermittel beantragt werden oder ob es sich um reine Selbsthilfeprojekte handelt. Fördermittel und die Unterstützung bei der Akquirierung von Mitteln sind jedoch ein zentraler Hebel für die Umsetzung der umfangreicheren Projektideen. In der Bundesrepublik Deutschland wird diese Methode von verschiedenen Organisationen in Niedersachsen (Landwirtschaftskammer Weser-Ems), Schleswig-Holstein (Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt der Nordelbischen Kirche) und Baden-Württemberg (Landesanstalt für Entwicklung Ländlicher Räume) zur Dorfentwicklungsplanung und Stadtteilplanung eingesetzt. Die Erfahrungen mit der Methodik sind mehrfach dokumentiert und publiziert (z.b. FRIEDRICH & KÜGLER 1999; KETELHODT 2003, KORF 2004, STÖBER 2005)
31 Abbildung 4 Ablauf einer PLA Projektwoche Vorbereitungsphase PLA Woche Durchführungsphase... P r o j e k t b e g i n n 6 Treffen in Dörfern 6 Monate 7 Tage: Sa bis Fr 1 Woche E v a l u i e r u n g s t r e f f e n Treffen mit Interessengruppen 2 bis 4 Jahre Weitere Arbeit in Initiativen Lokale Vertreter PLA Berater Lokale Vertreter PLA Berater Studierende Interessierte Bürger Lokale Vertreter Interessengruppen Lokale Vereine Quelle: in Anlehnung an LBL (2001)
32 5.4 Küchentischgespräche und Experteninterviews Im Vorfeld werden Leitfäden für die so genannten Küchentischgespräche entwickelt. Die Leitfäden basieren auf fünf Hauptfragen und einigen Fragen, die als Gedächtnisstütze dienen (siehe Anhang 1). Die Befragungsmethodik ist offener Natur und gewährt somit eine nichtdirektive Gesprächsführung. Die Gespräche verlaufen sehr unterschiedlich. Die persönliche Sichtweise der Interviewpartner bestimmt den Gesprächsverlauf. Der Interviewpartner beschreibt die Situation im Dorf jeweils bezogen auf sein unmittelbares Handlungs- und Wissensfeld. Abbildung 5 Küchentischgespräch mit Bootsausbauerfamilie in Deetz Die fünf Hauptfragen lauten: 1. Was läuft gut? Welche Potentiale gibt es? 2. Was läuft nicht so gut? Wo liegen die Probleme/Schwächen? Was vermissen Sie? 3. Was wünschen Sie sich für Ihr Dorf? 4. Welche Vorschläge/konkrete Projektideen haben Sie? (zum selber tun, zusammen mit Nachbarn, Behörden, Vereinen) 5. Wenn Sie drei Wünsche für Ihr Dorf offen hätten, was würden Sie sich wünschen? (Frage nach verrückten Ideen und Visionen ausdrücklich gestellt) Experteninterviews werden mit ausgewählten Vertretern des Dorfes geführt. Ein Leitfaden wird im Vorfeld entwickelt (siehe Anhang 2). Von Experten wird erwartet, dass sie weniger eine persönliche Sichtweise über das Dorf als vielmehr einen übergeordneten Einblick im Sinne einer Draufsicht auf das Dorf (Vogelperspektive) gewähren. Ausgewertet werden die Experteninterviews in der gleichen Weise wie die Küchentischgespräche. Zusätzlich werden sie auf Tonträger aufgenommen und ins Schriftliche übertragen (transkribiert). Nach Abschluss der Interviewphase werden die Ergebnisse der Befragungen inhaltlich ausgewertet. Die Kernaussagen der Gespräche werden auf farbige Moderationskarten geschrieben: Positive Aussagen (Stärken) Weiß Negative Aussagen (Probleme, Schwächen) Wünsche Projektideen Verrückte Ideen Gelb Grün Blau Rot
33 Pro Interview werden ca Karten geschrieben. Durch das Sortieren der verschiedenfarbigen Moderationskarten entstehen Schwerpunkte zu folgenden Themen: 1. Dorfinfrastruktur 2. Dorfökonomie Arbeiten im Dorf Tourismuspotenziale - Nahversorgung 3. Kultur und Bildung Jugend- und Kinderförderung 4. Natur- und Umweltschutz 5. Bürger Miteinander Kommunikation - Konflikte 6. Vereine Bürgerengagement - Kirche 7. Kommunale Politik und Verwaltung Dorf in der Region Abbildung 6 Auswertung der Interviews in Fürstlich Drehna
34 Mit dem Ziel, aussagekräftige Poster zu gestalten werden die Kernaussagen innerhalb eines jeden Themas erneut sortiert, strukturiert und entsprechende Poster gestaltet. Wichtig dabei ist, dass alle Kernaussagen der Interviews verwertet werden. Es ist Teil der Methodik, jede einzelne Aussage auf den Postern festzuhalten. Durch den Strukturierungs- und Analyseprozess werden die Aussagen der Bürger zunehmend anonymisiert. Sie sind letzten Endes nicht mehr einem bestimmten Interviewpartner zuordenbar. Abbildung 7 Analyse der Kernaussagen in Kroppen Abschließend werden die Poster sinnvoll und ansprechend gestaltet. Die Poster werden für den Dorfbericht sauber abfotografiert. Die Originale bleiben im Dorf. Ein Posterbeispiel findet sich in Abbildung 9. Abbildung 8 Gestaltung der Poster Wulkow
35 Abbildung 9 Beispielposter: Maasdorfer Miteinander
36 5.5 Ergänzender Fragebogen Um nicht ausschließlich qualitative Aussagen zu sammeln, wird ein quantitativer Fragebogen entwickelt und im Anschluss an jedes Küchentischgespräch abgefragt. Die Erfassung der sozialstatistischen Daten ermöglicht u.a. eine Auswertung nach Alter, Geschlecht und Bildungsstand. Aufgrund der geringen Anzahl an Bögen pro Dorf (max. 56 in Kroppen) wird darauf jedoch verzichtet. Der Fragebogen enthält Fragen zur Identität mit dem Dorf, zur Bewertung der eigenen Aktivitäten und des bürgerschaftlichem Engagements. Die Wahrnehmung des Dorfes und inwieweit verschiedene Ausstattungen und Aktivitäten als wichtig für die Lebendigkeit eines Dorfes erachtet werden (siehe Anhang 3) sind weitere Bestandteile des Fragebogens. Insgesamt werden 164 Interviews geführt, die meisten davon sind Einzelgespräche. Die Gruppengespräche finden überwiegend mit Jugendlichen, aber auch mit der Freiwilligen Feuerwehr, dem Heimat- und Sportverein und der Volkssolidarität statt. Es sind 163 Interviewbögen ausgewertet, wobei die 11 Bögen aus Maasdorf nur eingeschränkt verwendet wurden. Tabelle 2 Anzahl der Interviews in den Dörfern Dorf/Ortsteil Gruppengespräche Einzelgespräche Experteninterview Auswertbare Interviewbögen Deetz 28 4 (Heimatverein, FFW, Cheer Leader Gruppe, Volkssolidarität) 3 35 Fürstlich Drehna 24 1 (Jugendclub) 2 27 Kroppen 46 1 (Jugendclub) 3 56 Maasdorf 15 2 (Jugendclub, FFW) 4 11 Wulkow 28 1 (Jugendliche) 2 34 Gesamt
37 6. Kurzprofile der Dörfer Im folgenden Kapitel werden die Dorfsteckbriefe und die ausgewerteten Fragebögen zusammenfassend dargestellt. Detaillierte Information über die Dörfer enthalten die den Dörfern zur Verfügung gestellten Dorfberichte. In Tabelle 3 werden die Siedlungsstrukturtypen und Demographietypen der untersuchten Dörfer gezeigt. Drei Dörfer gehören zum Siedlungsstrukturtyp IV, d.h. zu verdichteten Räumen in ländlichen Kreisen. Wulkow und Kroppen befinden sich aufgrund ihrer Nähe zu den Großstädten Frankfurt/Oder und Dresden in ländlichen Kreisen von verstädterten Räumen. Deetz liegt im engeren Verflechtungsraum von Berlin und Potsdam und zählt zum Demographietyp 2 (suburbaner Wohnort mit hohen Wachstumserwartungen). Maasdorf und Fürstlich Drehna sind Ortsteile von schrumpfenden und alternden Städten und Gemeinden mit hoher Abwanderung. Für Wulkow und Kroppen ist keine Berechnung möglich, da die Methodik erst Gemeinden über Einwohner erfassen kann. Tabelle 3 Siedlungsstrukturtypen und Demographietypen Dorf/Ortsteil Gemeinde/ Stadt/ Landkreis Einwohner Gemeinde/Stadt (2003), davon Dorf in % Siedlungsstrukturtyp Demografietyp Deetz Groß Kreutz (Havel) (PM) (Deetz 12%) IV 2 Fürstlich Drehna Kroppen Maasdorf Wulkow Luckau (DS) Kroppen (OSL) Bad Liebenwerda (EE) Lebus (MOL) Legende: Siedlungsstrukturtyp IV Siedlungsstrukturtyp VII Demographietyp 2 Demographietyp 4 nv (FD 3%) 778 (Kroppen 100%) (Maasdorf 4%) (Wulkow 7%) IV 4 IV nv VII 4 Agglomerationsräume Ländliche Kreise Verstädterte Räume Ländliche Kreise Suburbane Wohnorte mit hohen Wachstumserwartungen Schrumpfende und alternde Städte und Gemeinden mit hoher Abwanderung Nicht verfügbare Daten, da der Demographietyp erst für Gemeinden ab einer Mindestgröße von Einwohnern berechnet wird. Quelle: berechnet nach Bertelsmann Stiftung, Wegweiser Demografischer Wandel (2005) VII nv
38 6.1 Identität und Engagement Der erste Themenblock bezieht sich auf die eigene Identität und die Aktivitäten der Befragten. Ziel der Fragen ist herauszufinden, wie stark die Befragten mit dem Dorf verwurzelt sind und in wie weit sie sich für ihr Dorf engagieren. Die erste Frage lautet, ob man gerne im Dorf lebt. Der Großteil der Befragten lebt sehr gern (82-100%) in ihrem Dorf. In Deetz und Maasdorf gibt es keine einzige befragte Person, die sich im Dorf eher weniger wohl fühlt. Auch in Fürstlich Drehna, Kroppen und Wulkow ist dieser Anteil mit 4% bis maximal 9% sehr gering. Abbildung 10 Leben in Maasdorf Leben Sie gerne in Maasdorf? Parkschlösschen Maasdorf 100% sicher eher ja eher nein nein Abbildung 11 Leben in Deetz Leben Sie gerne in Deetz? 9% 0% 0% Blick vom Mühlenberg auf die Havel - Deetz 91% sicher eher ja eher nein nein
39 Abbildung 12 Leben in Fürstlich Drehna Leben Sie gerne in Fürstlich Drehna? 11% 4% 0% sicher eher nein 85% eher ja nein Wasserschloss Fürstlich Drehna Abbildung 13 Leben in Kroppen Leben Sie gerne in Kroppen? 13% 5% 0% 82% sicher eher ja eher nein nein Evangelische Kirche Kroppen (1720) Abbildung 14 Leben in Wulkow Leben Sie gerne in Wulkow? 6% 9% 0% 85% sicher eher ja eher nein nein Dass sich die Meisten in ihren Dörfern Wohlfühlen, sieht man auch an der nächsten Aussage. Mindestens 73% der Befragten werden in den nächsten Jahren auf keinen Fall weg ziehen (Tabelle 4)
40 Tabelle 4 Werden Sie in den nächsten Jahren das Dorf verlassen? Dorf/Ortsteil Ich werde auf keinen Fall wegziehen Ich werde eher nicht wegziehen Wahrscheinlich werde ich wegziehen Ganz bestimmt werde ich wegziehen Deetz 88% 6% 3% 3% Fürstlich Drehna 85% 11% 4% 0% Kroppen 73% 11% 7% 9% Maasdorf 73% 0% 9% 18% Wulkow 73% 6% 9% 12% In den fünf Dörfern sind sehr viele Leute engagiert % der Befragten gaben an sehr engagiert zu sein. Mindestens Zwei Drittel der Bewohner sind am Engagement beteiligt. Da sich die stärker Engagierten auch tendenziell eher für ein Interview eingeschrieben haben, ist diese Zahl nicht unbedingt repräsentativ für das Gesamtdorf. In Kroppen beispielsweise wird geschätzt, dass sich nicht 70% sondern nur 50% der Bewohner engagieren. 6% (ca. 50 Personen) der Bewohner zählen zum ganz harten Kern. Tabelle 5 Engagieren Sie sich im Dorf? Dorf/Ortsteil Ich engagiere mich sehr stark Ich engagiere mich Ich engagiere mich weniger Ich engagiere mich gar nicht Deetz 60% 17% 14% 9% Fürstlich Drehna 36% 30% 15% 19% Kroppen 52% 18% 14% 16% Maasdorf 55% 45% 0% 0% Wulkow 53% 35% 6% 6% Der Großteil der Befragten, der sich mehr oder weniger engagiert, stellt seine Kraft im Bereich der Nachbarschaftshilfe zur Verfügung, dicht gefolgt von den Vereinen. Am geringsten ist das Engagement in der Kommunalpolitik (Beteiligung an Dorfversammlungen, Ortsbeiratssitzungen, etc.). Das Engagement in der Kirche liegt im mittleren Bereich. Mehrfachantworten sind möglich. Tabelle 6 Wo erfolgt das Engagement? Dorf/Ortsteil Vereine Nachbarschaftshilfe Kirche Kommunale Politik Sonstiges Deetz 44% 33% 15% 8% 0% Fürstlich Drehna 33% 47% 9% 11% 0% Kroppen 35% 38% 17% 10% 0% Maasdorf 42% 43% 10% 5% 0% Wulkow 32% 46% 10% 9% 3%
41 6.2 Wahrnehmungen des Dorfes Der folgende Fragenblock zielt darauf ab, herauszufinden, wie die Bewohner ihren Ort wahrnehmen. In welchen Bereichen stimmen die Bewohner den verschiedenen Aussagen zu, welche Aussagen treffen weniger zu. Das Ergebnis ist ein Dorfprofil, in dem erfasst wird, was von den Bewohnern als sehr ausgeprägt und weniger stark ausgeprägt wahrgenommen wird. Da Dörfer in großer Vielfalt und Differenziertheit erscheinen und daher die Profile für jedes Dorf sehr unterschiedlich sind, werden im Folgenden vier einzelne Dorfprofile 5 dargestellt. In den Abbildungen erkennt man Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Im folgenden Text wird lediglich auf die Besonderheiten der untersuchten Dörfer eingegangen. In allen Dörfern zeigen die meisten Befragten ihren Freunden gerne ihr Dorf und fühlen eine sehr starke Verbundenheit. Relativ große Zustimmung gibt es für die Aussagen, dass es starke Zugpferde gibt, die die Dorfgemeinschaft stützen, dass das Miteinander der Generationen gut ist und Selbsthilfe groß geschrieben wird. Eine differenzierte Einschätzung haben die Befragten zu den Aussagen, dass es viele engagierte Bürger gibt, dass Konflikte gut gelöst werden, Zugezogene gut integriert werden, die Menschen aufgeschlossen gegenüber Touristen sind und dass man vielfältige überregionale Kontakte hat. Eine eher niedrige Bewertung geben die Wulkower und Fürstlich Drehnaer ihrem Dorf in Bezug auf konstruktive Konfliktlösung. Eine Besonderheit von Kroppen im Vergleich zu den anderen untersuchten Orten ist die Wahrnehmung, dass Jugendliche das Dorfleben aktiv mitgestalten können. In den anderen drei Dörfern (Deetz, Fürstlich Drehna und Wulkow) sind diese Möglichkeiten für die Jugend eher limitiert. Der erwartete starke Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft bestätigt sich in Kroppen und Deetz. In Fürstlich Drehna und Wulkow ist der Zusammenhalt nach der Wende stark rückläufig, welches vermutlich in den noch nicht vollständig bewältigten Konflikten in der Dorfgemeinschaft zu begründen ist. Wulkow hat seine Stärken in der überörtlichen Vernetzung. Als einziges Dorf werden die vielfältigen überregionalen Kontakte von fast allen Befragten positiv bewertet. In den anderen Dörfern findet diese Aussage keine Zustimmung. In allen Dörfern findet die Aussage, dass man eng mit Nachbargemeinden zusammenarbeitet, sehr wenig Zustimmung. Dies gilt sogar für das überregional vernetzte Wulkow. Die große Mehrheit stimmt eher nicht bzw. überhaupt nicht zu, dass die Bürger das Sagen haben. Die Problematik der Großgemeinde, aber auch die mangelnde Nutzung der Mitgestaltungsangebote in den Dorfversammlungen, wird im nächsten Kapitel erörtert. Eine Besonderheit von Deetz im Vergleich zu den anderen untersuchten Orten ist die Wahrnehmung, dass Deetz eine gute Zukunft hat und sich gut und oft öffentlich präsentiert. Letzteres ist vor allem den Vereinen, insbesondere dem Sportverein, aber auch Einzelpersonen zu verdanken. In Fürstlich Drehna findet sich die Dorfgemeinschaft zurzeit nicht sehr lebendig. Drehnas Stärken sind der Tourismus, das lokale Gewerbe und die vielen Potenziale. Letztere sind erkannt, aber noch nicht völlig ausgeschöpft. Gut dabei ist, dass es wie die Wulkower und Kroppener sehr aufgeschlossen gegenüber Touristen ist. 5 Für Maasdorf wird aufgrund der niedrigen Anzahl an Fragebögen an dieser Stelle keine quantitative Auswertung gemacht
42 Abbildung 15 Dorfprofil - Deetz aus der Sicht seiner Bewohner zeigt man Freunden gerne 94% 6% starke Verbundenheit viele Potentiale 74% 71% 20% 3% 17% 6% 6% 3% gute Zukunft 63% 26% 11% präsentiert sich gut starke Zugpferde 63% 60% 26% 20% 9% 3% 11% 3% 6% gutes Miteinander der Generationen 46% 43% 9% 3% Selbsthilfe großgeschrieben starker Zusammenhalt 46% 40% 37% 37% 14% 3% 17% 3% 3% viele engagierte Bürger 40% 23% 31% 6% gute Konfliktlösung Integration von Neuen 37% 37% 29% 26% 20% 31% 9% 6% 3% 3% aufgeschlossen ggü. Touristen 31% 37% 23% 9% Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden 31% 20% 23% 17% 9% Jugend gestaltet mit 29% 26% 34% 6% 6% seit Wende bergauf 23% 46% 17% 6% 9% vielfältige überregionale Kontakte 14% 34% 26% 23% 3% Bürger haben das Sagen 14% 14% 43% 29% 0% 20% 40% 60% 80% 100% stimme voll zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu keine Angabe
43 Abbildung 16 Dorfprofil - Kroppen aus der Sicht seiner Bewohner Es wird nur die Antwortkategorie stimme voll zu dargestellt. Kroppen aus der Sicht seiner Bewohner aufgeschlossen ggü. Touristen zeigt man Freunden gerne Jugend gestaltet mit Selbsthilfe großgeschrieben viele engagierte Bürger gutes Miteinander der Generationen präsentiert sich gut starke Zugpferde gute Zukunft starker Zusammenhalt starke Verbundenheit viele Potentiale gute Konfliktlösung Integration von Neuen seit Wende bergauf Bürger haben das Sagen 98% 98% 94% 94% 93% 93% 93% 93% 89% 84% 84% 77% 71% 69% 66% 66% vielfältige überregionale Kontakte 48% Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden 29% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
44 Abbildung 17 Dorfprofil - Wulkow aus der Sicht seiner Bewohner Wulkow aus der Sicht seiner Bewohner stimme voll zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu keine Angabe starke Verbundenheit 76% 21% 3% vielfältige überregionale Kontakte aufgeschlossen ggü. Touristen 74% 68% 21% 3% 18% 9% 6% 3% gutes Miteinander der Generationen 65% 21% 12% 3% starke Zugpferde 62% 26% 9% 3% viele Potentiale 59% 26% 15% viele engagierte Bürger 50% 35% 12% 3% zeigt man Freunden gerne 50% 35% 9% 6% Selbsthilfe großgeschrieben 50% 29% 21% präsentiert sich gut Integration von Neuen 32% 50% 29% 50% 21% 6% 9% 3% seit Wende bergauf 26% 53% 15% 6% gute Zukunft starker Zusammenhalt 18% 18% 59% 53% 24% 21% 3% 3% 3% Bürger haben das Sagen 12% 32% 47% 9% gute Konfliktlösung 12% 26% 38% 15% 9% Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden 6% 24% 41% 21% 9% Jugend gestaltet mit 3% 21% 50% 24% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
45 Abbildung 18 Dorfprofil Fürstlich Drehna aus der Sicht seiner Bewohner Fürstlich Drehna aus der Sicht seiner Bewohner zeigt man Freunden gerne 93% 4% 4% starke Verbundenheit viele Potentiale aufgeschlossen ggü. Touristen 85% 70% 67% 11% 4% 22% 4% 26% 4% 4% 4% gute Zukunft starke Zugpferde 63% 56% 19% 33% 15% 4% 4% 7% präsentiert sich gut 48% 37% 7% 7% seit Wende bergauf 48% 33% 4% 11% 4% Selbsthilfe großgeschrieben 37% 22% 37% 4% gutes Miteinander der Generationen 33% 48% 11% 7% Integration von Neuen 26% 30% 26% 11% 7% viele engagierte Bürger 22% 33% 41% 4% vielfältige überregionale Kontakte Jugend gestaltet mit Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden 22% 4% 22% 4% 15% 30% 52% 52% 30% 7% 11% 26% 11% 11% 4% starker Zusammenhalt 37% 44% 19% gute Konfliktlösung 37% 30% 22% 11% Bürger haben das Sagen 19% 63% 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100% stimme voll zu stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme nicht zu keine Angabe
46 6.3 Wenn die Bürger entscheiden dürften... Mit dem folgenden Fragenblock wollte man herausfinden, für welche Einrichtungen und Aktivitäten die Bewohner, wenn sie denn eigenmächtig entscheiden könnten, öffentliche Gelder ausgeben würden. Die Frage lautete: Wofür würden Sie weiterhin Geld ausgeben, wenn Sie entscheiden könnten? Als Antwortkategorien standen 4 Kategorien von sehr wichtig bis unwichtig zur Wahl. Im Ergebnis werden die für die Bewohner sehr wichtigen Einrichtungen und Aktivitäten dargestellt (Abbildung 19). Die Jugendarbeit steht mit Abstand an erster Stelle, d.h. in den vier Dörfern wird Jugendarbeit als eine sehr wichtige Aufgabe betrachtet. Schule und Bildung stehen mit über 70% der Befragten in Deetz und Kroppen weit oben auf der Rangliste. In Wulkow und Fürstlich Drehna stimmen dem etwa 50% der Befragten zu. In allen Dörfern ist erkannt, dass attraktive Jugend- und Bildungsarbeit Anziehungsfaktoren für Neubürger und Bleibegründe für Alteingesessene sind. Wie die Dörfer dies in ihrem möglichen Rahmen auf die Beine stellen wird in Kapitel erläutert. Eine Unterstützung der Vereinsaktivitäten und der Feuerwehr ist ebenso Priorität. Fast ebenso wichtig ist der Erhalt des Gemeindehauses. Dies gilt insbesondere in Wulkow und Deetz, die über ein Gebäude verfügen, jedoch entweder noch kein Nutzungskonzept entwickelt haben bzw. noch umfangreiche Sanierungsarbeiten anstehen. In Kroppen spielt das Gemeindehaus insofern eine geringere Rolle, als dass Kroppen a) eine eigenständige Gemeinde ist und b) über ein sehr gut ausgestattetes und lebendig genutztes Gemeindehaus bereits verfügt. Bei dem Erhalt der Kirche und Kirchengemeindearbeit sind sich alle Dörfer mehr oder weniger einig. Etwa 60% aller Befragten würden für die Kirchenarbeit auf alle Fälle Geld ausgeben. Bei der medizinischen Versorgung wurden unterschiedliche Einschätzungen gegeben. Während die Bedeutung von den Älteren und für die Älteren als sehr wichtig eingeschätzt wird, sind sie in den jüngeren Bevölkerungssegmenten von untergeordneter Bedeutung. In Kroppen ist die medizinische Versorgung besonders wichtig. In den anderen Orten stimmt dem etwa knapp die Hälfte zu. Während für den Erhalt einer Poststelle und einen hauptamtlich bezahlten Bürgermeister keine dringende Notwendigkeit besteht, ist der Erhalt und Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) für Wulkow und Fürstlich Drehna vergleichsweise bedeutend. Nahezu ähnliche Priorität erlangt in allen Dörfern die Grünanlagen- und Straßenpflege. Straßen und Grünflächen werden schon jetzt nicht mehr nur von öffentlicher Hand, sondern durch die Bürger selbst oder durch Beschäftigte des dritten Arbeitsmarktes gepflegt
47 Abbildung 19 Wichtige Einrichtungen und Aktivitäten Als Entscheidungsträger würden wir auf alle Fälle investieren in Kroppen Deetz Wulkow Fürstlich Drehna Feuerwehr ÖPNV 100% 80% Laden Vereine 60% 40% Post 20% hauptamtl. BM 0% Kirche Grün-/Straßenpflege Gemeindehaus Schule / Bildung Jugendarbeit med. Versorgung
48 7. Bewertung der Lebendigkeit in den untersuchten Dörfern 7.1 Aspekte der Lebendigkeit In allen fünf Dörfern werden die Aspekte der Lebendigkeit gesammelt und je nach ihrer Bewertung als Stärke, Schwäche, Wunsch oder Projektidee auf den verschiedenfarbigen Karten in form von Postern (siehe Kapitel 5.4) dargestellt. Eine detaillierte Beschreibung aller 48 Poster findet sich in den einzelnen Dorfberichten. Im Folgenden wird ein Gesamtüberblick über die inhaltlichen Schwerpunkte gegeben und die Methode der Visualisierung beispielhaft erläutert. Anhand von acht Beispielen wird anschaulich beschrieben, wie sich Lebendigkeit in den untersuchten Orten ausdrückt. Eine Indikatorenmatrix wird vorgestellt, die eine Grundlage für die Diagnose des Grades der Lebendigkeit von Dörfern bildet. Wie Tabelle 7 zeigt sind jeweils für fast alle Bereiche und Akteure von Lebendigkeit Poster erstellt worden, d.h. es haben sich genügend Themenkärtchen durch die Befragung gefunden. Der Natur- und Umweltschutz ist nur in Wulkow als gesondertes Thema diskutiert. In den anderen Dörfern spielt dieser Aspekt auch eine Rolle, ist aber aufgrund relativ geringerer Aussagendichte zu diesem Thema nicht gesondert behandelt worden. In Fürstlich Drehna ist kein Poster zu Kultur und Bildung entstanden. Die Jugend wird in Bezug zu den anderen Generationen und Kultur und Bildung im Poster Vereine behandelt. Man erkennt an den Überschriften einige Schwerpunkte. Interessant ist nun, wie lebendig die Bereiche und Akteure von der Dorfbevölkerung wahrgenommen werden. Anhand von zwei Beispielen wird die Differenzierung der Wahrnehmungen veranschaulicht. Das Poster Stärken der Maasdorfer Bürger illustriert, dass im Bereich der Bürger und deren Miteinander eigentlich alles positiv gesehen wird (Abbildung 21). Daher sind fast ausschließlich weiße Karten abgebildet. Nur eine gelbe Problemkarte, die Einzelmeinung eines Befragten, der sich nicht genügend eingebunden fühlt, ist zu sehen: Nie Einbeziehung von Menschen mit Know-how. Es zeigt sich, dass die Potenziale des Bürgerschaftlichen Engagements, der Zugpferde und des Miteinanders rundherum ausgenutzt und positiv bewertet werden. Maasdorf ist in Bezug auf die Bürger und deren Miteinander und aufgrund seiner starken kompetenten Zugpferde derzeit sehr lebendig. In Abbildung 22 erschließt sich ein etwas anderes Bild. Auf dem Poster Jung sein in Wulkow finden sich keine weiße Karten. Die gegenwärtige Situation wird als problematisch wahrgenommen. Es gibt keinen Raum für Jugendliche, eine schlechte Verkehrsanbindung, keine Jugendarbeit und geringe Freizeitmöglichkeiten. Darüber hinaus beklagen einige Erwachsene, dass die Jugend nicht genug Eigeninitiative zeigt. Es zeigt sich aber auch, dass die Wulkower viele Interessen, Wünsche und Ideen bezüglich der Jugendsituation haben. Es gibt z.b. sehr konkrete Gestaltungsvorschläge für einen Jugendclub. Im Ergebnis steht also, dass die Wulkower derzeit ihr Dorf als nicht sehr lebendig für die Jugend wahrnehmen. Die Bewohner haben aber sehr viele Ideen, was besser gemacht werden könnte. Dies lässt wiederum auf einen lebendigen Umgang mit dem Problem schließen
49 Tabelle 7 Übersicht der Bereiche und Akteure von Lebendigkeit OT Maasdorf Bad Liebenwerda Unsere Infrastruktur Dorfinfrastruktur OT Deetz Gemeinde Groß Kreutz (Havel) Attraktiver Wohnort Deetz OT Wulkow Stadt Lebus Wulkows wichtige Wohlfühlorte Gemeinde Kroppen Der Park: Das grüne Herz Kroppens OT Fürstlich Drehna Stadt Luckau Unser kleines Dorf Schloss und Park Profitieren wir alle vom Tourismus? Nahversorgung und Dorfökonomie Havel (Wassersport) Tourismus Mehr Tourismus Arbeiten in Deetz Lokale Ökonomie Wulkows wunderbare Welt Keine Arbeit für Maasdorf Lokale Wirtschaft Chancen Dorfentwicklung Lokale Ökonomie Kultur und Bildung Junges Deetz Jung sein in Wulkow Jugend Forever Young Jugend in Kroppen Sportdorf Deetz Freizeit in Wulkow Verschiedene Aktivitäten Die Kinder von Kroppen Naturund Umweltschutz Bürger Miteinander - Kommunikation findet nicht statt Öko-Test: Wulkow ein Ökodorf? Wulkower Miteinander Maasdorfer Miteinander Dörfliches Zusammenleben Kroppen als Vorbild für andere Dörfer? Kommunikation & Konflikte Kommunikation Kommunikation Generationen ein Miteinander? Stärken der Maasdorfer Konflikte in Fürstlich Drehna Vereine und Kirche Das Dorf lebt Gruppen und Vereine Bürgerengagement Bürgerengagement Vereine in Fürstlich Drehna Vereine Engagement Kommunale Strukturen Großgemeinde Märchen versus reales Leben Wulkow in der Region Maasdorf in der Region Verwaltung und Förderung Verwaltung
50 Abbildung 20 Posterbeispiel Stärken der Maasdorfer
51 Abbildung 21 Posterbeispiel Jung sein in Wulkow
52 7.2 Zwölf Aktive retten einen Landschaftspark Alle fünf untersuchten Dörfer erfüllen viele Kriterien der Lebendigkeit im Bereich der Dorfinfrastruktur. Am Beispiel Fürstlich Drehna soll anschaulich erläutert werden, wie sich Lebendigkeit ausdrücken kann. Abbildung 22 Pavillon Landschaftspark Fürstlich Drehna In Fürstlich Drehna erschließt sich dem Besucher auf Anhieb eine Dorfinfrastruktur mit baulichen und naturräumlichen Besonderheiten. Die Geschichte des Dorfes wird sichtbar durch das Wasserschloss, den Park mit See, dem wunderschönen sanierten Dorfkern mit Dorfladen und ansprechender Gastronomie. Die sanierungsbedürftige aber noch produzierende Brauerei ist eine weitere Besonderheit. Fürstlich Drehna hat somit gut entwickelte Publikumsmagneten. Die entwickelte Infrastruktur ist nicht nur das Ergebnis großer Förderprogramme, sondern einem harten Kern von ca. 12 Aktiven aus dem Heimatverein zu verdanken, die sich bereits zu DDR Zeiten für den Erhalt und Aufbau des historischen Ortskerns und des Landschaftsparks kontinuierlich eingesetzt haben. Der Landschaftspark drohte vollkommen dem Braunkohletagebau zum Opfer zu fallen (die Hälfte wurde schon vernichtet). Bäume und Pflanzen drohten durch die Trockenheit aufgrund der gesunkenen Grundwasserstände einzugehen. Durch die Arbeitskraft vieler und das Wissen eines aktiven Kerns im Rahmen von ParkAktiv konnte die Hälfte des Parks erhalten werden. Abbildung 23 Windmühle in Fürstlich Drehna Bewässerungsvorrichtungen wurden gebaut, ein See, der ausgetrocknet war, an neuer Stelle gegraben. Somit ist heute das Wasserschloss immer noch von Wasser umgeben. Die Gelder hat der Heimatverein aus dem Braunkohleentschädigungsfond akquiriert. Maschinen wurden von der Braunkohlefördergesellschaft geliehen. Geplant, konzipiert und gegraben haben die Bürger selbst und ehrenamtlich. Nach der Wende erfolgten weitere Aktivitäten wie der Aufbau der Windmühle inkl. der Organisation eines Mühlentages. Das Aufstellen eines Pavillons im Park und viele weitere Feste folgten. Ein Fest bei dem ehemalige Drehnaer eingeladen werden ( Drehna trifft Drehna ) ist sehr beliebt. Der aktive Kern des Heimatvereins ist heute noch existent, hat jedoch aufgrund der neuen Arbeitsplatzsituation (die Leute pendeln in andere Orte zum Arbeiten) weniger Möglichkeiten sich im Dorf zu engagieren. Der Prozess der Lebendigkeit im Falle Drehnas Dorfinfrastruktur stellt sich insgesamt als beteiligungsorientiert, identitätsbildend, öffentlichkeitswirksam und breit akzeptiert dar. Etwas schwächer ausgeprägt ist der Prozess in Bezug auf die Kontinuität, die Zukunftsorientierung und die überdörfliche Vernetzung der Aktivitäten
53 7.3 Gutscheine für die Dorf-Sauna Lebendigkeit stellt sich in den Bereichen Dorfökonomie (Arbeitsplätze) und Nahversorgung unterschiedlich dar. Hier variieren die Ausprägungen in den untersuchten Dörfern sehr stark. Abbildung 24 Gaststätte Zur Eiche in Kroppen Das Beispiel Kroppen betrachtet eine lebendige kreative Dorfökonomie. Die Laienschauspielgruppe mit ihren Lustspielauftritten ist sowohl bei den Bewohnern als auch in der Region sehr beliebt. Die Schauspieler arbeiten generationsübergreifend in einer altersgemischten Gruppe von 27 bis 72 Jahren. Junge Kroppener, die aufgrund ihrer Arbeitsstelle woanders wohnen, kommen für die Aufführung angereist. Ca. acht Mal pro Jahr werden die Stücke im Saal der Dorfgaststätte aufgeführt. Das fördert den Umsatz und das Image der Gaststätte. Vereine stützen damit, aber auch mit anderen Aktivitäten (Dorffeste) die lokalen Gewerbetreibenden. Die Bewohner wertschätzen das lokale Angebot und achten die lokalen Gewerbetreibenden. Abbildung 25 Sägewerk in Kroppen Das Sägewerk mit seiner Wassermühle ist wichtig und anerkannt. Der Betreiber bringt durch sehr schöne und von ein paar hundert Leuten besuchte Mühlenfeste auch gehobene Kultur (z.b. Klassische Musik) nach Kroppen. Er sowie die anderen vielen Gewerbetreibenden (Bauernhof, Druckerei, Fahrradladen, Bäcker, Getränkehandel, Kfz) helfen bei der Organisation von Dorffesten und sind - soweit möglich - großzügige Sponsoren für die Vereine
54 Kroppen als altes Bauerndorf hat noch einen Bauernhof, der auch zur Brandenburger Landpartie seine Hoftüren öffnet. Seit Mitte der 90er Jahre zieht er durch sein Angebot Urlaub auf dem Bauernhof Städter an, die sich z.b. am Wochenende Dresden anschauen und am Abend auf dem Land in Kroppen übernachten. Die Inhaberin wird für ihren Mut und Fleiß, in heutiger Zeit eine kleine Landwirtschaft zu betreiben, von der Dorfbevölkerung positiv wahrgenommen. Dies äußert sich z.b. in der Anerkennung der Dorfbewohner (insbesondere auch der Jüngeren) ihres jährlichen Schlachtfestes. Die Sauna auf dem Bauernhof (Blockhütte) wird einmal pro Woche für die Dorfbewohner geöffnet. Die amtierende Bürgermeisterin verrät uns, dass sie an Geburtstagen schon mal Gutscheine für die Sauna auf dem Bauernhof verschenkt. Abbildung 26 Schafe in den Vorgärten zeigen landwirtschaftliche Tradition Ein jährlich stattfindender Lämmermarkt zieht Menschen aus der ganzen Region an. Insgesamt erfüllt der Prozess der Lebendigkeit in Kroppens Dorfökonomie und Nahversorgung alle sieben Prozessindikatoren (siehe Kapitel 4.5). Eine Ausnahme bildet der Dorfladen, der sich wenig integriert und nur mit ungenügendem Angebot präsentiert. Es gibt weitere, wenn auch wenige, Konfliktpotentiale. Nicht alle Gewerbetreibende arbeiten gut zusammen und erkennen sich an. Auch der Bäcker findet wenig Zuspruch im Dorf. Es kommen nur 50 Stammkunden (Kroppen hat 762 Einwohner). Die Besonderheit des Bäckers (3x am Tag Ansäuerung des Brotes) und das ungenutzte Backhaus im Landschaftspark könnte noch besser ausgenutzt werden. Doch die Lernfähigkeit, mit Konflikten konstruktiv umzugehen, und neu aufeinander zuzugehen ist in dieser Sache noch nicht stark ausgeprägt. Nun sieht die Realität wie überall in den Dörfern in Bezug auf die Arbeitsplatzsituation wenig rosig aus. Die Arbeitslosigkeit beträgt über 25%. Ein einmaliger Ansatz, das durch die Bürgermeisterin herangezogene Projekt der Pulsnitz Weiber 6 versucht, regionale Wirtschaftskreisläufe zu stärken. Sieben Frauen aller Altersklassen sollen sich in den Arbeitsmarkt reintegrieren. Dieser Ansatz wird in Kroppen sehr positiv wahrgenommen. Die Pulsnitz Weiber arbeiten als Team und organisieren in Kroppen Tagesausflüge für Senioren. Mit ihrem Angebot fördern sie das lokale Gewerbe. Die Touristengruppen werden mit Kuchen von der Bäckerei versorgt, kaufen Fisch bei der lokalen Fischzucht, essen Schlachtplatte beim Bauernhof und speisen in der Dorfgaststätte Zur Eiche. Für das Abendprogramm besteht die Möglichkeit, die Laienschauspielgruppe zu buchen. Die Frauen organisieren selbst einen Spreewaldkahn, der die Senioren über die Pulsnitz durch den schönen Petzold-Landschaftspark kutschiert. Alle lokalen Unternehmer profitieren in gewisser Weise von den Aktivitäten. Die Tourismusschiene wird dennoch vorsichtig beurteilt: Wenn Touristen kommen, dann zahlen sie auch. Aber man kann noch nicht davon leben. Daher wurde noch kein Kleinstgewerbe Pulsnitz-Weiber angemeldet. Es wird für die Beteiligten relativ risikoarm zunächst als gemeinsam organisierte ehrenamtliche Tätigkeit durchgeführt. Es bereitet allen Beteiligten Spaß und sie profitieren zumindest über eine bessere Integration in das gesellschaftliche Leben im Ort. 6 Gefördert durch die KooperationsAnstiftung e.v. Lauchhammer
55 7.4 Work Camps, Motocross und Beach Parties Im Bereich Kultur und Bildung weisen die untersuchten Dörfer einen hohen Grad an Selbsthilfefähigkeit und vielseitige interessante Aktivitäten auf. Lebensqualität im Bereich Kultur und Bildung wird sehr differenziert und einmalig geschaffen. Die Dörfer holen sich Kultur ins Dorf, ohne oder nur in geringem Maße öffentlich gefördert zu werden. Faschingsclubs, Sportvereine und Heimatverein gehören zum Standard der untersuchten Dörfer. Die Freiwillige Feuerwehr ist überall vertreten und organisiert kulturelle Veranstaltungen wie das Osterfeuer, St. Martins-Umzüge und Drachenfeste. Sie hat in den kleineren Orten jedoch bereits mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen. Abbildung 27 FC Deetz mit Nachwuchsgruppen Deetz ist ein richtiges Sportdorf mit einem sehr erfolgreichen Fußballverein, der von den Deetzern als sehr lebendig wahrgenommen wird. Menschen aller Altersgruppen werden gleichermaßen integriert. Für Mädchen gibt es zwei Cheer Leader Gruppen. Volleyball, Tischtennis, Rückengymnastik, vier Jugendmannschaften und Frauenfußball runden das vielseitige Angebot ab. Senioren kommen gerne zu den Heimspielen, da neben dem Sport auch Kaffee, Kuchen und Bier geboten wird. Es kommen immer mindestens 150 Leute zum Heimspiel. Der FC Deetz ist sehr aktiv in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und über die Gemarkung hinaus gut bekannt (nicht zuletzt aufgrund seiner Freundschaftsspiele mit den Traditionsmannschaften Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund). Abbildung 28 Beach Party in Kroppen Kroppen hat als Besonderheit seine Laienschauspielgruppe und zwei attraktive Dorffeste, bei denen die Jugend aktiv mitgestaltet. Die Jugend hat in Kroppen einen eigenen Raum aus dem nichts nach außen dringt. Sie können dort ungestört Ideen aushecken und diese, sobald sie durchdacht sind, in das Dorf tragen, von dem sie weitestgehend Unterstützung bekommen (insbesondere vom Dorfclub, in dem der Leiter des Jugendclubs auch Mitglied ist). Die Fotos zeigen Beach Parties und gewagtes Moto Cross über die Pulsnitz beim Dorffest Abbildung 29 Motocross über die Pulsnitz Das Dorffest läuft sich tot hört man ab und an von den Bewohnern. Um dies zu verhindern, werden jedes Jahr angeregt durch die Bürgermeisterin, den Ortsbeirat, den Dorfclub und die Jugendlichen gemeinsam neue Schwerpunkte und Attraktionen ausgedacht
56 Abbildung 30 Motocross MX Masters in der Bergbaufolgelandschaft Fürstlich Drehna ist mit seiner Motocross Veranstaltung im Gebiet der Bergbaufolgelandschaft überregional bekannt. Das ganze Dorf ist an diesem Wochenende aktiv. Der MotoCross Verein wird in seiner Arbeit vom Heimatverein und vom Jugendclub gut unterstützt. Bis zu Menschen aus bis zu 28 Nationen tummeln sich auf der Rennstrecke der jährlichen Veranstaltung der Motocross MX Masters in einem Ort, in dem knapp 300 Menschen wohnen. Das lokale Bier der Schlossbrauerei Fürstlich Drehna wird angeboten, was zum Imageaufbau des Ortes positiv beiträgt. Wulkow hat mit seinem Niedrigenergiehaus einen Tagungs- und Seminarraum, der Bildungsangebote nicht nur für Wulkower, sondern auch für die Region und darüber hinaus. Da die Angebote besonders im Bereich des Natur- und Umweltschutzes liegen, wird auf die Arbeit des Ökospeichers im nächsten Abschnitt eingegangen. Ein weiteres nicht umweltbezogenes Bildungsangebot sind Computer- und Internetseminare, welche den Umgang mit modernen Medien vermitteln. Abbildung 31 Niedrigenergiehaus in Wulkow (Ufo) Die durchgeführten internationalen Work Camps und der interkulturelle Austausch mit Polen sind bei den Wulkowern beliebt, schaffen interkulturelles Verständnis und bringen Leben ins Dorf
57 Abbildung 32 Garten des Natoureum in Maasdorf Auch Maasdorf hat ein Gebäude, das Natoureum, in dem Kultur und Bildung allen Generationen, insbesondere Schülern beim Sachunterricht, sehr plastisch nahe gebracht werden. Das Bild zeigt den Garten des Natoureums. Hier haben alle Nachbardörfer prinzipiell die Möglichkeit sich im Bonsai-Format mit ihren jeweiligen Besonderheiten zu präsentieren. Besonders an dem Gebäude sind die multifunktionale Nutzung und die klug eingesetzten Fördermittel, die über lange Zeit gestreckt wurden, da viel in Eigenleistung (Arbeitsstunden und Konzeption/Planung) entstanden ist. Im Natoureum ist neben dem Museum auch der Jugendclub, der Heimatverein sowie die Freiwillige Feuerwehr untergebracht. Abbildung 33 Jugend-Rockfestival in Maasdorf Rock am Wald Weit über die Grenzen Maasdorfs hinaus bekannt ist die Veranstaltung Rock am Wald. Der Jugendclub organisiert dies und die FFW und die Dorfbewohner helfen mit. Über 500 Besucher kommen zum Festival am Sportplatz. Auswärts lebende Jüngere oder Pendler sind in die Aktivitäten des Dorfes eingebunden und gestalten aktiv mit (z.b. Musikgruppe MOSB von Rock am Wald). Insgesamt sind in den Dörfern die Prozessindikatoren zu Lebendigkeit im Bereich Kultur und Bildung weitgehend erfüllt. Die überdörfliche internationale Vernetzung von Kultur und Bildung in Wulkow (Work Camp) und Fürstlich Drehna (MotoCross) stechen genauso heraus wie das vielfältige Sportangebot des FC Deetz, der zur Identitätsbildung und Öffentlichwirksamkeit in besonderem Maße beiträgt. Die Zukunftsorientierung der Angebote in Wulkow (Umweltbildungsangebote) und Maasdorf (Natoureum) und die Kontinuität und Lernfähigkeit der Kroppener bei der Gestaltung von Festen (Dorfeste, OpenAir, Beach Parties) zeigen, warum Dörfer lebendig sind
58 7.5 Öko fängt vor der eigenen Haustür an Tabelle 8 gibt einen Überblick über die Ansätze der Dörfer im Bereich Natur- und Umweltschutz. Im Folgenden wird auf Wulkow beispielhaft eingegangen, da es insofern heraus sticht, als dass es sich schon bald nach der Wende als Dorf mit ökologisch orientierter Dorfentwicklung etablierte. Wulkow gewann bereits 1994 einen renommierten Preis (Träger des Bundesumweltpreises durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt 1994). Abbildung 34 Ökospeicher in Wulkow Ein im Ortskern durch bürgerschaftliches Engagement sanierter Ökospeicher beherbergt zwei junge Menschen, die ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr in Wulkow machen. Er bietet auch Platz für die Vereine und Übernachtungsmöglichkeiten für Gäste. Es ist nach Kriterien der ökologischen Bauweise saniert. Im Aufbau steckt extrem harte Arbeit. Außer den Zuwendungen aus dem Bundesumweltpreis gab es kaum öffentliche Förderung. Auch die zahlreichen Aktivitäten in der Dorfinfrastruktur und der Bildung im Ökologie und Umwelt Bereich wurden überwiegend aus eigener Kraft geschaffen. Abbildung 35 Beschilderung der Natur-Besonderheiten Seit der Wende waren in Wulkow mit dem Thema Ökologie und Umwelt große Hoffnungen verbunden. Das naturräumliche Potential hat einen hohen Stellenwert in der Bewertung des Ortes, sowohl bei Bewohnern als auch bei Besuchern. Das Dorf liegt inmitten einer attraktiven, abwechslungsreichen Landschaft in Odernähe mit kleinen Waldbeständen, seltenen Pflanzen und Wildtieren. Sich mit diesem Potenzial einen Arbeitsplatz zu schaffen, war ein großer Wunsch vieler ABM-Kräfte, die Anfang der 90er im Umweltbereich gearbeitet haben. Für viele hat sich dieser Traum nicht erfüllt. Das Thema Öko wird im Dorf kontrovers diskutiert (siehe auch Kapitel 7.8). Manche Aktive sagen, dass der Anspruch an ökologische Dorfentwicklung sehr groß sei und ihnen manchmal die Puste ausgeht. Andere finden, dass die große Ära vorbei sei. Es herrscht im Dorf, was den hohen Anspruch angeht, eine gespaltene Ansicht über den Ökospeicher. Dennoch ist der Ökospeicher laut Umfrage der lebendigste Ort in Wulkow. Keiner aus dem Dorf stellt sich gegen die Aktivitäten des Vereins. Außerdem gibt es Wulkow gegenüber viele Neider. Die Stadtverwaltung blockiert einige der Umsetzungsideen. Der Ausbau der gemeindeverwalteten Räume konnte beispielsweise bisher nicht realisiert werden
59 Es gibt in Wulkow viele lebendige Merkmale im Bereich Umwelt und Ökologie. Der Tag für Wulkow ist ein erfolgreicher Ansatzpunkt, um das Dorf solidarisch aufzuräumen und zu verschönern. Das Ufo bietet die Möglichkeit, es als Tagungs- und Seminarraum bzw. Urlaubsdomizil zu nutzen. Dadurch werden einerseits zusätzliche Einnahmequellen erschlossen und andererseits aber auch bereits existierende überregionale und internationale Kontakte gepflegt und gefördert (z.b. Stadt-Land-Partnerschaften, Dorfpartnerschaften mit Rumänien, interkultureller Austausch mit Polen, internationale Work-Camps). Abbildung 36 Natur-Kita Grashüpfer seit 1954 Der Natur-Kindergarten Grashüpfer ist ein Juwel des Dorfes, das über die Grenzen Wulkows hinaus genutzt und geschätzt wird. Die Betreuerinnen bieten den Kindern ein spielerisches Naturerleben mit allen Sinnen durch ganzheitliche Naturpädagogik. Für potentielle Neubürger ist dies ein sehr attraktiver weicher Standortfaktor. Insgesamt wird am Beispiel Wulkow deutlich, dass der Prozess gerade im Bereich Natur- und Umweltschutz lebendig gestaltet werden muss. Öffentlichwirksamkeit und Zukunftsorientierung ist in diesem Bereich leicht erzielbar. Wulkow wurde schon früh mit wichtigen Preisen ausgezeichnet. Die derzeitigen notwendigen Schritte liegen eher in den Bereichen der Beteiligungsorientierung und der Akzeptanz. Die neue Vereinsstruktur arbeitet daher demokratischer und transparenter, um eine breite Akzeptanz zu erwirken. Es gibt viele kreative Ideen, um die Vereinstätigkeiten auszubauen und zur Identitätsbildung Wulkow als Dorf mit ökologisch orientierter Dorfentwicklung beizutragen. Entscheidend für den Erfolg ist, dass die Wulkower untereinander ein gemeinsames Ziel vor Augen haben, gut mit den Nachbargemeinden kooperieren und mehr Unterstützung bei der kommunalen Verwaltung einzufordern. Denn Öko fängt vor der eigenen Haustür an wie es ein Wulkower treffend (als Wunsch formuliert) ausdrückt
60 Tabelle 8 Übersicht über den Bereich Umwelt- und Naturschutz Deetz Fürstlich Drehna Kroppen Maasdorf Wulkow Naturparkgemeindckeschaft - Niederlausitzer Landrü- - Niederlausitzer Heideland- - ParkAktiv Gruppe (Heimatverein) - Ja, Landschaftspark Fürstlich Drehna Ja, Petzold-Landschaftspark 17 ha - - Auszeichnungen Umwelt - Bauten im Dorf Wohnhaus Solarheizung Aktivitäten Förderverein Mittlere Havel e.v. (Naturparkkonzept) Havelbadetag Beschilderung Wanderwege Personelle Kapazitäten - Heimatverein 10 Mitglieder - Förderverein Mittlere Havel 20 Mitglieder - - Austragung des 6. Brandenburger Dorf- und Erntefestes 2002 Besucherzentrum und Verwaltung des Naturparks Wiederaufbau Landschaftspark Windmühle Pavillon -Naturparkverwaltung vor Ort - Heimatverein 30 Mitglieder - Fachwerkhaus im Park auch für Heimatverein, Parkpflegedienst, Jugendclub Kahnanlegestelle Parkpflege und -gestaltung - 1 Zivildienstleistender - Heimatverein 10 Mitglieder ABM für Park Kreissieger Umweltpreis 1998 Kreissieger im Wettbewerb Unser Dorf soll schöner werden 1999 Naturparkgemeinde Natoureum - Badstube (Naturgrillplatz) - Wohnhäuser Solarheizung -dezentrale Abwasserleitung Streuobstwiese Renaturierung der Kleinen Elster mit diversen Massnahmen Waldsäuberungsaktion Pflege der Grünflächen durch Waldlehrpfad Sagenpfad Storchennest - Heimatverein 120 Mitglieder (Motto: Der Umwelt zuliebe) - 2 ABM im Natoureum Bundesumweltpreis 1994 Modellgemeinde für nachhaltige Entwicklung EXPO Ökospeicher - Ufo (Niedrigenergiehaus) - Wohnhäuser Solarheizung Naturkindergarten Kräutergarten Ökologische Landwirtschaft Ein Tag für Wulkow Vita-Regio Tag Internat. Work Camps diverse Fachvorträge Exkursionen, Kurse Lehmbau regenerative Energien ökol. Teichwirtschaft Kleinkläranlagen - 2 FÖJler - ABM - Ökospeicher Mitglieder z.t. extern mit ökologischem Anspruch und Ressourcen
61 7.6 Wenn der Storch nicht pünktlich kommt, ist das ganze Dorf krank Abbildung 37 Storchennest in Maasdorf beschreiben die Maasdorfer ihr Miteinander (siehe auch Posterbeispiel Abbildung 38). Tatsächlich sind die Maasdorfer besonders eng in ihrer Gemeinschaft. Sie gestalten zusammen, planen und arbeiten zusammen und leiden zusammen, wenn der Dorfstorch nicht pünktlich eintrifft. Es gibt unzählige Zitate und Merkmale des Miteinanders. Auffällig war das in den Interviews häufig benutzte Wort WIR. Wir machen [ ]; wir haben es geschafft [ ]; wir tun es gemeinsam für unser Dorf, hier muss es doch weitergehen [ ]; miteinander was schaffen; egal wie die Menschen sind, sie gehören alle zu unserem Dorf. Gute Beispiele für das Miteinander in Maasdorf: Die Bürger achten auf den Erhalt ihrer Einrichtungen. Sie haben beispielsweise ein gemeinsames Alarmnetzwerk, wenn in der Badstube (Naturgrillplatz) randaliert wird. Die Abwasserfrage (zentrales oder dezentrales System) hat das Dorf nicht gespalten. Der Konflikt wurde sachlich diskutiert und ausgetragen. Maasdorf hat sich für ein dezentrales System entschieden, mit dem heute alle sehr glücklich sind. Abbildung 38 Aufruf zur 12.Waldsäuberungsaktion Die gemeinschaftlichen Arbeitseinsätze im Dorf, z.b. die Waldsäuberungsaktion, werden zu Zeitpunkten veranstaltet, zu denen alle Bürger Zeit haben. Alle sozialen Gruppen (Berufstätige / Arbeitssuchende / Senioren) arbeiten miteinander. Versammlungen werden zeitlich so gelegt, dass Pendler mitmachen können. Im Jugendclub ist der Begriff der Jugend weit gefasst. Es findet ein Miteinander über mehrere Altersgruppen statt. Man trifft dort auch zuweilen den Ortsbürgermeister oder andere Zugpferde, die sich mit der Jugend austauschen. Dorffeste und Straßenfeste werden dezentral über Straßennetzwerke organisiert. Ältere Menschen werden durch Straßenbeauftragte explizit eingeladen und in die Aktivitäten miteinbezogen (z.b. zur Herstellung der Festdekoration). Auswärts lebende Jüngere oder Pendler sind in das Dorf eingebunden und gestalten immer noch mit (z.b. Musikgruppe). Ausgeprägte Nachbarschaftshilfe spiegelt sich auch in den Fahrgemeinschaften (z.b. zur Schule), in der Versorgung des Nachbarn und im gemeinsamen Hausbau wieder
62 Die Maasdorfer nehmen ihr Miteinander sehr positiv wahr. Sie räumen jedoch ein, dass zu DDR Zeiten die Gemeinschaft noch viel enger war. Der Rückgang des Gemeinschaftssinnes wird auch in den Untersuchungen der anderen vier Dörfer bestätigt. Abbildung 39 Ehrenamtlich geführte Gemeindebibliothek in Kroppen In allen fünf Dörfern ist das Miteinander von sehr viel Initiative und Kreativität geprägt. So gibt es viele praktisch denkende Menschen, die sich unterstützen, in dem sie z.b. landwirtschaftliche Produkte und handwerklichen Fähigkeiten austauschen. Die Kirchengemeinde prägt ein konstruktives Miteinander, und Menschen tun jeden Tag eine unentgeltliche gute Tat. Eine ehrenamtlich geführte Dorfbibliothek in Kroppen wird durch die Kreativität der Bibliothekarin ständig aktualisiert und sehr gut geführt. Sie kann mit den städtisch geführten Bibliotheken gut mithalten. Ihre Kapazitäten zur Einrichtung eines Internetcafés reichen aber nicht mehr. Dafür bräuchte auch sie Unterstützung. Für das Miteinander von Alt und Jung ist das Geburtstagssingen der Kinder für alle Senioren im Dorf Kroppen beispielhaft. Senioren bieten dafür ihre Hilfe bei der Kindergartenarbeit an, in dem sie alte Spiele, vergessene Reime etc. den Kindern beibringen. Der Buschfunk und die Gartenzaungespräche funktionieren i.d.r. hervorragend, nur in wenigen Fällen hat die innerdörfliche Kommunikation abgenommen. In Einzelfällen führt mangelnde Kommunikation zu Spannungen im Dorf, die zuweilen schwer überwindbare Gräben zurücklassen. Die junge Generation stöhnt gelegentlich über zu viel Klatsch und Tratsch. In Deetz hingegen (viele Pendler, keine Dorfgaststätte) beklagt sich darüber niemand. Es wird sogar bedauert, dass es früher nur 3 Minuten gedauert hat, bis man wusste, warum der Krankenwagen durchs Dorf fährt. Heute dauert es 3 Tage
63 7.7 Ohne Vereine wäre das Dorf tot Vereine tragen in den untersuchten Dörfern wesentlich zur Lebendigkeit bei. In Deetz, wo es weder eine Kneipe noch einen anderen öffentlichen Raum außerhalb des Sportplatzes gibt, wird behauptet, dass Vereine die Kristallisationspunkte des Dorfes sind und ohne Vereine das Dorf tot wäre. Über die Hälfte der Deetzer Bevölkerung sind Mitglieder in Vereinen. Der Anglerverein und der Sportverein binden allein 85% der Mitglieder. Die restlichen 15% sind im Förderverein Mittlere Havel, dem Heimatverein, der Volkssolidarität und der Freiwilligen Feuerwehr organisiert. Abbildung 40 Heimatverein Deetz im Heimatmuseum Der Heimatverein Deetz hat eine interessante Mitgliederstruktur, der sich aus Berliner Zugezogenen, alteingesessenen Deetzern und anderen älteren Zugezogenen zusammensetzt. Er arbeitet gut mit den anderen Vereinen zusammen und kümmert sich um Identitätsbildung und Kultur (Dorfchronik, Heimatmuseum, Ziegeleiausstellung, Uhrenausstellung, kreatives Deetz, Dorfinfrastruktur) und neue Einkommensmöglichkeiten im Tourismus (Auszeichnung und Beschilderung von Wander- und Fahrradwegen, Umgebungskarten, Postkarten). Er arbeitet mit allen anderen Vereinen konstruktiv zusammen und ist überdörflich aktiv (z.b. Anradeln der Fahrradwege, Eisbaden). Die Jugend wird weniger stark eingebunden. Es fehlt eine Person, die sich um die Jugend kümmert, um eventuell eine Splittergruppe Jugendclub zu gründen. Deetz könnte die Erfahrungen aus Maasdorf und Kroppen nutzen, um dieses Potenzial auszubauen. Der Förderverein Mittlere Havel e.v. hat sich ein besonders anspruchsvolles Ziel gesetzt. Er hat überdörflich eine breite Akzeptanz und hat sich mit Mitgliedern aus den Nachbargemeinden, dem Nabu, dem Tourismusverband Rathenow etc. organisiert, um ein Naturparkkonzept Mittlere Havel umzusetzen. Berücksichtigt man die Chancen des Naturparks (z.b. gemessen an der Quantität der Aktivitäten im Umwelt- und Naturschutz, die die beiden Naturparkdörfer Maasdorf und Fürstlich Drehna umsetzen), geht die Zielsetzung des Fördervereins in die richtige Richtung. Von einigen wichtigen Akteuren im Dorf wird die Naturparkidee jedoch kritisch beurteilt ( Der ganze Touristenkram ist Quatsch ). In Deetz gilt ähnlich wie in Wulkow (siehe Kapitel 7.5), eine breite Akzeptanz für den Naturpark nicht nur nach außen, sondern auch im Dorf zu schaffen. Anders als in den anderen untersuchten Dörfern, würden sich 42% der befragten Deetzer gerne noch mehr in Vereinen engagieren. Zeit ist jedoch der limitierende Faktor für mangelndes Engagement. Andere Gründe werden aber auch genannt: Während einigen die Perspektive des Engagements fehlt ( man müsste Perspektive für Engagement sehen, wenn etwas bei rauskommt ), wünschen sich andere materielle Anerkennung ( Sachzuwendungen als Unterstützung, Entschädigung für Fahrten etc. ). Eine Reihe von kommunikativ-kooperativen Aspekten ( mehr Anerkennung und Eigendynamik vom Dorf, jemanden, der mitmacht, man müsste gefragt werden, jemanden, der organisiert (z.b. Aushang) ) erlangen ebenfalls Bedeutung. Die Großgemeinde scheint manche vom Engagement abzuhalten, denn gäbe es weniger Bürokratie und mehr Unterstützung von der Gemeinde, käme
64 für den einen oder anderen mehr Engagement in Frage. Aus den letztgenannten Gründen steckt in Deetz noch einiges Potenzial für vermehrtes bürgerschaftliches Engagement. Die Kirche trägt in Deetz mit vielen Aktivitäten zum sozialen Miteinander bei. Deetz hat keinen ortsansässigen Pfarrer (die Pfarrerin wohnt im Ortsteil Jeserig). Das Pfarrhaus wird von dem kirchengemeindlich aktiven Ehepaar für die Bewohner geöffnet (Jugendarbeit, Krippenspiel, Kinderkreis, Frauenkreis, Kirchencafé nach dem Gottesdienst 2x pro Monat). In allen Dörfern werden bei der Vereinsstruktur viele Indikatoren der Lebendigkeit erfüllt. Im kulturellen Bereich gibt es eine vielseitige Vereinsstruktur, wo für jeden etwas dabei ist. Die Zusammenarbeit zwischen den Vereine könnte mancherorts besser sein ( Vetternwirtschaft, Vereine konkurrieren um Nachwuchs ). Auch wird bemängelt, dass einige Vereine nicht zukunftsorientiert arbeiten und mit Finanzen nicht umgehen können. Zuweilen lässt die Beteiligungsorientierung zu wünschen übrig. Die Menschen fühlen sich nicht genug aufgefordert, mit zu machen. Diese Potenziale müssten von den Vereinen noch stärker genutzt werden durch Ansprechen der Bürger. Auch wenn es darauf hinausläuft, dass die Bewohner sich zunächst eher projektbezogen engagieren. Denn nicht jeder tritt heutzutage gerne einem Verein bei, sondern stellt seine Kraft lieber kurzfristig zur Verfügung. Was den meisten Dörfern fehlt ist ein dorfübergreifend akzeptierter Verein, der als Dachverein die Dorfentwicklung vorantreibt. Der Heimatverein Maasdorf und (in geringerer Ausprägung) der Dorfclub Kroppen bilden hierbei Ausnahmen. Nach der Wende hat der Heimatverein Maasdorf durch sein Engagement die Lücke der weg gebrochenen kommunalen Strukturen schließen können. Seine Aktivitäten werden unter Abschnitt 7.9 Kommunale Strukturen dargestellt
65 7.8 Es gibt eine Lokomotive, Waggons als Mitmachende und ein paar, die hinten schieben Zugpferde sind wichtige Schlüsselpersonen, die Verantwortung übernehmen und Prozesse tragen. In den untersuchten Dörfern wird diese wichtige Akteursgruppe sehr unterschiedlich diskutiert und anerkannt. Anhand der Dorfgeschichte von 1989 (Wende) bis heute werden die Ursachen für den heutigen Umgang mit den Zugpferden seitens der Dorfbewohner exemplarisch erläutert. Abbildung 41 Maasdorfer Entwicklungsweg: Kontinuierliche starke Führung Wie überall in Ostdeutschland entstand in Maasdorf nach der Wende ein Loch. Das gute Gemeinschaftsgefühl war von einer Gruppe, die schon gemeinsam zur Schule gegangen sind, geprägt. Sie hatten damals bereits gute Posten in den umliegenden Betrieben. Sie vertrauten untereinander. Alles lief auf Zuruf. Die Trägerstruktur war auf einmal weg gebrochen. Die Menschen mit dem nötigen Fachwissen und Menschen, die bereit waren, dieses sich anzueignen, waren aktiv. Dies führte zu einer sehr frühzeitigen Nutzung der Fördergelder (1989/90 Trinkwasserversorgung, Abwasserver-sorgung). Die Gemeindegebietsreform hat zu einem erneuten Bruch in der Trägerstruktur geführt. Diese Lücke wurde sofort vom Heimatverein geschlossen. Der jetzige Ortsbürgermeister Herr Lehmann führt kontinuierlich das Dorf. Auf beide Brüche wurde immer schnell und zielorientiert mit einem Konzept reagiert. Die Brüche wurden aufgrund der Stärke der Führungsmannschaft kaum wahrgenommen. Das Erfolgskonzept des Heimatvereins und des Ortsbürgermeisters für die Dorfentwicklung in Maasdorf lautet: Es gibt eine Lokomotive (Herr Lehmann), Waggons als Mitmachende (Heimatverein) und ein paar (Bürger), die hinten schieben. Hinsichtlich der vier Kompetenzfelder von Zugpferden (Heimatverein und Herr Lehmann) (siehe Kapitel 4.4) sind folgende Eindrücke bei der Befragung in Maasdorf vermittelt worden. Soziale Kompetenzen: Der Ortsbürgermeister sucht immer Kompromisse. Er holt alle ins Boot. Es gibt keine Verlierer. Die Zugpferde haben und suchen den Rückhalt der Dorfbewohner. Alle Vorhaben werden gut kommuniziert und transportiert. Man muss die Leute nur ansprechen, dann machen sie mit In der Dorfversammlung wird sachlich diskutiert. Jeder, der will, kann sich informieren und hat kompetente Ansprechpartner. Trotz aller Widrigkeiten (z.b. Neid von anderen Dörfern) werden Ideen umgesetzt und man bemüht sich, die Neider ins Boot zu ziehen (z.b. Garten des Natoureums, in denen Nachbarorte sich präsentieren können)
66 Fachliche Kompetenzen: Es gibt es viele Zugpferde, die für die Entwicklung eines Dorfes wichtige Kompetenzen haben (Planer, Vermesser, Verwaltung, Finanzen, Kreative). Es gibt aktive Mitstreiter, die sich die Kompetenzen im Laufe der Zeit aneignen. Herr Lehmann = Ideenmaschine Organisatorische Kompetenzen: ABM-Kräfte und 1-Euro Jobber werden von Zugpferden für Dorf-Projekte und für die Menschen aus dem Dorf herangezogen. Mittel und Wege finden und auch ein wenig tricksen Zugpferde setzen ihr Wissen und Zeit für das Dorf ein und übernehmen Verantwortung (z.b. in dem sie selbst für Fördergelder und deren Verwendung haften). Überall Augen und Ohren und alles im Kopf haben Herr Lehmann und Frau Matthes organisieren Fördergelder Medien Kompetenzen: Nicht explizit hervorgehoben Abbildung 42 Wulkower Entwicklungsweg: Teamorientierter Neuanfang nach großem Bruch? Wulkows Geschichte ist die einer ökologisch orientierten Dorfentwicklung. Nach der Wende entstand in Wulkow kein großes Loch, denn die Idee war schon zu DDR Zeiten geboren. Die Nachwendebürgermeisterin, ihr Mann, der Pfarrer und weitere Aktive hatten zum Ziel, aus Wulkow ein Dorf mit ökologischer Orientierung zu machen. Bereits 1991 auf der Grünen Woche stießen sie auf große Resonanz. Man bemühte sich um Neubürger, die ökologisch orientierte Ideen mit umsetzen und arbeitete sehr intensiv an der Dorfentwick-lung. Dies war insofern eine Besonderheit, als dass Wulkow schon seit Jahren vor der Wende offiziell als Auslaufmodell galt. Von offizieller Seite wollte man, dass Wulkow totgewohnt wurde. Es flossen keine öffentlichen Gelder zur Stabilisierung der Dorfinfrastruktur nach Wulkow gewann Wulkow den Bundesumweltstiftungspreis. Ein damaliges Zugpferd mit vielen guten und innovativen Ideen setzte im Prinzip durch, was er wollte. Es gab unvollständige Geschäftsberichte und Finanzströme blieben undurchsichtig. Es kam aus persönlichen Gründen 1998 zu einem Bruch. Heute ist der Ökospeicher demokratischer organisiert. Im Dorf hängt ihm aber noch sein Ruf nach. Durch die Auszeichnungen waren die Erwartungen an Wulkow sehr hoch geworden. Wulkow wurde Modellgemeinde auf der EXPO Dies gab den Wulkowern das Gefühl, dass hier etwas Vernünftiges passiert, und nicht nur eine Spinnerei ist. In dieser Zeit entwickelte man sich stärker nach außen als nach innen
67 Eine resignierte Einstellung macht sich heute in Teilen der Dorfbevölkerung und bei einigen Zugpferden bemerkbar. Sie zeigen nach dem jahrelangen kontinuierlichen Einsatz erste Ermüdungserscheinungen. Auch die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen erleichtert nicht immer effektive Dorfentwicklungsarbeit. Es wird die allgemeine Tendenz in der Bevölkerung, Verantwortung zu scheuen beklagt. Es gibt wenig Zugpferde in Wulkow, die anderen tun mit. Manche Mitarbeitenden beklagen auch, dass ihnen für ihren ehrenamtlichen Einsatz zu wenig gedankt wird. Hinzu kommt die als gering empfundene Unterstützung durch die Großgemeinde. Ein lebendiger Umgang mit der oben genannten Problematik scheint in Sicht. Bürger und Zugpferde arbeiten auf einen Neuanfang hin. Beim 650 Jahre Jubiläumsfest entstand z.b. eine richtige Aufbruchstimmung. Es werden wieder Vorschläge gemacht, wie man zukünftig miteinander kommunizieren möchte. Ein Dachverband für Dorfentwicklung wird vorgeschlagen, in dem teamorientiert an der Dorfentwicklung gearbeitet wird. Und ihre Teamfähigkeit bewiesen die Wulkower schon mehrfach bei ihren gemeinsam organisierten Festen und dem Tag für Wulkow. Auch sind in dem kleinen Dorf sehr viele fachliche und organisatorische Kompetenzen bei den Bewohnern und Zugpferden vorhanden. 7.9 Unsere Großgemeinde Märchen versus reales Leben Abbildung 43 Handlungsunfähigkeit der Großgemeinde wirkt demotivierend Das Poster zur Großgemeinde spiegelt die Meinung der Dorfbewohner über die Bildung einer Großgemeinde mit acht Ortsteilen im Jahr 2003 in Deetz wider. Deetz musste dadurch große finanzielle Verluste in der Gemeindekasse hinnehmen. Deetz stieß unverschuldet zur Großgemeinde. Die Großgemeinde ist jedoch heute stark verschuldet und überwiegend mit sich selbst (z.b. Diskussion um den Amtssitz) beschäftigt. Alle negativen Aussagen (gelbe Karten) zur Großgemeinde finden sich in dem hohen Berg. Dieser Berg scheint alle positiven Aspekte, Wünsche und Visionen zu erdrücken. Durch den Ballast an Problemen können gar keine konkreten Ideen entstehen. Initiativen werden oft schon im Keim erstickt. Dadurch sind viele Deetzer mutlos bzw. fehlt ihnen die Motivation Projekte für das Dorf anzugehen und sich selbst zu helfen. Es gibt zu diesem Thema seitens der Befragten keine konkreten Projektideen (blaue Karten). Eine Vision (rote Karte) bringt die Absurdität der Großgemeinde auf den Punkt: Kein Zank in der Gemeindeverwaltung. Anscheinend glauben die Bürger nicht mehr an eine Lösung des Problems. Der Untertitel Märchen versus reales Leben ist ein Zitat aus den Gesprächen, welches die Situation gut erfasst. Die Bevölke-
Freiwillig und unentgeltlich, aber nicht umsonst. Herausforderungen und Perspektiven Bürgerschaftlichen Engagements in Rheinland-Pfalz
 Freiwillig und unentgeltlich, aber nicht umsonst. Herausforderungen und Perspektiven Bürgerschaftlichen Engagements in Rheinland-Pfalz Birger Hartnuß, Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung in der Staatskanzlei
Freiwillig und unentgeltlich, aber nicht umsonst. Herausforderungen und Perspektiven Bürgerschaftlichen Engagements in Rheinland-Pfalz Birger Hartnuß, Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung in der Staatskanzlei
Leitlinien Eichstetten Lebensplatz Dorf Zukunftsorientiertes Wohnen Arbeiten - Erholen
 Leitlinien Eichstetten Lebensplatz Dorf Zukunftsorientiertes Wohnen Arbeiten - Erholen Für folgende Themenbereiche haben wir Leitlinien formuliert: 1. Wichtige Querschnittsanliegen 2. Gemeinwesen und Kultur
Leitlinien Eichstetten Lebensplatz Dorf Zukunftsorientiertes Wohnen Arbeiten - Erholen Für folgende Themenbereiche haben wir Leitlinien formuliert: 1. Wichtige Querschnittsanliegen 2. Gemeinwesen und Kultur
Das kommunale Demografiekonzept der Verbandsgemeinde Winnweiler
 28. Oktober 2013 Das kommunale Demografiekonzept der Verbandsgemeinde Winnweiler Der demografische Wandel in vielen Orten im Zusammenwirken mit zunehmender Ressourcenknappheit stellt eine der zentralen
28. Oktober 2013 Das kommunale Demografiekonzept der Verbandsgemeinde Winnweiler Der demografische Wandel in vielen Orten im Zusammenwirken mit zunehmender Ressourcenknappheit stellt eine der zentralen
Öffentliche Beteiligung und freiwilliges Engagement in Deutschland im Trend
 Öffentliche Beteiligung und freiwilliges Engagement in Deutschland im Trend 1999 2004 2009 Ergebnisse zur Entwicklung der Zivilgesellschaft il ll in Deutschland auf Basis des Freiwilligensurveys Präsentation
Öffentliche Beteiligung und freiwilliges Engagement in Deutschland im Trend 1999 2004 2009 Ergebnisse zur Entwicklung der Zivilgesellschaft il ll in Deutschland auf Basis des Freiwilligensurveys Präsentation
BKS JUGEND. Leitbild Jugendpolitik Kanton Aargau
 BKS JUGEND Leitbild Jugendpolitik Kanton Aargau Dieses Leitbild ist im Auftrag des Regierungsrates entstanden aus der Zusammenarbeit der regierungsrätlichen Jugendkommission und der kantonalen Fachstelle
BKS JUGEND Leitbild Jugendpolitik Kanton Aargau Dieses Leitbild ist im Auftrag des Regierungsrates entstanden aus der Zusammenarbeit der regierungsrätlichen Jugendkommission und der kantonalen Fachstelle
AG 1 Gestaltung partizipativer Prozesse auf kommunaler Ebene
 BAGSO Tagung Leipzig 08. September 2015 AG 1 Gestaltung partizipativer Prozesse auf kommunaler Ebene 1. Ablauf der Arbeitsgruppe Vorstellen der Arbeitsschritte der Arbeitsgruppe Erwartungsabfrage und Vorstellungsrunde
BAGSO Tagung Leipzig 08. September 2015 AG 1 Gestaltung partizipativer Prozesse auf kommunaler Ebene 1. Ablauf der Arbeitsgruppe Vorstellen der Arbeitsschritte der Arbeitsgruppe Erwartungsabfrage und Vorstellungsrunde
Vorwort. Wir verfolgen das Ziel die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen zu fördern.
 Vorwort Wir verfolgen das Ziel die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen zu fördern. Mit dieser Zielsetzung vor Augen haben wir Führungskräfte der gpe uns Führungsleitlinien gegeben. Sie basieren
Vorwort Wir verfolgen das Ziel die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen zu fördern. Mit dieser Zielsetzung vor Augen haben wir Führungskräfte der gpe uns Führungsleitlinien gegeben. Sie basieren
Netzwerk mehr Sprache Kooperationsplattform für einen Chancengerechten Zugang zu Bildung in Gemeinden
 Simon Burtscher-Mathis ta n z Ha rd Ra Fr as nk W weil ol fur t Netzwerk mehr Sprache Kooperationsplattform für einen Chancengerechten Zugang zu Bildung in Gemeinden Ausgangspunkte Wieso und warum müssen
Simon Burtscher-Mathis ta n z Ha rd Ra Fr as nk W weil ol fur t Netzwerk mehr Sprache Kooperationsplattform für einen Chancengerechten Zugang zu Bildung in Gemeinden Ausgangspunkte Wieso und warum müssen
Das Leitbild der Industrie- und Handelskammer zu Lübeck
 Das Leitbild der Industrie- und Handelskammer zu Lübeck Herausgeber: Industrie- und Handelskammer zu Lübeck Fackenburger Allee 2 23554 Lübeck Telefon: 0451 6006 0 Telefax: 0451 6006 999 E-Mail: service@ihk-luebeck.de
Das Leitbild der Industrie- und Handelskammer zu Lübeck Herausgeber: Industrie- und Handelskammer zu Lübeck Fackenburger Allee 2 23554 Lübeck Telefon: 0451 6006 0 Telefax: 0451 6006 999 E-Mail: service@ihk-luebeck.de
I.O. BUSINESS. Checkliste Teamentwicklung
 I.O. BUSINESS Checkliste Teamentwicklung Gemeinsam Handeln I.O. BUSINESS Checkliste Teamentwicklung Der Begriff Team wird unterschiedlich gebraucht. Wir verstehen unter Team eine Gruppe von Mitarbeiterinnen
I.O. BUSINESS Checkliste Teamentwicklung Gemeinsam Handeln I.O. BUSINESS Checkliste Teamentwicklung Der Begriff Team wird unterschiedlich gebraucht. Wir verstehen unter Team eine Gruppe von Mitarbeiterinnen
Vereinsarbeit heute?!
 Vereinsarbeit heute?! Eine Befragung ausgewählter Vereine in Kassel durch die CVJM-Hochschule und das Zukunftsbüro der Stadt Kassel (April Juni 2012) 1) Einführung und Vorstellung der Befragung 2) Erkenntnisgewinne
Vereinsarbeit heute?! Eine Befragung ausgewählter Vereine in Kassel durch die CVJM-Hochschule und das Zukunftsbüro der Stadt Kassel (April Juni 2012) 1) Einführung und Vorstellung der Befragung 2) Erkenntnisgewinne
Lissabonner Erklärung zur Gesundheit am Arbeitsplatz in kleinen und mittleren Unternehmen KMU (2001)
 Lissabonner Erklärung zur Gesundheit am Arbeitsplatz in kleinen und mittleren Unternehmen KMU (2001) Diese Erklärung wurde vom ENBGF auf dem Netzwerktreffen am 16. Juni 2001 verabschiedet und auf der anschließenden
Lissabonner Erklärung zur Gesundheit am Arbeitsplatz in kleinen und mittleren Unternehmen KMU (2001) Diese Erklärung wurde vom ENBGF auf dem Netzwerktreffen am 16. Juni 2001 verabschiedet und auf der anschließenden
Älter werden in Münchenstein. Leitbild der Gemeinde Münchenstein
 Älter werden in Münchenstein Leitbild der Gemeinde Münchenstein Seniorinnen und Senioren haben heute vielfältige Zukunftsperspektiven. Sie leben länger als Männer und Frauen in früheren Generationen und
Älter werden in Münchenstein Leitbild der Gemeinde Münchenstein Seniorinnen und Senioren haben heute vielfältige Zukunftsperspektiven. Sie leben länger als Männer und Frauen in früheren Generationen und
Gesetzestext (Vorschlag für die Verankerung eines Artikels in der Bundesverfassung)
 Gesetzestext (Vorschlag für die Verankerung eines Artikels in der Bundesverfassung) Recht auf Bildung Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. Bildung soll auf die volle Entfaltung der Persönlichkeit, der
Gesetzestext (Vorschlag für die Verankerung eines Artikels in der Bundesverfassung) Recht auf Bildung Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. Bildung soll auf die volle Entfaltung der Persönlichkeit, der
MÜNCHEN - DUBLIN - ZWILLINGE?
 MÜNCHEN - DUBLIN - ZWILLINGE? Zwillinge auch wenn sie eine andere Sprache sprechen, so haben München und Dublin doch eine lange Liste von Gemeinsamkeiten. Sowohl die Hauptstadt von Bayern als auch die
MÜNCHEN - DUBLIN - ZWILLINGE? Zwillinge auch wenn sie eine andere Sprache sprechen, so haben München und Dublin doch eine lange Liste von Gemeinsamkeiten. Sowohl die Hauptstadt von Bayern als auch die
Aspekte der Nachhaltigkeit
 NACHHALTIGKEITSCHECK FÜR PROJEKTE Aspekte der Nachhaltigkeit Checkliste Mai 2005 Fachabteilung 19D Abfall- und Stoffflusswirtschaft Lebensressort Das Land Steiermark Einleitung Im Laufe von Lokalen Agenda
NACHHALTIGKEITSCHECK FÜR PROJEKTE Aspekte der Nachhaltigkeit Checkliste Mai 2005 Fachabteilung 19D Abfall- und Stoffflusswirtschaft Lebensressort Das Land Steiermark Einleitung Im Laufe von Lokalen Agenda
Wir haben klare strategische Prioritäten definiert und uns ehr geizige Ziele für unser Unternehmen gesetzt.
 Vision und Werte 2 Vorwort Wir haben klare strategische Prioritäten definiert und uns ehr geizige Ziele für unser Unternehmen gesetzt. Wir sind dabei, in unserem Unternehmen eine Winning Culture zu etablieren.
Vision und Werte 2 Vorwort Wir haben klare strategische Prioritäten definiert und uns ehr geizige Ziele für unser Unternehmen gesetzt. Wir sind dabei, in unserem Unternehmen eine Winning Culture zu etablieren.
2.2.1 Werteorientierung und Religiosität
 2.2.1 Werteorientierung und Religiosität Religion im Alltag des Kindergartens Unser Verständnis von Religion Wenn wir von Religion im Alltag des Kindergartens sprechen, ist zunächst unser Verständnis von
2.2.1 Werteorientierung und Religiosität Religion im Alltag des Kindergartens Unser Verständnis von Religion Wenn wir von Religion im Alltag des Kindergartens sprechen, ist zunächst unser Verständnis von
Quo Vadis, Germersheim?
 Quo Vadis, Germersheim? Eine (sehr kurze) Zusammenfassung der Studie Dienstag, 10. Februar 2015 1 Herzlich Willkommen! 2 Gliederung 1. Warum wurde die Studie durchgeführt? 2. Wie war die Studie aufgebaut?
Quo Vadis, Germersheim? Eine (sehr kurze) Zusammenfassung der Studie Dienstag, 10. Februar 2015 1 Herzlich Willkommen! 2 Gliederung 1. Warum wurde die Studie durchgeführt? 2. Wie war die Studie aufgebaut?
Rolle der Kommunen für die nachhaltige Entwicklung Baden-Württembergs
 Tagung der Heinrich Böll Stiftung Kommunen gehen voran: Rio 20+ 2. März 2012 in Stuttgart Rolle der Kommunen für die nachhaltige Entwicklung Baden-Württembergs Gregor Stephani Leiter des Referats Grundsatzfragen
Tagung der Heinrich Böll Stiftung Kommunen gehen voran: Rio 20+ 2. März 2012 in Stuttgart Rolle der Kommunen für die nachhaltige Entwicklung Baden-Württembergs Gregor Stephani Leiter des Referats Grundsatzfragen
Demographische Entwicklung in den hessischen Landkreisen
 Standortfaktor Bürgerengagement Keine Angst vor dem demographischen Wandel Wiesbaden, den 12. September 2006 Demographische Entwicklung in den hessischen Landkreisen 2020 2050 2 1 Hessen altert Bevölkerungsalterung
Standortfaktor Bürgerengagement Keine Angst vor dem demographischen Wandel Wiesbaden, den 12. September 2006 Demographische Entwicklung in den hessischen Landkreisen 2020 2050 2 1 Hessen altert Bevölkerungsalterung
Leitbild STADT UND LAND. des Konzerns STADT UND LAND
 Leitbild des Konzerns STADT UND LAND STADT UND LAND W O H N B A U T E N - G E S E L L S C H A F T M B H G E S C H Ä F T S B E S O R G E R I N D E R W O G E H E WIR SIND DIE STADT UND LAND. WIR WOLLEN ZUR
Leitbild des Konzerns STADT UND LAND STADT UND LAND W O H N B A U T E N - G E S E L L S C H A F T M B H G E S C H Ä F T S B E S O R G E R I N D E R W O G E H E WIR SIND DIE STADT UND LAND. WIR WOLLEN ZUR
Leitbild. des Jobcenters Dortmund
 Leitbild des Jobcenters Dortmund 2 Inhalt Präambel Unsere Kunden Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Unser Jobcenter Unsere Führungskräfte Unser Leitbild Unser Jobcenter Präambel 03 Die gemeinsame
Leitbild des Jobcenters Dortmund 2 Inhalt Präambel Unsere Kunden Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Unser Jobcenter Unsere Führungskräfte Unser Leitbild Unser Jobcenter Präambel 03 Die gemeinsame
ALENA. Raum für Ideen
 ALENA Akademie für ländliche Entwicklung und Nachhaltigkeit Raum für Ideen Was ist ALENA? ALENA ist die Abkürzung für Akademie für ländliche Entwicklung und Nachhaltigkeit Der ländliche Raum leidet. Der
ALENA Akademie für ländliche Entwicklung und Nachhaltigkeit Raum für Ideen Was ist ALENA? ALENA ist die Abkürzung für Akademie für ländliche Entwicklung und Nachhaltigkeit Der ländliche Raum leidet. Der
Lokale Veranstaltung Hommertshausen und Workshop GEMEINDE DAUTPHETAL INTEGRIERTES KOMMUNALES ENTWICKLUNGSKONZEPT (IKEK) 15.11.2014/26.02.
 GEMEINDE DAUTPHETAL INTEGRIERTES KOMMUNALES ENTWICKLUNGSKONZEPT (IKEK) Lokale Veranstaltung Hommertshausen und Workshop 15.11.2014/26.02.2015 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE Bearbeitung: Hartmut Kind, Kai
GEMEINDE DAUTPHETAL INTEGRIERTES KOMMUNALES ENTWICKLUNGSKONZEPT (IKEK) Lokale Veranstaltung Hommertshausen und Workshop 15.11.2014/26.02.2015 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE Bearbeitung: Hartmut Kind, Kai
VORWORT. Der Gemeinderat freut sich, Ihnen das Leitbild der Gemeinde Weiach vorlegen zu können.
 Leitbild der Gemeinde Weiach 2014 2018 VORWORT Der Gemeinderat freut sich, Ihnen das Leitbild der Gemeinde Weiach vorlegen zu können. Nach Beginn der neuen Amtsdauer hat der Gemeinderat das bestehende
Leitbild der Gemeinde Weiach 2014 2018 VORWORT Der Gemeinderat freut sich, Ihnen das Leitbild der Gemeinde Weiach vorlegen zu können. Nach Beginn der neuen Amtsdauer hat der Gemeinderat das bestehende
Ehrenamtliches Engagement im Zivil- und Katastrophenschutz. Kurzfassung. 19. Dezember 2011
 Fakultät für Kulturreflexion Prof. Dr. Hans-Jürgen Lange Lehrstuhl für Politikwissenschaft, Sicherheitsforschung und Sicherheitsmanagement Alfred-Herrhausen-Str. 50 D-58448 Witten Telefon : 02302/926-809
Fakultät für Kulturreflexion Prof. Dr. Hans-Jürgen Lange Lehrstuhl für Politikwissenschaft, Sicherheitsforschung und Sicherheitsmanagement Alfred-Herrhausen-Str. 50 D-58448 Witten Telefon : 02302/926-809
MEHRGENERATIONENHAUS. Mannheim,
 MEHRGENERATIONENHAUS Mannheim, 26.10.2011 WER WIR SIND SIFE: Students In Free Enterprise 1975 in USA gegründet 40 Non-Profit Organisation vertreten in 40 Ländern WER WIR SIND 48.000 Studenten/ 1.600 Universitäten
MEHRGENERATIONENHAUS Mannheim, 26.10.2011 WER WIR SIND SIFE: Students In Free Enterprise 1975 in USA gegründet 40 Non-Profit Organisation vertreten in 40 Ländern WER WIR SIND 48.000 Studenten/ 1.600 Universitäten
Projekt Grenzen überwinden mit neuen Medien
 Projekt Grenzen überwinden mit neuen Medien Teilziel des Projektes: Deutsche und polnische Jugendliche untersuchen, dokumentieren und kommunizieren nachhaltige Entwicklung mit neuen Medien in der deutsch-polnischen
Projekt Grenzen überwinden mit neuen Medien Teilziel des Projektes: Deutsche und polnische Jugendliche untersuchen, dokumentieren und kommunizieren nachhaltige Entwicklung mit neuen Medien in der deutsch-polnischen
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Herren Bürgermeister der Pilotkommunen,
 Rede von Ministerpräsidentin Malu Dreyer anlässlich der Veranstaltung Landestreffen der Initiative Ich bin dabei! am 17. Juni 2014, 14.00 16.00 Uhr in der Staatskanzlei Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
Rede von Ministerpräsidentin Malu Dreyer anlässlich der Veranstaltung Landestreffen der Initiative Ich bin dabei! am 17. Juni 2014, 14.00 16.00 Uhr in der Staatskanzlei Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
EUROPÄISCHES JAHR DER FREIWILLIGENTÄTIGKEIT ZUR FÖRDERUNG DER AKTIVEN BÜRGERBETEILIGUNG 2011
 EUROPÄISCHES JAHR DER FREIWILLIGENTÄTIGKEIT ZUR FÖRDERUNG DER AKTIVEN BÜRGERBETEILIGUNG 2011 Freiwillig. Etwas bewegen! Rudolf Hundstorfer, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz Michael
EUROPÄISCHES JAHR DER FREIWILLIGENTÄTIGKEIT ZUR FÖRDERUNG DER AKTIVEN BÜRGERBETEILIGUNG 2011 Freiwillig. Etwas bewegen! Rudolf Hundstorfer, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz Michael
Von Menschen für Menschen in Schleswig-
 Von Menschen für Menschen in Schleswig- Holstein Strategiepapier 2020 der Landes-Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände Schleswig-Holstein e.v. Visionen und Ziele Wir haben Überzeugungen! Wir
Von Menschen für Menschen in Schleswig- Holstein Strategiepapier 2020 der Landes-Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände Schleswig-Holstein e.v. Visionen und Ziele Wir haben Überzeugungen! Wir
Was tut sich auf dem Land?
 Was tut sich auf dem Land? Leben und Seelsorge im Umbruch - Kirche und Raumplanung im Gespräch Seelsorgetag 2016, Erzdiözese München und Freising, Rosenheim, 29.November 2016 Claudia Bosse Quelle: www.erzbistum-muenchen.de
Was tut sich auf dem Land? Leben und Seelsorge im Umbruch - Kirche und Raumplanung im Gespräch Seelsorgetag 2016, Erzdiözese München und Freising, Rosenheim, 29.November 2016 Claudia Bosse Quelle: www.erzbistum-muenchen.de
Mission. Die Nassauische Heimstätte / Wohnstadt zählt zu den zehn größten nationalen Wohnungsunternehmen.
 Vision Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen die Zukunft der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt gemeinsam erfolgreich gestalten. Unsere Vision und Mission sowie unsere Leitlinien
Vision Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen die Zukunft der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt gemeinsam erfolgreich gestalten. Unsere Vision und Mission sowie unsere Leitlinien
Freiwilliges Engagement in der Schweiz
 Kantons- und Stadtentwicklung Basel, GGG Benevol/Koordinationsstelle Freiwilligenarbeit, Donnerstag, 3. März 2016, Zunftsaal im Schmiedenhof Freiwilliges Engagement in der Schweiz Aktuelle Zahlen und Befunde
Kantons- und Stadtentwicklung Basel, GGG Benevol/Koordinationsstelle Freiwilligenarbeit, Donnerstag, 3. März 2016, Zunftsaal im Schmiedenhof Freiwilliges Engagement in der Schweiz Aktuelle Zahlen und Befunde
VORWORT DAS MODELL MANNHEIM
 VORWORT DR. PETER KURZ DAS MODELL MANNHEIM ZIELE FÜR EINE MODERNE GROSSSTADT Mannheim etabliert sich als Stadt der Talente und der Bildung und gewinnt mehr Menschen für sich. Mannheim ist sich seiner Tradition
VORWORT DR. PETER KURZ DAS MODELL MANNHEIM ZIELE FÜR EINE MODERNE GROSSSTADT Mannheim etabliert sich als Stadt der Talente und der Bildung und gewinnt mehr Menschen für sich. Mannheim ist sich seiner Tradition
Lokale Agenda 21 in Wien Umsetzungsstruktur
 Lokale Agenda 21 in Wien Umsetzungsstruktur Lokale Agenda 21 Prozesse auf Bezirksebene: BürgerInnen gestalten und entscheiden mit Koordination und Finanzierung durch den Verein Lokale Agenda 21 aus zentralen
Lokale Agenda 21 in Wien Umsetzungsstruktur Lokale Agenda 21 Prozesse auf Bezirksebene: BürgerInnen gestalten und entscheiden mit Koordination und Finanzierung durch den Verein Lokale Agenda 21 aus zentralen
Unsere Vision zieht Kreise... Das Leitbild der NÖ Landeskliniken-Holding.
 Unsere Vision zieht Kreise... Das Leitbild der NÖ Landeskliniken-Holding UNSERE MISSION & UNSERE VISION UNSERE MISSION & UNSERE VISION Unsere Organisation Die NÖ Landeskliniken-Holding ist das flächendeckende
Unsere Vision zieht Kreise... Das Leitbild der NÖ Landeskliniken-Holding UNSERE MISSION & UNSERE VISION UNSERE MISSION & UNSERE VISION Unsere Organisation Die NÖ Landeskliniken-Holding ist das flächendeckende
Was tut sich auf dem Land?
 Was tut sich auf dem Land? Leben und Seelsorge im Umbruch - Kirche und Raumplanung im Gespräch Seelsorgetag 2016, Erzdiözese München und Freising, Rosenheim, 29.November 2016 Claudia Bosse Quelle: www.erzbistum-muenchen.de
Was tut sich auf dem Land? Leben und Seelsorge im Umbruch - Kirche und Raumplanung im Gespräch Seelsorgetag 2016, Erzdiözese München und Freising, Rosenheim, 29.November 2016 Claudia Bosse Quelle: www.erzbistum-muenchen.de
Kleingärten im Wandel der Zeit. Eine Analyse der Kleingartensituation in Zürich und Luzern.
 Kleingärten im Wandel der Zeit. Eine Analyse der Kleingartensituation in Zürich und Luzern. Eidgenössische Technische Hochschule Zürich D-BAUG Masterarbeit in Raumentwicklung und Infrastruktursysteme Januar
Kleingärten im Wandel der Zeit. Eine Analyse der Kleingartensituation in Zürich und Luzern. Eidgenössische Technische Hochschule Zürich D-BAUG Masterarbeit in Raumentwicklung und Infrastruktursysteme Januar
Transformation Richtung Nachhaltigkeit Wirtschaft im Augsburger Nachhaltigkeitsprozess
 Transformation Richtung Nachhaltigkeit Wirtschaft im Augsburger Nachhaltigkeitsprozess ADMIRe A 3 -Tagung Nachhaltigkeit als zukünfige Aufgabe und Leitbild der Wirtschaftsförderung?! 29.4.2014 Dr. Norbert
Transformation Richtung Nachhaltigkeit Wirtschaft im Augsburger Nachhaltigkeitsprozess ADMIRe A 3 -Tagung Nachhaltigkeit als zukünfige Aufgabe und Leitbild der Wirtschaftsförderung?! 29.4.2014 Dr. Norbert
Aussicht Uckermark. AGRO - ÖKO - Consult Berlin GmbH. Rhinstr. 137, Berlin
 Aussicht Uckermark Gliederung 1. Das Modellprojekt Ideenwettbewerb 50+ Beschäftigungspakte in den Regionen 2. Wie wird es in der Uckermark gemacht? 3. Projekt Aussicht Uckermark 3.1 Wer wir sind! 3.2 Was
Aussicht Uckermark Gliederung 1. Das Modellprojekt Ideenwettbewerb 50+ Beschäftigungspakte in den Regionen 2. Wie wird es in der Uckermark gemacht? 3. Projekt Aussicht Uckermark 3.1 Wer wir sind! 3.2 Was
Junge Menschen für das Thema Alter interessieren und begeistern Lebenssituation von älteren, hochaltrigen und pflegebedürftigen Menschen verbessern
 Stefanie Becker Vorgeschichte Die Geschichte der Gerontologie ist eine lange und von verschiedenen Bewegungen gekennzeichnet Das Leben im (hohen) Alter wird mit steigender Lebenserwartung komplexer und
Stefanie Becker Vorgeschichte Die Geschichte der Gerontologie ist eine lange und von verschiedenen Bewegungen gekennzeichnet Das Leben im (hohen) Alter wird mit steigender Lebenserwartung komplexer und
Forum Ostsee Mecklenburg-Vorpommern
 Forum Ostsee Mecklenburg-Vorpommern Bildungsorientierte Regionalentwicklung im deutsch-polnischen Grenzraum Dennis Gutgesell Anklam, 17. Juni 2014 Ein starkes Land Mecklenburg-Vorpommern kann es nachhaltig
Forum Ostsee Mecklenburg-Vorpommern Bildungsorientierte Regionalentwicklung im deutsch-polnischen Grenzraum Dennis Gutgesell Anklam, 17. Juni 2014 Ein starkes Land Mecklenburg-Vorpommern kann es nachhaltig
Aktives und gesundes Leben im Alter: Die Bedeutung des Wohnortes
 DZA Deutsches Zentrum für Altersfragen 5 Aktives und gesundes Leben im Alter: Die Bedeutung des Wohnortes Der Deutsche Alterssurvey (DEAS): Älterwerden und der Einfluss von Kontexten 1996 2002 2008 2011
DZA Deutsches Zentrum für Altersfragen 5 Aktives und gesundes Leben im Alter: Die Bedeutung des Wohnortes Der Deutsche Alterssurvey (DEAS): Älterwerden und der Einfluss von Kontexten 1996 2002 2008 2011
Es gilt das gesprochene Wort! Sperrfrist: Beginn der Rede!
 Grußwort des Staatssekretärs im Bundesministerium für Bildung und Forschung Dr. Wolf-Dieter Dudenhausen anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Vereins zur Förderung des Deutschen Forschungsnetzes (DFN)
Grußwort des Staatssekretärs im Bundesministerium für Bildung und Forschung Dr. Wolf-Dieter Dudenhausen anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Vereins zur Förderung des Deutschen Forschungsnetzes (DFN)
Unternehmenszweck, Vision, Mission, Werte
 Unternehmenszweck, Vision, Mission, Werte UNSER STRATEGISCHER RAHMEN Unternehmenszweck, Vision, Mission, Werte Wir haben einen klaren und langfristig ausgerichteten strategischen Rahmen definiert. Er hilft
Unternehmenszweck, Vision, Mission, Werte UNSER STRATEGISCHER RAHMEN Unternehmenszweck, Vision, Mission, Werte Wir haben einen klaren und langfristig ausgerichteten strategischen Rahmen definiert. Er hilft
Lokale Agenda 21 im Dialog
 Lokale Agenda 21 im Dialog die Zivilgesellschaft im Nachhaltigkeitsprozess Überblick Entstehungsgeschichte: Warum so starke Orientierung an der unorganisierten Zivilgesellschaft Ziele & Grundsätze Dialogorte
Lokale Agenda 21 im Dialog die Zivilgesellschaft im Nachhaltigkeitsprozess Überblick Entstehungsgeschichte: Warum so starke Orientierung an der unorganisierten Zivilgesellschaft Ziele & Grundsätze Dialogorte
Wohngemeinschaft im Kirschentäle
 Information zur selbstverantworteten ambulanten Wohngemeinschaft im Kirschentäle in Dettingen an der Erms Mit Wirkung Mit Einander Mit Herz Mit Liebe Mit Gefühl Mit Lachen Mit Freude Mit Freunden Mit Machen
Information zur selbstverantworteten ambulanten Wohngemeinschaft im Kirschentäle in Dettingen an der Erms Mit Wirkung Mit Einander Mit Herz Mit Liebe Mit Gefühl Mit Lachen Mit Freude Mit Freunden Mit Machen
Aufruf zur Antragstellung auf Projektförderung. des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren
 MINISTERIUM FÜR ARBEIT UND SOZIALORDNUNG, FAMILIE, FRAUEN UND SENIOREN Aufruf zur Antragstellung auf Projektförderung des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren für die
MINISTERIUM FÜR ARBEIT UND SOZIALORDNUNG, FAMILIE, FRAUEN UND SENIOREN Aufruf zur Antragstellung auf Projektförderung des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren für die
Teilhabechancen durch Bildung im Alter erhöhen - Bildung bis ins hohe Alter? Dr. Jens Friebe. Dezember 2015
 Teilhabechancen durch Bildung im Alter erhöhen - Bildung bis ins hohe Alter? Dr. Jens Friebe Dezember 2015 ÜBERSICHT 1. Warum wird die Bildung auch im höheren Alter immer wichtiger? 2. Welche Bildungsangebote
Teilhabechancen durch Bildung im Alter erhöhen - Bildung bis ins hohe Alter? Dr. Jens Friebe Dezember 2015 ÜBERSICHT 1. Warum wird die Bildung auch im höheren Alter immer wichtiger? 2. Welche Bildungsangebote
Konzept Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) der Stadt Zug. Kurzfassung
 Konzept Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) der Stadt Zug Kurzfassung Stadträtin Vroni Straub-Müller Kleine Kinder lernen spielend Spielen ist für Kinder die natürlichste und gleichzeitig
Konzept Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) der Stadt Zug Kurzfassung Stadträtin Vroni Straub-Müller Kleine Kinder lernen spielend Spielen ist für Kinder die natürlichste und gleichzeitig
Allgemeiner Sozialer Dienst Hamburg-Nord. Leitbild
 Allgemeiner Sozialer Dienst Hamburg-Nord Leitbild Präambel Die verfassungsgemäß garantierten Grundrechte verpflichten unsere Gesellschaft, Menschen bei der Verbesserung ihrer Lebenssituation zu unterstützen.
Allgemeiner Sozialer Dienst Hamburg-Nord Leitbild Präambel Die verfassungsgemäß garantierten Grundrechte verpflichten unsere Gesellschaft, Menschen bei der Verbesserung ihrer Lebenssituation zu unterstützen.
Die wichtigsten Punkte in der Behinderten-Hilfe im Deutschen Roten Kreuz
 Die wichtigsten Punkte in der Behinderten-Hilfe im Deutschen Roten Kreuz Ein Heft in Leichter Sprache Hinweis: In dem Heft gibt es schwierige Wörter. Sie sind unterstrichen. Die Erklärungen stehen im Wörterbuch
Die wichtigsten Punkte in der Behinderten-Hilfe im Deutschen Roten Kreuz Ein Heft in Leichter Sprache Hinweis: In dem Heft gibt es schwierige Wörter. Sie sind unterstrichen. Die Erklärungen stehen im Wörterbuch
Dein Erstes Mal Konzept der Kampagne
 Dein Erstes Mal Konzept der Kampagne Was motiviert uns zur Kampagne? Brandenburg hat sich was getraut - es hat das Wahlrechtsalter bei Kommunal- und Landtagswahlen auf 16 Jahre abgesenkt! Mit dieser chancenreichen
Dein Erstes Mal Konzept der Kampagne Was motiviert uns zur Kampagne? Brandenburg hat sich was getraut - es hat das Wahlrechtsalter bei Kommunal- und Landtagswahlen auf 16 Jahre abgesenkt! Mit dieser chancenreichen
ESF-Jahrestagung ESF : Ressourcen bündeln, Zukunft gestalten. Dialogrunde 4:
 Dialogrunde 4: Bildung nach der Schule: Förderung des lebenslangen Lernens ESF-Jahrestagung 2013 ESF 2014-2020: Ressourcen bündeln, Zukunft gestalten 11. November 2013, Cottbus Bildung nach der Schule:
Dialogrunde 4: Bildung nach der Schule: Förderung des lebenslangen Lernens ESF-Jahrestagung 2013 ESF 2014-2020: Ressourcen bündeln, Zukunft gestalten 11. November 2013, Cottbus Bildung nach der Schule:
Das Stadterscheinungsbild von Kommunen als Standortfaktor. Hans Schmid Bürgermeister Ludwigsburg
 Das Stadterscheinungsbild von Kommunen als Standortfaktor Hans Schmid Bürgermeister Ludwigsburg 28.10.2010 2 3 4 Stadterscheinungsbild - Ausgangssituation Wichtiger weicher Standortfaktor Mit
Das Stadterscheinungsbild von Kommunen als Standortfaktor Hans Schmid Bürgermeister Ludwigsburg 28.10.2010 2 3 4 Stadterscheinungsbild - Ausgangssituation Wichtiger weicher Standortfaktor Mit
Caritas im Bistum Augsburg
 Caritas im Bistum Augsburg Workshop 2 Wir DAHEIM in Graben! - Projekteinblicke Datum: 04.12.2014 Caritas im Bistum Augsburg Wir DAHEIM in Graben! Inklusions- und Sozialraumprojekt des Caritasverbandes
Caritas im Bistum Augsburg Workshop 2 Wir DAHEIM in Graben! - Projekteinblicke Datum: 04.12.2014 Caritas im Bistum Augsburg Wir DAHEIM in Graben! Inklusions- und Sozialraumprojekt des Caritasverbandes
Spenden ja engagieren nein Eine Analyse der kroatischen Zivilgesellschaft
 Spenden ja engagieren nein Eine Analyse der kroatischen Zivilgesellschaft von Svenja Groth, Praktikantin im KAS-Büro Zagreb Wir sind auf dem richtigen Weg hin zu einer aktiven Zivilgesellschaft, aber es
Spenden ja engagieren nein Eine Analyse der kroatischen Zivilgesellschaft von Svenja Groth, Praktikantin im KAS-Büro Zagreb Wir sind auf dem richtigen Weg hin zu einer aktiven Zivilgesellschaft, aber es
Kind sein. Trotz Diabetes. Eine tolle Idee.
 IM INTERVIEW: EINE DIANIÑO NANNY Kind sein. Trotz Diabetes. Eine tolle Idee. Es gibt Momente, die das Leben einer Familie auf einen Schlag für immer verändern. So ein Moment ist Diagnose Diabetes. Nichts
IM INTERVIEW: EINE DIANIÑO NANNY Kind sein. Trotz Diabetes. Eine tolle Idee. Es gibt Momente, die das Leben einer Familie auf einen Schlag für immer verändern. So ein Moment ist Diagnose Diabetes. Nichts
KS 15 - Wie gewinne ich Kinder- und Jugendtrainer. KS 15 Wie gewinne ich Kinder- und Jugendtrainer 2
 1 KS 15 - Wie gewinne ich Kinder- und Jugendtrainer KS 15 Wie gewinne ich Kinder- und Jugendtrainer 2 Alle Jahre wieder KS 15 Wie gewinne ich Kinder- und Jugendtrainer 3 Inhalte der Schulung KS 15 Wie
1 KS 15 - Wie gewinne ich Kinder- und Jugendtrainer KS 15 Wie gewinne ich Kinder- und Jugendtrainer 2 Alle Jahre wieder KS 15 Wie gewinne ich Kinder- und Jugendtrainer 3 Inhalte der Schulung KS 15 Wie
Fünf Schritte zur Zusammenarbeit. Gemeinsam aktiv für unsere Gesellschaft.
 Fünf Schritte zur Zusammenarbeit. 1. Unter http://engagement.telekom.de tragen Sie Ihre Kontaktdaten ein. Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie Ihre Log-in-Daten. 2. In einem Datenblatt zur Projekterfassung
Fünf Schritte zur Zusammenarbeit. 1. Unter http://engagement.telekom.de tragen Sie Ihre Kontaktdaten ein. Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie Ihre Log-in-Daten. 2. In einem Datenblatt zur Projekterfassung
Einführung. Forscher sagen, dass jeder Mensch persönliche Erfahrung mit Technik und Computern hat. Dies gilt auch für Menschen mit Behinderungen.
 ENTELIS Bericht in einfacher Sprache Einführung Forscher sagen, dass jeder Mensch persönliche Erfahrung mit Technik und Computern hat. Dies gilt auch für Menschen mit Behinderungen. Einige Leute haben
ENTELIS Bericht in einfacher Sprache Einführung Forscher sagen, dass jeder Mensch persönliche Erfahrung mit Technik und Computern hat. Dies gilt auch für Menschen mit Behinderungen. Einige Leute haben
Chancenorientiertes Demografie-Management am Saalebogen LUST AUF ZUKUNFT?!
 Chancenorientiertes Demografie-Management am Saalebogen 2012-2015 LUST AUF ZUKUNFT?! Hanka Giller, Sebastian Heuchel, Christian Uthe, Astrid von Killisch- Horn Wir werden älter, weniger und bunter! Lust
Chancenorientiertes Demografie-Management am Saalebogen 2012-2015 LUST AUF ZUKUNFT?! Hanka Giller, Sebastian Heuchel, Christian Uthe, Astrid von Killisch- Horn Wir werden älter, weniger und bunter! Lust
Herausgegeben von: Mobene GmbH & Co. KG Spaldingstraße 64 20097 Hamburg
 Geschäftsgrundsätze Herausgegeben von: Mobene GmbH & Co. KG Spaldingstraße 64 20097 Hamburg Stand: Juni 2012 inhalt Vorbemerkung Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz Mitarbeiter Geschäftspartner Öffentlichkeit
Geschäftsgrundsätze Herausgegeben von: Mobene GmbH & Co. KG Spaldingstraße 64 20097 Hamburg Stand: Juni 2012 inhalt Vorbemerkung Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz Mitarbeiter Geschäftspartner Öffentlichkeit
Institut für ökosoziales Management e.v.
 Institut für ökosoziales Management e.v. - Gesundheit Umwelt Soziales - Moderation eines Lokalen Agenda - Prozesses Erfahrungen und Möglichkeiten (Vortragsmanuskript anlässlich des Kolloquiums der Rostocker
Institut für ökosoziales Management e.v. - Gesundheit Umwelt Soziales - Moderation eines Lokalen Agenda - Prozesses Erfahrungen und Möglichkeiten (Vortragsmanuskript anlässlich des Kolloquiums der Rostocker
Bürgerbeteiligung in rechtlichen Strukturen verankern Erfahrungen, Voraussetzungen, Möglichkeiten
 : Bürgerbeteiligung in rechtlichen Strukturen verankern Erfahrungen, Voraussetzungen, Möglichkeiten Redaktion: Initiative Allianz für Beteiligung e.v. Frank Zimmermann Geschäftsstelle Koordinierungsstelle
: Bürgerbeteiligung in rechtlichen Strukturen verankern Erfahrungen, Voraussetzungen, Möglichkeiten Redaktion: Initiative Allianz für Beteiligung e.v. Frank Zimmermann Geschäftsstelle Koordinierungsstelle
Das Persönliche Budget
 Das Persönliche Budget Erfahrungen aus Deutschland Prof. Dr. Gudrun Wansing Universität Kassel Institut für Sozialwesen FG Behinderung und Inklusion Übersicht 1. Hintergrund und Zielsetzung des Persönlichen
Das Persönliche Budget Erfahrungen aus Deutschland Prof. Dr. Gudrun Wansing Universität Kassel Institut für Sozialwesen FG Behinderung und Inklusion Übersicht 1. Hintergrund und Zielsetzung des Persönlichen
Bürgerbeteiligung in Deutschland mehr Demokratie wagen? VORANSICHT
 Direkte Demokratie 1 von 28 Bürgerbeteiligung in Deutschland mehr Demokratie wagen? Ein Beitrag von Dr. Christine Koch-Hallas, Mannheim Zeichnung: Klaus Stuttmann Dauer Inhalt Ihr Plus 4 Stunden Definition
Direkte Demokratie 1 von 28 Bürgerbeteiligung in Deutschland mehr Demokratie wagen? Ein Beitrag von Dr. Christine Koch-Hallas, Mannheim Zeichnung: Klaus Stuttmann Dauer Inhalt Ihr Plus 4 Stunden Definition
Deutschland im demografischen Wandel.
 Deutschland im demografischen Wandel. Gefährdung des gesellschaftlichen Zusammenhalts? Prof. Dr. Norbert F. Schneider Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung 3. Berliner Demografie Forum 10. April 2014
Deutschland im demografischen Wandel. Gefährdung des gesellschaftlichen Zusammenhalts? Prof. Dr. Norbert F. Schneider Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung 3. Berliner Demografie Forum 10. April 2014
1. Stabile Engagementquote: Ostdeutschland hat aufgeholt 34%* % % * Deutschland insgesamt Westdeutschland Ostdeutschland In de
 Zivilgesellschaftliches Informationssystem Freiwilligensurvey Der Freiwilligensurvey ist ein öffentliches Informationssystem, das umfassende und detaillierte bundesund landesweite Informationen zum freiwilligen,
Zivilgesellschaftliches Informationssystem Freiwilligensurvey Der Freiwilligensurvey ist ein öffentliches Informationssystem, das umfassende und detaillierte bundesund landesweite Informationen zum freiwilligen,
Europa stärken für seine Bürgerinnen und Bürger, für seine Städte
 Begrüßungsrede von Oberbürgermeister Peter Feldmann, anlässlich der Hauptversammlung des Deutschen Städtetages am 24. April 2013 in Frankfurt am Main Europa stärken für seine Bürgerinnen und Bürger, für
Begrüßungsrede von Oberbürgermeister Peter Feldmann, anlässlich der Hauptversammlung des Deutschen Städtetages am 24. April 2013 in Frankfurt am Main Europa stärken für seine Bürgerinnen und Bürger, für
Verantwortungspartner-Region Ummanz
 Verantwortungspartner-Region Ummanz Ländliche Gesundheits- und Naturregion Das Projekt Verantwortungspartner-Regionen in Deutschland wird im Rahmen des Programms Gesellschaftliche Verantwortung im Mittelstand
Verantwortungspartner-Region Ummanz Ländliche Gesundheits- und Naturregion Das Projekt Verantwortungspartner-Regionen in Deutschland wird im Rahmen des Programms Gesellschaftliche Verantwortung im Mittelstand
Die Bedeutung von Moderation in der Dorfentwicklung
 Alle kommen zu Wort! Moderation in der Dorfentwicklung Workshop vom 19. 21. April 2015 im Intercity-Hotel Göttingen Die Bedeutung von Moderation in der Dorfentwicklung Einführender Vortrag am 20.04.2015
Alle kommen zu Wort! Moderation in der Dorfentwicklung Workshop vom 19. 21. April 2015 im Intercity-Hotel Göttingen Die Bedeutung von Moderation in der Dorfentwicklung Einführender Vortrag am 20.04.2015
Rahmenvereinbarung. zwischen. dem Senat der Freien Hansestadt Bremen. und
 Rahmenvereinbarung zwischen dem Senat der Freien Hansestadt Bremen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Bremen e.v. (Bremer Sinti Verein e.v. und Bremerhavener Sinti Verein e.v.) Präambel
Rahmenvereinbarung zwischen dem Senat der Freien Hansestadt Bremen und dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Bremen e.v. (Bremer Sinti Verein e.v. und Bremerhavener Sinti Verein e.v.) Präambel
Fragebogen zur Bedarfs- und Befindlichkeitsanalyse zur männlichen Vereinbarkeit von Beruf und Familie
 1 (trifft nicht zu) bis 5 (trifft voll zu) Unterstützung am Arbeitsplatz Fragebogen zur Bedarfs- und Befindlichkeitsanalyse zur männlichen Vereinbarkeit von Beruf und Familie Die Lösungen, die meine Firma
1 (trifft nicht zu) bis 5 (trifft voll zu) Unterstützung am Arbeitsplatz Fragebogen zur Bedarfs- und Befindlichkeitsanalyse zur männlichen Vereinbarkeit von Beruf und Familie Die Lösungen, die meine Firma
Bundespressekonferenz
 Bundespressekonferenz Mittwoch, den 29.Oktober 2014 Erklärung von Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.v. Deutscher Caritasverband e.v. Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Hauptvorstand Deutschland braucht
Bundespressekonferenz Mittwoch, den 29.Oktober 2014 Erklärung von Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.v. Deutscher Caritasverband e.v. Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Hauptvorstand Deutschland braucht
2. Arbeit entsteht durch marktnahe einfache Beschäftigung, die sonst im Ausland landet.
 Pressemitteilung Aufbaugilde Heilbronn-Franken e. V. Hans-Rießer-Straße 7 74076 Heilbronn Tel. 0 71 31 / 770-701 www.aufbaugilde.de Andere Wege wagen bei der Hilfe für Langzeitarbeitslose Heilbronn soll
Pressemitteilung Aufbaugilde Heilbronn-Franken e. V. Hans-Rießer-Straße 7 74076 Heilbronn Tel. 0 71 31 / 770-701 www.aufbaugilde.de Andere Wege wagen bei der Hilfe für Langzeitarbeitslose Heilbronn soll
Im Kolloqium wählen Sie eine dieser Säule aus und stellen in Ihrer Präsentation dar, wie sich diese Gegebenheiten auf die anderen Säulen auswirken.
 Das Kolloqium dauert 40 Minuten und besteht aus 15 Minuten Präsentation und 25 Minuten Gespräch. Sie haben einen Bericht geschrieben. Der Teil I Insitutionsanalyse des Berichtes besteht aus 4 Säulen: Konzepte
Das Kolloqium dauert 40 Minuten und besteht aus 15 Minuten Präsentation und 25 Minuten Gespräch. Sie haben einen Bericht geschrieben. Der Teil I Insitutionsanalyse des Berichtes besteht aus 4 Säulen: Konzepte
Zielsetzung. Quelle : Angewandtes Qualitätsmanagement [M 251] Ziele können unterschieden werden nach:
![Zielsetzung. Quelle : Angewandtes Qualitätsmanagement [M 251] Ziele können unterschieden werden nach: Zielsetzung. Quelle : Angewandtes Qualitätsmanagement [M 251] Ziele können unterschieden werden nach:](/thumbs/50/26220103.jpg) Quelle : Angewandtes Qualitätsmanagement [M 251] Zielsetzung Jedes Unternehmen setzt sich Ziele Egal ob ein Unternehmen neu gegründet oder eine bestehende Organisation verändert werden soll, immer wieder
Quelle : Angewandtes Qualitätsmanagement [M 251] Zielsetzung Jedes Unternehmen setzt sich Ziele Egal ob ein Unternehmen neu gegründet oder eine bestehende Organisation verändert werden soll, immer wieder
Leitbild Malans. Wohnen und leben in den Bündner Reben
 Leitbild Malans Wohnen und leben in den Bündner Reben Gemeinde Malans: Zukunftsperspektiven Richtziele Malans mit seinen natürlichen Schönheiten, Wein und Kultur ist eine liebens- und lebenswerte Gemeinde.
Leitbild Malans Wohnen und leben in den Bündner Reben Gemeinde Malans: Zukunftsperspektiven Richtziele Malans mit seinen natürlichen Schönheiten, Wein und Kultur ist eine liebens- und lebenswerte Gemeinde.
S t e c k b r i e f. Kneipen Säle Vereinslokale. Lebensmittelgeschäfte Bäcker Metzger Post Bank
 S t e c k b r i e f 1. Bewerbung von: Gemeinde: a) Ort b) Ortsgruppe c) Stadtteil (Unzutreffendes streichen) Wieso diese Kombination? 2. Einwohnerzahlen 3. Bevölkerungsstruktur (in Prozent) Einwohner 1900
S t e c k b r i e f 1. Bewerbung von: Gemeinde: a) Ort b) Ortsgruppe c) Stadtteil (Unzutreffendes streichen) Wieso diese Kombination? 2. Einwohnerzahlen 3. Bevölkerungsstruktur (in Prozent) Einwohner 1900
Es wär dann an der Zeit zu gehen.
 Es wär dann an der Zeit zu gehen. Wenn Menschen mit Behinderung erwachsen werden Moment Leben heute Gestaltung: Sarah Barci Moderation und Redaktion: Marie-Claire Messinger Sendedatum: 13. November 2012
Es wär dann an der Zeit zu gehen. Wenn Menschen mit Behinderung erwachsen werden Moment Leben heute Gestaltung: Sarah Barci Moderation und Redaktion: Marie-Claire Messinger Sendedatum: 13. November 2012
Föderalismus in Deutschland
 Lektürefragen zur Orientierung: 1. Welchen Ebenen gibt es im deutschen Föderalismus? 2. Welche Aufgaben und Kompetenzen haben die einzelnen Ebenen? Diskussionsfragen: 3. Welche Vor- und Nachteile hat eine
Lektürefragen zur Orientierung: 1. Welchen Ebenen gibt es im deutschen Föderalismus? 2. Welche Aufgaben und Kompetenzen haben die einzelnen Ebenen? Diskussionsfragen: 3. Welche Vor- und Nachteile hat eine
Unternehmenszweck und -aufgaben
 Unternehmenszweck und -aufgaben Das oberste Ziel der Genossenschaft und ihre Aufgaben leiten sich direkt aus der Satzung ab: Zweck der Genossenschaft ist vorrangig eine gute, sichere und sozial verantwortbare
Unternehmenszweck und -aufgaben Das oberste Ziel der Genossenschaft und ihre Aufgaben leiten sich direkt aus der Satzung ab: Zweck der Genossenschaft ist vorrangig eine gute, sichere und sozial verantwortbare
Ziele und Schwerpunkte des EFRE in Brandenburg
 Ziele und Schwerpunkte des EFRE in Brandenburg 2014-2020 0 Zielsystem des EFRE im Land Brandenburg Platzhalter für eine Grafik. Das Zielsystem des EFRE teilt sich auf in: Ein Hauptziel, das von siebzehn
Ziele und Schwerpunkte des EFRE in Brandenburg 2014-2020 0 Zielsystem des EFRE im Land Brandenburg Platzhalter für eine Grafik. Das Zielsystem des EFRE teilt sich auf in: Ein Hauptziel, das von siebzehn
Entwicklung der LEADER- Entwicklungsstrategie der LAG Vogtland
 Entwicklung der LEADER- Entwicklungsstrategie der LAG Vogtland Das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) setzte am 9. Oktober 2013 den ersten Schritt in Richtung neuer Förderperiode.
Entwicklung der LEADER- Entwicklungsstrategie der LAG Vogtland Das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) setzte am 9. Oktober 2013 den ersten Schritt in Richtung neuer Förderperiode.
Pflegeheim Am Nollen Gengenbach
 Pflegeheim Am Nollen Gengenbach Geplante Revision: 01.06.2018 beachten!!! Seite 1 von 7 Unsere Gedanken zur Pflege sind... Jeder Mensch ist einzigartig und individuell. In seiner Ganzheit strebt er nach
Pflegeheim Am Nollen Gengenbach Geplante Revision: 01.06.2018 beachten!!! Seite 1 von 7 Unsere Gedanken zur Pflege sind... Jeder Mensch ist einzigartig und individuell. In seiner Ganzheit strebt er nach
Wenn wir das Váray-Quartett so wunderbar musizieren hören, spüren wir, wie uns Kunst und Kultur berühren.
 Sperrfrist: 14. Februar 2014, 10.30 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Verleihung des
Sperrfrist: 14. Februar 2014, 10.30 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Verleihung des
GElsenkirchen eine Stadt mit vielen Gesichtern
 GElsenkirchen eine Stadt mit vielen Gesichtern Grundlagen der strategischen Stadtentwicklungsplanung Sozial, ökonomisch, ökologisch GElsenkirchen eine Stadt mit vielen GEsichtern Grundlagen der strategischen
GElsenkirchen eine Stadt mit vielen Gesichtern Grundlagen der strategischen Stadtentwicklungsplanung Sozial, ökonomisch, ökologisch GElsenkirchen eine Stadt mit vielen GEsichtern Grundlagen der strategischen
Ehrenamtsagentur Jossgrund. Das gute Leben das Gute leben. Helmut Ruppel Vereinskonferenz Bürgerhaus Jossgrund Oberndorf, 14.
 Ehrenamtsagentur Jossgrund Das gute Leben das Gute leben Helmut Ruppel Vereinskonferenz Bürgerhaus Jossgrund Oberndorf, 14. März 2016 Das gute Leben das Gute leben 6 Kernsätze beschreiben das Selbstverständnis
Ehrenamtsagentur Jossgrund Das gute Leben das Gute leben Helmut Ruppel Vereinskonferenz Bürgerhaus Jossgrund Oberndorf, 14. März 2016 Das gute Leben das Gute leben 6 Kernsätze beschreiben das Selbstverständnis
Bundesrat Moritz Leuenberger
 Rede von Bundesrat Moritz Leuenberger Vorsteher des Eidgenössischen Departementes für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation anlässlich der Eröffnung der dritten Vorbereitungskonferenz (PrepCom 3)
Rede von Bundesrat Moritz Leuenberger Vorsteher des Eidgenössischen Departementes für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation anlässlich der Eröffnung der dritten Vorbereitungskonferenz (PrepCom 3)
Konkret handeln in NRW Das Projekt Labor WittgensteinWandel!
 Konkret handeln in NRW Das Projekt Labor WittgensteinWandel! Ländliche Regionen mit Zukunft Gestaltung des Wandels in der Region Wittgenstein Wittgenstein Der Prozess WittgensteinWandel Erfahrungen aus
Konkret handeln in NRW Das Projekt Labor WittgensteinWandel! Ländliche Regionen mit Zukunft Gestaltung des Wandels in der Region Wittgenstein Wittgenstein Der Prozess WittgensteinWandel Erfahrungen aus
Berlin, 23. Januar Impulsvortrag Professor Volker Hahn, geschäftsführender Gesellschafter
 Netzwerk statt Einzelkämpfer: Überblick - Was gibt es in der Bundesrepublik und gar darüber hinaus? Welche Kriterien machen eine Nahversorgung in kleinen Lebensräumen erfolgreich? Berlin, 23. Januar 2013
Netzwerk statt Einzelkämpfer: Überblick - Was gibt es in der Bundesrepublik und gar darüber hinaus? Welche Kriterien machen eine Nahversorgung in kleinen Lebensräumen erfolgreich? Berlin, 23. Januar 2013
Strategieentwicklung Der Weg zu einer erfolgreichen Unternehmensstrategie global denken, lokal handeln.
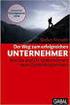 CONSULTING PEOPLE Strategieentwicklung Der Weg zu einer erfolgreichen Unternehmensstrategie global denken, lokal handeln. Analyse / Ziele / Strategieentwicklung / Umsetzung / Kontrolle Report: August 2012
CONSULTING PEOPLE Strategieentwicklung Der Weg zu einer erfolgreichen Unternehmensstrategie global denken, lokal handeln. Analyse / Ziele / Strategieentwicklung / Umsetzung / Kontrolle Report: August 2012
Pädagogisches Konzept. KiBiZ Tagesfamilien
 Pädagogisches Konzept KiBiZ Tagesfamilien Erweiterte Familien mit individuellem Spielraum Die grosse Stärke der Tagesfamilienbetreuung liegt in der Individualität. KiBiZ Tagesfamilien bieten Spielraum
Pädagogisches Konzept KiBiZ Tagesfamilien Erweiterte Familien mit individuellem Spielraum Die grosse Stärke der Tagesfamilienbetreuung liegt in der Individualität. KiBiZ Tagesfamilien bieten Spielraum
Bürgerschaftliches Engagement in den Frühen Hilfen. drei Beispiele aus Flensburg
 Bürgerschaftliches Engagement in den Frühen Hilfen drei Beispiele aus Flensburg Bürgerschaftliches Engagement in den Frühen Hilfen in Flensburg Einbindung von bürgerschaftlichem Engagement in die Frühen
Bürgerschaftliches Engagement in den Frühen Hilfen drei Beispiele aus Flensburg Bürgerschaftliches Engagement in den Frühen Hilfen in Flensburg Einbindung von bürgerschaftlichem Engagement in die Frühen
Evaluation von Partizipationsvorhaben mit Jugendlichen
 Evaluation von Partizipationsvorhaben mit Jugendlichen Fragebogen für Projekte und Vorhaben Die Initiative mitwirkung! Kinder und Jugendliche sind fast immer von politischen Entscheidungen betroffen. Selten
Evaluation von Partizipationsvorhaben mit Jugendlichen Fragebogen für Projekte und Vorhaben Die Initiative mitwirkung! Kinder und Jugendliche sind fast immer von politischen Entscheidungen betroffen. Selten
Ergebnisse der Befragung von Schulen zur Umsetzung von Maßnahmen der Personalentwicklung
 Ergebnisse der Befragung von Schulen zur Umsetzung von Maßnahmen der Personalentwicklung Im Zeitraum von November 2005 bis zum Februar 2006 erfolgte eine anonyme Schulleiterinnen- und Schulleiterbefragung
Ergebnisse der Befragung von Schulen zur Umsetzung von Maßnahmen der Personalentwicklung Im Zeitraum von November 2005 bis zum Februar 2006 erfolgte eine anonyme Schulleiterinnen- und Schulleiterbefragung
Weil mir mein Dorf ein Anliegen ist es ist mir nicht gleichgültig, wie es sich weiterentwickelt und wie es den Menschen in unserer Gemeinde geht.
 Name: Code: Zu meiner Person Bitte den per Post mitgeteilten Code angeben Name: Bauer Holzeisen Vorname: Marianne Beruf: Kindergartendirektorin Meine politische Erfahrung: 20 Jahre Mitglied des Gemeinderates
Name: Code: Zu meiner Person Bitte den per Post mitgeteilten Code angeben Name: Bauer Holzeisen Vorname: Marianne Beruf: Kindergartendirektorin Meine politische Erfahrung: 20 Jahre Mitglied des Gemeinderates
