Mehrjahresprogramm
|
|
|
- Ralf Morgenstern
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Mehrjahresprogramm bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung
2
3 Mehrjahresprogramm Bern 2015 bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung
4
5 Impressum Herausgeberin Druck/Auflage bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung Postfach CH-3001 Bern Tel Fax Bezug auf Art.-Nr UD Medien AG, Reusseggstrasse 9, CH-6002 Luzern 1/2015/1800 Gedruckt auf FSC-Papier bfu 2015 Alle Rechte vorbehalten; Reproduktion (z. B. Fotokopie), Speicherung, Verarbeitung und Verbreitung sind mit Quellenangabe (s. Zitationsvorschlag) gestattet. Zitationsvorschlag bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung. bfu-mehrjahresprogramm Bern: bfu; 2015.
6
7 Vorwort Wir machen Menschen sicher! Unfälle im Strassenverkehr, Sportunfälle und Unfälle in Haus und Freizeit in der Schweiz, pro Jahr. Zu viele, das finden nicht nur wir. Der Gesetzgeber hat uns deshalb mit der Verhütung von Unfällen beauftragt. Unsere Mission: Wir setzen uns mit ganzer Kraft für die Verhütung von Unfällen und die Minderung von Unfallfolgen ein. Wir vermindern sowohl menschliches Leid als auch volkswirtschaftliche Kosten und erhöhen die Lebensqualität der Bevölkerung. Alle Altersklassen, sozialen Schichten und Sprachregionen profitieren von unserem Wissen und unseren Empfehlungen. Wir ermöglichen, Tätigkeiten sicher auszuüben, ohne sie zu verhindern. Unsere Ziele verfolgen wir zusammen mit Partnern und der Bevölkerung. Die Statistik zeigt es deutlich: Es gibt nach wie vor viel zu tun, um die hohe Zahl von mehr als einer Million Unfällen zu senken. Wie wir dies erreichen wollen, ist im vorliegenden Mehrjahresprogramm dargestellt. Es zeigt unsere Schwerpunkte und die geplanten Präventionsmassnahmen der nächsten 5 Jahre auf. Mit der Veröffentlichung unseres Programms schaffen wir Transparenz und motivieren unsere Partner, gemeinsam mit uns die Mission zu verfolgen. Brigitte Buhmann Direktorin Drei Grundsätze bestimmen unsere Arbeit: Als Fachstelle sind wir ausschliesslich der Sicherheit verpflichtet. Wir agieren unabhängig von wirtschaftlichen und politischen Partikularinteressen. Wir stützen unsere Empfehlungen bei der Ausbildung, der Beratung und der Kommunikation auf die aktuellsten Erkenntnisse der Unfall- und Präventionsforschung und achten konsequent auf ein sinnvolles Kosten-Nutzen-Verhältnis. Wir arbeiten eng mit Partnern zusammen. Wichtig sind uns die internationale Vernetzung und die regionale Verankerung. Mehrjahresprogramm Vorwort 5
8 Inhalt Vorwort 5 I. Die bfu das Kompetenzzentrum für Unfallverhütung in der Schweiz 7 II. Evaluation Mehrjahresprogramm III. Rahmenbedingungen 10 IV. Präventionsgrundsätze 12 V. Handlungsbedarf und Präventionsziele 14 VI. Finanzen und Ressourcenallokation 16 VII. Schwerpunkte im Strassenverkehr 20 VIII. Schwerpunkte in Sport und Bewegung 24 IX. Schwerpunkte in Haus und Freizeit 28 X. Entwicklungsziele Positionierung als Forschungszentrum NBU-Prävention Entwicklung integrierter Bildungsangebote Pflege des integrierten bfu-beratungsangebots Professionalisierung der Beratungen der bfu-sicherheitsdelegierten Ausbau integrierter Angebote für Betriebe Positionierung als Kontrollorgan Produktesicherheit Erhöhung der Präventionswirkung dank integrierter Kommunikation Erhöhung der Präventionswirkung durch Vernetzung Schlankerer Support im Dienste der Unfallverhütung 44 6 Vorwort Mehrjahresprogramm
9 I. Die bfu das Kompetenzzentrum für Unfallverhütung in der Schweiz Die bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung wurde 1938 gegründet und 1984 in eine privatrechtlich organisierte Stiftung umgewandelt. Sie hat den gesetzlichen Auftrag, durch Aufklärung und Förderung allgemeiner Sicherheitsvorkehrungen Unfälle zu verhindern resp. deren Folgen zu mindern. Zudem hat ihr der Gesetzgeber die Aufgabe übertragen, gleichartige Bestrebungen von Organisationen mit ähnlicher Zielsetzung zu koordinieren (Unfallversicherungsgesetz, Art. 88). Dieser breite Präventionsauftrag, der die Gebiete Strassenverkehr, Sport und Bewegung sowie Haus und Freizeit abdeckt und sowohl die Anpassung des menschlichen Verhaltens als auch der Verhältnisse anvisiert, erlaubt der bfu einen optimalen Mitteleinsatz und eine sinnvolle Organisation. Die Synergien zwischen den Gebieten führen zu einem hohen Wissensstand und zu hoher Effizienz. Die Tätigkeit der bfu wird in erster Linie durch einen Zuschlag auf der Prämie der Nichtberufsunfallversicherung finanziert, dessen Höhe der Bundesrat festlegt. Im Stiftungsrat dem Steuerorgan der bfu sind die Suva und die Privatversicherungen vertreten. Dank der gesicherten Grundfinanzierung kann die bfu eine ausschliesslich der Sicherheit verpflichtete Unfallprävention betreiben, unabhängig von wirtschaftlichen und politischen Partikularinteressen. Ziele, Schwerpunkte und Arbeitsprogramm legt sie aufgrund des Handlungsbedarfs (Unfallschwerpunkte) und des Wissens über die Wirkung von Präventionsmassnahmen (Good-Practice-Wissen) fest. Mitberücksichtigt werden das gesellschaftliche und politische Umfeld sowie die zur Verfügung stehenden Ressourcen. Ziele, Schwerpunkte und Mehrjahresprogramm werden alle 5 Jahre überarbeitet. Im vorliegenden Mehrjahresprogramm wird einleitend die Evaluation des Mehrjahresprogramms für die Jahre zusammengefasst, die aktuellen Rahmenbedingungen werden beschrieben, die Grundsätze bei der Schwerpunktsetzung erläutert, die Schwerpunkte definiert und die Entwicklungsziele beschrieben. Das Dokument wurde am 5. Juni 2015 vom bfu-stiftungsrat genehmigt. Arbeitsgrundsätze der bfu Die bfu steuert und beeinflusst die Nichtberufsunfallprävention entsprechend dem Präventionskreislauf durch eine umfassende Analyse des Handlungsbedarfs, die Formulierung von quantitativen Zielen bezüglich Unfallgeschehen, die Suche nach geeigneten Interventionen, die Durchführung von Massnahmen sowie durch eine Überprüfung der realisierten Massnahmen. Der Präventionskreislauf schliesst sich. Die bfu setzt auf ihre Kernkompetenzen Forschung, Ausbildung, Beratung sowie Kommunikation und ist sowohl in der Verhältnisprävention (Infrastruktur, Technik, Produktesicherheit, Recht und Normen) als auch der Verhaltensprävention tätig. Die bfu trägt zu einer sachlichen Diskussion bei, indem sie das Sicherheitspotenzial möglicher Massnahmen mit anerkannten wissenschaftlichen Methoden analysiert und Good-Practice-Empfehlungen formuliert. Sie berücksichtigt dabei weder wirtschaftliche noch politische Partikularinteressen. Die bfu arbeitet eng mit Präventionspartnern, Behörden, Verbänden und der Wirtschaft zusammen und koordiniert die Tätigkeiten. Sie pflegt ihre nationalen und internationalen Fachkontakte und ist regional stark verankert. Mehrjahresprogramm Die bfu das Kompetenzzentrum für Unfallverhütung in der Schweiz 7
10 II. Evaluation Mehrjahresprogramm Die bfu veröffentlicht ihre Mehrjahresprogramme seit Während in der Planung das Leitmotto die Intensivierung der Kommunikation war, stand bei der Zielformulierung die Pflege der Partnerschaften und der Koordination ganz oben auf der Prioritätenliste. Bezüglich Zielerreichung des Programms sind erst qualitative Aussagen möglich, da die Unfallstatistik noch keine Daten für das Jahr 2015 liefert. Mehr Einfluss der Forschung auf die Präventionstätigkeit Im Zeitraum konnte der Einfluss der bfu- Forschung auf die Präventionstätigkeit der bfu, aber auch auf die von Partnern verstärkt werden. Der Wissenstransfer von der Forschung zu internen und externen Fachspezialisten ist geglückt. Erfolgsfaktoren dazu waren u. a. die Bereitstellung zuverlässiger Indikatoren zum Sicherheitsniveau (STATUS, SINUS- Report, Sicherheitsdossier, Hochrechnung), Mitarbeit der Forschung bei konkreten Präventionsmassnahmen (u. a. bei Kampagnen) und Durchführung von Evaluationen zentraler Sicherheitsmassnahmen (z. B. 2-Phasen-Fahrausbildung, Sturzprävention). Die Sportforschung wurde ausgebaut und ihre Erkenntnisse sind besonders von den Partnern in den Schwerpunktprogrammen sehr gut aufgenommen worden. Mehr Ausbildung für die Prävention bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen Das Ziel, mehr in die Ausbildung für die Prävention bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu investieren, konnte erreicht werden. Für Schulen wurde ein integrales Sicherheitspaket entwickelt. Mit Jugend und Sport (J+S) wurden für alle 70 relevanten Sportarten minimale Sicherheitsanforderungen definiert und implementiert; für die Prävention von Ertrinkungsunfällen wurde der Wasser-Sicherheits- Check (WSC) für Kinder entwickelt. Mit der Entwicklung neuer Lehrmethoden und -mittel förderte die bfu die sicherheitsorientierte Ausbildung von jungen Autofahrern; zudem setzte sie sich beim Bund für die Verbesserung der Vorschriften zur Fahrausbildung ein. Ausdehnung der Beratung auf weitere Tätigkeitsfelder Die Beratungstätigkeit der bfu konnte auf neue Tätigkeitsfelder ausgedehnt werden. Das gilt insbesondere für die Beratung im Outdoor-Bereich und im Tourismus (Mountainbike-Trails, Schlittel- und Schneeschuhrouten, Qualitätslabels des Tourismus usw.). Erweitert wurde auch das Beratungsangebot zur Sturzprävention für ältere Personen. Inhaltliche Verbesserungen wurden bei den verkehrstechnischen Infrastrukturberatungen vorgenommen, wo zusammen mit Partnern die ISSI-Instrumente entwickelt wurden, die nun systematisch angewendet werden. Andere Tätigkeiten im Bereich Ausbildung, wie Nachschulung von Verkehrsdelinquenten, Schulung von Sicherheitsfachleuten in Betrieben, Kurse Arbeitsfahrten, Kursangebote für Fachspezialisten des Weiterbildungszentrums usw. wurden im normalen Rahmen weitergeführt. Vom Sicherheitsdelegierten zur Sicherheitsfachkraft Das Kaskadensystem, wonach Anfragen mit tiefer Komplexität durch die Sicherheitsdelegierten, solche mit mittlerer Komplexität durch die Chef-Sicher- 8 Evaluation Mehrjahresprogramm Mehrjahresprogramm
11 heitsdelegierten und diejenigen mit hoher Komplexität durch die Fachexperten der bfu (Verkehrsingenieure, Architekten, Experten für Sportanlagen usw.) bearbeitet werden, hat sich etabliert und funktioniert reibungslos. Das Kursangebot, mit dem sich interessierte Sicherheitsdelegierte weiterbilden können, wurde gestartet. Die Erfolgschancen stehen auch für das Fernziel gut, zusammen mit Partnern eine Ausbildung zur Sicherheitsfachkraft mit eidg. Anerkennung aufzubauen. Mehr Kontrollen durch neues Produktesicherheitsgesetz Das im Herbst 2009 verabschiedete Produktesicherheitsgesetz hat zu einem Ausbau der Kontrollen geführt. Pro Jahr werden heute drei bis vier Stichproben durchgeführt und es wird deutlich mehr Meldungen betreffend Produktemängeln nachgegangen. Die Tätigkeit der bfu auf diesem Gebiet ist bei Herstellern besser bekannt und diese greifen immer öfter auch auf unsere Beratung zurück, damit es erst gar nicht zu Sicherheitsmängeln an den Produkten kommt. Diese generalpräventive Wirkung ist eine der Absichten des Produktesicherheitsgesetzes. Zielgruppengerechtere Kommunikation dank neuen Instrumenten Die Kommunikation wurde in den letzten fünf Jahren weiter verbessert und bedeutend stärker auf die Bedürfnisse der Zielgruppen zugeschnitten. Dazu hat nicht zuletzt der Relaunch der bfu-website mit vielen neuen Funktionen und der Ersatz von Broschüren durch Videofilme beigetragen. Letztere sprechen Zielgruppen direkter, wirkungsvoller und vielfach auch kostengünstiger an. Das Ziel, dass die bfu jeweils die Federführung in einer der nationalen Grosskampagnen des Fonds für Verkehrssicherheit innehat, wurde nur in der ersten Hälfte der Planungsperiode erreicht. Schliesslich konnte auch das 75-jährige Jubiläum der bfu plangemäss durchgeführt und angemessen gefeiert werden. Bessere Koordination dank Schwerpunktprogrammen Der Start der Schwerpunktprogramme (SPP) war ein Erfolg. Die Koordination mit Partnern, insbesondere auf den Gebieten Schneesport, Fahrrad/Bike, Bergsport und Stürze, wurde wesentlich verbessert, wodurch die Wirkung der Präventionsaktivitäten erhöht werden konnte. Aber auch bei den Themen Motorrad und Neulenkende konnte dank der SPP eine Intensivierung und Verbesserung der Kontakte erreicht werden. So führten die bfu und die Föderation der Motorradfahrer der Schweiz (FMS) gemeinsam eine Motorradkampagne durch. Nicht gestartet wurde das angedachte SPP Geschwindigkeit, da es zu viele Überschneidungen mit den Themen Neulenkende und Motorrad gab. Dafür wurde ein Programm «Wasser» zur Ertrinkungsprävention lanciert, das so erfolgreich war, dass es für den Zeitraum in ein SPP überführt wird. Schlankerer Support im Dienst der Unternehmensziele Die Supportdienste können mit verkürzten Prozessen und integrierten Applikationen die Fachabteilungen noch effektiver und effizienter unterstützen. Gleichzeitig konnten in diesem Bereich durch die Prozessoptimierung auch Ressourcen eingespart werden. Mehrjahresprogramm Evaluation Mehrjahresprogramm
12 III. Rahmenbedingungen Das Problembewusstsein der Bevölkerung bezüglich Unfälle ist in der Schweiz erfreulich hoch. Diese Sensibilisierung geht mit einer wachsenden Anspruchshaltung gegenüber körperlicher Unversehrtheit einher. Sie äussert sich in der ideellen Unterstützung vieler, auch repressiver Sicherheitsmassnahmen, insbesondere im Strassenverkehr und wenn es um den Schutz vor Fremdgefährdung und unfreiwillig eingegangenem Risiko geht. Auch die Politik bekräftigt immer wieder ihren Willen zur Unfallprävention und hat in den letzten Jahren einige Gesetze mit hohem Präventionspotenzial verabschiedet (Via sicura, Sportförderungsgesetz, Gesetz über Risikoaktivitäten und das neue Erwachsenenschutzrecht). Obwohl vermutet werden kann, dass dieses unfallpräventionsfreundliche Klima auch weiterhin besteht, muss sich die Unfallverhütung dennoch auf verschiedene Änderungen bei den gesellschaftlichen, technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen einstellen. Aus der beigezogenen wissenschaftlichen Literatur lassen sich folgende relevante Trends herleiten: Demographische Alterung Die demographische Zusammensetzung der Bevölkerung wird sich in den nächsten Jahrzehnten stark verändern. Insbesondere werden immer mehr ältere Menschen in der Schweiz leben. Diese werden gesünder sein, höhere Mobilitätsanforderungen haben, mehr Sport treiben und auch ihre Zeit im Haus- und Freizeitbereich aktiver und körperlich anspruchsvoller gestalten (Werken, Gartenarbeit). Trotz der besseren Gesundheit sind Senioren durch ihre verlangsamte Reaktionsfähigkeit aber weiterhin unfallgefährdeter als junge Menschen und aufgrund der abnehmenden Muskelkraft und Osteoporose- Gefahr (insbesondere bei Frauen) auch verletzlicher: Gleiche Unfallkräfte führen zu schwereren Verletzungen. Mit der zunehmenden Zahl hochbetagter Menschen kommt das Problem der Demenz hinzu, was sich insbesondere im Strassenverkehr und hinsichtlich Sturzunfälle negativ auswirkt. Diese Entwicklungen bedeuten, dass sich die Unfallverhütung in Zukunft mehr um die Belange der Senioren kümmern muss. Grössere Bedeutung der Frauen in Gesellschaft und Wirtschaft Die grössere Bedeutung der Frauen in Gesellschaft und Wirtschaft wird mit einer erhöhten Teilnahme am Strassenverkehr und an (risikoreicheren) sportlichen Aktivitäten einhergehen. Dadurch und durch deren höhere Verletzlichkeit werden die Unfallzahlen von Frauen steigen, auch wenn diese ein risikoärmeres Verhalten als Männer im Strassenverkehr und Sport aufweisen. Insgesamt müssen geschlechtsspezifische Aspekte bei der Unfallprävention ein höheres Gewicht erhalten. Mehr Personen mit Migrationshintergrund Der Anteil Personen mit Migrationshintergrund wird tendenziell steigen oder mindestens auf demselben Niveau bleiben. Insbesondere die bildungsferne Migrationsbevölkerung hat tendenziell ein höheres Unfallrisiko. Personen mit Migrationshintergrund sind aus sprachlichen, kulturellen und bildungsbedingten Gründen mit Präventionsbotschaften schwieriger zu erreichen. Für sie müssen speziell angepasste Präventionsmassnahmen entwickelt werden. 10 Rahmenbedingungen Mehrjahresprogramm
13 Zunehmender Stellenwert von Gesundheit und Unversehrtheit Wie eingangs erwähnt misst die Gesellschaft der Gesundheit und Unversehrtheit einen immer höheren Stellenwert zu. Dies führt zu mehr körperlichen Aktivitäten, aber auch zu vermehrtem Medikamentenkonsum. Beides kann sich positiv wie negativ auf die Unfallzahlen auswirken und muss bei der Prävention berücksichtigt werden. Freizeitgesellschaft und Trend zu mehr Outdoor- Aktivitäten Die Menschen in der Schweiz werden künftig noch mehr Freizeit zur Verfügung haben. Ein wachsender Teil der Bevölkerung wird seine Freizeit mit sportlichen (Outdoor-)Aktivitäten und anderen aktiven Freizeitbeschäftigungen verbringen. Dies auch als Reaktion auf die sich wandelnde Berufswelt, die immer weniger körperlichen Einsatz verlangt. Dabei werden in informellen Gruppen eher Einzelsportarten mit zum Teil hohem Risiko für schwere oder gar tödliche Unfälle gewählt. Der Trend zu «instant fun», Risiko- und Abenteueraktivitäten scheint im Moment ungebrochen. Auch hier ist die Unfallprävention herausgefordert. Zunehmende Globalisierung Die Globalisierung führt dazu, dass immer mehr Produkte aus dem Ausland in die Schweiz gelangen. Ein zunehmender Teil dieser Importprodukte erfüllt die geltenden Sicherheitsnormen nicht, was zu vermehrten Unfällen führen kann. Im Sportbereich kommt hinzu, dass immer mehr neue Sportgeräte und neue Bewegungsarten in die Schweiz «importiert» werden, die zum Teil erhebliche Unfallgefahren bergen. Rasante Entwicklung in der Technologie Durch den Einzug von Informations- und Kommunikationstechnologien in Strassenverkehr, Sport und Bewegung sowie Haus und Freizeit ergeben sich ganz neue Möglichkeiten für die Prävention. Besonders vielversprechend sind die intelligenten Fahrzeugtechnologien (Fahrassistenzsysteme, ABS bei Motorrädern), die Airbag-Technologie, die mobilen Kommunikationsgeräte mit Standortdaten und die intelligente Haustechnik (Sturzdetektion im Hausbereich, Pflegeroboter, Hilfsmittel für kontextabhängige Sensorik). Präventionsfreundliche Rechtsprechung Die Unfallverhütung kann sich auf eine Vielzahl rechtlicher Vorgaben auf allen politischen Ebenen abstützen: Verwaltungsrecht (z. B. Baurecht) oder Normen (z. B. SIA) sind verbindlich oder zumindest rechtlich relevant und enthalten viele einschlägige Vorschriften. Eine Herausforderung ist, dass diese Vorgaben oft zu wenig bekannt sind. Besonders relevant ist auch die bundesgerichtliche Rechtsprechung, die sich nicht selten auf Empfehlungen von Kompetenzzentren wie die bfu abstützt. Schliesslich nehmen Versicherungen Leistungskürzungen bei Unfällen aufgrund grobfahrlässigen Verhaltens vor. Mehrjahresprogramm Rahmenbedingungen 11
14 IV. Präventionsgrundsätze Bei der Festlegung der Unfall- und Interventionsschwerpunkte werden verschiedene Grundsätze berücksichtigt, die die Optimierung der Präventionstätigkeit hinsichtlich Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit, ethischer Kriterien und Zweckmässigkeit garantieren soll. 1. Häufigkeit und Schwere bestimmen die Unfallschwerschwerpunkte Bei der Bestimmung der Unfallschwerpunkte stellt die bfu auf das Unfallgeschehen bzw. den damit einhergehenden volkswirtschaftlichen Schaden ab. Bedarf vor Bedürfnis Die bfu ist in erster Linie dort tätig, wo sich viele Unfälle mit schweren Folgen ereignen (Unfallschwerpunkte). Dabei kommt ihr zugute, dass Massnahmen, die auf schwere Unfälle abzielen, meist auch die Zahl der leichten Unfälle reduzieren. Allerdings darf die bfu gemäss gesetzlichem Auftrag die Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung nicht vernachlässigen, selbst wenn es sich dabei in Einzelfällen nicht um Unfallschwerpunkte handelt. 2. Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit bestimmen die Interventionsschwerpunkte Die Auswahl der Präventionsmassnahmen erfolgt aufgrund der Good-Practice-Erkenntnisse der nationalen und internationalen Unfall- und Präventionsforschung, die sich an Kriterien der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit orientieren. Unfallvermeidung vor Schadenminderung Massnahmen zur Vermeidung von Verletzungsereignissen (primäre Prävention) werden den Massnahmen zur Folgenminderung vorgezogen (sekundäre Prävention). Nur in einem sehr beschränkten Ausmass werden Interventionen zur Rettung (tertiäre Prävention) verfolgt, da dieser Bereich von anderen Institutionen abgedeckt wird. Verhältnis- vor Verhaltensbeeinflussung Verhältnisprävention ist in der Regel wirkungsvoller und nachhaltiger als Verhaltensprävention. Insbesondere gilt es, die Gefahrenquelle wenn immer möglich zu entfernen oder zu entschärfen. Nicht alle Unfälle lassen sich aber mit Verhältnisprävention verhindern, weshalb auf Verhaltensprävention nicht verzichtet werden kann. Diese entfaltet ihre Wirkung am intensivsten, wenn sie mit technischen und/oder rechtlichen Massnahmen kombiniert wird. Gesetzgebung und Kontrollen haben positive Auswirkungen auf die Unfallzahlen, wenn Akzeptanz, Verständlichkeit und Umsetzbarkeit gegeben sind. Grosse Bevölkerungsgruppen vor kleinen Hochrisikogruppen Bevorzugt werden Massnahmen, von denen die Gesamtbevölkerung oder möglichst grosse Bevölkerungsgruppen profitieren (universelle Prävention). Ergänzend werden auch Interventionen für definierte Risikogruppen gewählt (selektive Prävention). Demgegenüber werden Interventionen, die sich an identifizierte Einzelpersonen mit manifestem Fehlverhalten richten, nur sehr punktuell ergriffen (indizierte Prävention). 12 Präventionsgrundsätze Mehrjahresprogramm
15 Eigeninitiative Massnahmen, die ohne Eigenverantwortung/ Eigeninitiative funktionieren, sind in der Regel wirksamer als solche, die nur mit Eigenverantwortung wirken. Sie sind deshalb vorzuziehen. Massnahmen, die eine Eigeninitiative erfordern, sind wirksamer, wenn sie den Möglichkeiten und dem Interesse des Zielpublikums angepasst sind, ein Gefühl der persönlichen Betroffenheit auslösen und mit einer konkreten Handlungsempfehlung verknüpft sind. Wirtschaftlichkeit Bei der Auswahl von Massnahmen gilt es, neben der Wirkung auch ihre Wirtschaftlichkeit (Verhältnis von Aufwand und Ertrag) zu berücksichtigen. Es werden prioritär diejenigen Massnahmen umgesetzt, die mit einem geringen Aufwand einen hohen Präventionsnutzen generieren. Keine unerwünschten Nebeneffekte Massnahmen müssen auch auf ihre möglichen negativen Effekte auf andere gesellschaftliche Bereiche, wie zum Beispiel Ökologie oder Gesundheit, überprüft werden und es muss eine Gesamtbilanz gezogen werden. Vernetzung vor Alleingang Durch die Verbreitung von Präventionsmassnahmen gemeinsam mit Partnern kann die Glaubwürdigkeit und Bekanntheit einer Botschaft und damit die Wirkung verstärkt werden. Auch die Anlehnung einer Präventionsempfehlung an die Rechtsprechung erhöht ihre Relevanz und Wirkung. 3. Ethische Überlegungen und Zweckmässigkeit ergänzen Good-Practice- Kriterien Unfreiwilliges vor freiwilligem Risiko und Fremd- vor Selbstgefährdung Freiwillig eingegangene Risiken werden in der Präventionsarbeit weniger hoch gewichtet als unfreiwillig eingegangene. Die Verhinderung von Unfällen infolge Fremdgefährdung hat für die bfu Priorität vor der Verhinderung von Unfällen durch Selbstgefährdung. Umsetzbarkeit Neben Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit ist auch die Realisierbarkeit der Massnahmen im aktuellen Kontext zu prüfen. Technische Machbarkeit, aber auch politische und gesellschaftliche Akzeptanz müssen vorhanden sein. Mehrjahresprogramm Präventionsgrundsätze 13
16 V. Handlungsbedarf und Präventionsziele Mehr als 1 Million Menschen verletzen sich in der Schweiz jährlich bei einem Nichtberufsunfall im Strassenverkehr, bei Sport und Bewegung und in Haus und Freizeit. Mehr als Personen erleiden mittelschwere bis schwere, 1800 Personen so schwere Verletzungen, dass sie dauerhaft invalid bleiben, und fast 2300 Personen sterben. Von den tödlich verlaufenden Nichtberufsunfällen ereignen sich ca in Haus und Freizeit, rund 300 im Strassenverkehr und 140 bei Sport und Bewegung. Erfreulich ist die Entwicklung der Unfallzahlen im Strassenverkehr. Seit dem traurigen Rekord von 1971 (1800 Tote, Schwerverletzte) hat die Zahl der schweren Unfälle laufend abgenommen. Allein zwischen 2001 und 2011 sank die Zahl der Getöteten um 41 %, diejenige der Schwerverletzten um 28 %. Die schweren Sport- sowie Haus- und Freizeitunfälle hingegen stiegen zwischen 2001 und 2011 um jeweils rund 7 %. Bei der Interpretation dieser Zahlen muss berücksichtigt werden, dass die Bevölkerungszahl im gleichen Zeitraum um 9 % anstieg und das Durchschnittsalter der Bevölkerung zunahm. Für die Nichtberufsunfälle eines Jahres müssen die Unfallversicherer 7 Millionen Arbeitsausfalltage entschädigen. Das entspricht einem durchschnittlichen Arbeitsausfall von 15 Tagen pro Fall (exkl. Karenztage). Entsprechend hoch sind die volkswirtschaftlichen Kosten. Allein die materiellen Kosten belaufen sich jährlich auf 10,5 Milliarden Franken, wobei für jeweils rund 40 % davon Unfälle im Strassenverkehr sowie in Haus und Freizeit verantwortlich sind; Sportunfälle verursachen rund 20 % der Kosten. Berücksichtigt man auch die immateriellen Kosten, so beträgt der jährliche volkswirtschaftliche Schaden annähernd 50 Milliarden Franken, 10 verursacht durch den Strassenverkehr, 15 durch den Sport und 23 durch Unfälle in Haus und Freizeit. Der Auftrag der bfu bezieht sich auf die Prävention von allen Nichtberufsunfällen der gesamten Bevölkerung. Neben den unfallbedingten Todesund Invaliditätsfällen beschäftigt sich die bfu in erster Linie mit der Vermeidung von schweren Verletzungen. Bei der Formulierung der quantitativen Präventionsziele 2020 wird auf die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, auf das Wissen über die Wirkung von Präventionsmassnahmen (Präventionsgrundsätze) sowie auf den Handlungsbedarf abgestellt. Nichtberufsunfälle der schweizerischen Wohnbevölkerung, 2011 Total Strassenverkehr Sport Haus und Freizeit Getötete Total Verletzte davon Invalide davon Schwerverletzte davon Mittelschwerverletzte davon Leichtverletzte Quelle: bfu-hochrechnung (Schweizerische Wohnbevölkerung, ohne Touristen, ohne Berufsunfälle, inkl. Unfälle von Schweizern im Ausland) 14 Handlungsbedarf und Präventionsziele Mehrjahresprogramm
17 Es wurde davon ausgegangen, dass die bfu weiterhin über die nötigen finanziellen Mittel verfügt (vgl. Kapitel VI) und dass Politik, Wirtschaft und Partner die Präventionsziele der bfu teilen. Sie ist auf eine breite Unterstützung bei der Bearbeitung der in Kapitel VII bis IX skizzierten Schwerpunkte und bei der Umsetzung der in Kapitel X formulierten Entwicklungsziele angewiesen. 15 % auf 110 und diejenige der Schwerverletzten um 15 % auf pro Jahr zu senken. Im Vergleich zum Strassenverkehr scheint dieses Ziel bescheiden. Zu bedenken ist aber, dass in den nächsten Jahren mit einer steigenden Zahl aktiver Sportler zu rechnen ist und kaum auf repressive Massnahmen gesetzt werden kann. Die Chancen für die Sportunfallprävention liegen vor allem bei der Bereitschaft der Anbieter von Sportinfrastrukturen, diese so sicher wie möglich zu gestalten, bei den laufend verbesserten Schutzausrüstungen und der zunehmenden Möglichkeit, gut abgestimmten Präventionsempfehlungen einen rechtlich verbindlichen Status zu geben. Der Bereich Haus- und Freizeit ist aufgrund der demographischen Veränderungen vor besondere Herausforderungen gestellt. Hier ist ein Halten der Unfallzahlen bereits ein Erfolg was gelingen kann, wenn verhältnispräventive Massnahmen konsequent angegangen und umgesetzt werden. Wirksame und wirtschaftliche Sicherheitsmassnahmen, die das Unfallrisiko merklich senken können, sind in allen drei Nichtberufsunfall-Bereichen vorhanden. Im Strassenverkehr strebt die bfu an, die Zahl der Getöteten innerhalb von 10 Jahren, zwischen 2010 und 2020, um 40 % auf 180 zu senken, die Zahl der Schwerverletzten um rund 10 % auf 6000 zu reduzieren. Dies ist möglich, wenn konsequent an der Verbesserung der Infrastruktur und der Verbreitung sicherer Fahrzeuge gearbeitet, die Fahrausbildung für Neulenkende optimiert wird und die bestehenden Gesetze und Vorschriften dank Polizeikontrollen und begleitenden Aufklärungskampagnen noch konsequenter eingehalten werden. Im Bereich Sport verfolgt die bfu das Ziel, die Zahl der Getöteten zwischen 2010 und 2020 um knapp Entwicklung, Prognose und Reduktionsziel der schweren Nichtberufsunfälle der schweizerischen Wohnbevölkerung (Prognose) Strassenverkehr Getötete Invalide Schwerverletzte Sport Getötete Invalide Schwerverletzte Haus und Freizeit Getötete Invalide Schwerverletzte Quelle: bfu-hochrechnung (Schweizerische Wohnbevölkerung, ohne Touristen, ohne Berufsunfälle, inkl. Unfälle von Schweizern im Ausland) 2020 (Ziel) Mehrjahresprogramm Handlungsbedarf und Präventionsziele 15
18 VI. Finanzen und Ressourcenallokation Das bfu-mehrjahresprogramm ist auf die vorhandenen finanziellen Möglichkeiten der bfu abgestimmt. Sollten sich die finanziellen Rahmenbedingungen grundlegend ändern, so muss auch das Mehrjahresprogramm angepasst werden. Der Ertrag der bfu setzt sich aus verschiedenen Quellen zusammen. Der grösste Ertragsposten ergibt sich aus dem gesetzlich vorgeschriebenen Zuschlag von 0,75 % auf der Prämie der Nichtberufsunfallversicherung UVG resp. 80 % davon, weil die Suva und die Privatversicherungen 20 % für eigene Aktivitäten einbehalten. Die absolute Höhe des Zuschlags ist abhängig vom Prämienvolumen und damit von der Lohnsumme, vom gesetzlich festgelegten höchstversicherten Verdienst und vom Risikosatz, der bei der Ermittlung der NBU-Prämien angewendet wird. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Ertrag aus dem Prämienzuschlag auch in Zukunft moderat, ungefähr parallel zum Wirtschaftswachstum, steigen wird. Neben dem UVG-Prämienzuschlag verfügt die bfu über weitere Einnahmequellen: Es wird davon ausgegangen, dass der Fonds für Verkehrssicherheit (FVS) auch in Zukunft immer wieder sinnvolle Projekte der bfu finanziert, dass das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco die bfu weiterhin mit der Durchführung der Marktkontrolle zur Produktesicherheit beauftragt und dass die Betriebserträge aus der Weiterverrechnung von bfu-dienstleistungen (v. a. Schulungen, Beratung, Expertisen) aufgrund der geplanten Aktivitäten im Mehrjahresprogramm moderat ansteigen werden. Der Aufwand der bfu kann in drei Kategorien unterteilt werden: Personalkosten, Infrastruktur/ Verwaltung und Aufwand für Präventionsleistungen. Der Personalkostenanteil am Betriebsaufwand soll wie in den letzten Jahren rund 66 % betragen. Der Aufwand für Infrastruktur und Verwaltung soll unter 10 % liegen, sodass für den Präventionssachaufwand mindestens 25 % zur Verfügung stehen. Prognose der bfu-betriebserträge nach Ertragsquellen, in CHF 2014* 2015** UVG NBU-Prämienzuschlag Übriger Ertrag Total Angestrebte Mittelverwendung nach Kostenarten 2014* 2015** Lohnaufwand 65% 65% 66% 66% 66% 66% 66% Infrastruktur und Verwaltung 9% 10% 9% 9% 8% 8% 8% Sachaufwand für Präventionsprojekte 26% 25% 25% 25% 26% 26% 26% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Quelle: *Jahresrechnung 2014, **Budget Finanzen und Ressourcenallokation Mehrjahresprogramm
19 Ressourcenallokation: Aufgrund des erwarteten monetären Nutzens von umsetzbaren Präventionsmassnahmen, aber auch aufgrund der Verteilung der volkswirtschaftlichen und materiellen Kosten der Nichtberufsunfälle strebt die bfu an, rund 40 % ihrer eigenfinanzierten Präventionsaufwendungen (Verwendung des UVG-Prämienzuschlags) für die Verhütung von Unfällen im Strassenverkehr zu verwenden. Je 30 % sollen für Sport und Bewegung sowie für Haus und Freizeit eingesetzt werden. Die Verteilung der Ressourcen auf die acht «Produktegruppen» der bfu soll ebenfalls leicht angepasst werden, wobei für die Kommunikation, die dank den digitalen Medien tendenziell günstiger wird (Wegfall von Druckkosten), anteilsmässig etwas weniger aufgewendet werden muss. Im Gegenzug soll der Aufwand für Ausbildung und Beratung leicht steigen. Für die Prävention von Nichtberufsunfällen in Betrieben wurden 2014, im Sinne einer Anfangsinvestition, überdurchschnittlich viele Ressourcen eingesetzt, die in den Folgejahren nicht mehr in diesem Ausmass nötig sein werden. Angestrebte Mittelverwendung der Einnahmen aus dem Prämienzuschlag gemäss Unfallversicherungsgesetz nach Kernkompetenzen, in % der Vollkosten Angestrebte Mittelverwendung der Einnahmen aus dem Prämienzuschlag gemäss Unfallversicherungsgesetz nach Arbeitsgebiet, in % der Vollkosten Strassenverkehr 45% 40% Sport 26% 30% Haus und Freizeit 29% 30% Total 100% 100% Forschung 10% 10% Ausbildung 19% 20% Beratung 13% 15% Sicherheitsdelegierte 14% 14% Betriebe 9% 8% Produktesicherheitsgesetz 0% 0% Kommunikation 27% 25% Kooperation 8% 8% Total 100% 100% Mehrjahresprogramm Finanzen und Ressourcenallokation 17
20 18 Finanzen und Ressourcenallokation Mehrjahresprogramm
21
22 VII. Schwerpunkte im Strassenverkehr Aufgrund der Entwicklung der allgemeinen Rahmenbedingungen, mit denen die Unfallprävention konfrontiert ist, sind im Strassenverkehr folgende Herausforderungen zu berücksichtigen: Die Problematik der oft altersbedingten eingeschränkten Fahreignung wird sich verschärfen (z. B. steigende Anzahl von Senioren mit Gehirnkrankheiten wie Demenz, zunehmender Medikamentenkonsum). Das Unfallgeschehen wird sich eher zu den ver- Die zunehmend komplexeren Verkehrssituati- letzlicheren Verkehrsteilnehmern (Motorradfah- onen in Kombination mit den gesteigerten Kom- rer, Velofahrer, Fussgänger) und Senioren hin munikationsbedürfnissen ( , SMS usw.) er- entwickeln. Insbesondere die Zahl der Schwerst- höhen die Gefahr von Ablenkungsunfällen. verletzten scheint sich in diesen Gruppen nicht zu reduzieren. Die höheren Durchschnittsgeschwindigkeiten und Beschleunigungswerte von Elektrofahrrädern und ähnlichen Geräten führen zu neuen, mit Risiken verbundenen Verkehrssituationen. Generell dürften die Wunschgeschwindigkeiten heterogener werden, die Interessenskonflikte im Verkehr möglicherweise zunehmen. Die Unfallschwerpunkte, die zentralen Risikofaktoren und die Interventionsschwerpunkte werden in den Forschungspublikationen der bfu zum Thema Strassenverkehr detailliert hergeleitet (vgl. z. B. STATUS, SINUS-Report, Sicherheitsdossiers Strassenverkehr). Schwerpunkte im Strassenverkehr: Verletzte und Getötete nach Verkehrsteilnahme und Ursache, Ø * Verletzte Getötete davon Schwerverletzte Personenwagenlenker Motorrad Fahrrad Fussgänger übriger Strassenverkehr Total davon: junge Neulenkende Senioren (65+) Geschwindigkeit als Unfallursache Alkohol/Drogen/Medikamente als Unfallursache Unaufmerksamkeit/Ablenkung/Müdigkeit als Unfallursache * Statistik der polizeilich registrierten Strassenverkehrsunfälle des Bundesamts für Statistik BFS (Territorialstatistik), inkl. Touristen und Berufsunfälle, exkl. Unfälle von Schweizern im Ausland 20 Schwerpunkte im Strassenverkehr Mehrjahresprogramm
23 1. Unfallschwerpunkt Neulenkende Die Zahl der getöteten und schwer verletzten PW- Insassen ist in der Schweiz ähnlich tief wie in den Vorbildländern Grossbritannien, Schweden und Niederlande. Die aber immer noch hohe Zahl an Verkehrsopfern sowie die vorhandenen wirksamen und weitherum akzeptierten Massnahmen ergeben nach wie vor ein relevantes Rettungspotenzial, insbesondere bei den Neulenkenden. Prioritär sind daher die Verbesserung des Fahrerzulassungs- und Fahrausbildungssystems, die Optimierung der Infrastruktur sowie die Verhaltensbeeinflussung durch Enforcement und Kommunikationsmassnahmen. Das Schwerpunktprogramm Neulenkende wird weitergeführt. 2. Unfallschwerpunkt Motorrad Das Motorrad ist ein beliebtes Verkehrsmittel insbesondere bei Männern. Im Vergleich zu anderen Ländern ist die Unfallbelastung in der Schweiz überdurchschnittlich hoch. Obwohl nur 2 % der Verkehrsleistung mit Motorrädern absolviert wird, erleiden Motorradfahrende rund 30 % aller schweren Personenschäden. Die bfu will diese vor allem zu einem sicheren Fahr- und Schutzverhalten motivieren und befähigen. Zudem sollen Infrastruktur und Fahrzeuge mit technischen Massnahmen sicherer gemacht werden. Das Schwerpunktprogramm Motorrad wird weitergeführt. (E-Bikes) und die ungenügende Helmtragquote dar. Die bfu will Radfahrende zu einem sicheren Verhalten motivieren und befähigen. Zudem soll die Infrastruktur vermehrt auf Fahrräder und E-Bikes ausgerichtet werden. Das Schwerpunktprogramm Fahrrad/Bike wird weitergeführt. 4. Unfallschwerpunkt Senioren Rund 1/3 der tödlich und 1/6 der schwer verletzten Verkehrsteilnehmenden sind 65-jährig oder älter (rund 700 Schwerverletzte und 100 Todesfälle pro Jahr). Ein ständig komplexer werdendes Verkehrsgeschehen, gestiegene Mobilitätsansprüche der zahlreicher werdenden Senioren sowie altersbedingte Einschränkungen verlangen nach gezielten Präventionsmassnahmen für Senioren als Fussgänger, Rad- und Autofahrende. Besonderer Beachtung durch Präventionsfachleute bedürfen die Senioren aufgrund ihrer altersbedingten Verletzlichkeit (Letalität). Die bfu will durch gezielte Forschung den tatsächlichen Handlungsbedarf ermitteln und wirkungsvolle Massnahmen aufzeigen. Die erfolgversprechendsten Massnahmen sollen gemeinsam mit Partnern mit einem neuen Schwerpunktprogramm angegangen werden. Insbesondere sollen die Senioren befähigt werden, selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen bei der Wahl der Verkehrsmittel zu treffen. 5. Risikofaktor Geschwindigkeit 3. Unfallschwerpunkt Fahrrad In der Schweiz sterben jährlich 30 Radfahrende, 800 verletzen sich schwer. Im europäischen Vergleich ist das bevölkerungsbezogene Unfallrisiko nur durchschnittlich. Herausforderungen stellen unter anderem die Unfälle bei den Elektrofahrrädern Inadäquate Geschwindigkeit ist trotz der positiven Entwicklung der letzten 10 Jahre eine zentrale Ursache von schweren Verkehrsunfällen. Pro Jahr werden bei Geschwindigkeitsunfällen rund 900 Verkehrsteilnehmende schwer verletzt und 90 getötet. Gut dokumentierte Erfahrungen zeigen, welches die erfolgreichen edukativen, technischen und legis- Mehrjahresprogramm Schwerpunkte im Strassenverkehr 21
24 lativen Massnahmen sind. Die bfu will die Strasseneigentümer bei der Implementierung eines wirksamen und kosteneffizienten Geschwindigkeitsmanagements unterstützen. Die Verbreitung der wirksamsten Fahrerassistenzsysteme soll beschleunigt werden. Zudem setzt sich die bfu dafür ein, dass die Fahrausbildung bezüglich angepasster Geschwindigkeit optimiert und die Kontrolldichte durch die Polizei erhöht wird. Die bfu unterstützt die verantwortlichen Stellen mit Fachwissen und Kommunikationsmitteln. 6. Risikofaktor Alkohol/Drogen/ Medikamente Alkohol, Drogen und Medikamente beeinträchtigen die Fahrfähigkeit und sind für einen bedeutenden Teil der schweren Verkehrsunfälle verantwortlich (600 schwere Verletzungen, davon 10 % tödlich). In annähernd 9 von 10 Fällen geht die Fahrunfähigkeit, die zum Unfall geführt hat, auf den Konsum von Alkohol zurück. Inhalt und Bedeutung bestehender Vorschriften sind etwas in Vergessenheit geraten. Die bfu will daher die Stakeholder motivieren, die existierenden und beschlossenen Massnahmen (u. a. Via sicura) gewinnbringender umzusetzen. Die Polizei soll bei der Durchsetzung der Vorschriften mit Fachwissen und begleitenden Kampagnen unterstützt werden. 7. Risikofaktor Ablenkung/ Unaufmerksamkeit/Müdigkeit Ablenkung, Unaufmerksamkeit und Müdigkeit sind unterschätzte Unfallursachen. Die zunehmend komplexeren Verkehrssituationen in Kombination mit den gesteigerten Kommunikationsbedürfnissen ( , SMS usw.) erhöhen die Ablenkungsgefahr. Die Unfallstatistik weist aus, dass rund 1/4 aller schweren Unfälle auf Ablenkung und Unaufmerksamkeit zurückzuführen ist, wobei die Dunkelziffer bei dieser Ursache vermutlich recht hoch ist. Die verfügbaren Daten zeigen zudem, dass Müdigkeit bei bis zu 20 % der Unfälle eine wichtige Mitursache ist. Die bfu will die Stakeholder unterstützen, die existierenden Möglichkeiten gewinnbringender für die Unfallverhütung einzusetzen. Dazu gehören Massnahmen zur beschleunigten Verbreitung der wirksamsten Fahrassistenzsysteme sowie Kampagnen, die den Sicherheitsnutzen von Polizeikontrollen verstärken. 8. Interventionsschwerpunkt Infrastruktur: im Fokus fehlerverzeihende Strassen Ein Teil der Unfälle im Strassenverkehr kann durch eine optimale Strassenraumgestaltung verhindert werden. Die bfu will zum Aufbau eines Verkehrssystems beitragen, das Fehlverhalten bestenfalls verunmöglicht, zumindest aber dessen Folgen reduziert. Zudem will sie die Gemeinden und Kantone bei der Umsetzung des im Rahmen von Via sicura beschlossenen Art. 6a des Strassenverkehrsgesetzes (Verbesserung der Strasseninfrastruktur) mit Fachwissen unterstützen. 9. Interventionsschwerpunkt Fahrzeug: im Fokus intelligente Technologien In intelligenten Fahrzeugtechnologien liegen grosse Hoffnungen, was die Erhöhung der Verkehrssicherheit anbelangt. Sie erfassen mehr Informationen, verarbeiten diese rascher und zuverlässiger und reagieren schneller als Fahrzeuglenkende. Unerwünschte Verhaltensanpassungen müssen vermieden werden. Die bfu prüft laufend die neuen, intel- 22 Schwerpunkte im Strassenverkehr Mehrjahresprogramm
25 ligenten Fahrassistenzsysteme hinsichtlich Zuverlässigkeit und unerwünschter Nebeneffekte und fördert die Verbreitung besonders sicherheitsförderlicher Systeme. 10. Interventionsschwerpunkt Mensch: im Fokus Risiko- und Schutzverhalten Für eine sichere Verkehrsteilnahme muss der Mensch potenzielle Gefahren erkennen und richtig einschätzen. Zudem müssen in Anbetracht der situativen Bedingungen und der persönlichen Fertigkeiten und Defizite richtige Entscheide gefällt und umgesetzt werden selbst bei gegenläufigen Motiven. Die bfu will Wissen vermitteln und/oder Verhaltensweisen schulen, insbesondere bei Kindern. Mittels Kampagnen soll der Nutzen sicheren Verhaltens aufgezeigt werden. 11. Interventionsschwerpunkt Recht: im Fokus Durchsetzen von Vorschriften Bestehende Vorschriften werden von den Verkehrsteilnehmern immer noch zu wenig konsequent beachtet. Eine vollständige Umsetzung der für die Verkehrsteilnehmenden zentralen und verpflichtenden Regeln (z. B. konsequentes Tragen des Gurtes) würde die Zahl der schweren Unfälle um rund 15 % reduzieren. Die Polizei soll motiviert werden, unfallverhütende Vorschriften vermehrt durchzusetzen. Dazu werden durch die bfu wirkungsvolle Einsatzmittel und Kampagnen entwickelt. Die Polizei soll damit bestmöglich unterstützt werden. Mehrjahresprogramm Schwerpunkte im Strassenverkehr 23
26 VIII. Schwerpunkte in Sport und Bewegung Aufgrund der Entwicklung der allgemeinen Rahmenbedingungen, mit denen die Unfallprävention konfrontiert ist, sind in Sport und Bewegung folgende Herausforderungen zu berücksichtigen: Die Unfallschwerpunkte, die zentralen Risikofaktoren und die Interventionsschwerpunkte werden in den Forschungspublikationen der bfu zum Thema Sport und Bewegung detailliert hergeleitet (vgl. z. B. STATUS-Report, Sicherheitsdossier Sport). Es gibt immer mehr verschieden Sportarten, die ausgeübt werden. Das bedeutet, die Anliegen an die Unfallprävention werden mannigfaltiger und der einzelne Sporttreibende übt unter Umständen mehrere Sportarten gleichzeitig, aber weniger vertieft aus (mehr Anfänger und Ungeübte). Es gibt eine Tendenz zu mehr Einzel- oder Individualsport, wodurch die Einflussmöglichkeiten z. B. über Vereinsstrukturen geringer werden. Die Exposition und somit auch die Unfallzahlen nehmen bei den über 45-Jährigen weiterhin zu, wodurch sich die Sportunfallprävention vermehrt mit älteren Nutzergruppen befassen muss. Schwerpunkte im Sport: Verletzte und Getötete, Ø * Verletzte Getötete davon Schwerverletzte Bergsport/Wandern Schneesport Baden/Wassersport Radfahren (abseits der Strasse) Fussball andere Ballsportarten andere Sportarten Total * bfu-hochrechnung: Ständige Wohnbevölkerung der Schweiz 24 Schwerpunkte in Sport und Bewegung Mehrjahresprogramm
27 1. Unfallschwerpunkt Bergsport Der Bergsport (inkl. Skitouren und Schneeschuhlaufen) bleibt mit seinen über Unfällen und jährlich rund Toten (ohne ausländische Gäste) ein Unfallschwerpunkt. Besonders gefährdet sind ältere, männliche Bergwanderer. Die bfu will das risikobewusste Verhalten in den Bergen fördern, wozu auch die Promotion von «Schonräumen» und sicheren Routen, wie die Plaisir-Skitouren für Bergsportler mit geringen Kenntnissen, gehört. Das Schwerpunktprogramm «Bergsport» wird weitergeführt. 2. Unfallschwerpunkt Schneesport beim Baden/Schwimmen sterben pro Jahr rund 15 Personen und bei anderen Aktivitäten im, am oder auf dem Wasser (wie Tauchen, Bootfahren usw.) ereignen sich 5 zusätzliche Todesfälle. In öffentlichen Bädern wird sich die bfu für eine möglichst lückenlose Überwachung der Bassins (u. a. durch elektronische Systeme) einsetzen. Wichtigste Zielgruppen für die Verhaltensprävention sind die Kinder und jungen Männer, deren Gefahrenbewusstsein und Handlungsfähigkeit in nicht überwachten Gewässern optimiert werden soll. Zusätzlich fördert die bfu die Selbstrettungskompetenz durch die landesweite Verbreitung des bfu-wasser- Sicherheitschecks (WSC). Aus dem bisherigen Wasserprogramm wird neu ein Schwerpunktprogramm. Im Schneesport (Skifahren, Snowboardfahren, Schlitteln) gibt es jährlich über Verletzte und durchschnittlich 30 Todesopfer (davon rund 20 Lawinenopfer). Wegen neuer Zielgruppen (z. B. Touristen aus China) und immer mehr älteren Schneesporttreibenden wird das Unfallausmass nicht abnehmen. Die bfu unterstützt alle Bestrebungen, die die Schneesport-Infrastruktur laufend sicherer machen wollen. Zu diesem Zweck wird die georeferenzierte Analyse des Unfallgeschehens aufund ausgebaut. Technische Verbesserungen der Schutzausrüstung (inkl. Skibindung) werden begleitet und das Tragen wird gefördert. Die Präventionsempfehlungen der bfu sollen in möglichst allen Ausund Weiterbildungsgefässen der Schneesportpartner integriert werden. Das Schwerpunktprogramm «Schneesport» wird weitergeführt. 3. Unfallschwerpunkt Ertrinken (Baden/Wassersport) Mit jährlich fast Verletzten bilden Unfälle im Wasser einen weiteren Unfallschwerpunkt. Allein 4. Unfallschwerpunkt Radfahren abseits der Strasse Beim Radfahren abseits der Strasse, insbesondere bei Mountainbike-Aktivitäten, ereignen sich jährlich rund Unfälle, bisweilen mit schwerem oder gar tödlichem Ausgang. Diese Aktivitäten werden voraussichtlich weiter zunehmen. Es ist mit mehr ungeübten Bikern zu rechnen. Prioritär sind daher sicherheitstechnisch optimierte Strecken und Anlagen. Ergänzend will die bfu Tourenplanung-Kenntnisse vermitteln und für das Tragen der Schutzausrüstung (auch Airbag-Technologien) sensibilisieren. Das Teilprojekt «Mountainbike» wird im Schwerpunktprogramm Fahrrad/Bike weitergeführt. 5. Unfallschwerpunkt Fussball und andere grosse Ballsportarten Fussball ist mit über Unfällen pro Jahr zusammen mit dem Schneesport weiterhin die Sportart mit den meisten Unfällen. In den übrigen Ballsportarten verletzen sich jährlich rund Per- Mehrjahresprogramm Schwerpunkte in Sport und Bewegung 25
28 sonen. Da sich die Suva stark für die Prävention der Fussballunfälle einsetzt, will sich die bfu hauptsächlich um die übrigen Ballsportarten kümmern. Die Sportverbände werden in ihren Präventionsbemühungen unterstützt. Die Verankerung von Standards (Schutzausrüstungen, Risikoverhalten, Fairness, Ausbildung usw.) wird in allen grossen Ballsportarten vorangetrieben. Prioritär ist der Kinder- und Jugendsport. 6. Unfälle im Abenteuersport Zum Abenteuersport gehören Sportarten wie Canyoning und Rafting. Obwohl Abenteuersport kein Unfallschwerpunkt ist, engagiert sich die bfu in der Stiftung «Safety in adventures», die sich für die Reduktion der Zahl der Unfälle im Abenteuersport einsetzt und den Bund bei der Umsetzung des Risikoaktivitätengesetzes unterstützt. Menschliches Leid soll verhindert, aber auch die Tourismusbranche vor wirtschaftlichem Schaden bewahrt werden. 7. Übergeordnete Risikofaktoren in Sport und Bewegung Einzelne Risikofaktoren in Sport und Bewegung betreffen vielfach nicht eine einzige Sportart. Es sind vielmehr globale Themen aus der Sportpsychologie (z. B. Umgang mit Risiko) oder der Medizin (z. B. Vorverletzungen). Sie treten als Unfallursachen bei vielen Sportarten auf und können mit gezielten, sportartunabhängigen Präventionsmassnahmen angegangen werden. Die bfu will dazu die Forschung vorantreiben, die Relevanz neu aufkommender Anliegen prüfen und gezielte Präventionsmassnahmen einleiten. 8. Interventionsschwerpunkt Infrastruktur: im Fokus sichere Sportanlagen Bei fixen Sportbauten (Bäder, Sporthallen usw.) ist die Unfallprävention bereits auf einem hohen Niveau. Die Qualität der bfu-beratung wird aufrechterhalten, die Beratungsinhalte werden dem sich wandelnden Stand der Bautechnik laufend angepasst. Bei naturnahen, variabel gestaltbaren Routen oder Strecken sowie bei neu aufkommenden Trendsportarten wie Trottinett-Abfahrtsstrecken werden Leitlinien für deren Planung, Bau, Betrieb und Unterhalt erstellt und etabliert. Für die bfu ist prioritär, dass für Anfänger, Ungeübte, Kinder und Senioren geeignete Routen oder Strecken existieren. Diese Gruppen sind zu sensibilisieren, die Angebote auch zu nutzen. 9. Interventionsschwerpunkt Technik: im Fokus Sport- und Schutzausrüstung Die wachsende Vielfalt der Sportarten hat immer diversifiziertere Ausrüstungen zur Folge. Die bfu will den Markt beobachten, den (Schutz-)Nutzen abklären, qualitativ gute Produkte fördern (Normen, Tragkomfort) und geeignete Angebote empfehlen. Bei Produkten mit einem Sicherheitsrisiko wird die bfu intervenieren. 10. Interventionsschwerpunkt Mensch: im Fokus Risiko- und Schutzverhalten Gefahren erkennen und richtig einschätzen, die richtigen Entscheide fällen und sie umsetzen all dies macht die Risikokompetenz des Menschen aus. 26 Schwerpunkte in Sport und Bewegung Mehrjahresprogramm
29 Daher soll das Wissen über Risiko- und Schutzverhalten geschult werden, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. Während Kinder vor allem den richtigen Umgang mit Risiko erlernen sollen, gilt es beim Älterwerden die entsprechenden Veränderungen in die Risikobetrachtung miteinzubeziehen. In organisierten Settings sollen Standards zur Vermeidung von Unfällen mit Schwerstverletzten etabliert werden. Wenn nötig soll der Schutz Sport treibender Kinder durch neue oder angepasste Gesetze bzw. Reglemente erhöht werden. 11. Interventionsschwerpunkt Recht: im Fokus Bekanntmachung von Präjudizurteilen mit Soft-Law-Wirkung Empfehlungen erhalten einen erhöhten rechtlichen Stellenwert, wenn sie durch mehrere Institutionen getragen werden und in der Rechtsprechung abgestützt sind (z. B. FIS-Regeln). Das will die bfu bei der Erarbeitung von Empfehlungen noch stärker berücksichtigen. Prioritär ist die Konzentration auf wenige, aber zentrale und sehr gut begründete Präventionsempfehlungen mit Soft-Law-Potenzial und die Information der Bevölkerung über Präjudizurteile mit Soft-Law-Wirkung. Mehrjahresprogramm Schwerpunkte in Sport und Bewegung 27
30 IX. Schwerpunkte in Haus und Freizeit Aufgrund der Entwicklung der allgemeinen Rahmenbedingungen, mit denen die Unfallprävention konfrontiert ist, sind in Haus und Freizeit folgende Herausforderungen zu berücksichtigen: Die Bestrebungen zu hindernisfreiem und generationengerechtem Bauen finden verstärkt Eingang in die Normen und Standards. Die vielfältigen Interessen und Ansätze gilt es als Rahmenbedingungen zu beachten und bei der Beratung Durch die starke demographische Veränderung zur baulichen Sicherheit zu nutzen. werden mehr ältere Menschen in der Schweiz le- Der zunehmende Stellenwert von Gesundheit ben. Die generell verbesserte Gesundheit bis ins und Unversehrtheit in der Gesellschaft stellt hö- hohe Alter (auch dank Medikamenten) hat eine here Anforderungen/Erwartungen an den körperlich anspruchsvollere Freizeitgestaltung Schutz vor Fremdgefährdung und vor unfreiwil- zur Folge. lig eingegangenen Risiken. Frauen im hohen Alter sind aufgrund ihrer phy- Durch den Einbezug von Informations- und sischen Konstellation (geringerer Muskelanteil, Kommunikationstechnologien ergeben sich im Osteoporose-Risiko) grundsätzlich verletzlicher, Haushaltsbereich neue Möglichkeiten zur Prä- weshalb die geschlechterspezifischen Aspekte, vention. Den Trend zu intelligenter Haustechnik insbesondere bei der Sturzprävention, verstärkt gilt es gezielt aufzunehmen und zu nutzen. zu berücksichtigen sind. Schwerpunkte in Haus und Freizeit: Verletzte und Getötete, Ø * Verletzte Getötete davon Schwerverletzte Sturz auf gleicher Ebene Sturz aus der Höhe Sturz auf der Treppe anderer Sturz Total Stürze übrige stumpfe Krafteinwirkung ein- und durchdringende Krafteinwirkung Verbrennungen/Verbrühungen weitere Mechanismen Total davon: Kinder (0 16 Jahre) Erwachsene (17 64 Jahre) Senioren (65+) * bfu-hochrechnung: Ständige Wohnbevölkerung der Schweiz 28 Schwerpunkte in Haus und Freizeit Mehrjahresprogramm
31 Die Unfallschwerpunkte, die zentralen Risikofaktoren und die Interventionsschwerpunkte werden in den Forschungspublikationen der bfu zum Thema Haus- und Freizeit detailliert hergeleitet (vgl. z. B. STATUS-Report, Sicherheitsdossiers Haus und Freizeit). 1. Unfallschwerpunkt: Stürze Rund 80 der jährlich 1700 Todesfälle in Haus und Freizeit sind auf Stürze zurückzuführen. Rund 95 % dieser tödlichen Sturzunfälle betreffen Personen über 65 Jahre. Deshalb sind Seniorinnen und Senioren die Hauptzielgruppe der bfu-sturzpräventionsmassnahmen. Die Massnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur-Sicherheit im öffentlichen und privaten Bereich (auch in Alters- und Pflegeheimen) sowie die Aus- und Weiterbildung von Fachpersonen und Spezialisten, vor allem in Gesundheits- und Sozialberufen, sollen weitergeführt werden. Das Schwerpunktprogramm Stürze wird fortgesetzt. 2. Unfallschwerpunkt: Kinder Jährlich verletzen sich durchschnittlich Kinder ausserhalb von Strassenverkehr, Sport und Bewegung. Die Unfallverhütungsarbeit der bfu verfolgt einen integrativ-programmatischen Ansatz, der verschiedene Präventionsthemen zusammenfasst. Besonders berücksichtigt werden Personengruppen mit wenig Affinität zur Unfallverhütung, beispielsweise bildungsferne Gruppen oder Teile der Migrationsbevölkerung. Die bfu will ein Schwerpunktprogramm Kinder lancieren. 3. Übergeordnete Risikofaktoren in Haus und Freizeit Das fehlende Risikobewusstsein (Ursache-Wirkungs- Bewusstsein) ist in vielen Situationen im und ums Haus ein unfallfördernder Faktor. Generelle Risikofaktoren sind abnehmende Sehkraft und Medikationen, die im Alter notwendig sind. Kommen Nachlässigkeit oder fehlende Ordnung im Haushalt hinzu, sind Stolper- und Sturzunfälle sehr wahrscheinlich. Die bfu will die Forschung zu diesen Themen vorantreiben, die Relevanz neu aufkommender Anliegen prüfen und wirkungsvolle Präventionsmassnahmen einleiten. 4. Interventionsschwerpunkt Infrastruktur: im Fokus sichere Bauten Menschliches Fehlverhalten kann durch eine adäquate Infrastruktur zumindest teilweise aufgefangen werden. Eine intelligente Haus- und Gerätetechnik kann die Sicherheit erhöhen. Ein Beispiel: In Seniorenhaushalten kann eine moderne Lichtsteuerung die Wahrnehmung verbessern. Die bfu trägt durch Beratung, Ausbildung von Fachleuten und durch Normentätigkeit zur Optimierung von Bauten und Anlagen bei. Fehlverhalten soll bestenfalls verunmöglicht, zumindest aber dessen Auftretenshäufigkeit gesenkt, und die Unfallfolgen sollen reduziert werden. Zudem sollen die neuen, intelligenten Systeme der Haus- und Gerätetechnik hinsichtlich Zuverlässigkeit und unerwünschter Nebeneffekte beobachtet und die Verbreitung sicherheitsfördernder Systeme soll unterstützt werden. Der gesetzliche Koordinationsauftrag soll dazu genutzt werden, die diversen Stakeholder im Bereich der baulichen Sicherheit zu vernetzen und die vielfältigen Anstrengungen zu koordinieren (auch auf der Ebene der technischen Normen). Mehrjahresprogramm Schwerpunkte in Haus und Freizeit 29
32 5. Interventionsschwerpunkt Produkte: im Fokus sichere Produkte und Sicherheitsprodukte 7. Interventionsschwerpunkt Recht: im Fokus Durchsetzen von bestehenden Vorschriften Das Produktesicherheitsgesetz PrSG hat zum Ziel, dass nur sichere Produkte auf den Schweizer Markt kommen. Im Rahmen des Marktüberwachungsmandats des Seco gewährleistet die bfu, dass in der Schweiz nur normenkonforme Produkte verkauft werden. Besonders wichtig sind die sogenannten Sicherheitsprodukte, die explizit der Sicherheit dienen oder über einen zusätzlichen Nutzen für die Sicherheit verfügen. Wo immer möglich empfiehlt die bfu den Gebrauch solcher Produkte. 6. Interventionsschwerpunkt Mensch: im Fokus Risiko- und Schutzverhalten Die Risikokompetenz, die Erkennung und Einschätzung potenzieller Gefahren, soll im Haus- und Freizeitbereich verbessert und das adäquate Risiko- und Schutzverhalten gefördert werden (z. B. Tragen von Schutzbrillen beim Heimwerken). Zur Risikokompetenz gehört, dass altersspezifische Veränderungen zu einer (Neu-)Einschätzung von Gefahren führen müssten und das Verhalten entsprechend angepasst werden sollte, was für Senioren in Einzelhaushalten besonders wichtig ist. Im Sinn von Ermöglichung/Empowerment will die bfu für Senioren ein Selbstbeurteilungsprogramm entwickeln (z. B. in Bezug auf die Sturzprävention). Für die Unfallverhütung in Haus und Freizeit bestehen viele rechtliche Vorgaben, unter anderem zur Sicherheit von Bauten, von Kinderspielplätzen und -geräten und von sonstigen Produkten sowie zur Sturzprävention im medizinisch-pflegerischen Bereich. Heute haben viele Verantwortungsträger vor allem im baulichen Bereich wegen der Vielfalt relevanter Vorschriften und Normen kaum die Übersicht. Deshalb werden einerseits gesetzliche Vorschriften auf kantonaler Ebene auf kommunaler Ebene (v. a. im Baureglement) nicht übernommen, andererseits werden Normen für Bauten und Anlagen zu wenig konsequent beachtet. Die bfu will die Vollzugsorgane mit Grundlagen und Beratung gezielt beim konsequenten Einbezug und der Umsetzung bestehender unfallverhütender Vorschriften unterstützen. 30 Schwerpunkte in Haus und Freizeit Mehrjahresprogramm
33
Die bfu stellt sich vor
 Die bfu stellt sich vor Schweizer Kompetenz- und Koordinationszentrum für Unfallprävention bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung 1 Wer wir sind. 2 Die Beratungsstelle für Unfallverhütung Die bfu, gegründet
Die bfu stellt sich vor Schweizer Kompetenz- und Koordinationszentrum für Unfallprävention bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung 1 Wer wir sind. 2 Die Beratungsstelle für Unfallverhütung Die bfu, gegründet
Pflichten des Arbeitgebers unter dem Aspekt der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes
 Pflichten des Arbeitgebers unter dem Aspekt der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes Info Waldeigentümer Referent Heinz Hartmann Heinz Hartmann -Förster -Suva - Arbeitssicherheit - Bereich Holz
Pflichten des Arbeitgebers unter dem Aspekt der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes Info Waldeigentümer Referent Heinz Hartmann Heinz Hartmann -Förster -Suva - Arbeitssicherheit - Bereich Holz
I. Überblick über Kinderunfälle im Straßenverkehr 2011. Unfallzahlen 2011 sowie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr:
 1 unfälle im Straßenverkehr im Jahr 2011 Der folgende Überblick informiert über die Eckdaten des Statistischen Bundesamt zum Thema unfälle im Straßenverkehr 2011. Als gelten alle Mädchen und Jungen unter
1 unfälle im Straßenverkehr im Jahr 2011 Der folgende Überblick informiert über die Eckdaten des Statistischen Bundesamt zum Thema unfälle im Straßenverkehr 2011. Als gelten alle Mädchen und Jungen unter
Mehrjahresprogramm
 Mehrjahresprogramm 2011 2015 bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu-mehrjahresprogramm 2011 2015 Mehrjahresprogramm 2011 2015 Bern 2010 bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung Impressum Herausgeberin
Mehrjahresprogramm 2011 2015 bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu-mehrjahresprogramm 2011 2015 Mehrjahresprogramm 2011 2015 Bern 2010 bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung Impressum Herausgeberin
Auf Rollen unterwegs. Fahrzeugähnliche Geräte. bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung
 Auf Rollen unterwegs Fahrzeugähnliche Geräte bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung Was sind fahrzeugähnliche Geräte? Als fahrzeugähnliche Geräte (fäg) werden alle mit Rädern oder Rollen ausgestatteten
Auf Rollen unterwegs Fahrzeugähnliche Geräte bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung Was sind fahrzeugähnliche Geräte? Als fahrzeugähnliche Geräte (fäg) werden alle mit Rädern oder Rollen ausgestatteten
VERKEHRSUNFALL-STATISTIK 2010
 VERKEHRSUNFALL-STATISTIK 2010 1 Leichter Anstieg bei der Zahl der registrierten Verkehrsunfälle Zahl der Verunglückten insgesamt zurückgegangen - allerdings mehr Verkehrstote Hauptunfallursachen Zahl der
VERKEHRSUNFALL-STATISTIK 2010 1 Leichter Anstieg bei der Zahl der registrierten Verkehrsunfälle Zahl der Verunglückten insgesamt zurückgegangen - allerdings mehr Verkehrstote Hauptunfallursachen Zahl der
Lissabonner Erklärung zur Gesundheit am Arbeitsplatz in kleinen und mittleren Unternehmen KMU (2001)
 Lissabonner Erklärung zur Gesundheit am Arbeitsplatz in kleinen und mittleren Unternehmen KMU (2001) Diese Erklärung wurde vom ENBGF auf dem Netzwerktreffen am 16. Juni 2001 verabschiedet und auf der anschließenden
Lissabonner Erklärung zur Gesundheit am Arbeitsplatz in kleinen und mittleren Unternehmen KMU (2001) Diese Erklärung wurde vom ENBGF auf dem Netzwerktreffen am 16. Juni 2001 verabschiedet und auf der anschließenden
NBU-Themenpräsentationen in Betrieben - Kurzbeschrieb
 Angebot NBU-Kampagnen / Kontakt 031 390 22 63 NBU-Themenpräsentationen in Betrieben - Kurzbeschrieb Dieser Kurzbeschrieb gibt einen Überblick über unser Angebot an verschiedenen Themenpräsentationen. Weitergehende
Angebot NBU-Kampagnen / Kontakt 031 390 22 63 NBU-Themenpräsentationen in Betrieben - Kurzbeschrieb Dieser Kurzbeschrieb gibt einen Überblick über unser Angebot an verschiedenen Themenpräsentationen. Weitergehende
Indikator 4.2: Kosten der Sportunfälle
 Indikator 4.2: Kosten der Sportunfälle Sportunfälle und -verletzungen verursachen nicht nur Leid und Schmerzen, sondern auch Kosten. Wie Abbildung A zeigt, lagen die Kosten der Sportunfälle aller UVG-Versicherten
Indikator 4.2: Kosten der Sportunfälle Sportunfälle und -verletzungen verursachen nicht nur Leid und Schmerzen, sondern auch Kosten. Wie Abbildung A zeigt, lagen die Kosten der Sportunfälle aller UVG-Versicherten
Humanitäre Stiftung SRK
 Humanitäre Stiftung SRK Richtlinien für die Vergabungen der Humanitären Stiftung SRK (Vergaberichtlinien) Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) ist ein von der Eidgenossenschaft anerkannter, privater Verein,
Humanitäre Stiftung SRK Richtlinien für die Vergabungen der Humanitären Stiftung SRK (Vergaberichtlinien) Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) ist ein von der Eidgenossenschaft anerkannter, privater Verein,
Verkehrsunfallbilanz 2015 und Verkehrssicherheitsarbeit. Pressekonferenz 24.02.2016
 Verkehrsunfallbilanz 2015 und Verkehrssicherheitsarbeit Pressekonferenz 24.02.2016 Wesentliche Unfalldaten/-Ursachen Unfalleckwerte 2014 / 2015 24168 Verkehrsunfälle (gesamt) 12289 ausgewertete Verkehrsunfälle
Verkehrsunfallbilanz 2015 und Verkehrssicherheitsarbeit Pressekonferenz 24.02.2016 Wesentliche Unfalldaten/-Ursachen Unfalleckwerte 2014 / 2015 24168 Verkehrsunfälle (gesamt) 12289 ausgewertete Verkehrsunfälle
Leitbild. des Jobcenters Dortmund
 Leitbild des Jobcenters Dortmund 2 Inhalt Präambel Unsere Kunden Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Unser Jobcenter Unsere Führungskräfte Unser Leitbild Unser Jobcenter Präambel 03 Die gemeinsame
Leitbild des Jobcenters Dortmund 2 Inhalt Präambel Unsere Kunden Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Unser Jobcenter Unsere Führungskräfte Unser Leitbild Unser Jobcenter Präambel 03 Die gemeinsame
Müdigkeit am Steuer. Auch tagsüber wach und sicher ankommen. bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung
 Müdigkeit am Steuer Auch tagsüber wach und sicher ankommen bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung Wache Fahrt Jedes Jahr verunfallen in der Schweiz 1500 Personen schwer oder tödlich, weil sie müde Auto
Müdigkeit am Steuer Auch tagsüber wach und sicher ankommen bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung Wache Fahrt Jedes Jahr verunfallen in der Schweiz 1500 Personen schwer oder tödlich, weil sie müde Auto
RB GESETZ über die Förderung von Kindern und Jugendlichen im Kanton Uri (Kantonales Kinderund Jugendförderungsgesetz, KKJFG)
 RB 10.4211 GESETZ über die Förderung von Kindern und Jugendlichen im Kanton Uri (Kantonales Kinderund Jugendförderungsgesetz, KKJFG) (vom ) Das Volk des Kantons Uri, gestützt auf Artikel 90 Absatz 1 der
RB 10.4211 GESETZ über die Förderung von Kindern und Jugendlichen im Kanton Uri (Kantonales Kinderund Jugendförderungsgesetz, KKJFG) (vom ) Das Volk des Kantons Uri, gestützt auf Artikel 90 Absatz 1 der
Speedtest 09 Welcher Risikotyp bist Du? www.speedtest09.ch
 Der Sponti Mir kann nichts passieren! Hans guck in die Luft Verkehrsunfälle schädigen nicht nur das Portemonnaie sie treffen auch Menschen direkt an Leib und Seele. Sie verursachen Schmerzen, machen Operationen
Der Sponti Mir kann nichts passieren! Hans guck in die Luft Verkehrsunfälle schädigen nicht nur das Portemonnaie sie treffen auch Menschen direkt an Leib und Seele. Sie verursachen Schmerzen, machen Operationen
Behördenrapport vom Major Pius Ludin, Chef Sicherheitspolizei Land, designierter Chef Sicherheits- und Verkehrspolizei
 Behördenrapport vom 25.11.2015 Major Pius Ludin, Chef Sicherheitspolizei Land, designierter Chef Sicherheits- und Verkehrspolizei Inhalt 1. Kantonaler Führungsstab / Funktionswechsel 2. Organisationsentwicklung
Behördenrapport vom 25.11.2015 Major Pius Ludin, Chef Sicherheitspolizei Land, designierter Chef Sicherheits- und Verkehrspolizei Inhalt 1. Kantonaler Führungsstab / Funktionswechsel 2. Organisationsentwicklung
Kampagne Besserfahrer.ch: Wer Kurse besucht, fährt sicherer.
 29. Januar 2015 MEDIENROHSTOFF Besserfahrer.ch Zusätzliche Informationen zur Medienmitteilung Kampagne Besserfahrer.ch: Wer Kurse besucht, fährt sicherer. Das will Besserfahrer.ch: Die Präventionskampagne
29. Januar 2015 MEDIENROHSTOFF Besserfahrer.ch Zusätzliche Informationen zur Medienmitteilung Kampagne Besserfahrer.ch: Wer Kurse besucht, fährt sicherer. Das will Besserfahrer.ch: Die Präventionskampagne
LAGEBILD VERKEHR 2014 POLIZEIINSPEKTION FRANKENTHAL/PFALZ
 LAGEBILD VERKEHR 2014 POLIZEIINSPEKTION FRANKENTHAL/PFALZ 1 Verkehrsunfallbilanz der Polizei Frankenthal auf einen Blick Die Gesamtzahl der polizeilich registrierten Verkehrsunfälle ist leicht auf insgesamt
LAGEBILD VERKEHR 2014 POLIZEIINSPEKTION FRANKENTHAL/PFALZ 1 Verkehrsunfallbilanz der Polizei Frankenthal auf einen Blick Die Gesamtzahl der polizeilich registrierten Verkehrsunfälle ist leicht auf insgesamt
Verkehrsunfallbilanz 2013
 Verkehrsunfallbilanz 2013 I. Trends/Entwicklungen Verkehrsunfallentwicklung insgesamt nahezu unverändert Rückgang der Verletzten um 0,6 % aber Anstieg der Getöteten um 2,4 % - Rückgang der Getöteten bei
Verkehrsunfallbilanz 2013 I. Trends/Entwicklungen Verkehrsunfallentwicklung insgesamt nahezu unverändert Rückgang der Verletzten um 0,6 % aber Anstieg der Getöteten um 2,4 % - Rückgang der Getöteten bei
Älter werden in Münchenstein. Leitbild der Gemeinde Münchenstein
 Älter werden in Münchenstein Leitbild der Gemeinde Münchenstein Seniorinnen und Senioren haben heute vielfältige Zukunftsperspektiven. Sie leben länger als Männer und Frauen in früheren Generationen und
Älter werden in Münchenstein Leitbild der Gemeinde Münchenstein Seniorinnen und Senioren haben heute vielfältige Zukunftsperspektiven. Sie leben länger als Männer und Frauen in früheren Generationen und
Neuregelung von Prävention und Gesundheitsförderung
 Neuregelung von Prävention und Gesundheitsförderung 11. September 2008 Vorgeschichte und Meilensteine Auftrag des EDI: Prüfung der inhaltlichen Voraussetzungen und der politischen Machbarkeit eines «Präventionsgesetzes»
Neuregelung von Prävention und Gesundheitsförderung 11. September 2008 Vorgeschichte und Meilensteine Auftrag des EDI: Prüfung der inhaltlichen Voraussetzungen und der politischen Machbarkeit eines «Präventionsgesetzes»
Unfallentwicklung im Kreis Paderborn 2010
 Pressekonferenz am 14. Februar 2011, 12:00 Uhr Polizeidienststelle Riemekestraße 60-62, 33102 Paderborn Podium: Landrat Manfred Müller Polizeidirektorin Ursula Wichmann Polizeioberrat Friedrich Husemann
Pressekonferenz am 14. Februar 2011, 12:00 Uhr Polizeidienststelle Riemekestraße 60-62, 33102 Paderborn Podium: Landrat Manfred Müller Polizeidirektorin Ursula Wichmann Polizeioberrat Friedrich Husemann
Strategieentwicklung Der Weg zu einer erfolgreichen Unternehmensstrategie global denken, lokal handeln.
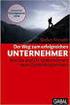 CONSULTING PEOPLE Strategieentwicklung Der Weg zu einer erfolgreichen Unternehmensstrategie global denken, lokal handeln. Analyse / Ziele / Strategieentwicklung / Umsetzung / Kontrolle Report: August 2012
CONSULTING PEOPLE Strategieentwicklung Der Weg zu einer erfolgreichen Unternehmensstrategie global denken, lokal handeln. Analyse / Ziele / Strategieentwicklung / Umsetzung / Kontrolle Report: August 2012
Strategie Vision. Werthaltung. Zweck. Unabhängigkeit: Wir arbeiten unbefangen, unvoreingenommen und objektiv.
 Strategie 2013 2016 Strategie 2013 2016 Vision Athletinnen und Athleten können in einem doping freien Umfeld Sport treiben. Zweck Die Stiftung Antidoping Schweiz leistet einen wesentlichen Beitrag zur
Strategie 2013 2016 Strategie 2013 2016 Vision Athletinnen und Athleten können in einem doping freien Umfeld Sport treiben. Zweck Die Stiftung Antidoping Schweiz leistet einen wesentlichen Beitrag zur
Vorwort. Wir verfolgen das Ziel die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen zu fördern.
 Vorwort Wir verfolgen das Ziel die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen zu fördern. Mit dieser Zielsetzung vor Augen haben wir Führungskräfte der gpe uns Führungsleitlinien gegeben. Sie basieren
Vorwort Wir verfolgen das Ziel die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen zu fördern. Mit dieser Zielsetzung vor Augen haben wir Führungskräfte der gpe uns Führungsleitlinien gegeben. Sie basieren
Ausschreibung für Primokiz 2
 Ausschreibung für Primokiz 2 Ein Programm zur Förderung einer vernetzten frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung Primokiz 2 unterstützt in den Jahren 2017 bis 2020 Gemeinden, Regionen und Kantone
Ausschreibung für Primokiz 2 Ein Programm zur Förderung einer vernetzten frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung Primokiz 2 unterstützt in den Jahren 2017 bis 2020 Gemeinden, Regionen und Kantone
Unfälle junger Fahrerinnen und Fahrer 2005
 Unfälle junger Fahrerinnen und Fahrer 2005 18- bis 24-Jährige im Straßenverkehr: Die sieben risikoreichsten Jahre Der Führerschein hat für Heranwachsende eine kaum zu überschätzende Bedeutung. Er steht
Unfälle junger Fahrerinnen und Fahrer 2005 18- bis 24-Jährige im Straßenverkehr: Die sieben risikoreichsten Jahre Der Führerschein hat für Heranwachsende eine kaum zu überschätzende Bedeutung. Er steht
Gesetzestext (Vorschlag für die Verankerung eines Artikels in der Bundesverfassung)
 Gesetzestext (Vorschlag für die Verankerung eines Artikels in der Bundesverfassung) Recht auf Bildung Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. Bildung soll auf die volle Entfaltung der Persönlichkeit, der
Gesetzestext (Vorschlag für die Verankerung eines Artikels in der Bundesverfassung) Recht auf Bildung Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. Bildung soll auf die volle Entfaltung der Persönlichkeit, der
Baden-Württemberg INNENMINISTERIUM PRESSESTELLE
 Baden-Württemberg INNENMINISTERIUM PRESSESTELLE PRESSEMITTEILUNG 19. Februar 2015 Verkehrsunfallbilanz 2014 Innenminister Reinhold Gall: Mehr als jeder fünfte Verkehrstote ist ein Motorradfahrer Schwerpunktkontrollen
Baden-Württemberg INNENMINISTERIUM PRESSESTELLE PRESSEMITTEILUNG 19. Februar 2015 Verkehrsunfallbilanz 2014 Innenminister Reinhold Gall: Mehr als jeder fünfte Verkehrstote ist ein Motorradfahrer Schwerpunktkontrollen
Strukturreform und Berater Zsolt Kukorelly Zürich, 28. März 2012
 Zsolt Kukorelly Zürich, 28. März 2012 Pension Services Strukturreform: Erweiterung des Verantwortlichkeitsbereichs Art. 51a (neu) Aufgaben des obersten Organs der Vorsorgeeinrichtung 1 Das oberste Organ
Zsolt Kukorelly Zürich, 28. März 2012 Pension Services Strukturreform: Erweiterung des Verantwortlichkeitsbereichs Art. 51a (neu) Aufgaben des obersten Organs der Vorsorgeeinrichtung 1 Das oberste Organ
Die wichtigsten Begriffe und ihre Verwendung
 Die wichtigsten Begriffe und ihre Verwendung Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die wichtigsten Begriffe zu Wirkungsmessung und deren Definitionen. Zudem wird der Begriff Wirkungsmessung zu Qualitätsmanagement
Die wichtigsten Begriffe und ihre Verwendung Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die wichtigsten Begriffe zu Wirkungsmessung und deren Definitionen. Zudem wird der Begriff Wirkungsmessung zu Qualitätsmanagement
c/o mcw Wuhrmattstrasse Zofingen Charta zur Qualität familienergänzender Kinderbetreuung
 c/o mcw Wuhrmattstrasse28 4800 Zofingen info@netzwerk-kinderbetreuung.ch Charta zur Qualität familienergänzender Kinderbetreuung Charta zur Qualität familienergänzender Kinderbetreuung Zum Wohl des Kindes
c/o mcw Wuhrmattstrasse28 4800 Zofingen info@netzwerk-kinderbetreuung.ch Charta zur Qualität familienergänzender Kinderbetreuung Charta zur Qualität familienergänzender Kinderbetreuung Zum Wohl des Kindes
ARBEITS- UND An der Hasenquelle 6. Seit dem ist die neue Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV in Kraft.
 Die neue Betriebssicherheitsverordnung Seit dem 01.06.2015 ist die neue Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV in Kraft. Diese Verordnung heißt in der Langversion eigentlich Verordnung über Sicherheit
Die neue Betriebssicherheitsverordnung Seit dem 01.06.2015 ist die neue Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV in Kraft. Diese Verordnung heißt in der Langversion eigentlich Verordnung über Sicherheit
Sicher und gesund dank den Präventionsmodulen
 Sicher und gesund dank den Präventionsmodulen Hanspeter Schürmann / Marcel Thommen ERFA-Tagung Swissmechanic 2014 Unfälle und Krankheiten gehen ins Geld 7% Ausfalltage wegen BU 13% Ausfalltage wegen NBU
Sicher und gesund dank den Präventionsmodulen Hanspeter Schürmann / Marcel Thommen ERFA-Tagung Swissmechanic 2014 Unfälle und Krankheiten gehen ins Geld 7% Ausfalltage wegen BU 13% Ausfalltage wegen NBU
Alkohol am Steuer. Fahren mit Verantwortung. bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung
 Alkohol am Steuer Fahren mit Verantwortung bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung Autofahren erfordert eine gute Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit. Schon wenig Alkohol schränkt diese ein. Am besten
Alkohol am Steuer Fahren mit Verantwortung bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung Autofahren erfordert eine gute Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit. Schon wenig Alkohol schränkt diese ein. Am besten
Alkohol am Steuer. Für eine sichere Fahrt in Ihre Zukunft. bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung
 Alkohol am Steuer Für eine sichere Fahrt in Ihre Zukunft bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung Auf Ihr Wohl Viele Unfälle im Strassenverkehr werden von angetrunkenen Lenkern verursacht. Unter Alkoholeinfluss
Alkohol am Steuer Für eine sichere Fahrt in Ihre Zukunft bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung Auf Ihr Wohl Viele Unfälle im Strassenverkehr werden von angetrunkenen Lenkern verursacht. Unter Alkoholeinfluss
Gesund älter werden in Deutschland
 Gesund älter werden in Deutschland - Handlungsfelder und Herausforderungen - Dr. Rainer Hess Vorsitzender des Ausschusses von gesundheitsziele.de Gemeinsame Ziele für mehr Gesundheit Was ist gesundheitsziele.de?
Gesund älter werden in Deutschland - Handlungsfelder und Herausforderungen - Dr. Rainer Hess Vorsitzender des Ausschusses von gesundheitsziele.de Gemeinsame Ziele für mehr Gesundheit Was ist gesundheitsziele.de?
Risikokommunikation und neue Medien
 Risikokommunikation und neue Medien Workshop 7 Cees Meijer; Consumer Safety Institute, Amsterdam Gesundheitsförderung trifft Jugendarbeit Fonds Gesundes Österreich Salzburg, 19.9.2008 Unfallprävention
Risikokommunikation und neue Medien Workshop 7 Cees Meijer; Consumer Safety Institute, Amsterdam Gesundheitsförderung trifft Jugendarbeit Fonds Gesundes Österreich Salzburg, 19.9.2008 Unfallprävention
18- bis 24-Jährige im Straßenverkehr: Die sieben risikoreichsten Jahre. Unfallstatistik junger Fahrerinnen und Fahrer 2011
 18- bis 24-Jährige im Straßenverkehr: Die sieben risikoreichsten Jahre Unfallstatistik junger Fahrerinnen und Fahrer 2011 Der Führerschein hat für junge Menschen eine große Bedeutung. Er steht für die
18- bis 24-Jährige im Straßenverkehr: Die sieben risikoreichsten Jahre Unfallstatistik junger Fahrerinnen und Fahrer 2011 Der Führerschein hat für junge Menschen eine große Bedeutung. Er steht für die
Sportentwicklung und Vereinsentwicklung in der Schweiz Erklärungen, Fakten, Modelle, Bedeutung für die Verbände und Vereine?
 Swiss Olympic Forum 10. und 12. Mai 2016 in Interlaken Sportentwicklung und Vereinsentwicklung in der Schweiz Erklärungen, Fakten, Modelle, Bedeutung für die Verbände und Vereine? Dr. Markus Lamprecht
Swiss Olympic Forum 10. und 12. Mai 2016 in Interlaken Sportentwicklung und Vereinsentwicklung in der Schweiz Erklärungen, Fakten, Modelle, Bedeutung für die Verbände und Vereine? Dr. Markus Lamprecht
Gewicht und Ernährungsweise
 Gewicht und Ernährungsweise Die Ernährungsgewohnheiten der Bevölkerung sind für den Gesundheitszustand ausschlaggebend. Insbesondere das verkürzt die Lebensdauer und senkt die Lebensqualität und ist ein
Gewicht und Ernährungsweise Die Ernährungsgewohnheiten der Bevölkerung sind für den Gesundheitszustand ausschlaggebend. Insbesondere das verkürzt die Lebensdauer und senkt die Lebensqualität und ist ein
Institut Bildungsevaluation, Entwicklung und Beratung
 Institut Bildungsevaluation, Entwicklung und Beratung entwickeln erheben analysieren beurteilen empfehlen Die gesellschaftlichen und pädagogischen Anforderungen an Schulen und unser Bildungssystem sind
Institut Bildungsevaluation, Entwicklung und Beratung entwickeln erheben analysieren beurteilen empfehlen Die gesellschaftlichen und pädagogischen Anforderungen an Schulen und unser Bildungssystem sind
Leitbild Schweizerischer Schwimmverband
 Leitbild Schweizerischer Schwimmverband Genehmigt durch die DV vom. April 06 (Stand per.04.06) Leitbild Schweizerischer Schwimmverband: Genehmigt durch die DV Seite von 6 Vorbemerkungen Das vorliegende
Leitbild Schweizerischer Schwimmverband Genehmigt durch die DV vom. April 06 (Stand per.04.06) Leitbild Schweizerischer Schwimmverband: Genehmigt durch die DV Seite von 6 Vorbemerkungen Das vorliegende
Müdigkeit am Steuer. Wach ans Ziel. bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung
 Müdigkeit am Steuer Wach ans Ziel bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung Brennen Ihnen beim Autofahren die Augen oder gähnen Sie dauernd? Halten Sie an und machen Sie einen Turboschlaf von 15 Minuten.
Müdigkeit am Steuer Wach ans Ziel bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung Brennen Ihnen beim Autofahren die Augen oder gähnen Sie dauernd? Halten Sie an und machen Sie einen Turboschlaf von 15 Minuten.
Demographische Alterung und deren Auswirkungen auf die Gesundheitskosten
 Demographische Alterung und deren Auswirkungen auf die Gesundheitskosten 1. Problematik der demographischen Alterung Die Schweiz ist wie die meisten modernen Industrie- und Dienstleistungsstaaten geprägt
Demographische Alterung und deren Auswirkungen auf die Gesundheitskosten 1. Problematik der demographischen Alterung Die Schweiz ist wie die meisten modernen Industrie- und Dienstleistungsstaaten geprägt
Betriebliches Eingliederungsmanagement - Erfahrungen aus der Praxis
 Betriebliches Eingliederungsmanagement - Erfahrungen aus der Praxis Unser Film zu BEM: http://hf.uni-koeln.de/32286 Kontakt: mathilde.niehaus@uni-koeln.de Übersicht 1. Handlungsbedarf Relevanz 2. Gesetzlicher
Betriebliches Eingliederungsmanagement - Erfahrungen aus der Praxis Unser Film zu BEM: http://hf.uni-koeln.de/32286 Kontakt: mathilde.niehaus@uni-koeln.de Übersicht 1. Handlungsbedarf Relevanz 2. Gesetzlicher
Pflege und Betreuung von Menschen mit einer Behinderung im Alter «Was uns betrifft»
 Pflege und Betreuung von Menschen mit einer Behinderung im Alter «Was uns betrifft» Tagung Schweizerisches Epilepsie-Zentrum 20. September 2013 Marie-Thérèse Weber-Gobet Bereichsleiterin Sozialpolitik
Pflege und Betreuung von Menschen mit einer Behinderung im Alter «Was uns betrifft» Tagung Schweizerisches Epilepsie-Zentrum 20. September 2013 Marie-Thérèse Weber-Gobet Bereichsleiterin Sozialpolitik
information Radfahren ist die Lösung und nicht das Problem Zehn gute Gründe, warum die Helmpflicht für Kinder und Jugendliche keine Probleme löst.
 Mobilität mit Zukunft information Radfahren ist die Lösung und nicht das Problem Zehn gute Gründe, warum die Helmpflicht für Kinder und Jugendliche keine Probleme löst. Fahrradförderung 1 erhöht die Verkehrssicherheit
Mobilität mit Zukunft information Radfahren ist die Lösung und nicht das Problem Zehn gute Gründe, warum die Helmpflicht für Kinder und Jugendliche keine Probleme löst. Fahrradförderung 1 erhöht die Verkehrssicherheit
Mögliche Themen für Abschlussarbeiten (Zulassungs-, Bachelor- oder Masterarbeiten) bei der Professur für Sport- und Gesundheitspädagogik
 Mögliche Themen für Abschlussarbeiten (Zulassungs-, Bachelor- oder Masterarbeiten) bei der Professur für Sport- und Gesundheitspädagogik Am Lehrstuhl Sport- und Gesundheitspädagogik sind folgende Abschlussarbeiten
Mögliche Themen für Abschlussarbeiten (Zulassungs-, Bachelor- oder Masterarbeiten) bei der Professur für Sport- und Gesundheitspädagogik Am Lehrstuhl Sport- und Gesundheitspädagogik sind folgende Abschlussarbeiten
Die Bedeutung des Labels Friendly Work Space für die Micarna SA. Albert Baumann Unternehmensleiter Micarna SA
 Die Bedeutung des Labels Friendly Work Space für die Micarna SA Albert Baumann Unternehmensleiter Micarna SA Agenda Betriebliches Gesundheitsmanagement 1.Wer ist die Micarna? 2.Ziele und Kriterien von
Die Bedeutung des Labels Friendly Work Space für die Micarna SA Albert Baumann Unternehmensleiter Micarna SA Agenda Betriebliches Gesundheitsmanagement 1.Wer ist die Micarna? 2.Ziele und Kriterien von
Verkehrsdienst. Schüler und Erwachsene im Einsatz für die Sicherheit. bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung
 Verkehrsdienst Schüler und Erwachsene im Einsatz für die Sicherheit bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung Der Schüler- und Erwachsenenverkehrsdienst leistet einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit.
Verkehrsdienst Schüler und Erwachsene im Einsatz für die Sicherheit bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung Der Schüler- und Erwachsenenverkehrsdienst leistet einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit.
Empfehlung zur Mobilitäts- und Verkehrserziehung in der Schule. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom i. d. F. vom
 Empfehlung zur Mobilitäts- und Verkehrserziehung in der Schule Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.07.1972 i. d. F. vom 10.05.2012 Vorbemerkung Mobilitäts- und Verkehrserziehung ist eine übergreifende
Empfehlung zur Mobilitäts- und Verkehrserziehung in der Schule Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.07.1972 i. d. F. vom 10.05.2012 Vorbemerkung Mobilitäts- und Verkehrserziehung ist eine übergreifende
NETZWERK NACHHALTIGES BAUEN SCHWEIZ NNBS
 NETZWERK NACHHALTIGES BAUEN SCHWEIZ NNBS Novatlantis Bauforum 27. August 2013, Zürich Joe Luthiger, NNBS Netzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz NNBS Bestandteil der vierten Strategie «Nachhaltige Entwicklung»
NETZWERK NACHHALTIGES BAUEN SCHWEIZ NNBS Novatlantis Bauforum 27. August 2013, Zürich Joe Luthiger, NNBS Netzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz NNBS Bestandteil der vierten Strategie «Nachhaltige Entwicklung»
BKS JUGEND. Leitbild Jugendpolitik Kanton Aargau
 BKS JUGEND Leitbild Jugendpolitik Kanton Aargau Dieses Leitbild ist im Auftrag des Regierungsrates entstanden aus der Zusammenarbeit der regierungsrätlichen Jugendkommission und der kantonalen Fachstelle
BKS JUGEND Leitbild Jugendpolitik Kanton Aargau Dieses Leitbild ist im Auftrag des Regierungsrates entstanden aus der Zusammenarbeit der regierungsrätlichen Jugendkommission und der kantonalen Fachstelle
Forum 4: Wenn nur der Erfolg zählt Work-Life-Balance im Vertrieb
 Forum 4: Wenn nur der Erfolg zählt Work-Life-Balance im Vertrieb Reduzierung psychischer Fehlbelastung trotz Erfolgsorientierung Gestaltungsansätze für den Vertrieb (Jürgen Laimer ) Abschlusskonferenz
Forum 4: Wenn nur der Erfolg zählt Work-Life-Balance im Vertrieb Reduzierung psychischer Fehlbelastung trotz Erfolgsorientierung Gestaltungsansätze für den Vertrieb (Jürgen Laimer ) Abschlusskonferenz
Unterwegs mit Licht und Köpfchen! Tagsüber LED-Tagfahrlicht statt Abblendlicht.
 Unterwegs mit Licht und Köpfchen! Tagsüber LED-Tagfahrlicht statt Abblendlicht. Seit Anfang 2014 muss auch tagsüber stets mit Licht gefahren werden. Die Massnahme gehört zu «Via sicura», dem Verkehrssicherheitsprogramm
Unterwegs mit Licht und Köpfchen! Tagsüber LED-Tagfahrlicht statt Abblendlicht. Seit Anfang 2014 muss auch tagsüber stets mit Licht gefahren werden. Die Massnahme gehört zu «Via sicura», dem Verkehrssicherheitsprogramm
Mobil bleiben. asa ASSOCIATION DES SERVICES DES AUTOMOBILES VEREINIGUNG DER STRASSENVERKEHRSÄMTER ASSOCIAZIONE DEI SERVIZI DELLA CIRCOLAZIONE
 Mobil bleiben Sicher unterwegs asa ASSOCIATION DES SERVICES DES AUTOMOBILES VEREINIGUNG DER STRASSENVERKEHRSÄMTER ASSOCIAZIONE DEI SERVIZI DELLA CIRCOLAZIONE Sichere Autofahrt Autofahren ist auch im Alter
Mobil bleiben Sicher unterwegs asa ASSOCIATION DES SERVICES DES AUTOMOBILES VEREINIGUNG DER STRASSENVERKEHRSÄMTER ASSOCIAZIONE DEI SERVIZI DELLA CIRCOLAZIONE Sichere Autofahrt Autofahren ist auch im Alter
Erich Stather, Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
 Erich Stather, Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Erneuerbare Energien und Energieeffizienz Innovative Politik- und Finanzierungsinstrumente für die
Erich Stather, Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Erneuerbare Energien und Energieeffizienz Innovative Politik- und Finanzierungsinstrumente für die
Schwimmen, Schnorcheln, Schlauchboot
 Schwimmen, Schnorcheln, Schlauchboot Spass im Nass bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung Baden, Schwimmen, Schnorcheln und Schlauchbootfahren gehören zu warmen Tagen wie ein erfrischendes Glacé. Sommerzeit
Schwimmen, Schnorcheln, Schlauchboot Spass im Nass bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung Baden, Schwimmen, Schnorcheln und Schlauchbootfahren gehören zu warmen Tagen wie ein erfrischendes Glacé. Sommerzeit
Formen der Jugendkriminalität. Ursachen und Präventionsmaßnahmen
 Pädagogik Mirka Fuchs Formen der Jugendkriminalität. Ursachen und Präventionsmaßnahmen Studienarbeit Inhaltsverzeichnis Seite 1. Einleitung... 1 2. Begriffsdefinitionen... 2 2.1. Kriminalität, Devianz,
Pädagogik Mirka Fuchs Formen der Jugendkriminalität. Ursachen und Präventionsmaßnahmen Studienarbeit Inhaltsverzeichnis Seite 1. Einleitung... 1 2. Begriffsdefinitionen... 2 2.1. Kriminalität, Devianz,
Echte Arbeitszeitflexibilität
 Situation der Mitarbeiter Mit der Einführung der Rente mit 67 Körperliche versus Wissensbasierte Arbeit one size fits all? Nicht für alle Mitarbeiter ist die 35 Stunden Woche perfekt auf dessen Arbeitskraft
Situation der Mitarbeiter Mit der Einführung der Rente mit 67 Körperliche versus Wissensbasierte Arbeit one size fits all? Nicht für alle Mitarbeiter ist die 35 Stunden Woche perfekt auf dessen Arbeitskraft
Systematische Früherkennung von Krebs
 Das Kompetenzzentrum für die Krebs-Früherkennung Systematische Früherkennung von Krebs Hohe und messbare Qualität Ausgewogene Information Effizienter Mitteleinsatz Zugang für alle Engagement von swiss
Das Kompetenzzentrum für die Krebs-Früherkennung Systematische Früherkennung von Krebs Hohe und messbare Qualität Ausgewogene Information Effizienter Mitteleinsatz Zugang für alle Engagement von swiss
TÜV Rheinland: Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Zeitalter von Industrie Köln
 TÜV Rheinland: Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Zeitalter von Industrie 4.0 28.10.2015 Köln Mit Auswirkungen auf ihren Arbeitsplatz durch Industrie 4.0 und den damit einhergehenden nachhaltigen
TÜV Rheinland: Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Zeitalter von Industrie 4.0 28.10.2015 Köln Mit Auswirkungen auf ihren Arbeitsplatz durch Industrie 4.0 und den damit einhergehenden nachhaltigen
Fahrzeugähnliche Geräte
 Fahrzeugähnliche Geräte Mit Spass und Sicherheit unterwegs bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung Bewegung draussen macht Spass, erst recht mit fahrzeugähnlichen Geräten. Mit Einsatz der eigenen Körperkraft
Fahrzeugähnliche Geräte Mit Spass und Sicherheit unterwegs bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung Bewegung draussen macht Spass, erst recht mit fahrzeugähnlichen Geräten. Mit Einsatz der eigenen Körperkraft
Schwerpunkte des Verkehrsunfallgeschehens.
 Inhalt Schwerpunkte des Verkehrsunfallgeschehens 1. Langzeitentwicklung 2005-2014. 2 2. Allgemeine Verkehrsunfallentwicklung -.. 3 3. Vorläufige polizeiliche Verkehrsunfallstatistik Sachsen-Anhalt. 4 4.
Inhalt Schwerpunkte des Verkehrsunfallgeschehens 1. Langzeitentwicklung 2005-2014. 2 2. Allgemeine Verkehrsunfallentwicklung -.. 3 3. Vorläufige polizeiliche Verkehrsunfallstatistik Sachsen-Anhalt. 4 4.
,3 70,4-88, ,7 68,4-85, ,3 68,2-86,4. Geschlecht. Männer 86,9 81,2-92,7 Frauen 68,3 60,2-76,5.
 Alkoholkonsum Trotz der großen Auswirkungen der Risiken bei übermäßigem Konsum auf die Öffentliche Gesundheit, wird das Alkoholproblem derzeit unterschätzt: neben der befürwortenden Einstellung der Bevölkerung
Alkoholkonsum Trotz der großen Auswirkungen der Risiken bei übermäßigem Konsum auf die Öffentliche Gesundheit, wird das Alkoholproblem derzeit unterschätzt: neben der befürwortenden Einstellung der Bevölkerung
"Gesundheit und Krankheit der älteren Generation in Österreich"
 Präsentation des Berichts "Gesundheit und Krankheit der älteren Generation in Österreich" Pressekonferenz 31. August 2012 10:30 Uhr VHS Wiener Urania Am Podium: Alois Stöger, Bundesminister für Gesundheit
Präsentation des Berichts "Gesundheit und Krankheit der älteren Generation in Österreich" Pressekonferenz 31. August 2012 10:30 Uhr VHS Wiener Urania Am Podium: Alois Stöger, Bundesminister für Gesundheit
GEMEINSAM SIND WIR (KNOCHEN) STARK
 GEMEINSAM SIND WIR (KNOCHEN) STARK 1. Auflage 2008 WAS IST OSTEOPOROSE? In der Schweiz leiden rund 300000 Menschen an Osteoporose und jede zweite Frau sowie jeder fünfte Mann ab fünfzig muss heute damit
GEMEINSAM SIND WIR (KNOCHEN) STARK 1. Auflage 2008 WAS IST OSTEOPOROSE? In der Schweiz leiden rund 300000 Menschen an Osteoporose und jede zweite Frau sowie jeder fünfte Mann ab fünfzig muss heute damit
Auswertung der Audit-Berichte 2014 Statistik
 Auswertung der Audit-Berichte 2014 Statistik Allgemein Die folgende Auswertung der Audit-Berichte soll Ihnen helfen, Schwerpunkte des Unfallgeschehens bzw. der in der Branche vorkommenden Risiken zu finden
Auswertung der Audit-Berichte 2014 Statistik Allgemein Die folgende Auswertung der Audit-Berichte soll Ihnen helfen, Schwerpunkte des Unfallgeschehens bzw. der in der Branche vorkommenden Risiken zu finden
Berufsbildungsfonds Treuhand und Immobilientreuhand
 Jahresbericht 2013 Berufsbildungsfonds Treuhand und Immobilientreuhand Editor ial Der Berufsbildungsfonds Treuhand und Immobilientreuhand befindet sich bereits in seinem dritten Geschäftsjahr. Die anfänglichen
Jahresbericht 2013 Berufsbildungsfonds Treuhand und Immobilientreuhand Editor ial Der Berufsbildungsfonds Treuhand und Immobilientreuhand befindet sich bereits in seinem dritten Geschäftsjahr. Die anfänglichen
Ältere Kraftfahrer im ADAC. Unfallursachen & Prävention
 Ältere Kraftfahrer im ADAC Unfallursachen & Prävention Fühlen Sie sich jung? 56 Jahre 67 Jahre 83 Jahre Demographischer Wandel Altersstrukturen der Senioren in den nächsten Jahrzehnten Die Alterstrukturen
Ältere Kraftfahrer im ADAC Unfallursachen & Prävention Fühlen Sie sich jung? 56 Jahre 67 Jahre 83 Jahre Demographischer Wandel Altersstrukturen der Senioren in den nächsten Jahrzehnten Die Alterstrukturen
Ruedi Kaufmann, Suva Stefan Oglesby, LINK Institut. Ruedi Kaufmann, Suva Stefan Oglesby, LINK Institut
 Ist die Wirkung von Präventionsmassnahmen messbar? Ansätze und Evaluationsergebnisse am Beispiel der ersten vier Durchgängen des Suva Präventionspanels Ruedi Kaufmann, Suva Stefan Oglesby, LINK Institut
Ist die Wirkung von Präventionsmassnahmen messbar? Ansätze und Evaluationsergebnisse am Beispiel der ersten vier Durchgängen des Suva Präventionspanels Ruedi Kaufmann, Suva Stefan Oglesby, LINK Institut
Konzept-, Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität
 Konzept-, Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität PD Dr. Rainer Strobl Universität Hildesheim Institut für Sozialwissenschaften & proval Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Analyse, Beratung und
Konzept-, Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität PD Dr. Rainer Strobl Universität Hildesheim Institut für Sozialwissenschaften & proval Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Analyse, Beratung und
Leitfaden für gesundheitsfördernde Bewegung und gesundes Essen und Trinken
 Leitfaden für gesundheitsfördernde Bewegung und gesundes Essen und Trinken Mag a Silvia Marchl http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/45359806/de/ Hintergrund Vorrangiges Gesundheitsziel Mit Ernährung
Leitfaden für gesundheitsfördernde Bewegung und gesundes Essen und Trinken Mag a Silvia Marchl http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/45359806/de/ Hintergrund Vorrangiges Gesundheitsziel Mit Ernährung
Die Cadolto Modulbau Technologie. Faszination Modulbau. cadolto Fertiggebäude Als Module gefertigt. Als Ganzes überzeugend.
 Die Cadolto Modulbau Technologie Faszination Modulbau cadolto Fertiggebäude cadolto Fertiggebäude Faszination Modulbau cadolto Fertiggebäude Die Cadolto Modulbau Technologie Erleben Sie, wie Ihr individueller
Die Cadolto Modulbau Technologie Faszination Modulbau cadolto Fertiggebäude cadolto Fertiggebäude Faszination Modulbau cadolto Fertiggebäude Die Cadolto Modulbau Technologie Erleben Sie, wie Ihr individueller
Bundespressekonferenz
 Bundespressekonferenz Mittwoch, den 29.Oktober 2014 Erklärung von Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.v. Deutscher Caritasverband e.v. Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Hauptvorstand Deutschland braucht
Bundespressekonferenz Mittwoch, den 29.Oktober 2014 Erklärung von Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.v. Deutscher Caritasverband e.v. Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Hauptvorstand Deutschland braucht
Deutschland im demografischen Wandel.
 Deutschland im demografischen Wandel. Gefährdung des gesellschaftlichen Zusammenhalts? Prof. Dr. Norbert F. Schneider Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung 3. Berliner Demografie Forum 10. April 2014
Deutschland im demografischen Wandel. Gefährdung des gesellschaftlichen Zusammenhalts? Prof. Dr. Norbert F. Schneider Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung 3. Berliner Demografie Forum 10. April 2014
Vom steuerlichen Kontrollsystem zum Tax Performance Management System. Das innerbetriebliche Kontrollsystem zur Erfüllung der steuerlichen Pflichten
 Vom steuerlichen Kontrollsystem zum Tax Performance Management System Das innerbetriebliche Kontrollsystem zur Erfüllung der steuerlichen Pflichten Anforderungen Risiko Tax Compliance? Unternehmen sind
Vom steuerlichen Kontrollsystem zum Tax Performance Management System Das innerbetriebliche Kontrollsystem zur Erfüllung der steuerlichen Pflichten Anforderungen Risiko Tax Compliance? Unternehmen sind
Quantifizierung von Raucherprävalenzen auf nationaler Ebene: Voraussetzungen und Chancen
 Quantifizierung von Raucherprävalenzen auf nationaler Ebene: Voraussetzungen und Chancen Peter Lang Berlin, den 25. Januar 2010 Die Festlegung von Zielgrößen für die Senkung des Rauchverhaltens auf nationaler
Quantifizierung von Raucherprävalenzen auf nationaler Ebene: Voraussetzungen und Chancen Peter Lang Berlin, den 25. Januar 2010 Die Festlegung von Zielgrößen für die Senkung des Rauchverhaltens auf nationaler
Analyse des Betriebszustandes der ZKS-Abfall. Empfehlungen für den zukünftigen Betrieb
 Analyse des Betriebszustandes der ZKS-Abfall Empfehlungen für den zukünftigen Betrieb Stand: 21. März 2011 Neutrale Prüfung der ZKS-Abfall Nachdem die ZKS-Abfall ab 1. April 2010, dem Inkrafttreten der
Analyse des Betriebszustandes der ZKS-Abfall Empfehlungen für den zukünftigen Betrieb Stand: 21. März 2011 Neutrale Prüfung der ZKS-Abfall Nachdem die ZKS-Abfall ab 1. April 2010, dem Inkrafttreten der
Auf dem Weg zu einer jugendfreundlichen Kommune
 Auf dem Weg zu einer jugendfreundlichen Kommune Nutzen und Handlungsbedarfe Fachforum auf dem 15. DJHT 05. Juni 2014 Berlin Dr. Christian Lüders lueders@dji.de Prämissen von Jugendpolitik Sämtliche Akteure,
Auf dem Weg zu einer jugendfreundlichen Kommune Nutzen und Handlungsbedarfe Fachforum auf dem 15. DJHT 05. Juni 2014 Berlin Dr. Christian Lüders lueders@dji.de Prämissen von Jugendpolitik Sämtliche Akteure,
Direktion Bildung und Soziales Abteilung Bildung, Soziale Einrichtungen und Sport. Fachstelle Prävention, Kinderund Jugendarbeit.
 Leitbild 18. März 2016 Vorwort Jugendliche kümmern sich nicht um Gemeindegrenzen Die heutige Jugend ist viel mobiler als früher. Ein Jugendlicher aus Köniz besucht vielleicht ab und zu den lokalen Jugendtreff,
Leitbild 18. März 2016 Vorwort Jugendliche kümmern sich nicht um Gemeindegrenzen Die heutige Jugend ist viel mobiler als früher. Ein Jugendlicher aus Köniz besucht vielleicht ab und zu den lokalen Jugendtreff,
Pressekonferenz. Thema: Vorstellung des Geburtenbarometers - Eine neue Methode zur Messung der Geburtenentwicklung
 Pressekonferenz mit Bundesministerin Ursula Haubner, Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz und Prof. Dr. Wolfgang Lutz, Direktor des Instituts für Demographie der
Pressekonferenz mit Bundesministerin Ursula Haubner, Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz und Prof. Dr. Wolfgang Lutz, Direktor des Instituts für Demographie der
Müdigkeit am Steuer. Wach ans Ziel. bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung
 Müdigkeit am Steuer Wach ans Ziel bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung Schlafen Sie sich wach Bei rund 10 20 % aller Verkehrsunfälle ist Müdigkeit im Spiel. Nicht nur das Einschlafen am Steuer ist gefährlich,
Müdigkeit am Steuer Wach ans Ziel bfu Beratungsstelle für Unfallverhütung Schlafen Sie sich wach Bei rund 10 20 % aller Verkehrsunfälle ist Müdigkeit im Spiel. Nicht nur das Einschlafen am Steuer ist gefährlich,
Arbeitsschutzmanagement- Mit System sicher zum Erfolg
 Arbeitsschutzmanagement- Mit System sicher zum Erfolg SiGe-Fachgespräch, 28.09.2016, Köln Marcus Hussing Stichwort AMS in Google: 346 Mio. Ergebnisse von Auto Motor Sport, Service für Arbeitssuchende,
Arbeitsschutzmanagement- Mit System sicher zum Erfolg SiGe-Fachgespräch, 28.09.2016, Köln Marcus Hussing Stichwort AMS in Google: 346 Mio. Ergebnisse von Auto Motor Sport, Service für Arbeitssuchende,
Therese Stutz Steiger, Vorstandsmitglied Esther Neiditsch, Geschäftsleiterin
 Therese Stutz Steiger, Vorstandsmitglied Esther Neiditsch, Geschäftsleiterin 17. März 2014 Überblick ProRaris Rare Disease Days in der Schweiz Nationale Strategie für Seltene Krankheiten Aktuelle Fragen;
Therese Stutz Steiger, Vorstandsmitglied Esther Neiditsch, Geschäftsleiterin 17. März 2014 Überblick ProRaris Rare Disease Days in der Schweiz Nationale Strategie für Seltene Krankheiten Aktuelle Fragen;
SDK, Schweizerische Konferenz der Direktoren gewerblich-industrieller Berufsschulen Wülflingerstr. 17, 8400 Winterthur
 Programm: LEONARDO DA VINCI Projekt: EURO - BAC II Laufzeit: 01. Januar 2000 30. Juni 2001 Antrag: Beitrag an die Kosten des Projektes Antragsteller: SDK, Schweizerische Konferenz der Direktoren gewerblich-industrieller
Programm: LEONARDO DA VINCI Projekt: EURO - BAC II Laufzeit: 01. Januar 2000 30. Juni 2001 Antrag: Beitrag an die Kosten des Projektes Antragsteller: SDK, Schweizerische Konferenz der Direktoren gewerblich-industrieller
Inputreferat Nationale Strategie zur Bekämpfung nichtübertragbarer Krankheiten. Überblick zu den Inhalten. Slow motion disaster
 Inputreferat Nationale Strategie zur Bekämpfung nichtübertragbarer Krankheiten Dr. Roy Salveter Überblick zu den Inhalten 1. Nichtübertragbare Erkrankungen 2. Abteilung Nationale Präventionsprogramme 3.
Inputreferat Nationale Strategie zur Bekämpfung nichtübertragbarer Krankheiten Dr. Roy Salveter Überblick zu den Inhalten 1. Nichtübertragbare Erkrankungen 2. Abteilung Nationale Präventionsprogramme 3.
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) und betriebliche Gesundheitsförderung
 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) und betriebliche Erfolgreiche Unternehmen zeichnen sich durch leistungsfähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus, die dafür sorgen, dass das Unternehmen mit
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) und betriebliche Erfolgreiche Unternehmen zeichnen sich durch leistungsfähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus, die dafür sorgen, dass das Unternehmen mit
P R E S S E I N F O R M A T I O N
 P R E S S E I N F O R M A T I O N Deutsche Reihenmessung SizeGERMANY Veränderungen bei Körpermaßen, Marktanteilen und Konfektionsgrößen Bönnigheim/Kaiserslautern (ri) Die repräsentative Deutsche Reihenmessung
P R E S S E I N F O R M A T I O N Deutsche Reihenmessung SizeGERMANY Veränderungen bei Körpermaßen, Marktanteilen und Konfektionsgrößen Bönnigheim/Kaiserslautern (ri) Die repräsentative Deutsche Reihenmessung
rechtsstaatlich bürgerorientiert professionell Verkehrsunfallstatistik 2014 Pressemeldung
 rechtsstaatlich bürgerorientiert professionell Verkehrsunfallstatistik 2014 Pressemeldung www.polizei.nrw.de/bonn 1 Verkehrsunfallstatistik 2014 Bagatell- und Zweiradunfälle sorgen für Anstieg der Unfallzahlen
rechtsstaatlich bürgerorientiert professionell Verkehrsunfallstatistik 2014 Pressemeldung www.polizei.nrw.de/bonn 1 Verkehrsunfallstatistik 2014 Bagatell- und Zweiradunfälle sorgen für Anstieg der Unfallzahlen
Experience responsibility. Dienstleistungen für die. Medizintechnik. Pharma & Biotechnologie
 Experience responsibility Dienstleistungen für die Pharma & Biotechnologie Medizintechnik QM/GMP Compliance für Ihre Medizinprodukte Für Inverkehrbringer, Hersteller und technische Aufbereiter von Medizinprodukten
Experience responsibility Dienstleistungen für die Pharma & Biotechnologie Medizintechnik QM/GMP Compliance für Ihre Medizinprodukte Für Inverkehrbringer, Hersteller und technische Aufbereiter von Medizinprodukten
Stand der Arbeit. Kinder und Jugendliche mit frühkindlichen Entwicklungsstörungen in der Schweiz Bericht des Bundesrats
 Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Sozialversicherungen BSV Kinder und Jugendliche mit frühkindlichen Entwicklungsstörungen in der Schweiz Bericht des Bundesrats Stand der Arbeit
Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Sozialversicherungen BSV Kinder und Jugendliche mit frühkindlichen Entwicklungsstörungen in der Schweiz Bericht des Bundesrats Stand der Arbeit
Einleitung. 1. Untersuchungsgegenstand und Relevanz. Gegenstand der hier vorliegenden Arbeit ist die Mediation als Instrument der Konfliktlösung
 Einleitung 1. Untersuchungsgegenstand und Relevanz Gegenstand der hier vorliegenden Arbeit ist die Mediation als Instrument der Konfliktlösung 1 und damit v.a. als Mittel außergerichtlicher Konfliktbeilegung
Einleitung 1. Untersuchungsgegenstand und Relevanz Gegenstand der hier vorliegenden Arbeit ist die Mediation als Instrument der Konfliktlösung 1 und damit v.a. als Mittel außergerichtlicher Konfliktbeilegung
Begeisterung? «Bei meinem Geld kann ich mitreden.» Helvetia Garantieplan. Garantie und Rendite individuell optimieren. Ihre Schweizer Versicherung.
 Begeisterung? «Bei meinem Geld kann ich mitreden.» Helvetia Garantieplan. Garantie und Rendite individuell optimieren. Ihre Schweizer Versicherung. 1/6 Helvetia Garantieplan Produktblatt So funktioniert
Begeisterung? «Bei meinem Geld kann ich mitreden.» Helvetia Garantieplan. Garantie und Rendite individuell optimieren. Ihre Schweizer Versicherung. 1/6 Helvetia Garantieplan Produktblatt So funktioniert
Die Rolle der Ökobilanzen im Rahmen der Grünen Wirtschaft
 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Ökonomie und Umweltbeobachtung Die Rolle der Ökobilanzen im Rahmen der Grünen Wirtschaft Ökobilanzplattform
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Umwelt BAFU Ökonomie und Umweltbeobachtung Die Rolle der Ökobilanzen im Rahmen der Grünen Wirtschaft Ökobilanzplattform
(Termine, Daten, Inhalte)
 IV. Dokumentationsbögen / Planungsbögen (I VII) für die Referendarinnen und Referendare hinsichtlich des Erwerbs der geforderten und im Verlauf ihrer Ausbildung am Marie-Curie-Gymnasium Die Referendarinnen
IV. Dokumentationsbögen / Planungsbögen (I VII) für die Referendarinnen und Referendare hinsichtlich des Erwerbs der geforderten und im Verlauf ihrer Ausbildung am Marie-Curie-Gymnasium Die Referendarinnen
Entwicklung des Arbeitsmarkts für Ältere
 Arbeitsmarktservice Salzburg Landesgeschäftsstelle Medieninformation Salzburg, 29. April 2015 50plus: Programme für ältere Arbeitslose Entwicklung des Arbeitsmarkts für Ältere 2008-2014 Unselbständige
Arbeitsmarktservice Salzburg Landesgeschäftsstelle Medieninformation Salzburg, 29. April 2015 50plus: Programme für ältere Arbeitslose Entwicklung des Arbeitsmarkts für Ältere 2008-2014 Unselbständige
Leitbild Malans. Wohnen und leben in den Bündner Reben
 Leitbild Malans Wohnen und leben in den Bündner Reben Gemeinde Malans: Zukunftsperspektiven Richtziele Malans mit seinen natürlichen Schönheiten, Wein und Kultur ist eine liebens- und lebenswerte Gemeinde.
Leitbild Malans Wohnen und leben in den Bündner Reben Gemeinde Malans: Zukunftsperspektiven Richtziele Malans mit seinen natürlichen Schönheiten, Wein und Kultur ist eine liebens- und lebenswerte Gemeinde.
Massnahmenkatalog zur Cloud Computing Strategie der Schweizer Behörden
 Massnahmenkatalog zur Cloud Computing Strategie der Schweizer Behörden 2012-2020 25. Oktober 2012 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 3 2 Stossrichtung S1/Teil 1 - Schrittweiser Einsatz von Cloud-Diensten...
Massnahmenkatalog zur Cloud Computing Strategie der Schweizer Behörden 2012-2020 25. Oktober 2012 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 3 2 Stossrichtung S1/Teil 1 - Schrittweiser Einsatz von Cloud-Diensten...
