Lehrplan Gymnasium/ Fachgymnasium
|
|
|
- Otto Wagner
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Lehrplan Gymnasium/ Fachgymnasium Kompetenzentwicklung und Unterrichtsqualität Stand: Grundsatzband
2 An der Erstellung des Grundsatzbandes Kompetenzentwicklung und Unterrichtsqualität haben als Mitglieder der Koordinierungsgruppe für die Entwicklung des Lehrplans am LISA mitgewirkt: Dr. Uta Bentke Dr. Siegfried Both Elke Dönitz Dr. Volker Richter
3 Inhaltsverzeichnis Seite 1 Erziehungs- und Bildungsauftrag Der Lehrplan als Grundlage für Unterrichtsqualität Bestandteile und Funktionen des Lehrplans Schulinterne Planungen Kompetenzentwicklung Grundlagen Schlüsselkompetenzen Kompetenzorientierte Unterrichtsgestaltung Kompetenzorientierte Leistungsbewertung Fach- und schulformübergreifende Empfehlungen und Beschlüsse zur schulischen Bildung und Erziehung
4 1 Erziehungs- und Bildungsauftrag Grundlage Der Erziehungs- und Bildungsauftrag für Schulen in Sachsen-Anhalt ist auf eine ganzheitliche und abschlussbezogene Erziehung und Bildung der Schülerinnen und Schüler unter Beachtung ihrer individuellen Lernvoraussetzungen und Lernbedürfnisse gerichtet. Die Schülerinnen und Schüler lernen, die Werte des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt zu achten und mit Leben zu erfüllen. Sie werden befähigt, ihr Leben bewusst und eigenverantwortlich zu gestalten. Dazu gehört, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen, eigene Rechte und Pflichten zu erkennen und diese als Orientierung zu nutzen. Die Schülerinnen und Schüler hinterfragen ihr eigenes Handeln und das der anderen vor dem Hintergrund nationaler und globaler Herausforderungen. Sie entwickeln die Fähigkeit und Bereitschaft zum lebenslangen Lernen. Das Gymnasium und das Fachgymnasium vermitteln eine abschlussbezogene vertiefte allgemeine Bildung, die am Fachgymnasium mit berufsbezogenen Schwerpunkten verbunden ist. Die Schülerinnen und Schüler werden ihren Leistungen und Neigungen entsprechend befähigt, die Allgemeine Hochschulreife zu erwerben. Teilhabe und Teilnahme am gesellschaftlichen Leben Die Schule ist Handlungsfeld gelebter Demokratie, in der die Würde des jeweils anderen geachtet, Toleranz gegenüber anderen Menschen und Meinungen geübt und für Zivilcourage eingetreten wird sowie Regeln eingehalten und Konflikte gewaltfrei gelöst werden. Es kommen Lehr- und Lernformen zum Tragen, die demokratisches Handeln und Verantwortungsübernahme in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung fordern und fördern. Dabei werden Werte wie Gerechtigkeit, Ehrlichkeit und gegenseitiger Respekt vermittelt. Dazu gehört auch die Kenntnis, Anerkennung und Beachtung allgemeiner und schulischer Verhaltensregeln sowie die Entwicklung der Fähigkeit und Bereitschaft zur aktiven Wahrnehmung von Verantwortung für eigenes Handeln in individuellen, sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhängen. 2
5 Lebensweltbezogenes Lernen Fachliche Zusammenhänge und Erklärungen werden in lebensweltliche Bezüge der Schülerinnen und Schüler eingebettet. Sie erfahren auf diese Weise die Relevanz von Wissensbeständen und Kompetenzen für die Bewältigung der Anforderungen in Studium und Beruf sowie für die Weiterentwicklung der Gesellschaft. Die Nachhaltigkeit ihres Handelns und die Auswirkungen für nachfolgende Generationen sind ihnen bewusst. Um den eigenen Lebensalltag bewältigen und die Lebenswelt mitgestalten zu können, entwickeln die Schülerinnen und Schüler auch ein verantwortungsbewusstes Verhalten gegenüber ihrer eigenen Gesundheit und der ihrer Mitmenschen. Dazu reflektieren sie ihre Lebensgewohnheiten, verstehen Zusammenhänge zwischen ausgewogener Ernährung, körperlicher Fitness und aktiver Bewegung sowie geistigem Leistungsvermögen und ziehen Rückschlüsse für die eigene Lebensgestaltung. In diesem Zusammenhang setzen sie sich auch mit Suchtgefahren auseinander und richten ihr Verhalten entsprechend aus. Allgemeine Hochschulreife Das Gymnasium und das Fachgymnasium führen zur Allgemeinen Hochschulreife, der schulischen Abschlussqualifikation, die den Zugang zu einem Studium an einer Hochschule, aber auch den Weg in eine vergleichbare berufliche Ausbildung ermöglicht 1. Dazu ist es notwendig, dass die Schülerinnen und Schüler auf der Grundlage eines sicher verfügbaren und flexibel anwendbaren Wissens zu einem Denk-, Lern- und Arbeitsstil gelangen, der von einer zunehmend eigenverantwortlichen und selbstständigen Erkenntnisgewinnung und -aneignung geprägt ist. Sie entwickeln Anstrengungsbereitschaft, Gewissenhaftigkeit und Selbstständigkeit, verbinden dies mit der Neugierde auf neues Wissen sowie den dafür notwendigen Wissenserwerb und sind bereit, ausdauernd und leistungsorientiert zu arbeiten. Die Schülerinnen und Schüler erhalten dabei eine kontinuierliche Unterstützung, um ihre Stärken auszubauen und Schwächen zu überwinden. Auftrag des Gymnasiums und des Fachgymnasiums ist es in diesem Zusammenhang auch, die Schülerinnen und Schüler zur Berufs- und Studienwahl zu befähigen. 1 Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom i. d. F. vom , S. 4. 3
6 Wissenschaftspropädeutik Insbesondere in der gymnasialen Oberstufe wird der Unterricht wissenschaftspropädeutisch angelegt. Die Schülerinnen und Schüler lernen wesentliche Strukturen und Arbeitsweisen von Wissenschaften kennen, wenden diese an und verstehen deren Erkenntnismöglichkeiten und Aussagegrenzen. Sie gewinnen Einsichten in die Komplexität wissenschaftlicher Disziplinen und deren Zusammenwirken und erwerben insbesondere die Fähigkeit, theoretische Erkenntnisse zu erklären und anzuwenden. 4
7 2 Der Lehrplan als Grundlage für Unterrichtsqualität 2.1 Bestandteile und Funktionen des Lehrplans Bestandteile Der Lehrplan für das Gymnasium bzw. Fachgymnasium besteht aus dem Grundsatzband und den Fachlehrplänen. Der Grundsatzband knüpft am Erziehungs- und Bildungsauftrag des Schulgesetzes an. Er stellt dar, über welche Schlüsselkompetenzen die Schülerinnen und Schüler mit dem Erreichen der Allgemeinen Hochschulreife verfügen sollen. Darüber hinaus werden allgemeine Anforderungen an die Kompetenzentwicklung sowie an die Gestaltung schulinterner Planungen verdeutlicht. Die Fachlehrpläne weisen den spezifischen Beitrag der einzelnen Fächer zur Erziehung und Bildung im Gymnasium und im Fachgymnasium aus. In ihrem Zentrum stehen die systematische Entwicklung von Kompetenzen auf der Grundlage fachspezifischer Kompetenzmodelle sowie der Beitrag des jeweiligen Faches zur Entwicklung von Schlüsselkompetenzen. Kompetenzentwicklung und das zu erwerbende Wissen werden gemäß den fachspezifischen Kompetenzmodellen für die Doppeljahrgänge 5/6 und 7/8, den Schuljahrgang 9, die Einführungsphase und die Qualifikationsphase als Zielniveaus ausgewiesen. Niveaubestimmende Aufgaben untersetzen exemplarisch die Lehrplananforderungen. Sie geben Anregungen für die Unterrichtsgestaltung und leisten einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Aufgabenkultur. Funktionen Der Lehrplan formuliert Anforderungen an die Beteiligten am Lernprozess und an die erwarteten Lernergebnisse. Er ist verbindliche Grundlage für: die Unterrichtsplanung und -gestaltung, die Leistungsfeststellung und -beurteilung sowie die Arbeit schulischer Gremien. Der Lehrplan beschreibt verbindliche Grundlagen für die Erziehungs- und Bildungsarbeit und untersetzt die Anforderungen fachbezogen. Mit seinen Vorgaben werden Qualität und Vergleichbarkeit schulischer Arbeit im Gymnasium und Fachgymnasium grundlegend abgesichert. 5
8 Er dient gleichzeitig der Information von Schülerinnen und Schülern, deren Erziehungsberechtigten und der Öffentlichkeit über Inhalte und Ansprüche des Lernens im Gymnasium und im Fachgymnasium. Er gibt Anregungen für die Einbeziehung außerschulischer Partner. Darüber hinaus ist er eine wichtige Grundlage interner bzw. externer Evaluationen in folgenden Qualitätsbereichen: Schülerleistungen, Lehr- und Lernbedingungen, Professionalität der Lehrkräfte, Leitungsgeschehen und Schulmanagement, Schulorganisation sowie Schulklima und Schulkultur. 2.2 Schulinterne Planungen Bedeutung Voraussetzung und zugleich Merkmal für die Qualität einer Schule ist die Zusammenarbeit aller Beteiligten. Für die Koordinierung der Arbeit von Lehrkräften sind schulinterne Planungen notwendig, in denen inhalts- und prozessbezogene Aspekte des Lehrens und Lernens unter Berücksichtigung schulspezifischer Bedingungen und Ziele abgestimmt werden. Entsprechende Konkretisierungen und Festlegungen werden durch Konferenzbeschlüsse zur gemeinsamen und verbindlichen Arbeitsgrundlage der Lehrkräfte. Schulinterne Planungen auf Fachebene sowie auf der Ebene der Schuljahrgänge dienen der Umsetzung des Schulprogramms, des Grundsatzbandes, der Fachlehrpläne und der zentralen Vorgaben zur Sicherung der Abschlüsse. Die individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Begabungen sowie von Schülerinnen und Schülern, die vorübergehend Schwierigkeiten haben, die Anforderungen des Bildungsganges zu erfüllen, erfolgt auf der Grundlage zeitlich begrenzter Individualpläne gemäß den Vorgaben. 6
9 Schwerpunkte Schulinternes Planen zur Umsetzung des kompetenzorientierten Lehrplans umfasst folgende Schwerpunkte: Analysieren fach- bzw. schuljahrgangsspezifischer Ausgangslagen und Ableiten von entwicklungsangemessenen Anforderungen, Verständigen zu fachspezifischen Beiträgen zur Entwicklung von Schlüsselkompetenzen sowie zum Erreichen des wissenschaftspropädeutischen Anspruchs, Koordinieren der Entwicklung fachbezogener Kompetenzen und von Schlüsselkompetenzen in Verantwortung mehrerer Fächer, Abstimmen didaktisch-methodischer Konzepte und Materialien kompetenzorientierten Unterrichtens (z. B. kumulatives Lernen, Gestalten von Anforderungssituationen), Planen der Ziele, Inhalte und Formen der Leistungsfeststellung und -beurteilung sowie deren zeitliche Abstimmung, Koordinieren von fächerübergreifendem Arbeiten im schulischen bzw. außerschulischen Bereich (z. B. Service-Learning, Berufs- bzw. Studienorientierung), Gestalten von Lernarrangements (z. B. zur individuellen Förderung) und Konzipieren der Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern, mit Erziehungsberechtigten sowie mit außerschulischen Partnern. Vereinbarungen, Verabredungen und Entscheidungen werden so getroffen, dass Freiräume für individuelle Anpassungen durch die Lehrkräfte möglich sind. Dazu zählt insbesondere die inhaltliche und methodische Gestaltung von Lernprozessen entsprechend der zu unterrichtenden Lerngruppe und individueller Lernvoraussetzungen. 7
10 3 Kompetenzentwicklung 3.1 Grundlagen Kompetenzbegriff Fachbezogene Kompetenzen und Schlüsselkompetenzen Wissen Im Lehrplan werden unter Kompetenzen erlernbare, auf Wissen begründete Fähigkeiten und Fertigkeiten verstanden, die eine erfolgreiche Bewältigung bestimmter Anforderungssituationen ermöglichen. Hinzu kommen die dafür erforderliche motivationale Bereitschaft, Einstellungsdispositionen und soziale Fähigkeiten. 2 Im Kern geht es darum, Wissen und Können flexibel und verantwortungsvoll zur Lösung von Problemen in Denk- oder Handlungsprozessen anzuwenden. Den Fachlehrplänen liegen fachspezifische Kompetenzmodelle zu Grunde. Diese verdeutlichen, in welchen Kompetenzbereichen systematisch und in Schuljahrgängen aufwachsend fachbezogene Kompetenzen erworben werden. Erziehung und Bildung im Gymnasium und im Fachgymnasium werden gleichzeitig von Schlüsselkompetenzen bestimmt. Diese sind im Grundsatzband dargestellt. Der Fachunterricht ist sowohl auf die Entwicklung fachbezogener Kompetenzen als auch der Schlüsselkompetenzen gerichtet. Diese werden in besonderer Weise gefördert, wenn in mehreren Fächern gemeinsam und koordiniert daran gearbeitet wird. Die Fachlehrpläne legen Grundlagen zur Entwicklung von Schlüsselkompetenzen. Ein kompetenzorientierter Unterricht hat zum Ziel, den Aufbau von Wissen systematisch mit der Befähigung zu verknüpfen, dieses Wissen zunehmend selbstständig anwenden zu können. Einerseits ist flexibel anwendbares Wissen die Grundlage für die Entwicklung von Kompetenzen, andererseits bilden Kompetenzen eine Voraussetzung für die Erweiterung und Vertiefung vorhandenen Wissens. Die in den Fachlehrplänen ausgewiesenen Wissensbestände werden nach fachspezifischen Kriterien ausgewählt und angeordnet. Sie stehen exemplarisch für ähnliche Wissensbestände, sind relativ konstant anwendbar für Schülerinnen und Schüler sowie zukunftsrelevant für den Einzelnen und die Gesellschaft. 2 Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) in Zusammenarbeit mit dem Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen: Konzeption der Kultusministerkonferenz zur Nutzung der Bildungsstandards für die Unterrichtsentwicklung. Bonn und Berlin 2010, S. 9. 8
11 Anforderungssituationen Kompetenzen zu entwickeln und zu überprüfen bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler Denkoperationen bzw. Handlungen ausführen, die sich auf das Bearbeiten von Problemen beziehen und im Kern eine Lösung erwarten lassen. Solche Anforderungssituationen sind gekennzeichnet durch: bewusstes Aufgreifen vorhandenen Wissens sowie vorhandener Fähigkeiten und Fertigkeiten, Erkennen inhaltlicher und methodischer Zusammenhänge, Durchdenken und Realisieren angemessener Handlungsschritte, Beschaffen erforderlicher Informationen durch die Lernenden, Dokumentieren und Präsentieren von Ergebnissen sowie Prüfen und Bewerten eigener Lernwege bzw. eigenen Handelns. 3.2 Schlüsselkompetenzen Bedeutung Schlüsselkompetenzen sind immanente Bestandteile gymnasialer Bildung. Unter Schlüsselkompetenzen werden übergreifende Kompetenzen verstanden, die in unserer durch raschen Wandel und zunehmende Globalisierung geprägten Gesellschaft für persönliche Entfaltung in Schule, Studium oder Beruf, für eine aktive Teilnahme und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sowie zum nachhaltigen Umgang mit natürlichen, sozialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ressourcen nötig sind. Sie sind auf die Entwicklung von Persönlichkeiten gerichtet, die Verantwortung übernehmen und sowohl Rechte als auch Pflichten wahrnehmen können. Zwischen den Schlüsselkompetenzen gibt es Schnittmengen und Verbindungen, die insbesondere von den Lerngegenständen und den Lernwegen abhängig sind. Die Schlüsselkompetenzen basieren auf Beschlüssen und Empfehlungen der KMK sowie der EU und des Europaparlamentes. 3 Gemeinsame Aufgabe aller Fächer ist die Ausprägung von Sprachkompetenz, Lernkompetenz, Medienkompetenz, Sozialkompetenz, Demokratiekompetenz sowie kultureller Kompetenz. Auch für die Entwicklung der mathematischen, naturwissenschaftlichtechnischen und wirtschaftlichen Kompetenz sind Beiträge erforderlich, die über die jeweiligen Fächergruppen hinausgehen. 3 vgl. Abschnitt 4 9
12 Sprachkompetenz Sprachen angemessen und normgerecht gebrauchen Die Schülerinnen und Schüler kommunizieren sowohl in der deutschen Sprache als auch in Fremdsprachen selbstständig norm-, sach-, situations- und adressatengerecht in mündlicher und schriftlicher Form. Sie setzen Sprache bewusst bei der Teilnahme und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ein. Die Schülerinnen und Schüler erschließen und produzieren Texte verschiedener Textsorten, einschließlich wissenschaftlicher Fachtexte. Sie verwenden die jeweilige Fachsprache und die Umgangssprache angemessen und in bewusster Abgrenzung zueinander. Die Schülerinnen und Schüler achten und berücksichtigen die Ästhetik der deutschen Sprache und von Fremdsprachen. Sie nutzen ihre Mehrsprachigkeit zur Ausprägung von Sprachbewusstheit und Interkulturalität. Lernkompetenz Lernen bewusst gestalten und reflektieren Die Schülerinnen und Schüler lernen und handeln individuell und in Kooperation mit anderen kontinuierlich und erfolgreich in bewusst gestalteten unterschiedlichen Lernsituationen. Sie entwickeln für sich ein effizientes Zeitmanagement. Das schließt Selbstorganisation, Reflexion des Lehrens und Lernens sowie das Ableiten von Rückschlüssen für sich selbst und für die Lerngruppe bezüglich der Lernziele, Lernstrategien, Lernergebnisse und Lernhaltungen ein. Sie erwerben die Fähigkeit und Bereitschaft, Hindernisse in Lernprozessen zu überwinden. Dazu gehört es auch, dass die Schülerinnen und Schüler das physische und psychische Leistungsvermögen von sich und anderen einschätzen können und sich dabei körperlicher und geistiger Stärken wie auch Schwächen bewusst werden. Sie lernen es, mit Belastungssituationen umzugehen und sich darauf einzustellen. Die Schülerinnen und Schüler gewinnen, verarbeiten, bewerten und präsentieren Informationen, tauschen diese aus und nutzen sie für eigenständiges Lernen sowie für die Bewältigung individueller und gesellschaftlicher Anforderungen. Zur Unterstützung nutzen sie verschiedene Medien, auch digitale Werkzeuge und Endgeräte. 10
13 Medienkompetenz Herausforderungen der Mediengesellschaft konstruktiv bewältigen Auf der Grundlage eines fundierten und kritischen Verständnisses der komplexen Medienlandschaft in der Gesellschaft reflektieren und gestalten die Schülerinnen und Schüler ihren eigenen Mediengebrauch und beachten neben den Chancen auch die Risiken, die mit dem Gebrauch digitaler Medien verbunden sind. Die Schülerinnen und Schüler beurteilen den Einfluss der Medien auf ihre bzw. fremde Wertvorstellungen, Haltungen und Handlungen. Sie nutzen verantwortungsvoll und rechtmäßig mediale Möglichkeiten, um sich in kommunikativen und kooperativen Prozessen angemessen zu artikulieren und achten dabei die Persönlichkeitsrechte anderer. Sie können Medienprodukte selbst erstellen. Miteinander achtungsvoll umgehen und konstruktiv handeln Die Schülerinnen und Schüler handeln in sozialen Beziehungen konstruktiv, solidarisch und tolerant und bringen anderen Empathie sowie Verständnis entgegen. Auf dieser Basis arbeiten sie wirkungsvoll mit anderen zusammen. Auch in virtuellen Umgebungen handeln sie besonnen und verantwortungsvoll. Sie erkennen Konflikten zugrunde liegende unterschiedliche Wertvorstellungen, Interessen sowie Sichtweisen und verfolgen konstruktive Wege zur Konfliktbewältigung. Durch die Auseinandersetzung mit verschiedenen Kulturen, Religionen, Weltanschauungen, sexueller Vielfalt und individuellen Vorstellungen von Lebensgestaltung nehmen die Schülerinnen und Schüler ihre Unterschiedlichkeit bewusst wahr. Sie empfinden diese Vielfalt als Bereicherung, gehen respektvoll miteinander um und helfen Benachteiligten. Sozialkompetenz Demokratiekompetenz Demokratisch handeln und Demokratie stärken Die Schülerinnen und Schüler tragen zur weiteren Ausgestaltung einer auf Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität ausgerichteten Gesellschaft bei. Sie finden sich in gesellschaftlichen Zusammenhängen und im System des demokratischen Verfassungsstaates zurecht, erkennen politische Beteiligungsrechte und sind in der Lage, von ihnen Gebrauch zu machen. Die Schülerinnen und Schüler können begründet Positionen beziehen, getroffene Entscheidungen nach demo- 11
14 kratischen Regeln umsetzen und auch dann akzeptieren, wenn sie nicht einverstanden sind. Sie verfügen über die Einsicht, dass Demokratie nur bewahrt und nachhaltig weiterentwickelt werden kann, wenn sie von möglichst vielen Menschen verstanden, akzeptiert und unterstützt wird. Kulturelle Kompetenz Kultur wahrnehmen, gestalten und reflektieren Die Schülerinnen und Schüler erkennen in künstlerischen, technischen, wissenschaftlichen und mentalen Zeugnissen menschlicher Zivilisationen deren Kultur und verstehen, dass diese Orientierungen für das Fühlen und Handeln von Menschen waren und sind. Die Schülerinnen und Schüler können eigene Ansprüche in der Auseinandersetzung mit vergangener und gegenwärtiger Kultur sowie mit Kulturen anderer Länder und Regionen einordnen. Sie sind in der Lage, eigene kulturbezogene Standpunkte und ästhetische Vorstellungen zu entwickeln und sich in bewusster Übereinstimmung oder Abgrenzung zu fremden oder vertrauten kulturellen Systemen auszudrücken. Die Schülerinnen und Schüler nehmen Jugend- und Alltagskultur wahr, achten kulturelle Errungenschaften der Vergangenheit und Gegenwart sowie die kulturelle Vielfalt, die die Menschheit hervorgebracht hat. Sie nutzen Chancen zur Teilnahme und Teilhabe an kulturellen Prozessen. Mathematische Kompetenz Sachverhalte mit mathematischen Mitteln wahrnehmen und verstehen Die Schülerinnen und Schüler nutzen mathematisches Denken und Darstellen, um Erscheinungen aus Natur, Gesellschaft, Kultur und Arbeitswelt in einer spezifischen Weise wahrzunehmen und verstehen zu können. Sie sind in der Lage, mathematische Strukturen in Problemen zu erkennen und geeignete mathematische Denkarten (logisches und räumliches Denken) bzw. Darstellungen (z. B. Formeln, Modelle, Konstruktionen, Kurven, Tabellen) anzuwenden. Dabei berücksichtigen sie Möglichkeiten und Grenzen mathematischer Konzepte und Modelle. Die Schülerinnen und Schüler wenden heuristische Strategien, Prinzipien und Hilfsmittel an, um alltägliche Problemstellungen unterschiedlicher Komplexität bearbeiten zu können. Sie gebrauchen mathematische Hilfsmittel und Werkzeuge sachgerecht. 12
15 Naturwissenschaftlichtechnische Kompetenz Phänomene und Sachverhalte in Natur und Technik beschreiben und erklären Die Schülerinnen und Schüler beobachten, beschreiben, erkennen und erklären naturwissenschaftliche Phänomene, ziehen begründete Schlussfolgerungen aus gewonnenen Erkenntnissen und prüfen die Evidenz naturwissenschaftlicher Daten. Sie berücksichtigen dabei Wechselwirkungen zwischen naturwissenschaftlichem Denken und Arbeiten sowie technischen Entwicklungen. Naturwissenschaftliche und technische Verfahren wie Planen, Beobachten, Messen, Konstruieren, Experimentieren, Arbeit mit Modellen, Simulieren, Herstellen, Bewerten, Verwenden und Entsorgen führen die Schülerinnen und Schüler selbst aus und interpretieren die gewonnenen Ergebnisse. Sie wenden naturwissenschaftliches und technisches Wissen verantwortungsbewusst auf Sachverhalte des persönlichen und sozialen Lebens an. Die Schülerinnen und Schüler erkennen Strukturen und Funktionen technischer Systeme und Prozesse. Sie erklären Zusammenhänge von Bedingungen und Folgen technischer Entwicklungen, insbesondere die Auswirkungen auf die Gesellschaft, auf die natürliche Umwelt und auf sich selbst. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln ein Bewusstsein für ethische Fragen sowie für Sicherheits- und Nachhaltigkeitsaspekte. Sie positionieren sich zu aktuellen naturwissenschaftlichen und technischen Entwicklungen, erkennen ihre Mitverantwortung und nehmen diese wahr. Wirtschaftliche Kompetenz In wirtschaftlichen Zusammenhängen eigenverantwortlich handeln Die Schülerinnen und Schüler analysieren und beurteilen wirtschaftliche Abläufe auf privater, volkswirtschaftlicher und weltwirtschaftlicher Ebene angemessen. Sie verstehen Wechselwirkungen zwischen Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, treffen sachgerechte Entscheidungen und sind in der Lage, in diesem Sinne verantwortungsvoll zu handeln. Das Verständnis der Struktur einer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung ermöglicht ihnen die Einordnung der eigenen Rolle und die der anderen Akteure in den Wirtschaftskreislauf und deren Bewertung auch mit Blick auf nachhaltiges Wirtschaften und ethische Verantwortung. 13
16 3.3 Kompetenzorientierte Unterrichtsgestaltung Grundlagen Die Lehrkräfte knüpfen an die Interessen und Voraussetzungen der einzelnen Schülerinnen und Schüler an und gewährleisten eine Erziehung und Bildung, die zur Persönlichkeitsentwicklung beiträgt. Sie berücksichtigen die Heterogenität ihrer Lerngruppen und richten ihre fachlichen und didaktisch-methodischen Entscheidungen danach aus. Kompetenzorientierter Unterricht schafft Freiräume für individuelle Lernwege und zur Mitgestaltung von Unterricht durch die Schülerinnen und Schüler. Sie lernen es, Ideen in die Tat umzusetzen. Dies erfordert Kreativität, Innovation und Risikobereitschaft sowie die Fähigkeit, Lernprozesse zu planen und durchzuführen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Fachspezifische Arbeits- und Betrachtungsweisen werden durch fächerverbindendes und fächerübergreifendes Herangehen ergänzt und bereichert. Neben der Einordnung in die fachliche Systematik findet auch die Entwicklung der Kompetenzen unter Anwendung des Wissens in verschiedenen Situationen und lebenspraktischen Zusammenhängen Beachtung. Über die Fächergrenzen hinaus werden die Schülerinnen und Schüler zu komplexem Denken und Handeln befähigt. Merkmale Im Kern geht es dabei um eine Lernkultur mit folgenden Merkmalen 4 : Entwickeln und Anwenden eines flexibel verfügbaren Wissens, Fördern sinnstiftenden Lernens, indem neue Zusammenhänge erschlossen und Lerngegenstände gewählt werden, die für die Lernenden von Bedeutung sind, Fördern und Fordern eigener Lernaktivitäten der Schülerinnen und Schüler innerhalb kognitiv herausfordernder Prozesse, Entwickeln einer positiven Einstellung zu den Lerninhalten, indem die Freude der Schülerinnen und Schüler am Lernen, ihre Anstrengungsbereitschaft und die Entwicklung von Interessen gezielt gefördert werden, Abstimmen von Lernangeboten auf die individuellen kognitiven Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler, Vermitteln von Lernstrategien und Fähigkeiten zum selbstregulierten Lernen, Fördern von Selbstvertrauen durch Lernarrangements, in denen die 4 Vgl. Konzeption KMK zur Nutzung der Bildungsstandards, S
17 Schülerinnen und Schüler ein hohes Maß an Erfolg erleben können, Vermitteln von Werteorientierungen sowie Aufbau und Fördern sozialer Kompetenzen. 3.4 Kompetenzorientierte Leistungsbewertung Anspruch Die Leistungsbewertung umfasst die Leistungsfeststellung und die Leistungsbeurteilung. Ihr Ziel ist die Ermittlung des Standes der Kompetenzentwicklung und der Lernfortschritte von Schülerinnen und Schülern auf der Grundlage der Anforderungen des Lehrplanes. Bei der Feststellung und Bewertung des Standes der Kompetenzentwicklung werden die Qualität von Ergebnissen, die Arbeitsprozesse sowie die Präsentation der Arbeitsergebnisse berücksichtigt. Das gilt auch für das fachbezogene sowie für das fächerübergreifende Entwickeln von Schlüsselkompetenzen. Kompetenzorientierte Leistungsbewertung setzt eine anspruchsvolle und problemorientierte Aufgabenkultur voraus. Verfahren Leistungsbewertungen beziehen sich auf die Ermittlung des Standes der Kompetenzentwicklung, auf verfügbare Wissensbestände bzw. auf das zu einem bestimmten Zeitpunkt erreichte Können. Klausuren, Tests und mündliche Überprüfungen werden durch Portfolios, Lerntagebücher, Unterrichtsdokumentationen, Präsentationen oder Ergebnisse praktischer und projektbezogener Tätigkeiten ergänzt. Leistungen einschätzen zu können, ist ein wichtiges Bildungsziel für die Schülerinnen und Schüler. Deshalb werden sie in zunehmendem Maße in das Verfahren der Leistungsbewertung einbezogen. 15
18 4 Fach- und schulformübergreifende Empfehlungen und Beschlüsse zur schulischen Bildung und Erziehung KMK (Hrsg.): KMK (Hrsg.): KMK (Hrsg.): KMK (Hrsg.): KMK (Hrsg.): KMK (Hrsg.): KMK und Deutsche UNESCO- Kommission (Hrsg.): Europäisches Parlament und Europäischer Rat: Empfehlung zur Gesundheitsförderung und Prävention in der Schule (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom ) Empfehlung zur Mobilitäts- und Verkehrserziehung in der Schule (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom i. d. F. vom ) Medienbildung in der Schule (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 8. März 2012) Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zur Stärkung der Fremdsprachenkompetenz (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom ) Empfehlung der Kultusministerkonferenz zur Stärkung der mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Bildung (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom ) Stärkung der Demokratieerziehung (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom ) Empfehlung zur Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Schule vom Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zu Schlüsselkompetenzen für lebensbegleitendes Lernen. In: Amtsblatt der Europäischen Union vom
(Termine, Daten, Inhalte)
 IV. Dokumentationsbögen / Planungsbögen (I VII) für die Referendarinnen und Referendare hinsichtlich des Erwerbs der geforderten und im Verlauf ihrer Ausbildung am Marie-Curie-Gymnasium Die Referendarinnen
IV. Dokumentationsbögen / Planungsbögen (I VII) für die Referendarinnen und Referendare hinsichtlich des Erwerbs der geforderten und im Verlauf ihrer Ausbildung am Marie-Curie-Gymnasium Die Referendarinnen
Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule
 Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule Kompetenzbereiche: Sach-, Methoden-, Urteils-, Handlungskompetenz Synopse aller Kompetenzerwartungen Sachkompetenz
Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule Kompetenzbereiche: Sach-, Methoden-, Urteils-, Handlungskompetenz Synopse aller Kompetenzerwartungen Sachkompetenz
Gemeinschafts- und Wirtschaftskunde. Schuljahr 1
 Gemeinschafts- und Wirtschaftskunde 1 Berufsfachschule Berufseinstiegsjahr Gemeinschafts- und Wirtschaftskunde Schuljahr 1 2 Gemeinschafts- und Wirtschaftskunde Vorbemerkungen Ziel des Unterrichts in Gemeinschafts-
Gemeinschafts- und Wirtschaftskunde 1 Berufsfachschule Berufseinstiegsjahr Gemeinschafts- und Wirtschaftskunde Schuljahr 1 2 Gemeinschafts- und Wirtschaftskunde Vorbemerkungen Ziel des Unterrichts in Gemeinschafts-
Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung in den Fächern der Gesellschaftslehre (Geschichte, Erdkunde, Politik) an der RS Hohenhameln
 Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung in den Fächern der Gesellschaftslehre (Geschichte, Erdkunde, Politik) an der RS Hohenhameln 1. Schulrechtliche Vorgaben A Niedersächsisches Schulgesetz in der
Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung in den Fächern der Gesellschaftslehre (Geschichte, Erdkunde, Politik) an der RS Hohenhameln 1. Schulrechtliche Vorgaben A Niedersächsisches Schulgesetz in der
Konkretisierung der Ausbildungslinien im Fach Spanisch
 Konkretisierung der slinien im Fach Spanisch Stand: September 2012 slinie Entwicklungsstufen der slinien im VD Gym A: Unterricht konzipieren 1 Den Wortschatz und die Grammatik kommunikationsorientiert
Konkretisierung der slinien im Fach Spanisch Stand: September 2012 slinie Entwicklungsstufen der slinien im VD Gym A: Unterricht konzipieren 1 Den Wortschatz und die Grammatik kommunikationsorientiert
Demokratiebildung aus Sicht des Sachunterrichts
 Demokratiebildung aus Sicht des Sachunterrichts Input im Rahmen des thematischen Forums Demokratiebildung eine didaktische Herausforderung Dr. Sandra Tänzer; 27.5.2010 Gliederung 1.Demokratische Kompetenzen
Demokratiebildung aus Sicht des Sachunterrichts Input im Rahmen des thematischen Forums Demokratiebildung eine didaktische Herausforderung Dr. Sandra Tänzer; 27.5.2010 Gliederung 1.Demokratische Kompetenzen
Zaubern im Mathematikunterricht
 Zaubern im Mathematikunterricht 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Die Mathematik als Fachgebiet ist so ernst, dass man keine Gelegenheit versäumen sollte, dieses Fachgebiet unterhaltsamer zu gestalten.
Zaubern im Mathematikunterricht 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Die Mathematik als Fachgebiet ist so ernst, dass man keine Gelegenheit versäumen sollte, dieses Fachgebiet unterhaltsamer zu gestalten.
Lernen lernen. Bestandteil der neuen sächsischen Lehrpläne
 Lernen lernen Bestandteil der neuen sächsischen Lehrpläne Leitbild Schulentwicklung Die Wissensgesellschaft verlangt neben inhaltlichen Wissensgrundlagen die Fähigkeiten sein Wissen zu erweitern zu lebensbegleitendem
Lernen lernen Bestandteil der neuen sächsischen Lehrpläne Leitbild Schulentwicklung Die Wissensgesellschaft verlangt neben inhaltlichen Wissensgrundlagen die Fähigkeiten sein Wissen zu erweitern zu lebensbegleitendem
Empfehlung der Kultusministerkonferenz zur Förderung der Menschenrechtserziehung in der Schule
 Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland xms325sw-00.doc Empfehlung der Kultusministerkonferenz zur Förderung der Menschenrechtserziehung in der
Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland xms325sw-00.doc Empfehlung der Kultusministerkonferenz zur Förderung der Menschenrechtserziehung in der
Vorwort. Wir verfolgen das Ziel die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen zu fördern.
 Vorwort Wir verfolgen das Ziel die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen zu fördern. Mit dieser Zielsetzung vor Augen haben wir Führungskräfte der gpe uns Führungsleitlinien gegeben. Sie basieren
Vorwort Wir verfolgen das Ziel die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen zu fördern. Mit dieser Zielsetzung vor Augen haben wir Führungskräfte der gpe uns Führungsleitlinien gegeben. Sie basieren
Fachanforderungen Kunst Sek I und Sek II. Schleswig-Holstein. Der echte Norden.
 Fachanforderungen Kunst Sek I und Sek II Schleswig-Holstein. Der echte Norden. Themen der Präsentation Zur Struktur der Fachanforderungen Bildbegriff Arbeitsfelder Kompetenzbereiche Dimensionen Aufbau
Fachanforderungen Kunst Sek I und Sek II Schleswig-Holstein. Der echte Norden. Themen der Präsentation Zur Struktur der Fachanforderungen Bildbegriff Arbeitsfelder Kompetenzbereiche Dimensionen Aufbau
Potsdam ; Dr. Ursula Behr (ThILLM) Sprachenübergreifendes Lehren und Lernen und die Weiterentwicklung des Sprachenunterrichts
 Potsdam 18.09.2015; Dr. Ursula Behr (ThILLM) Sprachenübergreifendes Lehren und Lernen und die Weiterentwicklung des Sprachenunterrichts Begründungszusammenhänge sprachenpolitisch spracherwerbstheoretisch
Potsdam 18.09.2015; Dr. Ursula Behr (ThILLM) Sprachenübergreifendes Lehren und Lernen und die Weiterentwicklung des Sprachenunterrichts Begründungszusammenhänge sprachenpolitisch spracherwerbstheoretisch
Blick über den Zaun' - Unser Leitbild einer guten Schule
 Blick über den Zaun' - Unser Leitbild einer guten Schule Den Einzelnen gerecht werden individuelle Förderung und Herausforderung 1. Schulen haben die Aufgabe, die Heranwachsenden mit den Grundlagen unserer
Blick über den Zaun' - Unser Leitbild einer guten Schule Den Einzelnen gerecht werden individuelle Förderung und Herausforderung 1. Schulen haben die Aufgabe, die Heranwachsenden mit den Grundlagen unserer
Lehrplan Sekundarschule
 Lehrplan Sekundarschule Kompetenzentwicklung und Unterrichtsqualität Grundsatzband An der Erstellung des Grundsatzbandes Kompetenzentwicklung und Unterrichtsqualität haben als Mitglieder der Koordinierungsgruppe
Lehrplan Sekundarschule Kompetenzentwicklung und Unterrichtsqualität Grundsatzband An der Erstellung des Grundsatzbandes Kompetenzentwicklung und Unterrichtsqualität haben als Mitglieder der Koordinierungsgruppe
5 6 7 8 9 EF Q1 Q2 Seite 1. Vorwort. Sekundarstufe I
 Vorwort Die Fachkonferenz Politik/Wirtschaft bzw. Sozialwissenschaften hat auf ihre Sitzung am 26. Mai 2011 ein neues Hauscurriculum für die Sekundarstufe I sowie für die Sekundarstufe II beschlossen.
Vorwort Die Fachkonferenz Politik/Wirtschaft bzw. Sozialwissenschaften hat auf ihre Sitzung am 26. Mai 2011 ein neues Hauscurriculum für die Sekundarstufe I sowie für die Sekundarstufe II beschlossen.
KOMPETENZORIENTIERTE LEHRPLÄNE FÜR DAS BERUFLICHE GYMNASIUM
 KOMPETENZORIENTIERTE LEHRPLÄNE FÜR DAS BERUFLICHE GYMNASIUM Pädagogisches Landesinstitut Bad Kreuznach 24. und 31. Mai 2011 Folie 1 GLIEDERUNG Vorgaben für die Lehrplanarbeit Leitlinien des Bildungsganges
KOMPETENZORIENTIERTE LEHRPLÄNE FÜR DAS BERUFLICHE GYMNASIUM Pädagogisches Landesinstitut Bad Kreuznach 24. und 31. Mai 2011 Folie 1 GLIEDERUNG Vorgaben für die Lehrplanarbeit Leitlinien des Bildungsganges
Umwelterziehung Umweltbildung Umweltpädagogik Nachhaltigkeitsbildung
 Umwelterziehung Umweltbildung Umweltpädagogik Nachhaltigkeitsbildung Umwelt... ist all das, was einen Menschen umgibt und in seinem Verhalten beeinflusst (natürliche Umwelt, gebaute Umwelt, soziale Umwelt)
Umwelterziehung Umweltbildung Umweltpädagogik Nachhaltigkeitsbildung Umwelt... ist all das, was einen Menschen umgibt und in seinem Verhalten beeinflusst (natürliche Umwelt, gebaute Umwelt, soziale Umwelt)
Schlüsselkompetenzen der Erzieherin (entnommen aus der Ausbildungskonzeption der Fachakademie für Sozialpädagogik Aschaffenburg)
 Schlüsselkompetenzen der Erzieherin (entnommen aus der Ausbildungskonzeption der Fachakademie für Sozialpädagogik Aschaffenburg) Mit den im Folgenden angeführten Schlüsselkompetenzen sollen die fachlichen
Schlüsselkompetenzen der Erzieherin (entnommen aus der Ausbildungskonzeption der Fachakademie für Sozialpädagogik Aschaffenburg) Mit den im Folgenden angeführten Schlüsselkompetenzen sollen die fachlichen
Manifest. für eine. Muslimische Akademie in Deutschland
 Manifest für eine Muslimische Akademie in Deutschland 1. Ausgangssituation In der Bundesrepublik Deutschland gibt es ein breit gefächertes, differenziertes Netz von Institutionen der Erwachsenen- und Jugendbildung,
Manifest für eine Muslimische Akademie in Deutschland 1. Ausgangssituation In der Bundesrepublik Deutschland gibt es ein breit gefächertes, differenziertes Netz von Institutionen der Erwachsenen- und Jugendbildung,
Studien und Berufswahlvorbereitung
 Studien und Berufswahlvorbereitung Leitbild Die Schillerschule bietet ihren Schülerinnen und Schülern eine verlässliche Umgebung für den Erwerb fundierten Fachwissens, für die Entfaltung von Kreativität
Studien und Berufswahlvorbereitung Leitbild Die Schillerschule bietet ihren Schülerinnen und Schülern eine verlässliche Umgebung für den Erwerb fundierten Fachwissens, für die Entfaltung von Kreativität
3) Evangelischer Religionsunterricht in der Sek.II
 3) Evangelischer Religionsunterricht in der Sek.II Evangelischer Religionsunterricht erschließt die religiöse Dimension der Wirklichkeit und des Lebens und trägt damit zur religiösen Bildung der Schüler/innen
3) Evangelischer Religionsunterricht in der Sek.II Evangelischer Religionsunterricht erschließt die religiöse Dimension der Wirklichkeit und des Lebens und trägt damit zur religiösen Bildung der Schüler/innen
15 Kompetenzbereiche und Inhalte der Ausbildung
 ZALS: 15 Kompetenzbereiche und Inhalte der Ausbildung 15 Kompetenzbereiche und Inhalte der Ausbildung (1) 1 Die Ausbildung im Vorbereitungsdienst umfasst Bereiche der Pädagogik, der Sonderpädagogik und
ZALS: 15 Kompetenzbereiche und Inhalte der Ausbildung 15 Kompetenzbereiche und Inhalte der Ausbildung (1) 1 Die Ausbildung im Vorbereitungsdienst umfasst Bereiche der Pädagogik, der Sonderpädagogik und
Semester: Kürzel Titel CP SWS Form P/WP Turnus Sem. A Politikwissenschaft und Forschungsmethoden 4 2 S P WS 1.
 Politikwissenschaft, Staat und Forschungsmethoden BAS-1Pol-FW-1 CP: 10 Arbeitsaufwand: 300 Std. 1.-2. - kennen die Gliederung der Politikwissenschaft sowie ihre Erkenntnisinteressen und zentralen theoretischen
Politikwissenschaft, Staat und Forschungsmethoden BAS-1Pol-FW-1 CP: 10 Arbeitsaufwand: 300 Std. 1.-2. - kennen die Gliederung der Politikwissenschaft sowie ihre Erkenntnisinteressen und zentralen theoretischen
Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Einführungsphase. Unterrichtsvorhaben: Der Mensch in christlicher Perspektive
 Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Einführungsphase Unterrichtsvorhaben: Der Mensch in christlicher Perspektive Inhaltliche Schwerpunkte Der Mensch als Geschöpf und Ebenbild Gottes (Was
Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Einführungsphase Unterrichtsvorhaben: Der Mensch in christlicher Perspektive Inhaltliche Schwerpunkte Der Mensch als Geschöpf und Ebenbild Gottes (Was
Empfehlung zur Mobilitäts- und Verkehrserziehung in der Schule. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom i. d. F. vom
 Empfehlung zur Mobilitäts- und Verkehrserziehung in der Schule Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.07.1972 i. d. F. vom 10.05.2012 Vorbemerkung Mobilitäts- und Verkehrserziehung ist eine übergreifende
Empfehlung zur Mobilitäts- und Verkehrserziehung in der Schule Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.07.1972 i. d. F. vom 10.05.2012 Vorbemerkung Mobilitäts- und Verkehrserziehung ist eine übergreifende
Prüfungen im Fach Biologie im Schuljahr 2013/14
 Prüfungen im Fach Biologie im Schuljahr 2013/14 (1) Grundlagen Qualifizierender Hauptschulabschluss Realschulabschluss Abitur Externenprüfungen (2) Anforderungen an Prüfungsaufgaben (3) Bewertung Zusammenstellung
Prüfungen im Fach Biologie im Schuljahr 2013/14 (1) Grundlagen Qualifizierender Hauptschulabschluss Realschulabschluss Abitur Externenprüfungen (2) Anforderungen an Prüfungsaufgaben (3) Bewertung Zusammenstellung
Kompetenzorientiertes Lernen in heterogenen Lerngruppen
 Fortbildungsoffensive Fachtagung des Arbeitskreises Ausbildungsstätten für Altenpflege Kompetenzorientiertes Lernen in heterogenen Lerngruppen Problemstellung Heterogene Lerngruppe Zentrale Standards "typische"
Fortbildungsoffensive Fachtagung des Arbeitskreises Ausbildungsstätten für Altenpflege Kompetenzorientiertes Lernen in heterogenen Lerngruppen Problemstellung Heterogene Lerngruppe Zentrale Standards "typische"
Zentralabitur 2019 Chinesisch
 Zentralabitur 2019 Chinesisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten schriftlichen
Zentralabitur 2019 Chinesisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten schriftlichen
Ein Qualitätsmanagement im Dienste der Schul- und Unterrichtsentwicklung
 Ein Qualitätsmanagement im Dienste der Schul- und Unterrichtsentwicklung n haben jahrelang Reformen ihrer Strukturen und der Führung bewältigt. Nun kann das Kerngeschäft Guter Unterricht ins Zentrum der
Ein Qualitätsmanagement im Dienste der Schul- und Unterrichtsentwicklung n haben jahrelang Reformen ihrer Strukturen und der Führung bewältigt. Nun kann das Kerngeschäft Guter Unterricht ins Zentrum der
Leistungs- und Bewertungskonzept. im Fach Informatik
 Leistungs- und Bewertungskonzept im Fach Informatik Nach Beschluss der Fachkonferenz Informatik vom 14.06.2011 wird das folgende fachspezifische Leistungs- und Leistungsbewertungskonzept ab dem Schuljahr
Leistungs- und Bewertungskonzept im Fach Informatik Nach Beschluss der Fachkonferenz Informatik vom 14.06.2011 wird das folgende fachspezifische Leistungs- und Leistungsbewertungskonzept ab dem Schuljahr
Zentralabitur 2019 Russisch
 Zentralabitur 2019 Russisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten schriftlichen
Zentralabitur 2019 Russisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten schriftlichen
Netzwerkplenum Bremen 22. / 23. Oktober. Studium als wissenschaftliche Berufsausbildung
 Netzwerkplenum Bremen 22. / 23. Oktober Studium als wissenschaftliche Berufsausbildung Gliederung Die Umstellung auf die neuen Abschlüsse hat in der Vielzahl der Fälle nicht zu einer Verbesserung von Studium
Netzwerkplenum Bremen 22. / 23. Oktober Studium als wissenschaftliche Berufsausbildung Gliederung Die Umstellung auf die neuen Abschlüsse hat in der Vielzahl der Fälle nicht zu einer Verbesserung von Studium
Leistungsbewertung. Dietrich Bonhoeffer Gymnasium Bergisch Gladbach
 Leistungsbewertung Dietrich Bonhoeffer Gymnasium Bergisch Gladbach Beurteilungsbereich Sonstige Leistungen (Sonstige Leistungen umfassen die Qualität und Quantität der Beiträge, die Schülerinnen und Schüler
Leistungsbewertung Dietrich Bonhoeffer Gymnasium Bergisch Gladbach Beurteilungsbereich Sonstige Leistungen (Sonstige Leistungen umfassen die Qualität und Quantität der Beiträge, die Schülerinnen und Schüler
Realgymnasium Schlanders
 Realgymnasium Schlanders Fachcurriculum aus Geschichte Klasse: 5. Klasse RG und SG Lehrer: Christof Anstein für die Fachgruppe Geschichte/ Philosophie Schuljahr 2013/2014 1/5 Lernziele/Methodisch-didaktische
Realgymnasium Schlanders Fachcurriculum aus Geschichte Klasse: 5. Klasse RG und SG Lehrer: Christof Anstein für die Fachgruppe Geschichte/ Philosophie Schuljahr 2013/2014 1/5 Lernziele/Methodisch-didaktische
Ein Teil der Eltern und der Lehrpersonen bemängelt Klima an Schule
 Wertschätzende Gemeinschaft Die Lehrpersonen stärken die Gemeinschaft mit stufenübergreifenden Anlässen und einer erfolgreich eingeführten Schülerpartizipation. Die Kinder fühlen sich wohl an der Schule.
Wertschätzende Gemeinschaft Die Lehrpersonen stärken die Gemeinschaft mit stufenübergreifenden Anlässen und einer erfolgreich eingeführten Schülerpartizipation. Die Kinder fühlen sich wohl an der Schule.
Grundätze zur Leistungsbewertung im Fach Mathematik
 Grundätze zur Leistungsbewertung im Fach Mathematik Die von der Fachkonferenz Mathematik getroffenen Vereinbarungen bzgl. der Leistungsbewertung basieren auf den in 48 des Schulgesetzes und in 6 der APO
Grundätze zur Leistungsbewertung im Fach Mathematik Die von der Fachkonferenz Mathematik getroffenen Vereinbarungen bzgl. der Leistungsbewertung basieren auf den in 48 des Schulgesetzes und in 6 der APO
Berufsbildungszentrum Bau und Gewerbe
 Berufsbildungszentrum Bau und Gewerbe Inhalt Vorwort 3 Zweck des Leitbildes 4 Bildungsauftrag 5 Unterricht 6 Schulmanagement 7 Professionalität der Lehrperson 8 Schulkultur 9 Aussenbeziehungen 10 Vom Leitbild
Berufsbildungszentrum Bau und Gewerbe Inhalt Vorwort 3 Zweck des Leitbildes 4 Bildungsauftrag 5 Unterricht 6 Schulmanagement 7 Professionalität der Lehrperson 8 Schulkultur 9 Aussenbeziehungen 10 Vom Leitbild
Bildungsplan 2016: Die Leitperspektive BTV. Bildungsplan Die Leitperspektive Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt (BTV)
 Bildungsplan 2016 Die Leitperspektive Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt (BTV) Gliederung Vorbemerkung: Die doppelte Funktion eines Bildungsplans 1. Wofür eigentlich Leitperspektiven? 2. Die
Bildungsplan 2016 Die Leitperspektive Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt (BTV) Gliederung Vorbemerkung: Die doppelte Funktion eines Bildungsplans 1. Wofür eigentlich Leitperspektiven? 2. Die
Schriftliche Befragung: Häufigkeitsverteilungen. Lehrpersonen Primar- und Kindergartenstufe. Lebenswelt Schule
 Fachstelle für Schulbeurteilung Schriftliche Befragung: Häufigkeitsverteilungen Datenbasis: Alle Volksschulen des Kantons, Stand Juni 2016 Lehrpersonen Primar- und Kindergartenstufe Anzahl Lehrpersonen,
Fachstelle für Schulbeurteilung Schriftliche Befragung: Häufigkeitsverteilungen Datenbasis: Alle Volksschulen des Kantons, Stand Juni 2016 Lehrpersonen Primar- und Kindergartenstufe Anzahl Lehrpersonen,
Zentralabitur 2019 Portugiesisch
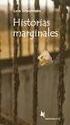 Zentralabitur 2019 Portugiesisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten
Zentralabitur 2019 Portugiesisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten
Leitbildarbeit im Rahmen der schulischen Qualitätssicherung und -entwicklung
 Leitbildarbeit im Rahmen der schulischen Qualitätssicherung und -entwicklung Informationsbaustein im Rahmen der Informationsveranstaltung zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung Referat 77 Qualitätssicherung
Leitbildarbeit im Rahmen der schulischen Qualitätssicherung und -entwicklung Informationsbaustein im Rahmen der Informationsveranstaltung zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung Referat 77 Qualitätssicherung
Wir danken folgenden Institutionen für die finanzielle Unterstützung bei der Drucklegung dieser Unterrichtsmaterialien:
 Sponsoren Wir danken folgenden Institutionen für die finanzielle Unterstützung bei der Drucklegung dieser Unterrichtsmaterialien: BO-Koordination Tirol 8. Schulstufe 1 BERUFSORIENTIERUNG ein Grundbedürfnis
Sponsoren Wir danken folgenden Institutionen für die finanzielle Unterstützung bei der Drucklegung dieser Unterrichtsmaterialien: BO-Koordination Tirol 8. Schulstufe 1 BERUFSORIENTIERUNG ein Grundbedürfnis
Hinweise zur Vorbereitung auf die Abiturprüfung 2013 Prüfungsschwerpunkte Englisch. Grundkurs
 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung Hinweise zur Vorbereitung auf die Abiturprüfung 2013 Grundkurs Die angegebenen Schwerpunkte sind im Zusammenhang
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung Hinweise zur Vorbereitung auf die Abiturprüfung 2013 Grundkurs Die angegebenen Schwerpunkte sind im Zusammenhang
Methodenkonzept der Christian-Maar-Schule
 Methodenkonzept der Christian-Maar-Schule Inhalt 1. Vorbemerkungen... 3 2. Zielsetzung... 3 3. Methodenvermittlung im Unterricht... 4 3.1. Lern- und Arbeitstechniken... 4 3.1.1. Ausgestaltung des Arbeitsplatzes...
Methodenkonzept der Christian-Maar-Schule Inhalt 1. Vorbemerkungen... 3 2. Zielsetzung... 3 3. Methodenvermittlung im Unterricht... 4 3.1. Lern- und Arbeitstechniken... 4 3.1.1. Ausgestaltung des Arbeitsplatzes...
Schulprogramm der Grundschule Kremperheide
 Schulprogramm der Grundschule Kremperheide Gib den Kindern Wurzeln, damit sie Geborgenheit und Sicherheit haben. Gib ihnen Flügel, damit sie Selbstvertrauen und Fantasie entwickeln. - 2 - Inhaltsverzeichnis
Schulprogramm der Grundschule Kremperheide Gib den Kindern Wurzeln, damit sie Geborgenheit und Sicherheit haben. Gib ihnen Flügel, damit sie Selbstvertrauen und Fantasie entwickeln. - 2 - Inhaltsverzeichnis
GutsMuths-Grundschule
 Bericht zur Inspektion der GutsMuths-Grundschule 6 Qualitätsbereiche und 19 Qualitätsmerkmale guter Schule auf der Grundlage des Handlungsrahmens Schulqualität in Berlin 1 Ergebnisse der Schule 1.1 Schulleistungsdaten
Bericht zur Inspektion der GutsMuths-Grundschule 6 Qualitätsbereiche und 19 Qualitätsmerkmale guter Schule auf der Grundlage des Handlungsrahmens Schulqualität in Berlin 1 Ergebnisse der Schule 1.1 Schulleistungsdaten
Schulinterner Lehrplan Evangelische Religionslehre am Clara-Schumann-Gymnasium Holzwickede Qualifikationsphase (Q 1)
 Schulinterner Lehrplan Evangelische Religionslehre am Clara-Schumann-Gymnasium Holzwickede Qualifikationsphase (Q 1) Qualifikationsphase (Q1) GRUNDKURS Halbjahresthema 1.Hj.: Als Mensch Orientierung suchen
Schulinterner Lehrplan Evangelische Religionslehre am Clara-Schumann-Gymnasium Holzwickede Qualifikationsphase (Q 1) Qualifikationsphase (Q1) GRUNDKURS Halbjahresthema 1.Hj.: Als Mensch Orientierung suchen
1. Fachspezifische Standards
 1. Fachspezifische Standards Die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst... 1. kennt die wichtigsten musikdidaktischen Konzeptionen und kann Prinzipien daraus begründet für die eigene Planung nutzen. 2. gestaltet
1. Fachspezifische Standards Die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst... 1. kennt die wichtigsten musikdidaktischen Konzeptionen und kann Prinzipien daraus begründet für die eigene Planung nutzen. 2. gestaltet
Bildungsthemen der Kinder: Entwicklungspsychologische Grundlagen
 Kinder: Entwicklungspsychologische Abteilung Entwicklungs- und Pädagogische Psychologie / 1 Gliederung des Vortrags Der Ausgangspunkt: ein neues Bildungsprogramm Was ist eigentlich Bildung? Was hat Bildung
Kinder: Entwicklungspsychologische Abteilung Entwicklungs- und Pädagogische Psychologie / 1 Gliederung des Vortrags Der Ausgangspunkt: ein neues Bildungsprogramm Was ist eigentlich Bildung? Was hat Bildung
Berufliche Schulen des Landes Hessen
 Berufliche Schulen des Landes Hessen Lehrplan Fachoberschule Stand: 03.04.2006 Impressum: Herausgeber: Hessisches Kultusministerium Luisenplatz 10, 65185 Wiesbaden Lehrpläne für Berufliche Schulen Fachoberschule
Berufliche Schulen des Landes Hessen Lehrplan Fachoberschule Stand: 03.04.2006 Impressum: Herausgeber: Hessisches Kultusministerium Luisenplatz 10, 65185 Wiesbaden Lehrpläne für Berufliche Schulen Fachoberschule
Univ.-Prof. Dr. Gerhard Zimmer. Hamburg, September 2010
 Qualitätskriterien i für Helmut-Schmidt-Universität, i ität Universität ität der Bundeswehr Hamburg Hamburg, September 2010 Qualitätsbegriff Produktqualität = realisierte Beschaffenheit eines Produkts
Qualitätskriterien i für Helmut-Schmidt-Universität, i ität Universität ität der Bundeswehr Hamburg Hamburg, September 2010 Qualitätsbegriff Produktqualität = realisierte Beschaffenheit eines Produkts
Teilbarkeitsbetrachtungen in den unteren Klassenstufen - Umsetzung mit dem Abakus
 Naturwissenschaft Melanie Teege Teilbarkeitsbetrachtungen in den unteren Klassenstufen - Umsetzung mit dem Abakus Examensarbeit Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis... 2 1 Einleitung... 3 2 Anliegen
Naturwissenschaft Melanie Teege Teilbarkeitsbetrachtungen in den unteren Klassenstufen - Umsetzung mit dem Abakus Examensarbeit Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis... 2 1 Einleitung... 3 2 Anliegen
Handlungsfelder schulischer Prävention: die Leitperspektive Prävention und Gesundheitsförderung
 Handlungsfelder schulischer Prävention: die Leitperspektive Prävention und Gesundheitsförderung Kongress zur Bildungsplanreform 2016 Liane Hartkopf KM, Referat 56 Prävention und Schulpsychologische Dienste
Handlungsfelder schulischer Prävention: die Leitperspektive Prävention und Gesundheitsförderung Kongress zur Bildungsplanreform 2016 Liane Hartkopf KM, Referat 56 Prävention und Schulpsychologische Dienste
Herzlich Willkommen. 15. März zum INFO-Abend für alle Eltern der neuen Klassen 6 der Sekundarschule in Alt-Arnsberg 4/14/2016 1
 Herzlich Willkommen zum INFO-Abend für alle Eltern der neuen Klassen 6 der Sekundarschule 15. März 2016 4/14/2016 1 INFO-BLOCK 1 Allgemeine Informationen zum Wahlpflichtunterricht Vorstellung der einzelnen
Herzlich Willkommen zum INFO-Abend für alle Eltern der neuen Klassen 6 der Sekundarschule 15. März 2016 4/14/2016 1 INFO-BLOCK 1 Allgemeine Informationen zum Wahlpflichtunterricht Vorstellung der einzelnen
Lernen am außerschulischen Lernort
 Thementisch Außerschulische Lernorte als Vermittler schulischer Inhalte? Möglichkeiten, Mehrwert und Grenzen Dirk Stute Arbeitsstelle Kulturelle Bildung in Schule und Jugendarbeit NRW Tel.: 02191 / 794
Thementisch Außerschulische Lernorte als Vermittler schulischer Inhalte? Möglichkeiten, Mehrwert und Grenzen Dirk Stute Arbeitsstelle Kulturelle Bildung in Schule und Jugendarbeit NRW Tel.: 02191 / 794
KINDER FORSCHEN LERNEN MIT STUFENGERECHTEN EXPERIMENTEN
 KINDER FORSCHEN LERNEN MIT STUFENGERECHTEN EXPERIMENTEN Innovationstag SWiSE 29. März 2014 Judith Egloff, PH Zürich Ablauf des Ateliers Kurze Vorstellungsrunde Einstiegsreferat Ausprobieren, sichten, diskutieren
KINDER FORSCHEN LERNEN MIT STUFENGERECHTEN EXPERIMENTEN Innovationstag SWiSE 29. März 2014 Judith Egloff, PH Zürich Ablauf des Ateliers Kurze Vorstellungsrunde Einstiegsreferat Ausprobieren, sichten, diskutieren
Gesetzestext (Vorschlag für die Verankerung eines Artikels in der Bundesverfassung)
 Gesetzestext (Vorschlag für die Verankerung eines Artikels in der Bundesverfassung) Recht auf Bildung Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. Bildung soll auf die volle Entfaltung der Persönlichkeit, der
Gesetzestext (Vorschlag für die Verankerung eines Artikels in der Bundesverfassung) Recht auf Bildung Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. Bildung soll auf die volle Entfaltung der Persönlichkeit, der
2. Klassenarbeiten Im Fach Biologie werden in der Sekundarstufe I keine Klassenarbeiten geschrieben.
 1. Einleitung und Vorgaben durch Kernlehrpläne Die im allgemeinen Leistungskonzept aufgeführten Formen der sonstigen Mitarbeit gelten auch für das Fach Biologie. Dabei werden sowohl die Ausprägung als
1. Einleitung und Vorgaben durch Kernlehrpläne Die im allgemeinen Leistungskonzept aufgeführten Formen der sonstigen Mitarbeit gelten auch für das Fach Biologie. Dabei werden sowohl die Ausprägung als
Elterninformation Wahlpflicht-Wahl in Klasse 6. gem. Beschluss der Schulkonferenz vom
 Herzlich willkommen Elterninformation Wahlpflicht-Wahl in Klasse 6 gem. Beschluss der Schulkonferenz vom 19.04.2015 Gymnasiale Oberstufe Wahlpflichtmodell Gesamtschule Gronau Lt. Schulkonferenz vom 19.04.2015:
Herzlich willkommen Elterninformation Wahlpflicht-Wahl in Klasse 6 gem. Beschluss der Schulkonferenz vom 19.04.2015 Gymnasiale Oberstufe Wahlpflichtmodell Gesamtschule Gronau Lt. Schulkonferenz vom 19.04.2015:
Wie weiter ab Klasse 7?
 Wie weiter ab Klasse 7? Der Übergang der Schülerinnen und Schüler in weiterführende Bildungsgänge in Mecklenburg-Vorpommern Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur IMPRESSUM Herausgeber: Ministerium
Wie weiter ab Klasse 7? Der Übergang der Schülerinnen und Schüler in weiterführende Bildungsgänge in Mecklenburg-Vorpommern Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur IMPRESSUM Herausgeber: Ministerium
Politik/Wirtschaft Jahrgangsstufen 7-9
 Politik/Wirtschaft Jahrgangsstufen 7-9 Vorbemerkung: Die Entscheidung, an welchen Inhalten welche Kompetenzen entwickelt werden, liegt genauso wie die Auswahl von problemorientierten Erschließungsfragen
Politik/Wirtschaft Jahrgangsstufen 7-9 Vorbemerkung: Die Entscheidung, an welchen Inhalten welche Kompetenzen entwickelt werden, liegt genauso wie die Auswahl von problemorientierten Erschließungsfragen
Fragebogen für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I / II
 Fragebogen für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I / II Wie sehr stimmst du den folgenden Aussagen über deine Schule zu? 1 Ich fühle mich in unserer Schule wohl. 2 An unserer Schule gibt es klare
Fragebogen für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I / II Wie sehr stimmst du den folgenden Aussagen über deine Schule zu? 1 Ich fühle mich in unserer Schule wohl. 2 An unserer Schule gibt es klare
LehrplanPLUS Mittelschule Englisch Klasse 5. Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick. 1. Aufbau des Lehrplans
 Mittelschule Englisch Klasse 5 Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick Der Englischunterricht an der Mittelschule ist wie schon bisher - kommunikativ ausgerichtet. Die grundlegenden Voraussetzungen
Mittelschule Englisch Klasse 5 Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick Der Englischunterricht an der Mittelschule ist wie schon bisher - kommunikativ ausgerichtet. Die grundlegenden Voraussetzungen
Englisch. Berufskolleg Gesundheit und Pflege I. Schuljahr 1. Landesinstitut für Erziehung und Unterricht Abteilung III
 Berufskolleg Gesundheit und Pflege I Schuljahr 1 2 Vorbemerkungen Die immer enger werdende Zusammenarbeit der Staaten innerhalb und außerhalb der Europäischen Union verlangt in Beruf und Alltag in zunehmendem
Berufskolleg Gesundheit und Pflege I Schuljahr 1 2 Vorbemerkungen Die immer enger werdende Zusammenarbeit der Staaten innerhalb und außerhalb der Europäischen Union verlangt in Beruf und Alltag in zunehmendem
Impressum. Erarbeitet durch die Projektgruppe Leitbild und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes Rastatt
 Impressum Herausgeber Landratsamt Rastatt Am Schlossplatz 5 76437 Rastatt Telefon: 07222/381-0 Telefax: 07222/381-1398 E-Mail: post@landkreis-rastatt.de http://www.landkreis-rastatt.de Erarbeitet durch
Impressum Herausgeber Landratsamt Rastatt Am Schlossplatz 5 76437 Rastatt Telefon: 07222/381-0 Telefax: 07222/381-1398 E-Mail: post@landkreis-rastatt.de http://www.landkreis-rastatt.de Erarbeitet durch
Wasser ist wertvoll Individuelle Seiten für ein Portfolio. Heimat- und Sachunterricht / Deutsch. Portfolio Wasser, Papier
 Portfolio Das Instrument des Portfolios wird als eine gute Möglichkeit bewertet, verschiedene Aufträge der Flexiblen Grundschule zu vereinen: Die Schülerinnen und Schüler lernen individuell, aber im Rahmen
Portfolio Das Instrument des Portfolios wird als eine gute Möglichkeit bewertet, verschiedene Aufträge der Flexiblen Grundschule zu vereinen: Die Schülerinnen und Schüler lernen individuell, aber im Rahmen
Zum Einsatz des Berufswahlpasses
 Zum Einsatz des Berufswahlpasses Was ist eigentlich der Berufswahlpass? Schülerinnen und Schüler brauchen Strategien und Instrumente, die sie bei der Bewältigung der Herausforderungen des Berufswahlprozesses
Zum Einsatz des Berufswahlpasses Was ist eigentlich der Berufswahlpass? Schülerinnen und Schüler brauchen Strategien und Instrumente, die sie bei der Bewältigung der Herausforderungen des Berufswahlprozesses
Schulcurriculum G8 - Oberstufe Fach: Erziehungswissenschaft Stand 2/2013
 Schulcurriculum G8 - Oberstufe Fach: Erziehungswissenschaft Stand 2/2013 JG EF1 Inhalte des Hauscurriculums (auf der Grundlage des Lehrplans) Kursthema: Erziehungssituationen und Erziehungsprozesse Das
Schulcurriculum G8 - Oberstufe Fach: Erziehungswissenschaft Stand 2/2013 JG EF1 Inhalte des Hauscurriculums (auf der Grundlage des Lehrplans) Kursthema: Erziehungssituationen und Erziehungsprozesse Das
Schultypen der Sekundarstufe I und Anforderungsprofile für den Übertritt
 Die Sekundarschule vermittelt den Schülerinnen und Schülern eine niveauspezifische Ausbildung, die ihnen den Eintritt in eine berufliche Grundbildung oder in eine weiterführende Schule ermöglicht. Sie
Die Sekundarschule vermittelt den Schülerinnen und Schülern eine niveauspezifische Ausbildung, die ihnen den Eintritt in eine berufliche Grundbildung oder in eine weiterführende Schule ermöglicht. Sie
Studienverlaufsplan Lehramt Bildungswissenschaften Haupt-, Real- und Gesamtschule
 Studienverlaufsplan Lehramt Bildungswissenschaften Haupt-, Real- und Gesamtschule Sem BA-Modul A CP BA-Modul B CP BA-Modul C CP BA-Modul D BA-Modul E CP BA-Modul F CP MA-Modul A CP MA-Modul B C Modul D
Studienverlaufsplan Lehramt Bildungswissenschaften Haupt-, Real- und Gesamtschule Sem BA-Modul A CP BA-Modul B CP BA-Modul C CP BA-Modul D BA-Modul E CP BA-Modul F CP MA-Modul A CP MA-Modul B C Modul D
Lernen mit Portfolio Chancen und Grenzen
 Lernen mit Portfolio Chancen und Grenzen Prof. Dr. Tina Hascher, Fachbereich Erziehungswissenschaft "eportfolio im:focus - Erwartungen, Strategien, Modellfälle, Erfahrungen, 09. Mai 2007 Gliederung 1.
Lernen mit Portfolio Chancen und Grenzen Prof. Dr. Tina Hascher, Fachbereich Erziehungswissenschaft "eportfolio im:focus - Erwartungen, Strategien, Modellfälle, Erfahrungen, 09. Mai 2007 Gliederung 1.
Wert -volle Partizipation für Kinder in der Demokratie Elisabeth Nowak
 Wert -volle Partizipation für Kinder in der Demokratie Elisabeth Nowak Workshop zur Fachtagung des Dt. Kinderschutzbundes LV Bayern vom 8. bis9.05.2010 Kinderrechte sind Menschenrechte Kinderrechte nach
Wert -volle Partizipation für Kinder in der Demokratie Elisabeth Nowak Workshop zur Fachtagung des Dt. Kinderschutzbundes LV Bayern vom 8. bis9.05.2010 Kinderrechte sind Menschenrechte Kinderrechte nach
Übersichtsraster: Unterrichtsvorhaben Praktische Philosophie, Jgst. 9
 Übersichtsraster: Unterrichtsvorhaben Praktische Philosophie, Jgst. 9 Halbjahr Thema des Unterrichtsvorhabens Fragenkreis 1 Entscheidung und Gewissen 3: Die Frage nach dem guten Handeln Völkergemeinschaft
Übersichtsraster: Unterrichtsvorhaben Praktische Philosophie, Jgst. 9 Halbjahr Thema des Unterrichtsvorhabens Fragenkreis 1 Entscheidung und Gewissen 3: Die Frage nach dem guten Handeln Völkergemeinschaft
Leistungskonzept für das Fach Spanisch
 Leistungskonzept für das Fach Spanisch als neueinsetzende Fremdsprache in der Oberstufe (GK) Leistungsanforderungen und Leistungsbewertung 1. Grundlagen für die Leistungsbewertung 1.1 Grundsätzliche Bezugsrahmen
Leistungskonzept für das Fach Spanisch als neueinsetzende Fremdsprache in der Oberstufe (GK) Leistungsanforderungen und Leistungsbewertung 1. Grundlagen für die Leistungsbewertung 1.1 Grundsätzliche Bezugsrahmen
Basismodul G 1: Gute Aufgaben... 13
 Einleitung... 11 Basismodul G 1: Gute Aufgaben... 13 Gerd Walther Die Entwicklung allgemeiner mathematischer Kompetenzen fördern... 15 Traditionelle Aufgabenstellung kontra Gute Aufgabe... 15 Bildungsstandards
Einleitung... 11 Basismodul G 1: Gute Aufgaben... 13 Gerd Walther Die Entwicklung allgemeiner mathematischer Kompetenzen fördern... 15 Traditionelle Aufgabenstellung kontra Gute Aufgabe... 15 Bildungsstandards
Allgemeine Lehrplanbezüge Hauptschule ERSTER TEIL ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL
 Allgemeine Lehrplanbezüge Hauptschule In diesem Dokument sind die Bezüge zum Thema Berufsorientierung grau hervorgehoben. ERSTER TEIL ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL 1. Funktion und Gliederung des Lehrplans Der
Allgemeine Lehrplanbezüge Hauptschule In diesem Dokument sind die Bezüge zum Thema Berufsorientierung grau hervorgehoben. ERSTER TEIL ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL 1. Funktion und Gliederung des Lehrplans Der
AWO pro:mensch. Kinder betreuen. Familien beraten.
 AWO pro:mensch. Kinder betreuen. Familien beraten. Unsere Kindertagesstätten. Profil l Konzept l Leitbild Spielen. Lernen. Leben. Was ein Kind in seinen ersten Lebensjahren lernt, ist von großer Bedeutung
AWO pro:mensch. Kinder betreuen. Familien beraten. Unsere Kindertagesstätten. Profil l Konzept l Leitbild Spielen. Lernen. Leben. Was ein Kind in seinen ersten Lebensjahren lernt, ist von großer Bedeutung
Gymnasium der Stadt Frechen FK Spanisch
 Gymnasium der Stadt Frechen FK Spanisch Vereinbarungen zur Leistungsbewertung Die Vereinbarungen zur Leistungsbewertung für das Fach Spanisch als neu einsetzende Fremdsprache beruhen auf den Vorgaben der
Gymnasium der Stadt Frechen FK Spanisch Vereinbarungen zur Leistungsbewertung Die Vereinbarungen zur Leistungsbewertung für das Fach Spanisch als neu einsetzende Fremdsprache beruhen auf den Vorgaben der
Zum Referendariat am LIS
 LIS 1. Ziele der Ausbildung Die Ziele der Ausbildung werden durch das Bremische Lehrerausbildungsgesetz (BLAG) und die Ausbildungs- und Prüfungsordnung bestimmt. Ziel der Ausbildung ist die Befähigung
LIS 1. Ziele der Ausbildung Die Ziele der Ausbildung werden durch das Bremische Lehrerausbildungsgesetz (BLAG) und die Ausbildungs- und Prüfungsordnung bestimmt. Ziel der Ausbildung ist die Befähigung
ÜBERSICHT. Lernarrangements zur Förderung demokratischer Handlungskompetenz
 ÜBERSICHT Lernarrangements zur Förderung demokratischer Handlungskompetenz (Stand: 14.12.2006) Entwickelt im Rahmen des Konzepts demokratischer Handlungskompetenz nach: Arbeitsgemeinschaft Qualität & Kompetenzen
ÜBERSICHT Lernarrangements zur Förderung demokratischer Handlungskompetenz (Stand: 14.12.2006) Entwickelt im Rahmen des Konzepts demokratischer Handlungskompetenz nach: Arbeitsgemeinschaft Qualität & Kompetenzen
Chance und Herausforderung.
 Chance und Herausforderung www.ursula-guenster.de www.ursula-guenster.de Was ist jetzt für die Einrichtung wichtig? Wo besteht Handlungsbedarf? Worauf lege ich in dieser Situation wert? Höre ich aufmerksam
Chance und Herausforderung www.ursula-guenster.de www.ursula-guenster.de Was ist jetzt für die Einrichtung wichtig? Wo besteht Handlungsbedarf? Worauf lege ich in dieser Situation wert? Höre ich aufmerksam
Leitbild. des Jobcenters Dortmund
 Leitbild des Jobcenters Dortmund 2 Inhalt Präambel Unsere Kunden Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Unser Jobcenter Unsere Führungskräfte Unser Leitbild Unser Jobcenter Präambel 03 Die gemeinsame
Leitbild des Jobcenters Dortmund 2 Inhalt Präambel Unsere Kunden Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Unser Jobcenter Unsere Führungskräfte Unser Leitbild Unser Jobcenter Präambel 03 Die gemeinsame
JAHRGANGSSTUFE 7 LEHRPLANBEZUG. Thematischer Schwerpunkt
 JAHRGANGSSTUFE 7 Philosophieren anfangen 1, 5, 6 Methodenschwerpunkt Die Gefühle und der Verstand 1 Gefühl und Verstand Fremden begegnen 1, 2, 6 Glückserfahrungen machen zwischen Schein und Sein 4, 6,
JAHRGANGSSTUFE 7 Philosophieren anfangen 1, 5, 6 Methodenschwerpunkt Die Gefühle und der Verstand 1 Gefühl und Verstand Fremden begegnen 1, 2, 6 Glückserfahrungen machen zwischen Schein und Sein 4, 6,
Ethik- Lehrplan Gymnasium
 Ethik- Lehrplan Gymnasium Zur Kompetenzentwicklung im Ethikunterricht 1 Beim Urteilen ist der Mensch als Einzelner immer unvollkommen. (Aristoteles) Kernstück des Ethikunterrichts ist die gemeinsame Reflexion,
Ethik- Lehrplan Gymnasium Zur Kompetenzentwicklung im Ethikunterricht 1 Beim Urteilen ist der Mensch als Einzelner immer unvollkommen. (Aristoteles) Kernstück des Ethikunterrichts ist die gemeinsame Reflexion,
Verwaltungsvorschrift über die Arbeit in der Kooperativen und in der Integrierten Gesamtschule
 Verwaltungsvorschrift über die Arbeit in der Kooperativen und in der Integrierten Gesamtschule Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Vom 2. Juni 2014 Nach 17 und 18
Verwaltungsvorschrift über die Arbeit in der Kooperativen und in der Integrierten Gesamtschule Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Vom 2. Juni 2014 Nach 17 und 18
Katrin Macha Berlin. Bildung und Gesundheit Berliner Bildungsprogramm
 Katrin Macha 13.1.15 Berlin Bildung und Gesundheit Berliner Bildungsprogramm System der Qualitätsentwicklung in Berlin Grundlage QVTAG Externe Evaluation Konzeptionsentwicklung Interne Evaluation 2 Bildungsverständnis
Katrin Macha 13.1.15 Berlin Bildung und Gesundheit Berliner Bildungsprogramm System der Qualitätsentwicklung in Berlin Grundlage QVTAG Externe Evaluation Konzeptionsentwicklung Interne Evaluation 2 Bildungsverständnis
Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung Düsseldorf Seminar HRGE Evangelische Religionslehre. 1. Quartal
 Evangelische Religionslehre 1. Quartal Thema: Auf dem Weg zum/zur reflektiert unterrichtenden Lehrer/Lehrerin Fachbezogene Leitidee: - Mein Selbstverständnis als Religionslehrer/in? - Wie motiviere ich
Evangelische Religionslehre 1. Quartal Thema: Auf dem Weg zum/zur reflektiert unterrichtenden Lehrer/Lehrerin Fachbezogene Leitidee: - Mein Selbstverständnis als Religionslehrer/in? - Wie motiviere ich
Departement für Erziehung und Kultur Lehrplan Volksschule Thurgau
 Departement für Erziehung und Kultur Lehrplan Volksschule Thurgau Informationen für Eltern Liebe Eltern Die Volksschule vermittelt Ihrem Kind Wissen und Können, das es für sein späteres Leben benötigt.
Departement für Erziehung und Kultur Lehrplan Volksschule Thurgau Informationen für Eltern Liebe Eltern Die Volksschule vermittelt Ihrem Kind Wissen und Können, das es für sein späteres Leben benötigt.
Externe Evaluation Schule Schlierbach
 Externe Evaluation Schule Schlierbach Oktober 2015 Externe Schulevaluation Die externe Schulevaluation stellt in den teilautonomen Schulen im Kanton Luzern eine vergleichbar gute Schul- und Unterrichtsqualität
Externe Evaluation Schule Schlierbach Oktober 2015 Externe Schulevaluation Die externe Schulevaluation stellt in den teilautonomen Schulen im Kanton Luzern eine vergleichbar gute Schul- und Unterrichtsqualität
Kompetenzerweiternde Unterrichtsplanung der Europäischen Volksschule
 Kompetenzerweiternde Unterrichtsplanung der Europäischen Volksschule Schlüsselkompetenzen Kompetenzen sind definiert als eine Kombination aus Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen, die an das jeweilige
Kompetenzerweiternde Unterrichtsplanung der Europäischen Volksschule Schlüsselkompetenzen Kompetenzen sind definiert als eine Kombination aus Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen, die an das jeweilige
Schulinterner Lehrplan im Fach Evangelische Religionslehre zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe
 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben: Qualifikationsphase 1 Schulinterner Lehrplan im Fach Evangelische Religionslehre zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe Qualifikationsphase (Q1) GRUNDKURS Halbjahresthema
Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben: Qualifikationsphase 1 Schulinterner Lehrplan im Fach Evangelische Religionslehre zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe Qualifikationsphase (Q1) GRUNDKURS Halbjahresthema
Seminar: Unterrichtsentwicklung Prof. Dr. Petra Buchwald SS Referat Bildungsstandards. Mario Del Regno Frauke Flesch Katharina Gührs
 Seminar: Unterrichtsentwicklung Prof. Dr. Petra Buchwald SS 2008 Referat 29.04.2008 Bildungsstandards Mario Del Regno Frauke Flesch Katharina Gührs Inhalt 1. Drei Phasen der Schulentwicklung 2. Bildungsstandards
Seminar: Unterrichtsentwicklung Prof. Dr. Petra Buchwald SS 2008 Referat 29.04.2008 Bildungsstandards Mario Del Regno Frauke Flesch Katharina Gührs Inhalt 1. Drei Phasen der Schulentwicklung 2. Bildungsstandards
Pädagogik als Nebenfach im Diplomstudiengang Informatik. Man könnte kurz auch sagen: Pädagogik befasst sich damit, wie man Menschen etwas beibringt.
 Universität Stuttgart Abteilung für Pädagogik Prof. Dr. Martin Fromm Dillmannstr. 15, D-70193 Stuttgart Pädagogik als Nebenfach im Diplomstudiengang Informatik Was ist Pädagogik? Pädagogen befassen sich
Universität Stuttgart Abteilung für Pädagogik Prof. Dr. Martin Fromm Dillmannstr. 15, D-70193 Stuttgart Pädagogik als Nebenfach im Diplomstudiengang Informatik Was ist Pädagogik? Pädagogen befassen sich
Die Botschaft Jesu in seiner Zeit und Umwelt (IF 4) Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler
 Unterrichtsvorhaben A: Jesus als Jude in seiner Zeit Die Botschaft Jesu in seiner Zeit und Umwelt (IF 4) unterscheiden Religionen und Konfessionen im Hinblick auf grundlegende Merkmale. finden selbstständig
Unterrichtsvorhaben A: Jesus als Jude in seiner Zeit Die Botschaft Jesu in seiner Zeit und Umwelt (IF 4) unterscheiden Religionen und Konfessionen im Hinblick auf grundlegende Merkmale. finden selbstständig
Schulinternes Curriculum Philosophie Gymnasium Schloss Holte-Stukenbrock
 Schulinternes Curriculum Philosophie Gymnasium Schloss Holte-Stukenbrock EF Unterrichtsvorhaben Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und
Schulinternes Curriculum Philosophie Gymnasium Schloss Holte-Stukenbrock EF Unterrichtsvorhaben Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und
Entwicklungszusammenarbeit mit Schwellenländern strategisch neu ausrichten
 Entwicklungszusammenarbeit mit Schwellenländern strategisch neu ausrichten Beschluss des CDU-Bundesfachausschusses Entwicklungszusammenarbeit und Menschenrechte unter der Leitung von Arnold Vaatz MdB,
Entwicklungszusammenarbeit mit Schwellenländern strategisch neu ausrichten Beschluss des CDU-Bundesfachausschusses Entwicklungszusammenarbeit und Menschenrechte unter der Leitung von Arnold Vaatz MdB,
KOOPERATIVE LERNFORMEN
 KOOPERATIVE LERNFORMEN Warum Lernen glücklich macht Bertelsmann Stiftung 2008 NETZWERKTREFFEN IM NÜRNBERGER LAND AM 16.7.2015 CAROLA KANNE, JAMINA DREXL UND TEAM DER GS AM LICHTENSTEIN MEETING POINT: EINSATZMÖGLICHKEITEN
KOOPERATIVE LERNFORMEN Warum Lernen glücklich macht Bertelsmann Stiftung 2008 NETZWERKTREFFEN IM NÜRNBERGER LAND AM 16.7.2015 CAROLA KANNE, JAMINA DREXL UND TEAM DER GS AM LICHTENSTEIN MEETING POINT: EINSATZMÖGLICHKEITEN
Prof. Dr. Peter Paulus Institut für Psychologie Universität Lüneburg Prävention und Gesundheitsförderung im Kontext von Schule
 Prof. Dr. Peter Paulus Institut für Psychologie Universität Lüneburg Prävention und Gesundheitsförderung im Kontext von Schule Symposium Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche 15.
Prof. Dr. Peter Paulus Institut für Psychologie Universität Lüneburg Prävention und Gesundheitsförderung im Kontext von Schule Symposium Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche 15.
Kapitel 2, Führungskräftetraining, Kompetenzentwicklung und Coaching:
 Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? von Tanja Hollinger 1. Auflage Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? Hollinger schnell und portofrei
Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? von Tanja Hollinger 1. Auflage Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? Hollinger schnell und portofrei
Personalbeurteilung (1): Aufgaben und Ziele
 Personalbeurteilung (1): Aufgaben und Ziele Mit der Personalbeurteilung wird die individuelle Leistung bewertet ( Stellenbewertung = Arbeitsplatzbewertung) Aufgaben: MA zeigen, wie die leistungsmäßige
Personalbeurteilung (1): Aufgaben und Ziele Mit der Personalbeurteilung wird die individuelle Leistung bewertet ( Stellenbewertung = Arbeitsplatzbewertung) Aufgaben: MA zeigen, wie die leistungsmäßige
