Erfassung der Wanzenfauna ausgewählter Standorte im Stadtgebiet von Schwelm Endbericht der Untersuchungen in den Jahren 2008 und 2009
|
|
|
- Cornelia Hartmann
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Erfassung der Wanzenfauna ausgewählter Standorte im Stadtgebiet von Schwelm Endbericht der Untersuchungen in den Jahren 2008 und 2009 Büro für Biologische Umwelt-Gutachten Schäfer
2 Erstellt von Büro für Biologische Umwelt-Gutachten Schäfer Stettiner Weg Telgte Festnetz: Im Auftrag von Wilhelm Erfurt-Stiftung für Kultur und Natur Hugo-Erfurt-Straße Wuppertal Telgte, den 2. November 2012
3 Inhaltsverzeichnis Tabellenverzeichnis... I Abbildungsverzeichnis... I 1 Anlass und Aufgabenstellung Methode Ergebnisse Diskussion Arten Wanzengemeinschaften der Teilgebiete Tannenbaum Brambecke Krähenberg Friedhof Oehde Literatur Tabellenverzeichnis Tabelle 1: Bezeichnung und Beschreibung der Bodenfallenstandorte in den Jahren 2008 und Tabelle 2: Nachgewiesene Wanzenarten in den Jahren 2006 bis Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Lage der untersuchten Teilgebiete (maßstabslos)... 1 Abbildung 2: Prozentuale Verteilung der in Schwelm nachgewiesenen Wanzenarten auf die Familien... 4 Abbildung 3: Bisherige Nachweise von Macrolophus rubri in Nordrhein-Westfalen (grün) und neuer Fundort in Schwelm (rot)... 8 Abbildung 4: Fundort (Brombeerbestand) der Weichwanze Macrolophus rubri im Teilgebiet Tannenbaum ( ; Blickrichtung NO)... 9 I
4 Abbildung 5: Fundort (Heckensaum, mit Wasserdost) der Bodenwanze Scolopostethus puberulus und der Sichelwanze Nabis brevis im Teilgebiet Tannenbaum ( ; Blickrichtung NNO)... 9 Abbildung 6: Adulte Gitterwanze Stephanitis takeyai mit leerer Larvenhülle (rechts) auf der Unterseite eines Rhododendronblattes (die dunklen Flecken sind Kottröpfchen) Abbildung 7: Durch Stephanitis takeyai stark geschädige Lavendelheide im Teilgebiet Friedhof Oehde Abbildung 8: Wärmebegünstiges Schlehen-Hundsrosen-Gebüsch im Teilgebiet Tannenbaum als Lebensraum von Deraeocoris flavilinea ( ; Blickrichtung NW) Abbildung 9: Unterschiedlich alte Larven der Randwanze Goncerus acuteangulatus auf den Früchten einer Kartoffelrose Abbildung 10: Ginsterbestände am Rand der abgeschobenen Fläche, im Hintergrund der Wall ( ; Blickrichtung NW) Abbildung 11: Rand der Obstwiese mit ungemähtem Saum ( ; Blickrichtung NW) Abbildung 12: Südlicher Abschnitt der Brambecke mit dem hier relativ breiten Talraum und kleinflächig besonnten Böschungen ( ; Blickrichtung NO) Abbildung 13: Stauteich im Weberstal; Lebensraum des Wasserläufers Gerris gibbifer ( ; Blickrichtung O) Abbildung 14: Erle im oberen Weberstal mit Vorkommen der Weichwanze Pantilius tunicatus und der Bodenwanze Oxycarenus modestus ( ; Blickrichtung N) Abbildung 15: Brache in einem Quellbereich westlich der L 527; Lebensraum von z. B. Acompus rufipes, Ischnodema sabuleti und Cymus aurescens ( ; Blickrichtung W) Abbildung 16: Die Stelzenwanze Metatropis rufescens lebt nur auf Hexenkraut und ist im Brambecketal und auf dem Krähenberg nachgewiesen worden Abbildung 17: Auf einer Brache im Brambecketal konnte die v. a. an Rohrglanzgras saugende Bodenwanze Ischnodema sabuleti (im Bild erwachsene Tiere und die rötlich gefärbten Larven) gefunden werden Abbildung 18: Eingang zum Naturdenkmal Erlenhöhle am Krähenberg; in der Krautschicht im Vordergrund lebt u. a. Metatropis rufescens ( ; Blickrichtung O) Abbildung 19: Friedhof Oehde ( ; Blickrichtung W) II
5 1 Anlass und Aufgabenstellung Wanzen sind eine kaum beachtete Insektenordnung, dabei aber nicht weniger interessant als populäre Gruppen wie z. B. Käfer oder Schmetterlinge. Die geringe Attraktivität liegt sicherlich in ihrem schlechten Image begründet, denn den Inbegriff einer Wanze stellt für viele Menschen die unscheinbare blutsaugende Bettwanze dar, die wenig berechtigt mit Gestank und Unrat verbunden wird. Unter den mehr als 600 in Nordrhein-Westfalen vorkommenden Wanzenarten gibt es aber auch viele große und auffallend bunte Tiere. Ihre teilweise skurrilen Formen machen es dem Laien oft nicht leicht, sie als Wanzen anzusprechen, und so werden viele unwissentlich anderen Insektengruppen zugeordnet. Die meisten Arten ernähren sich auch nicht von Blut, sondern von Pflanzensäften (ACHTZIGER et al. 2007). Dabei existieren häufig starke Abhängigkeiten von bestimmen Pflanzengruppen oder sogar einzelnen Pflanzenarten, was in einigen deutschen Namen zum Ausdruck kommt (z. B. Platanen-Gitterwanze, Hexenkraut-Stelzenwanze). Insgesamt stellen die Wanzen eine aus bioindikatorischer Sicht stark unterschätzte Tiergruppe dar, die sich aufgrund der häufig vorhandenen Nahrungs- und Lebensraumspezialisierung, der Artenvielfalt sowie der Präsenz in jedem terrestrischen und aquatischen Lebensraum hervorragend für naturschutzfachliche und ökologische Fragestellungen eignen (vgl. ACHTZIGER et al. 2007). Für die Ermittlung der Artendiversität eines Raumes stellt daher die Untersuchung der Wanzenfauna einen wichtigen Beitrag dar. Dankenswerterweise wurde das Büro für Biologische Umweltgutachten Schäfer (B.U.G.S.) von der Wilhelm Erfurt-Stiftung für Kultur und Natur beauftragt, 2008 und 2009 auf dem Gebiet der Stadt Schwelm in ausgewählten Lebensräumen eine entsprechende Erfassung von Wanzen durchzuführen. Untersucht wurden die Teilgebiete Biotopverbund Tannenbaum, Brambecketal, Kalkbuchenwald Krähenberg und Friedhof Oehde, deren Lage aus Abbildung 1 hervorgeht. Abbildung 1: Lage der untersuchten Teilgebiete (maßstabslos) 1
6 2 Methode In den Jahren 2008 und 2009 sind insgesamt zehn Begehungen durchgeführt worden. Das Teilgebiet Tannenbaum wurde an sechs Tagen besucht ( , , , , , ), das Brambecketal an sieben Tagen ( , , , , , , ), der Krähenberg an zwei Tagen ( , ) und der Friedhof Oehde an einem Tag ( ). Dabei wurden mit verschiedenen Methoden möglichst viele unterschiedliche Kleinlebensräume auf ihren Wanzenbestand hin untersucht. Zum Einsatz kamen Streifkescher, Wasserkescher, Klopfschirm, Streusieb sowie bei verschiedenen Strukturen (unter Steinen, auf der Vegetation, unter Rinde, an Ufern etc.) der Handfang. Als weitere Erfassungsmethode sind Bodenfallen eingesetzt worden. Die Auswahl der Fallenstandorte erfolgte am zusammen mit Martin Kreuels (Bearbeiter der Spinnenfauna) in Anwesenheit von Michael Treimer und Andreas Kronshage. Dabei wurden jeweils 1-2 Fallen an jeweils drei Stellen in den Teilgebieten Tannenbaum und Brambecketal gesetzt sind im Teilgebiet Tannenbaum wiederholt alle drei Standorte beprobt worden, im Brambecketal mussten die Standorte aus privatrechtlichen Gründen aufgegeben werden. Als Ersatz wurde eine Fläche westlich der L 527 gewählt, allerdings mit nur einem Fallenstandort. Die Beschreibung und Bezeichnung der Standorte geht aus Tabelle 1 hervor. Tabelle 1: Bezeichnung und Beschreibung der Bodenfallenstandorte in den Jahren 2008 und 2009 Teilgebiet Standortbezeichnung Expositionsjahr Beschreibung Bemerkungen Tannenbaum Ginstersaum Südostexponierter, unbeschatteter Grassaum zwischen Ginsterbüschen am Rand einer abgeschobenen Rohbodenfläche 2008 und 2009 an jeweils drei Terminen vollständiger Ausfall der Falle(n) Tannenbaum Aufgeschobener Wall Südwestexponierter, unbeschatteter Wall aus steinig-lehmigem Substrat mit spärlicher Vegetation aus Gräsern und Hochstauden (Erdmaterial von der abgeschobenen Rohbodenfläche) 2008 keine Beeinträchtigungen, 2009 an drei Terminen vollständiger Ausfall der Falle(n) Tannenbaum Hecke Südostexponierter, bis nachmittags unbeschatteter Saum an einer Hecke mit dichter Vegetation aus Gräsern und Hochstauden (tlw. Mahd) 2008 und 2009 an jeweils einem Termin vollständiger Ausfall der Falle(n) Brambecke Waldsaum 2008 Südostexponierte, teilbeschatteter Waldsaum auf einer Böschung oberhalb eines Forstwegs mit dichter Vegetation aus Gräsern und Hochstauden An vier Terminen vollständiger Ausfall der Falle(n) Brambecke Wall 2008 Westsüdwestexponierte, unbeschattete Böschung eines Walls (ehemaliger Schießwall) mit dichter Vegetation aus Gräsern und Hochstauden An zwei Terminen vollständiger Ausfall der Falle(n) Brambecke Bachufer (östlich L 527) 2008 Bachnaher und sumpfiger Standort mit dichter Vegetation aus Gräsern und Hochstauden An einem Termin vollständiger Ausfall der Falle(n) Brambecke Bachufer (westlich L 527) 2009 Bachnaher und sumpfiger Standort mit dichter Vegetation aus Gräsern und Hochstauden Keine Beeinträchtigungen 2
7 Die insgesamt elf Leerungen umfassen folgende Zeitintervalle: , , , , , , , , , , Die Ursachen für Ausfälle von einer oder allen Fallen eines Standortes waren mechanische Zerstörung (Fahrzeuge, möglicherweise Tiere oder Menschen), unerwartete Fäulnis (z. B. nach starken Regenfällen) oder Verlust aufgrund zwischenzeitlich hoch aufgewachsener oder zusammengefallener Vegetation (z. B. nach Mahd). Die Bestimmungsmerkmale sind bei Wanzen häufig sehr diffizil (z. B. Bestimmung von Körperproportionen durch Messungen, Art der Behaarung, Aufbau von Klauengliedern, Innenstrukturen von Genitalen) und die Tiere sehr klein, so dass sie nur in seltenen Fällen vor Ort bestimmt und wieder freigelassen werden konnten. Der weitaus größte Teil wurde deshalb direkt nach dem Fang getötet und am Arbeitsplatz mit Hilfe eines stark vergrößernden Binokulars bestimmt. Von nahezu allen Arten wurden Belege präpariert, die sich in der Sammlung des Verfassers befinden. Mit berücksichtigt wurden schließlich auch einige Wanzen, die Andreas Kronshage im Oktober 2006 in Tannenbaum gefangen hat und die sich in seiner Sammlung befinden. Die Arten sind mit WAGNER (1961, 1966, 1967) und ergänzender Literatur ( Wasserwanzen : NIESER 1982, JANSSON 1986, SAVAGE 1989; Saldidae: PÉRICART 1990; Tingidae: PÉRICART 1983; Miridae: WAGNER 1971, RIEGER 1985, AUKEMA 2003, AGLYAMZYANOV 2003, WYNINGER 2004; Nabidae: PÉRICART 1987; Lygaeidae: PÉRICART 1998) bestimmt worden. 3
8 3 Ergebnisse B.U.G.S. Büro für Biologische Umwelt-Gutachten Schäfer Die Erfassung der vier Schwelmer Teilgebiete in den Jahren 2008 und 2009 erbrachte den Nachweis von 125 Wanzenarten aus 18 Familien mit zusammen Individuen (Tabelle 2). Die fünf von Andreas Kronshage im Jahr 2006 gefangenen Arten (L. tripustulatus, St. laevigata, H. mirmicoides, S. thomsoni, C. marginatus) konnten aktuell bestätigt werden. 18 der Arten sind in Bodenfallen gefangen worden, davon drei (D. foliacea, M. antennatus, S. puberulus) ausschließlich mit dieser Methode. HOFFMANN et al. (2011) melden aus Nordrhein-Westfalen 608 Wanzenarten; in den Schwelmer Teilgebieten wurde somit bislang rund 21% des nordrhein-westfälischen Artenbestandes nachgewiesen. Überdurchschnittlich vertreten sind vor allem einige artenarme Wasserwanzenfamilien, weil hier der Nachweis schon einer Art 25 und mehr Prozent ausmachen kann. Von den artenreicheren Familien fallen vor allem die Sichelwanzen (Nabidae) mit einer Repräsentanz von über 60% auf. Betrachtet man die Verteilung der in Schwelm nachgewiesenen Arten auf die Familien (Abbildung 2), so überwiegen mit 55% aller Arten die Weichwanzen (Miridae), was deutlich über dem nordrhein-westfälischen Durchschnitt von 39% liegt. Die zweithäufigste Familie der Bodenwanzen (Lygaeidae) ist mit 12% aller Arten schon deutlich seltener, die meisten übrigen Familien haben mit nur ein oder zwei nachgewiesenen Arten einen Anteil von unter 2%. Das artenreichste Teilgebiet mit 84 Wanzenarten ist Tannenbaum, gefolgt vom Brambecketal mit 77 Arten (Tabelle 2). Hier liegt aber wohl nicht wirklich ein Unterschied in der Artendiversität beider Teilgebiete vor; vielmehr weist die Anzahl der Datensätze darauf hin, dass Tannenbaum etwas gründlicher untersucht wurde als das Brambecketal. In den Teilgebieten Krähenberg und vor allem Friedhof Oehde erfolgte die Erfassung deutlich weniger intensiv (z. B. auch ohne Bodenfallen), so dass hier nur zwölf bzw. vier Arten nachgewiesen wurden (vgl. Kapitel 4.2). Abbildung 2: Prozentuale Verteilung der in Schwelm nachgewiesenen Wanzenarten auf die Familien 4
9 Tabelle 2: Nachgewiesene Wanzenarten in den Jahren 2006 bis 2009 Anzahl der Datensätze/Individuen (i. d. R. Adulte) EG- Nr. Art NRW Tannenbaubecketaberg Oehde Bram- Krähen- Friedhof 7 Ranatra linearis (Linnaeus, 1758) ± - 1/ Ilyocoris c. cimicoides (Linnaeus, 1758) ± - 2/ Notonecta g. glauca Linnaeus, 1758 ± - 1/ Notonecta maculata Fabricius, 1794 ± - 1/ Notonecta obliqua Thunberg, 1787 ± - 1/ Hydrometra stagnorum (Linnaeus, 1758) ± - 1/ Gerris gibbifer Schummel, 1832 ± - 1/ Gerris lacustris (Linnaeus, 1758) ± - 3/ Saldula c-album (Fieber, 1859) ± - 1/ Saldula saltatoria (Linnaeus, 1758) ± - 2/ Dictyla humuli (Fabricius, 1794) ± - 2/15* Derephysia f. foliacea (Fallèn, 1807) ± 2/ Stephanitis rhododendri Horváth, (N) /3 149,5 Stephanitis takeyai Drake & Maa, (N) 1/1 1/1-1/ Bryocoris pteridis (Fallèn, 1807) ± - 3/3 3/ Monalocoris filicis (Linnaeus, 1758) ± - 4/13 1/9-175 Dicyphus globulifer (Fallèn, 1829) ± 1/ Dicyphus errans (Wolff, 1804) ± 1/1 1/ Dicyphus pallidus (Herrich-Schaeffer, 1836) ± 1/5* 2/8* 2/3-183 Dicyphus pallicornis (Fieber, 1861) ± - 2/ Macrolophus rubi Woodroffe, / Deraeocoris flavilinea (A. Costa, 1862) + (N) 1/ Deraeocoris ruber (Linnaeus, 1758) ± 1/1 1/ Deraeocoris lutescens (Schilling, 1837) ± 2/ Adelphocoris quadripunctatus (Fabricius, 1794) ± 1/1 3/ Adelphocoris seticornis (Fabricius, 1775) ± 1/ Calocoris affinis (Herrich-Schaeffer, 1835) + 1/1 1/ Closterotomus fulvomaculatus (De Geer, 1773) ± 3/ Closterotomus norwegicus (Gmelin, 1790) ± 2/4 1/ Miris striatus (Linnaeus, 1758) ± 1/ Pantilius tunicatus (Fabricius, 1781) ± - 1/ Phytocoris ulmi (Linnaeus, 1758) ± 2/ Phytocoris intricatus Flor, / Phytocoris longipennis Flor, 1861 ± 1/ Rhabdomiris st. striatellus (Fabricius, 1794) ± 1/ Stenotus binotatus (Fabricius, 1794) ± 2/15 3/ Apolygus lucorum (Meyer-Dür, 1843) ± - 1/ Apolygus spinolae (Meyer-Dür, 1841) ± - 1/ Capsus ater (Linnaeus, 1758) ± 2/4 3/ Charagochilus gyllenhalii (Fallèn, 1807) + - 1/ Liocoris tripustulatus (Fabricius, 1781) ± 3/3 1/1 2/8-268 Lygocoris pabulinus (Linnaeus, 1761) ± 5/31 6/ Lygocoris contaminatus (Fallén, 1807) ± 1/ Lygocoris viridis (Fallén, 1807) ± 1/ Lygus pratensis (Linnaeus, 1758) ± 6/16 1/ Lygus rugulipennis Poppius, 1911 ± 4/ Orthops basalis (A. Costa, 1853) + 4/16 4/ Orthops campestris (Linnaeus, 1758) ± - 3/ Pinalitus cervinus (Herrich-Schaeffer, 1841) ± 1/ Pinalitus rubricatus (Fallèn, 1807) ± - 3/ Polymerus nigrita (Fallèn, 1807) + - 2/ Leptopterna dolabrata (Linnaeus, 1758) ± 2/6 2/ Megaloceroea recticornis (Geoffroy, 1785) ± 3/7 1/ Notostira elongata (Geoffroy, 1785) ± 8/22 2/ Stenodema calcarata (Fallèn, 1807) ± 4/10 1/ Stenodema holsata (Fabricius, 1787) ± - 7/ Stenodema laevigata (Linnaeus, 1758) ± 7/10 7/23 3/ Pachytomella parallela (Meyer-Dür, 1843) + 4/11 1/ Cyllecoris histrionius (Linnaeus, 1767) ± 1/ Dryophilocoris flavoquadrimaculatus (De Geer, 1773) ± 1/ Heterocordylus tibialis (Hahn, 1833) ± 3/4 1/ Heterocordylus tumidicornis (Herrich-Schaeffer, 1835) ± 1/ Malacocoris chlorizans (Panzer, 1794) ± 1/ Mecomma a. ambulans (Fallèn, 1807) ± - 2/ Orthotylus marginalis Reuter, 1883 ± 2/8 1/ Orthotylus a. adenocarpi (Perris, 1857) ± 2/
10 Fortsetzung Tabelle 2 Anzahl der Datensätze/Individuen (i. d. R. Adulte) EG- Art NRW Nr. Tannenbaubecketaberg Oehde Bram- Krähen- Friedhof 382 Orthotylus virescens (Douglas & Scott, 1865) ± 3/5 1/ Amblytylus nasutus (Kirschbaum, 1856) ± 2/33 2/ Asciodema obsoleta (Fieber, 1864) + 2/9 1/ Atractotomus magnicornis (Fallèn, 1807) ± - 3/ Atractotomus mali (Meyer-Dür, 1843) ± 2/ Compsidolon salicellum (Herrich-Schaeffer, 1841) ± 1/ Harpocera thoracica (Fallèn, 1807) ± 1/ Megalocoleus tanaceti (Fallèn, 1807) ± 1/ Oncotylus punctipes Reuter, 1875 ± 1/ Orthonotus rufifrons (Fallèn, 1807) + 1/ Phylus coryli (Linnaeus, 1758) ± 1/ Plagiognathus a. arbustorum (Fabricius, 1794) ± 6/16 7/ Plagiognathus chrysanthemi (Wolff, 1804) ± 1/ Psallus perrisi (Mulsant & Rey, 1852) + 1/ Psallus wagneri Ossiannilsson, / Psallus ambiguus (Fallèn, 1807) ± 2/ Psallus v. varians (Herrich-Schaeffer, 1841) ± 1/ Himacerus major (A. Costa, 1842) ± 1/ Himacerus mirmicoides (O. Costa, 1834) ± 7/8* 1/ Himacerus apterus (Fabricius, 1798) ± 1/1 2/2 1/2-504 Nabis limbatus Dahlbom, 1851 ± 4/5 4/ Nabis flavomarginatus Scholtz, 1847 ± 3/4 1/ Nabis brevis Scholtz, 1847 ± 1/ Nabis p. pseudoferus Remane, 1949 ± 1/1 2/ Nabis rugosus (Linnaeus, 1758) ± 4/8 5/16 3/ Anthocoris confusus Reuter, 1884 ± 1/ Anthocoris nemoralis (Fabricius, 1794) ± 5/ Anthocoris nemorum (Linnaeus, 1761) ± 12/32 7/32 2/4-543 Orius minutus (Linnaeus, 1758) ± - 1/ Xylocoris cursitans (Fallèn, 1807) ± - 1/1 1/7-619 Kleidocerys r. resedae (Panzer, 1797) ± 2/2 3/ Cymus aurescens Distant, 1883 ± - 1/ Ischnodemus sabuleti (Fallén, 1826) ± - 1/ Oxycarenus modestus (Fallén, 1829) ± - 1/ Drymus b. brunneus (R. F. Sahlberg, 1848) ± 4/10 3/4 1/1-650 Drymus ryeii Douglas & Scott, /3 1/1 1/6-651 Drymus sylvaticus (Fabricius, 1775) ± 4/ Gastrodes abietum Bergroth, / Scolopostethus grandis Horváth, / Scolopostethus puberulus Horváth, / Scolopostethus thomsoni Reuter, /30 6/ Megalonotus antennatus (Schilling, 1829) ± 1/ Peritrechus geniculatus (Hahn, 1832) ± - 1/ Acompus rufipes (Wolff, 1804) ± - 1/ Stygnocoris sabulosus (Schilling, 1829) ± 2/2 2/ Berytinus m. minor (Herrich-Schaeffer, 1835) ± 1/ Metatropis rufescens (Herrich-Schaeffer, 1835) ± - 1/1 2/4* Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758) ± /11* 745 Coreus m. marginatus (Linnaeus, 1758) ± 4/8 1/ Gonocerus acuteangulatus (Goeze, 1778) ± 1/1* Stictopleurus abutilon (Rossi, 1790) ± 1/ Eurygaster t. testudinaria (Geoffroy, 1785) ± 1/1 2/ Picromerus bidens (Linnaeus, 1758) ± - 1/ Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758) ± 1/ Palomena prasina (Linnaeus, 1761) ± - 2/ Pentatoma rufipes (Linnaeus, 1758) ± 2/ Eurydema dominulus (Scopoli, 1763) ± - 3/ Elasmostethus interstinctus (Linnaeus, 1758) ± /1 865 Elasmucha g. grisea (Linnaeus, 1758) ± - 1/2 - - Arten Individuen (nur Adulte) Datensätze Die Nomenklatur folgt AUKEMA & RIEGER (1995; 1996; 1999; 2001; 2006) EG-Nr. = Bezeichnung und Systematik der Entomofauna Germanica (HOFFMANN & MELBER 2003) NRW (HOFFMANN et al. 2011): + = Funde nur nach 1950; ± = Funde vor und nach 1950; N = Neozoen * = Auch oder ausschließlich Larvenfunde 6
11 4 Diskussion 4.1 Arten Die Artenanzahl insgesamt, aber auch die in den intensiver untersuchten Teilgebieten Tannenbaum und Brambecketal liegen etwas unter dem, was angesichts der Erfassungsintensität zu erwarten gewesen wäre. So konnten HOFFMANN (1978) und SCHÄFER (2003) in vergleichbaren Untersuchungen von Bachtälern im Süderbergland 111 bzw. 80 Arten nachweisen, während es im Brambecketal nur 77 Arten waren. Auffällig am Schwelmer Artenspektrum und auch nicht zu erklären ist z. B. der geringe Anteil (und auch die Individuenarmut) der Baumwanzen (Pentatomidae), wobei diese Arten aufgrund ihrer Größe mit Sicherheit nicht übersehen worden sind. Andere Familien wie die Rindenwanzen (Aradidae) fehlen ganz, obwohl vor allem im Brambecketal und am Krähenberg gründlich danach gesucht wurde. Plausibel ist die Artenarmut bei den Wasserwanzen. Lediglich im Brambecketal gibt es entsprechende Lebensräume für diese Arten, aber auch hier handelt es sich lediglich um einen Kleinweiher, ein Staugewässer und um die Brambecke selbst. Das Schwelmer Stadtgebiet liegt hauptsächlich in einer Höhenlage von m ü NHN. Das mit 352 m ü NHN höchstgelegene und damit bereits in die submontane Stufe (vgl. WIL- MANNS 1984) hineinragende Teilgebiete ist Tannenbaum. Demgemäß sind hier eine Reihe landesweit charakteristischer Arten des Hügel- und Berglandes, die also im nordrheinwestfälischen Tiefland entweder fehlen oder zumindest deutlich seltener sind, gefunden worden. Es handelt sich dabei um G. gibbifer, S. c-album, M. rubi, C. affinis, St. holsata und S. puberulus. Andere im Bergland verbreitete und stellenweise häufige Arten wie Lygus wagneri Remane, 1955 und Rubiconia intermedia (Wolff, 1811) konnten dagegen nicht nachgewiesen werden (vgl. HOFFMANN & SCHÄFER 2010). Mit den vier Teilgebieten wurde nur ein kleiner Ausschnitt aus der Lebensraumvielfalt im Schwelmer Stadtgebiet berücksichtigt. Wären darüber hinaus z. B. wärmebegünstigte Ruderalflächen und strukturreiche Stillgewässer untersucht worden, hätten ohne weiteres mehr als die insgesamt 125 Arten nachgewiesen werden können. Dabei stellt sich die Frage, mit wie vielen Wanzenarten überhaupt in Schwelm zu rechnen ist. Anhaltspunkte geben die Zusammenstellung aller bekannten Wanzennachweise in Köln durch HOFFMANN (1996) mit 359 Arten sowie die langjährige Erfassung der Wanzen in Hagen und Umgebung durch DREES (2009) mit 334 Arten, was in beiden Fällen über die Hälfte des nordrhein-westfälischen Bestandes ausmacht. Über die Gefährdung einzelner Wanzenarten in Nordrhein-Westfalen lassen sich bislang kaum verlässliche Angaben machen, und so haben HOFFMANN et al. (2011) bewusst nur eine landesweite Checkliste und keine Rote Liste vorgelegt. Die bundesweite Rote Liste von GÜNTHER et al. (1998) ist durch ihr Alter nicht mehr anwendbar, eine aktualisierte Fassung befindet sich in Bearbeitung. Bei den meisten der in den Teilgebieten nachgewiesenen Wanzen handelt es sich wie üblich um in Nordrhein-Westfalen häufige und verbreitete Arten (vgl. Tabelle 2). Neunachweise sind nicht darunter. Es konnten aber Arten gefunden werden, die eher Seltenheiten darstellen oder aus biogeografischen Gründen bemerkenswert sind. Sie werden im Folgenden näher besprochen. 7
12 Macrolophus rubi Diese kleine und zarte, grüne Weichwanze ist in Deutschland nur an wenigen Orten gefunden worden und fehlt in der Osthälfte des Landes ganz (GOSSNER & SCHUSTER 2005). Aus Nordrhein-Westfalen lagen bisher nur Nachweise aus dem Gelpetal in Wuppertal-Elberfeld (HOFFMANN 1978), aus Burscheid-Höfchen (KOLBE & BRUNS 1988, als M. costalis; vgl. GÜN- THER 1989) und vom unteren Lennetal bei Hagen-Hohenlimburg (DREES 2009) vor. Alle Funde stammen aus der Zeit nach Der neue Nachweis aus Schwelm vom Teilgebiet Tannenbaum fügt sich nahtlos in das nordrhein-westfälische Verbreitungsmuster dieser Art ein, wonach Macrolophus rubi bislang ausschließlich im Übergangsbereich zwischen dem westlichen Süderbergland und der Tiefebene gefunden werden konnte (Abbildung 3). Im Teilgebiet Tannenbaum erfolgte der Fund auf einer Brache zwischen dem Zaun am Wasserhochbehälter und der abgeschobenen Fläche (Abbildung 4). Hier konnten am 23. Juni 2008 sechs Weibchen mit dem Streifkescher gefangen werden, die sich vermutlich auf den hier üppig wachsenden Brombeeren (Rubus spec.) aufhielten. Als Nahrungspflanze kommt hauptsächlich die Brombeere und hier die jungen Triebe, Blüten- und Fruchtstände infrage, es wird aber auch über Vorkommen auf Waldziest (Stachys sylvatica) berichtet (WACHMANN et al. 2004; GOSSNER & SCHUSTER 2005). Während GOSSNER & SCHUSTER (2005) nur Funde von schattigen bis halbschattigen Standorten mit feucht-kühlem Mikroklima kennen und keine außerhalb des Waldes bzw. von vollbesonnten Standorten, ist der südöstlich exponierte Fundort im Teilgebiet Tannenbaum doch eher besonnt und relativ trocken. Abbildung 3: Bisherige Nachweise von Macrolophus rubri in Nordrhein- Westfalen (grün) und neuer Fundort in Schwelm (rot) 8
13 Nabis brevis Diese Sichelwanzenart weist einen asiatischen Verbreitungsschwerpunkt auf. In Westeuropa ist sie selten, der Mittelmeerraum bleibt größtenteils unbesiedelt (PÉRICART 1987). Auch in Deutschland zeichnet sich ein kontinentales Verbreitungsmuster ab; so ist sie beispielsweise in Niedersachsen nur in den östlichen Landesteilen häufiger (vgl. MELBER 1999). Aus Nordrhein-Westfalen liegen nur wenige neuere Nachweise vor: Arnsberger Wald (BERNHARDT & GRUNWALD 1993), südliches Bergisches Land (SCHUMACHER 1994), Wahner Heide bei Köln (HOFFMANN 1996), Unterer Niederrhein (HOFFMANN 1999), Wiblingwerde im Märkischen Kreis (DREES 2009). In Schwelm konnte sie im Teilgebiet Tannenbaum nachgewiesen werden. Am gelang hier in einem Saum an der südlichen Gebietsgrenze (Abbildung 5) mit dem Kescher der Fang eines Männchens. N. brevis bewohnt ein breites Spektrum an Offenlandbiotopen, bevorzugt aber Saumbiotope und ist hier zum Beispiel im mittleren Thüringen häufig zu finden (ROTH 1997; 1999). Nach ROTH (1999) halten sich die Tiere bevorzugt in Bodennähe auf und legen hier auch die Eier ab, was eine erfolgreiche Fortpflanzung selbst in extrem trockenen Lebensräumen gewährleistet. Allgemein wird die Art als mesophil eingestuft (PÉRICART 1987; WACHMANN et al. 2006), doch scheint sie im atlantischen Klimaraum eher xerophil oder zumindest thermophil und aus diesem Grund auch nicht häufig zu sein. In den Niederlanden etwa ist N. brevis ein seltener Bewohner trockener und sandiger Lebensräume (AUKEMA & HERMES 2006). Der Fundort im Teilgebiet Tannenbaum zeigt, dass in Nordrhein-Westfalen nicht nur Sandböden besiedelt werden, doch muss es sich vermutlich zumindest um wärmebegünstigte Standorte handeln. Förderlich in diesem Sinne ist hier vermutlich auch die Mahd (vgl. Abbildung 5), zumal sie sich bei dieser Art aufgrund der bodennahen Lebensweise (ROTH 1999) vermutlich nicht negativ auswirkt. Abbildung 4: Fundort (Brombeerbestand) der Weichwanze Macrolophus rubri im Teilgebiet Tannenbaum ( ; Blickrichtung NO) Abbildung 5: Fundort (Heckensaum, mit Wasserdost) der Bodenwanze Scolopostethus puberulus und der Sichelwanze Nabis brevis im Teilgebiet Tannenbaum ( ; Blickrichtung NNO) Scolopostethus puberulus Die zur Familie der Bodenwanzen gehörende Art wurde für Nordrhein-Westfalen das erste Mal aus Hagen-Berchum durch DREES (2001) gemeldet, weitere publizierte Fundorte sind 9
14 Plettenberg (SCHÄFER 2003) und der Arnsberger Wald (GRUNWALD 2012). In Schelm konnte die Art im Teilgebiet Tannenbaum nachgewiesen werden. Hier gelang an der Hecke am südlichen Gebietsrand (Abbildung 5) der Fang eines Pärchens mit Bodenfallen, die vom bis zum aufgestellt waren. Zusammen mit weiteren, bislang unveröffentlichten Daten zeichnet sich in Nordrhein-Westfalen ein Vorkommensschwerpunkt im Hügelund Bergland ab, während das Tiefland nahezu fundlos ist. S. puberulus ist in fast allen Bundesländern nachgewiesen worden (vgl. HOFFMANN & MELBER 2003), Norddeutschland liegt jedoch bereits am nördlichen Arealrand dieser rein europäischen Art. Die Verbreitungsgrenzen werden in Groß-Britannien, im südlichen Skandinavien, im nördlichen Mittelmeerraum und an der westlichen Schwarzmeerküste erreicht. Es handelt sich um eine überall nur sehr zerstreut vorkommende und seltene Art (AUKEMA & RIEGER 2001; PÉRICART 1998; WACH- MANN et al. 2007). Es ist unbekannt, wovon genau sich S. puberulus ernährt, doch wie bei allen Arten dieser Gattung dürfte auch sie ein Pflanzensauger sein (vgl. WACHMANN et al. 2007). Bei den bisherigen, genau lokalisierbaren Fundorten in Nordrhein-Westfalen hat es sich um vernässte Standorte gehandelt. So käscherte SCHÄFER (2003) zwei Individuen in einem Bachtal u. a. von Wasserdost, DREES (2001) gelang der Nachweis in einem Sumpfgebiet durch Sieben von Moos. Aus dem Harz gibt POLENTZ (1954) Funde in feuchtem Gelände unter Moos, Laub und Genist an, SIMON (2007) charakterisiert sie als einen Bewohner von Feuchtwiesenkomplexen und moorigen Verlandungszonen. Zwar nennen WACHMANN et al. (2007) ebenfalls Moospolster (u. a. Sphagnum-Moose) als Lebensraum, geben aber auch solche an trockenen Stellen an. Auch der Fundort in Schwelm ist kein nasser Standort, doch weisen die Bestände von Wasserdost (Abbildung 5) auf eine zumindest zeitweise hohe Bodenfeuchte hin. Ansonsten dürfte hier im Sommer durch die südöstliche und bis zum Nachmittag beschattungsfreie Exposition sowie die leichte Geländeneigung ein eher trocken- bis feuchtwarmes Mikroklima bestehen. Es ist denkbar, dass S. puberulus hier im Lauf ihres Entwicklungszyklus sowohl den wärmebegünstigten Heckensaum als auch das Innere der Hecke nutzt. Möglich ist auch eine Vorliebe für Wasserdost als Nahrungsquelle (vgl. SCHÄFER 2003). Wegen ihres Habitatanspruchs wurde die Art allerdings eher im Teilgebiet Brambecketal erwartet und hier auch gezielt gesucht, konnte dort aber nicht gefunden werden. Gonocerus acuteangulatus Diese wärmeliebende, vor allem im Mittelmeerraum verbreitete Randwanze (MOULET 1995) ist schon länger in Nordrhein-Westfalen beheimatet, doch beschränken sich die Nachweise vom Anfang des 20 Jahrhunderts auf das südliche Rheinland. Inzwischen aber ist vermutlich das gesamte Tiefland von Nordrhein-Westfalen besiedelt und auch aus dem Bergland (wie hier in Schwelm) liegen jetzt Funde vor. Die Nordwanderung hält an und die Art hat inzwischen den Süden Dänemarks erreicht (WERNER 2011). Gonocerus acuteangulatus konnte im Teilgebiet Tannenbaum gefunden werden, wobei es sich um eine auf fruchtendem Faulbaum (Frangula alnus) sitzende Larve gehandelt hat. Die Art ernährt sich in allen Stadien ausschließlich von Beeren, in erster Linie Faulbaum, Rosen- Arten (v. a. Rosa canina agg., Rosa rugosa; Abbildung 9), Schlehe (Prunus spinosa), Kreuzdorn (Rhamnus cathartica) und Weißdorn (Crataegus monogyna) (WERNER 2007; 2011). 10
15 Bei den folgenden beiden Wanzen handelt es sich um in jüngster Zeit eingewanderte oder eingeschleppte Arten (Neozoen i. w. S.). Stephanitis takeyai Diese Netzwanze stammt ursprünglich aus Japan und konnte 2003 erstmalig in Deutschland gefunden werden (Abbildung 8). Seitdem hat sie sich vor allem in den westlichen Bundesländern sehr stark ausgebreitet und auch aus Nordrhein-Westfalen sind mittlerweile viele Fundorte bekannt geworden (HOFFMANN 2008). Die Art ist zuerst als Schädling an Lavendelheide (Pieris japonica) aufgefallen, wird jedoch zunehmend auch an Rhododendron-Arten (Rhododendron spec.) festgestellt. Auf dem Friedhof Oehde konnte die Art sehr häufig auf Lavendelheide gefunden werden, wobei einige Pflanzen starke Saugschäden aufwiesen (Abbildung 7). Bemerkenswert ist, dass auch in den Teilgebieten Brambecketal und Tannenbaum jeweils einzelne Tiere von St. takeyai mit dem Streifkescher in der Krautschicht gefangen wurden, obwohl vor allem im Brambecketal keine Rhododendron-Bestände in der weiteren Umgebung vorhanden sind. Vermutlich sind die Tiere bei günstigen Schwärmbedingungen fliegend hierher gekommen, was das große Ausbreitungspotential dieser Art belegt. Dafür spricht, dass beide Nachweise am selben Tag erfolgten. Deraeocoris flavilinea D. flavilinea war ursprünglich nur aus Italien und von Korsika bekannt (WAGNER 1971), breitete sich dann aber über das westliche Mittelmeergebiet nach Mitteleuropa aus und konnte 1990 erstmals in Nordrhein-Westfalen nachgewiesen werden (HOFFMANN 2008). Die Art lebt auf verschiedenen Laubgehölzen und stellt hier vor allem Blattläusen nach (WACHMANN et al. 2004). In Schwelm konnten zwei Individuen im Teilgebiet Tannenbaum auf den von Schlehe (Prunus spinosa) und Hundsrose (Rosa canina agg.) dominierten Gebüschen nahe dem Wasserhochbehälter gefunden werden (Abbildung 8). Abbildung 6: Adulte Gitterwanze Stephanitis takeyai mit leerer Larvenhülle (rechts) auf der Unterseite eines Rhododendronblattes (die dunklen Flecken sind Kottröpfchen) Abbildung 7: Durch Stephanitis takeyai stark geschädige Lavendelheide im Teilgebiet Friedhof Oehde 11
16 Abbildung 8: Wärmebegünstiges Schlehen-Hundsrosen- Gebüsch im Teilgebiet Tannenbaum als Lebensraum von Deraeocoris flavilinea ( ; Blickrichtung NW) Abbildung 9: Unterschiedlich alte Larven der Randwanze Goncerus acuteangulatus auf den Früchten einer Kartoffelrose 4.2 Wanzengemeinschaften der Teilgebiete Tannenbaum Nicht nur die vergleichsweise gründliche Erfassung, sondern auch der Strukturreichtum und die größtenteils wärmebegünstigten Standorte sowie die Pflanzenvielfalt sind Gründe dafür, dass im Teilgebiet Tannenbaum die meisten Wanzenarten gefangen wurden. Dabei befinden sich unter den 84 Arten noch nicht einmal solche der Gewässer und Feuchtgebiete, da im Gebiet entsprechende Lebensräume fehlen. Einen großen Anteil machen Arten der Baum- und Strauchschicht aus. Ausschließlich oder überwiegend an Eiche (Quercus spec.) leben die Weichwanzen R. striatellus, C. histrionius, D. flavoquadrimaculatus, H. thoracica, P. perrisi, P. varians und P. wagneri. Sie treten nur wenige Wochen als Adulte auf und können daher leicht übersehen werden; die meiste Zeit ihres Lebens existieren sie als Ei und überwintern auch in diesem Stadium. An Hasel (Corylus avellana) leben C. salicellum und P. coryli, an Weidenarten (Salix spec.) O. marginalis und an Schlehe (Prunus spinosa) und anderen Rosengewächsen H. tumidicornis, A. mali und P. ambiguus. Typische Arten an Birken (Betula spec.) sind L. contaminatus und K. resedae, wobei letztere Art in manchen Jahren sehr häufig ist und auf der Suche nach Überwinterungsmöglichkeiten so massenhaft in Gebäude eindringen kann, dass dies schon zu Berichten in Tageszeitungen geführt hat (HOFFMANN 1992). Neben diesen mehr oder weniger spezialisierten Arten sind in den Gebüschen und auf Bäumen auch viele gefunden worden, die ein weites Wirtspflanzenspektrum aufweisen oder räuberisch leben, darunter die wärmeliebenden und sich derzeit nach Norden ausbreitenden Arten D. flavilinea und G. acuteangulatus (siehe Kapitel 4.1; Abbildung 8 und Abbildung 9). Eine besondere Wanzenfauna weist der Besenginster (Sarothamnus scoparius) auf, der im Gebiet vor allem südlich vom Wasserhochbehälter wuchs (Abbildung 10) und auf dem die Arten H. tibialis, O. adenocarpi, O. virescens und A. obsoleta gefunden wurden. 12
17 Die meisten der übrigen Arten sind Bewohner der Krautschicht und leben im Gebiet vor allem entlang der Säume oder auf der Brache südlich vom Wasserhochbehälter. In solchen strukturreichen, wenig oder gar nicht genutzten Lebensräumen ist bei Wanzen häufig eine hohe Artendiversität nachzuweisen (z. B. ACHTZIGER 1991). Daher sollte, wie es im Gebiet ja auch der Fall ist, immer ein Angebot entsprechender Bereiche vorhanden sein. Auch hier konnten wieder Spezialisten für bestimmte Pflanzen oder Pflanzengruppen nachgewiesen werden. So leben M. tanaceti und O. punctipes ausschließlich auf Rainfarn (Chrysanthemum vulgare)), D. pallidus saugt bevorzugt an Wald-Ziest (Stachys sylvatica) und die bemerkenswerte M. rubi (siehe Kapitel 4.1) bei uns vermutlich ausschließlich an Brombeere (Rubus fruticosus-aggr.). Viele Wanzen, so wie die im Gebiet vorkommenden Arten A. quadripunctatus, C. affinis, L. tripustulatus und O. rufifrons, sind auf der ansonsten wenig beliebten Großen Brennessel (Urtica dioica) zu finden. Die übrigen Arten leben an Vertretern einer einzigen Familie wie z. B. den Nelkengewächsen oder sind wirklich polyphag, oder es handelt sich um räuberisch lebende Arten wie die seltene Sichelwanze N. brevis (siehe Kapitel 4.1). Eine besondere Gruppe sind die an Süßgräsern lebenden Wanzen, von denen im Gebiet zehn Arten nachgewiesen wurden. Obwohl sie keine bestimmte Grasart präferieren und Süßgräser an fast jedem Ort vorhanden sind, sind nicht alle von ihnen so häufig wie man erwarten könnte. Am erfolgreichsten sind Arten wie N. elongata, die die Blätter besaugen, als Imago überwintern und zwei Generationen im Jahr aufbauen. Sie sind so in der Lage, auch häufiger gemähtes oder intensiver beweidetes Grünland zu besiedeln. Auf der anderen Seite stehen als Ei überwinternde Arten mit einer Generation wie L. dolabrata, die auf Gräsersamen angewiesen sind. Sie müssen sich in Säume und junge Brachen zurückziehen, da ihnen auf konventionell bewirtschaftetem Grünland oder auf Rasenflächen regelmäßig die Lebensgrundlage entzogen wird (BOCKWINKEL 1988; SCHÄFER et al. 1995). Im Teilgebiet Tannenbaum sind durch das Nutzungsmosaik geeignete Bedingungen auch für diese Arten vorhanden, wobei auf der Obstwiese das Aussparen von Randstreifen bei der Mahd besonders günstig für eine Wiederbesiedlung der Fläche ist (Abbildung 11). Abbildung 10: Ginsterbestände am Rand der abgeschobenen Fläche, im Hintergrund der Wall ( ; Blickrichtung NW) Abbildung 11: Rand der Obstwiese mit ungemähtem Saum ( ; Blickrichtung NW) 13
18 Wie der deutsche Name zu Recht annehmen lässt, sind mehr auf der Erdoberfläche lebende Wanzen vor allem in der Familie der Bodenwanzen (Lygaeidae) zu erwarten, von denen im Gebiet neun Arten nachgewiesen wurden. Die meisten von ihnen besiedeln mäßig trockene bis feuchte Standorte und sind allgemein häufig, nur bei der an der Hecke am südlichen Gebietsrand nachgewiesenen S. puberulus handelt es sich um eine seltene Art (siehe Kapitel 4.1). Deutlich trockenheitsliebende Arten fehlen offensichtlich im Gebiet und konnten auch nicht auf der abgeschobenen Fläche mit dem Wall und den angrenzenden Säumen südlich vom Wasserhochbehälter gefunden werden (Abbildung 10), obwohl solche vegetationsarmen und sonnenexponierten Flächen für sie am ehesten als Lebensraum infrage kommen Brambecke Aufgrund der Existenz einiger Gewässer konnten hier zehn Arten gefunden werden, die in den anderen Teilgebieten nicht vorkommen können. Zwar ist keine von ihnen landesweit selten, doch handelt es sich beim Wasserläufer G. gibbifer und bei der Uferwanze S. c-album um zwei Arten, die im Bergland deutlich verbreiteter auftreten als im Tiefland und damit das Teilgebiet Brambecke naturräumlich kennzeichnen. G. gibbifer kam nur im großen Stauteich im Weberstal vor (Abbildung 13), S. c-album nur an den wenigen besonnten Abschnitten des Brambecke-Ufers. Dass viele der im Teilgebiet Tannenbaum an Bäumen und Sträuchern nachgewiesene Arten hier fehlen, hat mit Sicherheit methodische Gründe, denn der Erfassungsschwerpunkt wurde auf für dieses Bachtal charakteristischere Gehölze wie Fichte (Picea abies) und Schwarzerle (Alnus glutinosa) gelegt. Und so konnten mit P. intricatus, P. rubricatus, A. magnicornis und G. abietum vier nur an Nadelgehölzen lebende Arten nachgewiesen werden und mit P. tunicatus und O. modestus zwei Bewohner von Erlen. Die beiden letzten Arten sind trotz der Häufigkeit der Schwarzerle im Untersuchungsgebiet nur an einer Stelle im oberen Weberstal festgestellt worden. Dabei handelte es sich um einen halb umgefallenen Baum auf einer Lichtung, der stark fruchtete (Abbildung 14). Gehölzbewohnende Arten, die im Teilgebiet Tannenbaum nicht gefunden wurden, waren die an Birke lebende Stachelwanze E. grisea und die räuberisch unter der Borke von Totholz lebende Blumenwanze X. cursitans (siehe auch Kapitel 4.2.3). Einen verhältnismäßig großen Anteil nehmen im Gebiet die Wanzen der Krautschicht ein. Die lokalklimatischen Bedingungen in diesem Bachtal unterscheiden sich sehr von denen im eher trocken-warmen Teilgebiet Tannenbaum ; viele der folgenden nur im Brambecketal gefangenen Arten sind daher typisch für feuchte bis nasse Standorte und vermutlich fehlen einige von ihnen deshalb tatsächlich im Teilgebiet Tannenbaum. Die beiden Weichwanzenarten B. pteridis und M. filicis saugen an Farnen auch beschatteter Standorte und sind wohl im gesamten Bachtal verbreitet. Dagegen beschränken sich die an Fingerhut (Digitalis purpurea) saugende Weichwanze D. pallicornis, die auf Doldenblütler lebende Weichwanze O. campestris und die von Beinwell (Symphytum officinale) stammende Gitterwanze D. humuli in ihrem Vorkommen eher auf Weg- und Waldränder oder Lichtungen, während die ausschließlich an Hexenkraut-Arten (Circea spec.) lebende Stelzenwanze M. rufescens (Abbildung 16) gemäß den Wuchsorten ihrer Wirtspflanze nur an beschatteten Stellen lebt. 14
19 Als besonders interessanter Standort erwies sich eine Brachfläche westlich der Beyenburger Straße (L 527), die aufgrund der Vernässung von der Mahd ausgespart blieb (Abbildung 17). Nur hier konnten einige typische Wanzenarten von Sumpfgebieten wie A. rufipes (an Baldrian, Valeriana spec. saugend), I. sabuleti (vor allem Rohrglanzgras, Phalaris arundinacea; Abbildung 17) und C. aurescens (Sauergräser) oder allgemein krautige Säume und Brachen bevorzugende Arten wie A. lucorum, A. spinolae und P. bidens gefunden werden. Wie beim Teilgebiet Tannenbaum fehlen auch im Brambecketal deutlich trockenheitsliebende Wanzen, was angesichts der vorherrschenden Standortbedingungen aber auch nicht verwundern kann. Lediglich die wenigstens zeitweilig besonnten und stellenweise vegetationsarmen Wegränder und Böschungen (Abbildung 12) kommen für sie infrage und können trotz ihrer geringen Flächengröße unter geeigneten Bedingungen auch in kühlen Bachtälern ein Lebensraum sehr seltener Arten sein (vgl. SCHÄFER 2003). Als am ehesten wärme- und trockenheitsliebende Art konnte im Gebiet aber nur die weit verbreitete und häufige Bodenwanze P. geniculatus nachgewiesen werden. Abbildung 12: Südlicher Abschnitt der Brambecke mit dem hier relativ breiten Talraum und kleinflächig besonnten Böschungen ( ; Blickrichtung NO) Abbildung 13: Stauteich im Weberstal; Lebensraum des Wasserläufers Gerris gibbifer ( ; Blickrichtung O) Abbildung 14: Erle im oberen Weberstal mit Vorkommen der Weichwanze Pantilius tunicatus und der Bodenwanze Oxycarenus modestus ( ; Blickrichtung N) Abbildung 15: Brache in einem Quellbereich westlich der L 527; Lebensraum von z. B. Acompus rufipes, Ischnodema sabuleti und Cymus aurescens ( ; Blickrichtung W) 15
20 4.2.3 Krähenberg B.U.G.S. Büro für Biologische Umwelt-Gutachten Schäfer Die am Krähenberg gefundenen Wanzenarten sind ebenfalls im Teilgebiet Brambecke und die meisten auch im Teilgebiet Tannenbaum nachgewiesenen worden. Der ermittelte Bestand von zwölf Arten ist angesichts der Lebensraumvielfalt sicher kein Hinweis auf eine generell hier vorhandene geringe Artendiversität. Die Erfassung konzentrierte sich in diesem Gebiet vielmehr auf die Krautschicht innerhalb des Waldes und auf rindenbewohnende Wanzenarten. Zu letzteren gehört die Blumenwanze X. cursitans. Diese stark abgeplattete und nur knapp über 2 mm große Art lebt an Totholz unter der sich ablösenden Rinde und stellt hier anderen Tieren und ihren Eiern nach. Die Stelzenwanze M. rufescens war in Anzahl im Hexenkrautbestand vor dem Eingang zur Erlenhöhle zu finden (Abbildung 16 und Abbildung 18). Weitere häufige Arten waren hier die auf Farnen lebende B. pteridis und die an Waldziest saugende D. pallidus. Auf dem Boden unter den Kräutern sind die an Samen verschiedener Pflanzenarten saugenden Bodenwanzen D. ryeii und D. brunneus nachgewiesen worden. Abbildung 16: Die Stelzenwanze Metatropis rufescens lebt nur auf Hexenkraut und ist im Brambecketal und auf dem Krähenberg nachgewiesen worden Abbildung 17: Auf einer Brache im Brambecketal konnte die v. a. an Rohrglanzgras saugende Bodenwanze Ischnodema sabuleti (im Bild erwachsene Tiere und die rötlich gefärbten Larven) gefunden werden Friedhof Oehde Die Berücksichtigung eines Friedhofs bei Wanzenuntersuchungen mag auf den ersten Blick verwundern. Die für Friedhöfe charakteristische große Anzahl verschiedener Stauden-, Strauch- und Baumarten auch ausländischer Herkunft führt allerdings auch zu einer hohen Artendiversität bei den Wanzen und vielen anderen Insektenordnungen (Abbildung 19). So konnte SCHIRDEWAHN (1996) auf Bonner Friedhöfen insgesamt 84 Arten nachweisen und es ist daher einleuchtend, dass bei einer intensiveren Erfassung des Friedhofs Oehde ebenfalls viel mehr als die gefundenen vier Arten erfasst worden wären. Die Nachsuche auf Rhododendron-Arten ergab nicht nur die in Kapitel 4.1 bereits besprochenen Neozoe St. takeyai, sondern auch die nahe verwandte St. rhododendri. Sie ist ebenfalls keine einheimische Art, lebt aber schon seit ca. 100 Jahren in Mitteleuropa. Die Ein- 16
21 schleppung erfolgte über Pflanzengut aus dem Osten Nordamerikas (PÉRICART 1983). St. rhododendri ist deutlich seltener als St. takeyai, da sie bei uns nur auf Rhododendron vorkommt, der nach HOFFMANN (1990) zudem nicht beschattet sein darf. Der Fundort auf dem Friedhof Oehde war damit übereinstimmend ein einzeln und vollkommen besonnt stehender Strauch dieser Gattung. Unter den einzelnen Linden (Tilia spec.) und an den umliegenden Wegrändern und Gräbern konnten in großer Anzahl erwachsene Tiere von P. apterus und ihre Larven beobachtet werden. Für eine Wanze ist die Art ziemlich bekannt und hat sogar einen deutschen Namen; aufgrund ihrer roten Färbung wird sie Feuerwanze genannt. Die vierte nachgewiesene Wanze E. interstinctus schließlich ist eine häufige Art, die vor allem an Birken lebt. Abbildung 18: Eingang zum Naturdenkmal Erlenhöhle am Krähenberg; in der Krautschicht im Vordergrund lebt u. a. Metatropis rufescens ( ; Blickrichtung O) Abbildung 19: Friedhof Oehde ( ; Blickrichtung W) 17
22 5 Literatur B.U.G.S. Büro für Biologische Umwelt-Gutachten Schäfer ACHTZIGER, R. (1991): Zur Wanzen- und Zikadenfauna von Saumbiotopen. Berichte der ANL 15: ACHTZIGER, R., FRIEß, T. & RABITSCH, W. (2007): Die Eignung von Wanzen (Insecta, Heteroptera) als Indikatoren im Naturschutz. Insecta 10: AGLYAMZYANOV, R. (2006): Revision der paläarktischen Arten der Gattung Lygus Hahn (Heteroptera, Miridae). Dissertation am Fachbereich Biologie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 70 S. AUKEMA, B. (2003): Wantsennieuws uit Zeeland (Heteroptera). Nederlandse Faunistische Mededelingen 18: AUKEMA, B. & HERMES, D. J. (2006): Verspreidingsatlas Nederlandse Wantsen (Hemiptera: Heteroptera). Deel II: Tingidae, Microphysidae, Nabidae, Anthocoridae, Cimicidae, Reduviidae. Leiden, 136 S. AUKEMA, B. & RIEGER, C. (Ed.) (1995): Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. Volume 1: Enicocephalomorpha, Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha and Leptopodomorpha. Amsterdam, 222 S. AUKEMA, B. & RIEGER, C. (Ed.) (1996): Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. Volume 2: Cimicomorpha I. Amsterdam, 361 S. AUKEMA, B. & RIEGER, C. (Ed.) (1999): Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. Volume 3: Cimicomorpha II. Amsterdam, 577 S. AUKEMA, B. & RIEGER, C. (Ed.) (2001): Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. Volume 4: Pentatomomorpha I. - Amsterdam, 346 S. AUKEMA, B. & RIEGER, C. (Ed.) (2006): Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. Volume 5: Pentatomomorpha II. Amsterdam, 550 S. BERNHARDT, K.-G. & GRUNWALD, H.-J. (1993): Beitrag zur Wanzenfauna des Arnsberger Waldes (Nordrhein-Westfalen). Natur Heimat 53 (3): BOCKWINKEL, G. (1988): Der Einfluß der Mahd auf die Besiedlung von mäßig intensiv bewirtschafteten Wiesen durch Graswanzen (Stenodemini, Heteroptera). Natur Heimat 48 (4): DREES, M. (2001): Zur Faunistik der Boden-, Stelzen- und Feuerwanzen des Raumes Hagen (Heteroptera: Lygaeidae, Berytidae, Pyrrhocoridae). Dortmunder Beiträge zur Landeskunde 35: DREES, M. (2009): Daten zur Wanzenfauna des Raumes Hagen (Nordrhein-Westfalen). Heteropteron 29: DREES, M. (2001): Zur Faunistik der Boden-, Stelzen- und Feuerwanzen des Raumes Hagen (Heteroptera: Lygaeidae, Berytidae, Pyrrhocoridae). Dortmunder Beiträge zur Landeskunde 35: GOSSNER, M. & SCHUSTER, G. (2005): Erstnachweis von Macrolophus rubi Woodroffe, 1957, für Bayern mit Angaben zu bisherigen Fundorten in Mitteleuropa und Hinweisen zur Ökologie der Art. Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 54 (1/2): GRUNWALD, H.-J. (2012): Die Wanzen der Naturwaldzelle "Hellerberg" (Arnsberger Wald) (Insecta: Heteroptera). Coleo (Preprint) 13: GÜNTHER, H. (1989): Auswertung von Wanzenfängen von zwei Standorten im Raum Leverkusen (Hemiptera: Heteroptera). Verhandlungen Westdeutscher Entomologentag 1988: GÜNTHER, H., HOFFMANN, H.-J., MELBER, A., REMANE, R., SIMON H. & WINKELMANN, H. (Bearb.) (1998): Rote Liste der Wanzen (Heteroptera). Schriftenreihe Landschaftspflege Naturschutz 55:
23 HOFFMANN, H.-J. (1978): Untersuchungen zur Heteropteren-Fauna des Gelpetales in Wuppertal. Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal; Beihefte31: HOFFMANN, H.-J. (1990): Zur Ausbreitung der Rhododendronzikade Graphocephala fennahi Young (Homoptera, Cicadellidae) in Deutschland, nebst Anmerkungen zu anderen Neueinwanderern bei Wanzen und Zikaden. Verhandlungen Westdeutscher Entomologentag 1989: HOFFMANN, H.-J. (1992): Zur Wanzenfauna (Hemiptera-Heteroptera) von Köln. In: HOFFMANN, H.-J. & WIPKING, W. (Hrsg.): Beiträge zur Insekten- und Spinnenfauna der Großstadt Köln. Decheniana-Beiheft 31: HOFFMANN, H.-J. (1996): Zur Wanzenfauna der Großstadt Köln (Hemiptera - Heteroptera) 1. Nachtrag. In: HOFFMANN, H.-J., WIPKING, W. & CÖLLN, K. (Hrsg.): Beiträge zur Insekten-, Spinnen- und Molluskenfauna der Großstadt Köln (II). Decheniana Beiheft 35. HOFFMANN, H.-J. (1999): Zur Wanzenfauna (Hemiptera, Heteroptera) des Unteren Niederrhein- Gebietes - Datengrundlage. Heteropteron 7: HOFFMANN, H.-J. (2008): Neubürger (Neozoen und Arealerweiterer) unter den Wanzen in Nordrhein- Westfalen (Hemiptera, Heteroptera). Entomologie heute 20: HOFFMANN, H.-J., KOTT, P. & SCHÄFER, P. (2011): Kommentiertes Artenverzeichnis der Wanzen - Heteroptera - in Nordrhein-Westfalen, 1. Fassung, Stand Januar In: LANDESAMT FÜR NATUR, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ NORDRHEIN-WESTFALEN (Hrsg.): Rote Liste der gefährdeten Pflanzen, Pilze und Tiere in Nordrhein-Westfalen, 4. Fassung, Band 2: Tiere. LANUV- Fachbericht 36: HOFFMANN, H.-J. & MELBER, A. (2003): Verzeichnis der Wanzen (Heteroptera) Deutschlands. Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 8: HOFFMANN, H.-J. & SCHÄFER, P. (2010): Aktivitäten der Arbeitsgruppe Wanzen NRW und Ergebnisse der Sommerexkursion im Jahr Heteropteron 32: JANSSON, A. (1986): The Corixidae (Heteroptera) of Europe and some adjacent regions. Acta Entomologica Fennica 47: KOLBE, W. & BRUNS, A. (1988): Insekten und Spinnen in Land- und Gartenbau. Ergebnisse der faunistischen Arten-Bestandsaufnahmen in Höfchen (Burscheid) und Laacherhof (Monheim) Pflanzenbau - Pflanzenschutz 25: MELBER, A. (1999): Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Wanzen mit Gesamtartenverzeichnis. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen Supplement 19 (5): MOULET, P. (1995): Hémiptères Coreoidea Euro-Mediterraneens (= Faune de France 81). Paris, 336 S. NIESER, N. (1982): De Nederlandse Water- En Oppervlatke Wantsen (Heteroptera: Nepomorpha en Gerromorpha). Wetenschappelijke Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 155: PERICART, J. (1983): Hémiptères Tingidae Euro-Mèditerranèens (= Faune de France 69). Paris, 618 S. PERICART, J. (1987): Hémiptères Nabidae d'europe Occidentale et du Maghreb (= Faune de France 71). Paris, 185 S. PÉRICART, J. (1990): Hemiptères Saldidae et Leptopodidae d'europe Occidentale et du Maghreb (= Faune de France 77). Paris, 238 S. PERICART, J. (1998): Hèmiptéres Lygaeidae Euro-Mèditerranèens Vol. 2 (= Faune de France 84 B). Paris, 453 S. POLENTZ, G. (1954): Die Wanzenfauna des Harzes. Abh. Ber. Naturkunde Vorgeschichte Magdeburgs 9, RIEGER, C. (1985): Zur Systematik und Faunistik der Weichwanzen Orthops kalmi Linné und Orthops basalis Costa (Heteroptera, Miridae). Veröffentlichung für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg, Beiheft 59/60:
3.2 Heteroptera (Wanzen) Wolfgang H. O. Dorow
 3.2 Heteroptera (Wanzen) Wolfgang H. O. Dorow 61 Naturwaldreservate in Hessen, Band 7/2.1 Hohestein Zoologische Untersuchungen 1994-1996, Teil 1 Inhaltsverzeichnis 3.2.1 Einleitung... 65 3.2.2 Ergebnisse...
3.2 Heteroptera (Wanzen) Wolfgang H. O. Dorow 61 Naturwaldreservate in Hessen, Band 7/2.1 Hohestein Zoologische Untersuchungen 1994-1996, Teil 1 Inhaltsverzeichnis 3.2.1 Einleitung... 65 3.2.2 Ergebnisse...
Wanzen (Heteroptera) in Berlin und Brandenburg Literatur
 Wanzen (Heteroptera) in Berlin und Brandenburg Literatur ACHTZIGER, R. & NIGMANN, U. (2008): Neue Nachweise von Arocatus longiceps STÅL 1872 in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg
Wanzen (Heteroptera) in Berlin und Brandenburg Literatur ACHTZIGER, R. & NIGMANN, U. (2008): Neue Nachweise von Arocatus longiceps STÅL 1872 in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg
Zur Insektenfauna vom Rüss-Spitz (Kanton Zug), 388 m, bei Maschwanden ZH IV. Heteroptera (Wanzen)
 Entomologische Berichte Natur-Museum Luzern Luzern 33 und (995): Entomologische S. 9-38 Gesellschaft Luzern; download www.biologiezentrum.at 9 Zur Insektenfauna vom Rüss-Spitz (Kanton Zug), 388 m, bei
Entomologische Berichte Natur-Museum Luzern Luzern 33 und (995): Entomologische S. 9-38 Gesellschaft Luzern; download www.biologiezentrum.at 9 Zur Insektenfauna vom Rüss-Spitz (Kanton Zug), 388 m, bei
INTERNATIONAL COOPERATIVE PROGRAMME ON INTEGRATED MONITORING ON AIR POLLUTION EFFECTS ON ECOSYSTEMS
 RIPARTIZIONE 32 FORESTE BOLZANO ABTEILUNG 32 FORSTWIRTSCHAFT BOZEN PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL UN-ECE CONVENTION ON LONG-RANGE TRANSBOUNDARY OF AIR POLLUTION
RIPARTIZIONE 32 FORESTE BOLZANO ABTEILUNG 32 FORSTWIRTSCHAFT BOZEN PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL UN-ECE CONVENTION ON LONG-RANGE TRANSBOUNDARY OF AIR POLLUTION
Rote Liste und Gesamtartenliste der Wanzen (Heteroptera) von Berlin
 Zitiervorschlag: DECKERT, J. & WINKELMANN, H. 2005: Rote Liste und Gesamtartenliste der Wanzen (Heteroptera) von Berlin. In: DER LANDESBEAUFTRAGTE FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE / SENATSVERWALTUNG
Zitiervorschlag: DECKERT, J. & WINKELMANN, H. 2005: Rote Liste und Gesamtartenliste der Wanzen (Heteroptera) von Berlin. In: DER LANDESBEAUFTRAGTE FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE / SENATSVERWALTUNG
Die Hecke - unentbehrlicher Lebensraum für Neuntöter & Co. -
 Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Die Hecke - unentbehrlicher Lebensraum für Neuntöter & Co. - IAB 4a Sachgebiet Kulturlandschaft & Kulturlandschaftstag am 5. Oktober 2016 in Freising E. Schweiger
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Die Hecke - unentbehrlicher Lebensraum für Neuntöter & Co. - IAB 4a Sachgebiet Kulturlandschaft & Kulturlandschaftstag am 5. Oktober 2016 in Freising E. Schweiger
Neue Wanzenarten für Österreich, die Steiermark und das Burgenland (Heteroptera)
 Joannea Zool. 1: 71 78 (1999) Neue Wanzenarten für Österreich, die Steiermark und das Burgenland (Heteroptera) (7. Beitrag zur Faunistik steirischer Wanzen) Karl ADLBAUER Zusammenfassung: Neun Wanzenarten
Joannea Zool. 1: 71 78 (1999) Neue Wanzenarten für Österreich, die Steiermark und das Burgenland (Heteroptera) (7. Beitrag zur Faunistik steirischer Wanzen) Karl ADLBAUER Zusammenfassung: Neun Wanzenarten
Rote Liste der Wanzen (Heteroptera) des Landes Sachsen-Anhalt
 Rote Listen Sachsen-Anhalt Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 39 (2004) Rote Liste der Wanzen (Heteroptera) des Landes Sachsen-Anhalt Bearbeitet von Roland BARTELS, Wolfgang GRUSCHWITZ
Rote Listen Sachsen-Anhalt Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 39 (2004) Rote Liste der Wanzen (Heteroptera) des Landes Sachsen-Anhalt Bearbeitet von Roland BARTELS, Wolfgang GRUSCHWITZ
aber attraktiv und farbenprächtig
 Die Wanzeunbeliebt, aber attraktiv und farbenprächtig Biologie und Ökologie Wenn die Rede auf Wanzen kommt, löst das bei uns meist unangenehme Assoziationen aus: Entweder denken wir dabei an kleine, versteckte
Die Wanzeunbeliebt, aber attraktiv und farbenprächtig Biologie und Ökologie Wenn die Rede auf Wanzen kommt, löst das bei uns meist unangenehme Assoziationen aus: Entweder denken wir dabei an kleine, versteckte
3.4 Heteroptera (Wanzen) W. H. O. DOROW
 . Heteroptera (Wanzen) W. H. O. DOROW nhaltsverzeichnis... inleitung.. Arten und ndividuenzahlen.. Ökologische Charakterisierung der Artengemeinschaft (Qualitative Analyse) 8... Verbreitung 8... Geographische
. Heteroptera (Wanzen) W. H. O. DOROW nhaltsverzeichnis... inleitung.. Arten und ndividuenzahlen.. Ökologische Charakterisierung der Artengemeinschaft (Qualitative Analyse) 8... Verbreitung 8... Geographische
Mitteilungsblatt der Arbeitsgruppe Mitteleuropäischer Heteropterologen Heft Nr. 21 - Köln, Dezember 2005 ISSN 1432-3761
 HETEROPTERON Heft 21 / 2005 1 HETEROPTERON Mitteilungsblatt der Arbeitsgruppe Mitteleuropäischer Heteropterologen Heft Nr. 21 - Köln, Dezember 2005 ISSN 1432-3761 INHALT Einleitende Bemerkungen des Herausgebers...
HETEROPTERON Heft 21 / 2005 1 HETEROPTERON Mitteilungsblatt der Arbeitsgruppe Mitteleuropäischer Heteropterologen Heft Nr. 21 - Köln, Dezember 2005 ISSN 1432-3761 INHALT Einleitende Bemerkungen des Herausgebers...
Baumtagebuch Japanische Zierkirsche
 Baumtagebuch Japanische Zierkirsche Klasse 9d Juni 2016 Die Japanische Zierkirsche habe ich mir für das Baumtagebuch ausgesucht. Ich habe mich für diesen Baum entschieden, weil er in meiner Straße sehr
Baumtagebuch Japanische Zierkirsche Klasse 9d Juni 2016 Die Japanische Zierkirsche habe ich mir für das Baumtagebuch ausgesucht. Ich habe mich für diesen Baum entschieden, weil er in meiner Straße sehr
Die Wanzenfauna (Insecta: Heteroptera) des Nationalparks Gesäuse (Österreich, Steiermark) 1
 Beiträge zur Entomofaunistik 15: 21 59 Wien, Dezember 2014 Die Wanzenfauna (Insecta: Heteroptera) des Nationalparks Gesäuse (Österreich, Steiermark) 1 Thomas Frieß* Abstract The true bug fauna (Insecta:
Beiträge zur Entomofaunistik 15: 21 59 Wien, Dezember 2014 Die Wanzenfauna (Insecta: Heteroptera) des Nationalparks Gesäuse (Österreich, Steiermark) 1 Thomas Frieß* Abstract The true bug fauna (Insecta:
HETEROPTERON. Mitteilungsblatt der Arbeitsgruppe Mitteleuropäischer Heteropterologen. Heft Nr. - Köln, -... ISSN print ISSN online
 HETEROPTERON Mitteilungsblatt der Arbeitsgruppe Mitteleuropäischer Heteropterologen Heft Nr. - Köln, -... ISSN 1432-3761 print ISSN 2105-1586 online Heft 1 - Köln, Juni 1996 INHALT: Heteropterologentreffen
HETEROPTERON Mitteilungsblatt der Arbeitsgruppe Mitteleuropäischer Heteropterologen Heft Nr. - Köln, -... ISSN 1432-3761 print ISSN 2105-1586 online Heft 1 - Köln, Juni 1996 INHALT: Heteropterologentreffen
Spechte im Duisburger Süden 1
 Elektronische Aufsätze der Biologischen Station Westliches Ruhrgebiet 1.14 (25): 1-6 Electronic Publications of the Biological Station of Western Ruhrgebiet 1.14 (25): 1-6 Spechte im Duisburger Süden 1
Elektronische Aufsätze der Biologischen Station Westliches Ruhrgebiet 1.14 (25): 1-6 Electronic Publications of the Biological Station of Western Ruhrgebiet 1.14 (25): 1-6 Spechte im Duisburger Süden 1
NATURSCHUTZFACHLICHE AUFWERTUNG VON KURZUMTRIEBSPLANTAGEN LAUFKÄFER-MONITORING IN HAINE Michael-Andreas Fritze
 19. Jahrestagung der GAC vom 12.2. 14.2.2016 in Neustadt a.d.w. NATURSCHUTZFACHLICHE AUFWERTUNG VON KURZUMTRIEBSPLANTAGEN LAUFKÄFER-MONITORING IN HAINE Michael-Andreas Fritze www.eurocarabidae.de Callistus
19. Jahrestagung der GAC vom 12.2. 14.2.2016 in Neustadt a.d.w. NATURSCHUTZFACHLICHE AUFWERTUNG VON KURZUMTRIEBSPLANTAGEN LAUFKÄFER-MONITORING IN HAINE Michael-Andreas Fritze www.eurocarabidae.de Callistus
Japanischer Staudenknöterich
 Blätter und Blüte Japanischer Staudenknöterich Blatt Japanischer Staudenknöterich Wissenschaftlicher Name: Fallopia japonica Beschreibung: Der japanische Staudenknöterich ist eine schnell wachsende, krautige
Blätter und Blüte Japanischer Staudenknöterich Blatt Japanischer Staudenknöterich Wissenschaftlicher Name: Fallopia japonica Beschreibung: Der japanische Staudenknöterich ist eine schnell wachsende, krautige
Näher betrachtet: Natur im Park unter der Lupe
 Näher betrachtet: Natur im Park unter der Lupe Schmetterlinge im Schönbuch (III): Augenfalter von Ewald Müller In diesem Beitrag möchte ich Vertreter der Augenfalter (Satyridae) im Schönbuch vorstellen.
Näher betrachtet: Natur im Park unter der Lupe Schmetterlinge im Schönbuch (III): Augenfalter von Ewald Müller In diesem Beitrag möchte ich Vertreter der Augenfalter (Satyridae) im Schönbuch vorstellen.
Verbreitung. Riesa. Freiberg
 Hertweck & Hieke: Auswertung der Wildtiererfassung 2000 / 2001 Rothirsch - Cervus elaphus Linnaeus, 1758 Verbreitung Verbreitungsgebiet auch Standwild entsprechende Der Rothirsch ist als zweitgrößte europäische
Hertweck & Hieke: Auswertung der Wildtiererfassung 2000 / 2001 Rothirsch - Cervus elaphus Linnaeus, 1758 Verbreitung Verbreitungsgebiet auch Standwild entsprechende Der Rothirsch ist als zweitgrößte europäische
HETEROPTERON. Mitteilungsblatt der Arbeitsgruppe Mitteleuropäischer Heteropterologen. Heft Nr Köln, Mai 2011 ISSN
 HETEROPTERON Mitteilungsblatt der Arbeitsgruppe Mitteleuropäischer Heteropterologen Heft Nr. 34 - Köln, Mai 2011 ISSN 1432-3761 INHALT Einleitende Bemerkungen des Herausgebers... 1 Änderungen zum Adressenverzeichnis
HETEROPTERON Mitteilungsblatt der Arbeitsgruppe Mitteleuropäischer Heteropterologen Heft Nr. 34 - Köln, Mai 2011 ISSN 1432-3761 INHALT Einleitende Bemerkungen des Herausgebers... 1 Änderungen zum Adressenverzeichnis
Ergänzungssatzung Sandackerstraße, Gemeinde Kusterdingen, Gemarkung Jettenburg
 Potenzialabschätzung Artenschutz Ergänzungssatzung Sandackerstraße, Gemeinde Kusterdingen, Gemarkung Jettenburg 12. November 2014 Auftraggeber: Künster Architektur + Stadtplanung Bismarckstrasse 25 72764
Potenzialabschätzung Artenschutz Ergänzungssatzung Sandackerstraße, Gemeinde Kusterdingen, Gemarkung Jettenburg 12. November 2014 Auftraggeber: Künster Architektur + Stadtplanung Bismarckstrasse 25 72764
in die Buchhorst Waldsaum dient als Weidefläche Eichen ließ man groß wachsen Schweinefutter; Bauholz Hainbuchen: Brennholz
 Von Kristina, Lisa, Roberta und Gesa!!! die Mönchsteiche M stammen aus der zeit der Zisterzienser MöncheM sie werden und wurden zur Fischzucht genutzt das Wasser erhalte sie vom Springberg (früher:
Von Kristina, Lisa, Roberta und Gesa!!! die Mönchsteiche M stammen aus der zeit der Zisterzienser MöncheM sie werden und wurden zur Fischzucht genutzt das Wasser erhalte sie vom Springberg (früher:
Ressourcenprojekt zur Erhaltung und Förderung der gefährdeten Schweizer Ackerbegleitflora. Fotodokumentation einiger Zielarten
 Ressourcenprojekt zur Erhaltung und Förderung der gefährdeten Schweizer Ackerbegleitflora Fotodokumentation einiger Zielarten Auf den folgenden Seiten werden einige repräsentative Vertreter der einheimischen
Ressourcenprojekt zur Erhaltung und Förderung der gefährdeten Schweizer Ackerbegleitflora Fotodokumentation einiger Zielarten Auf den folgenden Seiten werden einige repräsentative Vertreter der einheimischen
Einfluss des Mikroklimas auf xylobionte Käfergemeinschaften
 Umweltforschungsplan 2011 FKZ 3511 86 0200 Anpassungskapazität ausgewählter Arten im Hinblick auf Änderungen durch den Klimawandel Einfluss des Mikroklimas auf xylobionte Käfergemeinschaften Elisabeth
Umweltforschungsplan 2011 FKZ 3511 86 0200 Anpassungskapazität ausgewählter Arten im Hinblick auf Änderungen durch den Klimawandel Einfluss des Mikroklimas auf xylobionte Käfergemeinschaften Elisabeth
Bevölkerung nach demografischen Strukturmerkmalen
 BEVÖLKERUNG 80.219.695 Personen 5,0 8,4 11,1 6,0 11,8 16,6 20,4 11,3 9,3 unter 5 6 bis 14 15 bis 24 25 bis 29 30 bis 39 40 bis 49 50 bis 64 65 bis 74 75 und älter 51,2 48,8 Frauen Männer 92,3 7,7 Deutsche
BEVÖLKERUNG 80.219.695 Personen 5,0 8,4 11,1 6,0 11,8 16,6 20,4 11,3 9,3 unter 5 6 bis 14 15 bis 24 25 bis 29 30 bis 39 40 bis 49 50 bis 64 65 bis 74 75 und älter 51,2 48,8 Frauen Männer 92,3 7,7 Deutsche
SELTENE AKROBATEN DER LÜFTE
 Modul 3: Seltene Akrobaten der Lüfte SELTENE AKROBATEN DER LÜFTE Blaue Schmetterlinge auf bunten Wiesen Die Hausübungen sind gemacht und endlich dürfen Lena und Ben in den Wald spielen gehen. Auf dem Weg
Modul 3: Seltene Akrobaten der Lüfte SELTENE AKROBATEN DER LÜFTE Blaue Schmetterlinge auf bunten Wiesen Die Hausübungen sind gemacht und endlich dürfen Lena und Ben in den Wald spielen gehen. Auf dem Weg
Historische Gärten und Parks charmante Orte und alte Pflanzen
 Historische Gärten und Parks charmante Orte und alte Pflanzen 14. Oktober 2014 Gemeinschaftshaus Broitzem Landschaftsgarten: Kunstvolle Zähmung der Natur Einen Park ohne exotische Arten könnte man mit
Historische Gärten und Parks charmante Orte und alte Pflanzen 14. Oktober 2014 Gemeinschaftshaus Broitzem Landschaftsgarten: Kunstvolle Zähmung der Natur Einen Park ohne exotische Arten könnte man mit
7. Definitive Beteiligungen der DAX-30-Firmen
 7. Definitive Beteiligungen der DAX-3-Firmen 183 7. Definitive Beteiligungen der DAX-3-Firmen 7.1 Adidas-Salomon Aktiengesellschaft Die adidas-salomon AG ist definitiv an 126 Unternehmungen beteiligt.
7. Definitive Beteiligungen der DAX-3-Firmen 183 7. Definitive Beteiligungen der DAX-3-Firmen 7.1 Adidas-Salomon Aktiengesellschaft Die adidas-salomon AG ist definitiv an 126 Unternehmungen beteiligt.
Ökologisches Potential von Verkehrsbegleitflächen
 Ökologisches Potential von Verkehrsbegleitflächen Christian Gnägi Christian Gnägi Grundausbildung: Landwirt Studium: Geographie, Biologie, Ökologie mit Schwerpunkt Natur- u. Landschaftsschutz (Uni Bern
Ökologisches Potential von Verkehrsbegleitflächen Christian Gnägi Christian Gnägi Grundausbildung: Landwirt Studium: Geographie, Biologie, Ökologie mit Schwerpunkt Natur- u. Landschaftsschutz (Uni Bern
Weinbergschnecke. Outdoor-Schneckenbestimmungsbüchlein. Zusammengestellt von Angelika Benninger, 2015
 0 cm Wer schneckt denn da? 1 cm Outdoor-Schneckenbestimmungsbüchlein 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm Zusammengestellt von Angelika Benninger, 2015 Schrift: Andika Leseschrift by zaubereinmaleins.de Fotos: siehe
0 cm Wer schneckt denn da? 1 cm Outdoor-Schneckenbestimmungsbüchlein 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm Zusammengestellt von Angelika Benninger, 2015 Schrift: Andika Leseschrift by zaubereinmaleins.de Fotos: siehe
Unterlage 12.0B. Anlage 21
 Planfeststellung A 14, VKE 1153 Landesgrenze Sachsen-Anhalt (ST) / Brandenburg (BB) bis südlich AS Wittenberge Unterlage 12.0B Anlage 21 Unterlage 12.0B Anlage 21 Ergänzende faunistische Sonderuntersuchung
Planfeststellung A 14, VKE 1153 Landesgrenze Sachsen-Anhalt (ST) / Brandenburg (BB) bis südlich AS Wittenberge Unterlage 12.0B Anlage 21 Unterlage 12.0B Anlage 21 Ergänzende faunistische Sonderuntersuchung
Antrag auf Förderung der Wallheckenpflege
 An die Stadt Delmenhorst Fachdienst Stadtgrün und Naturschutz Am Stadtwall 1 (Stadthaus) Telefon: (04221) 99-2889 27749 Delmenhorst Telefax: (04221) 99-1255 Antrag auf Förderung der Wallheckenpflege Grundstückseigentümer/-in:
An die Stadt Delmenhorst Fachdienst Stadtgrün und Naturschutz Am Stadtwall 1 (Stadthaus) Telefon: (04221) 99-2889 27749 Delmenhorst Telefax: (04221) 99-1255 Antrag auf Förderung der Wallheckenpflege Grundstückseigentümer/-in:
Biodiversität im Siedlungsraum: Zustand und Potenziale
 Biodiversität im Siedlungsraum: Zustand und Potenziale Manuela Di Giulio Natur Umwelt Wissen GmbH Siedlungen: Himmel oder Hölle? Wirkungsmechanismen unklar, Aussagen teilweise widersprüchlich Methodische
Biodiversität im Siedlungsraum: Zustand und Potenziale Manuela Di Giulio Natur Umwelt Wissen GmbH Siedlungen: Himmel oder Hölle? Wirkungsmechanismen unklar, Aussagen teilweise widersprüchlich Methodische
Kultur- und Lebensräume
 Kultur- und Lebensräume 14 Kultur- und Lebensräume 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Einstieg: Lebensräume
Kultur- und Lebensräume 14 Kultur- und Lebensräume 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Einstieg: Lebensräume
Windblütige Bäume im Siedlungsgebiet
 Newsletter Nr. 8-2008 Windblütige Bäume im Siedlungsgebiet Die Pollenkonzentrationen in der Luft erreichen - bedingt durch die Blüte der windblütigen Bäume - im Zeitraum von März bis Mai ihre höchsten
Newsletter Nr. 8-2008 Windblütige Bäume im Siedlungsgebiet Die Pollenkonzentrationen in der Luft erreichen - bedingt durch die Blüte der windblütigen Bäume - im Zeitraum von März bis Mai ihre höchsten
Familie Thaller vlg. Wratschnig
 Natur auf unserem Betrieb Impressum: Herausgeber: Arge NATURSCHUTZ und LFI Kärnten; Für den Inhalt verantwortlich: Mag. Margret Dabernig; Text und Layout: Mag. Margret Dabernig und Fam. Thaller; Fotos:
Natur auf unserem Betrieb Impressum: Herausgeber: Arge NATURSCHUTZ und LFI Kärnten; Für den Inhalt verantwortlich: Mag. Margret Dabernig; Text und Layout: Mag. Margret Dabernig und Fam. Thaller; Fotos:
Wiese in Leichter Sprache
 Wiese in Leichter Sprache 1 Warum müssen wir die Natur schützen? Wir Menschen verändern die Natur. Zum Beispiel: Wir bauen Wege und Plätze aus Stein. Wo Stein ist, können Pflanzen nicht wachsen. Tiere
Wiese in Leichter Sprache 1 Warum müssen wir die Natur schützen? Wir Menschen verändern die Natur. Zum Beispiel: Wir bauen Wege und Plätze aus Stein. Wo Stein ist, können Pflanzen nicht wachsen. Tiere
Stadt Luzern. öko-forum. Stichwort. Marienkäfer. öko-forum Bourbaki Panorama Luzern Löwenplatz Luzern.
 Stadt Luzern öko-forum Stichwort Marienkäfer Stadt Luzern öko-forum Bourbaki Panorama Luzern Löwenplatz 11 6004 Luzern Telefon: 041 412 32 32 Telefax: 041 412 32 34 info@oeko-forum.ch www.ublu.ch Inhalt
Stadt Luzern öko-forum Stichwort Marienkäfer Stadt Luzern öko-forum Bourbaki Panorama Luzern Löwenplatz 11 6004 Luzern Telefon: 041 412 32 32 Telefax: 041 412 32 34 info@oeko-forum.ch www.ublu.ch Inhalt
Info: Wechselwirkungen
 Info: Wechselwirkungen Abbildung 1: Dickkopffalter an einer Skabiosenblüte In der Sprache einiger Naturvölker werden Schmetterlinge auch fliegende Blumen genannt. Schmetterlinge gleichen in ihrer Schönheit
Info: Wechselwirkungen Abbildung 1: Dickkopffalter an einer Skabiosenblüte In der Sprache einiger Naturvölker werden Schmetterlinge auch fliegende Blumen genannt. Schmetterlinge gleichen in ihrer Schönheit
& ) %*#+( %% * ' ),$-#. '$ # +, //$ ' ' ' ' %0 -. % ( #+$1 $$! / 0# ' $ " ' #) % $# !! # ' +!23!4 * ' ($!#' (! " # $ & - 2$ $' % & " $ ' '( +1 * $ 5
 !"!! # " # $% $ & $$% % & " $ ' '( &% % # ) # $ ' #% $ $$ $ (! ' #%#'$ & ) %*#+( %% * ' ) $-#. '$ # + //$ ' ' ' ' %0 -. % ( #+$1 $$! / 0# ' $ " ' #) % $# 0+ ' +!23!4 * ' ($!#' (! ) ' $1%%$( - 2$ $' +1
!"!! # " # $% $ & $$% % & " $ ' '( &% % # ) # $ ' #% $ $$ $ (! ' #%#'$ & ) %*#+( %% * ' ) $-#. '$ # + //$ ' ' ' ' %0 -. % ( #+$1 $$! / 0# ' $ " ' #) % $# 0+ ' +!23!4 * ' ($!#' (! ) ' $1%%$( - 2$ $' +1
Vogelfreundliche Hecken und Sträucher
 Vogelfreundliche Hecken und Sträucher Blutrote Johannisbeere ( Ribes Sanguineum ) Efeu ( Hedera helix ) Goji Beere ( Lycium barbarum ) Hainbuche ( Carpinus betulus ) Haselnuss ( Corylus avellana ) Heidelbeere
Vogelfreundliche Hecken und Sträucher Blutrote Johannisbeere ( Ribes Sanguineum ) Efeu ( Hedera helix ) Goji Beere ( Lycium barbarum ) Hainbuche ( Carpinus betulus ) Haselnuss ( Corylus avellana ) Heidelbeere
Fenster auf! Für die Feldlerche.
 Fenster auf! Für die Feldlerche. Mit wenig Aufwand viel erreichen Jan-Uwe Schmidt, Pirna, 05.03.2015 Foto: Bodenbrüterprojekt, M. Dämmig Im Auftrag von: Hintergründe Lebensraum Acker Ackerland umfasst
Fenster auf! Für die Feldlerche. Mit wenig Aufwand viel erreichen Jan-Uwe Schmidt, Pirna, 05.03.2015 Foto: Bodenbrüterprojekt, M. Dämmig Im Auftrag von: Hintergründe Lebensraum Acker Ackerland umfasst
Hirschkäfer, Lucanus cervus
 Hirschkäfer, Lucanus cervus Johann August Rösel von Rosenhof (1705 1759) Abbildung aus: Insectenbelustigung, Rösel von Rosenhof, 1705-1759 (1978) Workshop Biologie und Schutz xylobionter Käfer am Beispiel
Hirschkäfer, Lucanus cervus Johann August Rösel von Rosenhof (1705 1759) Abbildung aus: Insectenbelustigung, Rösel von Rosenhof, 1705-1759 (1978) Workshop Biologie und Schutz xylobionter Käfer am Beispiel
r e b s r e l l a b e i r t e b t s r , h c s e l e t t i M n i r e t i e l r e i v e r, s s i e w a s i l önnen. hützen zu k
 der wald lebt Lebensräume erhalten und verbessern, Vielfalt gewährleisten und fördern: Das ist der Kern unserer Arbeit. Wir wollen keine räumliche Trennung der wirtschaftlichen und ökologischen Aufgaben
der wald lebt Lebensräume erhalten und verbessern, Vielfalt gewährleisten und fördern: Das ist der Kern unserer Arbeit. Wir wollen keine räumliche Trennung der wirtschaftlichen und ökologischen Aufgaben
Deichrückverlegung Monheimer Rheinbogen Projekt Akzeptanz Ökologie - Tourismus
 Deichrückverlegung Monheimer Rheinbogen Projekt Akzeptanz Ökologie - Tourismus Holger Pieren (Biologische Station Haus Bürgel Stadt Düsseldorf - Kreis Mettmann e.v.) Henning Rothstein (Stadt Monheim) Lage
Deichrückverlegung Monheimer Rheinbogen Projekt Akzeptanz Ökologie - Tourismus Holger Pieren (Biologische Station Haus Bürgel Stadt Düsseldorf - Kreis Mettmann e.v.) Henning Rothstein (Stadt Monheim) Lage
Epidemiologische Untersuchung zur Verbreitung der Räude beim Rotfuchs (Vulpes vulpes) in Baden-Württemberg
 Aus dem Chemischen-und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe Außenstelle Heidelberg und aus dem Institut für Parasitologie und Internationale Tiergesundheit des Fachbereiches Veterinärmedizin der Freien
Aus dem Chemischen-und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe Außenstelle Heidelberg und aus dem Institut für Parasitologie und Internationale Tiergesundheit des Fachbereiches Veterinärmedizin der Freien
 GEMEINDE ZIMMERN OB ROTTWEIL LANDKREIS ROTTWEIL BEBAUUNGSPLAN "ZIMMERN O.R. - OST, TEIL II" IN ZIMMERN OB ROTTWEIL ANLAGE 1 ZU DEN PLANUNGSRECHTLICHEN FESTSETZUNGEN (TEXTTEIL) PFLANZLISTEN siehe folgende
GEMEINDE ZIMMERN OB ROTTWEIL LANDKREIS ROTTWEIL BEBAUUNGSPLAN "ZIMMERN O.R. - OST, TEIL II" IN ZIMMERN OB ROTTWEIL ANLAGE 1 ZU DEN PLANUNGSRECHTLICHEN FESTSETZUNGEN (TEXTTEIL) PFLANZLISTEN siehe folgende
Erstnachweis und bekannte Verbreitung von Oxycarenus lavaterae (FABRICIUS, 1787) in Österreich (Heteroptera: Lygaeidae)
 Beiträge zur Entomofaunistik 2 49-54 Wien, Dezember 2001 Erstnachweis und bekannte Verbreitung von Oxycarenus lavaterae (FABRICIUS, 1787) in Österreich (Heteroptera: Lygaeidae) Wolfgang Rabitsch* & Karl
Beiträge zur Entomofaunistik 2 49-54 Wien, Dezember 2001 Erstnachweis und bekannte Verbreitung von Oxycarenus lavaterae (FABRICIUS, 1787) in Österreich (Heteroptera: Lygaeidae) Wolfgang Rabitsch* & Karl
Wald in Leichter Sprache
 Wald in Leichter Sprache Warum müssen wir die Natur schützen? Wir Menschen verändern die Natur. Zum Beispiel: Wir fällen viele Bäume. Aber Bäume sind wichtig für saubere Luft. Wir Menschen brauchen saubere
Wald in Leichter Sprache Warum müssen wir die Natur schützen? Wir Menschen verändern die Natur. Zum Beispiel: Wir fällen viele Bäume. Aber Bäume sind wichtig für saubere Luft. Wir Menschen brauchen saubere
Tagfalter in Bingen Der Admiral -lat. Vanessa atalanta- Inhalt
 Tagfalter in Bingen Der Admiral -lat. Vanessa atalanta- Inhalt Kurzporträt... 2 Falter... 2 Eier... 2 Raupe... 3 Puppe... 4 Besonderheiten... 5 Beobachten... 5 Zucht... 5 Artenschutz... 5 Literaturverzeichnis...
Tagfalter in Bingen Der Admiral -lat. Vanessa atalanta- Inhalt Kurzporträt... 2 Falter... 2 Eier... 2 Raupe... 3 Puppe... 4 Besonderheiten... 5 Beobachten... 5 Zucht... 5 Artenschutz... 5 Literaturverzeichnis...
Bestimmungshilfe Krautpflanzen
 Bestimmungshilfe Krautpflanzen Buschwindröschen Wald-Schlüsselblume Blüte weiss mit 6 bis 8 Blütenblättern 3 gestielte, dreigeteilte und grob gezähnte Blätter Höhe: 10-25 cm wächst an schattigen, humusreichen
Bestimmungshilfe Krautpflanzen Buschwindröschen Wald-Schlüsselblume Blüte weiss mit 6 bis 8 Blütenblättern 3 gestielte, dreigeteilte und grob gezähnte Blätter Höhe: 10-25 cm wächst an schattigen, humusreichen
Invasiv - Konkurrenzstark - Regressiv
 Invasiv - Konkurrenzstark - Regressiv Anmerkungen zu Baumarten im Klimawandel Norbert Asche, Gelsenkirchen 1 Vilm, September 2009 Wer kennt diese Baumarten? Landesbetrieb Wald und Holz 2 Begriffe und Definitionen
Invasiv - Konkurrenzstark - Regressiv Anmerkungen zu Baumarten im Klimawandel Norbert Asche, Gelsenkirchen 1 Vilm, September 2009 Wer kennt diese Baumarten? Landesbetrieb Wald und Holz 2 Begriffe und Definitionen
Anlage der Wiese: Schmetterlingswiese, Bienenweide, Barfuss- und Sinnesgarten für Kleine und Grosse
 Naturnahe Flächen im Nachbarschaftsgarten Menschenskinder Anlage der Wiese: Schmetterlingswiese, Bienenweide, Barfuss- und Sinnesgarten für Kleine und Grosse... Bunt blühende Pflanzen und Blüten bestäubende
Naturnahe Flächen im Nachbarschaftsgarten Menschenskinder Anlage der Wiese: Schmetterlingswiese, Bienenweide, Barfuss- und Sinnesgarten für Kleine und Grosse... Bunt blühende Pflanzen und Blüten bestäubende
Ecology meets application: biologische Regulation von Bodenschädlingen
 K Staudacher C Wallinger N Schallhart M Traugott Institut f. Ökologie Ecology meets application: biologische Regulation von Bodenschädlingen Treffen FZ Berglandwirtschaft 2012 Drahtwürmer sind wichtige
K Staudacher C Wallinger N Schallhart M Traugott Institut f. Ökologie Ecology meets application: biologische Regulation von Bodenschädlingen Treffen FZ Berglandwirtschaft 2012 Drahtwürmer sind wichtige
Ökologische Ansprüche von Wildbienen
 Ökologische Ansprüche von Wildbienen Folgerungen für sinnvolle Hilfsmaßnahmen Norbert Voigt, SHHB, 28.04. 2015 Die Ausführung geht in vielen Fällen an den Ansprüchen der Wildbienen vorbei. Nisthilfen sind
Ökologische Ansprüche von Wildbienen Folgerungen für sinnvolle Hilfsmaßnahmen Norbert Voigt, SHHB, 28.04. 2015 Die Ausführung geht in vielen Fällen an den Ansprüchen der Wildbienen vorbei. Nisthilfen sind
Bio Versuche 2013 09.12.2013. In der Natur - Biologisches Gleichgewicht. Versuche im geschützten Anbau Projekt Bauernparadeiser
 9.12.213 Bio Versuche 213 I 4,5 ha Freilandfläche insgesamt 213 ca. 2.4 m² geschützter Anbau 3.69 m² biologisch zertifizierte Fläche 5.31 m² konventionell genutzte Fläche an der Versuchsstation für Spezialkulturen
9.12.213 Bio Versuche 213 I 4,5 ha Freilandfläche insgesamt 213 ca. 2.4 m² geschützter Anbau 3.69 m² biologisch zertifizierte Fläche 5.31 m² konventionell genutzte Fläche an der Versuchsstation für Spezialkulturen
Nützliche Insekten im Garten. Referentin: Dr. Sandra Lerche
 im Garten Referentin: Dr. Sandra Lerche Begriff durch den Menschen definiert Ort des Auftretens (z. B. Asiatischer Marienkäfer) in Blattlauskolonien: +++ an Früchten: --- Quelle: www.wikipedia. de Begriff
im Garten Referentin: Dr. Sandra Lerche Begriff durch den Menschen definiert Ort des Auftretens (z. B. Asiatischer Marienkäfer) in Blattlauskolonien: +++ an Früchten: --- Quelle: www.wikipedia. de Begriff
NATURWALDRESERVAT HECKE
 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Passau-Rotthalmünster NATURWALDRESERVAT HECKE Naturwaldreservat Hecke Gräben, Totholz und junge Bäume vermitteln den Besuchern einen urwaldartigen Eindruck.
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Passau-Rotthalmünster NATURWALDRESERVAT HECKE Naturwaldreservat Hecke Gräben, Totholz und junge Bäume vermitteln den Besuchern einen urwaldartigen Eindruck.
Alpenbock (Rosalia alpina), Großer Eichenbock (Cerambyx cerdo) und Trauerbock (Morimus funereus)
 Alpenbock (Rosalia alpina), Großer Eichenbock (Cerambyx cerdo) und Trauerbock (Morimus funereus) Dr. Walter Hovorka In der FFH Richtlinie sind aus der Familie der Bockkäfer (Cerambycidae) drei Arten angeführt,
Alpenbock (Rosalia alpina), Großer Eichenbock (Cerambyx cerdo) und Trauerbock (Morimus funereus) Dr. Walter Hovorka In der FFH Richtlinie sind aus der Familie der Bockkäfer (Cerambycidae) drei Arten angeführt,
Wald und Weidetieren. Landschaftsentwicklung durch Beweidung und die Ko-Evolution von Pflanzen und Pflanzenfresser
 Wald und Weidetieren Landschaftsentwicklung durch Beweidung und die Ko-Evolution von Pflanzen und Pflanzenfresser Leo Linnartz, september 2015 Inhalt Wald und Weidetieren Landschaftsentwicklung durch Beweidung
Wald und Weidetieren Landschaftsentwicklung durch Beweidung und die Ko-Evolution von Pflanzen und Pflanzenfresser Leo Linnartz, september 2015 Inhalt Wald und Weidetieren Landschaftsentwicklung durch Beweidung
Torsten van der Heyden. Mitglied des Redaktionskomitees von BV news Publicaciones Científicas Hamburg (Deutschland)
 Ein aktueller Nachweis von Zelus renardii (Kolenati, 1856) auf Kreta/Griechenland (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae: Harpactorinae) Una cita reciente de Zelus renardii (Kolenati, 1856) en Creta/Grecia
Ein aktueller Nachweis von Zelus renardii (Kolenati, 1856) auf Kreta/Griechenland (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae: Harpactorinae) Una cita reciente de Zelus renardii (Kolenati, 1856) en Creta/Grecia
Aktuelle Heteropteren-Funde nach 1980 aus dem Freistaat Sachsen (Insecta: Hemiptera) 2. Beitrag
 Faun. Abh. 25: 79 89 79 Aktuelle Heteropteren-Funde nach 1980 aus dem Freistaat Sachsen (Insecta: Hemiptera) 2. Beitrag KURT ARNOLD Postfach 11 20, D-09466 Geyer / Erzgebirge; e-mail: kurt_arnold @ web.de
Faun. Abh. 25: 79 89 79 Aktuelle Heteropteren-Funde nach 1980 aus dem Freistaat Sachsen (Insecta: Hemiptera) 2. Beitrag KURT ARNOLD Postfach 11 20, D-09466 Geyer / Erzgebirge; e-mail: kurt_arnold @ web.de
Die Vogel-Kirsche (Prunus avium L.) Baum des Jahres 2010
 Die Vogel-Kirsche (Prunus avium L.) Baum des Jahres 2010 Wer kennt sie nicht, diese besonders im Frühjahr und Herbst attraktive und ökologisch äußerst wertvolle Baumart unserer Waldränder, die Vogel-Kirsche,
Die Vogel-Kirsche (Prunus avium L.) Baum des Jahres 2010 Wer kennt sie nicht, diese besonders im Frühjahr und Herbst attraktive und ökologisch äußerst wertvolle Baumart unserer Waldränder, die Vogel-Kirsche,
Gehölze für Bienen und andere Hautflügler
 Gehölze für Bienen und andere Hautflügler Insekten haben wichtige Funktionen im Naturkreislauf. Insbesondere Honigbiene, Wildbienen und andere Hautflügler sind von großer Bedeutung für den Menschen. Sie
Gehölze für Bienen und andere Hautflügler Insekten haben wichtige Funktionen im Naturkreislauf. Insbesondere Honigbiene, Wildbienen und andere Hautflügler sind von großer Bedeutung für den Menschen. Sie
Bedarfsliste für die Erstbepflanzung des Baumparks Rüdershausen
 E R L Ä U T E R U N G Die Bepflanzung ist im Oktober 2012 vorgesehen (Liefertermin ab 42. KW) Gepflanzt werden generell einheimische Gehölze in Anlehnung an das bisher ausgewählte Sortiment der sog. Bäume
E R L Ä U T E R U N G Die Bepflanzung ist im Oktober 2012 vorgesehen (Liefertermin ab 42. KW) Gepflanzt werden generell einheimische Gehölze in Anlehnung an das bisher ausgewählte Sortiment der sog. Bäume
Hecken - lebendige Heimatgeschichte
 Hecken - lebendige Heimatgeschichte Die Entstehung der Heckenlandschaft um Allhartsmais ist eng mit der Besiedelungsgeschichte und der traditionellen Fluraufteilung im Bayerischen Wald verknüpft. 4 3 5
Hecken - lebendige Heimatgeschichte Die Entstehung der Heckenlandschaft um Allhartsmais ist eng mit der Besiedelungsgeschichte und der traditionellen Fluraufteilung im Bayerischen Wald verknüpft. 4 3 5
Anforderungen ökologischer Ausgleich Illnau-Effretikon
 Anforderungen ökologischer Ausgleich Illnau-Effretikon Verbindlich für Arealüberbauungen und Projekte mit Gestaltungsplan Empfohlen für weitere Überbauungen in der Wohnzone und im Industriegebiet Grundlagen
Anforderungen ökologischer Ausgleich Illnau-Effretikon Verbindlich für Arealüberbauungen und Projekte mit Gestaltungsplan Empfohlen für weitere Überbauungen in der Wohnzone und im Industriegebiet Grundlagen
Für die Artenschutzprüfung relevante Schutzkategorien / Planungsrelevante Arten
 Für die Artenschutzprüfung relevante Schutzkategorien / Planungsrelevante Arten 16./17.09.2015 Dr. Ernst-Friedrich Kiel MKULNV, Referat III-4 (Biotop- und Artenschutz, Natura 2000, Klimawandel und Naturschutz,
Für die Artenschutzprüfung relevante Schutzkategorien / Planungsrelevante Arten 16./17.09.2015 Dr. Ernst-Friedrich Kiel MKULNV, Referat III-4 (Biotop- und Artenschutz, Natura 2000, Klimawandel und Naturschutz,
Untersuchung zu einem potenziellen Vorkommen des Feldhamsters bei Wustweiler (Gemeinde Illingen, Saarland) Ergebnisbericht
 Untersuchung zu einem potenziellen Vorkommen des Feldhamsters bei Wustweiler (Gemeinde Illingen, Saarland) Ergebnisbericht? Untersuchung zu einem potenziellen Vorkommen des Feldhamsters bei Wustweiler
Untersuchung zu einem potenziellen Vorkommen des Feldhamsters bei Wustweiler (Gemeinde Illingen, Saarland) Ergebnisbericht? Untersuchung zu einem potenziellen Vorkommen des Feldhamsters bei Wustweiler
Pilottestung der Standard-Orientierungsaufgaben ERGEBNISSE
 Pilottestung der Standard-Orientierungsaufgaben für die mathematischen Fähigkeiten der österreichischen Schülerinnen und Schüler am Ende der 8. Schulstufe ERGEBNISSE Auftraggeber Österreichisches Kompetenzzentrum
Pilottestung der Standard-Orientierungsaufgaben für die mathematischen Fähigkeiten der österreichischen Schülerinnen und Schüler am Ende der 8. Schulstufe ERGEBNISSE Auftraggeber Österreichisches Kompetenzzentrum
Abgesägt- und dann? Überlegungen für eine effektive Gehölzpflege auf Böschungen
 Abgesägt- und dann? Überlegungen für eine effektive Gehölzpflege auf Böschungen Problem Böschungspflege Die Pflege der teilweise sehr hohen und steilen Böschungen am Kaiserstuhl und im Breisgau verursacht
Abgesägt- und dann? Überlegungen für eine effektive Gehölzpflege auf Böschungen Problem Böschungspflege Die Pflege der teilweise sehr hohen und steilen Böschungen am Kaiserstuhl und im Breisgau verursacht
Tier-Steckbriefe. Tier-Steckbriefe. Lernziele: Material: Köcher iege. Arbeitsblatt 1 - Welches Tier lebt wo? Methode: Info:
 Tier-Steckbriefe Lernziele: Die SchülerInnen können Tiere nennen, die in verschiedenen Lebensräumen im Wald leben. Die SchülerInnen kennen die Lebenszyklen von Feuersalamander und Köcher iege. Sie wissen,
Tier-Steckbriefe Lernziele: Die SchülerInnen können Tiere nennen, die in verschiedenen Lebensräumen im Wald leben. Die SchülerInnen kennen die Lebenszyklen von Feuersalamander und Köcher iege. Sie wissen,
Fünfjahresbilanz des Monitoring-Projektes (G)ARTEN@ELSA in Oberhausen (2001-2005) 1
 Elektronische Aufsätze der Biologischen Station Westliches Ruhrgebiet 6.1 (2006): 1-5 Electronic Publications of the Biological Station of Western Ruhrgebiet 6.1 (2006): 1-5 Fünfjahresbilanz des Monitoring-Projektes
Elektronische Aufsätze der Biologischen Station Westliches Ruhrgebiet 6.1 (2006): 1-5 Electronic Publications of the Biological Station of Western Ruhrgebiet 6.1 (2006): 1-5 Fünfjahresbilanz des Monitoring-Projektes
Biologie und Lebensweise von Nützlingen im Gemüsebau - Nützlinge erkennen und fördern
 Biologie und Lebensweise von Nützlingen im Gemüsebau - Nützlinge erkennen und fördern Gliederung Wie und warum Nützlinge schonen Bedeutende Schädlinge und ihre Feinde Biologie und Lebensweise von Nützlingen
Biologie und Lebensweise von Nützlingen im Gemüsebau - Nützlinge erkennen und fördern Gliederung Wie und warum Nützlinge schonen Bedeutende Schädlinge und ihre Feinde Biologie und Lebensweise von Nützlingen
Mischkultur im Hobbygarten
 Schwester Christa Weinrich OSB Mischkultur im Hobbygarten 4., aktualisierte Auflage 33 Farbfotos 25 Zeichnungen 2 Vorwort Warum hat die Abtei Fulda ihre Erfahrungen im Mischkulturenanbau noch nicht in
Schwester Christa Weinrich OSB Mischkultur im Hobbygarten 4., aktualisierte Auflage 33 Farbfotos 25 Zeichnungen 2 Vorwort Warum hat die Abtei Fulda ihre Erfahrungen im Mischkulturenanbau noch nicht in
Bebauung Theodor-Heuß-Ring 16. Artenschutzrechtliche Beurteilung der Baumfällungen (ASP 1)
 Bebauung Theodor-Heuß-Ring 16 Artenschutzrechtliche Beurteilung der Baumfällungen (ASP 1) Auftraggeber: Schmeing Baugruppe Ansprechpartner: Herr Josef Schmölzl Bearbeitet durch: Graevendal GbR Moelscherweg
Bebauung Theodor-Heuß-Ring 16 Artenschutzrechtliche Beurteilung der Baumfällungen (ASP 1) Auftraggeber: Schmeing Baugruppe Ansprechpartner: Herr Josef Schmölzl Bearbeitet durch: Graevendal GbR Moelscherweg
Er kann zwischenzeitlich aber auch Pollen und Nektar aufnehmen.
 Marienkäfer (Coccinella septempunctata) Der sehr schön gefärbte, gefleckte und auch wohl bekannteste unter den Coccinelliden ist der Siebenpunkt Marienkäfer. Sowohl die 5 bis 9 mm großen Erwachsenen als
Marienkäfer (Coccinella septempunctata) Der sehr schön gefärbte, gefleckte und auch wohl bekannteste unter den Coccinelliden ist der Siebenpunkt Marienkäfer. Sowohl die 5 bis 9 mm großen Erwachsenen als
Naturwaldreservate als Datenbasis zur Einschätzung natürlicher Waldentwicklungen in einem künftigen Nationalpark
 Naturwaldreservate als Datenbasis zur Einschätzung natürlicher Waldentwicklungen Dr. Patricia Balcar Dr. Patricia Balcar AUSWEISUNGEN VON NATURWALDRESERVATEN IN RHEINLAND-PFALZ aus der Nutzung genommen
Naturwaldreservate als Datenbasis zur Einschätzung natürlicher Waldentwicklungen Dr. Patricia Balcar Dr. Patricia Balcar AUSWEISUNGEN VON NATURWALDRESERVATEN IN RHEINLAND-PFALZ aus der Nutzung genommen
Die Landkarte der Angst 2012 bis 2016
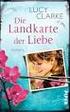 Alle Texte und Grafiken zum Download: www.die-aengste-der-deutschen.de Die Ängste der Deutschen Die Landkarte der Angst 2012 bis 2016 Die Bundesländer im Vergleich 2012 bis 2016 zusammengefasst Von B wie
Alle Texte und Grafiken zum Download: www.die-aengste-der-deutschen.de Die Ängste der Deutschen Die Landkarte der Angst 2012 bis 2016 Die Bundesländer im Vergleich 2012 bis 2016 zusammengefasst Von B wie
Körperbau und Sinnesorgane
 Biberinfo: Körperbau und Sinnesorgane Der Biber ist das größte Nagetier Europas und kann bis zu 36 kg schwer und 1.30m lang werden. Der Schwanz des Bibers, die Biberkelle ist netzartig mit Schuppen bedeckt
Biberinfo: Körperbau und Sinnesorgane Der Biber ist das größte Nagetier Europas und kann bis zu 36 kg schwer und 1.30m lang werden. Der Schwanz des Bibers, die Biberkelle ist netzartig mit Schuppen bedeckt
Jetzt mischen wir den Schatten auf: Staudenmischpflanzungen für schattige Standorte. Cornelia Pacalaj
 Jetzt mischen wir den Schatten auf: Staudenmischpflanzungen für schattige Standorte Stauden am Gehölzrand Exposition/Lichtverhältnisse beurteilen: - sonnig-warmer Gehölzrand (der zur Freifläche vermittelt)
Jetzt mischen wir den Schatten auf: Staudenmischpflanzungen für schattige Standorte Stauden am Gehölzrand Exposition/Lichtverhältnisse beurteilen: - sonnig-warmer Gehölzrand (der zur Freifläche vermittelt)
Satzung der Gemeinde Hochkirch zum Schutz von Bäumen und Gehölzen
 Satzung der Gemeinde Hochkirch zum Schutz von Bäumen und Gehölzen Gemäß 50 Abs. 1 Nr. 4 i.v.m. 22 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege in der Fassung vom 11.10.1994 (SächsGVBl. S. 1601)
Satzung der Gemeinde Hochkirch zum Schutz von Bäumen und Gehölzen Gemäß 50 Abs. 1 Nr. 4 i.v.m. 22 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege in der Fassung vom 11.10.1994 (SächsGVBl. S. 1601)
Chartbericht Jan. - Aug. 2015
 Tourismus-Statistik in Nordrhein-Westfalen Chartbericht Jan. - Aug. 2015 Basis: Vorläufige Ergebnisse von IT.NRW und Destatis Beherbergungsstatistik Jan.-Aug. 2015 BUNDESLÄNDER 2 26.10.2015 Beherbergungsstatistik
Tourismus-Statistik in Nordrhein-Westfalen Chartbericht Jan. - Aug. 2015 Basis: Vorläufige Ergebnisse von IT.NRW und Destatis Beherbergungsstatistik Jan.-Aug. 2015 BUNDESLÄNDER 2 26.10.2015 Beherbergungsstatistik
Untersuchung der Fledermausfauna im Bereich einer ehemaligen Gärtnerei bei Northen (Stadt Gehrden)
 Untersuchung der Fledermausfauna im Bereich einer ehemaligen Gärtnerei bei Northen (Stadt Gehrden) Auftraggeber: Stadt Gehrden Rathaus Kirchstr. 1-3 30989 Gehrden Sterntalerstr. 29a D 31535 Neustadt 05032
Untersuchung der Fledermausfauna im Bereich einer ehemaligen Gärtnerei bei Northen (Stadt Gehrden) Auftraggeber: Stadt Gehrden Rathaus Kirchstr. 1-3 30989 Gehrden Sterntalerstr. 29a D 31535 Neustadt 05032
Gemeindehaus Meiersmaadstrasse Sigriswil 3657 Schwanden. Praxishilfe Neophytenbekämpfung
 Gemeinde Sigriswil Forstbetrieb Sigriswil Gemeindehaus Meiersmaadstrasse 24 3655 Sigriswil 3657 Schwanden Praxishilfe Neophytenbekämpfung Andreas Schweizer Försterpraktikant BZW-Lyss verfasst am 8.8.2013
Gemeinde Sigriswil Forstbetrieb Sigriswil Gemeindehaus Meiersmaadstrasse 24 3655 Sigriswil 3657 Schwanden Praxishilfe Neophytenbekämpfung Andreas Schweizer Försterpraktikant BZW-Lyss verfasst am 8.8.2013
Alternative Methoden
 Praxis naturnaher Gestaltung Grundlagen und Erfahrungen Was zeichnet ein naturnah gestaltetes Gelände aus? Ort zum Leben für uns Menschen: Renate Froese-Genz Fachbetrieb für naturnahe Grünplanung In dem
Praxis naturnaher Gestaltung Grundlagen und Erfahrungen Was zeichnet ein naturnah gestaltetes Gelände aus? Ort zum Leben für uns Menschen: Renate Froese-Genz Fachbetrieb für naturnahe Grünplanung In dem
Material. 3 Akteure im Simulationsspiel
 Akteure im Simulationsspiel Blattläuse vermehren sich schnell und brauchen dazu nicht einmal einen Geschlechtspartner. Bei den meisten Arten wechselt sich eine geschlechtliche Generation (mit Männchen
Akteure im Simulationsspiel Blattläuse vermehren sich schnell und brauchen dazu nicht einmal einen Geschlechtspartner. Bei den meisten Arten wechselt sich eine geschlechtliche Generation (mit Männchen
Die heimischen Ginsterarten
 Die heimischen Ginsterarten HANS WALLAU Die gemeinhin Ginster genannten Arten gehören zwei verschiedenen Gattungen an, doch handelt es sich bei allen in unserem Bereich wildwachsenden Ginsterarten um gelbblühende
Die heimischen Ginsterarten HANS WALLAU Die gemeinhin Ginster genannten Arten gehören zwei verschiedenen Gattungen an, doch handelt es sich bei allen in unserem Bereich wildwachsenden Ginsterarten um gelbblühende
Heinz Sielmann Stiftung und Industrie-und und Handelskammer Braunschweig
 Naturidyll auf dem Firmengelände Wie geht das? - Unternehmerfrühstück in Braunschweig - Vortrag am 26. August 2015 für Heinz Sielmann Stiftung und Industrie-und und Handelskammer Braunschweig Im Rahmen
Naturidyll auf dem Firmengelände Wie geht das? - Unternehmerfrühstück in Braunschweig - Vortrag am 26. August 2015 für Heinz Sielmann Stiftung und Industrie-und und Handelskammer Braunschweig Im Rahmen
Kinderarmut. Factsheet. Nordrhein-Westfalen. Kinder im SGB-II-Bezug
 Factsheet Nordrhein-Westfalen Kinderarmut Kinder im SGB-II-Bezug ABBILDUNG 1 Anteil der Kinder unter 18 Jahren in Familien im SGB-II-Bezug in den Jahren 2011 und 2015 im Vergleich 2011 2015 Saarland Rheinland-
Factsheet Nordrhein-Westfalen Kinderarmut Kinder im SGB-II-Bezug ABBILDUNG 1 Anteil der Kinder unter 18 Jahren in Familien im SGB-II-Bezug in den Jahren 2011 und 2015 im Vergleich 2011 2015 Saarland Rheinland-
Landeskundlich bemerkenswerte Wanzenftxnde (Insecta: Heteroptera) aus den Bundesländern Steiermark, Kärnten und Burgenland (Österreich)
 Mitt, naturwiss. Ver. Steiermark Band 129 S.287-298 Graz 1999 Landeskundlich bemerkenswerte Wanzenftxnde (Insecta: Heteroptera) aus den Bundesländern Steiermark, Kärnten und Burgenland (Österreich) Von
Mitt, naturwiss. Ver. Steiermark Band 129 S.287-298 Graz 1999 Landeskundlich bemerkenswerte Wanzenftxnde (Insecta: Heteroptera) aus den Bundesländern Steiermark, Kärnten und Burgenland (Österreich) Von
Waldschäden durch Luftverunreinigungen
 Waldschäden durch Luftverunreinigungen Neuartige Waldschäden, in den Anfangszeiten auch Waldsterben genannt, bezeichnet Waldschadensbilder in Mittel- und Nordeuropa, die seit Mitte der 1970er Jahre festgestellt
Waldschäden durch Luftverunreinigungen Neuartige Waldschäden, in den Anfangszeiten auch Waldsterben genannt, bezeichnet Waldschadensbilder in Mittel- und Nordeuropa, die seit Mitte der 1970er Jahre festgestellt
2125 Geltende Gesetze und Verordnungen (SGV. NRW.) mit Stand vom
 1 von 7 2125 Geltende Gesetze und Verordnungen (SGV. NRW.) mit Stand vom 23.1.2014 Verordnung zur integrierter Untersuchungsanstalten für Bereiche des Verbraucherschutzes Vom 20. Dezember 2007 (Fn 1, 2)
1 von 7 2125 Geltende Gesetze und Verordnungen (SGV. NRW.) mit Stand vom 23.1.2014 Verordnung zur integrierter Untersuchungsanstalten für Bereiche des Verbraucherschutzes Vom 20. Dezember 2007 (Fn 1, 2)
Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung in Stuttgart und in anderen Großstädten mit 500 000 und mehr Einwohnern 1995 bis 2001
 Kurzberichte Statistik und Informationsmanagement, Monatsheft 12/2003 Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung in Stuttgart und in anderen Großstädten mit 500 000 und mehr Einwohnern 1995 bis 2001
Kurzberichte Statistik und Informationsmanagement, Monatsheft 12/2003 Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung in Stuttgart und in anderen Großstädten mit 500 000 und mehr Einwohnern 1995 bis 2001
Gehaltsatlas 2014 Eine Studie über den Zusammenhang von Regionen und Gehalt
 ein Unternehmen von Gehaltsatlas 0 Eine Studie über den Zusammenhang von Regionen und Gehalt Seite /9 Wie wirken sich geografische Regionen auf das Gehalt aus? Welche regionalen Unterschiede gibt es zwischen
ein Unternehmen von Gehaltsatlas 0 Eine Studie über den Zusammenhang von Regionen und Gehalt Seite /9 Wie wirken sich geografische Regionen auf das Gehalt aus? Welche regionalen Unterschiede gibt es zwischen
Urbanes Grün und Gesundheit
 Urbanes Grün und Gesundheit Ergebnisse einer Befragung von Bewohnern in deutschen Großstädten 5. Juni 2015 q5436/31707 Pl, Ma forsa Politik- und Sozialforschung GmbH Büro Berlin Schreiberhauer Straße 30
Urbanes Grün und Gesundheit Ergebnisse einer Befragung von Bewohnern in deutschen Großstädten 5. Juni 2015 q5436/31707 Pl, Ma forsa Politik- und Sozialforschung GmbH Büro Berlin Schreiberhauer Straße 30
Schmetterlinge in Höfen und Gärten
 Schmetterlinge in Höfen und Gärten Wenn man bedenkt, dass der Flächenanteil unserer Gärten den der Naturschutzgebiete um ein Vielfaches übersteigt, wird klar, dass in unseren Gärten in viel stärkerem Maße
Schmetterlinge in Höfen und Gärten Wenn man bedenkt, dass der Flächenanteil unserer Gärten den der Naturschutzgebiete um ein Vielfaches übersteigt, wird klar, dass in unseren Gärten in viel stärkerem Maße
Natur und Technik. Lernstandserhebung zu den Schwerpunkten Biologie, Naturwissenschaftliches Arbeiten, Informatik. Datum:
 Name: Natur und Technik Lernstandserhebung zu den Schwerpunkten Biologie, Naturwissenschaftliches Arbeiten, Informatik Datum: Klasse: 1 Joseph Priestley, ein englischer Naturforscher, führte im 18. Jahrhundert
Name: Natur und Technik Lernstandserhebung zu den Schwerpunkten Biologie, Naturwissenschaftliches Arbeiten, Informatik Datum: Klasse: 1 Joseph Priestley, ein englischer Naturforscher, führte im 18. Jahrhundert
Explosiv! Wer rettet die Schmetterlinge am Untersberg? Auf den Spuren besonderer Schmetterlinge und Streuwiesen im Salzburger Freilichtmuseum
 Explosiv! Wer rettet die Schmetterlinge am Untersberg? Auf den Spuren besonderer Schmetterlinge und Streuwiesen im Salzburger Freilichtmuseum Unterlagen zum Schülerprogramm Explosiv! Wer rettet die Schmetterlinge
Explosiv! Wer rettet die Schmetterlinge am Untersberg? Auf den Spuren besonderer Schmetterlinge und Streuwiesen im Salzburger Freilichtmuseum Unterlagen zum Schülerprogramm Explosiv! Wer rettet die Schmetterlinge
STANDORTGERECHTE GEHÖLZPFLANZEN Liste aus naturschutzfachlicher Sicht mit naturräumlicher Zuordnung Alle Angaben ohne Gewähr!
 STANDORTGERECHTE GEHÖLZPFLANZEN Liste aus naturschutzfachlicher Sicht mit naturräumlicher Zuordnung Alle Angaben ohne Gewähr! A V B deutscher Name wissenschaftlicher Name Gef. F W X X X Berg-Ahorn Acer
STANDORTGERECHTE GEHÖLZPFLANZEN Liste aus naturschutzfachlicher Sicht mit naturräumlicher Zuordnung Alle Angaben ohne Gewähr! A V B deutscher Name wissenschaftlicher Name Gef. F W X X X Berg-Ahorn Acer
