5 Syntaktische Relationen: Dependenz
|
|
|
- Holger Acker
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Übersicht 5 Syntaktische Relationen: Dependenz 5.1 Dependenzstruktur Eigenschaften der Dependenzstruktur Vergleich Konstituenten- und Dependenzstruktur Typen von Dependenzrelationen Methoden zur Komplement/Adjunkt-Unterscheidung 5.2 Syntaktische Funktionen Grammatische Relationen Grammatische Relationen im UD-Annotationschema Attributfunktion 5.3 Formale Repräsentation - Dependenzgrammatik 5.4 Zusammenfassung
2 5 Syntaktische Relationen: Dependenz 5 Syntaktische Relationen: Dependenz 2
3 5 Syntaktische Relationen: Dependenz 5.1 Dependenzstruktur 5.1 Dependenzstruktur 3
4 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Eigenschaften der Dependenzstruktur Eigenschaften der Dependenzstruktur Ergebnis Konstituentenanalyse (Eliminierungstest): bestimmte Wörter nur mit anderen eliminierbar: unilaterale Abhängigkeit: eine sehr schwierige Aufgabe *eine sehr schwierige Aufgabe (* = ungrammatisch) eine sehr schwierige Aufgabe 4
5 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Eigenschaften der Dependenzstruktur bilaterale Abhängigkeit: Beantworte den Brief *Beantworte den Brief *Beantworte den Brief 5
6 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Eigenschaften der Dependenzstruktur Dependenzrelation < Y, X > = binäre (zweistellige) Relation zwischen zwei Wörtern X und Y, wobei (das Vorkommen oder die Form von) Y von (dem Vorkommen oder der Form von) X abhängt asymetrische Beziehung: wenn Y abhängig von X ist, dann ist X nicht abhängig von Y kontrolliert X Y abhängig von 6
7 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Eigenschaften der Dependenzstruktur Kontrolle als umgekehrte Dependenzrelation < X, Y >: X regiert Y (X ist Regens) Darstellung Kontrollrelation mit Pfeilen (gerichteter Graph) oder implizit durch vertikale Anordnung X X Y Z Y Z 7
8 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Eigenschaften der Dependenzstruktur Relation der unmittelbaren und der mittelbaren Abhängigkeit: X Y Z unmittelbar abh. mittelbar abh. zum Vergleich: XP Kopf Kopf Dependens Dependens Dependens Dependens Abbildung 1: Konstituenten- und Dependenzstrukturschema 8
9 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Eigenschaften der Dependenzstruktur Dependenzstruktur Dependenzstruktur: Menge der durch die Relation der Dependenz/Kontrolle verbundenen lexikalischen Einheiten (Wörter; ggf. auch Stämme und Affixe) direkte Untersuchung der hierarchischen Beziehungen der Einheiten im Satz (wie ihr Vorkommen und ihre Form voneinander abhängen) Verb als Wurzelknoten des Satzes, von dem alle anderen Knoten unmittelbar oder mittelbar abhängen 9
10 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Eigenschaften der Dependenzstruktur in einer Phrase: Kopf kontrolliert Dependenten; Dependenten hängen von Kopf ab ein Wort kann nur von einem anderen Wort abhängen: nur 1 Kopf pro Dependent! (aber mehrere Dependenten pro Kopf) jagt Hund Katze in der kleine die Park dem Abbildung 2: Einfacher Dependenzbaum (auch: Stemma) 10
11 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Eigenschaften der Dependenzstruktur jagt Hund Katze in der klein die Park dem der kleine Hund jagt die Katze in dem Park Abbildung 3: Dependenzbaum mit Berücksichtigung der linearen Ordnung: Linksversetzung markiert Vorgänger-Relation; gestrichelt = Projektionslinien, von 2-dim Depstr auf 1-dim Wortfolge 11
12 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Eigenschaften der Dependenzstruktur V N N P DET ADJ DET N DET der kleine Hund jagt die Katze in dem Park Abbildung 4: Dependenzbaum mit Wortartenangaben 12
13 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Eigenschaften der Dependenzstruktur S NP VP DET ADJ N V NP PP DET N P NP DET N Der kleine Hund jagt die Katze in dem Park Abbildung 5: zum Vergleich: Konstituentenstruktur 13
14 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Vergleich Konstituenten- und Dependenzstruktur Vergleich Konstituenten- und Dependenzstruktur XP X X Y Z Y Z Abbildung 6: Konstituenten- und Dependenzstrukturschema 14
15 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Vergleich Konstituenten- und Dependenzstruktur Übersicht Dependenzstruktur: Elemente der Struktur (Knoten) Wörter Relationen der Struktur (Kanten) Dependenzrelationen (z. B. Subjekt, Objekt) syntaktische Kategorien gerichtete Kanten = Dependenzrelationen Kategorientyp funktional / relational Strukturinformationen in Kanten des Syntaxbaums (funktionale Kategorien) 15
16 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Vergleich Konstituenten- und Dependenzstruktur Konstituentenstruktur = Phrasenstrukturgrammatik Analyse des Aufbaus der Satzstruktur durch Zergliederung in Konstituenten Zusammensetzung von Wörtern zu syntaktischen Einheiten Subjekt-Prädikat-Grundstruktur Strukturinformation in Knoten (Kategorien des strukturellen Aufbaus) phrasale Knoten 16
17 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Vergleich Konstituenten- und Dependenzstruktur Dependenzstruktur = relationale Wortgrammatik Analyse Satzstruktur 'von innen heraus' (vom Verb ausgehend) Beziehung zwischen Wörtern Subjekt und Objekt gleichrangige Argumente des Verbs (beide valenzgefordert) Strukturinformation in Kanten (relationale Kategorien) keine phrasalen Knoten, flachere Struktur als PSG 17
18 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Vergleich Konstituenten- und Dependenzstruktur Abbildung 7: Geordneter Dependenzbaum - Konstituentenbaum (von Tjo3ya - eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, 18
19 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Vergleich Konstituenten- und Dependenzstruktur Dependenz in Konstituentenstruktur implizite Dependenzanalyse in Phrasenkategorien durch Kopf-Prinzip (X-Phrase) Phrasenkopf ist Regens aller anderen Schwesterknoten in X-Bar-Theorie: Ergänzung und Angabe als Komplement und Adjunkt über Strukturposition definiert Konstituenten in Dependenzstruktur implizite Konstituentenanalyse: Teilbäume als Konstituenten (aber nicht alle Konstituenten repräsentiert: VP) 19
20 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Vergleich Konstituenten- und Dependenzstruktur Transformation Konstituenten- in Dependenzstruktur S (jagt) NP (Hund) VP (jagt) DET (der) ADJ (kleine) N (Hund) V (jagt) NP (Katze) PP (auf) DET (eine) ADJ (große) N (Katze) P (auf) NP (Straße) DET (der) N (Straße) der kleine Hund jagt eine große Katze auf der Straße Abbildung 8: Phrasenstruktur mit Kopfannotation 20
21 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Vergleich Konstituenten- und Dependenzstruktur DET ADJ N N P DET ADJ N DET Der kleine Hund jagt eine große Katze auf der Straße Abbildung 9: aus Phrasenstruktur mit Kopfannotation abgeleitete Dependenzstruktur alle Ko-Konstituenten des Phrasenkopfes sind seine Dependenten Label der Dependenzrelation: Wortart des Nicht-Kopfes 21
22 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Typen von Dependenzrelationen Typen von Dependenzrelationen Typ 1: Rektion Dependent ist Komplement bilaterale Dependenz: Kopf kann nicht ohne Dependent auftreten Typ 2: Modifikation Dependent ist Adjunkt oder Attribut unilaterale Dependenz: Kopf kann ohne Dependent auftreten regiert X (Kopf) modifiziert Y (Komplement) Z (Modifikator) 22
23 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Typen von Dependenzrelationen Komplement (auch: Ergänzung / Aktant) Vorkommen und Form des Dependents vom Kopf gefordert valenzgebundener Dependent (obligatorisch) Leerstelle (Bühler) beim Kopf (insbes. beim Verb), die mit bestimmter Konstituente in bestimmter Form zu füllen ist Anzahl der Leerstellen = Valenz, Subkategorisierungsrahmen, Argumentstruktur weiter Komplementbegriff: enthält auch Subjekt 23
24 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Typen von Dependenzrelationen Modifikator Vorkommen und Form des Dependents NICHT vom Kopf gefordert nicht-valenzgebundener Dependent (optional) Leerstellen beim Dependent, mit der er sich an einen Kopf bestimmten Typs andocken kann (Ergebnis ist ein Syntagma gleichen Typs wie der Kopf) Adjunkt als verbaler Modifikator(auch: Angabe/ Zirkumstant) Attribut als nominaler Modifikator eingeschränkter Adjunkt-Begriff gegenüber X-Bar-Theorie! 24
25 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Typen von Dependenzrelationen V comp comp adjunct N N P mod mod mod comp DET ADJ DET N mod DET der kleine Hund jagt die Katze in dem Park Abbildung 10: Dependenzbaum mit Differenzierung von Komplementen, Adjunkten und nominalen Modifikatoren 25
26 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Typen von Dependenzrelationen mod mod comp ROOT adjunct comp mod comp mod Der kleine Hund jagt die Katze in dem Park Abbildung 11: Alternative Darstellung ('Dependenz-Blume') KOMPLEMENT 1 ADJUNKT KOMPLEMENT 2 Der kleine Hund jagt die Katze in dem Park ATTRIBUT Abbildung 12: Analyse von grundlegenden Dependenzfunktionen 26
27 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Methoden zur Komplement/Adjunkt-Unterscheidung Methoden zur Komplement/Adjunkt- Unterscheidung 27
28 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Methoden zur Komplement/Adjunkt-Unterscheidung Eliminierungstest Eliminierung der Konstituente (Feststellung ihrer Notwendigkeit). Wenn Grammatikalität erhalten: Angabe/Adjunkt, sonst: Ergänzung/Komplement Er beantwortete einen Brief im Arbeitszimmer. Er beantwortete einen Brief im Arbeitszimmer. (Adjunkt) *Er beantwortete einen Brief im Arbeitszimmer. (Komplement) 28
29 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Methoden zur Komplement/Adjunkt-Unterscheidung Adverbialsatz-Test Auslagerung der Konstituente in einen Adverbialsatz (funktioniert nicht bei Zeitangaben). Wenn Grammatikalität erhalten: Angabe/Adjunkt, sonst: Ergänzung/Komplement Er wartete im Park auf die Katze. Er wartete auf die Katze, als er im Park war. (Adjunkt) *Er wartete im Park, als er auf die Katze war. (Komplement) 29
30 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Methoden zur Komplement/Adjunkt-Unterscheidung geschehen-test Auslagerung der Konstituente in einen Satz mit dem Verb geschehen. Wenn Grammatikalität erhalten: Angabe/Adjunkt, sonst: Ergänzung/Komplement Er wartete im Park auf die Katze. Er wartete auf die Katze, und das geschah im Park. (Adjunkt) *Er wartete im Park, und das geschah auf die Katze. (Komplement) 30
31 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Methoden zur Komplement/Adjunkt-Unterscheidung Obligatorische, fakultative und optionale Dependenten Obligatorischer Dependent = Komplement (valenzgefordert): *Er beantwortet einen Brief Fakultativer Dependent = Komplement, aber kontextabhängig eliminierbar: Er schreibt einen Brief Ellipse eines an sich obligatorischen Dependenten oder Annahme von zwei Valenzrahmen 31
32 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Methoden zur Komplement/Adjunkt-Unterscheidung Optionaler Dependent = Adjunkt (immer eliminierbar): Er schreibt den ganzen Tag Differenzierung fakultativer von optionalen Dependenten: beide: eliminierbar Differenzierung über geschehen-test: *Er schreibt, und es geschieht einen Brief (fakultativ) Er schreibt, und es geschieht den ganzen Tag (optional) 32
33 5 Syntaktische Relationen: Dependenz 5.2 Syntaktische Funktionen 5.2 Syntaktische Funktionen Dependenzrelationen zwischen Wörtern können zu Klassen von Relationen zwischen lexikalischen und syntaktischen Klassen/Kategorien zusammengefasst werden (Relationale Kategorien) Differenzierung der Relationen zwischen abhängigen Elementen nach syntaktischem Verhalten im Satz (Syntaktische Funktion) 33
34 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Grammatische Relationen Grammatische Relationen Relationen zwischen Prädikat und seinen Dependenten (Komplemente + Adjunkte) Kategorisierung dieser Relationen über morphosyntaktische Kriterien, z. B. über Passivierbarkeit, Relativierbarkeit, Agreement Feststellung von Klassen sich morphosyntaktisch in Relation zum Verb gleich verhaltender Argumente (in gleicher syntaktischer Funktion) 34
35 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Grammatische Relationen z. B.: in Subjektfunktion zum Verb stehen Argumente, die mit dem Verb kongruieren, sowie prototypisch unmarkiert sind, in Akkusativsprachen: Nominativ Element x erfüllt Funktion als Subjekt des Verbes y: subj(x,y) Hierarchie dieser syntaktischen Funktionsklassen: wenn eine Funktion an einer syntakt. Konstruktion (z. B. Relativierbarkeit) teilnimmt, dann auch alle höheren(sprachspezifisch!) Subjekt > Direktes Objekt > Indir. Objekt > Adverbiale Feststellung von Kern- und peripheren Argumenten (Core/- Oblique-Unterscheidung) 35
36 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Grammatische Relationen Komplement-Adjunkt-Unterscheidung verläuft quer zu dieser Kategorisierung der syntaktischen Funktionen: Kernargumente sind i. A. Verbkomplemente (valenzgefordert), periphere Argumente Adjunkte aber auch periphere Argumente (Adverbiale) können valenzgefordert sein: die Blumen ins Wasser stellen; nach Hause fahren und es gibt auch Kernargumente, die keine Komplemente sind z.b. Expletiv-Konstruktion'es regnet': valenzsemantisch 0-wertig, aber: syntaktisch hat es die Funktion eines Subjekts 36
37 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Grammatische Relationen Prädikat Kopf des Satzes (Wurzelknoten) semantisch: auf Subjekt bezogener Zustand, Vorgang, Tätigkeit, Handlung formale Realisierung: Verb oder Verbkomplex (Aux + V; Cop + Prädikativ=Nomen oder Adjektiv) enger Prädikatbegriff im Gegensatz zum weiten Prädikatbegriff der Generativen Grammatik (Prädikat als Satzaussage über Subjekt, also Verb + Komplemente) Kongruenz mit Subjekt (in Akkusativsprachen) 37
38 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Grammatische Relationen Verben haben unterschiedliche Anzahl an Kernargumenten: intransitive Verben: haben 1 Kernargument transitive Verben: haben 2 Kernargumente ditransitive Verben: haben 3 Kernargumente 38
39 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Grammatische Relationen Subjekt (nsubj / csubj) Funktion als das Kernargument eines intransitiven Verbs Funktion als Agens-Kernargument eines transitiven Verbs topologisches Kriterium: typische Wortstellung im Deutschen: Subjekt im Mittelfeld vor dem Objekt Kongruenz mit Verb (in Akkusativsprachen) 39
40 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Grammatische Relationen kann in bestimmten Konstruktionen optional gelöscht werden (z. B. Koordination: ich kam, sah und siegte; *ich sah ihn, ich besiegte ihn) vgl. Pro-Drop-Sprachen, z. B. ital. piove 'es regnet'; Kodierung Subjekt über Agreement reicht aus dagegen im Deutschen: Subjektposition muss besetzt sein: Expletiv als semantisch leeres (nicht-referentielles) Element: es regnet 40
41 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Grammatische Relationen morphologisch (in Akkusativsprachen) prototypisch kodiert mit Nominativkasus unmarkierter Kasus, nominale 'Grundform', auch in freier Verwendung als Zitierform/Anrede prototypische semantische Rolle (im transitiven Satz): Agens (Ausgangspunkt des Geschehens) prototypische pragmatische Rolle: Topic (Satzgegenstand) (worüber der Satz etwas aussagt) 41
42 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Grammatische Relationen (Direktes) Objekt (obj / ccomp) Funktion als Patiens-Kernargument eines transitiven Verbs Passivierbarkeit (wird zum Subjekt-Argument des Passivsatzes), Relativierbarkeit (Dt.) syntaktisch: steht in Verbnähe morphologisch (in Akkusativsprachen) prototypisch kodiert durch Akkusativ (Objektkasus), im Deutschen bei einigen Verben auch Genitiv/Dativ oder präpositional (Präpositionalobjekt) prototypische semantische Rolle: Patiens / Theme (vom Geschehen betroffene Entität) 42
43 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Grammatische Relationen Indirektes Objekt (iobj) Funktion als Recipient-Argument eines ditransitiven Verbs Relativierbarkeit (Dt.), keine Passivierbarkeit syntaktisch: verbferner als direktes Objekt Test über Topikalisierung Konstituente mit Verb:*seinem Freund gegeben hat er ein Buch morphologisch kodiert durch Dativ oder verwandten Kasus oder präpositional: ich bringe es zu dir 43
44 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Grammatische Relationen prototypische semantische Rolle: Recipient / Goal (worauf das Geschehen mittelbar gerichtet ist) 44
45 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Grammatische Relationen Adverbial (obl / advmod / advcl) Funktion als lokale/zeitliche/kausale/modale Bestimmung zum Verb keine Passivierbarkeit, keine Verbkongruenz 45
46 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Grammatische Relationen morphologische Kodierung: präpositional (präpositionales Adverbial) durch obliquen Kasus (Kasusadverbial) im Dt. Akkusativ und Genitiv als obliquer Kasus: Dieser Tage kommt er; Er ging den ganzen Tag in anderen Sprachen (z. B. finno-ugrischer Sprachfamilie): Vielzahl an Lokalkasus (Lokativ, Adessiv, Translativ, Ablativ) prototypische semantische Rolle: Location, Direction, Source, Time, Instrument, Manner, Purpose, Cause (Bestimmungen der Umstände des Geschehens) 46
47 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Grammatische Relationen Komplement vs. Adjunkt beim Adverbial (obl) alle optionalen verbalen Angaben = Adjunkte: haben adverbiale Funktion Element in adverbialer Funktion kann aber auch vom Verb gefordert sein (adverbiales Komplement/Ergänzung) Satz wird ungrammatisch beim Weglassen: *Er stellt die Blumen ins Wasser bei fakultativen adverbialen Ergänzungen: Geschehenstest: *Er fährt nach München, und es geschieht nach München. 47
48 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Grammatische Relationen aber: Valenz schwierig zu operationalisieren: (*?) Ich habe das Brot mit dem Messer geschnitten (Instrument Teil des Valenzrahmens?) in Analyse syntaktischer Funktion: Unterscheidung von obligatorischem und optionalem Adverbial nicht notwendig, vgl. Universal Dependencies: overview/syntax.html#avoiding-an-argumentadjunct-distinction 48
49 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Grammatische Relationen Differenzierung Präpositionalobjekt (obj+case) - Adverbial (obl+case): aber: Abgrenzung zwischen Präpositionalobjekt und präpositionalem Adverbial Präpositionalobjekt: gebildet mit semantisch leerer Präpos. valenzgefordert: *er glaubt nur an sich verhält sich syntaktisch ähnlich wie Objekte (Präposition als Kasusmarker) Präpositionalobjekt ersetzbar durch Pronominaladverb mit Nebensatz (Komplementsatz): er glaubt daran, dass...; er wartet darauf, dass... Inhalt erfragbar mit Objektpronomen: worauf wartete er? 49
50 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Grammatische Relationen Differenzierung Kasusobjekt (obj) - Kasusadverbial (obl): beim Kasusobjekt wird (im Gegensatz zum Kasusadverbial) der Kasus vom Verb regiert: er gedachte der schönen Tage vs. Er lief den ganzen Tag Kasusobjekt erfragbar mit Objektpronomen: wessen gedachte er?; *wen lief er? Kasusobjekt nicht erweiterbar mit Objekt in gleichem Kasus: *Er gedachte der schönen Tage der dunklen Nächte Kasusadverbial nicht passivierbar(promotion zum Subjekt):*Der ganze Tag wird gelaufen. 50
51 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Grammatische Relationen Realisierung von Grammatischen Relationen Subjekt: NP (nsubj), Expletiv (expl), Komplementsatz (csubj) direktes Objekt: NP (obj), Komplementsatz (ccomp) indirektes Objekt: NP (iobj) Adverbial: NP (obl), PP (obl+case), ADVP (advmod), Adverbialsatz (advcl) 51
52 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Grammatische Relationen Morphologische Kodierung von Grammatischen Relationen Agreement: Markierung der syntaktischen Funktion eines oder mehrerer Kernargumente (mono-/double-agreement usw., entsprechend der GR-Hierarchie: Subjekt, Objekt, usw.) durch Spiegelung von grammatischen Merkmalen des Dependents am Kopf (head-marking) Kasus: Markierung der syntaktischen Funktion durch grammatische Marker am Dependent (dependent-marking) entweder: von Verbvalenz geforderter Kasus bei Komplement oder: je nach Semantik des adverbialen Adjunkts 52
53 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Grammatische Relationen Präposition: ähnlich wie Kasus: Element zur Markierung syntaktischer Funktion Zwei Analysekonventionen für Präposition (bilaterale Dependenz!): 1. Präposition als Kopf (der Kasus des Nomens regiert), Nomen als Dependent (pobj) 2. Nomen(Inhaltswort) als Kopf, Präposition als Kasus-Marker (Funktionswort, das Kopf modifiziert, so dass es anschlussfähig wird) hier: 2. Variante (vgl. UD: 'primacy of content words'), Präposition als obliquer Kasusmarker (case) 53
54 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Grammatische Relationen V nsubj obj obl N N N mod mod mod case mod DET ADJ DET P DET der kleine Hund jagt die Katze in dem Park Abbildung 13: Dependenzbaum mit Grammatischen Relationen 54
55 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Grammatische Relationen V nsubj obj prep N N P mod mod mod pobj DET ADJ DET N mod DET der kleine Hund jagt die Katze in dem Park Abbildung 14: Dependenzbaum mit Grammatischen Relationen mit alternativer PP-Analyse (Stanford Dependencieshttps://nlp.stanford.edu/software/ dependencies_manual.pdf (prep = prepositional modifier) 55
56 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Grammatische Relationen obl mod mod nsubj ROOT obj mod case mod Der kleine Hund jagt die Katze in dem Park Abbildung 15: Präposition als Kasusmarker mod mod nsubj ROOT prep obj mod pobj mod Der kleine Hund jagt die Katze in dem Park Abbildung 16: Präposition als direkter Dependent zum Verb 56
57 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Grammatische Relationen Syntaktische Funktionen von Präpositionalphrasen verbales Adjunkt = obliques Objekt (obl) verbales Komplement = (Präpositional-)Objekt (obj) nominales Attribut = Präpositionalattribut (nmod, s. u. ) Frage PP-Attachment-Ambiguität: ist PP Attribut (nominaler Dependent) oder Adjunkt (verbaler Dependent)? 57
58 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Grammatische Relationen obl nsubj root obj case nmod case case Der Hund wartet auf die Katze im Fenster auf der Straße Komplement Attribut Adjunkt Abbildung 17: Dependenzbaum mit PP-Attribut, -Komplement und -Adjunkt 58
59 5 Syntaktische Relationen: Dependenz5.2.2 Grammatische Relationen im UD-Annotationschema Grammatische Relationen im UD-Annotationschema verschiedene lexikalische und syntaktische Einheiten realisieren gleiche Funktion in UD-Labels: aufgenommen, durch welche Formklasse die Funktion realisiert wird Kombination aus Wortart und Funktionslabel ('mixed-functional-structural') 59
60 5 Syntaktische Relationen: Dependenz5.2.2 Grammatische Relationen im UD-Annotationschema nominal subject (nsubj): dep/nsubj.html nsubj nsubj Ich AGENS laufe Das Eis schmilzt PATIENS expletive (expl): html expl es regnet semantisch leer 60
61 5 Syntaktische Relationen: Dependenz5.2.2 Grammatische Relationen im UD-Annotationschema object (obj): obj nsubj Die Sonne erwärmt den See AGENS PATIENS obj nsubj Der schönen Tage erinnert er sich gerne obj THEME EXPERIENCER nsubj case Er denkt nur an sich (Präpositionalobjekt) 61
62 5 Syntaktische Relationen: Dependenz5.2.2 Grammatische Relationen im UD-Annotationschema indirect object (iobj): iobj.html obj nsubj iobj Er gibt seinem Freund das Buch AGENS RECIPIENT PATIENS 62
63 5 Syntaktische Relationen: Dependenz5.2.2 Grammatische Relationen im UD-Annotationschema oblique nominal (obl): obl.html obl obl nsubj case Er läuft im Park obj nsubj case Er stellt die Blumen ins Wasser LOCATIVE (adverbiales Komplement) obl obl nsubj Eines Tages kam er TEMP (Kasusadverbial) nsubj Er schreibt den ganzen Tag TEMP (Kasusadverbial) 63
64 5 Syntaktische Relationen: Dependenz5.2.2 Grammatische Relationen im UD-Annotationschema case marking (case): case.html case im Sommer adverbial modifier (advmod): u/dep/advmod.html advmod Er erinnert sich gerne MODAL 64
65 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Attributfunktion Attributfunktion 65
66 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Attributfunktion Attribut = nominaler Dependent semantisch: prädikative Näherbestimmung (Modifikation) vs. nicht-prädikative Relation (Genitiv-Komplement, analog zu Verb: Das Bellen des Hundes) aber: nominale Dependenten sind nie obligatorisch (vom Nomen zwingend gefordert, in Valenz angelegt) 66
67 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Attributfunktion weiter Attributbegriff: umfasst auch nominale Komplimente syntaktischer Modifikationsbegriff (s. o.) keine Komplement-Adjunkt-Differenzierung wie in X-Bar analog zu Adverbialen oben: keine Differenzierung zwischen valenzgebundenen und nicht-valenzgebundenen Attributen ein attributives Element bildet mit Nomen/NP endozentrisch eine erweiterte NP syntaktische Kategorie des Syntagmas bleibt bestehen(nomen bleibt Kopf) rekursiv wiederholbar (wie mit Adjunkten beim Verb) 67
68 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Attributfunktion realisiert als Adjektiv-/Partizipial-Attribut (amod), Präpositional- /Genitiv-Attribut (nmod), Apposition (appos), Determinativ (det) oder Attributsatz (acl) im Folgenden: Typen von Attributen aus UD Tagset (Universal Dependencies, v2) determiner (det): html det der Hund 68
69 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Attributfunktion adjectival modifier (amod): u/dep/amod.html amod rotes Auto 69
70 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Attributfunktion nominal modifier (nmod): dep/nmod.html nmod:poss case nmod case Hund des Lehrers Hund vom Lehrer nmod case Hund im Park 70
71 5 Syntaktische Relationen: Dependenz Attributfunktion appositional modifier (appos): u/dep/appos.html appos Brutus, mein Hund 71
72 5 Syntaktische Relationen: Dependenz 5.3 Formale Repräsentation - Dependenzgrammatik 5.3 Formale Repräsentation - Dependenzgrammatik 72
73 5 Syntaktische Relationen: Dependenz 5.3 Formale Repräsentation - Dependenzgrammatik formale Eigenschaften der Dependenzstruktur gerichteter Graph als Repräsentationsformalismus: G =< M, R > M: Elementmenge = Knoten (hier: Wörter) R: Relation zwischen Elementen von M = Menge geordneter Paare = gerichtete Kanten (directed edges /arcs) (hier: Abhängigkeitsrelation) Dependenzstruktur hat genau einen Wurzelknoten (ROOT; hängt von nichts ab) ein Wort kann mehrere Dependenten haben 73
74 5 Syntaktische Relationen: Dependenz 5.3 Formale Repräsentation - Dependenzgrammatik ein Wort kann nur von von einem Wort abhängen (und nicht von sich selbst) Kanten können markiert (gelabelt) oder unmarkiert sein Begriffe: Mutterknoten (X von Y, Z), Tochterknoten (Y, Z von X), Schwesterknoten (Y von Z und umgekehrt) X Y Z 74
75 5 Syntaktische Relationen: Dependenz 5.3 Formale Repräsentation - Dependenzgrammatik 2 (jagt) nsubj dobj 1 (Hund) 3 (Katze) Abbildung 18: Gerichteter Graph mit gelabelten Kanten 75
76 5 Syntaktische Relationen: Dependenz 5.3 Formale Repräsentation - Dependenzgrammatik Modellierung Dependenzstruktur mit formaler Grammatik Wortgrammatik Transformation Konstituenten- in Dependenzstrukturen möglich über head-finding-rules und Regeln für das Labeln der Relationen 76
77 5 Syntaktische Relationen: Dependenz 5.3 Formale Repräsentation - Dependenzgrammatik Auflistung 1: NLTK: Dependenzgrammatik 1 import nltk 2 3 grammar = nltk. DependencyGrammar. fromstring(""" 4 'gibt' 'Mann' 'Frau' 'Buch' 5 ' schenkt ' 'Mann ' 'Frau' 'Buch' 6 'Mann' 'der' 7 'Frau' 'der' 'die' 8 'Buch' 'das' 9 """) sent = 'der Mann schenkt der Frau das Buch'.split () parser = nltk. ProjectiveDependencyParser ( grammar) 77
78 5 Syntaktische Relationen: Dependenz 5.3 Formale Repräsentation - Dependenzgrammatik for parse in parser. parse( sent): 16 tree = parse print(tree) 19 #( schenkt (Mann der) (Frau der) (Buch das)) 20 # Format: Tree - Objekt (nicht: depency graph..) tree. pretty_print () 23 schenkt Mann Frau Buch der der das 78
79 5 Syntaktische Relationen: Dependenz 5.4 Zusammenfassung 5.4 Zusammenfassung Dependenzstruktur Untersuchung von Abhängigkeiten im Satz(zwischen dem Vorkommen und der Form von Wörtern) Dependenzrelation: binäre asymetrische Relation zwischen Wörtern (Kopf und Dependent) 2 Typen von Abhängigkeiten: Rektion (bilaterale Abhängigkeit): Komplemente Modifikation (unilaterale Abhängigkeit): Modifikatoren Valenzgrammatik: Untersuchung ausgehend vom Verb 79
80 5 Syntaktische Relationen: Dependenz 5.4 Zusammenfassung Komplement (valenzgrammatisch: Ergänzung / Aktant) obligatorischer Dependent (gefordert vom Kopf) aber: kann fakultativ sein Modifikator optionaler Dependent hängt ab von Kopf, aber wird nicht vom Kopf gefordert verbal: Adjunkt (valenzgrammatisch: Angabe / Zirkumstant) nominal: Attribut 80
81 5 Syntaktische Relationen: Dependenz 5.4 Zusammenfassung Dependenzrelationen als syntaktische Funktionen Kategorisierung der Dependenzrelationen nach syntaktischem Verhalten der Dependenten Feststellung der syntaktischen Funktion einer Einheit, die sie in Bezug auf ihren Kopf einnimmt Grammatische Relationen syntaktische Funktion verbaler Dependenten Subjekt: Kernargument intransitiver Satz, Kongruenz mit Verb Objekt: passivierbares Patiens-Argument transitiver Satz indirektes Objekt: Recipient-Argument ditransitiver Satz Adverbial: nicht-zentrales, peripheres Argument 81
82 5 Syntaktische Relationen: Dependenz 5.4 Zusammenfassung Attributfunktionen Syntaktische Funktion nominaler Modifikatoren Adjektiv-/Partizipial-Atribut, Präpositional-/Genitiv-Attribut, Apposition, Determinativ, Attributsatz Dependenzgrammatik formale Repräsentation als gerichteter Graph Wortgrammatik Strukturinformation in den Kanten (Relationen) Transformation Konstituenten- in Dependenzstruktur möglich Hauptvorteil gegenüber PSGs: Grammatische Funktionen direkt kodiert 82
Syntax natürlicher Sprachen
 Syntax natürlicher Sprachen 05: Dependenz und Valenz Martin Schmitt Ludwig-Maximilians-Universität München 22.11.2017 Martin Schmitt (LMU) Syntax natürlicher Sprachen 22.11.2017 1 Themen der heutigen Übung
Syntax natürlicher Sprachen 05: Dependenz und Valenz Martin Schmitt Ludwig-Maximilians-Universität München 22.11.2017 Martin Schmitt (LMU) Syntax natürlicher Sprachen 22.11.2017 1 Themen der heutigen Übung
Ivana Daskalovska. Willkommen zur Übung Einführung in die Computerlinguistik. Syntax. Sarah Bosch,
 Ivana Daskalovska Willkommen zur Übung Einführung in die Computerlinguistik Syntax Wiederholung Aufgabe 1 Was ist Syntax und womit beschäftigt sie sich? 3 Aufgabe 1 Was ist Syntax und womit beschäftigt
Ivana Daskalovska Willkommen zur Übung Einführung in die Computerlinguistik Syntax Wiederholung Aufgabe 1 Was ist Syntax und womit beschäftigt sie sich? 3 Aufgabe 1 Was ist Syntax und womit beschäftigt
Syntax und Morphologie
 Syntax und Morphologie Einführungskurs 8. Vorlesung Strukturanalyse Aufgabe der syntaktisch-funktionalen Analyse ist es, alle Informationen bereitzustellen, die es der semantischen Analyse ermöglichen,
Syntax und Morphologie Einführungskurs 8. Vorlesung Strukturanalyse Aufgabe der syntaktisch-funktionalen Analyse ist es, alle Informationen bereitzustellen, die es der semantischen Analyse ermöglichen,
Einführung in die Sprachwissenschaft des Deutschen Syntax IV. PD Dr. Alexandra Zepter
 Einführung in die Sprachwissenschaft des Deutschen Syntax IV PD Dr. Alexandra Zepter Überblick Syntax 1. Fokus auf linearer Ordnung: Sprachtypen, Topologisches Feldermodell 2. Fokus auf hierarchischer
Einführung in die Sprachwissenschaft des Deutschen Syntax IV PD Dr. Alexandra Zepter Überblick Syntax 1. Fokus auf linearer Ordnung: Sprachtypen, Topologisches Feldermodell 2. Fokus auf hierarchischer
Einführung in die Sprachwissenschaft des Deutschen. Syntax IV. PD Dr. Alexandra Zepter
 Einführung in die Sprachwissenschaft des Deutschen Syntax IV PD Dr. Alexandra Zepter Überblick Syntax Fokus auf linearer Ordnung: Sprachtypen, Topologisches Feldermodell Fokus auf hierarchischer Ordnung:
Einführung in die Sprachwissenschaft des Deutschen Syntax IV PD Dr. Alexandra Zepter Überblick Syntax Fokus auf linearer Ordnung: Sprachtypen, Topologisches Feldermodell Fokus auf hierarchischer Ordnung:
Syntax. Ending Khoerudin Deutschabteilung FPBS UPI
 Syntax Ending Khoerudin Deutschabteilung FPBS UPI Traditionale Syntaxanalyse Was ist ein Satz? Syntax: ein System von Regeln, nach denen aus einem Grundinventar kleinerer Einheiten (Wörter und Wortgruppen)
Syntax Ending Khoerudin Deutschabteilung FPBS UPI Traditionale Syntaxanalyse Was ist ein Satz? Syntax: ein System von Regeln, nach denen aus einem Grundinventar kleinerer Einheiten (Wörter und Wortgruppen)
Zur Struktur der Verbalphrase
 Zur Struktur der Verbalphrase Ein formales Kriterium zur Verbklassifikation: V ist ein intransitives Verb (ohne Objekte) schlafen, arbeiten, tanzen,... (1) Klaus-Jürgen schläft. V ist ein transitives Verb
Zur Struktur der Verbalphrase Ein formales Kriterium zur Verbklassifikation: V ist ein intransitives Verb (ohne Objekte) schlafen, arbeiten, tanzen,... (1) Klaus-Jürgen schläft. V ist ein transitives Verb
Teil II: Phrasen und Phrasenstruktur
 Teil II: Phrasen und Phrasenstruktur Übersicht: Grammatische Funktionen Kategorien Konstituenten & Strukturbäume Konstituententest Endozentrizität 1 Einfacher Satzbau Drei allgemeine Grundfragen der Syntax:
Teil II: Phrasen und Phrasenstruktur Übersicht: Grammatische Funktionen Kategorien Konstituenten & Strukturbäume Konstituententest Endozentrizität 1 Einfacher Satzbau Drei allgemeine Grundfragen der Syntax:
4 Syntaktische Relationen: Konstituenz
 Übersicht 4 Syntaktische Relationen: Konstituenz 4.1 Konstituentenstruktur 4.1.1 Eigenschaften der Konstituentenstruktur 4.1.2 Konstituentenstruktur des Deutschen 4.2 Modellierung mit kontextfreier Grammatik
Übersicht 4 Syntaktische Relationen: Konstituenz 4.1 Konstituentenstruktur 4.1.1 Eigenschaften der Konstituentenstruktur 4.1.2 Konstituentenstruktur des Deutschen 4.2 Modellierung mit kontextfreier Grammatik
Funktionale-Grammatik
 Lexikalisch-Funktionale Funktionale-Grammatik Architektur der LFG K-Strukturen F-Strukturen Grammatische Funktionen Lexikon Prädikat-Argument-Strukturen Lexikonregeln Basiskomponente PS Regeln Lexikon
Lexikalisch-Funktionale Funktionale-Grammatik Architektur der LFG K-Strukturen F-Strukturen Grammatische Funktionen Lexikon Prädikat-Argument-Strukturen Lexikonregeln Basiskomponente PS Regeln Lexikon
Einführung in die Computerlinguistik Syntaktische Funktionen & Dependenzen
 Einführung in die Computerlinguistik Syntaktische Funktionen & Dependenzen Hinrich Schütze Center for Information and Language Processing 2018-10-29 Schütze: Syntaktische Funktionen & Dependenzen 1 / 56
Einführung in die Computerlinguistik Syntaktische Funktionen & Dependenzen Hinrich Schütze Center for Information and Language Processing 2018-10-29 Schütze: Syntaktische Funktionen & Dependenzen 1 / 56
a) Erklären Sie, was eine SOV Sprache ist und was eine V2 Sprache ist. b) Welche Wortstellungsmuster sind eher selten in Sprachen der Welt?
 Syntax 1) Wortstellung a) Erklären Sie, was eine SOV Sprache ist und was eine V2 Sprache ist. Unter SOV Sprachen verstehen wir all jene Sprachen, die als Grundwortstellung die Reihenfolge Subjekt (S) Objekt
Syntax 1) Wortstellung a) Erklären Sie, was eine SOV Sprache ist und was eine V2 Sprache ist. Unter SOV Sprachen verstehen wir all jene Sprachen, die als Grundwortstellung die Reihenfolge Subjekt (S) Objekt
Einführung in die Computerlinguistik
 Einführung in die Computerlinguistik Syntax II WS 2011/2012 Manfred Pinkal Geschachtelte Strukturen in natürlicher Sprache [ der an computerlinguistischen Fragestellungen interessierte Student im ersten
Einführung in die Computerlinguistik Syntax II WS 2011/2012 Manfred Pinkal Geschachtelte Strukturen in natürlicher Sprache [ der an computerlinguistischen Fragestellungen interessierte Student im ersten
LFG-basierter Transfer
 Inhaltsverzeichnis 1 2 2 Ein Beispiel 4 3 Strukturaufbau 7 4 Alternative Übersetzungen 8 5 Adjunkte 9 6 Kodeskription 10 http://www.ims.uni-stuttgart.de/ gojunaa/mue_tut.html 1 1 Um einen quellsprachlichen
Inhaltsverzeichnis 1 2 2 Ein Beispiel 4 3 Strukturaufbau 7 4 Alternative Übersetzungen 8 5 Adjunkte 9 6 Kodeskription 10 http://www.ims.uni-stuttgart.de/ gojunaa/mue_tut.html 1 1 Um einen quellsprachlichen
Satzstruktur und Wortstellung im Deutschen
 Hauptstudium-Linguistik: Syntaxtheorie (DGA 32) WS 2016-17 / A. Tsokoglou Satzstruktur und Wortstellung im Deutschen 2. Satzstruktur und Wortstellung in den deskriptiven Grammatiken Relativ freie Wortstellung
Hauptstudium-Linguistik: Syntaxtheorie (DGA 32) WS 2016-17 / A. Tsokoglou Satzstruktur und Wortstellung im Deutschen 2. Satzstruktur und Wortstellung in den deskriptiven Grammatiken Relativ freie Wortstellung
Grammatikanalyse. Prof. Dr. John Peterson. Sprechstunde: Montags, 14:30-15:30h Raum LS10/Raum 425. Sommersemester 2015 Donnerstags, 14:15h-15:45h
 Grammatikanalyse Sommersemester 2015 Donnerstags, 14:15h-15:45h Prof. Dr. John Peterson Sprechstunde: Montags, 14:30-15:30h Raum LS10/Raum 425 1 Termin Thema 16.4. Einführung Zerlegung des Satzes in seine
Grammatikanalyse Sommersemester 2015 Donnerstags, 14:15h-15:45h Prof. Dr. John Peterson Sprechstunde: Montags, 14:30-15:30h Raum LS10/Raum 425 1 Termin Thema 16.4. Einführung Zerlegung des Satzes in seine
Funktionale-Grammatik
 Lexikalisch-Funktionale Funktionale-Grammatik Formaler Aufbau der F-Strukturen Funktionale Beschreibungen Funktionale Annotationen Von der K-Struktur zur F-Struktur Architektur der LFG Grammatik Erweiterte
Lexikalisch-Funktionale Funktionale-Grammatik Formaler Aufbau der F-Strukturen Funktionale Beschreibungen Funktionale Annotationen Von der K-Struktur zur F-Struktur Architektur der LFG Grammatik Erweiterte
Abkürzungen Einführung Übungsaufgaben... 13
 Inhalt Abkürzungen............................................. 10 1 Einführung............................................. 11 1.1 Übungsaufgaben..................................... 13 2 Syntaktische
Inhalt Abkürzungen............................................. 10 1 Einführung............................................. 11 1.1 Übungsaufgaben..................................... 13 2 Syntaktische
Einführung Computerlinguistik. Konstituentensyntax II
 Einführung Computerlinguistik Konstituentensyntax II Hinrich Schütze & Robert Zangenfeind Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung, LMU München 2013-11-18 1 / 31 Take-away Phrasenstrukturgrammatik:
Einführung Computerlinguistik Konstituentensyntax II Hinrich Schütze & Robert Zangenfeind Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung, LMU München 2013-11-18 1 / 31 Take-away Phrasenstrukturgrammatik:
Topologisches Modell Qualitative Valenz Überblick Übung. Syntax III. Gerrit Kentner
 Syntax III Gerrit Kentner 6. Februar 2013 1 / 34 Was bisher geschah Syntax I Aufgabe an die Syntax: Beschreibung grammatischer Satzstrukturen Wortabfolge und hierarchische Struktur Konstituentenbegriff
Syntax III Gerrit Kentner 6. Februar 2013 1 / 34 Was bisher geschah Syntax I Aufgabe an die Syntax: Beschreibung grammatischer Satzstrukturen Wortabfolge und hierarchische Struktur Konstituentenbegriff
Syntax natürlicher Sprachen
 Syntax natürlicher Sprachen 03: Phrasen und Konstituenten Martin Schmitt Ludwig-Maximilians-Universität München 08.11.2017 Martin Schmitt (LMU) Syntax natürlicher Sprachen 08.11.2017 1 Themen der heutigen
Syntax natürlicher Sprachen 03: Phrasen und Konstituenten Martin Schmitt Ludwig-Maximilians-Universität München 08.11.2017 Martin Schmitt (LMU) Syntax natürlicher Sprachen 08.11.2017 1 Themen der heutigen
Vorlesung: Lexikalisch Funktionale Grammatik Christian Fortmann Universität Zürich Sommersemester 2005
 Vorlesung: Lexikalisch Funktionale Grammatik 15.04.2005 Christian Fortmann Universität Zürich Sommersemester 2005 III. Regierte Grammatische Funktionen / Präpositionalobjekt / Ajdunkt Die Abbildung der
Vorlesung: Lexikalisch Funktionale Grammatik 15.04.2005 Christian Fortmann Universität Zürich Sommersemester 2005 III. Regierte Grammatische Funktionen / Präpositionalobjekt / Ajdunkt Die Abbildung der
Einführung in die Sprachwissenschaft des Deutschen Syntax II. PD Dr. Alexandra Zepter
 Einführung in die Sprachwissenschaft des Deutschen Syntax II PD Dr. Alexandra Zepter Systemorientierte theoretische Linguistik Pragmatik: Textlinguistik (Semiotik) Semantik Syntax Morphologie Phonetik/Phonologie
Einführung in die Sprachwissenschaft des Deutschen Syntax II PD Dr. Alexandra Zepter Systemorientierte theoretische Linguistik Pragmatik: Textlinguistik (Semiotik) Semantik Syntax Morphologie Phonetik/Phonologie
Grammatiktheorie. Klausurfragen und Antworten
 Germanistik Franziska Riedel Grammatiktheorie. Klausurfragen und Antworten Prüfungsvorbereitung Klausurfragen Grammatiktheorie Kasus: - Bestimmen Sie die Kasus! - Bestimmen Sie die Art der Kasusvergabe!
Germanistik Franziska Riedel Grammatiktheorie. Klausurfragen und Antworten Prüfungsvorbereitung Klausurfragen Grammatiktheorie Kasus: - Bestimmen Sie die Kasus! - Bestimmen Sie die Art der Kasusvergabe!
Einführung Syntaktische Funktionen
 Syntax I Einführung Syntaktische Funktionen Syntax I 1 Syntax allgemein Syntax befasst sich mit den Regeln, mit denen man Wörter zu grammatischen Sätzen kombinieren kann. Es gibt unterschiedliche Modelle
Syntax I Einführung Syntaktische Funktionen Syntax I 1 Syntax allgemein Syntax befasst sich mit den Regeln, mit denen man Wörter zu grammatischen Sätzen kombinieren kann. Es gibt unterschiedliche Modelle
Grammatiktheorie: Merkmale, Merkmalstrukturen, Unifikation, Unifikationsgrammatiken
 Grammatiktheorie: Merkmale, Merkmalstrukturen, Unifikation, Unifikationsgrammatiken Einführungskurs Syntax und Morphologie 11. Vorlesung Merkmale Das Wort 'Merkmal' bedeutet im Prinzip soviel wie 'Eigenschaft'
Grammatiktheorie: Merkmale, Merkmalstrukturen, Unifikation, Unifikationsgrammatiken Einführungskurs Syntax und Morphologie 11. Vorlesung Merkmale Das Wort 'Merkmal' bedeutet im Prinzip soviel wie 'Eigenschaft'
Syntax I. Vorlesung: Syntax des Deutschen unter besonderer Berücksichtigung regionaler Varietäten Claudia Bucheli Berger
 Syntax I Vorlesung: Syntax des Deutschen unter besonderer Berücksichtigung regionaler Varietäten Claudia Bucheli Berger Repetition Morphologie Calvin: Ich verbe gern Wörter. ( Jet ) Es ist geverbt worden.
Syntax I Vorlesung: Syntax des Deutschen unter besonderer Berücksichtigung regionaler Varietäten Claudia Bucheli Berger Repetition Morphologie Calvin: Ich verbe gern Wörter. ( Jet ) Es ist geverbt worden.
Von Subjekten, Sätzen und Subjektsätzen
 Wilhelm Oppenrieder Von Subjekten, Sätzen und Subjektsätzen Untersuchungen zur Syntax des Deutschen Max Niemeyer Verlag Tübingen 1991 V 0. EINLEITUNG 1 1. SUBJEKTE 3 1.1 Generelle Oberlegungen zu grammatischen
Wilhelm Oppenrieder Von Subjekten, Sätzen und Subjektsätzen Untersuchungen zur Syntax des Deutschen Max Niemeyer Verlag Tübingen 1991 V 0. EINLEITUNG 1 1. SUBJEKTE 3 1.1 Generelle Oberlegungen zu grammatischen
Satzglieder: Subjekt, Prädikat und Objekt. Satzglieder: Prädikat, Subjekt und Objekt
 https://www.woxikon.de/referate/deutsch/satzglieder-subjekt-praedikat-und-objekt Satzglieder: Subjekt, Prädikat und Objekt Fach Deutsch Klasse 9 Autor Anja333 Veröffentlicht am 02.09.2018 Zusammenfassung
https://www.woxikon.de/referate/deutsch/satzglieder-subjekt-praedikat-und-objekt Satzglieder: Subjekt, Prädikat und Objekt Fach Deutsch Klasse 9 Autor Anja333 Veröffentlicht am 02.09.2018 Zusammenfassung
Syntaktische Kategorien: Phrasenkategorien
 Syntaktische Kategorien: Phrasenkategorien FLM0410 - Introdução à Linguística Alemã I Profa. Dra. Ma. Helena Voorsluys Battaglia Eugenio Braga 8974165 Márcio Ap. de Deus 7000382 Wörter Phrasen Satz Satz
Syntaktische Kategorien: Phrasenkategorien FLM0410 - Introdução à Linguística Alemã I Profa. Dra. Ma. Helena Voorsluys Battaglia Eugenio Braga 8974165 Márcio Ap. de Deus 7000382 Wörter Phrasen Satz Satz
Konstituentenstrukturgrammatik
 Konstituentenstrukturgrammatik Computer Wallpapers HD 2010 // Abstraktion // http://goo.gl/jsi40t Kommentar 1 Form und Funktion schickte Strukturale Ordnung PROJEKTION Dozent Studenten gestern E-Mail Aufgaben
Konstituentenstrukturgrammatik Computer Wallpapers HD 2010 // Abstraktion // http://goo.gl/jsi40t Kommentar 1 Form und Funktion schickte Strukturale Ordnung PROJEKTION Dozent Studenten gestern E-Mail Aufgaben
Dependenz. Ferdinand de Saussure (* )
 Dependenz Dependenz Ferdinand de Saussure (* 26.11.1857 22.2.1913) - Genfer Sprachwissenschaftler - Begründer des Strukturalismus - langue vs. parole - synchron vs. diachron - paradigmatisch vs. syntagmatisch
Dependenz Dependenz Ferdinand de Saussure (* 26.11.1857 22.2.1913) - Genfer Sprachwissenschaftler - Begründer des Strukturalismus - langue vs. parole - synchron vs. diachron - paradigmatisch vs. syntagmatisch
Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung Uni München Repetitorium ZP Sommersemester 09. Syntax. Alla Shashkina
 Syntax Alla Shashkina Was ist Syntax? Satzlehre System von Regeln, die beschreiben, wie aus einem Inventar von Grundelementen (Morphemen, Wörtern, Satzgliedern) durch spezifische syntaktische Mittel (Morphologische
Syntax Alla Shashkina Was ist Syntax? Satzlehre System von Regeln, die beschreiben, wie aus einem Inventar von Grundelementen (Morphemen, Wörtern, Satzgliedern) durch spezifische syntaktische Mittel (Morphologische
Syntax Phrasenstruktur und Satzglieder
 Syntax Phrasenstruktur und Satzglieder Sätze und ihre Bestandteile haben eine hierarchische Struktur. Die Bestandteile eines Satzes (Konstituenten) bestehen aus geordneten Wortfolgen, die ihrerseits wieder
Syntax Phrasenstruktur und Satzglieder Sätze und ihre Bestandteile haben eine hierarchische Struktur. Die Bestandteile eines Satzes (Konstituenten) bestehen aus geordneten Wortfolgen, die ihrerseits wieder
1. Stellen Sie die Konstituentenstruktur der folgenden Sätze als Baumdiagramme dar:
 1. Stellen Sie die Konstituentenstruktur der folgenden Sätze als Baumdiagramme dar: 1. Die Überschwemmungen hinterließen ernorme Schäden. 2. Der amtierende Bundeskanzler verzichtet auf eine erneute Kandidatur.
1. Stellen Sie die Konstituentenstruktur der folgenden Sätze als Baumdiagramme dar: 1. Die Überschwemmungen hinterließen ernorme Schäden. 2. Der amtierende Bundeskanzler verzichtet auf eine erneute Kandidatur.
Einführung in die Sprachwissenschaft des Deutschen. Syntax II. PD Dr. Alexandra Zepter
 Einführung in die Sprachwissenschaft des Deutschen Syntax II PD Dr. Alexandra Zepter Überblick Syntax Fokus auf linearer Ordnung: Sprachtypen, Topologisches Feldermodell Fokus auf hierarchischer Ordnung:
Einführung in die Sprachwissenschaft des Deutschen Syntax II PD Dr. Alexandra Zepter Überblick Syntax Fokus auf linearer Ordnung: Sprachtypen, Topologisches Feldermodell Fokus auf hierarchischer Ordnung:
VP vs.?p. N V P N? N P N V Peter kommt nach Hause...dass Peter nach Hause kommt. Syntax V 2
 Syntax V Rechts- vs. Links-Köpfigkeit VL-Sätze als grundlegende Muster funktionale Kategorien IP/CP zum Nachlesen: Grewendorf/Hamm/Sternefeld: Sprachliches Wissen, S. 213-223, Kap. 7.1., 7.2 Syntax V 1
Syntax V Rechts- vs. Links-Köpfigkeit VL-Sätze als grundlegende Muster funktionale Kategorien IP/CP zum Nachlesen: Grewendorf/Hamm/Sternefeld: Sprachliches Wissen, S. 213-223, Kap. 7.1., 7.2 Syntax V 1
Hausaufgaben X-bar Schema Nebensatztypen Wortabfolgetendenzen. Syntax IV. Gerrit Kentner
 Syntax IV Gerrit Kentner 13. Februar 2013 1 / 44 Was bisher geschah Grundsätzliches zur Sprachwissenschaft Semiotik Phonetik und Phonologie Morphologie Syntax I III Die Vorlesungsfolien finden Sie unter
Syntax IV Gerrit Kentner 13. Februar 2013 1 / 44 Was bisher geschah Grundsätzliches zur Sprachwissenschaft Semiotik Phonetik und Phonologie Morphologie Syntax I III Die Vorlesungsfolien finden Sie unter
Zum Innenbau der Satzglieder: Lösung
 Prof. Dr. Peter Gallmann Jena, Sommer 2018 M Zum Innenbau der Satzglieder: Lösung M 1 Satzglieder und Gliedteile: Welche Merkmale treffen zu? Kreuzen Sie die Merkmale an, die auf die eingeklammerte Phrase
Prof. Dr. Peter Gallmann Jena, Sommer 2018 M Zum Innenbau der Satzglieder: Lösung M 1 Satzglieder und Gliedteile: Welche Merkmale treffen zu? Kreuzen Sie die Merkmale an, die auf die eingeklammerte Phrase
Satzglieder und Gliedteile. Duden
 Satzglieder und Gliedteile Duden 1.1-1.3 1. Valenz: Ergänzungen und Angaben - Verb (bzw. Prädikat) bestimmt den Satz syntaktisch und semantisch [Anna] stellte [rasch] [eine Kerze] [auf den Tisch]. - Neben
Satzglieder und Gliedteile Duden 1.1-1.3 1. Valenz: Ergänzungen und Angaben - Verb (bzw. Prädikat) bestimmt den Satz syntaktisch und semantisch [Anna] stellte [rasch] [eine Kerze] [auf den Tisch]. - Neben
Slot Grammar Eine Einführung
 Slot Grammar Eine Einführung München, 4. Dez. 2002 Gerhard Rolletschek gerhard@cis.uni-muenchen.de 1 ! Entstehungskontext Übersicht! Elemente der Slot Grammar (Was ist ein Slot?)! Complement Slots vs.
Slot Grammar Eine Einführung München, 4. Dez. 2002 Gerhard Rolletschek gerhard@cis.uni-muenchen.de 1 ! Entstehungskontext Übersicht! Elemente der Slot Grammar (Was ist ein Slot?)! Complement Slots vs.
Ergänzende Betrachtungen zur syntaktischen Dependenz
 Vertiefung der Grundlagen der Computerlinguistik Ergänzende Betrachtungen zur syntaktischen Dependenz Robert Zangenfeind Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung, LMU München 28.11.2017 Zangenfeind:
Vertiefung der Grundlagen der Computerlinguistik Ergänzende Betrachtungen zur syntaktischen Dependenz Robert Zangenfeind Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung, LMU München 28.11.2017 Zangenfeind:
Deutsche Grammatik WS 14/15. Kerstin Schwabe
 Deutsche Grammatik WS 14/15 Kerstin Schwabe Generelle Information Dr. Kerstin Schwabe Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft Schützenstraße 18, R. 432 10117 Berlin Tel.: 20192410 E-mail: schwabe@zas.gwz-berlin.de
Deutsche Grammatik WS 14/15 Kerstin Schwabe Generelle Information Dr. Kerstin Schwabe Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft Schützenstraße 18, R. 432 10117 Berlin Tel.: 20192410 E-mail: schwabe@zas.gwz-berlin.de
Einführung in die Computerlinguistik. Syntax II
 Einführung in die Computerlinguistik yntax II Hinrich chütze & Robert Zangenfeind Centrum für Informations- und prachverarbeitung, LMU München 18.12.2015 chütze & Zangenfeind: yntax II 1 / 17 Take-away
Einführung in die Computerlinguistik yntax II Hinrich chütze & Robert Zangenfeind Centrum für Informations- und prachverarbeitung, LMU München 18.12.2015 chütze & Zangenfeind: yntax II 1 / 17 Take-away
Phrase vs. Satzglied. 1. Bedeutung der Kapitän hat das Fernrohr:
 Phrase vs. Satzglied Übung 1: Bestimmen Sie die Phrasen bzw. Satzglie für die zwei möglichen Bedeutungen des folgenden Satzes: Der Kapitän beobachtet den Piraten mit dem Fernrohr. 1. Bedeutung Kapitän
Phrase vs. Satzglied Übung 1: Bestimmen Sie die Phrasen bzw. Satzglie für die zwei möglichen Bedeutungen des folgenden Satzes: Der Kapitän beobachtet den Piraten mit dem Fernrohr. 1. Bedeutung Kapitän
Vertiefung der Grundlagen der Computerlinguistik. Semesterüberblick und Einführung zur Dependenz. Robert Zangenfeind
 Vertiefung der Grundlagen der Computerlinguistik Semesterüberblick und Einführung zur Dependenz Robert Zangenfeind Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung, LMU München 17.10.2017 Zangenfeind:
Vertiefung der Grundlagen der Computerlinguistik Semesterüberblick und Einführung zur Dependenz Robert Zangenfeind Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung, LMU München 17.10.2017 Zangenfeind:
Syntax und Morphologie
 Syntax und Morphologie Einführungskurs 10. Vorlesung Einfache Sätze und ihre logische Struktur Einfache Sätze und ihre logische Struktur Systeme der Argumentrealisierung Argumentstruktur eines Prädikats
Syntax und Morphologie Einführungskurs 10. Vorlesung Einfache Sätze und ihre logische Struktur Einfache Sätze und ihre logische Struktur Systeme der Argumentrealisierung Argumentstruktur eines Prädikats
Grundlagen der LFG. 2. Analysieren Sie jeweils einen der Sätze in (1) und (2), d.h., zeigen Sie, wie die C- und die F-Strukturen aussehen sollten.
 Einführung in die LFG Sommersemester 2010 Universität Konstanz Miriam Butt Lösung 1 Grundlagen der LFG 1 C-structure vs. F-structure 1. Die LFG bedient sich zweier Haupträpresentationsebenen: die C-Strukur
Einführung in die LFG Sommersemester 2010 Universität Konstanz Miriam Butt Lösung 1 Grundlagen der LFG 1 C-structure vs. F-structure 1. Die LFG bedient sich zweier Haupträpresentationsebenen: die C-Strukur
LFG- Einführung. Grammatiktheorien. LFG- Einführung (2) Theorie-Architektur. Aufbau der Grammatik. Lexikon
 Grammatiktheorien Teil 8 Lexical Functional Grammar Einführung LFG- Einführung Bresnan (1982) Unterschiede zu GB etc. Nur eine syntaktische Ebene Keine Konstituentenbewegung Keine Änderung grammatischer
Grammatiktheorien Teil 8 Lexical Functional Grammar Einführung LFG- Einführung Bresnan (1982) Unterschiede zu GB etc. Nur eine syntaktische Ebene Keine Konstituentenbewegung Keine Änderung grammatischer
Semesterplan. Grammatikschreibung des Deutschen konstituentenorientiert: Eisenberg, Duden dependenzorientiert: Helbig-Buscha (Mischtyp), Engel
 konstituentenorientiert: 1 Im Vordergrund steht die Satzgliedebene oder eine vergleichbare Ebene Eisenberg Übersicht aus: Grammatik in Rahmenplänen: Was bleibt von der Satzgliedlehre? : PRÄDIKAT Verb SUBJEKT
konstituentenorientiert: 1 Im Vordergrund steht die Satzgliedebene oder eine vergleichbare Ebene Eisenberg Übersicht aus: Grammatik in Rahmenplänen: Was bleibt von der Satzgliedlehre? : PRÄDIKAT Verb SUBJEKT
Grundkurs Linguistik - Syntax
 Grundkurs Linguistik - Syntax Jens Fleischhauer fleischhauer@phil.uni-duesseldorf.de Universität Düsseldorf; Abteilung für Allgemeine Sprachwissenschaft 19.11.2015; WS 2015/2016 1 / 24 Jens Fleischhauer
Grundkurs Linguistik - Syntax Jens Fleischhauer fleischhauer@phil.uni-duesseldorf.de Universität Düsseldorf; Abteilung für Allgemeine Sprachwissenschaft 19.11.2015; WS 2015/2016 1 / 24 Jens Fleischhauer
Hausaufgaben X-bar Schema Nebensatztypen Wortabfolgetendenzen. Syntax IV. Gerrit Kentner
 Syntax IV Gerrit Kentner 12. November 2010 1 / 38 Was bisher geschah Syntax I Wortabfolge und hierarchische Struktur Konstituentenbegriff/ Konstituententests Analyse syntaktischer Ambiguitäten Syntax II
Syntax IV Gerrit Kentner 12. November 2010 1 / 38 Was bisher geschah Syntax I Wortabfolge und hierarchische Struktur Konstituentenbegriff/ Konstituententests Analyse syntaktischer Ambiguitäten Syntax II
Sie gab das Buch ihrer Schwester.
 Linguistische Kriterien für kontextfreie Grammatiken Zerlegung eines Satzes in Konstituenten gemäß Austausch-, Verschiebe- und Weglaßprobe Dies ist ein Beispiel. Beschreibungsmöglichkeiten: 1. S Pron V
Linguistische Kriterien für kontextfreie Grammatiken Zerlegung eines Satzes in Konstituenten gemäß Austausch-, Verschiebe- und Weglaßprobe Dies ist ein Beispiel. Beschreibungsmöglichkeiten: 1. S Pron V
Syntax natürlicher Sprachen
 Syntax natürlicher Sprachen 06: Merkmalstrukturen Martin Schmitt Ludwig-Maximilians-Universität München 29.11.2017 Martin Schmitt (LMU) Syntax natürlicher Sprachen 29.11.2017 1 Themen der heutigen Übung
Syntax natürlicher Sprachen 06: Merkmalstrukturen Martin Schmitt Ludwig-Maximilians-Universität München 29.11.2017 Martin Schmitt (LMU) Syntax natürlicher Sprachen 29.11.2017 1 Themen der heutigen Übung
Syntax. Valenz Aktanten Rektionsmodell
 Syntax Valenz Aktanten Rektionsmodell Robert Zangenfeind & Hinrich Schütze Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung, LMU München 11.11.2013 Zangenfeind & Schütze: Syntax 1 / 18 Take-away Valenzbegriff
Syntax Valenz Aktanten Rektionsmodell Robert Zangenfeind & Hinrich Schütze Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung, LMU München 11.11.2013 Zangenfeind & Schütze: Syntax 1 / 18 Take-away Valenzbegriff
Subjekt und Subjektpositionen
 Prof. Dr. Peter Gallmann Sommer 2017 U Subjekt und Subjektpositionen U 1 Subjekt: Kasus und semantische Rolle Wie in den vorangehenden Skripts ausgeführt, wird in der wissenschaftlichen Grammatik postuliert,
Prof. Dr. Peter Gallmann Sommer 2017 U Subjekt und Subjektpositionen U 1 Subjekt: Kasus und semantische Rolle Wie in den vorangehenden Skripts ausgeführt, wird in der wissenschaftlichen Grammatik postuliert,
Stefan Lotze Seminar: Grundlagen der deutschen Grammatik (Satz I, Teil II) Sommer Valenz, thematische Rollen, Kasus. Was ist Valenz?
 1 T Valenz, thematische Rollen, Kasus Theorie (Fragenkatalog) A Was ist Valenz? Die Eigenschaft eines Wortes, Ergänzungen mit bestimmten en und/oder formalen Merkmalen zu verlangen. [1] B Definieren Sie
1 T Valenz, thematische Rollen, Kasus Theorie (Fragenkatalog) A Was ist Valenz? Die Eigenschaft eines Wortes, Ergänzungen mit bestimmten en und/oder formalen Merkmalen zu verlangen. [1] B Definieren Sie
Karl Heinz Wagner
 Architektur der LFG Lexikalisch-Funktionale Funktionale-Grammatik Grammatik Erweiterte PG Grammatik Lexikon Lexikonregeln Formaler Aufbau der F Funktionale Beschreibungen Funktionale zur F-trukturF K-trukturen
Architektur der LFG Lexikalisch-Funktionale Funktionale-Grammatik Grammatik Erweiterte PG Grammatik Lexikon Lexikonregeln Formaler Aufbau der F Funktionale Beschreibungen Funktionale zur F-trukturF K-trukturen
Einführung in unifikationsbasierte Grammatikformalismen
 Universität Potsdam Institut für Linguistik Computerlinguistik Einführung in unifikationsbasierte Grammatikformalismen Thomas Hanneforth head: VP form: finite subj: pers: 3 num: pl Merkmalsstrukturen:
Universität Potsdam Institut für Linguistik Computerlinguistik Einführung in unifikationsbasierte Grammatikformalismen Thomas Hanneforth head: VP form: finite subj: pers: 3 num: pl Merkmalsstrukturen:
Stefan Lotze Seminar: Grundlagen der deutschen Grammatik (Satz I, Teil II) Sommer Valenz, Kasus, syntaktische Strukturen
 1 T Valenz, Kasus, syntaktische Strukturen Theorie (Fragenkatalog) A B D E F G Was ist Valenz? Die Eigenschaft eines Wortes, Ergänzungen mit bestimmten en und/oder formalen Merkmalen zu verlangen. Definieren
1 T Valenz, Kasus, syntaktische Strukturen Theorie (Fragenkatalog) A B D E F G Was ist Valenz? Die Eigenschaft eines Wortes, Ergänzungen mit bestimmten en und/oder formalen Merkmalen zu verlangen. Definieren
Einführung in die Computerlinguistik
 Einführung in die Computerlinguistik Merkmalstrukturen und Unifikation Dozentin: Wiebke Petersen WS 2004/2005 Wiebke Petersen Formale Komplexität natürlicher Sprachen WS 03/04 Universität Potsdam Institut
Einführung in die Computerlinguistik Merkmalstrukturen und Unifikation Dozentin: Wiebke Petersen WS 2004/2005 Wiebke Petersen Formale Komplexität natürlicher Sprachen WS 03/04 Universität Potsdam Institut
Grammatik des Standarddeutschen III. Michael Schecker
 Grammatik des Standarddeutschen III Michael Schecker Einführung und Grundlagen Nominalgruppen Nomina Artikel Attribute Pronomina Kasus (Subjekte und Objekte, Diathese) Verbalgruppen Valenz und Argumente
Grammatik des Standarddeutschen III Michael Schecker Einführung und Grundlagen Nominalgruppen Nomina Artikel Attribute Pronomina Kasus (Subjekte und Objekte, Diathese) Verbalgruppen Valenz und Argumente
Kontrastive Linguistik und Übersetzung
 Kontrastive Linguistik und Übersetzung WS 2014/15 29.04.2015 EINFÜHRUNG IN DIE SYNTAX Syntax Die syntaktische Analyse (von gr. syntaxis Zusammenstellung ) befasst sich mit den Regeln und Verfahren, mit
Kontrastive Linguistik und Übersetzung WS 2014/15 29.04.2015 EINFÜHRUNG IN DIE SYNTAX Syntax Die syntaktische Analyse (von gr. syntaxis Zusammenstellung ) befasst sich mit den Regeln und Verfahren, mit
Syntax natürlicher Sprachen
 Syntax natürlicher Sprachen 02: Grammatik und Bäume Martin Schmitt Ludwig-Maximilians-Universität München 25.10.2017 Martin Schmitt (LMU) Syntax natürlicher Sprachen 25.10.2017 1 1 Syntax im NLTK 2 Grammatik
Syntax natürlicher Sprachen 02: Grammatik und Bäume Martin Schmitt Ludwig-Maximilians-Universität München 25.10.2017 Martin Schmitt (LMU) Syntax natürlicher Sprachen 25.10.2017 1 1 Syntax im NLTK 2 Grammatik
Dependenz. Einleitung: Dependenz und Konstituenz. Dependenz als asymmetrische, binäre Relation
 Dependenz Einleitung: Dependenz und Konstituenz Dem Konzept»Dependenz«wird in vielen Einführungen in die Syntax gar nicht oder nur indirekt Rechnung getragen die meisten Autoren beginnen mit Konstituentenstrukturen
Dependenz Einleitung: Dependenz und Konstituenz Dem Konzept»Dependenz«wird in vielen Einführungen in die Syntax gar nicht oder nur indirekt Rechnung getragen die meisten Autoren beginnen mit Konstituentenstrukturen
Computerlexikographie-Tutorium
 Computerlexikographie-Tutorium 18.04.2008 Thema für heute: lexikalische Regeln nach Daniel Flickinger Computerlexikographie PS, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, SS08 Dozentin: Claudia Kunze ~*~ Tutorin:
Computerlexikographie-Tutorium 18.04.2008 Thema für heute: lexikalische Regeln nach Daniel Flickinger Computerlexikographie PS, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, SS08 Dozentin: Claudia Kunze ~*~ Tutorin:
Hausaufgaben Topologisches Modell Qualitative Valenz Überblick Übung. Syntax III. Gerrit Kentner
 Syntax III Gerrit Kentner 5. November 2010 1 / 40 Organisatorisches Folien und andere Materialien für beide Semester unter http://user.uni-frankfurt.de/ kentner/einfling.html (jetzt online) Tutorium donnerstags
Syntax III Gerrit Kentner 5. November 2010 1 / 40 Organisatorisches Folien und andere Materialien für beide Semester unter http://user.uni-frankfurt.de/ kentner/einfling.html (jetzt online) Tutorium donnerstags
Syntax und Phonologie: Prosodische Phrasen
 Morphologie und Syntax (BA) Syntax und Phonologie: Prosodische Phrasen PD Dr. Ralf Vogel Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft Universität Bielefeld, SoSe 2007 Ralf.Vogel@Uni-Bielefeld.de 28.6.2007
Morphologie und Syntax (BA) Syntax und Phonologie: Prosodische Phrasen PD Dr. Ralf Vogel Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft Universität Bielefeld, SoSe 2007 Ralf.Vogel@Uni-Bielefeld.de 28.6.2007
Einführung in die Computerlinguistik. Morphologie II
 Einführung in die Computerlinguistik Morphologie II Hinrich Schütze & Robert Zangenfeind Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung, LMU München 30.11.2015 Schütze & Zangenfeind: Morphologie II 1
Einführung in die Computerlinguistik Morphologie II Hinrich Schütze & Robert Zangenfeind Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung, LMU München 30.11.2015 Schütze & Zangenfeind: Morphologie II 1
Klausur Syntaxseminar, SoSe Musterantworten.
 A. Einige bibliographische Kenntnisse. Mehrfach habe ich Sie auf einige Werke aufmerksam gemacht, die für die Geschichte der Teildiszipin Syntax bedeutsam sind. Falls Sie die Recherche-Aufgaben gemacht
A. Einige bibliographische Kenntnisse. Mehrfach habe ich Sie auf einige Werke aufmerksam gemacht, die für die Geschichte der Teildiszipin Syntax bedeutsam sind. Falls Sie die Recherche-Aufgaben gemacht
Attribut Bsp.: Der schöne Baum im Wald verliert seine Blätter.
 Lern- / Lehrmaterial für Nachhilfe in Deutsch oder Deutsch als Fremdsprache Deutsche Grammatik: Grammatische Grundbegriffe, Liste 2018 www.nachhilfe-vermittlung.com, Autor: D. Lepold Im Deutschunterricht
Lern- / Lehrmaterial für Nachhilfe in Deutsch oder Deutsch als Fremdsprache Deutsche Grammatik: Grammatische Grundbegriffe, Liste 2018 www.nachhilfe-vermittlung.com, Autor: D. Lepold Im Deutschunterricht
EINFÜHRUNG IN DIE GERMANISTISCHE LINGUISTIK KAPITEL 4: SYNTAX LÖSUNGEN
 Bitte beachten Sie, dass an verschiedenen Stellen auch andere Lösungen denkbar sind. Ich habe versucht, die Lösungen ausführlicher zu formulieren; das soll aber nicht bedeuten, dass auch Ihre Lösungen
Bitte beachten Sie, dass an verschiedenen Stellen auch andere Lösungen denkbar sind. Ich habe versucht, die Lösungen ausführlicher zu formulieren; das soll aber nicht bedeuten, dass auch Ihre Lösungen
Sprachproduktion: grammatische Enkodierung nach Levelt 1989 bzw. Kempen & Hoenkamp 1987
 Sprachproduktion: grammatische Enkodierung nach Levelt 989 bzw. Kempen & Hoenkamp 987 dargestellt nach Schade & Eikmeyer 2003: Produktion von Syntagmen. In: Rickheit, G., Herrmann, T. & Deutsch, W.: (eds)
Sprachproduktion: grammatische Enkodierung nach Levelt 989 bzw. Kempen & Hoenkamp 987 dargestellt nach Schade & Eikmeyer 2003: Produktion von Syntagmen. In: Rickheit, G., Herrmann, T. & Deutsch, W.: (eds)
Fortsetzung: Worin die Struktur von Konstruktionen besteht. kleinste (grammatische) Bausteine: Morpheme, realisiert durch (Allo-)Morphe;
 Plank, WS 03/04, EinfLing, M&S 5a 1 Fortsetzung: Worin die Struktur von Konstruktionen besteht kleinste (grammatische) Bausteine: Morpheme, realisiert durch (Allo-)Morphe; Konstruktionen mit diesen Bausteinen,
Plank, WS 03/04, EinfLing, M&S 5a 1 Fortsetzung: Worin die Struktur von Konstruktionen besteht kleinste (grammatische) Bausteine: Morpheme, realisiert durch (Allo-)Morphe; Konstruktionen mit diesen Bausteinen,
Parsing mit NLTK. Parsing mit NLTK. Parsing mit NLTK. Parsing mit NLTK. Beispiel: eine kleine kontextfreie Grammatik (cf. [BKL09], Ch. 8.
![Parsing mit NLTK. Parsing mit NLTK. Parsing mit NLTK. Parsing mit NLTK. Beispiel: eine kleine kontextfreie Grammatik (cf. [BKL09], Ch. 8. Parsing mit NLTK. Parsing mit NLTK. Parsing mit NLTK. Parsing mit NLTK. Beispiel: eine kleine kontextfreie Grammatik (cf. [BKL09], Ch. 8.](/thumbs/39/18970986.jpg) Gliederung Natürlichsprachliche Systeme I D. Rösner Institut für Wissens- und Sprachverarbeitung Fakultät für Informatik Otto-von-Guericke Universität Magdeburg 1 WS 2011/12, 26. Oktober 2011, c 2010-2012
Gliederung Natürlichsprachliche Systeme I D. Rösner Institut für Wissens- und Sprachverarbeitung Fakultät für Informatik Otto-von-Guericke Universität Magdeburg 1 WS 2011/12, 26. Oktober 2011, c 2010-2012
Morphologische Merkmale. Merkmale Merkmale in der Linguistik Merkmale in der Morpholgie Morphologische Typologie Morphologische Modelle
 Morphologische Merkmale Merkmale Merkmale in der Linguistik Merkmale in der Morpholgie Morphologische Typologie Morphologische Modelle Merkmale Das Wort 'Merkmal' ' bedeutet im Prinzip soviel wie 'Eigenschaft'
Morphologische Merkmale Merkmale Merkmale in der Linguistik Merkmale in der Morpholgie Morphologische Typologie Morphologische Modelle Merkmale Das Wort 'Merkmal' ' bedeutet im Prinzip soviel wie 'Eigenschaft'
Dativobjekt! Akkusativobjekt! Genitivobjekt! Präpositionalobjekt! = Ziel der Handlung, Patiens!
 Akkusativobjekt! Dativobjekt! = Ziel der Handlung, Patiens! = Rezipient [Empfänger(in)]! = Benefizient [Nutznießer(in) der Handlung]! = Experiencer [erfährt etwas]! Genitivobjekt! Präpositionalobjekt!
Akkusativobjekt! Dativobjekt! = Ziel der Handlung, Patiens! = Rezipient [Empfänger(in)]! = Benefizient [Nutznießer(in) der Handlung]! = Experiencer [erfährt etwas]! Genitivobjekt! Präpositionalobjekt!
Semantik. Anke Himmelreich Prädikation und verbale Bedeutung. Universität Leipzig, Institut für Linguistik
 1 / 42 Semantik Prädikation und verbale Bedeutung Anke Himmelreich anke.assmann@uni-leipzig.de Universität Leipzig, Institut für Linguistik 11.05.2017 2 / 42 Inhaltsverzeichnis 4 Nomen und Adjektive 1
1 / 42 Semantik Prädikation und verbale Bedeutung Anke Himmelreich anke.assmann@uni-leipzig.de Universität Leipzig, Institut für Linguistik 11.05.2017 2 / 42 Inhaltsverzeichnis 4 Nomen und Adjektive 1
Wortgruppen: Phrase und Verbgruppe
 Wortgruppen: Phrase und Verbgruppe Äußerungen bestehen aus Sätzen oder Wortgruppen. Es sind Wortgruppen oder Nebensätze, denen Satzfunktionen wie Subjekt, Adverbial, Objekt, Komplement etc. zugewiesen
Wortgruppen: Phrase und Verbgruppe Äußerungen bestehen aus Sätzen oder Wortgruppen. Es sind Wortgruppen oder Nebensätze, denen Satzfunktionen wie Subjekt, Adverbial, Objekt, Komplement etc. zugewiesen
Formale Methoden 1. Gerhard Jäger 12. Dezember Uni Bielefeld, WS 2007/2008 1/22
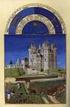 1/22 Formale Methoden 1 Gerhard Jäger Gerhard.Jaeger@uni-bielefeld.de Uni Bielefeld, WS 2007/2008 12. Dezember 2007 2/22 Bäume Baumdiagramme Ein Baumdiagramm eines Satzes stellt drei Arten von Information
1/22 Formale Methoden 1 Gerhard Jäger Gerhard.Jaeger@uni-bielefeld.de Uni Bielefeld, WS 2007/2008 12. Dezember 2007 2/22 Bäume Baumdiagramme Ein Baumdiagramm eines Satzes stellt drei Arten von Information
2.2.2 Semantik von TL. Menge der Domänen. Zu jedem Typ gibt es eine Menge von möglichen Denotationen der Ausdrücke dieses Typs.
 2.2.2 Semantik von TL Menge der Domänen Zu jedem Typ gibt es eine Menge von möglichen Denotationen der Ausdrücke dieses Typs. Diese Menge wird Domäne des betreffenden Typs genannt. Johannes Dölling: Formale
2.2.2 Semantik von TL Menge der Domänen Zu jedem Typ gibt es eine Menge von möglichen Denotationen der Ausdrücke dieses Typs. Diese Menge wird Domäne des betreffenden Typs genannt. Johannes Dölling: Formale
UBUNGS- GRAMMATIK DEUTSCH
 GERHARD HELBIG JOACHIM BUSCHA UBUNGS- GRAMMATIK DEUTSCH Langenscheidt Berlin München Wien Zürich New York SYSTEMATISCHE INHALTSÜBERSICHT VORWORT Übung Seite ÜBUNGSTEIL FORMENBESTAND UND EINTEILUNG DER
GERHARD HELBIG JOACHIM BUSCHA UBUNGS- GRAMMATIK DEUTSCH Langenscheidt Berlin München Wien Zürich New York SYSTEMATISCHE INHALTSÜBERSICHT VORWORT Übung Seite ÜBUNGSTEIL FORMENBESTAND UND EINTEILUNG DER
Grundkurs Linguistik Morphologie
 Grundkurs Linguistik Morphologie Jens Fleischhauer fleischhauer@phil.uni-duesseldorf.de Universität Düsseldorf; Abteilung für Allgemeine Sprachwissenschaft WS 2018/2019 1 / 26 Jens Fleischhauer Morphologie
Grundkurs Linguistik Morphologie Jens Fleischhauer fleischhauer@phil.uni-duesseldorf.de Universität Düsseldorf; Abteilung für Allgemeine Sprachwissenschaft WS 2018/2019 1 / 26 Jens Fleischhauer Morphologie
Syntaktische Bäume. Syntaktische Bäume: Prinzipien. Köpfe in Syntax vs. Morphologie CP! C S VP! V CP PP! P NP. S! NP VP VP! V (NP) PP* NP!
 Einführung in die Linguistik Butt / Eulitz / Wiemer Di. 12:15-13:45 Do.! 12:15-13:45 Fr.! 12:15-13:45 Syntax nfos etc. http://ling.uni-konstanz.de => Lehre Einführung in die Linguistik Syntaktische Bäume
Einführung in die Linguistik Butt / Eulitz / Wiemer Di. 12:15-13:45 Do.! 12:15-13:45 Fr.! 12:15-13:45 Syntax nfos etc. http://ling.uni-konstanz.de => Lehre Einführung in die Linguistik Syntaktische Bäume
Einführung in die Computerlinguistik
 Einührung in die Coputerlinguistik yntax: Graatische Funktionen / Graatische Merkale W 2008/2009 Manred Pinkal Kategorie und Funktion yntaktische Kategorien bezeichnen Klassen Ausdrücken it ähnlicher innerer
Einührung in die Coputerlinguistik yntax: Graatische Funktionen / Graatische Merkale W 2008/2009 Manred Pinkal Kategorie und Funktion yntaktische Kategorien bezeichnen Klassen Ausdrücken it ähnlicher innerer
3. Phrasenstruktur und Merkmale 2
 .1. WIEDERHOLUNG. Phrasenstruktur und Merkmale An welchen Eigenschaften erkennt man den Kopf einer Phrase? Was besagt das Thetakriterium? Was sind interpretierbare und uninterpretierbare Merkmale? Was
.1. WIEDERHOLUNG. Phrasenstruktur und Merkmale An welchen Eigenschaften erkennt man den Kopf einer Phrase? Was besagt das Thetakriterium? Was sind interpretierbare und uninterpretierbare Merkmale? Was
Einführung in die Syntax
 Einführung in die Syntax Grundlagen Strukturen Theorien Bearbeitet von Jürgen Pafel 1. Auflage 2011. Taschenbuch. ix, 264 S. Paperback ISBN 978 3 476 02322 3 Format (B x L): 17 x 24,4 cm Gewicht: 481 g
Einführung in die Syntax Grundlagen Strukturen Theorien Bearbeitet von Jürgen Pafel 1. Auflage 2011. Taschenbuch. ix, 264 S. Paperback ISBN 978 3 476 02322 3 Format (B x L): 17 x 24,4 cm Gewicht: 481 g
Stefan Lotze Seminar: Grundlagen der deutschen Grammatik (Satz I, Teil II) Winter 2017/18. Passiv (und nichtakkusativische Verben)
 1 Stefan Lotze Seminar: Grundlagen der deutschen Grammatik (Satz, Teil ) Winter 2017/18 Passiv (und nichtakkusativische erben) Theorie (Fragenkatalog) A B Welche oraussetzung muss ein erb erfüllen, um
1 Stefan Lotze Seminar: Grundlagen der deutschen Grammatik (Satz, Teil ) Winter 2017/18 Passiv (und nichtakkusativische erben) Theorie (Fragenkatalog) A B Welche oraussetzung muss ein erb erfüllen, um
Zum kategorialen Status von Hauptsätzen und Nebensätzen.
 Zum kategorialen Status von Hauptsätzen und Nebensätzen. - Uniformitätsthese: o beide gehören derselben Kategorie CP an o V2=C - Differenzthese o beide gehören verschiedenen Kategorien an. o V2 Ergebnis:
Zum kategorialen Status von Hauptsätzen und Nebensätzen. - Uniformitätsthese: o beide gehören derselben Kategorie CP an o V2=C - Differenzthese o beide gehören verschiedenen Kategorien an. o V2 Ergebnis:
Probeklausur: Einführung in die formale Grammatiktheorie
 Probeklausur: Einführung in die formale Grammatiktheorie Prof. Dr. Stefan Müller Deutsche Grammatik Freie Universität Berlin Stefan.Mueller@fu-berlin.de 16. Juli 2016 Name und Vorname: Matrikelnummer:
Probeklausur: Einführung in die formale Grammatiktheorie Prof. Dr. Stefan Müller Deutsche Grammatik Freie Universität Berlin Stefan.Mueller@fu-berlin.de 16. Juli 2016 Name und Vorname: Matrikelnummer:
7 Komplexe Satzkonstruktionen und Wortstellung
 Übersicht 7 Komplexe Satzkonstruktionen und Wortstellung 7.1 Wortstellung 7.1.1 Wortstellungstypologie 7.1.2 Wortstellungssyntax des Deutschen 7.2 Komplexe Satzkonstruktionen 7.2.1 Subordination 7.2.2
Übersicht 7 Komplexe Satzkonstruktionen und Wortstellung 7.1 Wortstellung 7.1.1 Wortstellungstypologie 7.1.2 Wortstellungssyntax des Deutschen 7.2 Komplexe Satzkonstruktionen 7.2.1 Subordination 7.2.2
Syntax natürlicher Sprachen
 Syntax natürlicher Sprachen Vorlesung WS 2017/2018 Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung LMU München Axel Wisiorek Organisatorisches 2 Vorlesung: Di, 10-12 Uhr, Raum 151 (Wisiorek) Email: wisiorek
Syntax natürlicher Sprachen Vorlesung WS 2017/2018 Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung LMU München Axel Wisiorek Organisatorisches 2 Vorlesung: Di, 10-12 Uhr, Raum 151 (Wisiorek) Email: wisiorek
Die Grammatik. sowie ausführlichem Register. Auflage
 Die Grammatik Unentbehrlich für richtiges Deutsch Umfassende Darstellung des Aufbaus der deutschen Sprache vom Laut über das Wort und den Satz bis hin zum Text und zu den Merkmalen der gesprochenen Sprache
Die Grammatik Unentbehrlich für richtiges Deutsch Umfassende Darstellung des Aufbaus der deutschen Sprache vom Laut über das Wort und den Satz bis hin zum Text und zu den Merkmalen der gesprochenen Sprache
Semantik & Pragmatik. 8. Mai 2006
 Semantik & Pragmatik 8. Mai 2006 1 Lexikalische Semantik Semantik lexikalische Semantik Semantik von einfachen Ausdrücken Satz-Semantik Semantik von zusammengesetzten Ausdrücken 2 Das Lexikon Gesamtheit
Semantik & Pragmatik 8. Mai 2006 1 Lexikalische Semantik Semantik lexikalische Semantik Semantik von einfachen Ausdrücken Satz-Semantik Semantik von zusammengesetzten Ausdrücken 2 Das Lexikon Gesamtheit
Patricia Harke Sindy Geißler
 Patricia Harke Sindy Geißler Sätze weisen eine hierarchische Struktur auf Lassen sich in ihre Bestandteile Phrasen/Konstituenten zerlegen [Die Katze] [sitzt gern auf der Tastatur]. Können selbst in ihre
Patricia Harke Sindy Geißler Sätze weisen eine hierarchische Struktur auf Lassen sich in ihre Bestandteile Phrasen/Konstituenten zerlegen [Die Katze] [sitzt gern auf der Tastatur]. Können selbst in ihre
DGY 17 Semantik Universität Athen, SoSe 2009
 DGY 17 Semantik Universität Athen, SoSe 2009 Winfried Lechner wlechner@gs.uoa.gr Handout #3 WAS SIND PRÄDIKATE? (ZUR FORM UND FUNKTION DER KONSTITUENTEN) Jede Konstituente im Satz kann in Hinblick auf
DGY 17 Semantik Universität Athen, SoSe 2009 Winfried Lechner wlechner@gs.uoa.gr Handout #3 WAS SIND PRÄDIKATE? (ZUR FORM UND FUNKTION DER KONSTITUENTEN) Jede Konstituente im Satz kann in Hinblick auf
Inhalt. Einleitung. Satzformen 1
 Inhalt Einleitung XI Satzformen 1 1 Reihenfolge von Satzteilen im einfachen Satz 3 Satzklammern 4 1.1 Die Unterscheidung von Stellungsfeldern 5 Stellungsfelder bei einteiligen Prädikaten 8 Stellungsfelder
Inhalt Einleitung XI Satzformen 1 1 Reihenfolge von Satzteilen im einfachen Satz 3 Satzklammern 4 1.1 Die Unterscheidung von Stellungsfeldern 5 Stellungsfelder bei einteiligen Prädikaten 8 Stellungsfelder
Einführung Computerlinguistik. Konstituentensyntax II
 Einführung Computerlinguistik Konstituentensyntax II Hinrich Schütze & Robert Zangenfeind Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung, LMU München 2013-11-18 Schütze & Zangenfeind: Konstituentensyntax
Einführung Computerlinguistik Konstituentensyntax II Hinrich Schütze & Robert Zangenfeind Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung, LMU München 2013-11-18 Schütze & Zangenfeind: Konstituentensyntax
Hausaufgabe 2 Linking, Regeln, Kongruenz, Adjunkte
 Einführung in die LFG Wintersemester 2010 Universität Konstanz Miriam Butt Sprechstunde Di 2 4 Hausaufgabe 2 Linking, Regeln, Kongruenz, Adjunkte Wer einen Anglistikschein machen möchte, sollte (wo angebracht)
Einführung in die LFG Wintersemester 2010 Universität Konstanz Miriam Butt Sprechstunde Di 2 4 Hausaufgabe 2 Linking, Regeln, Kongruenz, Adjunkte Wer einen Anglistikschein machen möchte, sollte (wo angebracht)
Syntax und Phonologie: Prosodische Phrasen
 Morphologie und Syntax (BA) Syntax und Phonologie: Prosodische Phrasen PD Dr. Ralf Vogel Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft Universität Bielefeld, SoSe 2008 Ralf.Vogel@Uni-Bielefeld.de 30.6.2008
Morphologie und Syntax (BA) Syntax und Phonologie: Prosodische Phrasen PD Dr. Ralf Vogel Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft Universität Bielefeld, SoSe 2008 Ralf.Vogel@Uni-Bielefeld.de 30.6.2008
