,6 29,3 4,0 2,5 6, CDCI3 4 26,0 34,0 34,0 25,0 5,0 4,5 5,0 303 CDCI3
|
|
|
- Friederike Kaiser
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 31 P-NMR-Untersuchungen an linearen Phosphorylphosphazenen 31 P NMR Investigations oil Linear Phosphorylphosphazenes Gerhard Schilling*, Claus W. Rabener und Wendel Lehr Anorganisch-Chemisches und Organisch-Chemisches Institut der Universität, Im Neuenheimer Feld 270, D-6900 Heidelberg Z. Naturforsch. 37b, (1982); eingegangen am 19. Juni P NMR Spectra, Linear Phosphorylphosphazenes The 31 P NMR Spectra of PCI3NPCI2O (1) and the homologous compounds 2-4 do not indicate any rotational isomers in the temperature range K. The observed values for v/2 depend on the viscosity of the solvent and on the temperature of the sample. They are reduced to T 1 relaxation effects, where the spin rotational mechanism may be dominant in the case of the small molecules and the PCI3 group. Nach 31 P-NMR-Untersuchungen existiert bei Diphosphinaminen in Lösung ein Rotamerengleichgewicht [1]. Auch die Polymeren (NPF2)n und (NP(0CH2CF3)2)n, die aber ein P=N P-Gerüst besitzen, zeigen laut Röntgenstrukturanalyse unterhalb 56 C eine planare a's-jrarw-geometrie, bei höherer Temperatur dagegen eine nicht planare Anordnung [2]. Inzwischen -wurde bei PCl3NPCl20 (1), dem einfachsten Vertreter dieser Stoffklasse, das Vorliegen von drei Rotationsisomeren beschrieben [3]. Im Rahmen unserer Untersuchungen an Phosphazenen haben wir 1 a, die mit 15 N markierte Verbindung 1 b und die entsprechenden Homologen 2-4 dargestellt und mit Hilfe der 31 P-NMR- Spektroskopie die Frage nach der Existenz von Rotameren bei diesem Verbindungstyp zu beantworten versucht. Ergebnisse und Diskussion In den Tabn. I-IV sind die spektroskopischen Daten für 1-4 zusammengefaßt. Die 31 P-NMR- Spektren von 2-4 sind nicht nach erster Ordnung Tab. II. 31 P-Chemische Verschiebungen für 1-4 bei 36,43 MHz in verschiedenen Lösungsmitteln gegen ext. H3PO4 (85%). a b c d e Lösungsmittel 1 + 2,9 11,7 CD3CN 2,2 12,0 C2D2CI4 2,3 12,3 4,9 14,1 CFCI ,3 19,9 12,7 CD3CN + 4,6 19,9 11, ,1 15,8 20,4 11, ,6 14,6 16,4 21,2 11,1 Tab. I. Kopplungskonstanten i, J (Hz) für 1-4 in Abhängigkeit von der Temperatur und vom Lösungsmittel. la 18,5 20,4 19,3 lb 18,5 20,4 2 30,9 31,3 33,8 31,6 3 32,8 36,0 ab bc cd de ac bd ce a 15 N bi5n T(K) Lösungsmittel ,7 26,0 37,2 44,4 4,0 2,5 6,3 + 18,0 12, , ,5 29, , ,0 34,0 34,0 25,0 5,0 4,5 5,0 + Nicht ermittelt wegen zu großer Halbwertsbreite. * Sonderdruckanforderungen an Dr. G. Schilling /82/ /$ 01.00/0 rein, CFCI3, C2D2CI4 CD3CN CFCI3 rein CD3CN Dieses Werk wurde im Jahr 2013 vom Verlag Zeitschrift für Naturforschung in Zusammenarbeit mit der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.v. digitalisiert und unter folgender Lizenz veröffentlicht: Creative Commons Namensnennung 4.0 Lizenz. This work has been digitalized and published in 2013 by Verlag Zeitschrift für Naturforschung in cooperation with the Max Planck Society for the Advancement of Science under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
2 W. Lehr et al. 31 P-N"MR-Untersuchungen an linearen Phosphorylphosphazenen 39 Tab. III. Halbwertsbreite v/2 (Hz) als Funktion der Temperatur für 1, POCL3, (PNC12)3 und (PNC12)4;5. T 1, PCI3 1, PC120 POCI3 (PNC1 3 )3 (PNC1 2) 4i , ,0 4, ,5 3,2 3 1, ,5 3, ,0 2,0 Tab. IV. Halbwertsbreite v/2 (Hz) als Funktion des Lösungsmittels bei 1. PCI3 PC120 Viskosität rj CD3CN ,375 C2D2CI4 12,4 6,1 1,844 CDCls 15,0 6,8 0,596 CFC13 20,0 11,0 0,31* * Wert aus: Frigen", Handbuch für die Kälte- und Klimatechnik, Farbwerke Hoechst AG, Frankfurt/M auswertbar, sie wurden deshalb durch Simulation berechnet. Dabei wurden solange die Parameter Kopplungskonstante J, chemische Verschiebung 6 und die Halbwertsbreite v/2 geändert, bis experimentelles und berechnetes Spektrum praktisch übereinstimmten. Änderungen in der Halbwertsbreite erwiesen sich als notwendig, da bei verschiedenen Kernen eines Moleküls verschiedene Halbwertsbreiten auftreten. la PC13NPC120 2 PC13NPC12NPC120 lb PC13 15 NPC120 3 Pa3NPa2NPCl2NPCl20 4 PCl3NPa2NPCl2NPCl2NPCl20 Eine zweimal sorgfältig unter Stickstoff destillierte Probe von la zeigt bei 314 und 324 K ein AB- Spinsystem mit J = 18 Hz. Weitere Temperaturerhöhung verursacht lediglich eine Vergrößerung der Halbwertsbreite (v/2). Auch in der unterkühlten Schmelze konnte das von Glidewell [3] angegebene Spektrum nicht reproduziert werden. In CFC13 als Lösungsmittel (Abb. 1) unterscheidet sich das Spektrum nicht von dem in der Schmelze. Selbst bis zu einer Temperatur von 183 K sind Vorgänge, die auf Koaleszenzphänomene hinweisen, nicht zu beobachten; im Gegenteil, wir beobachten mit sinkender A 40 Hz V W/U/VK Abb P-NMR-Spektren von 1 a (A), reine Schmelze bei 314 K; lb in CDC13 bei 223 K (B) und in CFC13 bei 183 K (C). x Rotationsseitenbanden. Temperatur eine signifikante Abnahme von v/2 (Tab. III) bei gleichbleibender Kopplungskonstante 2 JPNP. In C2D2Cl4 steigt 2 JPNP um 2 Hz an, ändert sich jedoch nicht bis 413 K. Wenn bei 1 Rotamere vorliegen und die Literaturdaten bezüglich der Kopplungskonstanten für diese Isomeren zutreffen [3], dann muß aus der Konstanz der Werte für 2 «7PNP in Lösung und in der Schmelze geschlossen werden, daß zwischen 183 und 413 K das Rotamerengleichgewicht konstant ist. Es folgt außerdem, daß die Energiebarriere sehr klein sein muß, so daß sich die Rotameren rasch ineinander umwandeln. Wie 1 wurden auch die Verbindungen 2, 3 und 4 bis 213 K vermessen, darüber hinaus 2 auch in der Schmelze untersucht. Die Spektren von 4 sind sehr kompliziert und konnten bisher quantitativ nur für T = K ausgewertet werden. Trotzdem erkennt man bei 4 wie auch bei 2 und 3 keinerlei Anzeichen
3 40 W. Lehr et al. 31P-N"MR-Untersuchungen an linearen Phosphorylphosphazenen 40 die Spektren mit gleichem v/2 bei und 223 K berechnet haben (Abb. 2). Aus Abb. 2 ist, wie der Vergleich mit den berechneten Spektren zeigt, die unterschiedliche Halbwertsbreite für die PCk-Gruppe und die restlichen Phosphoratome zu erkennen. Diese Unterschiede findet man bei allen Verbindungen, wobei bei 1 die Unterschiede besonders ausgeprägt sind. Die Vermutung, Änderungen v o n v/2 könnten auf Relaxationsphänomene zurückzuführen sein, veranlaß te uns, zunächst die zu 9 8 % mit 15 N angereicherte Verbindung l b herzustellen, denn häufig werden Verbreiterungen auf die nicht vollständig ausgemittelte Kopplung zum 1 5 N-Kern mit seinem Quadrupolmoment zurückgeführt [4, 5]. l b verhält sich jedoch exakt wie die nicht markierte Verbindung 1 a. Ein weiterer Relaxationsmechanismus, der eine ähnliche Abhängigkeit v o n der Temperatur aufweist, ist die Relaxation durch Spin-Rotation. Dieser Mechanismus (SR) tritt vor allem bei kleinen Molekülen auf [6]. Wir haben deshalb zum Vergleich bei POCI3 und (PNCl2)3-5 v/2 als Funktion der Temperatur gemessen (Tab. I I I ) und finden wie im Falle von 1-4 dieselbe Temperaturabhängigkeit. Abb P-NMR-Spektren von 8 in CDC13 bei 36,43 MHz; A bei K, C bei 223 K, B und D berechnete Spektren mit v/2 = 4 Hz. für beginnende Koaleszenzvorgänge. Signifikant sind jedoch bei allen Verbindungen die mit fallender Temperatur abnehmenden Halbwertsbreiten. Verglichen mit 1 zeigen 2 und noch deutlicher 3 und 4 bereits bei Zimmertemperatur eine geringere Halb wertsbreite, die Abnahme von v/2 mit fallender Temperatur ist deshalb nicht mehr so stark ausgeprägt. Den gleichen Effekt finden wir auch bei den Cyclophosphazenen, z. B. nimmt v/2 bei (NPCl2)8 zwischen und 173 K nur noch um 1 Hz ab. Die gesteigerte Auflösung der Spektren bei tieferen Temperaturen wird bei 2-4 vor allem durch das Anwachsen der Kopplungskonstanten verursacht. Deutlich erkennt man diese Tatsache an Verbindung 3, bei der wir mit den Daten aus Tab. I und II POCI3 relaxiert praktisch ausschließlich nach den SR-Mechanismus [7]. Nach Hubbard [8] und Aksnes [7] gilt TXSR-1 ~ k T/rj, wobei rj die Viskosität des Lösungsmittels ist. Wendet man diese Beziehung auf 1 an, so ergibt sich eine gute Korrelation zwischen der Temperatur und v/2. Dabei wurde TISR-1 * v/2 angenommen (Abb. 3). Auf Grund dieser Tatsache scheint uns vor allem bei 1 und weniger ausgeprägt bei 2-4 der SR-Mechanismus für die beobachteten Halb wertsbreiten verantwortlich zu sein. Aus Abb. 2 wird deutlich, daß die W erte für die PCl3-Gruppe weniger gut korrelieren. Möglicherweise werden die noch ausstehenden Ti-Messungen zeigen, daß für diese Gruppe die Relaxation nicht nur über die Rotation des Gesamtmoleküls sondern zusätzhch über eine Eigenrotation ei folgt. Damit wären auch die höheren Halbwertsbreiten der PCIsGruppe bei den übrigen Verbindungen 2-4 erkläit. Ähnliche Verhältnisse sind bei Methyl- und Trifluormethylgruppen beschrieben [9]. Eine weitere Stütze für den vorgeschlagenen Mechanismus sehen wir in der Abhängigkeit der Halb wertsbreite v o m Lösungsmittel (Tab. IV). Entsprechend der Hubbard-Gleichung findet man eine indirekte Proportionalität zwischen v/2 und der Viskosität des Lösungsmittels.
4 W. Lehr et al. 31 P-N"MR-Untersuchungen an linearen Phosphorylphosphazenen 41 TOO h h hl K Abb. 3. Korrelation zwischen v/2 und k T/r] für 1. # ^/2(HZ) berechnete, 0, 0 = experimentelle Werte. Getrennt von den Relaxationsphänomenen müssen die Änderungen in den chemischen Verschiebungen und Kopplungskonstanten betrachtet werden. Von den Verschiebungsänderungen ist vor allem die PCl3-Gruppe betroffen. Sie wird in 1 beim Übergang von CFC13 zu CD3CN um 263 Hz nach tieferem Feld verschoben, während die POCI2-Gruppe lediglich eine Verschiebung von 87 Hz erfährt. Ähnliche Effekte treten auch bei 2 auf (Tab. II). Auch der Temperatureinfluß wirkt wesentlich stärker auf die PC13-Gruppe als auf die übrigen Phosphoratome; auf diese Tatsache haben schon Riesel et al. [10] hingewiesen. Eine dritte Größe, nämlich die Kettenlänge beeinflußt diese Gruppe signifikant, während der Rest des Moleküls praktisch nicht auf diesen Parameter reagiert. Die Änderungen der Kopplungskonstanten in Abhängigkeit vom Lösungsmittel sind eindeutig zu erkennen, doch ist bei dem vorliegenden Datenmaterial kein systematischer Gang zu erkennen. Beachtenswert sind hier vor allem die x JpN-Kopplungen bei lb: in CFCI3 betragen sie 18 und ~0 Hz, in 12,5 und 4 Hz. Mit fallender Temperatur nehmen bei 2-4 die Kopplungen zu, z.b. wurde bei 3 J in Schritten von 10 gemessen und eine lineare Zunahme festgestellt. Beachtenswert ist hierbei die starke Zunahme der weiter reichenden Kopplungen ( 4 «7pp; Abb. 1). Im Gegensatz zu 2-4 sind die Kopplungskonstanten für 1 bis 193 K konstant. Auch die Kettenlänge wirkt auf die Größe der Kopplungskonstanten. Dabei nehmen die 2 Jpp-Kopplungen mit wachsender Kettenlänge zu. Betroffen davon sind vornehmlich die Kopplungen im Inneren der Kette. Die geschilderten Effekte - Änderungen in den chemischen Verschiebungen und Kopplungskonstanten - können erklärt werden, wenn Konformerengleichgewichte bei 2-4 ausgebildet werden, deren einzelne Individuen zwar durch eine sehr kleine Energiebarriere voneinander getrennt sind, von denen aber z.b. bei tiefer Temperatur oder beim Wechsel des Lösungsmittels eines bevorzugt im Gleichgewicht vorhegt. Wahrscheinlicher erscheint jedoch, daß Lösungsmittel etc. in das Bindungssystem, etwa durch Polarisierung, eingreifen. In diesem Zusammenhang gewinnt die bei allen Verbindungen festgestellte höhere Halbwertsbreite und die daraus abgeleitete Rotation der PCI3-Gruppe eine außerordentliche Bedeutung. Würden T-l- Messungen diesen Befund endgültig beweisen, dann sollten exaktere Aussagen über die Bindungsverhältnisse in solchen Molekülen möglich sein.
5 42 W. Lehr et al. 31 P-N"MR-Untersuchungen an linearen Phosphorylphosphazenen 42 Experimenteller Teil Verbindungen 1, lb und 2 wurden nach bekannten Verfahren dargestellt [11]. Verbindung 3 wurde analog der Vorschrift in [12] hergestellt. Abweichend hiervon gelang es erstmals, das Produkt durch Kurzweg-UH-Vakuumdestillation zu reinigen [13]. Abweichend von den bisher behandelten Produkten wurde 4 durch Hydrolyse von (a3pnpcl2npcl2npcl2npcl3) + PCl6- mit Ameisensäure gewonnen [13]. Die Proben wurden mittels einer Abfüll-Vorrichtung unter Stickstoff in die NMR-Röhrchen überführt, mit ultra-trockenen Lösungsmitteln versetzt und dann Reste von im Lösungsmittel noch vorhandenem Sauerstoff durch Evakuieren entfernt: Apparatur-Zeichnung [14]. [1] I. J. Colquhoun und W. McFarlane, C. Chem. Soc. 1977, [2] H. R. Allcock, G. F. Konopski, R. L. Kugel und E. G. Stroh, Chem. Commun. 1970, 985; H. R. Allcock, R. L. Kugel und E. G. Stroh, Inorg. Chem. 11, 1120 (1972). [3] C. Glide well, Inorg. Chim. Acta 87, L 523 (1979). [4] R. Keat und G. Bulloch, Inorg. Chimia Acta 33, 245 (1979). [5] H. Agahigian, G. D. Vickers, J. Roscoe und J. Bishop, J. Chem. Phys. 39, 1621 (1963). [6] R. K. Harris und E. M. Mc Vicker, J. Chem. Soc. Faraday II 72, 2291 (1976). [7] W. D. Aksnes, M. Rhodes und J. G. Powles, Mol. Phys. 14, 333 (1968). [8] P. S. Hubbard, Phys. Rev. 131, 1155 (1963). [9] B. E. Mann, NMR and Periodic Table", Acad. Press, London [10] L. Riesel, J. Steinbach und B. Thomas, Z. Anorg. Allg. Chem. 451, 5 (1979). [12] A. A. Volodin, V. V. Kireev, V. V. Khoroshak und E. A. Filipov, Z. Obsch. Khim. 42, 510 (1972); J. Gen. Chem. 42, 104 (1972). [11] M. Becke-Goering und W. Lehr, Z. Anorg. Allg. Chem. 325, 287 (1963). [13] W. Lehr und C. W. Rabener, Ringspaltungen von Chlorocyclophosphazenen mit PCI5, in Vorbereitung. [14] C. W. Rabener, Dissertation Univ. Heidelberg 1980.
Spektroskopische Methoden in der Organischen Chemie (OC IV) NMR Spektroskopie 1. Physikalische Grundlagen
 NMR Spektroskopie 1. Physikalische Grundlagen Viele Atomkerne besitzen einen von Null verschiedenen Eigendrehimpuls (Spin) p=ħ I, der ganz oder halbzahlige Werte von ħ betragen kann. I bezeichnet die Kernspin-Quantenzahl.
NMR Spektroskopie 1. Physikalische Grundlagen Viele Atomkerne besitzen einen von Null verschiedenen Eigendrehimpuls (Spin) p=ħ I, der ganz oder halbzahlige Werte von ħ betragen kann. I bezeichnet die Kernspin-Quantenzahl.
Teil 2 NMR-Spektroskopie. Dr. Christian Merten, Ruhr-Uni Bochum, WiSe 2017/18
 Teil 2 NMR-Spektroskopie Dr. Christian Merten, Ruhr-Uni Bochum, WiSe 2017/18 www.ruhr-uni-bochum.de/chirality 1 Rückblick Chemische Verschiebung Chemische Umgebung Funktionelle Gruppen Signalintensitäten
Teil 2 NMR-Spektroskopie Dr. Christian Merten, Ruhr-Uni Bochum, WiSe 2017/18 www.ruhr-uni-bochum.de/chirality 1 Rückblick Chemische Verschiebung Chemische Umgebung Funktionelle Gruppen Signalintensitäten
Spektroskopie in der Organischen Chemie. Spin-Entkopplung
 Spin-Entkopplung Spin-Spin-Kopplung zwischen nichtäquivalenten Kernen führt zur Aufspaltung der Signale der Kopplungspartner: im Falle größerer Spinsysteme können komplexe Multiplettsignale entstehen.
Spin-Entkopplung Spin-Spin-Kopplung zwischen nichtäquivalenten Kernen führt zur Aufspaltung der Signale der Kopplungspartner: im Falle größerer Spinsysteme können komplexe Multiplettsignale entstehen.
5 Die Photolyse von Methyl-Semiquadratsäureamid
 44 5 Die Photolyse von Methyl-Semiquadratsäureamid 5 Die Photolyse von Methyl-Semiquadratsäureamid 5.1 Vorbemerkungen: Methylsemiquadratsäureamid (53) unterscheidet sich von Semiquadratsäureamid (48) nur
44 5 Die Photolyse von Methyl-Semiquadratsäureamid 5 Die Photolyse von Methyl-Semiquadratsäureamid 5.1 Vorbemerkungen: Methylsemiquadratsäureamid (53) unterscheidet sich von Semiquadratsäureamid (48) nur
Spektroskopie in der Organischen Chemie. 1 H, 1 H-Kopplungskonstanten. Geminale Kopplungen
 Spektroskopie in der rganischen hemie Geminale Kopplungen 1, 1 -Kopplungskonstanten Wenn sich die beiden Kopplungspartner (wie Zwillinge; lat.: gemini) am gleichen Kohlenstoffatom befinden, also nur zwei
Spektroskopie in der rganischen hemie Geminale Kopplungen 1, 1 -Kopplungskonstanten Wenn sich die beiden Kopplungspartner (wie Zwillinge; lat.: gemini) am gleichen Kohlenstoffatom befinden, also nur zwei
8 Kristallisation von Propen Copolymeren und Ethen-1-Hexen Copolymeren
 60 Einleitung 8 Kristallisation von Propen Copolymeren und Ethen-1-Hexen Copolymeren 8.1 Einleitung Die Untersuchung der Kristallisation von Polymeren ist ein dynamisches Wissenschaftsgebiet, erst mit
60 Einleitung 8 Kristallisation von Propen Copolymeren und Ethen-1-Hexen Copolymeren 8.1 Einleitung Die Untersuchung der Kristallisation von Polymeren ist ein dynamisches Wissenschaftsgebiet, erst mit
Strukturaufklärung (BSc-Chemie): Einführung
 Strukturaufklärung (BSc-Chemie): Einführung Prof. S. Grimme OC [TC] 13.10.2009 Prof. S. Grimme (OC [TC]) Strukturaufklärung (BSc-Chemie): Einführung 13.10.2009 1 / 25 Teil I Einführung Prof. S. Grimme
Strukturaufklärung (BSc-Chemie): Einführung Prof. S. Grimme OC [TC] 13.10.2009 Prof. S. Grimme (OC [TC]) Strukturaufklärung (BSc-Chemie): Einführung 13.10.2009 1 / 25 Teil I Einführung Prof. S. Grimme
13 C, 1 H-Kopplungskonstanten. 13 C, 1 H-Kopplungen hier leichter erkannt werden können. Spektroskopie in der Organischen Chemie
 Spektroskopie in der Organischen hemie 13, 1 -Kopplungskonstanten NMR-Signalaufspaltungen aufgrund von skalaren Kopplungen treten grundsätzlich bei beiden Kopplungspartnern auf. Entsprechend kann man 13,
Spektroskopie in der Organischen hemie 13, 1 -Kopplungskonstanten NMR-Signalaufspaltungen aufgrund von skalaren Kopplungen treten grundsätzlich bei beiden Kopplungspartnern auf. Entsprechend kann man 13,
Spektroskopische Methoden in der Organischen Chemie (OC IV) 8. NMR Spektroskopie und Dynamik
 8. NMR Spektroskopie und Dynamik 8.1 Lebenszeit von Zuständen 8.2 Intramolekulare Prozesse - Konformationsänderungen - molekulare Bewegungsprozesse 8.3 Intermolekulare Prozesse 8.4 Diffusion - Komplexbildung
8. NMR Spektroskopie und Dynamik 8.1 Lebenszeit von Zuständen 8.2 Intramolekulare Prozesse - Konformationsänderungen - molekulare Bewegungsprozesse 8.3 Intermolekulare Prozesse 8.4 Diffusion - Komplexbildung
Spinsysteme. AX 3 -Spinsystem
 Spinsysteme Eine Gruppe aus zwei oder mehreren Kernspins, die miteinander eine magnetische Wechselwirkung eingehen, bezeichnet man als ein Spinsystem. Die Struktur eines hochaufgelösten NMR-Spektrums und
Spinsysteme Eine Gruppe aus zwei oder mehreren Kernspins, die miteinander eine magnetische Wechselwirkung eingehen, bezeichnet man als ein Spinsystem. Die Struktur eines hochaufgelösten NMR-Spektrums und
Aufgabe 1: (18 Punkte)
 Aufgabe 1: (18 Punkte) In der Arbeitsgruppe Hilt wurde folgende Reaktionssequenz durchgeführt: A H 10 H B O O O 1 1 2 2 + 10 3 3 4 4 Δ DA- Produkt 6-9 5 5 6-9 2 Ph Ph Co(dppe) 2 3 3 4 4 Im ersten Reaktionsschritt
Aufgabe 1: (18 Punkte) In der Arbeitsgruppe Hilt wurde folgende Reaktionssequenz durchgeführt: A H 10 H B O O O 1 1 2 2 + 10 3 3 4 4 Δ DA- Produkt 6-9 5 5 6-9 2 Ph Ph Co(dppe) 2 3 3 4 4 Im ersten Reaktionsschritt
Spektroskopische Methoden in der Organischen Chemie (OC IV)
 2 3 4 O 1 2 3 1 N 5 6 O 5 4 6 Probleme bei der Interpretation von NMR Spektren großer Moleküle Zuordnung der Resonanzen Bestimmung der geometrischen Beziehungen (Bindungen, Abstände, Winkel) zwischen den
2 3 4 O 1 2 3 1 N 5 6 O 5 4 6 Probleme bei der Interpretation von NMR Spektren großer Moleküle Zuordnung der Resonanzen Bestimmung der geometrischen Beziehungen (Bindungen, Abstände, Winkel) zwischen den
Ergebnisse und Interpretation 54
 Ergebnisse und Interpretation 54 4 Ergebnisse In den Abbildungen 24/4.1 bis 29/4.1 werden die Laktat-Geschwindigkeits-Kurve und die Herzfrequenzwerte der beiden Schwimmgruppen (Männer: n=6, Frauen: n=8)
Ergebnisse und Interpretation 54 4 Ergebnisse In den Abbildungen 24/4.1 bis 29/4.1 werden die Laktat-Geschwindigkeits-Kurve und die Herzfrequenzwerte der beiden Schwimmgruppen (Männer: n=6, Frauen: n=8)
Homonukleare Korrelationsspektroskopie (COSY)
 Homonukleare Korrelationsspektroskopie (COSY) Hier wird ähnlich wie bei HETCOR in beiden Dimensionen die chemische Verschiebung abgebildet. Im homonuklearen Fall ( 1 H, 1 H COSY) jedoch, ist es in beiden
Homonukleare Korrelationsspektroskopie (COSY) Hier wird ähnlich wie bei HETCOR in beiden Dimensionen die chemische Verschiebung abgebildet. Im homonuklearen Fall ( 1 H, 1 H COSY) jedoch, ist es in beiden
Kurs "Spektroskopische Methoden in der Anorganischen und Organischen Chemie" Kernresonanzspektroskopie - Übungen Lösung zu NMR-6 (Blatt 1)
 Kernresonanzspektroskopie - Übungen Lösung zu NMR-6 (Blatt ) Zum Lösungsmittel: Das Kohlenstoffspektrum zeigt bei 77 ppm drei gleich große äquidistante Signale. Diese stammen von CDC 3. Chemische Verschiebungen
Kernresonanzspektroskopie - Übungen Lösung zu NMR-6 (Blatt ) Zum Lösungsmittel: Das Kohlenstoffspektrum zeigt bei 77 ppm drei gleich große äquidistante Signale. Diese stammen von CDC 3. Chemische Verschiebungen
5. Schwingungsspektroskopische Untersuchungen
 5. Schwingungsspektroskopische Untersuchungen Die Cyanid- und Thiocyanatliganden gehören als lineare Moleküle ohne Symmetriezentrum zu der Punktgruppe C v. 117 Für das zweiatomige CN - -Molekül gibt es
5. Schwingungsspektroskopische Untersuchungen Die Cyanid- und Thiocyanatliganden gehören als lineare Moleküle ohne Symmetriezentrum zu der Punktgruppe C v. 117 Für das zweiatomige CN - -Molekül gibt es
7 HT-NMR-Experimente und CD-Messungen
 71 7 HT-M-Experimente und CD-Messungen 7.1 otamerengleichgewichte der -geschützten Verbindungen in der M-Spektroskopie Alle synthetisierten -geschützten Verbindungen zeigen sowohl im 1 H-M- als auch im
71 7 HT-M-Experimente und CD-Messungen 7.1 otamerengleichgewichte der -geschützten Verbindungen in der M-Spektroskopie Alle synthetisierten -geschützten Verbindungen zeigen sowohl im 1 H-M- als auch im
Spektroskopie-Seminar SS NMR-Spektroskopie. H-NMR-Spektroskopie. nuclear magnetic resonance spectroscopy- Kernmagnetresonanzspektroskopie
 1 H-NMR-Spektroskopie nuclear magnetic resonance spectroscopy- Kernmagnetresonanzspektroskopie 4.1 Allgemeines Spektroskopische Methode zur Untersuchung von Atomen: elektronische Umgebung Wechselwirkung
1 H-NMR-Spektroskopie nuclear magnetic resonance spectroscopy- Kernmagnetresonanzspektroskopie 4.1 Allgemeines Spektroskopische Methode zur Untersuchung von Atomen: elektronische Umgebung Wechselwirkung
7 Kernresonanz-Spektroskopische Untersuchungen
 7 Kernresonanz-Spektroskopische Untersuchungen 79 7 Kernresonanz-Spektroskopische Untersuchungen 7.1 1 H-MR-Signale Die 1 H-MR-Spektroskopie liefert aufgrund der charakteristischen chemischen Verschiebung
7 Kernresonanz-Spektroskopische Untersuchungen 79 7 Kernresonanz-Spektroskopische Untersuchungen 7.1 1 H-MR-Signale Die 1 H-MR-Spektroskopie liefert aufgrund der charakteristischen chemischen Verschiebung
Physik I TU Dortmund WS2017/18 Gudrun Hiller Shaukat Khan Kapitel 2
 1 .1.5 Experimentelle Aspekte von Kräften Bisher behandelt: - Gravitationskraft - Rückstellkraft einer Feder - Lorentzkraft: elektrisches und magnetisches Feld - Reibungskräfte - Scheinkräfte Gravitationskonstante
1 .1.5 Experimentelle Aspekte von Kräften Bisher behandelt: - Gravitationskraft - Rückstellkraft einer Feder - Lorentzkraft: elektrisches und magnetisches Feld - Reibungskräfte - Scheinkräfte Gravitationskonstante
Zusammenstellung der Koeffizienten für die Anpassung komplexer atomarer Streufaktoren für schnelle Elektronen durch Polynome
 nicht mit den theoretischen Berechnungen überein. Das deutet darauf hin, daß das DipolDipolWechselwirkungspotential in der 2. Ordnung der störungstheoretischen Behandlung der Nichtresonanzstöße den Stoßprozeß
nicht mit den theoretischen Berechnungen überein. Das deutet darauf hin, daß das DipolDipolWechselwirkungspotential in der 2. Ordnung der störungstheoretischen Behandlung der Nichtresonanzstöße den Stoßprozeß
Dynamische Prozesse Chemischer Austausch
 Dynamische Prozesse Chemischer Austausch Weil die Messfrequenz der Kernresonanz (100 bis 900 MHz, also ca. 10 8 bis 10 9 s -1 ) in einem Frequenzbereich liegt, in dem auch viele Molekülbewegungen (Moleküldynamik)
Dynamische Prozesse Chemischer Austausch Weil die Messfrequenz der Kernresonanz (100 bis 900 MHz, also ca. 10 8 bis 10 9 s -1 ) in einem Frequenzbereich liegt, in dem auch viele Molekülbewegungen (Moleküldynamik)
Teil 2: Spin-Spin Kopplung
 NMR-Spektroskopie Teil 2: Spin-Spin Kopplung 1. Die skalare Spin-Spin Kopplung 2. Multiplizitaet und Intensitaetsverteilung 3. Geminale, vicinale und allylische Kopplungskonstanten 4. Anschauliche Beschreibung
NMR-Spektroskopie Teil 2: Spin-Spin Kopplung 1. Die skalare Spin-Spin Kopplung 2. Multiplizitaet und Intensitaetsverteilung 3. Geminale, vicinale und allylische Kopplungskonstanten 4. Anschauliche Beschreibung
Hochauflösende NMR in Festkörpern
 Hochauflösende NMR in Festkörpern Strukturaufklärung in Phosphatgläsern Anne Wiemhöfer Agnes Wrobel Gliederung Auftretende Wechselwirkungen in der Festkörper NMR Flüssig- vs. Festkörper-NMR NMR Techniken
Hochauflösende NMR in Festkörpern Strukturaufklärung in Phosphatgläsern Anne Wiemhöfer Agnes Wrobel Gliederung Auftretende Wechselwirkungen in der Festkörper NMR Flüssig- vs. Festkörper-NMR NMR Techniken
NMR - Seite 1. NMR (Kernresonanzspektroskopie) Allgemeines zur Theorie
 NMR - Seite 1 NMR (Kernresonanzspektroskopie) Allgemeines zur Theorie Protonen besitzen ebenso wie Elektronen einen eigenen Spin (Drehung um die eigene Achse).Allerdings gibt es mehrere Möglichkeiten als
NMR - Seite 1 NMR (Kernresonanzspektroskopie) Allgemeines zur Theorie Protonen besitzen ebenso wie Elektronen einen eigenen Spin (Drehung um die eigene Achse).Allerdings gibt es mehrere Möglichkeiten als
Mündliche Prüfung Analytik: Moderne NMR Spektroskopie, Elektroanalytische Methoden, chemische Sensoren
 Mündliche Prüfung Analytik: Moderne NMR Spektroskopie, Elektroanalytische Methoden, chemische Sensoren Prüfer: W. Morf [M] und B. Jaun [J] Geprüfte: Susanne Kern [I] Dauer: 30 min Datum: 18.10.05 Allgemeines
Mündliche Prüfung Analytik: Moderne NMR Spektroskopie, Elektroanalytische Methoden, chemische Sensoren Prüfer: W. Morf [M] und B. Jaun [J] Geprüfte: Susanne Kern [I] Dauer: 30 min Datum: 18.10.05 Allgemeines
Research Collection. Optisch aktive Polyvinylketone Beziehungen zwischen optischer Aktivität und Stereoregularität. Doctoral Thesis.
 Research Collection Doctoral Thesis Optisch aktive Polyvinylketone Beziehungen zwischen optischer Aktivität und Stereoregularität Author(s): Allio, Angelo Publication Date: 1979 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-a-000173135
Research Collection Doctoral Thesis Optisch aktive Polyvinylketone Beziehungen zwischen optischer Aktivität und Stereoregularität Author(s): Allio, Angelo Publication Date: 1979 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-a-000173135
Spektroskopiemodul II. H-NMR und 13 C-NMR
 Spektroskopiemodul II 1 H-NMR und 13 C-NMR 1 1. Was gehört zu einer vollständigen Spektreninterpretation zur Strukturaufklärung? 1.1. 1 H-NMR-Spektren Man muss die chemische Verschiebung jedes einzelnen
Spektroskopiemodul II 1 H-NMR und 13 C-NMR 1 1. Was gehört zu einer vollständigen Spektreninterpretation zur Strukturaufklärung? 1.1. 1 H-NMR-Spektren Man muss die chemische Verschiebung jedes einzelnen
Cluster aus Halbleitern
 Halbleitercluster Halbleitercluster Cluster aus Halbleitern Insbesondere von Clustern aus im Festkörper halbleitenden Materialien wie Si oder Ge hatte man sich sehr viel für mögliche Anwendungen versprochen
Halbleitercluster Halbleitercluster Cluster aus Halbleitern Insbesondere von Clustern aus im Festkörper halbleitenden Materialien wie Si oder Ge hatte man sich sehr viel für mögliche Anwendungen versprochen
The Nature of Hydrogen Bonds in Cytidine-H + -Cytidine DNA Base Pairs
 The ature of Hydrogen Bonds in Cytidine-H + -Cytidine DA Base Pairs A. L. Lieblein, M. Krämer, A. Dreuw, B. Fürtig, H. Schwalbe, Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 4067 4070. Seminar Moderne Anwendungen der
The ature of Hydrogen Bonds in Cytidine-H + -Cytidine DA Base Pairs A. L. Lieblein, M. Krämer, A. Dreuw, B. Fürtig, H. Schwalbe, Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 4067 4070. Seminar Moderne Anwendungen der
Kapitel 5: Einfaktorielle Varianzanalyse
 Rasch, Friese, Hofmann & Naumann (006). Quantitative Methoden. Band (. Auflage). Heidelberg: Springer. Kapitel 5: Einfaktorielle Varianzanalyse Berechnen der Teststärke a priori bzw. Stichprobenumfangsplanung
Rasch, Friese, Hofmann & Naumann (006). Quantitative Methoden. Band (. Auflage). Heidelberg: Springer. Kapitel 5: Einfaktorielle Varianzanalyse Berechnen der Teststärke a priori bzw. Stichprobenumfangsplanung
Teil 1 Aufgaben zum Stoff der Vorlesung OC1a (Grundvorlesung Organische Chemie) Maximale Punktezahl: 20 Notwendige Mindestpunkte: 8
 1. Klausur OC1 (BSc-Studiengang) PIN: 18.02.2016 11:00 14:00 Uhr N6 Name: Punkte: Matrikel Nr. Note: Notenskala: 80-78=1.0 77-75=1.3 74-71=1.5 70-67=1.7 66-63=2.0 62-59=2.3 58-56=2.5 55-53=2.7 52-50=3.0
1. Klausur OC1 (BSc-Studiengang) PIN: 18.02.2016 11:00 14:00 Uhr N6 Name: Punkte: Matrikel Nr. Note: Notenskala: 80-78=1.0 77-75=1.3 74-71=1.5 70-67=1.7 66-63=2.0 62-59=2.3 58-56=2.5 55-53=2.7 52-50=3.0
NOESY und ROESY. Wir hatten gesehen (NMR-8), dass die Intensität eines 1 B
 NOESY und ROESY Wir hatten gesehen (NMR-8), dass die Intensität eines 1 B -Signals kann durch ein Entkopplungsexperiment verändert werden kann. Wird der Über- 2 A C gang eines ausgewählten 1 -Kerns S für
NOESY und ROESY Wir hatten gesehen (NMR-8), dass die Intensität eines 1 B -Signals kann durch ein Entkopplungsexperiment verändert werden kann. Wird der Über- 2 A C gang eines ausgewählten 1 -Kerns S für
Analytische Methoden in Org. Chemie und optische Eigenschaften von chiralen Molekülen
 Analytische Methoden in Org. Chemie und optische Eigenschaften von chiralen Molekülen Seminar 5. 0. 200 Teil : NMR Spektroskopie. Einführung und Physikalische Grundlagen.2 H NMR Parameter: a) Chemische
Analytische Methoden in Org. Chemie und optische Eigenschaften von chiralen Molekülen Seminar 5. 0. 200 Teil : NMR Spektroskopie. Einführung und Physikalische Grundlagen.2 H NMR Parameter: a) Chemische
Kernmagnetische Resonanzspektroskopie (NMR) Spektroskopische Methoden
 Kernmagnetische Resonanzspektroskopie (NMR) Spektroskopische Methoden Grundlagen Die meisten Atomkerne führen eine Drehbewegung um die eigene Achse aus ("Spin"). Da sie geladene Teilchen (Protonen) enthalten,
Kernmagnetische Resonanzspektroskopie (NMR) Spektroskopische Methoden Grundlagen Die meisten Atomkerne führen eine Drehbewegung um die eigene Achse aus ("Spin"). Da sie geladene Teilchen (Protonen) enthalten,
Spektroskopische Methoden in der Organischen Chemie (OC IV) C NMR Spektroskopie
 6. 3 C NMR Spektroskopie Die Empfindlichkeit des NMR Experiments hängt von folgenden physikalischen Parametern (optimale Abstimmung des Spektrometers vorausgesetzt) ab: Feldstärke B o, Temperatur T, gyromagnetisches
6. 3 C NMR Spektroskopie Die Empfindlichkeit des NMR Experiments hängt von folgenden physikalischen Parametern (optimale Abstimmung des Spektrometers vorausgesetzt) ab: Feldstärke B o, Temperatur T, gyromagnetisches
9. Tantal SIMS-Ergebnisse RTP-GETEMPERTE SBT-PROBEN OFENGETEMPERTE SBT-PROBEN
 9. Tantal 9.1. SIMS-Ergebnisse 9.1.1. RTP-GETEMPERTE SBT-PROBEN In Abbildung 32 sind die Tantal-Tiefenprofile nach Tempern der SBT-Proben im RTP dargestellt, in Abbildung 32 a) mit und in Abbildung 32
9. Tantal 9.1. SIMS-Ergebnisse 9.1.1. RTP-GETEMPERTE SBT-PROBEN In Abbildung 32 sind die Tantal-Tiefenprofile nach Tempern der SBT-Proben im RTP dargestellt, in Abbildung 32 a) mit und in Abbildung 32
6. Temperaturbehandlung Ag/Na-ionenausgetauschter Gläser
 Temperaturbehandlung Ag/Na-ionenausgetauschter Gläser 35 6. Temperaturbehandlung Ag/Na-ionenausgetauschter Gläser 6.1. Natriumsilikatglas Nach dem Ionenaustausch folgten Temperaturbehandlungen zwischen
Temperaturbehandlung Ag/Na-ionenausgetauschter Gläser 35 6. Temperaturbehandlung Ag/Na-ionenausgetauschter Gläser 6.1. Natriumsilikatglas Nach dem Ionenaustausch folgten Temperaturbehandlungen zwischen
Teil 2 NMR-Spektroskopie. Dr. Christian Merten, Ruhr-Uni Bochum, WiSe 2017/18
 Teil 2 NMR-Spektroskopie Dr. Christian Merten, Ruhr-Uni Bochum, WiSe 2017/18 www.ruhr-uni-bochum.de/chirality 1 Rückblick: Kopplungskonstanten Kopplungskonstante ist abhängig von der Entfernung der Kopplungspartner:
Teil 2 NMR-Spektroskopie Dr. Christian Merten, Ruhr-Uni Bochum, WiSe 2017/18 www.ruhr-uni-bochum.de/chirality 1 Rückblick: Kopplungskonstanten Kopplungskonstante ist abhängig von der Entfernung der Kopplungspartner:
Der Kern-Overhauser-Effekt (Nuclear Overhauser Effect, NOE)
 Der Kern-verhauser-Effekt (Nuclear verhauser Effect, NE) Die Intensität eines 1 H-Signals kann durch ein Entkopplungsexperiment verändert werden. Wird der Übergang eines ausgewählten 1 H-Kerns S für eine
Der Kern-verhauser-Effekt (Nuclear verhauser Effect, NE) Die Intensität eines 1 H-Signals kann durch ein Entkopplungsexperiment verändert werden. Wird der Übergang eines ausgewählten 1 H-Kerns S für eine
Spektroskopie-Seminar WS 17/18 5 NMR-Spektroskopie. H-NMR-Spektroskopie. nuclear magnetic resonance spectroscopy- Kernmagnetresonanzspektroskopie
 WS 17/18 1 -NMR-Spektroskopie nuclear magnetic resonance spectroscopy- Kernmagnetresonanzspektroskopie 1 5.1 1 -NMR-Spektroskopie NMR-Spektrum liefert folgende Informationen: Chemische Verschiebung δ(in
WS 17/18 1 -NMR-Spektroskopie nuclear magnetic resonance spectroscopy- Kernmagnetresonanzspektroskopie 1 5.1 1 -NMR-Spektroskopie NMR-Spektrum liefert folgende Informationen: Chemische Verschiebung δ(in
NMR-spektroskopische Untersuchungen an Chalkogenyerbindungen, III 77. C NMR Data of Compounds Containing C = S and C = S e Double Bonds
 NMR-spektroskopische Untersuchungen an Chalkogenyerbindungen, III Se- und 18C-NMR-Daten von Verbindungen mit C=S- und C Se-Doppelbindung NMR Spectroscopic Studies on Chalcogen Compounds, I I I Se and C
NMR-spektroskopische Untersuchungen an Chalkogenyerbindungen, III Se- und 18C-NMR-Daten von Verbindungen mit C=S- und C Se-Doppelbindung NMR Spectroscopic Studies on Chalcogen Compounds, I I I Se and C
Polarisationstransfer
 Polarisationstransfer Schon früh in der Geschichte der NMR-Spektroskopie hat man Experimente durchgeführt, bei denen auf einzelne Signale, d.h. bestimmte Spinübergänge, selektiv mit einer B 2 -Frequenz
Polarisationstransfer Schon früh in der Geschichte der NMR-Spektroskopie hat man Experimente durchgeführt, bei denen auf einzelne Signale, d.h. bestimmte Spinübergänge, selektiv mit einer B 2 -Frequenz
Teil 3: Spin-Spin Kopplung
 NMR-Spektroskopie Teil 3: Spin-Spin Kopplung 1. Die skalare Spin-Spin Kopplung 2. Multiplizitaet und Intensitaetsverteilung 3. Geminale, vicinale und allylische Kopplungskonstanten 4. Anschauliche Beschreibung
NMR-Spektroskopie Teil 3: Spin-Spin Kopplung 1. Die skalare Spin-Spin Kopplung 2. Multiplizitaet und Intensitaetsverteilung 3. Geminale, vicinale und allylische Kopplungskonstanten 4. Anschauliche Beschreibung
Struktur und Schwingungsspektrum des Kaliumundecawolframats Kgl^WnOsg* 11 H 2 0
 Struktur und Schwingungsspektrum des Kaliumundecawolframats Kgl^WnOsg* 11 H 2 0 Structure and Vibrational Spectrum of the Potassium Undecatungstate K 6 H 4 Wn03 8-1 1 H : 0 Thomas Lehmann und Joachim Fuchs*
Struktur und Schwingungsspektrum des Kaliumundecawolframats Kgl^WnOsg* 11 H 2 0 Structure and Vibrational Spectrum of the Potassium Undecatungstate K 6 H 4 Wn03 8-1 1 H : 0 Thomas Lehmann und Joachim Fuchs*
NMR Spektroskopie. Aufgaben
 hemische Verschiebung 1. Zeichnen Sie zu den nachfolgend aufgeführten Stoffen die Strukturformeln! Unterscheiden Sie dann zwischen chemisch äquvalenten und nichtäquivalenten Kernen. Bezeichnen Sie die
hemische Verschiebung 1. Zeichnen Sie zu den nachfolgend aufgeführten Stoffen die Strukturformeln! Unterscheiden Sie dann zwischen chemisch äquvalenten und nichtäquivalenten Kernen. Bezeichnen Sie die
NMR-Spektroskopie. Magnet. Steuerung. Probenrohr Spinner. Shimspulen. B -Spulen. Gradient 2. Vorverstärker
 NMR-Spektroskopie Magnet Steuerung He He CPU Frequenz Pulsform Pulsleistung Zeitkontrolle Temperierung Gradienten Shim/Lock/Gas Vorverstärker N N Probenrohr Spinner Shimspulen B -Spulen Gradient 2 H K
NMR-Spektroskopie Magnet Steuerung He He CPU Frequenz Pulsform Pulsleistung Zeitkontrolle Temperierung Gradienten Shim/Lock/Gas Vorverstärker N N Probenrohr Spinner Shimspulen B -Spulen Gradient 2 H K
Übungen zur Spektroskopie 2
 Übungen zur Spektroskopie 2 C. Dubler und Dr. D. S. Stephenson Department Chemie, Universität München Sie finden diese Übungen und alte Klausuren (mit Lösung) auf unserer Homepage: http://cicum200.cup.unimuenchen.de/intranet/depch/analytik/nmr_f/index.php
Übungen zur Spektroskopie 2 C. Dubler und Dr. D. S. Stephenson Department Chemie, Universität München Sie finden diese Übungen und alte Klausuren (mit Lösung) auf unserer Homepage: http://cicum200.cup.unimuenchen.de/intranet/depch/analytik/nmr_f/index.php
6 Diskussion Diskussion
 6 Diskussion 101 6 Diskussion In dieser Arbeit wurden Alkohole, die sich in der Kettenlänge, dem Grad der Verzweigung und der Position der OH-Gruppe unterscheiden, untersucht. Es konnte gezeigt werden,
6 Diskussion 101 6 Diskussion In dieser Arbeit wurden Alkohole, die sich in der Kettenlänge, dem Grad der Verzweigung und der Position der OH-Gruppe unterscheiden, untersucht. Es konnte gezeigt werden,
Wissenschaftliches Schreiben in der AC
 Wissenschaftliches Schreiben in der AC Saarbrücken, den 05.06.2015 6 Publikationen in Wissenschaftlichen Zeitschriften > 1 Einleitung Inhalte der Übung Wissenschaftliches Schreiben in der AC 1 Einleitung
Wissenschaftliches Schreiben in der AC Saarbrücken, den 05.06.2015 6 Publikationen in Wissenschaftlichen Zeitschriften > 1 Einleitung Inhalte der Übung Wissenschaftliches Schreiben in der AC 1 Einleitung
Multipuls-NMR in der Organischen Chemie. 1 H, 1 H, 1 H Relayed-COSY und TOCSY
 1 H, 1 H, 1 H Relayed-COSY und TOCSY Das 1 H, 1 H, 1 H-Relay-COSY-Experiment gehört historisch zu den älteren und wurde später durch das weit überlegene TOCSY-Experiment ersetzt. Dennoch sei es hier kurz
1 H, 1 H, 1 H Relayed-COSY und TOCSY Das 1 H, 1 H, 1 H-Relay-COSY-Experiment gehört historisch zu den älteren und wurde später durch das weit überlegene TOCSY-Experiment ersetzt. Dennoch sei es hier kurz
'Die Temperaturabhängigkeit der Petronenrelaxationszeiten des Systems Benzol-Silikagel
 Sonderdruck aus Zeitschr. für physikalische Chemie" 232, 276-280, 1966 'Die Temperaturabhängigkeit der Petronenrelaxationszeiten des Systems Benzol-Silikagel Von D. Freude, H. Pfeifer und H. Winkler Mit
Sonderdruck aus Zeitschr. für physikalische Chemie" 232, 276-280, 1966 'Die Temperaturabhängigkeit der Petronenrelaxationszeiten des Systems Benzol-Silikagel Von D. Freude, H. Pfeifer und H. Winkler Mit
Die Entwicklung des Erde-Mond-Systems
 THEORETISCHE AUFGABE Nr. 1 Die Entwicklung des Erde-Mond-Systems Wissenschaftler können den Abstand Erde-Mond mit großer Genauigkeit bestimmen. Sie erreichen dies, indem sie einen Laserstrahl an einem
THEORETISCHE AUFGABE Nr. 1 Die Entwicklung des Erde-Mond-Systems Wissenschaftler können den Abstand Erde-Mond mit großer Genauigkeit bestimmen. Sie erreichen dies, indem sie einen Laserstrahl an einem
NMR-Spektroskopie Teil 2
 BC 3.4 : Analytische Chemie I NMR Teil 2 NMR-Spektroskopie Teil 2 Stefanie Wolfram Stefanie.Wolfram.1@uni-jena.de Raum 228, TO Vom Spektrum zur Struktur 50000 40000 Peaks u. Integrale 30000 Chemische Verschiebung
BC 3.4 : Analytische Chemie I NMR Teil 2 NMR-Spektroskopie Teil 2 Stefanie Wolfram Stefanie.Wolfram.1@uni-jena.de Raum 228, TO Vom Spektrum zur Struktur 50000 40000 Peaks u. Integrale 30000 Chemische Verschiebung
NMR-Lösungsmittel. 1 H-NMR. Bei der Verwendung der normalen, nichtdeuterierten Lösungsmittel. Spektroskopie in der Organischen Chemie
 NMR-Lösungsmittel In der werden i.a. deuterierte Lösungsmittel verwendet. ie Substitution der leichten durch die schweren Wasserstoffatome hat zwei Vorteile: - euterium als Spin-1-Kern hat ebenfalls ein
NMR-Lösungsmittel In der werden i.a. deuterierte Lösungsmittel verwendet. ie Substitution der leichten durch die schweren Wasserstoffatome hat zwei Vorteile: - euterium als Spin-1-Kern hat ebenfalls ein
Phosphor(V)-Schwefel(VI)-nitrid-chloriden
 368 W. HAUBOLD UND E. FLUCK Untersuchungen der kernmagnetischen Resonanz von Phosphorverbindungen, XXV 1 31 PNMRSpektren von Phosphor(V)nitridchloriden und Phosphor(V)Schwefel(V)nitridchloriden 31 P NMR
368 W. HAUBOLD UND E. FLUCK Untersuchungen der kernmagnetischen Resonanz von Phosphorverbindungen, XXV 1 31 PNMRSpektren von Phosphor(V)nitridchloriden und Phosphor(V)Schwefel(V)nitridchloriden 31 P NMR
Spektroskopie-Seminar SS NMR-Spektroskopie. H-NMR-Spektroskopie. nuclear magnetic resonance spectroscopy- Kernmagnetresonanzspektroskopie
 1 H-NMR-Spektroskopie nuclear magnetic resonance spectroscopy- Kernmagnetresonanzspektroskopie 4 NMR-Spektroskopie 5.1 1 H-NMR-Spektroskopie Wasserstoffatome ( 1 H, natürliche Häufigkeit 99,985 %) mit
1 H-NMR-Spektroskopie nuclear magnetic resonance spectroscopy- Kernmagnetresonanzspektroskopie 4 NMR-Spektroskopie 5.1 1 H-NMR-Spektroskopie Wasserstoffatome ( 1 H, natürliche Häufigkeit 99,985 %) mit
Biophysikalische Studien fiber Blutserum-Eiweisse III. Ueber das Verhalten einiger Mineralstoffe im Blutserum bei elektrischer Aufladung* Von
 The Tohoku Journal of Experimental Medicine, Vol. 60, Nos. 3-4, 1954 Biophysikalische Studien fiber Blutserum-Eiweisse III. Ueber das Verhalten einiger Mineralstoffe im Blutserum bei elektrischer Aufladung*
The Tohoku Journal of Experimental Medicine, Vol. 60, Nos. 3-4, 1954 Biophysikalische Studien fiber Blutserum-Eiweisse III. Ueber das Verhalten einiger Mineralstoffe im Blutserum bei elektrischer Aufladung*
S erum -C reatinin unter T orasem id. A E Mittelwert+/- Stabw. am Beob.-anfang
 3. Ergebnisse Allgemein soll bereits an dieser Stalle darauf hingewiesen werden, dass neben den in den folgenden Abschnitten gezeigten Abbildungen weitere Tabellen und graphische Darstellungen zur Verbildlichung
3. Ergebnisse Allgemein soll bereits an dieser Stalle darauf hingewiesen werden, dass neben den in den folgenden Abschnitten gezeigten Abbildungen weitere Tabellen und graphische Darstellungen zur Verbildlichung
6 Zusammenfassung und Ausblick
 6. Zusammenfassung und Ausblick 117 6 Zusammenfassung und Ausblick Der Schwerpunkt dieser Arbeit lag in stationären und instationären Untersuchungen zur Methanolsynthese. Ein Ziel war, den Einfluss der
6. Zusammenfassung und Ausblick 117 6 Zusammenfassung und Ausblick Der Schwerpunkt dieser Arbeit lag in stationären und instationären Untersuchungen zur Methanolsynthese. Ein Ziel war, den Einfluss der
Reduction ofindigo: Kinetics andmechanism
 Diss. ETB No. 15268 Reduction ofindigo: Kinetics andmechanism A dissertation submitted to the Swiss Federal Institute oftechnology (ETH), Zurich for the degree of Doctor oftechnical Seiences presented
Diss. ETB No. 15268 Reduction ofindigo: Kinetics andmechanism A dissertation submitted to the Swiss Federal Institute oftechnology (ETH), Zurich for the degree of Doctor oftechnical Seiences presented
1.Vortrag: Rechnen mit Restklassen/modulo einer Zahl
 Westfälische Wilhelms-Universität Münster Mathematik Sommersemester 2017 Seminar: Verschlüsselungs- und Codierungstheorie Leitung: Thomas Timmermann 1.Vortrag: Rechnen mit Restklassen/modulo einer Zahl
Westfälische Wilhelms-Universität Münster Mathematik Sommersemester 2017 Seminar: Verschlüsselungs- und Codierungstheorie Leitung: Thomas Timmermann 1.Vortrag: Rechnen mit Restklassen/modulo einer Zahl
Der Urknall und die Kosmische Hintergrundstrahlung
 und die Kosmische Hintergrundstrahlung Seminar Astroteilchenphysik in der Theorie und Praxis Physik Department Technische Universität München 12.02.08 und die Kosmische Hintergrundstrahlung 1 Das Standardmodell
und die Kosmische Hintergrundstrahlung Seminar Astroteilchenphysik in der Theorie und Praxis Physik Department Technische Universität München 12.02.08 und die Kosmische Hintergrundstrahlung 1 Das Standardmodell
Schriftliche Prüfung BSc Frühling 2008
 Prüfungen Analytische Chemie Samstag, 9. Februar 2008 Schriftliche Prüfung BSc Frühling 2008 D CHAB/BIL Vorname:... Name:... Jede Aufgabe wird separat bewertet. Die maximal erreichbare Punktzahl beträgt
Prüfungen Analytische Chemie Samstag, 9. Februar 2008 Schriftliche Prüfung BSc Frühling 2008 D CHAB/BIL Vorname:... Name:... Jede Aufgabe wird separat bewertet. Die maximal erreichbare Punktzahl beträgt
Diskussion der Ergebnisse
 5 Diskussion der Ergebnisse Die Auswertung der Basiseigenschaften der Gläser beider Versuchsreihen lieferte folgende Ergebnisse: Die optische Einteilung der hergestellten Gläser konnte in zwei Gruppen
5 Diskussion der Ergebnisse Die Auswertung der Basiseigenschaften der Gläser beider Versuchsreihen lieferte folgende Ergebnisse: Die optische Einteilung der hergestellten Gläser konnte in zwei Gruppen
1 1 H-NMR-Spektroskopie in metallorganischen Komplexen. 1.1 Allgemeines. 1.2 Chiralität in Metallkomplexen 1.3 Dynamische Prozesse
 1 1 H-NMR-Spektroskopie in metallorganischen Komplexen 1.1 Allgemeines Chemische Verschiebungen Beispiele für einfache Komplexe 1.2 Chiralität in Metallkomplexen 1.3 Dynamische Prozesse 1.4 Heteronukleare
1 1 H-NMR-Spektroskopie in metallorganischen Komplexen 1.1 Allgemeines Chemische Verschiebungen Beispiele für einfache Komplexe 1.2 Chiralität in Metallkomplexen 1.3 Dynamische Prozesse 1.4 Heteronukleare
3.1 Zur Photochemie von HNO 3 11 Abbildung 3.1: Das UV-Absorptionsspektrum von HNO 3 nach [71] Abbildung 3.2: Das UV-Absorptionsspektrum von HNO 3 nac
![3.1 Zur Photochemie von HNO 3 11 Abbildung 3.1: Das UV-Absorptionsspektrum von HNO 3 nach [71] Abbildung 3.2: Das UV-Absorptionsspektrum von HNO 3 nac 3.1 Zur Photochemie von HNO 3 11 Abbildung 3.1: Das UV-Absorptionsspektrum von HNO 3 nach [71] Abbildung 3.2: Das UV-Absorptionsspektrum von HNO 3 nac](/thumbs/53/31354364.jpg) Kapitel 3 Grundlagen der Photochemie von HNO 3 und Modellentwicklung 3.1 Zur Photochemie von HNO 3 Salpetersaure ist ein wichtiges Nebenprodukt des photochemischen Smogs [67], und es ist ein relevanter
Kapitel 3 Grundlagen der Photochemie von HNO 3 und Modellentwicklung 3.1 Zur Photochemie von HNO 3 Salpetersaure ist ein wichtiges Nebenprodukt des photochemischen Smogs [67], und es ist ein relevanter
NMR Spektroskopie. 1nm Frequenz X-ray UV/VIS Infrared Microwave Radio
 NMR Spektroskopie 1nm 10 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 Frequenz X-ray UV/VIS Infrared Microwave Radio Anregungsmodus electronic Vibration Rotation Nuclear Spektroskopie X-ray UV/VIS Infrared/Raman NMR
NMR Spektroskopie 1nm 10 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 Frequenz X-ray UV/VIS Infrared Microwave Radio Anregungsmodus electronic Vibration Rotation Nuclear Spektroskopie X-ray UV/VIS Infrared/Raman NMR
Acta Universitatis Carolinae. Mathematica et Physica
 Acta Universitatis Carolinae. Mathematica et Physica E. Vavřinec Elektrische Erscheinungen bei der plastischen Deformation von Silberchloridkristallen Acta Universitatis Carolinae. Mathematica et Physica,
Acta Universitatis Carolinae. Mathematica et Physica E. Vavřinec Elektrische Erscheinungen bei der plastischen Deformation von Silberchloridkristallen Acta Universitatis Carolinae. Mathematica et Physica,
Spins Do -Experimenteller Magnetismus
 29.11.2017 Spins Do -Experimenteller Magnetismus Martin Valldor IBM-Ahmed Email: m.valldor@ifw-dresden.de 1 Rückblick auf magnetisches Chaos Das magnetiche Chaos kann aus Domänen oder Verdünnung entstehen.
29.11.2017 Spins Do -Experimenteller Magnetismus Martin Valldor IBM-Ahmed Email: m.valldor@ifw-dresden.de 1 Rückblick auf magnetisches Chaos Das magnetiche Chaos kann aus Domänen oder Verdünnung entstehen.
AC I (AC) HS 2011 Übungen + Lösungen Serie 10
 rof. A. Togni, D-CHAB, HCI H 239 AC I (AC) HS 2011 Übungen ösungen Serie 10 Koordinationschemie A 1. rinzipiell liessen sich sechs iganden () in einem Metallkomplex M 6 nicht nur oktaedrisch sondern auch
rof. A. Togni, D-CHAB, HCI H 239 AC I (AC) HS 2011 Übungen ösungen Serie 10 Koordinationschemie A 1. rinzipiell liessen sich sechs iganden () in einem Metallkomplex M 6 nicht nur oktaedrisch sondern auch
Kapitel 4: Meßergebnisse Vergleiche der aerodynamischen und akustischen Meßgrößen des Originalstaubsaugers und des modifizierten Staubsaugers
 Kapitel 4: Meßergebnisse 65 4.4 Vergleiche der aerodynamischen und akustischen Meßgrößen des Originalstaubsaugers und des modifizierten Staubsaugers In diesem Abschnitt werden die aerodynamischen und akustischen
Kapitel 4: Meßergebnisse 65 4.4 Vergleiche der aerodynamischen und akustischen Meßgrößen des Originalstaubsaugers und des modifizierten Staubsaugers In diesem Abschnitt werden die aerodynamischen und akustischen
Über den Zn-, Cu-, Pb-, Mn-, Fe- und Sr-Gehalt des Sediments im Neusiedler See. M.Dinka
 BFBBericht71,9599 Biologisches Forschungsinstitut für Burgenland, Illmitz 1989 Über den,,, Mn, und SrGehalt des Sediments im Neusiedler See M.Dinka Institut für Ökologie und Botanik der UAW, 2163 Väcratöt,
BFBBericht71,9599 Biologisches Forschungsinstitut für Burgenland, Illmitz 1989 Über den,,, Mn, und SrGehalt des Sediments im Neusiedler See M.Dinka Institut für Ökologie und Botanik der UAW, 2163 Väcratöt,
Elektrochemisches Verhalten der Nitrophenole und ihrer Reduktionsprodukte an Graphitelektroden
 Elektrochemisches Verhalten der Nitrophenole und ihrer Reduktionsprodukte an Graphitelektroden Electrochemical Behavior of the Nitrophenols and Their Reduction Products at Graphite Electrodes Elli Theodoridou*
Elektrochemisches Verhalten der Nitrophenole und ihrer Reduktionsprodukte an Graphitelektroden Electrochemical Behavior of the Nitrophenols and Their Reduction Products at Graphite Electrodes Elli Theodoridou*
Kombinierte Übungen zur Spektroskopie Beispiele für die Bearbeitung
 Im folgenden soll gezeigt werden, daß es großen Spaß macht, spektroskopische Probleme zu lösen. Es gibt kein automatisches Lösungsschema, sondern höchstens Strategien, wie beim "Puzzle Lösen"; häufig hilft
Im folgenden soll gezeigt werden, daß es großen Spaß macht, spektroskopische Probleme zu lösen. Es gibt kein automatisches Lösungsschema, sondern höchstens Strategien, wie beim "Puzzle Lösen"; häufig hilft
Spektroskopie-Seminar SS NMR-Spektroskopie. H-NMR-Spektroskopie. nuclear magnetic resonance spectroscopy- Kernmagnetresonanzspektroskopie
 1 H-NMR-Spektroskopie nuclear magnetic resonance spectroscopy- Kernmagnetresonanzspektroskopie 5.1 1 H-NMR-Spektroskopie NMR-Spektrum liefert folgende Informationen: Chemische Verschiebung d (in ppm):
1 H-NMR-Spektroskopie nuclear magnetic resonance spectroscopy- Kernmagnetresonanzspektroskopie 5.1 1 H-NMR-Spektroskopie NMR-Spektrum liefert folgende Informationen: Chemische Verschiebung d (in ppm):
1 Zahlentheorie. 1.1 Kongruenzen
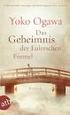 3 Zahlentheorie. Kongruenzen Der letzte Abschnitt zeigte, daß es sinnvoll ist, mit großen Zahlen möglichst einfach rechnen zu können. Oft kommt es nicht darauf, an eine Zahl im Detail zu kennen, sondern
3 Zahlentheorie. Kongruenzen Der letzte Abschnitt zeigte, daß es sinnvoll ist, mit großen Zahlen möglichst einfach rechnen zu können. Oft kommt es nicht darauf, an eine Zahl im Detail zu kennen, sondern
Bei näherer Betrachtung des Diagramms Nr. 3 fällt folgendes auf:
 18 3 Ergebnisse In diesem Kapitel werden nun zunächst die Ergebnisse der Korrelationen dargelegt und anschließend die Bedingungen der Gruppenbildung sowie die Ergebnisse der weiteren Analysen. 3.1 Ergebnisse
18 3 Ergebnisse In diesem Kapitel werden nun zunächst die Ergebnisse der Korrelationen dargelegt und anschließend die Bedingungen der Gruppenbildung sowie die Ergebnisse der weiteren Analysen. 3.1 Ergebnisse
PHYSIKO CHEMISCHE UNTERSUCHlJNGEN DER ALLYLÄTHOXY.SILANE I
 PHYSKO CHEMSCHE UNTERSUCHlJNGEN DER ALLYLÄTHOXY.SLANE Von J. NAGY und K. BECKER-PALOSSY Lehrstuhl für Anorganische Chemie, Technische Universität, Budapest. (Eingegangen am 14. November 1974) Die theoretische
PHYSKO CHEMSCHE UNTERSUCHlJNGEN DER ALLYLÄTHOXY.SLANE Von J. NAGY und K. BECKER-PALOSSY Lehrstuhl für Anorganische Chemie, Technische Universität, Budapest. (Eingegangen am 14. November 1974) Die theoretische
Chemische und Magnetische Äquivalenz
 Chemische und Magnetische Äquivalenz Das Aussehen von NMR-Signalen in Mehr-Spinsystemen wird ganz wesentlich davon beeinflusst, ob es äquivalente Kerne gibt oder nicht. ierbei sind zwei wichtige Arten
Chemische und Magnetische Äquivalenz Das Aussehen von NMR-Signalen in Mehr-Spinsystemen wird ganz wesentlich davon beeinflusst, ob es äquivalente Kerne gibt oder nicht. ierbei sind zwei wichtige Arten
Übungsaufgaben zur NMR-Spektrometrie
 Übungsaufgaben NMR 33 Übungsaufgaben zur NMR-Spektrometrie Aufgabe 1 a) Wieviele unterschiedliche Orientierungen des Kernmomentes relativ zu einem externen Magnetfeld sind beim 14 N-Kern (I = 1, γ = 1.932
Übungsaufgaben NMR 33 Übungsaufgaben zur NMR-Spektrometrie Aufgabe 1 a) Wieviele unterschiedliche Orientierungen des Kernmomentes relativ zu einem externen Magnetfeld sind beim 14 N-Kern (I = 1, γ = 1.932
Das Chemische Gleichgewicht
 Das Chemische Gleichgewicht 2 Ein chemisches Gleichgewicht herrscht dann, wenn Hin- sowie Rückreaktion gleich schnell ablaufen. Die Reaktionsgeschwindigkeit der Gesamtreaktion erscheint daher gleich null,
Das Chemische Gleichgewicht 2 Ein chemisches Gleichgewicht herrscht dann, wenn Hin- sowie Rückreaktion gleich schnell ablaufen. Die Reaktionsgeschwindigkeit der Gesamtreaktion erscheint daher gleich null,
Schriftliche Prüfung BSc Frühling 2010
 Prüfungen Analytische Chemie Donnerstag, 11. Februar 2010 Schriftliche Prüfung BSc Frühling 2010 D CHAB/BIL Vorname:... Name:... Jede Aufgabe wird separat bewertet. Die maximal erreichbare Punktzahl beträgt
Prüfungen Analytische Chemie Donnerstag, 11. Februar 2010 Schriftliche Prüfung BSc Frühling 2010 D CHAB/BIL Vorname:... Name:... Jede Aufgabe wird separat bewertet. Die maximal erreichbare Punktzahl beträgt
Wissenschaftliches Schreiben in der AC
 Wissenschaftliches Schreiben in der AC Saarbrücken, den 17.06.2016 6 Publikationen in Wissenschaftlichen Zeitschriften > 1 Einleitung Inhalte der Übung Wissenschaftliches Schreiben in der AC 1 Einleitung
Wissenschaftliches Schreiben in der AC Saarbrücken, den 17.06.2016 6 Publikationen in Wissenschaftlichen Zeitschriften > 1 Einleitung Inhalte der Übung Wissenschaftliches Schreiben in der AC 1 Einleitung
Teil 2 NMR-Spektroskopie. Dr. Christian Merten, Ruhr-Uni Bochum, WiSe 2016/17
 Teil 2 NMR-Spektroskopie Dr. Christian Merten, Ruhr-Uni Bochum, WiSe 2016/17 www.ruhr-uni-bochum.de/chirality 1 Rückblick: Kopplungskonstanten Kopplungskonstante ist abhängig von der Entfernung der Kopplungspartner:
Teil 2 NMR-Spektroskopie Dr. Christian Merten, Ruhr-Uni Bochum, WiSe 2016/17 www.ruhr-uni-bochum.de/chirality 1 Rückblick: Kopplungskonstanten Kopplungskonstante ist abhängig von der Entfernung der Kopplungspartner:
Bellsche Ungleichungen oder existiert Einstein s spukhafte Fernwirkung wirklich?
 Kapitel 1 Bellsche Ungleichungen oder existiert Einstein s spukhafte Fernwirkung wirklich? 1.1 Worum gehts? In vielen Experimenten mit verschiedensten Teilchen ist nun gezeigt worden, dass Verschränkung
Kapitel 1 Bellsche Ungleichungen oder existiert Einstein s spukhafte Fernwirkung wirklich? 1.1 Worum gehts? In vielen Experimenten mit verschiedensten Teilchen ist nun gezeigt worden, dass Verschränkung
Zusammenfassung 101 L 2 H 3
 Zusammenfassung 101 6. Zusammenfassung In dieser Arbeit gelang zum ersten Mal die Synthese und Charakterisierung von Übergangsmetall koordinierten Anilinoradikalen. Die Eigenschaften der koordinierten
Zusammenfassung 101 6. Zusammenfassung In dieser Arbeit gelang zum ersten Mal die Synthese und Charakterisierung von Übergangsmetall koordinierten Anilinoradikalen. Die Eigenschaften der koordinierten
Abschlussbericht zu Kennziffer 2472: Experimentelle Bestimmung von Grenzaktivitätskoeffizienten in ternären und höheren Elektrolytsystemen
 Abschlussbericht zu Kennziffer 2472: Experimentelle Bestimmung von Grenzaktivitätskoeffizienten in ternären und höheren Elektrolytsystemen Während es bei Nichtelektrolytsystemen möglich ist, mit Hilfe
Abschlussbericht zu Kennziffer 2472: Experimentelle Bestimmung von Grenzaktivitätskoeffizienten in ternären und höheren Elektrolytsystemen Während es bei Nichtelektrolytsystemen möglich ist, mit Hilfe
