Grundbegriffe: Intension, Extension, Referenz & mehr
|
|
|
- Edwina Lange
- vor 1 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Einführung in die Semantik und Pragmatik Grundbegriffe: Intension, Extension, Referenz & mehr Stefan Hartmann Bildmaterial, soweit nicht anders angegeben: Pixabay/Unsplash, CC0
2 Überblick ¾ Sinn und Bedeutung, Intension und Extension ¾ Referenz ¾ Wörter/Wortgruppen und ihre Semantik: ¾ Verben ¾ Nomen und Nominalgruppen ¾ Adjektive und Adjektivgruppen 2
3 Grundbegriffe Sinn und Bedeutung Es liegt nun nahe, mit einem Zeichen (Namen, Wortverbindung, Schriftzeichen) außer dem Bezeichneten, was die Bedeutung des Zeichens heißen möge, noch das verbunden zu denken, was ich den Sinn des Zeichens nennen möchte, worin die Art des Gegebenseins enthalten ist. [... ] Es würde die Bedeutung von Abendstern und Morgenstern dieselbe sein, aber nicht der Sinn. (...) Die regelmäßige Verknüpfung zwischen dem Zeichen, dessen Sinn und dessen Bedeutung ist derart, daß dem Zeichen ein bestimmter Sinn und diesem wieder eine bestimmte Bedeutung entspricht, währ end zu einer Bedeutung (einem Gegenstand) nicht nur ein Zeichen zugehört. (Frege, Über Sinn und Bedeutung, Hervorh. S.H.) 3 By NASA/JPL-Caltech - Public Domain,
4 Grundbegriffe Sinn und Bedeutung ¾ Sinn: Art des Gegebenseins Abendstern Morgenstern ¾ Bedeutung: das Bezeichnete selbst (in der Terminologie der heutigen Semantik: Referenz) Abensstern = Morgenstern anderer Bedeutungsbegriff! 4 By NASA/JPL-Caltech - Public Domain,
5 Grundbegriffe Sinn und Bedeutung ¾ Vorsicht: In der Terminologie der meisten modernen semantischen Ansätze ist Bedeutung NICHT (!!!) mit Referenz gleichzusetzen (wie bei Frege) ¾ Die Wörter Abendstern und Morgenstern referieren auf den Planeten Venus aber diese Referenz ist nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit ihrer Bedeutung! anderer Bedeutungsbegriff! 5 By NASA/JPL-Caltech - Public Domain,
6 Grundbegriffe Intension und Extension ¾ geht zurück auf Carnap, ähnliche Unterscheidung wie Sinn und Bedeutung, aber nicht deckungsgleich ¾ Intension: "Inhalt" oder "Konzept", der bzw. das durch den Ausdruck ausgedrückt wird; macht den Informationsgehalt eines Ausdrucks aus ¾ Extension: Klasse aller Entitäten, auf die ein Ausdruck aufgrund seiner Intension angewandt werden kann. 6 Morgenstern = Intension 1 Abendstern = Intension 2 Busse 2009: 36f.; Pafel & Reich 2016: 236; Gutzmann 2019: 6) Extension: Planet Venus
7 Grundbegriffe Intension und Extension ¾ Was ist die Intension des Ausdrucks der Präsident der USA? ¾ Staatsoberhaupt der USA ¾ Oberbefehlshaber der US-Armee ¾ etc. 7
8 Grundbegriffe Intension und Extension ¾ Was ist die Extension des Ausdrucks der Präsident der USA? 8 Bilder: Wikimedia Commons / Public Domain gegenwärtige Welt etc.
9 Grundbegriffe Intension und Extension ¾ Extension kann auch eine leere Menge sein: ¾ der König von Deutschland hat in der gegenwärtigen Welt keine Extension. ¾ Extension kann auch eine Menge von genau einem Element sein, z.b. der Präsident der USA oder der Papst (jeweils in der gegenwärtigen Welt) 9
10 Grundbegriffe Intension und Extension MORGENSTERN Extension + Sprachwissen + Weltwissen Ausdruck der Morgenstern Referenz Intension Planet Venus 10 (Gutzmann 2019: 6)
11 Grundbegriffe Intension und Extension DIE-DEUTSCHE-BUNDESKANZLERIN Extension + Sprachwissen + Weltwissen Ausdruck die deutsche Bundeskanzlerin Referenz Intension Angela Merkel 11 (Gutzmann 2019: 6)
12 Grundbegriffe Intension und Extension Düsseldorf die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen gleiche Extension: 'Düsseldorf' unterschiedliche Intension die Hauptstadt des bevölkerungsreichsten Bundeslands der Bundesrepublik Deutschland die (nach Einwohnern) siebtgrößte Stadt Deutschlands 12
13 Grundbegriffe Hinweis zu Intension Intension und Intention sind zwar etymologisch verwandt, haben aber sonst nicht viel miteinander zu tun. beide lassen sich auf lat. intendere 'anspannen / achten auf / bedacht sein auf' zurückführen (bzw. die nominalisierte Form intensio) Aber während Intention (auch alltagssprachlich) eine 'Absicht' bezeichnet, ist mit Intension der Begriffsinhalt/Bedeutungsgehalt eines sprachlichen Ausdrucks gemeint. 13
14 Grundbegriffe Referenz "Unter (semantischer) Referenz wird die Eigenschaft von Ausdrücken verstanden, auf etwas referieren zu können. Der Gegenstand, auf den referiert wird, wird Referent genannt." (Pafel & Reich 2016: 9) (Ogden & Richards 1923) 14
15 Grundbegriffe Referenz ¾ Der Präsident der USA ist Oberbefehlshaber der US-Armee. à nicht-referenzielle Verwendung ¾ Der Präsident der USA hat sich an einer Brezel verschluckt. à referenzielle Verwendung Dass Ausdrücke einerseits referenziell, andererseits nicht-referenziell gebraucht werden können, zeigt, dass Referenz nichts ist, was sprachlichen Ausdrücken inhärent ist. 15
16 Grundbegriffe Referenz ¾ Derselbe Satz kann eine referenzielle und eine nicht-referenzielle Lesart haben: Die Bundeskanzlerin schlägt die Mitglieder des Kabinetts vor. à nicht-referenzielle Lesart: Die Bundeskanzlerin (egal wer das Amt gerade hat) schlägt grundsätzlich immer die Mitglieder des Kabinetts vor, wenn ein neues Kabinett zusammengestellt wird. à referenzielle Lesart: Die aktuelle Bundeskanzlerin schlägt (jetzt gerade, ganz konkret) die Mitglieder ihres Kabinetts vor. 16
17 Grundbegriffe Referenz ¾ Derselbe Satz kann eine referenzielle und eine nicht-referenzielle Lesart haben: Der Vorsitzende eröffnet den Parteitag. Überlegen Sie kurz, was die referenzielle und was die nichtreferenzielle Lesart ist! 17
18 Grundbegriffe Referenz ¾ Pragmatisches vs. semantisches Konzept der Referenz: ¾ pragmatisch: SprecherIn verwendet Ausdruck x, um auf Konzept y zu referieren ¾ Referenz entsteht im Sprachgebrauch ¾ betrifft im Wesentlichen nur NPs ¾ semantisch: inhärente Referenz sprachlicher Zeichen ¾ abstrahiert über Sprachbenutzer*innen ¾ betrifft auch andere Einheiten als NPs 18 (Cummins 2019)
19 Grundbegriffe Denotation und Referenz ¾ "Denotat" potentiell ambig zwischen der Bedeutung eines Wortes und der außersprachlichen Entität, auf die es sich bezieht ¾ Referent: das, worauf sich ein Wort bezieht 19
20 Grundbegriffe Referenz ¾ sprachliche Bezugnahme auf Personen, Gegenstände oder Sachverhalte ¾ kann kontextabhängig sein ¾ der Mond und mein Auto referieren auf konkreten außersprachlichen Gegenstand ¾ bei mein Auto ändert sich der Referent, je nachdem, wer die Äußerung tätigt 20 (Cummins 2019)
21 Grundbegriffe Welche Wörter referieren? ¾ demonstrative und indexikalische Wörter und Phrasen: diese Katze, dieser Tisch, ich ¾ Eigennamen: Herr Meier, der Mount Everest ¾ definite Kennzeichnungen: die beiden in der ersten Reihe, die Autorin von "Harry Potter" 21 (Cummins 2019)
22 Grundbegriffe Referenzielle Ausdrücke ¾ Sprachliche Ausdrücke zur Herstellung von Referenz ¾ Variieren in der Form je nach Funktion, typischerweise: ¾ Einführung eines Referenten in das Diskursmodell oder ¾ Wiederaufnahme nach einer längeren Zeitspanne durch Nominalphrasen (NP) ¾ Wiederaufnahme eines bereits eingeführten und kürzlich erwähnten Referenten durch Pronomina ¾Mehrere koreferente Ausdrücke (d.h. die auf denselben Referenten verweisen) innerhalb eines Textes bilden eine referenzielle Kette 22 (Cummins 2019)
23 Grundbegriffe Term, Prädikat, Prädikation ¾ Term: ein sprachlicher Ausdruck, der auf einen oder mehrere Gegenstände referieren kann (dieser Stift hier) ¾ Prädikat(sausdruck): sprachlicher Ausdruck, der auf einen Begriff (ein Konzept) referieren kann (Stift) ¾ Prädikation: sprachlicher Ausdruck, der auf eine Proposition referieren kann (der Stift schreibt / zerbricht /...) 23 (Pafel & Reich 2016: 21)
24 Grundbegriffe Prädikat, Prädikation 24 nach Pafel & Reich (2016: 21): ¾ Prädikat(sausdruck): sprachlicher Ausdruck, der auf ein Konzept referieren kann ¾ Prädikation: sprachlicher Ausdruck, der auf eine Proposition referieren kann. Der Terminus Prädikat wird häufig verwendet für Wörter oder Phrasen, die ein Prädikation leisten also "einen Ausdruck, den zu einem vollständigen Satz nur noch das Subjekt fehlt" (Zimmermann 2014: 58). Im Sinne terminologischer Klarheit verwendet Löbner (2015: 121) hierfür den Terminus Prädikatsausdruck.
25 Grundbegriffe Prädikat, Prädikation nach Pafel & Reich (2016: 21): ¾ Prädikat(sausdruck): sprachlicher Ausdruck, der auf ein Konzept referieren kann ¾ Prädikation: sprachlicher Ausdruck, der auf eine Proposition referieren kann. Neben dem hier eingeführten semantischen gibt es auch einen syntaktischen Prädikatsbegriff (den die meisten aus BEM kennen). In der Satzgliedlehre werden i.d.r. nur Verben als Prädikate gesehen. Alle finiten und infiniten Verben zusammen bilden das Prädikat eines Satzes. Das Prädikat bildet quasi den Drehund Angelpunkt, von dem alle Satzglieder abhängen. Funktion des Prädikats ist es, eine Aussage über ein Subjekt zu machen. 25 (Zur Geschichte des Prädikatsbegriffs vgl. Gamerschlag 2013.) (Meibauer at al. 2015: 158, Imo 2016: 161)
26 Grundbegriffe Unterschiedliche Definitionen von Prädikat ¾ Pafel & Reich (2016: 21): "sprachlicher Ausdruck, der auf ein Konzept referieren kann" ¾ Meibauer et al. (2015: 356): "sprachlicher Ausdruck, der ein oder mehrere Argumente selegiert" ¾ Glottopedia: "In semantics, a predicate is [a] concept (property or n-ary relation) that is attributed to a given (set of) argument(s) in a predication." ( ¾ Utrecht Lexicon of Linguistics: "In predicate logic, a predicate designates a property or a relation. P in P(a) and R in R(b,c) are called predicates. P in P(a) assigns a property to a and R in R(b,c) designates a relation between b and c. The expressions a, b and c are called the arguments of the predicates P and R." ( 26
27 Grundbegriffe Prädikat, Prädikation ¾ vereinfacht: Ein Prädikat ist ein Konzept, das einem gegebenen (Set von) Argumenten zugeschrieben wird. ¾ Die Beziehung zwischen Prädikat und Argument nennt man Prädikation. 27
28 Grundbegriffe Prädikat(sausdrücke) 28 ¾ Kriterien zur Identifikation von Prädikaten nach Pafel & Reich (2016: 30) ¾ Verben, Substantive, Adjektive und Präpositionen sind fast immer Prädikate ¾ Prädikate können anderen Prädikaten über- oder untergeordnet sein und sich gegenseitig ausschließen. ¾ z.b. Vollverben: laufen ist ein Prädikat, das auf alle Leute zutrifft, die (in einer bestimmten Situation) laufen à das Verb leistet eine Prädikation. laufen und stehen schließen sich gegenseitig aus (sind inkompatibel) ¾ z.b. Adjektive: sternhagelvoll ist hyponym zu betrunken und inkompatibel mit nüchtern ¾ auch Wortgruppen können Prädikate sein (z.b. laut sprechen, eine Messe komponieren, sehr genial)
29 Grundbegriffe Prädikat(sausdrücke) ¾ Prädikate schreiben ihren Argumenten bestimmte Eigenschaften oder Bezihungen zwischen ihnen zu (man sagt: sie prädizieren über ihre Argumente), legen selbst aber nicht fest, um welche konkreten Entitäten es sich handelt. z.b. Prädikation Elke lacht Prädikat Der Prädikatsausdruck lacht schreibt dem Individuum Elke die Eigenschaft zu, zu lachen. Mit dem Satz Elke lacht wird über Elke also die Eigenschaft prädiziert, zu lachen. 29 (Löbner 2015: 121; Meibauer et al. 2015)
30 Grundbegriffe Prädikate und Argumente ¾ Bedeutungen der prädizierenden Verben, Nomen und Adjektive sind Konzepte, die eine oder mehrere Entitäten betreffen bzw. involvieren ¾ Die Konzepte selbst stellen die Prädikate dar, die Entitäten, die sie betreffen, ihre Argumente ¾ Prädikate mit einem Argument nennt man einstellige Prädikate, Prädikate mit zwei Argumenten zweistellige etc. ¾ Prädikate werden auf ihre Argumente angewendet bzw. "prädizieren" über sie, z.b. Wörter/NPs [Klaus N ] aß V [den Salat N ] mit P [einer roten A Gabel N ] Referenten r k r s r g 30 (Löbner 2015: 121)
31 Grundbegriffe Prädikate und Argumente ¾ Die Argumente sind diejenigen Dinge in der Welt, auf die die Prädikation angewendet wird. ¾ In Klaus aß den Salat mit einer roten Gabel werden die drei Argumente durch die drei NPs im Satz beschrieben. ¾ Diese drei NPs sind Argumentausdrücke, die zu dem Verb gehören. Klaus aß den Salat mit einer roten Gabel 31 (Löbner 2015: 121f.) Prädikatsausdruck 3 Argumentausdrücke (Komplemente)
32 Wörter / Wortgruppen & ihre Semantik
33 Überblick ¾ Wortarten unterscheiden sich u.a. ¾ in ihrer Distribution (Verteilung: in welchen syntaktischen Kontexten treten sie auf?), ¾ in ihren Flexionseigenschaften ¾ und oft auch in ihrer Semantik ¾ Semantische Kriterien zur Wortartenidentifikation sind problematisch ¾ dennoch lassen sich Tendenzen aufzeigen, welche Wortarten (tendenziell) welche Semantik aufweisen. ¾ Im Folgenden wollen wir uns Verben, Nomen und Adjektive hinsichtlich semantischer Eigenschaften genauer ansehen. 33
34 Verben Grundlegendes ¾ Verben werden primär zur Prädikation benutzt (Nomen hingegen primär zur Referenz) ¾ Sätze enthalten i.d.r. mehrere miteinander vernetzte Prädikationen, von denen eine die zentrale Prädikation ist Ein Unbekannter hat den rosaroten Diamanten gestohlen. 34 (Löbner 2015)
35 Verben Grundlegendes ¾ Verben bilden großen Teil des Lexikons; Löbner (2015: 150) schätzt Verben fürs Deutsche ¾ zentrale Gegenstände der Verbsemantik: ¾ zeitliche Aspekte der Verbsemantik (Situationsstruktur, Aspekt/Aktionsart, Tempus) ¾ involvierte Argumente (Argumentstruktur) 35 (Löbner 2015: 150)
36 Verben Argumentstruktur ¾ Verben unterscheiden sich durch die Anzahl ihrer Argumente und deren thematische Rollen ¾ 1-3 sog. Kernargumente ¾ in der Regel syntaktisch obligatorisch (sog. Ergänzungen) ¾ werden durch Subjekt, direktes oder indirektes Objekt spezifiziert ¾ die anderen Argumente sind eher peripher, erscheinen als sog. oblique Komplemente (Adjunkte bzw. Angaben) 36 (Löbner 2015: 152)
37 Verben Semantische Rollen (auch: thematische Rollen) Rolle Agens Patiens Thema Rezipient Instrument Experiencer Stimulus Possessor Quelle Ziel Ort Erklärung willentl. Initiator eines Geschehens: Brutus tötet Cäsar von einem Geschehen betroffene Person/Sache: Brutus tötet Cäsar was bei einem Geschehen bewegt/lokalisiert wird: Sabine kommt in Köln an. Person, die bei einem Geschehen etwas empfängt: Ich gab ihr ein Buch. das bei einem Geschehen benutzte Mittel: und dann mache ich sie platt mit einem Hammer! Träger eines psychischen Zustands/Prozesses: Das Kind war traurig Auslöser eines psychischen Zustands/Prozesses: Er hat Angst vor Spinnen Person, die etwas besitzt (auch metaphorisch): Marie hat Courage. das, von dem aus etw. bei einem Geschehen bewegt wird oder von dem aus das Geschehen seinen Ausgang nimmt: sie fährt von London nach Paris das, auf das hin ein Geschehen gerichtet ist: sie fährt von London nach Paris Ort, wo sich etwas befindet: Die Kronjuwelen liegen im Tower. 37 (Pafel & Reich 2016: 25; vgl. auch Löbner 2015: 138)
38 Verben Grundlegendes ¾ Verben werden primär zur Prädikation benutzt ¾ Sätze enthalten i.d.r. mehrere miteinander vernetzte Prädikationen ¾ eine davon ist die zentrale Prädikation, um die herum der Satz organisiert ist Ein Unbekannter hat den rosaroten Diamanten gestohlen. 38 (Löbner 2015)
39 Verben Grundlegendes ¾ Verben können Prozesse, Handlungen oder Zustände ausdrücken ¾ Eine Lawine brach über das Dorf hinein ¾ Er stahl den Diamanten ¾ Sie schläft ¾ zeitliche Aspekte der Prädikation mit Verben sind zentrale Aspekte der Verbsemantik 39 (Löbner 2015)
40 Verben Verbtypen ¾ Hilfsverb: Die Kanzlerin hat den Minister entlassen ¾ Modalverb: Die Kanzlerin musste den Minister entlassen ¾ Vollverb: Die Kanzlerin entlässt den Minister 40 (Pafel & Reich 2016)
41 Verben Finite und infinite Verben ¾ Modal-, Hilfs- und Vollverben können in finiter und in infiniter Form vorkommen. ¾ Sie entlässt den Minister. (finit) ¾ Sie will den Minister entlassen (infinit) ¾ Sie plant, den Minister zu entlassen (infinit) ¾ Hast du gut geschlafen? (infinit) ¾ Schlaf jetzt! (infinit) ¾ finite Formen flektieren nach Person, Numerus, Modus und Tempus. 41
42 Verben Semantische "Großklassen" von Verben inchoativ resultativ durativ drücken Beginn eines Geschehens aus drücken das Ende eines Geschehens aus drücken Andauern eines Geschehens aus aufbrechen, erblühen ankommen, verblühen bleiben, blühen iterativ drücken stetige Wiederholung aus schaukeln, zittern intensiv / diminutiv-intensiv drücken schwächere, aber dafür andauernde Intensität aus lächeln, kränkeln, hüsteln 42 (Busch & Stenschke 2018: 208)
43 Verben Aktionsarten ¾ atelische Verben: kein inhärenter Endpunkt, z.b. schlafen ¾ telische Verben: inhärenter Endpunkt, z.b. besteigen Verbklasse durativ dynam. telisch Beispiele Periphrase Achievement + + Accomplishment Activity + + aufwachen, finden, sterben ein Bild malen, absterben, sinken lesen, schwimmen, überlegen Unmittelbarer Zustandswechsel allmählich sich vollziehender Zustandswechsel Länger andauernde Tätigkeit, Handlung State + wissen, haben Andauernder Zustand 43 (modifiziert nach Flick 2016; dort nach Vendler 1957, 1967)
44 Verben Flexion ¾ Tempus Aspekt Modus (TAM) als zentrale Verbkategorien ¾ Tempus und Modus sind im Deutschen grammatikalisiert, es gibt jedoch keine grammatikalisierte Aspektkategorie ¾ daher betrachten wir zunächst Tempus und Modus 44
45 Verben Tempus "Tempus lokalisiert die ausgedrückte Situation in der Zeit." (Löbner 2015: 177) ¾ Tempuskategorien des Deutschen: ¾ Präsens ich gehe spazieren ¾ Präteritum ich ging spazieren ¾ Perfekt ich bin spazieren gegangen ¾ Plusquamperfekt ich war spezieren gegangen ¾ Futur I ich werde spazieren gehen ¾ Futur II ich werde spazieren gegangen sein periphrastische Verbformen 45
46 Verben Verben und Zeitreferenz ¾ nicht immer klarer 1:1-Bezug zwischen grammatischer Tempusform und Zeitbezug! historisches Präsens: Ich hielt eine ganz normale Vorlesung. Da meldet sich so ein Typ und sagt mir, dass ich völlig falsch liege!!!11elf futurisches Präsens: Ich gehe nächstes Jahr zum Rosenmontagszug. narratives Präteritum: Morgen war Weihnachten. (Käte Hamburger) 46
47 Verben Verben und Zeitreferenz ¾ Löbner (2015: 177f.) unterscheidet zwischen ¾ (polyfunktionalen) Verbformen einerseits und ¾ Tempusfunktionen andererseits ¾ Tempusfunktionen u.a.: ¾ PAST Gestern war ich essen. Gestern bin ich essen gegangen. ¾ PRESENT Ich telefoniere gerade. Der Rhein ist am fließen. ¾ NON-PAST ¾ FUTURE Ich fahre nach Tübingen. Morgen werde ich schwimmen gehen. 47
48 Verben Verben und Zeitreferenz ¾ einflussreiches Modell in Reichenbachs Elements of Symbolic Logic (1947): ¾ Unterscheidung zwischen ¾ Sprechzeit (S) ¾ Ereigniszeit (E) ¾ Referenzzeit (R) Peter war gegangen. Hans Reichenbach ( ) E R S 48
49 Verben Verben und Zeitreferenz ¾ Weinrich ([1964] 2001), anknüpfend an Hamburger ([1957] 1994): textlinguistisch motivierte Unterscheidung zwischen besprechenden Tempora erzählenden Tempora Präsens Perfekt Futur I Futur II Präteritum Plusquamperfekt Grundtempus der "besprochenen Welt" Grundtempus der "erzählten Welt" ¾ Die Unterscheidung hat als "Tempusgruppe I" und "Tempusgruppe II" auch Eingang in die Duden-Grammatik gefunden. 49 (Pafel & Reich 2016)
50 Verben Präsens ¾ Standardfall: Äußerungszeit = Ereigniszeit E S 50
51 Verben Präsens ¾ Standardfall: Ereigniszeit = Sprechzeit ES ¾ Sonderfälle: ¾ generische Lesart: Schweine sind klüger als Amöben. ¾ habituelle Lesart: Hanna raucht. ¾ atemporale Lesart: zwei mal zwei ist vier. ¾ historisches / szenisches / episches Präsens: Und dann kommt dieses doofe Virus! 51 (Pafel & Reich 2016, Musan 2002)
52 Verben Präteritum ¾ Standardfall: Ereigniszeit liegt vor der Sprechzeit E S ¾ Sonderfälle: ¾ narratives Präteritum: Morgen war Weihnachten (Käte Hamburger) ¾ sprecherbezogenes/"subjektifiziertes" Präteritum (meine Bezeichnung): Wie war nochmal Ihr Name? Wer bekam nochmal das Schnitzel? 52 (Pafel & Reich 2016: 93)
53 Verben Perfekt E R ¾ Semantik des Perfekts ist umstritten; Pafel & Reich (2016: 95) unterscheiden drei Arten von Analysen: ¾ Das Perfekt ist eine vom Präteritum unterschiedene Vergangenheitskonstruktion ("relative Vergangenheit": Ereigniszeit liegt vor der Referenzzeit, die mit der Sprechzeit identisch sein oder nach derselben liegen kann Morgen habe ich meine Schulden bezahlt!) ¾ Das Perfekt drückt die Gegenwart eines Resultatszustandes aus; es lässt sich zerlegen in das Tempus Präsens und den (Resultativität ausdrückenden) "Aspekt" Perfekt ¾ Das Perfekt bezeichnet ein Zeitintervall, das von der Vergangenheit bis zur Gegenwart reicht, ein extended now. 53
54 Verben Plusquamperfekt ¾ prototypischerweise: Ereigniszeit vor Referenzzeit vor Sprechzeit Sie hatte jahrelang in prekären Verhältnissen gearbeitet (Ereigniszeit), bevor sie den Ruf auf eine Professur bekam (Referenzzeit). E R S ¾ im tatsächlichen Gebrauch allerdings wie quasi alle Zeitformen deutlich flexibler 54
55 Verben Modalität 55 ¾ Begriff der Modalität bezieht sich auf den sprachlichen Ausdruck von Möglichkeit und Notwendigkeit ¾ Ausdruck von Modalität ist nicht auf den verbalen Bereich beschränkt, vgl. ¾ Das ist wohl typisch für ihn (Partikel) ¾ Möglicherweise ist das genetisch bedingt. (Adverb) ¾ Zumindest wenn Darwin Recht hat. (Konjunktion) ¾ Nach neuesten Erkenntnissen ist das vorstellbar (Derivarionssuffix) ¾ auch syntaktische Konstruktionen können Modalität ausdrücken, z.b. die nonagentive sein-zu-konstruktion, die sowohl Möglichkeit als auch Notwendigkeit ausdrücken kann: Die Aufgabe ist zu lösen. (Pafel & Reich 2016: 96f.)
56 Verben Modus ¾ Im verbalen Bereich wird Modalität durch die Modalverben können, sollen, dürfen, müssen, wollen ausgedrückt, aber auch durch den Modus Konjunktiv ¾ Konjunktiv I wird v.a. zur Darstellung indirekter Rede verwendet: er sagt, er sei aufgehalten worden ¾ Konjunktiv II kontrastiert inhaltlich mit dem Indikativ und wird i.d.r. für kontrafaktische Aussagen verwendet: Hätte ich zwei Cousinen, wögen sie zusammen 120 Kilo. 56 (Pafel & Reich 2016: 97)
57 Verben Modalverben ¾ zu den Modalverben werden im Deutschen i.d.r. dürfen, können, mögen, müssen, sollen gerechnet ¾ manchmal zählt man auch brauchen (du brauchst das nicht [zu] tun) und werden zu den Modalverben ¾ Modalverben fordern wie transitive Vollverben immer ein (formales) Subjekt und eine weitere Ergäzung ¾ diese weitere Ergänzung ist i.d.r. eine Verbalgruppe, deren Kopf im einfachen Infinitiv steht: Xaver muss niesen / Erna besuchen 57 (Pafel & Reich 2016: )
58 Verben Modalverben ¾ Bei Modalverben können grundsätzlich zwei Lesarten unterschieden werden: ¾ zirkumstanzielle Lesart: Die Notwendigkeit oder Möglichkeit des in der Kernproposition beschriebenen Sachverhalts ergibt sich aus den äußeren Bedingungen oder Umständen ¾ epistemische Lesart: die Notwendigkeit oder Möglichkeit eines Sachverhalts ergibt sich aus allem, was wir wissen, aus unseren Evidenzen Sie muss zu Hause sein, denn sie hat Hausarrest bekommen. Sie muss zu Hause sein, denn das Licht in der Wohnung ist an. 58 (Pafel & Reich 2016: 101)
59 Verben 59 Weitere Lesarten von Modalverben ¾ stereotypisch: typische Abläufe von Ereignissen, z.b. du musst erst das Browserfenster öffnen ¾ doxastisch: Glaubensinhalte; legt i.d.r. eine distanzierte Position der Sprecherin nahe: das mag alles genau so passiert sein ¾ deontisch: bezieht sich auf Forderungen Dritter, z.b. er soll heute sein Kinderzimmer aufräumen ¾ buletisch: bezieht sich auf Wunsch des Subjekts, z.b. er will das nicht ¾ teleologisch: Möglichkeit oder Notwendigkeit ergibt sich aus den Zielen, die das Subjekt verfolgt: Wenn du bestehen willst, musst du lernen ¾ ontologisch/alethisch: bezieht sich auf die Art, wie sich die Dinge (auch) hätten entwickeln können, z.b. diese Vorlesung könnte auch "Lange Liste von Fachbegriffen XXL" heißen (Pafel & Reich 2016: 101f.)
60 Verben Modalverben in der Kognitiven Semantik ¾ In der Kognitiven Linguistik wurden Modalverben v.a. von Leonard Talmy in seinem "Force-Dynamics"-Modell analysiert ¾ Dieses Modell versucht zu erfassen, wie in der Sprache Kausalitätsbeziehungen dargestellt werden ¾ Sweetser (1990) geht davon aus, dass sich z.b. die epistemische Lesart von Modalverben durch die metaphorische Übertragung der Kräftedynamik im Bereich der sozialen Pflichten auf den Bereich des Urteilens und Schließens erklären lässt: sie muss den ganzen Tag arbeiten. à soziale Welt sie muss wohl zu Hause sein à epistemische Welt 60 (Pafel & Reich 2016: 106f.)
61 Verben Hilfs- und Kopulaverben ¾ Als Hilfsverben (Auxiliare) werden alle Verben bezeichnet, die sich mit Vollverben zu einer grammatischen Konstruktion verbinden: ich habe den Text gelesen ¾ zentrale Hilfsverben im Deutschen sind sein, haben und werden ¾ sein, werden und bleiben kommen zudem als Kopulaverben vor ¾ Kopulaverben sind Verben, die nur zusammen mit einem Prädikativkomplement den Prädikatsausdruck bilden: Sie ist/wird/bleibt Ärztin. Das Verfahren ist sehr schwierig. 61 (Pafel & Reich 2016: 107f.;
62 Nomen und Nominalgruppen Substantive als Prädikate ¾ Ihrer semantischen Kategorie nach sind Substantive Prädikate ¾ beziehen sich auf Begriffe, genauer: auf Kategorien (Arten, Typen) von Entitäten ¾ Substantiv ist jedoch kein Term, mit dem man auf eine bestimmte Entität referieren kann diese Funktion übernimmt stattdessen die Nominalgruppe, vgl. Musiker: Prädikat, das auf alle Personen zutrifft, die Musiker sind; dieser Musiker: Term, der auf einen bestimmten Musiker refereirt 62 (Pafel & Reich 2016: 111)
63 Nomen und Nominalgruppen Relationalität und Eindeutigkeit ¾ Nomen lassen sich abhängig davon, ob sie semantisch eindeutig sind und ob sie relational sind, in 4 Typen untergliedern ¾ eine NP ist semantisch eindeutig, wenn die Beschreibung des Referenten unabhängig vom gegebenen Äußerungskontext eindeutig ist nicht relational relational nicht inhärent eindeutig sortale Nomen Junge, Hund, Rock, Stein relationale Nomen Sohn, Bein, Eigenschaft inhärent eindeutig Individualnomen Papst, Sonne, Datum Funktionalnomen Vater, Kopf, Größe 63 (Löbner 2015: 89)
64 Nomen und Nominalgruppen Nomen ¾ die meisten Nomen sind einstellige Prädikatsausdrücke ¾ sie werden v.a. als Kopf referierender NPs benutzt, die z.b. als Verbkomplement dienen. Der Hund hat die Tür zerkratzt. ¾ Daneben ist ein prädikativer Gebrauch möglich. Prädikative NPs referieren nicht: 64 (Löbner 2015: 129) Klaus ist Schlagzeuger.
65 Nomen und Nominalgruppen Relationale Nomen ¾ Neben einstelligen gibt es auch mehrstellige, sog. relationale Nomen ¾ z.b. Verwandtschaftsbezeichnungen: ¾ haben ein relationales Argument zu der Person, zu der die Verwandtschaftsbeziehung besteht, z.b. Bruder, Schwester, Onkel, Tante... ¾ In der Terminologie der Verwandtschaftsbegriffe nennt man dieses relationale Argument auch Propositus. 65 (Löbner 2016: 130)
66 Nomen und Nominalgruppen Referent Onkel/Tante Propositus (relationales Argument) 66
67 Nomen und Nominalgruppen Individuativa und Kontinuativa ¾zwei Großgruppen von Substantiven, die ein deutlich unterschiedliches Verhalten zeigen: ¾ Individuativa: Substantive, die Entitäten denotieren, die man im Prinzip zählen könnte, z.b. Klaviersonate, Flügel, Partitur, Ehe, Jahr,... ¾ Kontinuativa: Substantive, die nicht-zählbare Substanzen, Stoffe, Massen etc. denotieren, z.b. Wasser, Gold, Staub, Erde, Musik ¾auch "zählbare Nomen" und "unzählbare Nomen" (engl. count nouns / mass nouns) genannt 67 (Pafel & Reich 2016: 113f.)
68 Nomen und Nominalgruppen Individuativa und Kontinuativa ¾viele Nomen haben individuative und kontinuative Lesarten: ¾ Portionenlesart: Ich nehme ein Glas Wasser ¾ Sortenlesart: Dieses Öl ist ein ganz besonderes. ¾ Substanzlesart: Das Hack besteht zur Hälfte aus Rind, zur Hälfte aus Schwein. 68 (Pafel & Reich 2016: 113f.)
69 Nomen und Nominalgruppen Eigennamen ¾ spezielle Nomengruppe, die sich z.b. hinsichtlich Syntax und Orthographie von anderen Substantiven unterscheidet ¾ EN zeichnen sich aus durch Monoreferenz und Direktreferenz [ˈkat sə] 69 (Nübling et al. 2015; Ogden & Richards 1972)
70 Nomen und Nominalgruppen Eigennamen ¾ spezielle Nomengruppe, die sich z.b. hinsichtlich Syntax und Orthographie von anderen Substantiven unterscheidet ¾ EN zeichnen sich aus durch Monoreferenz und Direktreferenz [ˈaŋɡela ˈmɛʁkl ] 70 (Nübling et al. 2015; Ogden & Richards 1972; Von Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons), CC BY-SA 4.0,
71 Nomen und Nominalgruppen Eigennamenklassen ¾Personennamen (Anthroponyme), z.b. Angela Merkel ¾Tiernamen (Zoonyme), z.b. Bello (aber nicht Hund, Katze...) ¾Ortsnamen (Topoynme), z.b. Düsseldorf, New York ¾Objektnamen (Ergonyme), z.b. iphone ¾Ereignisnamen (Praxonyme), z.b. Zweiter Weltkrieg, 11. September ¾Phänomennamen (Phänonyme), z.b. Namen von Hoch- und Tiefdruckgebieten 71 (Nübling et al. 2015)
72 Nomen und Nominalgruppen Numerus und Genus ¾ die Flexionskategorien Numerus und Genus sind zunächst morphosyntaktische Phänomene, aber auch semantisch relevant ¾ Plural hat bei Individuativa den Effekt, dass aus einem Ausdruck, der auf Einzeldinge zutrifft, ein Ausdruck wird, der auf Pluralitäten von Einzeldingen dieser Art zutrifft: Auf der Straße spielen Kinder ¾ Genus teilweise durch Sexus bestimmt (der Mann, die Frau), aber nicht immer inwieweit Genus und Sexus entkoppelt sind, ist umstritten (vgl. Diskussion ums sog. generische Maskulinum) 72 (Pafel & Reich 2016: 114)
73 Adjektive und Adjektivgruppen Drei Typen von Adjektiven ¾ Zahladjektive ¾ quantifizierende Adjektive, z.b. viele, wenige ¾ Kardinalzahlen, z.b. zwei, drei, vier ¾ Ordinalzahlen, z.b. zweite, dritte, vierte ¾ relationale Adjektive ¾ drücken Beziehung oder Zugehörigkeit aus, z.b. europäisch, inneruniversitär ¾ qualifizierende Adjektive ¾ geben Eigenschaft einer Entität an, z.b. gut, schlecht, schön, hässlich 73 (Pafel & Reich 2016: 143)
74 Adjektive und Adjektivgruppen Attributiver und prädikativer Gebrauch ¾ Adjektive können attributiv und prädikativ gebraucht werden: der gutaussehende Mann (gutaussehend als Attribut zu Mann) der Mann ist gutaussehend (gutaussehend als Subjektsprädikativ) 74
75 Adjektive und Adjektivgruppen Restriktiver und nicht-restriktiver Gebrauch ¾ (vgl. Sitzung zu Ambiguität dort: restriktive und nicht-restriktive Relativsätze) ¾ restriktiver Gebrauch: Begriffsumfang von Nomen und attributivem Adjektiv ist kleiner als der des Nomens alleine ¾ bitte nur die grünen Stühle benutzen / bitte nur die Stühle benutzen, die grün sind ¾ nicht-restriktiver Gebrauch: Referent der Nominalgruppe ist bereits ohne das attributive Adjektiv eindeutig festgelegt ¾ die güldene Sonne / die Sonne, die heute scheint 75 (Pafel & Reich 2016: 145)
76 Adjektive und Adjektivgruppen Formen attributiver Adjektive ¾ intersektive Adjektive: aus der komplexen Prädikation X ist ein ADJ N kann auf die einfachen Prädikationen X ist ein ADJ und X ist ein N geschlossen werden: Olaf ist ein langweiliger Mann. à 'Olaf ist langweilig' & 'Olaf ist ein Mann' ¾ relative Adjektive: Interpretation des Adjektivs hängt beim attributiven Gebrauch zwingend von einem anderen Begriff ab, z.b. Das ist ein großer Grashüpfer vs. das ist ein großes Gebäude. (Vagheit von Adj. wie groß) ¾ intensionale Adjektive: das Adjektiv "blockiert" den Schluss auf das Kernnomen Rosi ist eine mutmaßliche Mörderin. à *'Sie ist mutmaßlich' 76 (Pafel & Reich 2016: 146ff.)
77 Adjektive und Adjektivgruppen Steigerung von Adjektiven ¾ Steigerung kommt v.a. bei relativen Adjektiven wie groß oder ehrgeizig vor ¾ Morphosyntaktisch werden drei Formen unterschieden: ¾ Positiv: Paula ist groß ( Referenzgrad) ¾ Komparativ: Julia ist größer als Paula (> Referenz) ¾ Superlativ: Wilhelmine ist die größte Frau der Welt P J 1,78m W 77 (Pafel & Reich 2016: 149ff.)
78 Adjektive und Adjektivgruppen Komparation und Stelligkeit ¾ die meisten Adjektive sind einstellige Prädikatsausdrücke, wenn sie im Positiv gebraucht werden ¾ in der Komparativform sind sie zweistellig ¾ manche Adjektive haben aber auch in der Positivform ein zweites Argument: anders als, zufrieden mit, reich an etc. 78 (Löbner 2015: 132ff.)
79 Fließende Übergänge zwischen Wortarten Nomen, Adjektive und mehr ¾ Wortartengrenzen sind oft fließend z.b. sind prädikative Nomen und Adjektive einander sehr ähnlich: Paul ist groß. Paul ist Arzt. ¾ Auch sonst gibt es viele Übergangsbereiche 79
80 Wortarten (... und ihre "Bedeutung") ¾ Boëthius Dacus (13. Jh.): ¾ lat. dolor Schmerz ¾ doleo Ich spüre Schmerz ¾ dolenter schmerzhaft ¾ heu! (Interjektion) à Ähnliche Bedeutungen, unterschiedliche Wortklassen 80
81 Wortarten (... und ihre "Bedeutung") Wortklassen als prototypische Kategorien Relationality Stativity Transitoriness Gradability Objects nonrelational state permanent nongradable Properties relational state permanent gradable Events relational process transitory nongradable (Croft 2001: 87) 81
82 Wortarten (... und ihre "Bedeutung") ¾ Wortbildung als besondere Herausforderung für semantische Charakterisierung von Wortarten: Cäsar zerstört die Stadt Die Stadt wird (durch Cäsar) zerstört Die Zerstörung der Stadt (durch Cäsar) ¾ sehr viele unterschiedliche Erklärungsansätze, u.a. über Construal- Varianten in der Kognitiven Grammatik (Langacker 1987) 82
83 Fazit ¾ Die drei Hauptwortarten Nomen, Verb und Adjektiv beziehen sich tendenziell auf unterschiedliche Klassen von Entitäten ¾ Hier liegt jedoch keineswegs eine 1:1-Zuordnung vor es gibt viele Spezialfälle, Ausnahmen etc. ¾ Umstrittene Frage: Inwiefern interagiert Semantik mit Grammatik? Sind Syntax, Morphologie und Semantik unterschiedliche "Module" sprachlichen Wissens oder untrennbar miteinander verbunden? 83
84 Literatur ¾ Busch, Albert & Oliver Stenschke Germanistische Linguistik: eine Einführung. 4., aktualisierte Auflage. (Narr Bachelor- Wissen.de). Tübingen: Narr Francke Attempto. ¾ Cummins, Chris Pragmatics. Edinburgh: Edinburgh University Press. ¾ Gamerschlag, Thomas Prädikat. In Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft (WSK) Online. De Gruyter. ¾ Flick, Johanna Der am-progressiv und parallele am V-en sein-konstruktionen. Kompositionalität, Variabilität und Netzwerkbildung. Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 138(2) ¾ Hamburger, Käte Die Logik der Dichtung. 4. Aufl. Stuttgart: Klett-Cotta. ¾ Kasper, Simon Semantik und Pragmatik (Vorlesungsskript). ¾ Langacker, Ronald W Nouns and Verbs. Language ¾ Löbner, Sebastian Semantik: Eine Einführung. 2nd ed. Berlin, Boston: De Gruyter. ¾ Ogden, C. K. & I. A. Richards. [1923] The meaning of meaning: a study of The influence of language upon thought and of The science of symbolism. 10. ed. London: Routledge [u.a.]. ¾ Nübling, Damaris, Fabian Fahlbusch & Rita Heuser Namen: eine Einführung in die Onomastik. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. (Narr Studienbücher). Tübingen: Narr Francke Attempto. ¾ Pafel, Jürgen & Ingo Reich Einführung in die Semantik: Grundlagen - Analysen - Theorien. (Lehrbuch). Stuttgart: J.B. Metzler Verlag. ¾ Sweetser, Eve From Etymology to Pragmatics: Metaphorical and Cultural Aspects of Semantic Structure. Cambridge: Cambridge University Press. ¾ Talmy, Leonard Force Dynamics in Language and Cognition. Cognitive Science ¾ Weinrich, Harald Tempus: besprochene und erzählte Welt. 6th ed. München: Beck. ¾ Vendler, Zeno Verbs and Times. The Philosophical Review 66(2) ¾ Vendler, Zeno (ed.) Linguistics in Philosophy. Ithaca, NY: Cornell University Press. 84
Semantik. Anke Himmelreich Prädikation und verbale Bedeutung. Universität Leipzig, Institut für Linguistik
 1 / 42 Semantik Prädikation und verbale Bedeutung Anke Himmelreich anke.assmann@uni-leipzig.de Universität Leipzig, Institut für Linguistik 11.05.2017 2 / 42 Inhaltsverzeichnis 4 Nomen und Adjektive 1
1 / 42 Semantik Prädikation und verbale Bedeutung Anke Himmelreich anke.assmann@uni-leipzig.de Universität Leipzig, Institut für Linguistik 11.05.2017 2 / 42 Inhaltsverzeichnis 4 Nomen und Adjektive 1
Einführung in die Semantik
 ~ J.B. METZLER Jürgen Pafel / Ingo Reich Einführung in die Semantik Grundlagen Analysen Theorien Mit Grafiken und Abbildungen J. B. Metzler Verlag Die Autoren: Jürgen Pafel ist Professor für germanistische
~ J.B. METZLER Jürgen Pafel / Ingo Reich Einführung in die Semantik Grundlagen Analysen Theorien Mit Grafiken und Abbildungen J. B. Metzler Verlag Die Autoren: Jürgen Pafel ist Professor für germanistische
Inhaltsverzeichnis. Abkürzungen... 9 Niveaustufentests Tipps & Tricks Auf einen Blick Auf einen Blick Inhaltsverzeichnis
 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Abkürzungen... 9 Niveaustufentests... 10 Tipps & Tricks... 18 1 Der Artikel... 25 1.1 Der bestimmte Artikel... 25 1.2 Der unbestimmte Artikel... 27 2 Das Substantiv...
Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Abkürzungen... 9 Niveaustufentests... 10 Tipps & Tricks... 18 1 Der Artikel... 25 1.1 Der bestimmte Artikel... 25 1.2 Der unbestimmte Artikel... 27 2 Das Substantiv...
Logik und modelltheoretische Semantik. Was ist Bedeutung?
 Logik und modelltheoretische Semantik Was ist Bedeutung? Robert Zangenfeind Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung, LMU München 30.5.2017 Zangenfeind: Was ist Bedeutung? 1 / 19 Zunächst: der
Logik und modelltheoretische Semantik Was ist Bedeutung? Robert Zangenfeind Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung, LMU München 30.5.2017 Zangenfeind: Was ist Bedeutung? 1 / 19 Zunächst: der
Inhalt.
 Inhalt EINLEITUNG II TEIL A - THEORETISCHE ASPEKTE 13 GRAMMATIK 13 Allgemeines 13 Die sprachlichen Ebenen 15 MORPHOLOGIE 17 Grundbegriffe der Morphologie 17 Gliederung der Morpheme 18 Basis- (Grund-) oder
Inhalt EINLEITUNG II TEIL A - THEORETISCHE ASPEKTE 13 GRAMMATIK 13 Allgemeines 13 Die sprachlichen Ebenen 15 MORPHOLOGIE 17 Grundbegriffe der Morphologie 17 Gliederung der Morpheme 18 Basis- (Grund-) oder
D5 WA D5 WA D5 WA D5 WA
 1 Was ist unter einem Substantiv/Nomen zu verstehen? Durch was ist es gekennzeichnet? Gib drei Beispiele! 1 Hauptwort (Namenwort), das Lebewesen, Gegenstände, aber auch Vorgestelltes und Gedachtes bezeichnet;
1 Was ist unter einem Substantiv/Nomen zu verstehen? Durch was ist es gekennzeichnet? Gib drei Beispiele! 1 Hauptwort (Namenwort), das Lebewesen, Gegenstände, aber auch Vorgestelltes und Gedachtes bezeichnet;
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Das Grammatikfundament: Wortarten. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Das Grammatikfundament: Wortarten Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Uta Livonius Das Grammatikfundament: Wortarten
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Das Grammatikfundament: Wortarten Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Uta Livonius Das Grammatikfundament: Wortarten
Syntax. Ending Khoerudin Deutschabteilung FPBS UPI
 Syntax Ending Khoerudin Deutschabteilung FPBS UPI Traditionale Syntaxanalyse Was ist ein Satz? Syntax: ein System von Regeln, nach denen aus einem Grundinventar kleinerer Einheiten (Wörter und Wortgruppen)
Syntax Ending Khoerudin Deutschabteilung FPBS UPI Traditionale Syntaxanalyse Was ist ein Satz? Syntax: ein System von Regeln, nach denen aus einem Grundinventar kleinerer Einheiten (Wörter und Wortgruppen)
Probeklausur Syntax-Übung MA Linguistik
 Probeklausur Syntax-Übung MA Linguistik Prof. Dr. Stefan Müller Humboldt Universität Berlin St.Mueller@hu-berlin.de 12. Februar 2018 In diesem Dokument gibt es Fragen zu allem, was in der Veranstaltung
Probeklausur Syntax-Übung MA Linguistik Prof. Dr. Stefan Müller Humboldt Universität Berlin St.Mueller@hu-berlin.de 12. Februar 2018 In diesem Dokument gibt es Fragen zu allem, was in der Veranstaltung
KAPITEL I EINLEITUNG
 KAPITEL I EINLEITUNG A. Der Hintergrund Die Wortklasse oder part of speech hat verschiedene Merkmale. Nach dem traditionellen System werden die deutschen Wortklassen in zehn Klassen unterteilt (Gross,
KAPITEL I EINLEITUNG A. Der Hintergrund Die Wortklasse oder part of speech hat verschiedene Merkmale. Nach dem traditionellen System werden die deutschen Wortklassen in zehn Klassen unterteilt (Gross,
Einführung in die Sprachwissenschaft des Deutschen. Syntax IV. PD Dr. Alexandra Zepter
 Einführung in die Sprachwissenschaft des Deutschen Syntax IV PD Dr. Alexandra Zepter Überblick Syntax Fokus auf linearer Ordnung: Sprachtypen, Topologisches Feldermodell Fokus auf hierarchischer Ordnung:
Einführung in die Sprachwissenschaft des Deutschen Syntax IV PD Dr. Alexandra Zepter Überblick Syntax Fokus auf linearer Ordnung: Sprachtypen, Topologisches Feldermodell Fokus auf hierarchischer Ordnung:
Wort. nicht flektierbar. flektierbar. nach Person, Numerus, Modus, Tempus, Genus verbi flektiert. nach Genus, Kasus, Numerus flektiert
 Wort flektierbar nicht flektierbar nach Person, Numerus, Modus, Tempus, Genus verbi flektiert genufest nach Genus, Kasus, Numerus flektiert genusveränderlich komparierbar nicht komparierbar Verb Substantiv
Wort flektierbar nicht flektierbar nach Person, Numerus, Modus, Tempus, Genus verbi flektiert genufest nach Genus, Kasus, Numerus flektiert genusveränderlich komparierbar nicht komparierbar Verb Substantiv
Einführung in die Sprachwissenschaft des Deutschen Syntax IV. PD Dr. Alexandra Zepter
 Einführung in die Sprachwissenschaft des Deutschen Syntax IV PD Dr. Alexandra Zepter Überblick Syntax 1. Fokus auf linearer Ordnung: Sprachtypen, Topologisches Feldermodell 2. Fokus auf hierarchischer
Einführung in die Sprachwissenschaft des Deutschen Syntax IV PD Dr. Alexandra Zepter Überblick Syntax 1. Fokus auf linearer Ordnung: Sprachtypen, Topologisches Feldermodell 2. Fokus auf hierarchischer
Lösungsansätze Bestimmung der finiten Verben
 Gymbasis Deutsch: Grammatik Wortarten Verb: Bestimmung der finiten Verben Lösung 1 Lösungsansätze Bestimmung der finiten Verben Unterstreiche zuerst in den folgenden Sätzen die konjugierten Verben und
Gymbasis Deutsch: Grammatik Wortarten Verb: Bestimmung der finiten Verben Lösung 1 Lösungsansätze Bestimmung der finiten Verben Unterstreiche zuerst in den folgenden Sätzen die konjugierten Verben und
Einführung in die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache
 Karl-Ernst Sommerfeldt / Günter Starke Einführung in die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache 3., neu bearbeitete Auflage unter Mitwirkung von Werner Hackel Max Niemeyer Verlag Tübingen 1998 Inhaltsverzeichnis
Karl-Ernst Sommerfeldt / Günter Starke Einführung in die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache 3., neu bearbeitete Auflage unter Mitwirkung von Werner Hackel Max Niemeyer Verlag Tübingen 1998 Inhaltsverzeichnis
Zur Struktur der Verbalphrase
 Zur Struktur der Verbalphrase Ein formales Kriterium zur Verbklassifikation: V ist ein intransitives Verb (ohne Objekte) schlafen, arbeiten, tanzen,... (1) Klaus-Jürgen schläft. V ist ein transitives Verb
Zur Struktur der Verbalphrase Ein formales Kriterium zur Verbklassifikation: V ist ein intransitives Verb (ohne Objekte) schlafen, arbeiten, tanzen,... (1) Klaus-Jürgen schläft. V ist ein transitives Verb
Flexion. Grundkurs Germanistische Linguistik (Plenum) Judith Berman Derivationsmorphem vs. Flexionsmorphem
 Grundkurs Germanistische Linguistik (Plenum) Judith Berman 23.11.04 vs. Wortbildung (1)a. [saft - ig] b. [[An - geb] - er] Derivationsmorphem vs. smorphem (4)a. Angeber - saftiger b. saftig - Safts c.
Grundkurs Germanistische Linguistik (Plenum) Judith Berman 23.11.04 vs. Wortbildung (1)a. [saft - ig] b. [[An - geb] - er] Derivationsmorphem vs. smorphem (4)a. Angeber - saftiger b. saftig - Safts c.
Grammatik des Standarddeutschen. Michael Schecker
 Grammatik des Standarddeutschen Michael Schecker Einführung und Grundlagen Nominalgruppen Nomina Artikel Attribute Pronomina Kasus (Subjekte und Objekte, Diathese) Verbalgruppen Valenz und Argumente Tempora
Grammatik des Standarddeutschen Michael Schecker Einführung und Grundlagen Nominalgruppen Nomina Artikel Attribute Pronomina Kasus (Subjekte und Objekte, Diathese) Verbalgruppen Valenz und Argumente Tempora
Die Grammatikalisierungsparameter am Beispiel der Modalverben. Grammatikalisierung. Modalverben. Sprachhistorische Aspekte
 Grammatikalisierung Hauptseminar WS 2004/05 Prof. Karin Pittner Die Grammatikalisierungsparameter am Beispiel der Modalverben Modalverben dürfen können mögen müssen sollen Wollen 2 verschiedene Modalverbsysteme
Grammatikalisierung Hauptseminar WS 2004/05 Prof. Karin Pittner Die Grammatikalisierungsparameter am Beispiel der Modalverben Modalverben dürfen können mögen müssen sollen Wollen 2 verschiedene Modalverbsysteme
Was bisher geschah. Semantik II. Gegenstand der Semantik
 Was bisher geschah Semantik II Semantik I Verborgener Sinn versus wörtliche Bedeutung Wortbegriff lexikalische Semantik Ambiguitäten Sinnrelationen (vertikal und horizontal) Wortfelder / semantische Merkmale
Was bisher geschah Semantik II Semantik I Verborgener Sinn versus wörtliche Bedeutung Wortbegriff lexikalische Semantik Ambiguitäten Sinnrelationen (vertikal und horizontal) Wortfelder / semantische Merkmale
Wortarten Merkblatt. Veränderbare Wortarten Unveränderbare Wortarten
 Wortarten Merkblatt Veränderbare Wortarten Deklinierbar (4 Fälle) Konjugierbar (Zeiten) Unveränderbare Wortarten Nomen Konjunktionen (und, weil,...) Artikel Verben Adverbien (heute, dort,...) Adjektive
Wortarten Merkblatt Veränderbare Wortarten Deklinierbar (4 Fälle) Konjugierbar (Zeiten) Unveränderbare Wortarten Nomen Konjunktionen (und, weil,...) Artikel Verben Adverbien (heute, dort,...) Adjektive
7. Klasse. Grammatik. Deutsch. Grammatik. in 15 Minuten
 Grammatik 7. Klasse Deutsch Grammatik in 15 Minuten Klasse So übst du mit diesem Buch Im Inhaltsverzeichnis findest du alle für deine Klassenstufe wichtigen Themengebiete. Du hast zwei Möglichkeiten: 1.
Grammatik 7. Klasse Deutsch Grammatik in 15 Minuten Klasse So übst du mit diesem Buch Im Inhaltsverzeichnis findest du alle für deine Klassenstufe wichtigen Themengebiete. Du hast zwei Möglichkeiten: 1.
Vorwort 1.
 Vorwort 1 1 Wege zur Grammatik 3 1.1 Die implizite Grammatik und die Sprachen in der Sprache oder: Gibt es gutes und schlechtes Deutsch? 4 1.2 Die explizite Grammatik und die Entwicklung des Standarddeutschen
Vorwort 1 1 Wege zur Grammatik 3 1.1 Die implizite Grammatik und die Sprachen in der Sprache oder: Gibt es gutes und schlechtes Deutsch? 4 1.2 Die explizite Grammatik und die Entwicklung des Standarddeutschen
Satzbedeutung. Ludwig Wittgenstein
 Was bisher geschah Semantik III Gerrit Kentner Semantik I lexikalische Semantik Ambiguitäten Sinnrelationen (vertikal und horizontal) Wortfelder / semantische Merkmale Semantik II Verbbedeutung: Aktionsart
Was bisher geschah Semantik III Gerrit Kentner Semantik I lexikalische Semantik Ambiguitäten Sinnrelationen (vertikal und horizontal) Wortfelder / semantische Merkmale Semantik II Verbbedeutung: Aktionsart
Inhalt. Inhalt. Vorwort 1
 Inhalt Vorwort 1 1 Wege zur Grammatik 3 1.1 Die implizite Grammatik und die Sprachen in der Sprache oder: Gibt es gutes und schlechtes Deutsch? 4 12 Die explizite Grammatik und die Entwicklung des Standarddeutschen
Inhalt Vorwort 1 1 Wege zur Grammatik 3 1.1 Die implizite Grammatik und die Sprachen in der Sprache oder: Gibt es gutes und schlechtes Deutsch? 4 12 Die explizite Grammatik und die Entwicklung des Standarddeutschen
Vertiefung der Grundlagen der Computerlinguistik. Semesterüberblick und Einführung zur Dependenz. Robert Zangenfeind
 Vertiefung der Grundlagen der Computerlinguistik Semesterüberblick und Einführung zur Dependenz Robert Zangenfeind Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung, LMU München 17.10.2017 Zangenfeind:
Vertiefung der Grundlagen der Computerlinguistik Semesterüberblick und Einführung zur Dependenz Robert Zangenfeind Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung, LMU München 17.10.2017 Zangenfeind:
Deutsch Grammatik Sekundarstufe 1 Die 5 Wortarten
 Deutsch Grammatik Sekundarstufe 1 Die 5 Wortarten Theorie und Klassenübungen (mit Lösungen) Geeignet für 8. bis 10. Schuljahr MSV- Unterricht ILF- Unterricht Als Skript verwendbar Mit Kommentaren und Erklärungen
Deutsch Grammatik Sekundarstufe 1 Die 5 Wortarten Theorie und Klassenübungen (mit Lösungen) Geeignet für 8. bis 10. Schuljahr MSV- Unterricht ILF- Unterricht Als Skript verwendbar Mit Kommentaren und Erklärungen
Wortarten Merkblatt. Veränderbare Wortarten Unveränderbare Wortarten
 Wortarten Merkblatt Veränderbare Wortarten Deklinierbar (4 Fälle) Konjugierbar (Zeiten) Unveränderbare Wortarten Nomen Konjunktionen (und, weil,...) Artikel Verben Adverbien (heute, dort,...) Adjektive
Wortarten Merkblatt Veränderbare Wortarten Deklinierbar (4 Fälle) Konjugierbar (Zeiten) Unveränderbare Wortarten Nomen Konjunktionen (und, weil,...) Artikel Verben Adverbien (heute, dort,...) Adjektive
Semantik. Sebastian Löbner. Eine Einführung. Walter de Gruyter Berlin New York 2003
 Sebastian Löbner 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Semantik Eine Einführung wde G Walter de Gruyter
Sebastian Löbner 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Semantik Eine Einführung wde G Walter de Gruyter
Syntax natürlicher Sprachen
 Syntax natürlicher Sprachen 05: Dependenz und Valenz Martin Schmitt Ludwig-Maximilians-Universität München 22.11.2017 Martin Schmitt (LMU) Syntax natürlicher Sprachen 22.11.2017 1 Themen der heutigen Übung
Syntax natürlicher Sprachen 05: Dependenz und Valenz Martin Schmitt Ludwig-Maximilians-Universität München 22.11.2017 Martin Schmitt (LMU) Syntax natürlicher Sprachen 22.11.2017 1 Themen der heutigen Übung
SATZGLIEDER UND WORTARTEN
 SATZGLIEDER UND WORTARTEN 1. SATZGLIEDER Was ist ein Satzglied? Ein Satzglied ist ein Bestandteil eines Satzes, welches nur als ganzes verschoben werden kann. Beispiel: Hans schreibt einen Brief an den
SATZGLIEDER UND WORTARTEN 1. SATZGLIEDER Was ist ein Satzglied? Ein Satzglied ist ein Bestandteil eines Satzes, welches nur als ganzes verschoben werden kann. Beispiel: Hans schreibt einen Brief an den
Deutsche Wortbildung in Grundzügen
 Wolfgang Motsch Deutsche Wortbildung in Grundzügen 2., überarbeitete Auflage W DE G Walter de Gruyter Berlin New York INHALT Vorwort V Kapitel 1: Grundlagen 1. Der allgemeine Rahmen 1 2. Lexikoneintragungen
Wolfgang Motsch Deutsche Wortbildung in Grundzügen 2., überarbeitete Auflage W DE G Walter de Gruyter Berlin New York INHALT Vorwort V Kapitel 1: Grundlagen 1. Der allgemeine Rahmen 1 2. Lexikoneintragungen
Deutsche Wortbildung in Grundzügen
 Wolfgang Motsch Deutsche Wortbildung in Grundzügen wde G Walter de Gruyter Berlin New York 1999 INHALT Vorwort xi Kapitel 1: Grundlagen 1. Der allgemeine Rahmen 1 2. Lexikoneintragungen 3 3. Wortbildungsmuster
Wolfgang Motsch Deutsche Wortbildung in Grundzügen wde G Walter de Gruyter Berlin New York 1999 INHALT Vorwort xi Kapitel 1: Grundlagen 1. Der allgemeine Rahmen 1 2. Lexikoneintragungen 3 3. Wortbildungsmuster
Was bisher geschah. Semantik III. Semantik I Ÿ lexikalische Semantik. Heute: Satzbedeutung, Wahrheitskonditionale Semantik.
 Was bisher geschah Semantik III Gerrit Kentner Semantik I lexikalische Semantik Ambiguitäten Sinnrelationen (vertikal und horizontal) Wortfelder / semantische Merkmale Semantik II Intension und Extension
Was bisher geschah Semantik III Gerrit Kentner Semantik I lexikalische Semantik Ambiguitäten Sinnrelationen (vertikal und horizontal) Wortfelder / semantische Merkmale Semantik II Intension und Extension
Kopiervorlagen. Schulgrammatik extra. Deutsch. 5. bis 10. Klasse. Arbeitsblätter zum Üben und Wiederholen von Grammatik
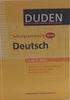 Kopiervorlagen Schulgrammatik extra Deutsch 5. bis 10. Arbeitsblätter zum Üben und Wiederholen von Grammatik Zeitformen des Verbs: Präteritum und Plusquamperfekt Das Präteritum bezeichnet ein abgeschlossenes
Kopiervorlagen Schulgrammatik extra Deutsch 5. bis 10. Arbeitsblätter zum Üben und Wiederholen von Grammatik Zeitformen des Verbs: Präteritum und Plusquamperfekt Das Präteritum bezeichnet ein abgeschlossenes
Stichwortverzeichnis. Anhang. Bedingungssatz siehe Konditionalsatz Befehlsform
 Anhang 130 A Adjektiv 68 73, 112 Bildung aus anderen Wörtern 69 mit Genitiv 63 Übersicht Deklination 108 109 Adverb 74 77, 112 Steigerung 76 Stellung 77 Typen (lokal, temporal, kausal, modal) 75 adverbiale
Anhang 130 A Adjektiv 68 73, 112 Bildung aus anderen Wörtern 69 mit Genitiv 63 Übersicht Deklination 108 109 Adverb 74 77, 112 Steigerung 76 Stellung 77 Typen (lokal, temporal, kausal, modal) 75 adverbiale
Morphologische Merkmale. Merkmale Merkmale in der Linguistik Merkmale in der Morpholgie Morphologische Typologie Morphologische Modelle
 Morphologische Merkmale Merkmale Merkmale in der Linguistik Merkmale in der Morpholgie Morphologische Typologie Morphologische Modelle Merkmale Das Wort 'Merkmal' ' bedeutet im Prinzip soviel wie 'Eigenschaft'
Morphologische Merkmale Merkmale Merkmale in der Linguistik Merkmale in der Morpholgie Morphologische Typologie Morphologische Modelle Merkmale Das Wort 'Merkmal' ' bedeutet im Prinzip soviel wie 'Eigenschaft'
Inhaltsverzeichnis. Abkürzungen... 9 Tipps & Tricks Inhaltsverzeichnis. 1.1 Der bestimmte Artikel Der unbestimmte Artikel...
 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Abkürzungen... 9 Tipps & Tricks... 10 1 Der Artikel... 17 1.1 Der bestimmte Artikel... 17 1.2 Der unbestimmte Artikel... 19 2 Das Substantiv... 20 2.1 Das Genus...
Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Abkürzungen... 9 Tipps & Tricks... 10 1 Der Artikel... 17 1.1 Der bestimmte Artikel... 17 1.2 Der unbestimmte Artikel... 19 2 Das Substantiv... 20 2.1 Das Genus...
Der Numerus dient zur Charakterisierung der Anzahl und kann sich auf ein Element (Singular) oder auf mehrere Elemente (Plural) beziehen.
 1 1. Der Begriff Konjugation Die Beugung von Verben bezeichnet man als Konjugation. Sie ermöglicht es, für jeden Aussagezweck die geeignete Verbform aus einem Infinitiv abzuleiten. 1.1. Formen der Verbgestaltung
1 1. Der Begriff Konjugation Die Beugung von Verben bezeichnet man als Konjugation. Sie ermöglicht es, für jeden Aussagezweck die geeignete Verbform aus einem Infinitiv abzuleiten. 1.1. Formen der Verbgestaltung
atttributive Adjektive das die attributiven Adjektive attributive adjectives das blaue Haus --- ist nicht relevant--
 Substantiv Die Substantive Das Pronomen, Nomen noun Lehrerin, der Spiegel, Dorf, Freiheit Groß geschrieben, Genus, Kasus, und dekliniert oder flektiertgroß geschrieben, Genus, Kasus, und dekliniert oder
Substantiv Die Substantive Das Pronomen, Nomen noun Lehrerin, der Spiegel, Dorf, Freiheit Groß geschrieben, Genus, Kasus, und dekliniert oder flektiertgroß geschrieben, Genus, Kasus, und dekliniert oder
PÄDAGOGISCHE FAKULTÄT. Einführung in die Morphologie der deutschen Sprache
 MASARYK - UNIVERSITÄT IN BRNO PÄDAGOGISCHE FAKULTÄT Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur Einführung in die Morphologie der deutschen Sprache Studienmaterial für die Lehramtstudenten PhDr. Olga
MASARYK - UNIVERSITÄT IN BRNO PÄDAGOGISCHE FAKULTÄT Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur Einführung in die Morphologie der deutschen Sprache Studienmaterial für die Lehramtstudenten PhDr. Olga
HPSG. Referat zu dem Thema Kongruenz im Englischen Von Anja Nerstheimer
 HPSG Referat zu dem Thema Kongruenz im Englischen Von Anja Nerstheimer Gliederung Einleitung Kongruenz Allgemein Zwei Theorien der Kongruenz Probleme bei ableitungsbasierenden Kongruenztheorien Wie syntaktisch
HPSG Referat zu dem Thema Kongruenz im Englischen Von Anja Nerstheimer Gliederung Einleitung Kongruenz Allgemein Zwei Theorien der Kongruenz Probleme bei ableitungsbasierenden Kongruenztheorien Wie syntaktisch
Semantik und Pragmatik
 Semantik und Pragmatik SS 2005 Universität Bielefeld Teil 4, 6. Mai 2005 Gerhard Jäger Semantik und Pragmatik p.1/35 Prädikatenlogik: atomare Formeln Syntax JO, BERTIE, ETHEL, THE-CAKE... sind Individuenkonstanten
Semantik und Pragmatik SS 2005 Universität Bielefeld Teil 4, 6. Mai 2005 Gerhard Jäger Semantik und Pragmatik p.1/35 Prädikatenlogik: atomare Formeln Syntax JO, BERTIE, ETHEL, THE-CAKE... sind Individuenkonstanten
Einführung Syntaktische Funktionen
 Syntax I Einführung Syntaktische Funktionen Syntax I 1 Syntax allgemein Syntax befasst sich mit den Regeln, mit denen man Wörter zu grammatischen Sätzen kombinieren kann. Es gibt unterschiedliche Modelle
Syntax I Einführung Syntaktische Funktionen Syntax I 1 Syntax allgemein Syntax befasst sich mit den Regeln, mit denen man Wörter zu grammatischen Sätzen kombinieren kann. Es gibt unterschiedliche Modelle
1 Das Lernen der norwegischen Sprache Begrifflichkeit... 11
 Inhalt Seite Vorwort 3 Einleitung 10. 1 Das Lernen der norwegischen Sprache... 10 2 Begrifflichkeit... 11 1 Wortarten... 11 2 Veränderbarkeit von Wörtern.... 12 Substantive 13. 3 Grundsätzliches... 13
Inhalt Seite Vorwort 3 Einleitung 10. 1 Das Lernen der norwegischen Sprache... 10 2 Begrifflichkeit... 11 1 Wortarten... 11 2 Veränderbarkeit von Wörtern.... 12 Substantive 13. 3 Grundsätzliches... 13
9 Temporale und modale Bedeutung
 9 Temporale und modale Bedeutung 9.1 Tempus 9.2 Aspekt 9.3 Modalität 9.4 Intension und Extension Johannes Dölling: Semantik und Pragmatik. SoSe 2012 1 9.1 Tempus 9.1.1 Temporalität Es gibt unterschiedliche
9 Temporale und modale Bedeutung 9.1 Tempus 9.2 Aspekt 9.3 Modalität 9.4 Intension und Extension Johannes Dölling: Semantik und Pragmatik. SoSe 2012 1 9.1 Tempus 9.1.1 Temporalität Es gibt unterschiedliche
Langenscheidt Deutsch-Flip Grammatik
 Langenscheidt Flip Grammatik Langenscheidt Deutsch-Flip Grammatik 1. Auflage 2008. Broschüren im Ordner. ca. 64 S. Spiralbindung ISBN 978 3 468 34969 0 Format (B x L): 10,5 x 15,1 cm Gewicht: 64 g schnell
Langenscheidt Flip Grammatik Langenscheidt Deutsch-Flip Grammatik 1. Auflage 2008. Broschüren im Ordner. ca. 64 S. Spiralbindung ISBN 978 3 468 34969 0 Format (B x L): 10,5 x 15,1 cm Gewicht: 64 g schnell
UBUNGS- GRAMMATIK DEUTSCH
 GERHARD HELBIG JOACHIM BUSCHA UBUNGS- GRAMMATIK DEUTSCH Langenscheidt Berlin München Wien Zürich New York SYSTEMATISCHE INHALTSÜBERSICHT VORWORT Übung Seite ÜBUNGSTEIL FORMENBESTAND UND EINTEILUNG DER
GERHARD HELBIG JOACHIM BUSCHA UBUNGS- GRAMMATIK DEUTSCH Langenscheidt Berlin München Wien Zürich New York SYSTEMATISCHE INHALTSÜBERSICHT VORWORT Übung Seite ÜBUNGSTEIL FORMENBESTAND UND EINTEILUNG DER
Deutsche Grammatik WS 14/15. Kerstin Schwabe
 Deutsche Grammatik WS 14/15 Kerstin Schwabe Generelle Information Dr. Kerstin Schwabe Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft Schützenstraße 18, R. 432 10117 Berlin Tel.: 20192410 E-mail: schwabe@zas.gwz-berlin.de
Deutsche Grammatik WS 14/15 Kerstin Schwabe Generelle Information Dr. Kerstin Schwabe Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft Schützenstraße 18, R. 432 10117 Berlin Tel.: 20192410 E-mail: schwabe@zas.gwz-berlin.de
Grammatikanalyse. Prof. Dr. John Peterson. Sprechstunde: Montags, 14:30-15:30h Raum LS10/Raum 425. Sommersemester 2015 Donnerstags, 14:15h-15:45h
 Grammatikanalyse Sommersemester 2015 Donnerstags, 14:15h-15:45h Prof. Dr. John Peterson Sprechstunde: Montags, 14:30-15:30h Raum LS10/Raum 425 1 Termin Thema 16.4. Einführung Zerlegung des Satzes in seine
Grammatikanalyse Sommersemester 2015 Donnerstags, 14:15h-15:45h Prof. Dr. John Peterson Sprechstunde: Montags, 14:30-15:30h Raum LS10/Raum 425 1 Termin Thema 16.4. Einführung Zerlegung des Satzes in seine
SMS Schnell-Merk-System
 5. bis 10. Klasse SMS Schnell-Merk-System Deutsch Grammatik Kompaktwissen Testfragen Mit Lernquiz fürs Handy 2Verben Verben lassen sich nach verschiedenen Merkmalen unterscheiden: nach Bedeutungsgruppen
5. bis 10. Klasse SMS Schnell-Merk-System Deutsch Grammatik Kompaktwissen Testfragen Mit Lernquiz fürs Handy 2Verben Verben lassen sich nach verschiedenen Merkmalen unterscheiden: nach Bedeutungsgruppen
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Deutsch - ABER HALLO! Grammatikübungen Mittel- und Oberstufe
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Deutsch - ABER HALLO! Grammatikübungen Mittel- und Oberstufe Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Inhaltsverzeichnis
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Deutsch - ABER HALLO! Grammatikübungen Mittel- und Oberstufe Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Inhaltsverzeichnis
Einführung in die Computerlinguistik. Morphologie II
 Einführung in die Computerlinguistik Morphologie II Hinrich Schütze & Robert Zangenfeind Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung, LMU München 30.11.2015 Schütze & Zangenfeind: Morphologie II 1
Einführung in die Computerlinguistik Morphologie II Hinrich Schütze & Robert Zangenfeind Centrum für Informations- und Sprachverarbeitung, LMU München 30.11.2015 Schütze & Zangenfeind: Morphologie II 1
Semantik III. Argumentstruktur/Theta-Rollen Typen von Extensionen/Valenz Wahrheitswerte Proposition. Semantik 3 1
 Semantik III Argumentstruktur/Theta-Rollen Typen von Extensionen/Valenz Wahrheitswerte Proposition Semantik 3 1 Thetarollen Aussagesätze beschreiben Situationen/Ereignisse. Ereignisse können intern unterschiedlich
Semantik III Argumentstruktur/Theta-Rollen Typen von Extensionen/Valenz Wahrheitswerte Proposition Semantik 3 1 Thetarollen Aussagesätze beschreiben Situationen/Ereignisse. Ereignisse können intern unterschiedlich
Semantik. Gerrit Kentner
 Semantik Gerrit Kentner 26. November 2010 1 / 36 Was bisher geschah Kernbereiche der sprachlichen Strukturbeschreibung: Semantik I Verborgener Sinn versus wörtliche Bedeutung Wortbegriff lexikalische Semantik
Semantik Gerrit Kentner 26. November 2010 1 / 36 Was bisher geschah Kernbereiche der sprachlichen Strukturbeschreibung: Semantik I Verborgener Sinn versus wörtliche Bedeutung Wortbegriff lexikalische Semantik
Inhalt. Basisinfos Konjugieren Person/Numerus Tempora (Zeitstrahl) Das Verb: Stamm und Endung Präsens Präteritum Perfekt Plusquamperfekt Futur
 Das Verb RS Josef Inhalt Basisinfos Konjugieren Person/Numerus Tempora (Zeitstrahl) Das Verb: Stamm und Endung Präsens Präteritum Perfekt Plusquamperfekt Futur Basisinfo Verben können verändert werden
Das Verb RS Josef Inhalt Basisinfos Konjugieren Person/Numerus Tempora (Zeitstrahl) Das Verb: Stamm und Endung Präsens Präteritum Perfekt Plusquamperfekt Futur Basisinfo Verben können verändert werden
1 Darstellung von Modalverben in einschlägigen Grammatiken am Beispiel von Eisenberg (1989) und Engel (1988)
 Textmuster Daniel Händel 2003-2015 (daniel.haendel@rub.de) 1 5 1 Darstellung von Modalverben in einschlägigen Grammatiken am Beispiel von Eisenberg (1989) und Engel (1988) Zur Klassifizierung beziehungsweise
Textmuster Daniel Händel 2003-2015 (daniel.haendel@rub.de) 1 5 1 Darstellung von Modalverben in einschlägigen Grammatiken am Beispiel von Eisenberg (1989) und Engel (1988) Zur Klassifizierung beziehungsweise
1 Das Lernen der schwedischen Sprache Begrifflichkeit... 11
 Inhalt Seite Vorwort 3 Einleitung 10 1 Das Lernen der schwedischen Sprache.................... 10 2 Begrifflichkeit........................................ 11 1 Wortarten.........................................
Inhalt Seite Vorwort 3 Einleitung 10 1 Das Lernen der schwedischen Sprache.................... 10 2 Begrifflichkeit........................................ 11 1 Wortarten.........................................
Grundlegendes zur Semantik 4. Januar 2005
 Linguistik Grundkurs Plenum Ruhr Universität Bochum Germanistisches Institut ********************************** Wolf Peter Klein Grundlegendes zur Semantik 4. Januar 2005 Wintersemester 04/05 Semantik
Linguistik Grundkurs Plenum Ruhr Universität Bochum Germanistisches Institut ********************************** Wolf Peter Klein Grundlegendes zur Semantik 4. Januar 2005 Wintersemester 04/05 Semantik
EDITH SCHMID UND EMIL KRAUCH FREGE II SINN UND BEDEUTUNG
 EDITH SCHMID UND EMIL KRAUCH FREGE II SINN UND BEDEUTUNG AUFBAU Einführung Ausgangslage Problemstellung Sinn und Bedeutung Freges Argument vom Erkenntniswert Exkurs: Semiotik Sätze Zusammenfassung Reflexion
EDITH SCHMID UND EMIL KRAUCH FREGE II SINN UND BEDEUTUNG AUFBAU Einführung Ausgangslage Problemstellung Sinn und Bedeutung Freges Argument vom Erkenntniswert Exkurs: Semiotik Sätze Zusammenfassung Reflexion
Einführung in die germanistische Sprachwissenschaft
 University of Vechta Universität Vechta Prof. Dr. J. A. Bär Fakultät III Germanistische Sprachwissenschaft Vorlesung Einführung in die germanistische Sprachwissenschaft Sitzung 9: Semantik II Zur Erinnerung:
University of Vechta Universität Vechta Prof. Dr. J. A. Bär Fakultät III Germanistische Sprachwissenschaft Vorlesung Einführung in die germanistische Sprachwissenschaft Sitzung 9: Semantik II Zur Erinnerung:
a) Erklären Sie, was eine SOV Sprache ist und was eine V2 Sprache ist. b) Welche Wortstellungsmuster sind eher selten in Sprachen der Welt?
 Syntax 1) Wortstellung a) Erklären Sie, was eine SOV Sprache ist und was eine V2 Sprache ist. Unter SOV Sprachen verstehen wir all jene Sprachen, die als Grundwortstellung die Reihenfolge Subjekt (S) Objekt
Syntax 1) Wortstellung a) Erklären Sie, was eine SOV Sprache ist und was eine V2 Sprache ist. Unter SOV Sprachen verstehen wir all jene Sprachen, die als Grundwortstellung die Reihenfolge Subjekt (S) Objekt
Lies die Sätze und schreibe die entsprechende Zeitform in das Kästchen!
 check 8. check 9. Wann bricht ein Vulkan aus? Verben in Zeitformen check 8. Wann bricht ein Vulkan aus? text- und Satzstrukturen kennen und anwenden / 4 Lies die Sätze und schreibe die entsprechende Zeitform
check 8. check 9. Wann bricht ein Vulkan aus? Verben in Zeitformen check 8. Wann bricht ein Vulkan aus? text- und Satzstrukturen kennen und anwenden / 4 Lies die Sätze und schreibe die entsprechende Zeitform
Kapitel 5 von Deutsche Syntax: Ein Arbeitsbuch (Pittner, Karin & Berman, Judith)
 Kapitel 5 von Deutsche Syntax: Ein Arbeitsbuch (Pittner, Karin & Berman, Judith) Introdução à Linguística Alemã I Profª. Drª. Maria Helena Voorsluys Battaglia Beatriz Ayres Santos (8573011) Lucas B. M.
Kapitel 5 von Deutsche Syntax: Ein Arbeitsbuch (Pittner, Karin & Berman, Judith) Introdução à Linguística Alemã I Profª. Drª. Maria Helena Voorsluys Battaglia Beatriz Ayres Santos (8573011) Lucas B. M.
DGm 04 Semantik Universität Athen, SoSe 2010
 DGm 04 Semantik Universität Athen, SoSe 2010 Winfried Lechner wlechner@gs.uoa.gr Handout #1 WAS IST SEMANTIK? 1. BEDEUTUNG Die natürlichsprachliche Semantik untersucht A. die Bedeutung von sprachlichen
DGm 04 Semantik Universität Athen, SoSe 2010 Winfried Lechner wlechner@gs.uoa.gr Handout #1 WAS IST SEMANTIK? 1. BEDEUTUNG Die natürlichsprachliche Semantik untersucht A. die Bedeutung von sprachlichen
9 Temporale und modale Bedeutung
 9.1 Tempus 9.2 Aspekt 9.3 Modalität 9.4 Intension und Extension 9.1 Tempus 9.1.1 Temporalität Es gibt unterschiedliche sprachliche Mittel, um sich auf zeitliche Relationen und Entitäten in der Welt zu
9.1 Tempus 9.2 Aspekt 9.3 Modalität 9.4 Intension und Extension 9.1 Tempus 9.1.1 Temporalität Es gibt unterschiedliche sprachliche Mittel, um sich auf zeitliche Relationen und Entitäten in der Welt zu
Sprachen im Vergleich
 Sprachen im Vergleich Deutsch-Ladinisch-Italienisch Peter Gallmann Heidi Siller-Runggaldier Horst Sitta Unter Mitarbeit von Giovanni Mischi und Marco Forni istitut Pedagogich ladin Das Inhaltsverzeichnis
Sprachen im Vergleich Deutsch-Ladinisch-Italienisch Peter Gallmann Heidi Siller-Runggaldier Horst Sitta Unter Mitarbeit von Giovanni Mischi und Marco Forni istitut Pedagogich ladin Das Inhaltsverzeichnis
Abkürzungen Einführung Übungsaufgaben... 13
 Inhalt Abkürzungen............................................. 10 1 Einführung............................................. 11 1.1 Übungsaufgaben..................................... 13 2 Syntaktische
Inhalt Abkürzungen............................................. 10 1 Einführung............................................. 11 1.1 Übungsaufgaben..................................... 13 2 Syntaktische
Dreyer Schmitt. Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatil< Hueber Verlag
 Hilke Richard Dreyer Schmitt Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatil< Hueber Verlag Inhaltsverzeichnis Teil I 9 13 Transitive und intransitive Verben, die schwer zu unterscheiden sind 75 1 Deklination
Hilke Richard Dreyer Schmitt Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatil< Hueber Verlag Inhaltsverzeichnis Teil I 9 13 Transitive und intransitive Verben, die schwer zu unterscheiden sind 75 1 Deklination
Deutsche Wortbildung in Grundziigen
 Wolfgang Motsch Deutsche Wortbildung in Grundziigen 2., iiberarbeitete Auflage W DE G Walter de Gruyter Berlin New York INHALT Vorwort V Kapitel 1: Grundlagen 1. Der allgemeine Rahmen 1 2. Lexikoneintragungen
Wolfgang Motsch Deutsche Wortbildung in Grundziigen 2., iiberarbeitete Auflage W DE G Walter de Gruyter Berlin New York INHALT Vorwort V Kapitel 1: Grundlagen 1. Der allgemeine Rahmen 1 2. Lexikoneintragungen
Die konjunktierbare Wortart: Verben
 Die konjunktierbare Wortart: Verben Vollverben: volle Semantik Hilfsverben (Auxiliarverben): helfen dem Vollverb dabei, bestimmte Tempusformen (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I und II), den Konjunktiv
Die konjunktierbare Wortart: Verben Vollverben: volle Semantik Hilfsverben (Auxiliarverben): helfen dem Vollverb dabei, bestimmte Tempusformen (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I und II), den Konjunktiv
 Vorwort 13 Ä Phonetik/Phonologie 15 AI -Laut-und Buchstabensystem des Deutschen..: 15 Ä2 Vokale (Vokalphoneme)...16 A3 Diphthonge ;... 17 A 4 Konsonanten (Konsonantenphoneme)... 18 A 4. 1 Prävokalische
Vorwort 13 Ä Phonetik/Phonologie 15 AI -Laut-und Buchstabensystem des Deutschen..: 15 Ä2 Vokale (Vokalphoneme)...16 A3 Diphthonge ;... 17 A 4 Konsonanten (Konsonantenphoneme)... 18 A 4. 1 Prävokalische
3.1.2 Der Beitrag von Wortarten für die Sprachbeschreibung Bisherige Forschungsarbeiten und ihre Anwendung auf das Kreolische...
 Inhaltsverzeichnis 1. Mauritius und das Kreolische auf Mauritius... 13 1.1 Landeskundlicher Teil ein Vorwort... 13 1.2 Zu Geographie, Bevölkerungsgruppen und Sprachen auf Mauritius... 14 1.3 Definition:
Inhaltsverzeichnis 1. Mauritius und das Kreolische auf Mauritius... 13 1.1 Landeskundlicher Teil ein Vorwort... 13 1.2 Zu Geographie, Bevölkerungsgruppen und Sprachen auf Mauritius... 14 1.3 Definition:
Inhalt. Basisinfos Konjugieren Person/Numerus Tempora (Zeitstrahl) Das Verb: Stamm und Endung Zeiten. genus verbi: Aktiv-Passiv modus verbi
 Das Verb RS Josef Inhalt Basisinfos Konjugieren Person/Numerus Tempora (Zeitstrahl) Das Verb: Stamm und Endung Zeiten Präsens Präteritum Perfekt Plusquamperfekt Futur genus verbi: Aktiv-Passiv modus verbi
Das Verb RS Josef Inhalt Basisinfos Konjugieren Person/Numerus Tempora (Zeitstrahl) Das Verb: Stamm und Endung Zeiten Präsens Präteritum Perfekt Plusquamperfekt Futur genus verbi: Aktiv-Passiv modus verbi
5 Die Gegenwart a Das simple present b Das present progressive... 30
 Haken Sie die Themen ab, die Sie durchgearbeitet oder wiederholt haben. Inhalt Contents A 1 2 3 Verben Die Zeiten Vollverben... 14 Die Verben be, have, do... 16 Modale Hilfsverben... 17 a Gebrauch... 17
Haken Sie die Themen ab, die Sie durchgearbeitet oder wiederholt haben. Inhalt Contents A 1 2 3 Verben Die Zeiten Vollverben... 14 Die Verben be, have, do... 16 Modale Hilfsverben... 17 a Gebrauch... 17
Glossar zum BESK/BESK-DaZ 2.0
 Glossar zum BESK/BESK-DaZ 2.0 Glossar zum BESK 2.0 bzw. BESK-DaZ 2.0 erstellt in Zusammenarbeit von der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg und dem Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abteilung Schule
Glossar zum BESK/BESK-DaZ 2.0 Glossar zum BESK 2.0 bzw. BESK-DaZ 2.0 erstellt in Zusammenarbeit von der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg und dem Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abteilung Schule
6. Klasse. Grammatik. Deutsch. Grammatik. in 15 Minuten
 Grammatik 6. Klasse Deutsch Grammatik in 15 Minuten Klasse So übst du mit diesem Buch Im Inhaltsverzeichnis findest du alle für deine Klassenstufe wichtigen Themengebiete. Du hast zwei Möglichkeiten: 1.
Grammatik 6. Klasse Deutsch Grammatik in 15 Minuten Klasse So übst du mit diesem Buch Im Inhaltsverzeichnis findest du alle für deine Klassenstufe wichtigen Themengebiete. Du hast zwei Möglichkeiten: 1.
Grundkurs Semantik. Sitzung 6: Prädikation, Modifikation, Referenz. Andrew Murphy
 Grundkurs Semantik Sitzung 6: Prädikation, Modifikation, Referenz Andrew Murphy andrew.murphy@uni-leizpig.de Grundkurs Semantik HU Berlin, Sommersemester 2015 http://www.uni-leipzig.de/ murphy/semantik15
Grundkurs Semantik Sitzung 6: Prädikation, Modifikation, Referenz Andrew Murphy andrew.murphy@uni-leizpig.de Grundkurs Semantik HU Berlin, Sommersemester 2015 http://www.uni-leipzig.de/ murphy/semantik15
QUALIA STRUKTUR NACH PUSTEJOVSKY
 QUALIA STRUKTUR NACH PUSTEJOVSKY Angewandte Linguistische Datenverarbeitung Sprachliche Informationsverarbeitung Universität zu Köln Dozent: Prof. Dr. Jürgen Rolshoven Referentin: Corinna Asselborn 20.01.2014
QUALIA STRUKTUR NACH PUSTEJOVSKY Angewandte Linguistische Datenverarbeitung Sprachliche Informationsverarbeitung Universität zu Köln Dozent: Prof. Dr. Jürgen Rolshoven Referentin: Corinna Asselborn 20.01.2014
Satzglieder und Gliedteile. Duden
 Satzglieder und Gliedteile Duden 1.1-1.3 1. Valenz: Ergänzungen und Angaben - Verb (bzw. Prädikat) bestimmt den Satz syntaktisch und semantisch [Anna] stellte [rasch] [eine Kerze] [auf den Tisch]. - Neben
Satzglieder und Gliedteile Duden 1.1-1.3 1. Valenz: Ergänzungen und Angaben - Verb (bzw. Prädikat) bestimmt den Satz syntaktisch und semantisch [Anna] stellte [rasch] [eine Kerze] [auf den Tisch]. - Neben
Der Oberdeutsche Präteritumschwund
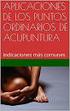 Germanistik Nadja Groß Der Oberdeutsche Präteritumschwund Zur Beobachtung einer sich verstärkenden Veränderung unseres Tempussystems Studienarbeit INHALTSVERZEICHNIS 1. Einleitung... 1 2. Zwei Vergangenheits-Tempora:
Germanistik Nadja Groß Der Oberdeutsche Präteritumschwund Zur Beobachtung einer sich verstärkenden Veränderung unseres Tempussystems Studienarbeit INHALTSVERZEICHNIS 1. Einleitung... 1 2. Zwei Vergangenheits-Tempora:
Der leckere Käse schmeckt dem kleinen Mäuschen sehr gut.
 Adjektiv (Wie-Wort, Eigenschaftswort) Adjektive geben deinem Satz Farbe. Sie begleiten das Nomen, beschreiben es haargenau oder drücken Empfindungen aus. Du benötigst sie in Erzählungen und Beschreibungen.
Adjektiv (Wie-Wort, Eigenschaftswort) Adjektive geben deinem Satz Farbe. Sie begleiten das Nomen, beschreiben es haargenau oder drücken Empfindungen aus. Du benötigst sie in Erzählungen und Beschreibungen.
Wiederholung der Modalverben. NIVEAU NUMMER SPRACHE Anfänger A2_1067G_DE Deutsch
 Wiederholung der Modalverben GRAMMATIK NIVEAU NUMMER SPRACHE Anfänger A2_1067G_DE Deutsch Lernziele Die Modalverben wiederholen Die Vergangenheitsform der Modalverben lernen 2 Als Kind habe ich nicht arbeiten
Wiederholung der Modalverben GRAMMATIK NIVEAU NUMMER SPRACHE Anfänger A2_1067G_DE Deutsch Lernziele Die Modalverben wiederholen Die Vergangenheitsform der Modalverben lernen 2 Als Kind habe ich nicht arbeiten
Tiefenkasus und Kasusrahmen bei Fillmore
 Tiefenkasus und Kasusrahmen bei Fillmore Technische Universität Berlin Fachbereich Germanistische Linguistik Seminar: Wortfeld, Frame, Diskurs Dozent: Prof. Dr. Posner Referent: Christian Trautsch 0. Referatsgliederung
Tiefenkasus und Kasusrahmen bei Fillmore Technische Universität Berlin Fachbereich Germanistische Linguistik Seminar: Wortfeld, Frame, Diskurs Dozent: Prof. Dr. Posner Referent: Christian Trautsch 0. Referatsgliederung
Deutsche Grammatik Grundfragen und Abriß
 Gerhard Heibig Deutsche Grammatik Grundfragen und Abriß iudicium vertag INHALTSVERZEICHNIS 1. ZUM BEGRIFF DER GRAMMATIK 11 2. DAS WORT 14 2.1. Wortarteneinteilung 14 2.1.1. Kriterien für die Wortartenklassifizierung
Gerhard Heibig Deutsche Grammatik Grundfragen und Abriß iudicium vertag INHALTSVERZEICHNIS 1. ZUM BEGRIFF DER GRAMMATIK 11 2. DAS WORT 14 2.1. Wortarteneinteilung 14 2.1.1. Kriterien für die Wortartenklassifizierung
bächer-und-bildung.de -3-
 Inhaltsverzeichnis Grammatik: Starke und schwache Verben... 6 Modalverben... 8 Zeitformen... 9 Zeitformen1... 10 Zeitformen2... 11 Zeitformen3... 12 Konjunktiv II... 13 Adjektive und Adverbien... 14 Vorsilben...
Inhaltsverzeichnis Grammatik: Starke und schwache Verben... 6 Modalverben... 8 Zeitformen... 9 Zeitformen1... 10 Zeitformen2... 11 Zeitformen3... 12 Konjunktiv II... 13 Adjektive und Adverbien... 14 Vorsilben...
Seminar Ib Wort, Name, Begriff, Terminus Sommersemester Morphologie. Walther v.hahn. v.hahn Universität Hamburg
 Seminar Ib Wort, Name, Begriff, Terminus Sommersemester 2006 Morphologie Walther v.hahn v.hahn Universität Hamburg 2005 1 Morphologie: Definition Definitionen: Morphologie ist die Lehre von den Klassen
Seminar Ib Wort, Name, Begriff, Terminus Sommersemester 2006 Morphologie Walther v.hahn v.hahn Universität Hamburg 2005 1 Morphologie: Definition Definitionen: Morphologie ist die Lehre von den Klassen
Die Modalverben. a) Vollverben: singen, spielen Die Vollverben können alleine ein Prädikat bilden. Beispiel: Ich spiele jeden Donnerstag Volleyball.
 Die Modalverben Zur Wiederholung: Das Verb Das Verb bezeichnen wir als Zeitwort bzw. Tätigkeitswort. Man nennt es so, weil es eine Tätigkeit (lachen, weinen,...) ausdrücken kann, aber auch ein Geschehen
Die Modalverben Zur Wiederholung: Das Verb Das Verb bezeichnen wir als Zeitwort bzw. Tätigkeitswort. Man nennt es so, weil es eine Tätigkeit (lachen, weinen,...) ausdrücken kann, aber auch ein Geschehen
Einführung in die Computerlinguistik
 Einführung in die Computerlinguistik Merkmalstrukturen und Unifikation Dozentin: Wiebke Petersen WS 2004/2005 Wiebke Petersen Formale Komplexität natürlicher Sprachen WS 03/04 Universität Potsdam Institut
Einführung in die Computerlinguistik Merkmalstrukturen und Unifikation Dozentin: Wiebke Petersen WS 2004/2005 Wiebke Petersen Formale Komplexität natürlicher Sprachen WS 03/04 Universität Potsdam Institut
Teil II: Phrasen und Phrasenstruktur
 Teil II: Phrasen und Phrasenstruktur Übersicht: Grammatische Funktionen Kategorien Konstituenten & Strukturbäume Konstituententest Endozentrizität 1 Einfacher Satzbau Drei allgemeine Grundfragen der Syntax:
Teil II: Phrasen und Phrasenstruktur Übersicht: Grammatische Funktionen Kategorien Konstituenten & Strukturbäume Konstituententest Endozentrizität 1 Einfacher Satzbau Drei allgemeine Grundfragen der Syntax:
Vorkurs Mediencode 7595-50. Die wichtigsten grammatikalischen Termini
 Vorkurs Mediencode 7595-50 Die wichtigsten grammatikalischen Termini Für die Arbeit mit Ihrem Lateinbuch benötigen Sie eine Reihe von grammatikalischen Fachbegriffen und auch ein Grundverständnis wichtiger
Vorkurs Mediencode 7595-50 Die wichtigsten grammatikalischen Termini Für die Arbeit mit Ihrem Lateinbuch benötigen Sie eine Reihe von grammatikalischen Fachbegriffen und auch ein Grundverständnis wichtiger
Gymbasis Deutsch: Grammatik Wortarten Verb: Bestimmung der infiniten Verben Lösung 1 Lösungsansätze Bestimmung der infiniten Verben
 Gymbasis Deutsch: Grammatik Wortarten Verb: Bestmung der Verben Lösung 1 Lösungsansätze Bestmung der Verben An anderer Stelle diente der unten stehende Text bereits zur Bestmung der Formen des. Unterstreiche
Gymbasis Deutsch: Grammatik Wortarten Verb: Bestmung der Verben Lösung 1 Lösungsansätze Bestmung der Verben An anderer Stelle diente der unten stehende Text bereits zur Bestmung der Formen des. Unterstreiche
ABKÜRZUNGEN UND SYMBOLE 14 DIE EINZELNEN WORTKLASSEN 15
 ABKÜRZUNGEN UND SYMBOLE 14 DIE EINZELNEN WORTKLASSEN 15 VEREi 15 l l.i 1. 1..1 1.. 1..3 1.3.1.1.1.1..1..1.1...1..3.1..4.1..5...1....3..4 FORMENSYSTEM Konjugation Formenbildung der regelmäßigen Verben Präsens
ABKÜRZUNGEN UND SYMBOLE 14 DIE EINZELNEN WORTKLASSEN 15 VEREi 15 l l.i 1. 1..1 1.. 1..3 1.3.1.1.1.1..1..1.1...1..3.1..4.1..5...1....3..4 FORMENSYSTEM Konjugation Formenbildung der regelmäßigen Verben Präsens
Grammatische Terminologie
 Grammatische Terminologie Vorschlag der Arbeitsgruppe Schulgrammatische Terminologie im Vergleich mit der von der KMK 1982 verabschiedeten Liste (Satz, Wort) Ausgangspunkt des Vergleichs ist der Neuvorschlag
Grammatische Terminologie Vorschlag der Arbeitsgruppe Schulgrammatische Terminologie im Vergleich mit der von der KMK 1982 verabschiedeten Liste (Satz, Wort) Ausgangspunkt des Vergleichs ist der Neuvorschlag
Ivana Daskalovska. Willkommen zur Übung Einführung in die Computerlinguistik. Syntax. Sarah Bosch,
 Ivana Daskalovska Willkommen zur Übung Einführung in die Computerlinguistik Syntax Wiederholung Aufgabe 1 Was ist Syntax und womit beschäftigt sie sich? 3 Aufgabe 1 Was ist Syntax und womit beschäftigt
Ivana Daskalovska Willkommen zur Übung Einführung in die Computerlinguistik Syntax Wiederholung Aufgabe 1 Was ist Syntax und womit beschäftigt sie sich? 3 Aufgabe 1 Was ist Syntax und womit beschäftigt
Was bisher geschah. Pragmatik II
 Was bisher geschah Pragmatik II Gerrit Kentner Folien basieren auf einer Vorlesung von Jan Köpping Kernbereiche der Linguistik Phonetik/ Phonologie Morphologie Syntax Semantik Pragmatik (Deixis und Anapher;
Was bisher geschah Pragmatik II Gerrit Kentner Folien basieren auf einer Vorlesung von Jan Köpping Kernbereiche der Linguistik Phonetik/ Phonologie Morphologie Syntax Semantik Pragmatik (Deixis und Anapher;
VP vs.?p. N V P N? N P N V Peter kommt nach Hause...dass Peter nach Hause kommt. Syntax V 2
 Syntax V Rechts- vs. Links-Köpfigkeit VL-Sätze als grundlegende Muster funktionale Kategorien IP/CP zum Nachlesen: Grewendorf/Hamm/Sternefeld: Sprachliches Wissen, S. 213-223, Kap. 7.1., 7.2 Syntax V 1
Syntax V Rechts- vs. Links-Köpfigkeit VL-Sätze als grundlegende Muster funktionale Kategorien IP/CP zum Nachlesen: Grewendorf/Hamm/Sternefeld: Sprachliches Wissen, S. 213-223, Kap. 7.1., 7.2 Syntax V 1
7 Intensionale Semantik
 7 Intensionale Semantik 7.1 Intension und Extension Bisher wurde eine extensionale Semantik verfolgt. D.h. als Denotationen von Sätzen wurden Wahrheitswerte, als Denotationen von Individuenausdrücken Individuen
7 Intensionale Semantik 7.1 Intension und Extension Bisher wurde eine extensionale Semantik verfolgt. D.h. als Denotationen von Sätzen wurden Wahrheitswerte, als Denotationen von Individuenausdrücken Individuen
Die Partikeln. Adverbien Präpositionen Konjunktionen
 Die Partikeln Adverbien Präpositionen Konjunktionen Gebrauch als adv. Bestimmung Dort liegt ein Buch. Der Ausflug war gestern. Attribut beim Substantiv, Adjektiv oder Adverb Das Buch dort gefällt mir.
Die Partikeln Adverbien Präpositionen Konjunktionen Gebrauch als adv. Bestimmung Dort liegt ein Buch. Der Ausflug war gestern. Attribut beim Substantiv, Adjektiv oder Adverb Das Buch dort gefällt mir.
2.2.2 Semantik von TL. Menge der Domänen. Zu jedem Typ gibt es eine Menge von möglichen Denotationen der Ausdrücke dieses Typs.
 2.2.2 Semantik von TL Menge der Domänen Zu jedem Typ gibt es eine Menge von möglichen Denotationen der Ausdrücke dieses Typs. Diese Menge wird Domäne des betreffenden Typs genannt. Johannes Dölling: Formale
2.2.2 Semantik von TL Menge der Domänen Zu jedem Typ gibt es eine Menge von möglichen Denotationen der Ausdrücke dieses Typs. Diese Menge wird Domäne des betreffenden Typs genannt. Johannes Dölling: Formale
