Executive Summary. Spital Wattwil. act-info Patientenmonitoring Spital Wattwil
|
|
|
- Jobst Michel
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 act-info Patientenmonitoring Autoren summary Sonja Stutz, Susanne Rösner, Katrin Schläfli und Harald Klingemann (2012) act-info Patientenmonitoring 2011 Executive-Summary Alkoholkurzzeittherapie PSA Wattwil, & atf Schweiz Executive Summary 2011
2 Basismodul Executive Summary Teil 1 Eckdaten im Überblick 2011 Eintritte: 162 Patient/innen Austritte: 165 Patient/innen 2010 Eintritte: 157 Patient/innen Austritte: 151 Patient/innen Soziodemographische Merkmale bei Eintritt Geschlecht 66% Männer (n=107) N=162 34% Frauen (n=55) Durchschnittsalter 47.3 Jahre N=162 (Männer: 46.2 Jahre, Frauen: 49.3 Jahre) Staatsangehörigkeit 84% Schweizer/innen N=162 13% EU 3% andere Zivilstand 34% ledig N=157 32% verheiratet 25% geschieden 3% verwitwet 6% getrennt (gerichtlich) Sozioökonomischer Status bei Eintritt Höchste Ausbildung 64% Berufslehre/-schule N=162 12% obligatorische oder weiterführende Schule 8% höhere Fach-/Berufsschule 7% Fachhochschule oder Universität 5% Matura, Seminar oder DMS 4% keine Ausbildung Erwerbsstatus 26% nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv N=162 47% Vollzeitarbeit (ab 70%) 13% Teilzeitarbeit 8% auf Stellensuche 6% anderes (z.b. in Ausbildung) Lebensunterhalt 57% Erwerbseinkommen N=162 15% Rente (AHV, IV, etc.) 14% Ersparnisse/PartnerIn 8% Sozialhilfe/Fürsorge 4% Arbeitslosenversicherung Berufliche Stellung 40% nicht erwerbstätig N=161 17% Kader 16% Arbeiter/innen 12% Angestellte/r 5% selbständig 4% Vorarbeiter/in 3% Hilfsarbeiter/Aushilfe Schulden 78% keine N=133 16% bis CHF % mehr als CHF Soziales Umfeld bei Eintritt Partnerschaft 54% haben eine feste Beziehung N=162 (N=75) (davon vermuten 13% Suchtprobleme beim Partner/bei der Partnerin) 39% sind alleinstehend 61% haben Kinder Zufriedenheit N=147, 161, % sind zufrieden mit ihrer Beziehungssituation 91% sind zufrieden mit ihrem Freundeskreis 65% sind zufrieden mit ihrer Freizeit 1
3 Basismodul Executive Summary Teil 1 Umstände bei Behandlungsbeginn Allgemeiner Gesundheitszustand Hauptzuweiser 30% Eigeninitiative N=162 28% Familie oder Partner/in Weitere Zuweiser Mehrfachantworten möglich N=154 32% Arztpraxis 24% Familie 14% Suchtinstitutionen 12% Freunde 11% Spitäler 7% Arbeitgeber 5% Sozialdienste 3% Verurteilung/Massnahme Hauptproblemsubstanz 99% Alkohol N=161 1% Heroin Therapieziel Eintritt 67% definitive Abstinenz N=161 22% zeitlich begrenzte Abstinenz 7% kontrollierter Konsum 4% noch nicht festgelegt Physische Gesundheit 43% leiden an körperlichen Suchtfolge- N=162 erkrankungen 15% weisen zudem im letzten Monat eine nicht-suchtbezogene körperliche Erkrankung auf Psychische Gesundheit 30-Tage-Prävalenz N=162, % an psychischen Problemen, nämlich: (Mehrfachangaben) 13% Depression 12% Angstzustände 11% medikamentös behandelte Probleme 8% kognitive Probleme 6% Suizidgedanken, 1% Suizidversuche 1% Schwierigkeiten mit der Gewaltkontrolle Psychische Probleme Lebenszeitprävalenz 48% psychische Probleme, nämlich: (Mehrfachangaben) 22% Depression 19% medikamentös behandelte Probleme 16% Angstzustände 13% Suizidgedanken, 9% Suizidversuche 6% kognitive Probleme 1% Schwierigkeiten mit der Gewaltkontrolle 1% Halluzinationen 2
4 Basismodul Executive Summary Teil 1 Behandlungsverlauf (Austritte 2011) Umstände des Behandlungsabschlusses (Austritte 2011) Rückfälle während der Therapie N=164 95% abstinent 5% Rückfälle 1 Rückfälle Männer N=108 96% abstinent 3% einen Rückfall 1 Patient: Rückfälle 3 Rückfälle Frauen N=56 91% abstinent 9% einen Rückfall Behandlungsabschluss 53% planmässig mit Übertritt, davon: N=165 91% ambulant 43% planmässig ohne Übertritt 4% expliziter Abbruch Nachsorge Bei 100% der PatientInnen ist die N=165 Nachsorge geregelt: 86% in Alkohol- und Drogenberatungsstelle 10% in Selbsthilfegruppe 4% andere Therapeutenprognose 14% sehr gut N=165 60% gut 20% eher ungünstig 6% ungünstig 3
5 Basismodul Executive Summary Teil 1 Ausgewählte Trends ALKOHOLWERTE «AUDIT» 1 (Eintritte 2010 und 2011) Der Gesamtwert des AUDIT lag im aktuellen Berichtsjahr mit 25.9 Punkten etwas höher als Nach Leitlinien der WHO besteht bei einem Punktwert ab 8 ein Gesundheitsrisiko, bei einem Wert zwischen 16 und 19 ist ein hohes Niveau des problematischen Alkoholkonsums erreicht, welches zumindest eine Beratung des Betreoffenen und evtl. eine Kurzintervention erfodert. Ab einem AUDIT-Score von 20 gilt die höchste Risikostufe mit der Empfehlung einer ausführlichen Diagnostik und Therapie (in Abhängigkeit vom Ergebnis der Alkoholdiagnostik). Bei 90% in die PSA Wattwil eingetretenen Personen liegt der AUDIT- Score über dem Schwellenwert eines problematischen Konsums und bei über 80% dieser Personen ist die höchste Risikostufe nach AUDIT erreicht. Die durchschnittlichen AUDIT-Werte unterscheiden sich bei Männern (26) und Frauen (25.5) kaum. 50% der PatientInnen (Median) wiesen 2011 einen AUDIT-Wert grösser 27 auf, im Vergleich dazu lag der Median 2010 noch bei 26 Punkten. Dieser Anstieg ist insbesondere auf die AUDIT-Werte der weiblichen Patientinnen zurückzuführen. Im Vergleich zum Vorjahr (2010) ist der durchschnittliche AUDIT-Wert der Patientinnen um knapp einen Punkt (0.7) gestiegen. Demgegenüber sank der durchschnittliche AUDIT-Wert der Männer bei Eintritt um 0.3 Punkte. Ob sich bezüglich Konsumverhalten eine Annäherung zwischen den Geschlechtern abzeichnet, kann anhand der zwei Aufzeichnungsjahre noch nicht beantwortet werden Gesamt (n=117; 118) Männer (n=62; 83) Frauen (n=55; 35) RAUCHERWERTE «FAGERSTRÖM» 2 (Eintritte/Austritte 2010 und 2011) Im Jahr 2011 rauchten 76% der Patienten und 78% der Patientinnen. Wie in der Grafik ersichtlich, wiesen Raucher wie Raucherinnen bei Eintritt 2011 in die PSA Wattwil auf der Fagerström-Skala im Durchschnitt eine mittlere Tabakabhängigkeit auf. Im Vergleich zum Vorjahr lag der durchschnittliche Wert gut 0.2 Punkt höher bei 5.1. Auch im Berichtsjahr nahm die Stärke der Nikotinabhängigkeit während des Aufenthaltes insgesamt leicht ab (4.9). Insbesondere bei den Männern zeigt sich 2011 eine Abnahme von gut einem halben Punkt von 5.5 bei Eintritt auf 5 bei Austritt. Demgegenüber stieg der durchschnittliche Fagerström-Wert bei den Patientinnen leicht von 4.7 auf 4.8 bei Austritt. Eine starke Nikotinabhängigkeit, was einem Fagerströmwert grösser sechs entspricht, berichteten bei Eintritt 2011 rund ein Drittel der Patientinnen (35%) und 51% der Patienten. Bei Austritt erreichten 41% der Frauen und 46% der Männer einen Punktwert 6. Insgesamt stellten 2011 vier Patienten während ihres Therapieaufenthaltes das Rauchen ein und zwei Raucherinnen konnten ihren Tabakkonsum reduzieren Eintritt Männer (2010, n=33) Männer (2011, n=43) Austritt Frauen (2010, n=29) Frauen (2011, n=32) 1 The Alcohol Use Disorders Identification Test AUDIT: Maximale Punktzahl 40, wobei ab 8 Punkten ein Gesundheitsrisiko besteht. 2 FAGERSTRÖM: Skala von 1 bis 10 (0 5: geringe bis mittlere Abhängigkeit / 6 10: starke bis sehr starke Abhängigkeit) 4
6 Zusatzmodul Psychische Komorbidität Executive Summary Teil 2 Psychische Komorbidität: Die Bedeutung von Entstehungsmodellen für Diagnostik und Therapie Susanne Rösner Jeder zweite alkoholabhängige Patient entwickelt im Laufe seines Lebens neben der Abhängigkeitserkrankung eine weitere psychische Störung, in der Allgemeinbevölkerung ist nur jeder Fünfte von einer psychischen Störung betroffen (Lieb 2007). Damit verdoppelt eine Alkoholabhängigkeit das Risiko weiterer psychischer Erkrankungen. Die aus statistischer Sicht überzufällig häufige Koinzidenz substanzbezogener und anderer psychischer Störungen ist unter anderem aus der pharmakologischen Wirkung des Alkohols ableitbar. So beeinflusst Alkohol eine Vielzahl unterschiedlicher Neurotransmitter-Systeme, unter anderem auch diejenigen Systeme, die an der Vermittlung von Entspannung, Belohnung und Euphorie sowie Stimmung und Impulskontrolle beteiligt sind. Welche dieser Wirkkomponenten des Alkohols im Vordergrund steht, hängt von vielfältigen Faktoren wie biologischen Dispositionen, aber auch Wirkungserwartungen sowie gesellschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen des Trinkens ab. Besonders seine Eigenschaft, aversive Befindlichkeiten wie Spannungszustände und Ängste abzuschwächen sowie seine einfache und praktisch immer gegebene Verfügbarkeit, erklären die hohe Attraktivität des Alkohols als Mittel der Selbstmedikation. Auf längere Sicht jedoch nimmt die alko holinduzierte Spannungsreduktion dem Betroffenen die Möglichkeit, effektive Strategien der Problembewältigung zu entwickeln. Darüber hinaus tragen neurobiologische und enzymatische Anpassungsprozesse zur Entwicklung von Alkoholtoleranz und zu Symptomen der psychischen und physischen Abhängigkeit bei. So mündet der anfangs als hilfreich erlebte Alkoholkonsum oftmals unweigerlich in einen Kreislauf verstärkter Probleme und gesteigerten Konsums. Neben der alkoholinduzierten Verstärkung psychischer Symptome und Problembereiche kann der chronische Konsum von Alkohol aber auch dazu führen, dass diese erst entstehen (Hypothese der sekundären Abhängigkeit). So führen Prozesse der Gegenregulierung auf neurobiologischer Ebene dazu, dass durch Alkohol unmittelbar gehemmte Systeme langfristig hochreguliert und umgekehrt durch Alkohol verstärkte Systeme im Laufe des chronischen Konsums abgeschwächt werden. So kann die kontinuierliche Aktivierung des Systems, welches beruhigende Alkoholwirkungen vermittelt dazu führen, dass dieses nach Down- Regulierung Angst und Reizbarkeit auslöst. Neben einer unidirektionalen Kausalbeziehung zwischen Alkoholkonsum und Komorbidität dürfte in vielen Fällen eine interaktive Beeinflussung wirksam werden, bei der sich psychische Störungen und Alkoholwirkungen in einer Art Teufelskreis gegenseitig aufschaukeln (Moggi 2005). Weitere Erklärungsmodelle gehen davon aus, dass die gemeinsam auftretende Substanzabhängigkeit und Komorbidität durch gemeinsame Faktoren wie genetische Prädispositionen oder Umweltfaktoren bedingt sind. So gibt es Hinweise, wonach die Komorbidität von Alkoholabhängigkeit und ADHS auf einen bestimmten Phänotyp hinweist, der mit einer besonders schweren Form der Alkoholabhängigkeit assoziiert ist (Johann 2003). Die psychische Komorbidität der Alkoholabhängigkeit bestimmt nicht nur deren Ätiologie, sondern prägt auch deren Verlauf. Wie eine Reihe klinischer Studien zeigen, wirkt sich psychiatrische Komorbidität negativ auf den Verlauf alkoholbezogener Probleme aus. Dies betrifft sowohl die Schwere der Abhängigkeit im unbehandelten Verlauf als auch das Rückfallrisiko nach Therapie (Übersicht bei Shivani 2002). Eine an der Forel Klinik durchgeführte Untersuchung im Rahmen einer Dissertationsarbeit findet Hinweise, wonach die Progression der alkoholbezogenen Symptomatik bei Patienten mit Persönlichkeitsstörungen schneller verläuft als in der Vergleichsgruppe (Schwemmer 2011). Sowohl die eingangs dargestellten Hypothesen zur Krankheitsentwicklung und die Ergebnisse zum Krankheitsverlauf verdeutlichen die Notwendigkeit, therapeutische Angebote für Patienten mit Doppeldiagnosen integrativ zu gestalten und einerseits die Funktionalität des Alkoholkonsums in Hinblick auf die komorbide Symptomatik in die Behandlung der Abhängigkeitserkrankung einzubeziehen, andererseits der Behandlung der komorbiden Symptomatik einen adäquaten Stellenwert in der Therapie einzuräumen. Die Berücksichtigung psychischer Komorbidität als Zuteilungskriterien individualisierter Ansätze der Alkoholbehandlung wird dadurch unumgänglich. Wesentliche Voraussetzung integrativer und individualisierter Behandlungskonzepte ist eine umfassende Diagnostik von Abhängigkeit und Komorbidität sowie die Klärung der Kausalität der Beziehung. Die Anamnese des Verlaufs von Substanzkonsum und psychischer Symptombelastung sowie die Veränderung der Komorbidität in konsumfreien Phasen sind dabei von erheblicher Bedeutung. Die Weiterentwicklung von Screeing-Instrumenten, welche eine differentielle Diagnostik der Komorbidität leisten, aber auch die Entwicklung therapeutischer Ansätze, die Abhängigkeit und psychische Komorbidität integrativ berücksichtigen, werden wesentliche Herausforderungen zukünftiger Entwicklungen in Diagnostik und Therapie der Alkoholabhängigkeit sein. Literatur: Lieb R, Isensee B (2002). Häufigkeit und zeitliche Muster von Komorbidität. In: Moggi F (Hrsg.): Doppeldiagnosen. Komorbidität psychischer Störungen und Sucht (S ). Bern: Huber Moggi F. (2005). Etiological theories on the relationship of mental disorders and substance use disorders. In R. Stohler & W. Rössler (Eds.), Dual diagnosis. (pp. 1-14). Basel: Karger. Johann M., Bobbe G., Putzhammer A., Wodarz N. (2003): Comorbidity of alcohol dependence with attention-deficit hyperactivity disorder: differences in phenotype with increased severity of the substance disorder, but not in genotype (serotonin transporter and 5-hydroxytryptamine-2c receptor). Alcohol. Clin. Exp. Res. 27, Shivani R, Goldsmith R, Anthenelli R. (2002). Alcoholism and psychiatric disorders: Diagnostic challenges. Alcohol Research and Health, 26(2), Schwemmer H. (2011). Doppeldiagnosen in stationärer suchtspezifischer Behandlung: Prävalenz und Zusammenhang mit behandlungsrelevanten Patientenmerkmalen. Medizinischen Fakultät der der Universität Zürich. Unveröffentlichte Dissertation. 5
7 Zusatzmodul Psychische Komorbidität Executive Summary Teil 2 HAUPT- UND NEBENDIAGNOSE (Eintritte 2010 und 2011) Seit Einführung der act-info Statistik werden bei Austritt neben den Hauptdiagnosen auch Nebendiagnosen erfasst. Wie für die PSA Wattwil zu erwarten ist, lagen bei Austritt der Patient/innen, mit jeweils einer Ausnahme im Jahre 2010 und 2011, als Hauptdiagnosen ausschliesslich Störungen durch psychotrope Substanzen (F1) vor. Wie aus der Grafik ersichtlich wurde 2011 nur bei wenigen Patient/ innen komorbide Störungsbilder diagnostiziert, dies betraf drei Personen. Bei einem Viertel aller Patient/innen, die aus der PSA Wattwil austraten, wurde als erste Nebendiagnosen eine F1 Diagnosen gestellt. Am häufigsten sind dies bei rund 20% der Patient/innen Nikotinabhängigkeiten. Die restlichen 5% verteilen sich auf eine zusätzliche Opiat- bzw. Cannabisabhängigkeit. Jeweils bei einer Person wurde eine Persönlichkeitsstörung (F6), eine affektive Störung (F3) und bei einer weiteren eine Angststörung (F4) diagnostiziert oder bestätigt. Bereits 2010 wurden als erste Nebendiagnose bei gut 25% der Patient/innen eine F1 Diagnose gestellt, wie im Berichtsjahr handelte es sich dabei überwiegend um eine Nikotinabhängigkeit. Der Anteil der Patient/innen, die ein komorbides Störungsbild aufwiesen lag mit 3% leicht höher als 2011 (2%). Neben zwei Personen mit einer affektiven Störungen (F3) wurde 2010 bei je einer Person eine Persönlichkeitsstörung (F6) sowie eine psychotische Störung (F2) diagnostiziert oder bestätigt (n=165) 2010 (n=151) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 1. Nebendiagnosen: F6 F4 F3 F2 F1 PSYCHISCHE PROBLEME (Eintritte 2011 und Austritt 2011) Bei 61% der Patient/innen, die 2011 in die PSA Wattwil eintraten, waren keine der in der Grafik aufgelisteten psychischen Probleme in den letzten 30 Tagen vor Eintritt zu verzeichnen. Dies betraf 48% der Frauen und 68% der Männer. Zu beachten ist, dass im act-info Fragebogen bei der Frage nach psychischen Problemen mehrfach Antworten möglich sind. Am häufigsten wurde bei Eintritt von Depressionen (13%) und/oder Angstund Spannungszuständen (13%) sowie nicht näher spezifizierten medikamentös behandelten psychischen Symptomen (11%) berichtet. 18% der Frauen litten an medikamentös behandelten psychischen-, 16% an depressiven Symptomen und 14% berichteten von Angstund Spannungszuständen. Insgesamt liegt der prozentuale Anteil der betroffenen Patientinnen bei fast allen psychischen Symptomen etwas höher als bei den Männern. Die Patienten berichten bei Eintritt etwas häufiger von kognitiven Problemen (7%), Suizidversuchen sowie Problemen mit der Gewaltkontrolle. Wie in der Grafik ersichtlich nahmen im Verlauf der Behandlung die psychischen Probleme insgesamt ab, demgegenüber stieg der prozentuale Anteil der Patient/innen leicht an, deren psychischen Probleme medikamentös behandelt wurden (13%), wobei es sich bei 60% dieser Patient/innen um dieselben Personen handelte bei Ein- und Austritt. Bei Austritt waren insgesamt 80% der Patient/innen Symptom frei, dies traf bei 68% der Frauen und bei 85% der Männer zu. Austritt 2011 Eintritt 2011 andere psychische Probleme Suizidversuche Suizidgedanken medi. behandelte psychische Probleme Gewaltkontrolle Halluzinationen kognitive Probleme Angst-, Spannungszustände Depressionen keine andere psychische Probleme Suizidversuche Suizidgedanken medi. behandelte psychische Probleme Gewaltkontrolle Halluzinationen kognitive Probleme Angst-, Spannungszustände Depressionen keine 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Gesamt (n=140) Frauen (n=44) Männer (n=96) 6
8 Zusatzmodul Psychische Komorbidität Executive Summary Teil 2 ANZAHL PSYCHISCHER PROBLEME (Eintritte und Austritte 2011) Die act-info Statistik erfasst sowohl bei Eintritt und Austritt als auch über die gesamte Lebensspanne die psychischen Probleme der Patient/innen. Gefragt wird nach schweren Depressionen, Angst- und Spannungszuständen, kognitiven Problemen, Halluzinationen, Gewaltkontrolle, medikamentös behandelte psychische Probleme sowie Suizidgedanken und versuche. Fasst man die Patient/innen, basierend auf der Anzahl vorhandener Symptome, zu Gruppen zusammen, wie in der Grafik dargestellt, zeigt sich ein tendenziell ausgeglichenes Bild für beide Geschlechter. Wie bereits im vorausgehenden Abschnitt gesehen berichtet der grösste Teil der Patient/innen an keinen psychischen Problemen zu leiden. Ein bis zwei der erwähnten Symptome werden von 28% der Personen über die gesamte Lebensspanne und 30 Tage vor Eintritt berichtet. Drei und mehr psychische Probleme sind bei 15% über die Lebensspanne und bei 6% der PatientInnen vor Eintritt zu verzeichnen. Im Gegensatz zu den Symptomen vor Eintritt sind die mehrfach Angaben zu den psychischen Problemen über die Lebenspanne nicht für einen begrenzten Zeitrahmen definiert bzw. weder das gemeinsame Auftreten noch die Häufigkeit der einzelnen Symptome wird mit dem act-info Fragebogen erfasst. Insgesamt kann aber festgehalten werden, dass rund die Hälfte derselben Patient/innen, die über die gesamte Lebensspanne keine der genannten psychischen Probleme berichteten (53%) auch vor Eintritt in die PSA Wattwil an keinem dieser Symptome litt. Der Vergleich zwischen den Geschlechtern zeigt, dass zu allen erfragten Zeitpunkten die Frauen rund 10% seltener berichten an keinen psychischen Problemen zu leiden. Ein bis zwei Symptome sind bei 33% über die Lebensspanne, 39% vor Eintritt und 19% bei Austritt der Patientinnen zu verzeichnen. Demgegenüber litten 27% der Patienten über die gesamte Lebensspanne, 25% vor Eintritt und 12% bei Austritt an einem oder zwei psychischen Problemen. Gesamt (n=159) Männer (n=105) Frauen (n=54) 3 und mehr Symptome 1-2 Symptome keine Symptome 3 und mehr Symptome 1-2 Symptome keine Symptome 3 und mehr Symptome 1-2 Symptome keine Symptome 0% 20% 40% 60% 80% 100% AustriB EintriB Lebensspanne 7
9 Zusatzmodul Psychische Komorbidität Executive Summary Teil 2 MEDIKAMENTE (Austritte 2010 und 2011) Der Anteil Patient/innen, die während der Behandlung verordnete Medikamente einnahmen lag 2010 bei 59.6% und im Berichtsjahr bei 64.8%. Der leichte prozentuale Anstieg ist insbesondere durch die häufiger verordneten Tranquilizer zu erklären. Demgegenüber nahmen der Anteil der Patient/innen, denen Antidepressiva und/oder Neuroleptika verordnet wurden von 37.9% bzw. 9.4% (2010) auf 31.1% bzw. 3.7% ab (2011). Einen geringen Anteil bei den verordneten Medikamenten nahmen, wie in der Entwöhnungsbehandlung zu erwarten, die Psychostimulantien/Analeptika ein. Dies betraf 2011 eine Person. Im Vergleich zu den Residalc-Institutionen lag der durchschnittliche prozentuale Anteil medikamentöser Behandlungen in der PSA Wattwil für alle Arzneimittel rund einen Drittel tiefer. Dies kann sicherlich zu einem Teil dadurch erklärt werden, dass die Patient/innen die Entzugsbehandlung bei Eintritt bereits abgeschlossen haben. andere Psychostimulantien Neuroleptika Antidepressiva Tranquilizer (nicht Benzo) Tranquilizer (Typ Benzo) Analgetika 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2011 (n=159) 2010 (n=151) MEDIKAMENTENEINNAHME NACH GESCHLECHT (Austritte 2011) Der Vergleich zwischen den Geschlechtern zeigt, dass 79% der Patientinnen, aber lediglich 58% der Männer Medikamente verordnet bekamen. Berücksichtigt wurden hier einzig die Patient/innen, die während der Behandlung durchschnittlich täglich verordnete Arzneimittel einnahmen. Wie aus der Grafik ersichtlich, handelte es sich 2011 bei den eingenommenen Pharmaka bei 62% der Patientinnen und 40% der Patienten um Antidepressiva. An zweiter Stelle sind die nicht näher spezifizierten Medikamente zu verzeichnen, die deutlich häufiger von den Patienten eingenommen wurden (Männer 40%, Frauen 17%). Deutlich geringer sind die medikamentös verordneten Behandlungen bei den Patient/innen mit Tranquilizer, Neuroleptika und Psychostimulantien, die unter 10% liegen. Dies trifft, mit Ausnahme der Tranquilizer (Typ nicht Benzodiazepine) 12%, auch auf die Frauen zu. verordnet andere Psychostimulantien Neuroleptika Antidepressiva Tranquilizer (nicht Benzodiazepine) Tranquilizier (Typ Benzodiazepine) Analgetika 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Frauen (n=45) Männer (n=63) 8
10 Zusatzmodul Psychische Komorbidität Executive Summary Teil 2 DURCHSCHNITTLICHER ALKOHOLKONSUM UND ANZAHL PSYCHISCHER SYMPTOME Die act-info Daten erlauben keine Aussage über komorbide Störungen der Patient/innen zum Zeitpunkt ihres Eintrittes in die PSA Wattwil. Die Annahme, dass Patient/innen mit komplexer Symptomatik einen schwierigeren Behandlungsverlauf bzw. höheren Alkoholkonsum im Vorfeld aufweisen, wurde deshalb anhand der Anzahl zusätzlicher psychischer Probleme untersucht. Die 2011 in die PSA ein- und ausgetretenen Patient/innen wurden in drei Gruppen zusammengefasst. Personen, die an keinen weiteren psychischen Problemen litten, Personen, die ein oder zwei und diejenigen, die drei oder mehr Symptome berichteten. Insgesamt wurde die Annahme nicht bestätig. Vielmehr scheint der Konsum tendenziell mit der Anzahl zusätzlicher psychischer Probleme abzunehmen. Diese Tendenz zeigte sich auch für die Patient/ innen die 2010 in die PSA Wattwil ein- und austraten. Wie in der Grafik ersichtlich, fällt zum Zeitpunkt des Eintritts der hohe durchschnittliche Alkoholkonsum bei den Frauen mit drei und mehr Symptomen auf. Die entsprechenden Männer berichten im Vergleich einen eher tiefen durchschnittlichen täglichen Konsum. Mit einem Tageskonsum von 39.5g Alkohol/Tag liegt die Gruppe deutlich unter dem Schnitt der Patient/innen mit einem oder zwei Symptomen bzw. keinen weiteren psychischen Symptomen (Frauen max. 285g/Tag; Männer max. 95g/Tag). Die höchsten Konsummengen (Frauen max. 412g/Tag; Männer max. 793g/Tag) als auch die grösste Varianz finden sich bei der Patient/innengruppe, die von keinen weiteren Symptomen berichteten. Eintritt Lebensspanne 3 und mehr Symptome 1-2 Symptome keine Symptome 3 und mehr Symptome 1-2 Symptome keine Symptome Gramm Alkohol /Tag Frauen (n=54) Männer (n=104) ENTZUG UND ANZAHL PSYCHISCHER SYMPTOME (Eintritt 2011) Bezüglich des Krankheitsverlaufs lassen sich die act-info Daten dahingehend analysieren, wie eine komplexere Symptomatik mit der Art und Häufigkeiten der Substanzentzüge einher geht. In der Grafik sind die Patient/innen in drei Gruppen bezüglich ihrer Anzahl psychischer Symptome vor Eintritt dargestellt. Eine ähnliche Verteilung zeigte sich auch bei einer Gruppierung hinsichtlich der psychischen Probleme über die gesamte Lebensspanne. Kaum Unterschiede finden sich zwischen der Gruppe Patient/innen, die keine weiteren psychischen Symptome berichteten, und der Gruppe mit ein bis zwei Symptomen. Dies gilt sowohl für die Anzahl bisheriger Entzüge als auch die Art des letzten Entzugs vor Eintritt in die PSA Wattwil. 86% bzw. 84% wurden beim Entzug medikamentös unterstützt und für jeweils gut 40% war es die erste Entzugsbehandlung bzw. die zweite oder dritte. Demgegenüber finden sich bei den Patient/innen mit drei und mehr zusätzlichen Symptomen prozentual fast doppelt so viele Personen (28.6%), die sich im Vorfeld bereits vier oder mehr Entzugsbehandlungen unterzogen. Auch wurden alle diese Patient/innen bei ihrer letzten Entzugsbehandlung medikamentös unterstützt. 4 und mehr Entzüge 2 oder 3 Entzüge 1 Entzug medi. unterstützter Entzug kalter Entzug 0% 20% 40% 60% 80% 100% 3 und mehr Symptome (n=7) 1-2 Symptome (n=36) keine (n=76) 9
11 Eine Initiative der Forel Klinik und der Klinik Südhang Kontakt: atf schweiz, Forel Klinik, Islikonerstrasse 5, 8548 Ellikon an der Thur, atf schweiz, Klinik Südhang, Südhang 1, 3038 Kirchlindach,
Executive Summary. act-info Patientenmonitoring Mühlhof. Autoren summary Sonja Stutz, Susanne Rösner, Katrin Schläfli und Harald Klingemann (2012)
 act-info Patientenmonitoring Autoren summary Sonja Stutz, Susanne Rösner, Katrin Schläfli und Harald Klingemann (2012) act-info Patientenmonitoring 2011 Executive-Summary Zentrum für Suchttherapie und
act-info Patientenmonitoring Autoren summary Sonja Stutz, Susanne Rösner, Katrin Schläfli und Harald Klingemann (2012) act-info Patientenmonitoring 2011 Executive-Summary Zentrum für Suchttherapie und
Patientenmonitoring Forel Klinik Autoren summary Executive Summary 2011
 act-info Patientenmonitoring Autoren summary Sonja Stutz, Susanne Rösner, Katrin Schläfli und Harald Klingemann (2012) Act-info Patientenmonitoring 2011 Executive-Summary Ellikon a.d. Thur, & atf Schweiz
act-info Patientenmonitoring Autoren summary Sonja Stutz, Susanne Rösner, Katrin Schläfli und Harald Klingemann (2012) Act-info Patientenmonitoring 2011 Executive-Summary Ellikon a.d. Thur, & atf Schweiz
Executive Summary. act-info Patientenmonitoring Klinik Südhang. atf. alkoholismus therapieforschung schweiz
 atf alkoholismus therapieforschung schweiz Autoren summary Veronica Gomez, Harald Klingemann, Peter Eggli, Thomas Meyer und Monika Schlüsselberger (2008). act-info Patientenmonitoring. Executive Summary.
atf alkoholismus therapieforschung schweiz Autoren summary Veronica Gomez, Harald Klingemann, Peter Eggli, Thomas Meyer und Monika Schlüsselberger (2008). act-info Patientenmonitoring. Executive Summary.
Studie zur Wirksamkeit ambulanter Beratung bei Alkoholproblemen
 Newsletter Juni 2015 Zürcher Fachstelle für Alkoholprobleme Studie zur Wirksamkeit ambulanter Beratung bei Alkoholproblemen Zürcher Fachstelle für Alkoholprobleme ZFA Josefstrasse 91, 8005 Zürich 043 444
Newsletter Juni 2015 Zürcher Fachstelle für Alkoholprobleme Studie zur Wirksamkeit ambulanter Beratung bei Alkoholproblemen Zürcher Fachstelle für Alkoholprobleme ZFA Josefstrasse 91, 8005 Zürich 043 444
Executive Summary. act-info Patientenmonitoring Forel Klinik. atf. alkoholismus therapieforschung schweiz
 atf alkoholismus therapieforschung schweiz Autoren summary Monika Schlüsselberger, Peter Eggli, Thomas Meyer, Katrin Schläfli und Harald Klingemann (2009). act-info Patientenmonitoring 2008. Executive
atf alkoholismus therapieforschung schweiz Autoren summary Monika Schlüsselberger, Peter Eggli, Thomas Meyer, Katrin Schläfli und Harald Klingemann (2009). act-info Patientenmonitoring 2008. Executive
Executive Summary. act-info Patientenmonitoring Südhang. atf. alkoholismus therapieforschung schweiz
 atf alkoholismus therapieforschung schweiz Autoren summary Katrin Schläfli, Harald Klingemann, Peter Allemann, Peter Eggli und Monika Schüsselberger (2009). act-info Patientenmonitoring 2008. Executive
atf alkoholismus therapieforschung schweiz Autoren summary Katrin Schläfli, Harald Klingemann, Peter Allemann, Peter Eggli und Monika Schüsselberger (2009). act-info Patientenmonitoring 2008. Executive
Integrierte Sucht-Psychose Station
 Integrierte Sucht-Psychose Station Priv. Doz. Dr. Iris Maurer Friedrich-Schiller Schiller-Universität Jena Nomenklatur Substanzgebrauch mit psychischer Erkrankung Psychisch Kranke mit Substanzgebrauch
Integrierte Sucht-Psychose Station Priv. Doz. Dr. Iris Maurer Friedrich-Schiller Schiller-Universität Jena Nomenklatur Substanzgebrauch mit psychischer Erkrankung Psychisch Kranke mit Substanzgebrauch
Evidenzbasierte Suchtmedizin
 Evidenzbasierte Suchtmedizin Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie e.v. und der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde von Lutz
Evidenzbasierte Suchtmedizin Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie e.v. und der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde von Lutz
Konsumziele in der stationären Behandlung
 Konsumziele in der stationären Behandlung Ansprüche und Wirklichkeit der Patientinnen und Patienten Peter Eggli atf Fachtagung 19.11.2010 Übersicht Übergeordnete Therapieziele in der stationären Behandlung
Konsumziele in der stationären Behandlung Ansprüche und Wirklichkeit der Patientinnen und Patienten Peter Eggli atf Fachtagung 19.11.2010 Übersicht Übergeordnete Therapieziele in der stationären Behandlung
Abhängigkeit: Krankheit oder Schwäche? Prof. Ion Anghelescu Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
 Abhängigkeit: Krankheit oder Schwäche? Prof. Ion Anghelescu Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie SCHULD vs. KRANKHEIT SUCHT vs. ABHÄNGIGKEIT ABHÄNGIGKEIT vs. MISSBRAUCH PSYCHISCHE vs. PHYSISCHE ABHÄNGIGKEIT
Abhängigkeit: Krankheit oder Schwäche? Prof. Ion Anghelescu Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie SCHULD vs. KRANKHEIT SUCHT vs. ABHÄNGIGKEIT ABHÄNGIGKEIT vs. MISSBRAUCH PSYCHISCHE vs. PHYSISCHE ABHÄNGIGKEIT
Ergebnisse der 2016 neu durchgeführten Behandlungen im Psychotherapieteam (Therapiebeginn bis 1 Jahr)
 Ergebnisse der 2016 neu durchgeführten Behandlungen im Psychotherapieteam (Therapiebeginn bis 1 Jahr) Das Psychotherapieteam kooperiert mit der Universität Zürich, um eine externe Qualitätssicherung und
Ergebnisse der 2016 neu durchgeführten Behandlungen im Psychotherapieteam (Therapiebeginn bis 1 Jahr) Das Psychotherapieteam kooperiert mit der Universität Zürich, um eine externe Qualitätssicherung und
Wege aus der Abhängigkeit
 Wege aus der Abhängigkeit 1 SUCHTTHERAPIE IM WANDEL Gatsch Hintergrund Historische Trennung von psychiatrischenund Suchterkrankungen Sucht als Charakterschwäche Psychiatrie vernachlässigte lange Zeit das
Wege aus der Abhängigkeit 1 SUCHTTHERAPIE IM WANDEL Gatsch Hintergrund Historische Trennung von psychiatrischenund Suchterkrankungen Sucht als Charakterschwäche Psychiatrie vernachlässigte lange Zeit das
Studie zur Wirksamkeit ambulanter Beratung bei Alkoholproblemen
 newsletter suchthilfe ags und beratungszentrum bezirk baden Studie zur Wirksamkeit ambulanter Beratung bei Alkoholproblemen Beratungszentrum Bezirk Baden Mellingerstrasse 30, 5400 Baden 056 200 55 77,
newsletter suchthilfe ags und beratungszentrum bezirk baden Studie zur Wirksamkeit ambulanter Beratung bei Alkoholproblemen Beratungszentrum Bezirk Baden Mellingerstrasse 30, 5400 Baden 056 200 55 77,
Substanzkonsum im Alter ein unterschätztes Problem?
 Forum für Suchtfragen; Basel 17. Oktober 2013 Substanzkonsum im Alter ein unterschätztes Problem? Prof. Dr. med. Gerhard Wiesbeck Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen, UPK Der demographische Begünstigungsfaktor
Forum für Suchtfragen; Basel 17. Oktober 2013 Substanzkonsum im Alter ein unterschätztes Problem? Prof. Dr. med. Gerhard Wiesbeck Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen, UPK Der demographische Begünstigungsfaktor
Definition: Komorbidität psychische Erkrankungen ASUD
 Definition: Komorbidität psychische Erkrankungen ASUD Komorbidtät bedeutet das Auftreten von Alkohol-/ Substanzmittelkonsumstörungen + anderen psychischen Erkrankungen. Diese können bei der Untersuchung,
Definition: Komorbidität psychische Erkrankungen ASUD Komorbidtät bedeutet das Auftreten von Alkohol-/ Substanzmittelkonsumstörungen + anderen psychischen Erkrankungen. Diese können bei der Untersuchung,
Illegale Suchtmittel
 Illegale Suchtmittel Illegal definiert einen juristischen Status: Suchtmittel, deren Erwerb und Vertrieb nach Betäubungsmittelgesetz, verboten ist. Wichtigste Vertreter: Heroin Kokain und andere Stimulantien,
Illegale Suchtmittel Illegal definiert einen juristischen Status: Suchtmittel, deren Erwerb und Vertrieb nach Betäubungsmittelgesetz, verboten ist. Wichtigste Vertreter: Heroin Kokain und andere Stimulantien,
Depression entschlossen behandeln aber wie?
 Depression entschlossen behandeln aber wie? Dr. med. Michael Enzl Wiesbaden (30. April 2011) - Depressionen im höheren Lebensalter werden zu selten diagnostiziert und häufig nicht aus-reichend behandelt.
Depression entschlossen behandeln aber wie? Dr. med. Michael Enzl Wiesbaden (30. April 2011) - Depressionen im höheren Lebensalter werden zu selten diagnostiziert und häufig nicht aus-reichend behandelt.
Suchtprobleme. stationären Altenpflege
 5. Kooperationstag Sucht und Drogen NRW www.wissensuchtwege.de 4. März 2009 - Köln Suchtprobleme in der stationären Altenpflege Birgitta Lengsholz Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie Gerontopsychiatrische
5. Kooperationstag Sucht und Drogen NRW www.wissensuchtwege.de 4. März 2009 - Köln Suchtprobleme in der stationären Altenpflege Birgitta Lengsholz Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie Gerontopsychiatrische
Drogenabhängigkeit als Doppeldiagnose
 Drogenabhängigkeit als Doppeldiagnose Heidelberger Kongress des Fachverband Sucht e.v. 2018 Forum 4 Klassifikation mehrerer Abhängigkeiten Fallvignette I Definition Eine Komorbidität ist ein weiteres,
Drogenabhängigkeit als Doppeldiagnose Heidelberger Kongress des Fachverband Sucht e.v. 2018 Forum 4 Klassifikation mehrerer Abhängigkeiten Fallvignette I Definition Eine Komorbidität ist ein weiteres,
Ergebnisse der 2014 neu durchgeführten Behandlungen im Psychotherapieteam
 Ergebnisse der 2014 neu durchgeführten Behandlungen im Psychotherapieteam Das Psychotherapieteam kooperiert mit der Universität Zürich, um eine externe Qualitätssicherung und Evaluation der Behandlungen
Ergebnisse der 2014 neu durchgeführten Behandlungen im Psychotherapieteam Das Psychotherapieteam kooperiert mit der Universität Zürich, um eine externe Qualitätssicherung und Evaluation der Behandlungen
Eike Fittig, Johannes Schweizer & Udo Rudolph Technische Universität Chemnitz/ Klinikum Chemnitz. Dezember 2005
 Lebenszufriedenheit bei chronischen Erkrankungen: Zum wechselseitigen Einfluss von Strategien der Krankheitsbewältigung, Depression und sozialer Unterstützung Technische Universität Chemnitz/ Klinikum
Lebenszufriedenheit bei chronischen Erkrankungen: Zum wechselseitigen Einfluss von Strategien der Krankheitsbewältigung, Depression und sozialer Unterstützung Technische Universität Chemnitz/ Klinikum
Depressive Erkrankungen in Thüringen: Epidemiologie, Prävalenz, Versorgung und Prävention
 Depressive Erkrankungen in Thüringen: Epidemiologie, Prävalenz, Versorgung und Prävention von Sebastian Selzer, Sabrina Mann 1. Auflage Diplomica Verlag 2015 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de ISBN
Depressive Erkrankungen in Thüringen: Epidemiologie, Prävalenz, Versorgung und Prävention von Sebastian Selzer, Sabrina Mann 1. Auflage Diplomica Verlag 2015 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de ISBN
Kognitive Therapie der Sucht
 B eckavright/ne wman/liese Kognitive Therapie der Sucht Herausgegeben von Johannes Lindenmeyer PsychologieVerlagsUnion Inhalt Vorwort von Johannes Lindenmeyer Einleitung V IX I Formen der Abhängigkeit
B eckavright/ne wman/liese Kognitive Therapie der Sucht Herausgegeben von Johannes Lindenmeyer PsychologieVerlagsUnion Inhalt Vorwort von Johannes Lindenmeyer Einleitung V IX I Formen der Abhängigkeit
Auf in eine neue Welt wenn Migration von Angst & Depression begleitet wird. Dr. med. Janis Brakowski Psychiatrische Universitätsklinik Zürich
 Auf in eine neue Welt wenn Migration von Angst & Depression begleitet wird Dr. med. Janis Brakowski Psychiatrische Universitätsklinik Zürich Was können Sie heute erwarten? Einführung in zentrale Aspekte
Auf in eine neue Welt wenn Migration von Angst & Depression begleitet wird Dr. med. Janis Brakowski Psychiatrische Universitätsklinik Zürich Was können Sie heute erwarten? Einführung in zentrale Aspekte
Workshop C: psychiatrische und somatische Begleiterkrankungen von Suchtkranken und deren Therapie
 Ekkehard Madlung Fachstation für Drogentherapie B3 Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie B Interdisziplinäres Symposium zur Suchterkrankung Grundlsee, 17. 18.02.2012 Workshop C: psychiatrische und
Ekkehard Madlung Fachstation für Drogentherapie B3 Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie B Interdisziplinäres Symposium zur Suchterkrankung Grundlsee, 17. 18.02.2012 Workshop C: psychiatrische und
Vorwort (Paulitsch, Karwautz) Geleitwort (Lenz) I Einführung (Paulitsch) Begriffsbestimmung Historische Aspekte...
 Inhaltsverzeichnis Vorwort (Paulitsch, Karwautz)... 15 Geleitwort (Lenz)... 17 I Einführung (Paulitsch)... 13 1 Begriffsbestimmung... 13 2 Historische Aspekte... 16 II Versorgungsstrukturen in der Psychiatrie
Inhaltsverzeichnis Vorwort (Paulitsch, Karwautz)... 15 Geleitwort (Lenz)... 17 I Einführung (Paulitsch)... 13 1 Begriffsbestimmung... 13 2 Historische Aspekte... 16 II Versorgungsstrukturen in der Psychiatrie
Termin: Mo., Psychosomatische Medizin / Psychotherapie 20. viele Altfragen! Frage 1:Somatisierungsstörung. Was ist falsch?
 Termin: Mo., 25.03.2013 Psychosomatische Medizin / Psychotherapie 20 viele Altfragen! Frage 1:Somatisierungsstörung. Was ist falsch? nehmen epidemiologisch mit zunehmendem Alter exponentiell ab Patienten
Termin: Mo., 25.03.2013 Psychosomatische Medizin / Psychotherapie 20 viele Altfragen! Frage 1:Somatisierungsstörung. Was ist falsch? nehmen epidemiologisch mit zunehmendem Alter exponentiell ab Patienten
9. Fragebogen Katamnese
 78 9. Fragebogen Katamnese KATAMNESE Laufende Nummer: -------------------------------------------------- Name der Patientin: --------------------------------------------------- Geburtstag der Patientin:
78 9. Fragebogen Katamnese KATAMNESE Laufende Nummer: -------------------------------------------------- Name der Patientin: --------------------------------------------------- Geburtstag der Patientin:
1 Vorwort Vorwort zur 2. Auflage Vorwort zur 1. Auflage... 16
 Inhalt Der Autor..................................................... 13 1 Vorwort.................................................... 15 1.1 Vorwort zur 2. Auflage.....................................
Inhalt Der Autor..................................................... 13 1 Vorwort.................................................... 15 1.1 Vorwort zur 2. Auflage.....................................
Epidemiologische Ergebnisse von MAZ.
 Epidemiologische Ergebnisse von - Häufigkeit psychischer Belastungen und substanzbezogener Störungen http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/neuro-psychiatrische_krankheiten/adhs 1 Prä-Post-Messung
Epidemiologische Ergebnisse von - Häufigkeit psychischer Belastungen und substanzbezogener Störungen http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/neuro-psychiatrische_krankheiten/adhs 1 Prä-Post-Messung
Ergebnisse der 2014 neu durchgeführten Behandlungen im Psychotherapieteam (Therapiebeginn bis -abschluss)
 Ergebnisse der 2014 neu durchgeführten Behandlungen im Psychotherapieteam (Therapiebeginn bis -abschluss) Das Psychotherapieteam kooperiert mit der Universität Zürich, um eine externe Qualitätssicherung
Ergebnisse der 2014 neu durchgeführten Behandlungen im Psychotherapieteam (Therapiebeginn bis -abschluss) Das Psychotherapieteam kooperiert mit der Universität Zürich, um eine externe Qualitätssicherung
AOK-Patienten vom Modellversuch zur Integrierten Versorgung
 AOK-Patienten vom Modellversuch zur Integrierten Versorgung Im Rahmen eines Modellprojekts ermöglichte es die AOK Niedersachsen den niedergelassenen Ärzten, Patienten direkt in die Mediclin Deister Weser
AOK-Patienten vom Modellversuch zur Integrierten Versorgung Im Rahmen eines Modellprojekts ermöglichte es die AOK Niedersachsen den niedergelassenen Ärzten, Patienten direkt in die Mediclin Deister Weser
Gliederung Psychische Komorbidität in der stationären Suchtrehabilitation Daten aus der Basisdokumentation des Fachverbandes Sucht Was sollten wir tun
 Komorbidität bei Suchterkrankungen Was wissen wir? Was sollten wir tun? Selbsthilfegruppentagung 2016 Oliver Kreh Leitender Psychologe AHG-Klinik Tönisstein AHG Klinik Tönisstein Profil: Gründung 1974
Komorbidität bei Suchterkrankungen Was wissen wir? Was sollten wir tun? Selbsthilfegruppentagung 2016 Oliver Kreh Leitender Psychologe AHG-Klinik Tönisstein AHG Klinik Tönisstein Profil: Gründung 1974
Depression und Angst. Komorbidität
 Depression und Angst Komorbidität Geschlechterverteilung der Diagnosen 70 60 50 40 30 W M 20 10 0 Depr. Angst Borderline 11.12.2007 erstellt von: Dr. Walter North 2 Angststörungen Panikstörung mit/ohne
Depression und Angst Komorbidität Geschlechterverteilung der Diagnosen 70 60 50 40 30 W M 20 10 0 Depr. Angst Borderline 11.12.2007 erstellt von: Dr. Walter North 2 Angststörungen Panikstörung mit/ohne
Fragen des allgemeinen Behandlungssettings
 25.Jahrestagung des Suchtausschusses der Bundesdirektorenkonferenz Regensburg 23.-24.1.2014 Die neuen S3-Leitlinien Alkoholabhängigkeit: Fragen des allgemeinen Behandlungssettings Ein Werkstattbericht
25.Jahrestagung des Suchtausschusses der Bundesdirektorenkonferenz Regensburg 23.-24.1.2014 Die neuen S3-Leitlinien Alkoholabhängigkeit: Fragen des allgemeinen Behandlungssettings Ein Werkstattbericht
Ambulanter Alkoholentzug
 Ambulanter Alkoholentzug in der Psychiatrie Alkoholverbrauch je Einwohner an reinem Alkohol 1990 1995 2000 2006 2007 12,1 Liter 11,1 Liter 10,5 Liter 10,1 Liter 9,9 Liter 2 Verbrauch je Einwohner an Bier,
Ambulanter Alkoholentzug in der Psychiatrie Alkoholverbrauch je Einwohner an reinem Alkohol 1990 1995 2000 2006 2007 12,1 Liter 11,1 Liter 10,5 Liter 10,1 Liter 9,9 Liter 2 Verbrauch je Einwohner an Bier,
Dietmar Kemmann, Diakonie Krankenhaus Harz Martina Fischer, AHG Kliniken Daun Altburg. 29. Heidelberger Kongress des Fachverbandes Sucht e.v.
 Dietmar Kemmann, Diakonie Krankenhaus Harz Martina Fischer, AHG Kliniken Daun Altburg 29. Heidelberger Kongress des Fachverbandes Sucht e.v. Fachverband Sucht e.v. 1 Beteiligte Einrichtungen der Katamnese:
Dietmar Kemmann, Diakonie Krankenhaus Harz Martina Fischer, AHG Kliniken Daun Altburg 29. Heidelberger Kongress des Fachverbandes Sucht e.v. Fachverband Sucht e.v. 1 Beteiligte Einrichtungen der Katamnese:
Sucht tut weh. Suchtmedizinische Abklärung und Behandlung
 Sucht tut weh Suchtmedizinische Abklärung und Behandlung Haben Sie selber das Gefühl, illegale oder legale Suchtmittel in einem schädlichen Mass zu konsumieren? Wir helfen Ihnen weiter Eine Suchterkrankung
Sucht tut weh Suchtmedizinische Abklärung und Behandlung Haben Sie selber das Gefühl, illegale oder legale Suchtmittel in einem schädlichen Mass zu konsumieren? Wir helfen Ihnen weiter Eine Suchterkrankung
Behandlung und Behandlungssettings bei Alkoholkonsumstörungen: Empfehlungen der S3-Leitlinie Alkoholbezogene Störungen
 Behandlung und Behandlungssettings bei Alkoholkonsumstörungen: Empfehlungen der S3-Leitlinie Alkoholbezogene Störungen Prof. Dr. Ulrich Preuss Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg / Vitos Herborn
Behandlung und Behandlungssettings bei Alkoholkonsumstörungen: Empfehlungen der S3-Leitlinie Alkoholbezogene Störungen Prof. Dr. Ulrich Preuss Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg / Vitos Herborn
Sucht im Alter: Epidemiologie, Therapie und Versorgung
 Sucht im Alter: Epidemiologie, Therapie und Versorgung Hans-Jürgen Rumpf Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Forschungsgruppe S:TEP (Substanzbezogene und verwandte Störungen: Therapie, Epidemiologie
Sucht im Alter: Epidemiologie, Therapie und Versorgung Hans-Jürgen Rumpf Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Forschungsgruppe S:TEP (Substanzbezogene und verwandte Störungen: Therapie, Epidemiologie
Alkoholabhängigkeit. W. Wolfgang Fleischhacker Univ.-Klinik für Biologische Psychiatrie Medizinische Universität Innsbruck
 Alkoholabhängigkeit W. Wolfgang Fleischhacker Univ.-Klinik für Biologische Psychiatrie Medizinische Universität Innsbruck Sucht in Österreich Nikotin: ca. 2 Mio Raucher Medikamente: 110.000 Abhängige Alkohol:
Alkoholabhängigkeit W. Wolfgang Fleischhacker Univ.-Klinik für Biologische Psychiatrie Medizinische Universität Innsbruck Sucht in Österreich Nikotin: ca. 2 Mio Raucher Medikamente: 110.000 Abhängige Alkohol:
Psychische Störungen und Suchterkrankungen
 Psychische Störungen und Suchterkrankungen Diagnostik und Behandlung von Doppeldiagnosen von Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank, Marc Walter 1. Auflage Kohlhammer 2013 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de
Psychische Störungen und Suchterkrankungen Diagnostik und Behandlung von Doppeldiagnosen von Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank, Marc Walter 1. Auflage Kohlhammer 2013 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de
Rau/Dehner-Rau Raus aus der Suchtfalle!
 Rau/Dehner-Rau Raus aus der Suchtfalle! Die Autoren Dr. med. Cornelia Dehner-Rau arbeitet als Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Klinik für Psychotherapeutische und Psychosomatische
Rau/Dehner-Rau Raus aus der Suchtfalle! Die Autoren Dr. med. Cornelia Dehner-Rau arbeitet als Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Klinik für Psychotherapeutische und Psychosomatische
Ambulanter Alkoholentzug
 Ambulanter Alkoholentzug in der Psychiatrie Alkoholverbrauch je Einwohner an reinem Alkohol 1990 1995 2000 2006 2007 12,1 Liter 11,1 Liter 10,5 Liter 10,1 Liter 9,9 Liter 2 Verbrauch je Einwohner an Bier,
Ambulanter Alkoholentzug in der Psychiatrie Alkoholverbrauch je Einwohner an reinem Alkohol 1990 1995 2000 2006 2007 12,1 Liter 11,1 Liter 10,5 Liter 10,1 Liter 9,9 Liter 2 Verbrauch je Einwohner an Bier,
act-info Residalc Marina Delgrande Jordan
 act-info Residalc act-info im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich Ergebnisse der KlientInnenbefragung 2005 Deskriptive Statistik Marina Delgrande Jordan Juli 2006 Dank Unser herzlicher Dank gilt
act-info Residalc act-info im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich Ergebnisse der KlientInnenbefragung 2005 Deskriptive Statistik Marina Delgrande Jordan Juli 2006 Dank Unser herzlicher Dank gilt
Helpline Glücksspielsucht Spielsucht und komorbide Erkrankungen
 Helpline Glücksspielsucht Spielsucht und komorbide Erkrankungen MMag.. Margarethe Zanki www.sucht-addiction sucht-addiction.infoinfo 1980 Klassifikation des pathologischen Spielens 1980 erstmalige offizielle
Helpline Glücksspielsucht Spielsucht und komorbide Erkrankungen MMag.. Margarethe Zanki www.sucht-addiction sucht-addiction.infoinfo 1980 Klassifikation des pathologischen Spielens 1980 erstmalige offizielle
Forum Tabakprävention und Behandlung der Tabakabhängigkeit in Gesundheitsinstitutionen Schweiz. Die Forel Klinik ein Überblick
 Die Forel Klinik ein Überblick Die Forel Klinik ist das schweizweit führende Kompetenzzentrum für die Behandlung von Alkohol-, Medikamenten- und Tabakabhängigkeit. Unser wissenschaftlich fundiertes Behandlungskonzept
Die Forel Klinik ein Überblick Die Forel Klinik ist das schweizweit führende Kompetenzzentrum für die Behandlung von Alkohol-, Medikamenten- und Tabakabhängigkeit. Unser wissenschaftlich fundiertes Behandlungskonzept
Trennung & Scheidung und Psychische Störungen: Epidemiologische Ergebnisse Reiner Bastine, 2006
 Trennung & Scheidung und Psychische Störungen: Epidemiologische Ergebnisse Reiner Bastine, 2006 Prof. Dr. Reiner Bastine Psychologisches Institut der Universität Heidelberg & Heidelberger Institut für
Trennung & Scheidung und Psychische Störungen: Epidemiologische Ergebnisse Reiner Bastine, 2006 Prof. Dr. Reiner Bastine Psychologisches Institut der Universität Heidelberg & Heidelberger Institut für
Therapieziel Abstinenz aus Sicht der Deutschen Rentenversicherung Bund
 Therapieziel Abstinenz aus Sicht der Deutschen Rentenversicherung Bund Dr. med. Joachim Köhler Ärztlicher Referent Geschäftsbereich Sozialmedizin und Rehabilitation Deutsche Rentenversicherung Bund Tagung
Therapieziel Abstinenz aus Sicht der Deutschen Rentenversicherung Bund Dr. med. Joachim Köhler Ärztlicher Referent Geschäftsbereich Sozialmedizin und Rehabilitation Deutsche Rentenversicherung Bund Tagung
Indikatoren für den Behandlungserfolg bei pathologischen Glücksspielern Ausgewählte Befunde einer multizentrischen Katamnese
 Indikatoren für den Behandlungserfolg bei pathologischen Glücksspielern Ausgewählte Befunde einer multizentrischen Katamnese Premper, V., Schwickerath, J., Missel, P., Feindel, H., Zemlin, U. & Petry,
Indikatoren für den Behandlungserfolg bei pathologischen Glücksspielern Ausgewählte Befunde einer multizentrischen Katamnese Premper, V., Schwickerath, J., Missel, P., Feindel, H., Zemlin, U. & Petry,
DSM-5-Updates: Offizielle Aktualisierungen der American Psychiatric Association
 American Psychiatric Association Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-5. 2., korrigierte Auflage Deutsche Ausgabe herausgegeben von Peter Falkai und Hans-Ulrich Wittchen, mitherausgegeben
American Psychiatric Association Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-5. 2., korrigierte Auflage Deutsche Ausgabe herausgegeben von Peter Falkai und Hans-Ulrich Wittchen, mitherausgegeben
Parkinson kommt selten allein
 Herausforderung Komorbiditäten Parkinson kommt selten allein Prof. Dr. Jens Volkmann, Würzburg Würzburg (14. März 2013) - Morbus Parkinson ist eine chronisch progrediente Erkrankung, für die noch keine
Herausforderung Komorbiditäten Parkinson kommt selten allein Prof. Dr. Jens Volkmann, Würzburg Würzburg (14. März 2013) - Morbus Parkinson ist eine chronisch progrediente Erkrankung, für die noch keine
Depression. Was ist das eigentlich?
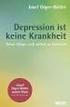 Depression Was ist das eigentlich? Marien Hospital Dortmund Kath. St.-Johannes-Gesellschaft Dr. med. Harald Krauß Chefarzt Tel: 0231-77 50 0 www.marien-hospital-dortmund.de 1 Selbsttest Leiden Sie seit
Depression Was ist das eigentlich? Marien Hospital Dortmund Kath. St.-Johannes-Gesellschaft Dr. med. Harald Krauß Chefarzt Tel: 0231-77 50 0 www.marien-hospital-dortmund.de 1 Selbsttest Leiden Sie seit
Verbreitung von Suchtformen und Zugangswege zur Behandlung
 Verbreitung von Suchtformen und Zugangswege zur Fachtagung Psychotherapie und Suchtbehandlung in Berlin 25. November 2008 Gerhard Bühringer, Monika Sassen, Axel Perkonigg, Silke Behrendt Gerhard Bühringer,
Verbreitung von Suchtformen und Zugangswege zur Fachtagung Psychotherapie und Suchtbehandlung in Berlin 25. November 2008 Gerhard Bühringer, Monika Sassen, Axel Perkonigg, Silke Behrendt Gerhard Bühringer,
Von dysfunktionalen Kompensationen zur Balance zwischen Polaritäten Eine Einführung in das Thema Dr. H. Terdenge, Fachtagung am 22.
 Von dysfunktionalen Kompensationen zur Balance zwischen Polaritäten Eine Einführung in das Thema Dr. H. Terdenge, Fachtagung am 22. September 2017 2 Inhalt 1. Einleitung 2. Was sind Persönlichkeitsstörungen?
Von dysfunktionalen Kompensationen zur Balance zwischen Polaritäten Eine Einführung in das Thema Dr. H. Terdenge, Fachtagung am 22. September 2017 2 Inhalt 1. Einleitung 2. Was sind Persönlichkeitsstörungen?
DEPRESSIONEN. Referat von Sophia Seitz und Ester Linz
 DEPRESSIONEN Referat von Sophia Seitz und Ester Linz ÜBERSICHT 1. Klassifikation 2. Symptomatik 3. Gruppenarbeit 4. Diagnostische Verfahren 5. Epidemiologie 6. Ätiologische Modelle 7. Fallbeispiel KLASSIFIKATION
DEPRESSIONEN Referat von Sophia Seitz und Ester Linz ÜBERSICHT 1. Klassifikation 2. Symptomatik 3. Gruppenarbeit 4. Diagnostische Verfahren 5. Epidemiologie 6. Ätiologische Modelle 7. Fallbeispiel KLASSIFIKATION
Stationäre Behandlung bei Pathologischem PC-/Internet-Gebrauch
 Stationäre Behandlung bei Pathologischem PC-/Internet-Gebrauch Fachtagung der Brandenburgischen Landesstelle für Suchtfragen e.v. am 21.03.2013 Dr. Bernd Sobottka Inhalt Stichprobenbeschreibung Stationäre
Stationäre Behandlung bei Pathologischem PC-/Internet-Gebrauch Fachtagung der Brandenburgischen Landesstelle für Suchtfragen e.v. am 21.03.2013 Dr. Bernd Sobottka Inhalt Stichprobenbeschreibung Stationäre
Glücksspielsucht im Alter. Heike Hinz AHG Kliniken Wigbertshöhe/Richelsdorf
 Glücksspielsucht im Alter Heike Hinz AHG Kliniken Wigbertshöhe/Richelsdorf Patientengruppen in der AHG Klinik Wigbertshöhe 2 Seniorengruppen 1. 50 bis 65-Jährige 2. 60 bis 80-Jährige (auch Medikamentenabhängige)
Glücksspielsucht im Alter Heike Hinz AHG Kliniken Wigbertshöhe/Richelsdorf Patientengruppen in der AHG Klinik Wigbertshöhe 2 Seniorengruppen 1. 50 bis 65-Jährige 2. 60 bis 80-Jährige (auch Medikamentenabhängige)
Anorexia und Bulimia nervosa als Komorbidität bei Substanzabhängigkeit. Heidelberg, 21. Juni 2018 Dr. Monika Vogelgesang.
 Anorexia und Bulimia nervosa als Komorbidität bei Substanzabhängigkeit Heidelberg, 21. Juni 2018 Dr. Monika Vogelgesang Das Leben leben Gliederung Problemstellung Epidemiologie Bedingungsgefüge Therapeutische
Anorexia und Bulimia nervosa als Komorbidität bei Substanzabhängigkeit Heidelberg, 21. Juni 2018 Dr. Monika Vogelgesang Das Leben leben Gliederung Problemstellung Epidemiologie Bedingungsgefüge Therapeutische
Qualitätsbericht 2010 Praxis für Psychotherapie Dr. Shaw & Kollegen
 Qualitätsbericht 2010 Praxis für Psychotherapie Dr. Shaw & Kollegen Qualitätsbericht 2010 Praxis für Psychotherapie Dr. Shaw & Kollegen In unserem Qualitätsbericht 2010 haben wir die Ergebnisse von Erhebungen
Qualitätsbericht 2010 Praxis für Psychotherapie Dr. Shaw & Kollegen Qualitätsbericht 2010 Praxis für Psychotherapie Dr. Shaw & Kollegen In unserem Qualitätsbericht 2010 haben wir die Ergebnisse von Erhebungen
Zur Epidemiologie der Opiatund Drogenabhängigkeit in Deutschland
 Zur Epidemiologie der Opiatund Drogenabhängigkeit in Deutschland Workshop: Wie geht es weiter mit der Behandlung Opiatabhängiger 18.05.2015, Diakonie Deutschland/Berlin Tim Pfeiffer-Gerschel -DBDD/IFT
Zur Epidemiologie der Opiatund Drogenabhängigkeit in Deutschland Workshop: Wie geht es weiter mit der Behandlung Opiatabhängiger 18.05.2015, Diakonie Deutschland/Berlin Tim Pfeiffer-Gerschel -DBDD/IFT
Prävalenz, Ätiologie und Therapie von Cannabisabhängigkeit
 Prävalenz, Ätiologie und Therapie von Cannabisabhängigkeit Meike Neumann Dipl. Psychologin Psychologische Psychotherapeutin Konsumsituation in Deutschland I Nach einer repräsentativen Befragung der Bundeszentrale
Prävalenz, Ätiologie und Therapie von Cannabisabhängigkeit Meike Neumann Dipl. Psychologin Psychologische Psychotherapeutin Konsumsituation in Deutschland I Nach einer repräsentativen Befragung der Bundeszentrale
Komorbidität Psychische Erkrankungen und Sucht. R. Höfter, Chefärztin FB Suchtmedizin Kbo-Inn-Salzach-Klinikum, Wasserburg
 Komorbidität Psychische Erkrankungen und Sucht R. Höfter, Chefärztin FB Suchtmedizin Kbo-Inn-Salzach-Klinikum, Wasserburg Einführung - Weshalb ist Komorbidität in der Suchtmedizin ein wichtiges Thema?
Komorbidität Psychische Erkrankungen und Sucht R. Höfter, Chefärztin FB Suchtmedizin Kbo-Inn-Salzach-Klinikum, Wasserburg Einführung - Weshalb ist Komorbidität in der Suchtmedizin ein wichtiges Thema?
Gemeinsame Entstehungsbedingungen von stoffgebundenen und nicht-stoffgebundenen Süchten
 Gemeinsame Entstehungsbedingungen von stoffgebundenen und nicht-stoffgebundenen Süchten Dr. Dilek Sonntag, Dipl.-Psych. Unter Mitarbeit von Dipl.-Psych. Christina Bauer Dipl.-Psych. Anja Eichmann IFT Institut
Gemeinsame Entstehungsbedingungen von stoffgebundenen und nicht-stoffgebundenen Süchten Dr. Dilek Sonntag, Dipl.-Psych. Unter Mitarbeit von Dipl.-Psych. Christina Bauer Dipl.-Psych. Anja Eichmann IFT Institut
F1 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen
 F1 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen Triadisches System: Suchterkrankungen werden den psychogenen Erkrankungen zugeordnet. Sucht als psychische Abhängigkeit wurde von Gewöhnung
F1 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen Triadisches System: Suchterkrankungen werden den psychogenen Erkrankungen zugeordnet. Sucht als psychische Abhängigkeit wurde von Gewöhnung
Persönliche Angaben. 1 [1]Geschlecht: * 2 [2]Alter: * weiblich männlich
![Persönliche Angaben. 1 [1]Geschlecht: * 2 [2]Alter: * weiblich männlich Persönliche Angaben. 1 [1]Geschlecht: * 2 [2]Alter: * weiblich männlich](/thumbs/91/107737414.jpg) Willkommen zu unserer Studie zum Thema: "Erwachsene Kinder psychisch erkrankter Eltern". Im Folgenden interessieren wir uns für die Auswirkungen einer chronischen elterlichen psychischen Erkrankung und
Willkommen zu unserer Studie zum Thema: "Erwachsene Kinder psychisch erkrankter Eltern". Im Folgenden interessieren wir uns für die Auswirkungen einer chronischen elterlichen psychischen Erkrankung und
Das Alter hat nichts Schönes oder doch. Depressionen im Alter Ende oder Anfang?
 Das Alter hat nichts Schönes oder doch Depressionen im Alter Ende oder Anfang? Depressionen im Alter Gedanken zum Alter was bedeutet höheres Alter Depressionen im Alter Häufigkeit Was ist eigentlich eine
Das Alter hat nichts Schönes oder doch Depressionen im Alter Ende oder Anfang? Depressionen im Alter Gedanken zum Alter was bedeutet höheres Alter Depressionen im Alter Häufigkeit Was ist eigentlich eine
Jahressauswertung Jahresauswertung. Klinik SGM Langenthal
 Jahresauswertung Klinik SGM Langenthal 2010 Abteilung für Qualitätssicherung und Diagnostik (AQSD) 18.02.2011, Lars Kägi/René Hefti Inhaltsverzeichnis 1 EINLEITUNG UND DATENBASIS 3 2 AUSWERTUNG DER EINTRITTSMESSUNGEN
Jahresauswertung Klinik SGM Langenthal 2010 Abteilung für Qualitätssicherung und Diagnostik (AQSD) 18.02.2011, Lars Kägi/René Hefti Inhaltsverzeichnis 1 EINLEITUNG UND DATENBASIS 3 2 AUSWERTUNG DER EINTRITTSMESSUNGEN
NLS-Jahrestagung Komorbidität und Sucht
 Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen NLS-Jahrestagung Komorbidität und Sucht Doppel- oder Mehrfachdiagnosen bei Abhängigkeitserkrankungen 17. August 2010 Hannover Warum das Thema? Schlusswort
Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen NLS-Jahrestagung Komorbidität und Sucht Doppel- oder Mehrfachdiagnosen bei Abhängigkeitserkrankungen 17. August 2010 Hannover Warum das Thema? Schlusswort
Evaluation der ersten 18 Monate der psychiatrischen Tagesklinik in Bergen auf Rügen
 Evaluation der ersten 18 Monate der psychiatrischen Tagesklinik in Bergen auf Rügen Forschungsgruppe Sozialpsychiatrie des Instituts für Sozialpsychiatrie MV Christina Nerlich Inhalt 1. Studiendesign (3)
Evaluation der ersten 18 Monate der psychiatrischen Tagesklinik in Bergen auf Rügen Forschungsgruppe Sozialpsychiatrie des Instituts für Sozialpsychiatrie MV Christina Nerlich Inhalt 1. Studiendesign (3)
Von der Wiege bis zur Bahre? Psychische Erkrankungen über die gesamte Lebensspanne
 Von der Wiege bis zur Bahre? Psychische Erkrankungen über die gesamte Lebensspanne 4. Tag der Angestellten // Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz // Psychotherapie in verschiedenen Lebensphasen
Von der Wiege bis zur Bahre? Psychische Erkrankungen über die gesamte Lebensspanne 4. Tag der Angestellten // Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz // Psychotherapie in verschiedenen Lebensphasen
Und wie geht es den Angehörigen? Berücksichtigung des sozialen Umfeldes. Sonja Stutz
 Und wie geht es den Angehörigen? Berücksichtigung des sozialen Umfeldes Sonja Stutz Übersicht 1. Rolle der Angehörigen in der Suchttherapie 2. Einbezug der Angehörigen in die stationäre Therapie 3. Studie
Und wie geht es den Angehörigen? Berücksichtigung des sozialen Umfeldes Sonja Stutz Übersicht 1. Rolle der Angehörigen in der Suchttherapie 2. Einbezug der Angehörigen in die stationäre Therapie 3. Studie
Woher kommen, wohin gehen die Klienten?
 Woher kommen, wohin gehen die Klienten? Am Beispiel von Haus Wartenberg, einer offenen sozio-therapeutischen Einrichtung für chronisch mehrfach beeinträchtigte alkohol- und medikamentenabhängige Menschen
Woher kommen, wohin gehen die Klienten? Am Beispiel von Haus Wartenberg, einer offenen sozio-therapeutischen Einrichtung für chronisch mehrfach beeinträchtigte alkohol- und medikamentenabhängige Menschen
Epidemiologie. Vorlesung Klinische Psychologie, WS 2009/2010
 Epidemiologie Prof. Tuschen-Caffier Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie Universität Freiburg Sprechstunde: Mi, 14.00 15.00 Uhr, Raum 1013 Vorlesung Klinische Psychologie, WS 2009/2010
Epidemiologie Prof. Tuschen-Caffier Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie Universität Freiburg Sprechstunde: Mi, 14.00 15.00 Uhr, Raum 1013 Vorlesung Klinische Psychologie, WS 2009/2010
Psychische Störungen und Suchterkrankungen
 Marc Walter Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank (Hrsg.) Psychische Störungen und Suchterkrankungen Diagnostik und Behandlung von Doppeldiagnosen Verlag W. Kohlhammer Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile
Marc Walter Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank (Hrsg.) Psychische Störungen und Suchterkrankungen Diagnostik und Behandlung von Doppeldiagnosen Verlag W. Kohlhammer Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile
Prävalenz und Behandlung der Aufmerksamkeitsdefizit- Hyperaktivitäts-Störung (ADHS) bei alkoholabhängigen Patienten in der stationären Entwöhnung
 Prävalenz und Behandlung der Aufmerksamkeitsdefizit- Hyperaktivitäts-Störung (ADHS) bei alkoholabhängigen Patienten in der stationären Entwöhnung Das Leben leben Tillmann Weber MEDIAN Klinik Wilhelmsheim
Prävalenz und Behandlung der Aufmerksamkeitsdefizit- Hyperaktivitäts-Störung (ADHS) bei alkoholabhängigen Patienten in der stationären Entwöhnung Das Leben leben Tillmann Weber MEDIAN Klinik Wilhelmsheim
https://cuvillier.de/de/shop/publications/1309
 Christel Winkelbach (Autor) "Psychodynamische Kurzzeittherapie und kognitive Verhaltenstherapie bei generalisierter Angststörung eine randomisierte, kontrollierte und manualisierte Therapiestudie." https://cuvillier.de/de/shop/publications/1309
Christel Winkelbach (Autor) "Psychodynamische Kurzzeittherapie und kognitive Verhaltenstherapie bei generalisierter Angststörung eine randomisierte, kontrollierte und manualisierte Therapiestudie." https://cuvillier.de/de/shop/publications/1309
Gebrauch psychoaktiver Medikamente von Erwachsenen
 psychoaktiver Medikamente von Erwachsenen Medikamentenmissbrauch liegt nach der Definition der WHO dann vor, wenn ein Medikament ohne medizinische Notwendigkeit oder in unnötigen Mengen eingenommen wird.
psychoaktiver Medikamente von Erwachsenen Medikamentenmissbrauch liegt nach der Definition der WHO dann vor, wenn ein Medikament ohne medizinische Notwendigkeit oder in unnötigen Mengen eingenommen wird.
Definition Verlauf Ursachen. 1 Einleitung und Begriffsbestimmung »Negative kommunikative Handlungen«... 6
 VII I Definition Verlauf Ursachen 1 Einleitung und Begriffsbestimmung............. 3 2 Definitionen............................... 5 2.1 Einleitung.................................. 5 2.2»Negative kommunikative
VII I Definition Verlauf Ursachen 1 Einleitung und Begriffsbestimmung............. 3 2 Definitionen............................... 5 2.1 Einleitung.................................. 5 2.2»Negative kommunikative
Inhaltsverzeichnis. Allgemeine Einführung in die Ursachen psychischer Erkrankungen sowie deren Bedeutung
 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Einführung in die Ursachen psychischer Erkrankungen sowie deren Bedeutung XIII 1 Diagnostik und Klassifikation in der Psychiatrie 1.1 Psychiatrische Anamneseerhebung 1 Synonyme
Inhaltsverzeichnis Allgemeine Einführung in die Ursachen psychischer Erkrankungen sowie deren Bedeutung XIII 1 Diagnostik und Klassifikation in der Psychiatrie 1.1 Psychiatrische Anamneseerhebung 1 Synonyme
Überlegungen zu einer am Versorgungsbedarf orientierten Psychotherapeutenausbildung
 Überlegungen zu einer am Versorgungsbedarf orientierten Psychotherapeutenausbildung Prof. Dr. Rainer Richter DGVT Tagung zur Zukunft der Psychotherapieausbildung Berlin, 19. 20. 09. 2008 Überblick Versorgungsbedarf,
Überlegungen zu einer am Versorgungsbedarf orientierten Psychotherapeutenausbildung Prof. Dr. Rainer Richter DGVT Tagung zur Zukunft der Psychotherapieausbildung Berlin, 19. 20. 09. 2008 Überblick Versorgungsbedarf,
Auswertung der Katamnesedaten zum Entlassungsjahrgang Tageskliniken - Stand: August 2016
 Bundesverband für Stationäre Suchtkrankenhilfe e.v. Auswertung der Katamnesedaten zum Entlassungsjahrgang 2014 - Tageskliniken - Stand: August 2016 Einführung Für die Auswertung wurden nur Einrichtungen
Bundesverband für Stationäre Suchtkrankenhilfe e.v. Auswertung der Katamnesedaten zum Entlassungsjahrgang 2014 - Tageskliniken - Stand: August 2016 Einführung Für die Auswertung wurden nur Einrichtungen
Konzept zur stationären Behandlung Medikamentenabhängiger Lippstädter Modell
 Medikamentenabhängigkeit: Gemeinsam handeln! Berlin, 23.04.2007 Konzept zur stationären Behandlung Medikamentenabhängiger Lippstädter Modell Warstein LWL-Kliniken Warstein und Lippstadt Lippstadt Medikamentenabhängige
Medikamentenabhängigkeit: Gemeinsam handeln! Berlin, 23.04.2007 Konzept zur stationären Behandlung Medikamentenabhängiger Lippstädter Modell Warstein LWL-Kliniken Warstein und Lippstadt Lippstadt Medikamentenabhängige
JCP Bern Evaluation des Supported Employment im Routinebetrieb
 UNIVERSITÄRE PSYCHIATRISCHE DIENSTE BERN (UPD) DIREKTION PSYCHIATRISCHE REHABILITATION Forschung und Entwicklung JCP Bern Evaluation des Supported Employment im Routinebetrieb Dirk Richter Hintergrund
UNIVERSITÄRE PSYCHIATRISCHE DIENSTE BERN (UPD) DIREKTION PSYCHIATRISCHE REHABILITATION Forschung und Entwicklung JCP Bern Evaluation des Supported Employment im Routinebetrieb Dirk Richter Hintergrund
Aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Medizinischen Fakultät Charité Universitätsmedizin Berlin DISSERTATION
 Aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Medizinischen Fakultät Charité Universitätsmedizin Berlin DISSERTATION Geschlechterunterschiede bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung Zur Erlangung
Aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Medizinischen Fakultät Charité Universitätsmedizin Berlin DISSERTATION Geschlechterunterschiede bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung Zur Erlangung
Sucht tut weh. Teilstationäre Entwöhnungstherapie bei Alkohol-, Medikamentenund anderer Suchtmittelabhängigkeit
 Sucht tut weh Teilstationäre Entwöhnungstherapie bei Alkohol-, Medikamentenund anderer Suchtmittelabhängigkeit Montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr in der Tagesklinik Südhang und an den Abenden und Wochenenden
Sucht tut weh Teilstationäre Entwöhnungstherapie bei Alkohol-, Medikamentenund anderer Suchtmittelabhängigkeit Montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr in der Tagesklinik Südhang und an den Abenden und Wochenenden
INHALTSVERZEICHNIS ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 1 1 EINLEITUNG/ZIEL DER DISSERTATION 3 2 LITERATURDISKUSSION 5
 INHALTSVERZEICHNIS Seite ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 1 1 EINLEITUNG/ZIEL DER DISSERTATION 3 2 LITERATURDISKUSSION 5 2.1 Definition der Intelligenzminderung 5 2.2 Symptome der Intelligenzminderung 5 2.3 Diagnostik
INHALTSVERZEICHNIS Seite ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 1 1 EINLEITUNG/ZIEL DER DISSERTATION 3 2 LITERATURDISKUSSION 5 2.1 Definition der Intelligenzminderung 5 2.2 Symptome der Intelligenzminderung 5 2.3 Diagnostik
Sucht tut weh. Teilstationäre Entwöhnungstherapie bei Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit
 Sucht tut weh Teilstationäre Entwöhnungstherapie bei Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit Montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr in der Tagesklinik Südhang und an den Abenden und Wochenenden in Ihrem gewohnten
Sucht tut weh Teilstationäre Entwöhnungstherapie bei Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit Montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr in der Tagesklinik Südhang und an den Abenden und Wochenenden in Ihrem gewohnten
Sucht tut weh. Stationärer Entzug, Entwöhnungstherapie und Arbeitsintegration bei Alkohol-, Medikamenten- und anderer Suchtmittelabhängigkeit
 Sucht tut weh Stationärer Entzug, Entwöhnungstherapie und Arbeitsintegration bei Alkohol-, Medikamenten- und anderer Suchtmittelabhängigkeit Die Klinik Südhang bietet ein umfassendes Therapieprogramm für
Sucht tut weh Stationärer Entzug, Entwöhnungstherapie und Arbeitsintegration bei Alkohol-, Medikamenten- und anderer Suchtmittelabhängigkeit Die Klinik Südhang bietet ein umfassendes Therapieprogramm für
Bundesverband für stationäre Suchtkrankenhilfe e. V. Zusammenfassung der Verbandsauswertung 2016
 Zusammenfassung der Verbandsauswertung 2016 Basisdaten 2015 Katamnesedaten 2014 Basisdaten 2015 Die Auswertung der Basisdaten des Entlassungsjahrgangs 2015 umfasst insgesamt 19.097 Fälle aus 112 Einrichtungen.
Zusammenfassung der Verbandsauswertung 2016 Basisdaten 2015 Katamnesedaten 2014 Basisdaten 2015 Die Auswertung der Basisdaten des Entlassungsjahrgangs 2015 umfasst insgesamt 19.097 Fälle aus 112 Einrichtungen.
Patientenbogen Erstelldatum:
 Liebe Patientin, Lieber Patient, wir freuen uns, dass Sie sich für eine Behandlung in unserer Klinik entschieden haben. Wir möchten die Therapieangebote in unserem Haus vorab bestmöglich und individuell
Liebe Patientin, Lieber Patient, wir freuen uns, dass Sie sich für eine Behandlung in unserer Klinik entschieden haben. Wir möchten die Therapieangebote in unserem Haus vorab bestmöglich und individuell
Inhalt VII. Definition - Verlauf - Ursachen. 1 Einleitung und Begriffsbestimmung з. 2 Definitionen 5
 VII I Definition - Verlauf - Ursachen 1 Einleitung und Begriffsbestimmung з 2 Definitionen 5 2.1 Einleitung 5 2.2»Negative kommunikative Handlungen«6 2.3 Gemobbt wird immer ein Einzelner 12 2.4 Die Kriterien
VII I Definition - Verlauf - Ursachen 1 Einleitung und Begriffsbestimmung з 2 Definitionen 5 2.1 Einleitung 5 2.2»Negative kommunikative Handlungen«6 2.3 Gemobbt wird immer ein Einzelner 12 2.4 Die Kriterien
18. Tannenhof-Fachtagung
 18. Tannenhof-Fachtagung «Sind wir alle gaga? Oder der Mythos vom Massenleiden. Paul Rhyn santésuisse, Leiter Publizistik Projekt: Tannenhof-Fachtagung, 29.04.2016 Datum: 28.04.2016 Folie 1 Wie geht es
18. Tannenhof-Fachtagung «Sind wir alle gaga? Oder der Mythos vom Massenleiden. Paul Rhyn santésuisse, Leiter Publizistik Projekt: Tannenhof-Fachtagung, 29.04.2016 Datum: 28.04.2016 Folie 1 Wie geht es
Depressive Patienten in der stationären Entwöhnungsbehandlung
 salus klinik Friedrichsd orf Depressive Patienten in der stationären Entwöhnungsbehandlung Dr. Dietmar Kramer salus klinik Friedrichsdorf Worum es gehen soll Komorbidität Alkoholabhängigkeit depressive
salus klinik Friedrichsd orf Depressive Patienten in der stationären Entwöhnungsbehandlung Dr. Dietmar Kramer salus klinik Friedrichsdorf Worum es gehen soll Komorbidität Alkoholabhängigkeit depressive
