Intrakranielle Blutungen: rtpa- Lyse als minimal- invasive. Behandlung bei intrazerebralen und intraventrikulären Blutungen
|
|
|
- Magdalena Frei
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Ruhr- Universität Bochum Prof. Dr. med. Martin Scholz Dienstort: Klinikum Duisburg Abteilung Neurochirurgie Intrakranielle Blutungen: rtpa- Lyse als minimal- invasive Behandlung bei intrazerebralen und intraventrikulären Blutungen (eine klinische volumetrische Arbeit) Inagural- Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Medizin Einer Hohen Medizinischen Fakultät Der Ruhr- Universität Bochum Vorgelegt von Georgios Ntoulias aus Athen, Griechenland 2013
2 Dekan: Prof. Dr. med. Klaus Überla Referent: Prof. Dr. med. Martin Scholz Korreferent: Prof. Dr. med. Kirsten Schmieder Tag der mündlichen Prüfung:
3 Abstract Ntoulias Georgios Intrakranielle Blutungen: rtpa- Lyse als minimal- invasive Behandlung bei intrazerebralen und intraventrikulären Blutungen, eine klinische volumetrische Arbeit Problem: Intrazerebrale Blutungen stellen mit einer Inzidenz von 10-20/ Einwohnern eine häufige Erkrankung dar und gehen trotz intensivmedizinischer Fortschritte mit einer infausten Prognose einher. In der derzeitigen Literatur wird über verschiedene konservative und operative Therapieansätze in Hinsicht auf die Letalität, Morbidität und das Langzeitoutcome kontrovers diskutiert. Methode: Es wurden die Daten von 102 Patienten verwendet und in eine Subgruppe von Patienten mit intrazerebralen Blutungen mit wenig oder keinem Blutungsanteil im Ventrikelsystem und eine zweite Subgruppe von Patienten, die den größten Blutungsanteil im Ventrikelsystems aufwiesen unterteilt. Bei allen Patienten wurden 3mg rtpa über drei Tage über eine externe Ventrikeldrainage oder eine Codman - Drainage nach intrazerebral appliziert. Es erfolgte die klinische Einteilung bei Aufnahme mithilfe der GCS und bei Entlassung mithilfe der GOS sowie eine Volumetrie des Blutkoagels bei der durchgeführten CCT nach jeder rtpa- Gabe. Ergebnis: Die gesamte prozentuale Volumenreduktion aller Patienten mit intraventrikulärer Blutung nach der dritten rtpa-gabe betrug 68.4%, die Nachblutungsrate lag bei 5% und die Mortalität bei 22,5%. Bei der Patientengruppe mit Hauptanteil der Blutung im Hirnparenchym konnten wir eine Volumenabnahme von insgesamt 73.05% verzeichnen sowie ein gutes Outcome (GOS 4,5) bei 75% der Patienten mit initialem GCS > 13. Diskussion: Die intrazerebrale Injektion von rtpa ist eine minimalinvasive Technik zur Behandlung von intrazerebralen Blutungen mit der eine schnelle Abnahme des Blutvolumens erreichbar ist. Im Vergleich mit aktuellen Studien ist die intrazerebrale Injektion von 3mg rtpa eine adäquate Behandlungsmethode der intrazerebralen Blutungen. Jedoch sind auch das Alter und der GCS für die Prognose entscheidend.
4 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung Ätiologie Die arterielle Hypertonie als Ursache einer ICB Zerebrale Amyloidangiopathie Gefäßmalformationen Gerinnungstörungen Eingeblutete Infarkte Weitere Risikofaktoren für eine ICB Pathophysiogie Lokalisation Symptomatik Diagnostik Therapieoptionen Konservative Behandlung Operative Behandlung Prognose Fragestellung und Ziel der Arbeit Methodik Patienten Gruppe mit intraventrikulärer Blutung Gruppe mit intraparenchymaler Blutung Diagnostik Intrazerebrale Gabe von rtpa Intrathekale Gabe von rtpa Exkurs: Duisburger Nadel Gabe von rtpa in die intraparenchymatöse Blutungshöhle Einteilungen Glasgow-Coma-Scale Glasgow-Outcome-Scale Publikation Statistische Analyse 21 1
5 5. Ergebnisse Ergebnisse der Gruppe mit intraventrikulärer Blutung Patientenverteilung Komplikationen Blutvolumenreduktion Mortalität und klinischer Zustand der Patienten bei Entlassung Ergebnisse der Gruppe mit intraparenchymaler Blutung Patientenverteilung Blutvolumenreduktion Komplikationen, Mortalität und GOS Diskussion Diskussion der Ergebnisse der Gruppe mit intraventrikulärer Blutung Abnahme des Blutvolumens Komplikationen und Outcome Einfluss der oralen Antikoagulantien Posthämorrhagischer Hydrozephalus Allgemeine Diskussion Diskussion der Ergebnisse der Gruppe mit intraparenchymaler Blutung Abnahme des Blutvolumens Komplikationen und Outcome Andere therapeutische Maßnahmen Zusammenfassung Literaturverzeichnis 40 2
6 Verzeichnis der Abkürzungen Aufn. Aufnahme ASS Acetylsalicylsäure cct Craniale Computertomographie CT Computertomographie Entl. Entlassung GCS Glasgow Coma Scale GOS Glasgow Outcome Scale ICB Intracerebrale Blutung IVB Intraventrikuläre Blutung MRT Magnetresonanztomographie rtpa Recombinant tissue plasminogen activator SAB Subarachnoidale Blutung TUNEL Terminal deoxynukleotid trasferasemediated dutp nick-end labelling TVT Tiefe Venen Thrombose VHF Vorhofflimmern VP Ventrikuloperitoneal 3
7 Verzeichnis der Abbildungen Abb. 1. Sagittale Röntgen-Aufnahme von Patienten mit Duisburger Nadel 15 Abb. 2. Instrumentarium der Duisburger Nadel 16 Abb. 3. Darstellung einer ICB mit Navigationsmarker in BrainLab 17 Abb. 4. CT-Darstellung einer Nachblutung bei einem 63 jährigen Patienten nach zweimaliger intrathekaler Gabe von rtpa 22 Abb. 5. CT-Darstellung der Abnahme von Blutvolumina bei einem 77 jährigen Patienten mit IVB 24 Abb. 6. CT-Darstellung der Abnahme von Blutvolumina bei einem 47 jährigen Patienten mit IVB 24 Abb. 7. CT-Darstellung der Abnahme von Blutvolumina bei einem 69 jährigen Patienten mit ICB 28 Abb. 8. CT-Darstellung der Abnahme von Blutvolumina bei einem 54 jährigen Patienten mit ICB 28 Verzeichnis der Tabellen Tab. 1. Glasgow Coma Scale 19 Tab. 2. Glasgow Outcome Scale 20 Tab. 3. Volumenreduktion in Abhängigkeit der GCS 23 Tab. 4. GOS bei Patienten mit IVB 24 Tab. 5. Statistische Analyse der klinischen Parameter mit Einfluss auf den GOS 25 Tab. 6. GCS bei Aufnahme bei Patienten mit intraparenchymaler Blutung 26 Tab. 7. Blutvolumina bei Patienten mit ICB. 27 Tab. 8. Verhältnis von Alter und GOS bei Patienten mit ICB 29 Tab. 9. Verhältnis zwischen GCS und GOS bei Patienten mit ICB 29 Tab. 10. Vergleich unserer Ergebnisse mit denen von Naff et al. (2011) 33 Tab. 11. Vergleich unserer Ergebnisse mit denen von Rohde et al. (1995) 34 4
8 1. Einleitung Als spontane intrazerebrale Blutung bezeichnet man die Blutung ins Gehirnparenchym ohne voran gegangenes Trauma. Die Inzidenz der ICB beträgt ca 10-20/ Einwohner pro Jahr. Die Prognose ist trotz der Fortschritte im Bereich der intensivmedizinischen Behandlung insgesamt infaust. Sie zeigt zum Beispiel eine höhere Mortalitätsrate als die cerebralen Ischämien, das Risiko an einer intrazerebralen Blutung zu versterben ist in den ersten Stunden nach stattgehabtem Blutungsereignis am größten [4, 6, 13, 20, 21, 35, 38, 61, 63]. 1.1 Ätiologie Die arterielle Hypertonie als Ursache einer ICB Die arterielle Hypertonie wurde als die häufigste Ursache einer ICB, vor allem lokalisiert im Bereich der Stammganglien beschrieben [46, 54]. Der konkrete Pathomechanismus ist jedoch noch unklar. Ein Ansatz zur Erklärung des Pathomechanismus stellt die Dominotheorie dar. Sie beschreibt den Anfang einer ICB als die Ruptur einer kleinen degenerierten Arteriole. Abhängig von der Größe des ausgetretenen extravasalen Blutvolumens, rupturieren auch benachbarte Blutgefäße und das Volumen der intrazerebralen Blutung nimmt zu [17]. Eine Gemeinsamkeit vieler bisheriger Theorien zum Pathomechanismus der intrazerebralen Blutung ist die Lipohyalinose der Gefäßwände [11, 17, 28] Zerebrale Amyloidangiopathie Die zerebrale Amyloidangiopathie ist eine Erkrankung bei der es zu Ablagerungen von beta- Amyloid in der Gefäßwand kleiner oder mittelgroßer Arterien des Gehirns kommt und macht ca 10% aller intrazerebralen Blutungen aus [26]. Zu den Risikofaktoren gehören das Alter des Patienten sowie die Präsenz bestimmter Chromosomenabschnitte des Apolipoproteins E [3]. Die Boston criteria for the diagnosis of cerebral Amyloidangiopathy gibt bei der Diagnose ein Alter von über 55 Jahren als Einschlusskriterium an, wobei jedoch von Purrucker et al zwei Fälle von unter 45-jährigen Patienten mit einer zerebralen Amyloidangiopathie in einer aktuellen Studie vorgestellt werden [53]. 5
9 1.1.3 Gefäßmalformationen Die Gefäßmalformationen (zum Beispiel Aneurysmen oder Angiome) sind mehrmals bewiesen als Ursache einer nicht traumatischen intrakraniellen Blutung (Parenchymblutung oder Ventrikelbltung). Die meisten ICB oder IVB mit Ursache einer Gefäßmalformation, treten bei jüngeren Patienten auf. Die typische Lokalisation einer aneurysmatischen Blutung ist der Temporallappen, das Ventrikelsystem oder der umliegende Bereich der Fissura Sylvii. Eine SAB ist fast immer zusätzlich vorhanden. Je nach Lokalisation, Vorhandensein einer SAB und Alter des Patienten ist eine Gefäßdarstellung mittels zerebraler Angiographie oder CT- Angiographie erforderlich. Beim dringlichen klinischen und bildmorphologischen Verdacht auf eine Gefäßmalformation, trotz negativem Ergebnisses einer Angiographie, besteht immer die Indikation zur Wiederholung einer Gefäßdarstellung mittels MRT [1, 27] Gerinnungsstörungen Eine der häufigsten Ursachen der ICB ist die Gerinnungsstörung im Rahmen einer Antikoagulation zum Beispiel bei TVT oder VHF. 3-15% aller ICB sind mit oraler Antikoagulation assoziiert [19, 49]. Die dauerhafte Einnahme von Antikoagulanzien, vor allem von Vitamin- K- Antagonisten (Phenprocoumon), steht im Zusammenhang mit spontanen ICB. Die ICB ist eine der schwersten Komplikationen der Phenprocoumontherapie. Rund 90% aller marcumarisierten Patienten, die als Komplikation der Marcumartherapie eine ICB entwickeln, versterben oder weisen im Verlauf hochgradige neurologische Defizite auf [15] Eingeblutete Infarkte Die eingebluteten Infarkte sind meistens assoziiert mit der Anwendung von intravenöser rtpa oder Antikoagulation in der akuten Phase eines Apoplex. Die Reperfusion des Infarktes stellt auch eine mögliche Ursache dar. Das Risiko für eine Einblutung ist abhängig von der Größe des Infarktes. Je größer der Infarkt desto wahrscheinlicher ist die Einblutung. In der computertomographischen Darstellung, zeigt sich der eingeblutete Infarkt als eine Hyperdensität in einem hypodensen Areal. In der Mehrzahl der Fälle sind mehr als nur ein Blutungsherd vorhanden [31, 59]. 6
10 1.1.6 Weitere Risikofaktoren für eine ICB Der Konsum von Alkohol, Nikotin oder Drogen (Amphetamine und/oder Kokain) in Kombination mit einer vorher bestehenden arteriellen Hypertonie stellt einen weiteren Risikofaktor für eine ICB dar [34]. Zusätzlich das Vorhandensein von intrakraniellen Tumoren, Leukämien, Moya-Moya Syndrom und Arteritiiden steigert das Risiko zur Entwicklung einer ICB [26]. 1.2 Pathophysiologie Die ICB entsteht durch die Ruptur eines Gefäßes oder mehrere Gefäße. Nach dem initialen Blutungsereignis, weisen 38% der Patienten eine Volumenzunahme der ICB auf. Die Zunahme der ICB findet meist in den ersten 24 Stunden nach dem akuten Ereignis statt [8]. Die Größenzunahme der initialen ICB kann zu einer Mittellinienverlagerung führen und steht im Zusammenhang mit neurologischen Defiziten [73]. Der genaue Pathomechanismus ist jedoch bisher nicht bekannt [8]. Hickenbottom konnte einen Zusammenhang von Apoptose und Nekrose der Nervenzellen und der Gehirnschädigung nach stattgehabter ICB nachweisen. Sowohl der Anstieg der Konzentration von nuklear Faktor-kB Protein als auch das Vorhandensein von TUNEL (terminal deoxynukleotid trasferasemediated dutp nick-end labelling) im Gehirnparenchym beweist, dass die Gehirnschädigung auf die Nekrose, beziehungsweise auf die Apoptose der geschädigten Nervenzellen, zurück zu führen ist. Die mechanische Wirkung der ICB oder die toxischen Substanzen des Blutklots sind eventuell verantwortlich für die Nekrose im Gehirnparenchym [29]. Mehrere Studien zeigten, dass die Prognose mit dem Ausdehnungsgrad des perifokalen Ödems im Zusammenhang steht [56, 73]. Das perifokale Ödem bildet sich circa drei Stunden nach Entwicklung der ICB und erreicht die größte Ausdehnung zwischen 10 und 20 Tagen nach dem Blutungsereignis [73]. Es gibt drei verschiedene Phasen des perifokalen Ödems. Die erste Phase (very early Phase) findet in den ersten Stunden nach dem akuten Blutungsereignis statt und umfasst den Anstieg des intrazerebralen Drucks und den Austritt des Serums vom Blutklot zum Gehirnparenchym. Die zweite Phase entwickelt sich in den ersten zwei Tagen und umfasst die Koagulation des Blutklots und die Produktion von 7
11 Thrombin. In der dritten Phase werden die Erythrozyten lysiert und das auf das Gehirn toxisch wirkende Hämoglobin wird freigesetzt [71]. 1.3 Lokalisation Die häufigste Lokalisation einer ICB stellt mit 50% die Stammganglienregion dar. Hierbei ist am häufigsten das Putamen, danach die Thalamusregion mit 15% und mit 10% der Ponsbereich betroffen. In 10-20% der Fälle findet man die ICB in lobären Anteilen (frontal, occipital, temporal, parietal). Im Gegensatz zu den Hirnstammblutungen mit einem Anteil von 1-6% aller ICB, stellen cerebelläre Blutungen eine weitere häufige Lokalisation der Blutung mit 10-20% dar. Die Symptomatik variiert je nach Lokalisation [26]. 1.4 Symptomatik Die primäre Symptomatik einer ICB ist der starke Kopfschmerz. Bei lobären Blutungen unterscheidet sich die Symptomatik je nach Lokalisation. Bei occipitalen ICB kommt es häufig zu einer starken Schmerzsymptomatik im Bereich des ipsilateralen Auges und zu Gesichtsfeldausfällen. Bei temporalen ICB beobachtet man häufig Störungen in der Sprachbildung und im Sprachverständnis sowie leichte Gesichtsfeldeinschränkungen. Eine frontale ICB führt meistens zur Hemiparese der kontralateralen Seite (der Arm ist häufiger als das Bein betroffen) und zu einer frontalen Kopfschmerzsymptomatik im Gegensatz zur parietalen Blutung, die zur einer Hemihypästhesie der kontralateralen Seite führt [57]. Die meisten basal gelegenen ICB (Stammganglien, Thalamus, Pons und Hirnstamm) haben eine dramatische Manifestation mit kontralateraler Hemiparese, positiven Pyramidenbahnzeichen, Anisokorie, Hirnnervenausfällen, Koma und respiratorischer Insuffizienz, sodass eine Intubation und maschinelle Beatmung häufig notwendig sind [43]. Die rein intraventrikulären Blutungen sind mit akut einsetzenden starken Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit und Liquorzirkulationsstörungen (Hydrocephalus) assoziiert [52]. 8
12 1.5 Diagnostik Die Symptomatik einer akuten ICB ähnelt der Symptomatik einer akuten Ischämie, daher spricht man auch von einem hämorrhagischen Infarkt. Daher ist ein bildgebendes Verfahren bei Diagnosestellung immer notwendig. Die native Computertomographie (CT) und die Kernspintomographie (MRT) sind die radiologischen Untersuchungen der Wahl zur Differenzialdiagnose zwischen Ischämie und ICB [9, 25, 37]. Nachdem die ICB bildmorphologisch gesichert ist, ist die Ursache des Blutungsereignisses abzuklären. Bei Verdacht auf aneurysmatische Blutungen sind die CT- Angiographie sowie die zerebrale Angiographie die Untersuchungen der Wahl [43]. Die CT- Angiographie und die zerebrale Angiographie sind meist nicht notwendig für Patienten mit hypertensiver ICB, die meistens im Bereich der Stammganglien, Thalamus oder Hirnstamm lokalisiert sind. Im Zweifelsfall und insbesondere bei jüngeren Patienten müssen dennoch weitere Untersuchungen für die Ursachenforschung folgen. Ein MRT oder eine MR- Angiographie sind in der Regel hilfreich zur Diagnosestellung eines Tumors oder Kavernoms, für normotensive Patienten mit lobärer ICB und unaufälliger Gefäßdarstellung durch CT-Angiographie oder zerebrale Angiographie [5]. 1.6 Therapieoptionen Konservative Behandlung Die Behandlung der spontanen ICB ist in der heutigen Literatur nach wie vor kontrovers diskutiert. Trotz einer höheren Sterblichkeitsrate im Vergleich zu operativen Maßnahmen, stellt die konservative Therapie weiterhin eine gängige Methode dar [69]. Die wichtigsten Richtlinien einer konservativen Behandlung hat J.P. Broderick in der Stroke Council der American Heart Association beschrieben. Die erste konservative Maßnahme sowohl bei wachen als auch bei komatösen Patienten sollte die ausreichende Oxygenierung, gegebenenfalls die Intubation sein. Als nächstes sollte eine Kreißlaufstabilisierung mit eventueller Blutdrucksenkung bei hypertonen Patienten erfolgen. Zusätzlich sollte man Maßnahmen zur Senkung des intrakraniellen Drucks ergreifen. Des Weiteren ist 9
13 eine Normovolämie sowie eine Körpertemperatur im Normbereich anzustreben. Auch die Normalisierung der Blutgerinnungssituation ist erforderlich [5] Operative Behandlung Es ist anzunehmen, dass die frühe operative Therapie einer ICB eine positive Auswirkung auf die Erholung der Hirnsubstanz, in Hinsicht auf die Minimierung sowohl des intrakraniellen Drucks als auch des perifokalen Hirnödems hat. Des Weiteren wird durch die Evakuation der Blutung die Schädigung des umliegenden Hirngewebes durch die Toxizität der Blutabbauprodukte reduziert [47, 63, 66]. Zu den gängigen Methoden der operativen Therapieoptionen zählen die stereotaktische sowie die neuronavigierte Punktion der Blutungshöhle, das endoskopische Operationsverfahren sowie die offene Evakuation der Blutung über eine Hemikraniektomie oder osteoplastische Kraniotomie, auf welche in der Diskussion noch näher eingegangen wird [14, 42, 62, 65, 69, 75]. Bei isolierten intraventrikulären Blutungen aufgrund ausgeprägter subarachnoidaler Blutungen oder minimaler ICB mit Einbruch in das Ventrikelsystem, ist meistens die Anlage einer externen Ventrikeldrainage, mit oder ohne lokale Fibrinolyse- Gabe, die Therapie der Wahl [23, 52]. 1.7 Prognose Bei der spontanen ICB ist mit einer hohen Rate von Mortalität und Morbidität zu rechnen. Die Mortalität ist unter anderem abhängig von der Lokalisation der Blutung. Die Mortalität innerhalb der ersten 30 Tage nach dem Blutungsereignis beträgt für tiefe ICB im Bereich der Stammganglien und des Thalamus ungefähr 44%, hingegen für lobäre Blutungen nur 11% [6]. Einer der wichtigsten prognostischen Parameter ist das Alter der Patienten. Karnik et al [36] beschrieben, dass über 60-jährige Patienten mit spontaner ICB ein deutlich erhöhtes Mortalitätsrisiko haben. Des Weiteren spielen der allgemeine sowie der neurologische Zustand des Patienten zum Zeitpunkt der Aufnahme in der neurochirurgischen Klinik eine große Rolle für die Prognose. Je schlechter die Vigilanz des Patienten bei Aufnahme desto schlechter ist das Outcome des Patienten. Zusätzlich ist die Prognose einer ICB mit der Hirnlokalisation assoziiert. Studien beschrieben, dass Intraventrikuläre-, Multilobäre-, 10
14 Stammganglien- und Hirnstammblutungen eine höhere Rate an Mortalität haben als zum Beispiel isolierte kortikale Blutungen. Die Lokalisation definiert auch die Art der neurologischen Defizite (Hemiparese, Aphasie, Hemianopsie). Letztendlich stellen die Dauertherapie mit Antikoagulantien sowie das Vorhandensein von Vorerkrankungen wie zum Beispiel koronare Herzkrankheit, arterielle Hypertonie und Diabetes mellitus negative prognostische Faktoren für Patienten mit ICB dar [40, 43, 51, 60]. 11
15 2 Fragestellung und Ziel der Arbeit Intrazerebrale Blutungen sind schwerwiegende Ereignisse die mit einer hohen Letalität und Morbidität einhergehen. Hinsichtlich der Behandlung sowohl von intrazerebralen Blutungen mit dem Hauptblutanteil im Ventrikelsystem als auch von Blutungen mit hauptsächlich parenchymalem Blutungsanteil gibt es verschiedene Ansätze deren Effektivität in der Literatur kontrovers diskutiert werden. In unserer Arbeit vergleichen wir die Daten der Patienten die zwischen aufgrund einer intrazerebralen Blutung mit intrazerebraler Injektion von rtpa behandelt wurden, mit den Daten und den Ergebnissen anderer Therapienansätze aktueller Studien. 1. Hypothese: Die Injektion von rtpa über eine parenchymal gelegte Codman-Drainage in die Blutungshöhle erzielt hinsichtlich der Letalität und Morbidität bessere Ergebnisse als eine konservative Therapie oder operative Evakuation der Blutung. 2. Hypothese: Die Injektion von rtpa über eine externe Ventrikeldrainage bei intrazerebralen Blutungen mit Hauptanteil der Blutungskomponente im Ventrikelsystem erzielt bessere Ergebnisse hinsichtlich der Letalität und Morbidität im Vergleich der Anlage einer externen Ventrikeldrainage ohne Injektion von rtpa. 12
16 3 Methodik 3.1 Patienten Für die Arbeit wurden die Daten von Patienten verwendet die zwischen 2005 und 2010 in der Neurochirurgischen Abteilung des Klinikum Duisburg behandelt wurden. Die Neurochirurgische Abteilung des Klinikum Duisburg verfügt über 83 Betten, darunter bis zu 30 Intensivbetten und zählt über 2600 Eingriffe pro Jahr. Die für die Arbeit verwendeten Patientendaten mit intrazerebraler Blutung wurden in zwei Subgruppen unterschieden. Die erste Subgruppe beinhaltet die Patienten mit intrazerebralen Blutungen mit wenig oder keinem Blutungsanteil im Ventrikelsystem. In die zweite Subgruppe wurden alle Patienten eingeschlossen, die den größten Blutungsanteil im Ventrikelsystems aufwiesen, mit wenig oder keiner intraparenchymatösen Blutungskomponente Gruppe mit intraventrikulärer Blutung In die erste Subgruppe wurden alle Patienten mit spontaner, nicht-traumatischer intrazerebraler Blutung (n=80) und Patienten mit kleiner intrazerebraler Blutung (<35ml) eingeschlossen, die während in unserer Klinik mit rtpa- Injektion behandelt wurden und den Hauptblutungsanteil im Ventrikelsystem aufwiesen. Die Patienten wurden in vier Altersklassen eingeteilt: <50 Jahre, Jahre, Jahre und >70 Jahre. Eine weitere Einteilung der Patienten fand hinsichtlich des klinischen Zustandes zum Zeitpunkt der Aufnahme in unserer Klinik und zum Zeitpunkt der Entlassung statt. Hierfür wurden die Glascow Coma Scale [62] und die Glasgow Outcome Scale [33] verwendet. Die erreichten Scores wurden in bei der GCS in drei weitere Untergruppen eingeteilt: GCS 8, GCS 9-12 und GCS 13. Die erreichten GOS Grade wurden in zwei Gruppen unterteilt: 1. Schlechtes Outcome (GOS 1-3) und gutes Outcome (GOS 4 und 5) Gruppe mit intraparenchymaler Blutung Für die zweite Subgruppe wurden alle Daten der Patienten (n= 22) hinzugezogen, die zwischen in unserer Klinik aufgrund einer spontanen intrazerebralen Blutung mit wenig oder keinem ventrikulären Blutungseinbruch mit rtpa-injektion behandelt wurden. Diese Patienten wurden wiederum nach 13
17 dem klinischen Zustand bei Aufnahme in unserer Klinik und zum Zeitpunkt der Entlassung unterteilt. Auch dabei wurden die Glascow Coma Scale und die Glasgow Outcome Scale verwendet. Die erreichten Scores wurden in der GCS in drei weitere Untergruppen eingeteilt: GCS 8, GCS 9-12 und GCS 13. Die erreichten GOS Grade wurden in zwei Gruppen unterteilt: Schlechtes Outcome (GOS 1-3) und gutes Outcome (GOS 4 und 5). 3.2 Diagnostik Für die Diagnostik wurden ein natives cct bei Aufnahme des Patienten und ein cct, innerhalb von 24 Stunden nach jeder rtpa- Injektion durchgeführt. 3.3 Intrazerebrale Gabe von rtpa In Anlehnung an die Literatur [45, 55] wurde bei allen Patienten 3mg rtpa über drei Tage nach intrazerebral appliziert Intrathekale Gabe von rtpa Bei der Patientengruppe mit intraventrikulären Blutungen erfolgte aufgrund des Haupanteils der Blutung im Ventrikelsystem die Gabe von rtpa über eine externe Ventrikeldrainage durch ein frontales Bohrloch. Die Patienten wurden nach Anlage der externen Ventrikeldrainage auf der neurochirurgischen Intensivstation überwacht und es wurden täglich drei Milligramm rtpa über drei Tage über die externe Ventrikeldrainage injiziert. Die externe Ventrikeldrainage wurde nach Applikation für zwei Stunden geschlossen. Nach jeder rtpa-gabe wurde innerhalb der nächsten 24 Stunden ein cct zur Analyse der Volumenänderung durchgeführt. Im Falle einer Nachblutung wurde keine weitere rtpa über die Ventrikeldrainage appliziert Exkurs: Duisburger Nadel Die Duisburger Nadel wurde für die schnelle Punktion des Ventrikelsystems bei einem akuten Liquoraufstaus entwickelt [58]. Die Duisburger Nadel besteht aus Stahl oder Titan und setzt sich aus einer Schraube die in die Kalotte gedreht wird und aus einer Hohlnadel mit Mandrin zusammen (siehe Abb. 2.). Für die Punktion 14
18 wird der Patient in Rückenlage mit dem Kopf in gerader Position gelagert. Die Bohlrlochtrepanation erfolgt mittels eines Handbohrers 11cm oberhalb des Nasions und 2.5 cm lateral der Mittelline je nach Indikation bevorzugt rechts. Die Positionierung der Schraube und der Nadel erfolgt in einer gedachten Linie zwischen ipsilateralem medialen Augenwinkel und ipsilateralem äußeren Gehörgang in einem 90 Winkel auf die Kalotte (siehe Abb. 1.). Es handelt sich um eine in vielen Kliniken etablierte minimal- invasive Methode, die schnell durchführbar ist und außerhalb des Operationssaals angewandt werden kann. Abb. 1. Sagittale Röntgen- Aufnahme von Patienten mit Duisburger Nadel 15
19 Abb. 2. Instrumentarium der Duisburger Nadel Gabe von rtpa in die intraparenchymatöse Blutungshöhle Bei Patienten mit intraparenchymalen Blutungen erfolgte die Applikation von rtpa über die navigationsgestütze Schlaucheinlage (BrainLab ). Zunächst erfolgte die Durchführung einer präoperativen CT-Neuronavigation (siehe Abb.3.) Der Kopf des Patienten wurde in der Mayfield-Klemme eingespannt. Es folgte die Anlage eines Bohrlochs links oder rechts, je nach Lokalisation der Blutung, zwei bis drei Zentimeter lateral der Sutura sagitallis und präcoronar. Ein flexibler Katheter (Codman-Drainage ) wurde an der Spitze des Neuronavigationspointer befestigt und langsam, mithilfe der Neuronavigation, in das Zentrum der Blutungshöhle eingeführt. Daraufhin wurde der Pointer langsam zurückgezogen und der flexible Katheter wurde an der Kopfhaut fixiert. Die Patienten wurden postoperativ auf der neurochirurgischen Intensivstation überwacht und es erfolgte die Gabe von drei Milligramm rtpa für drei Tage täglich über den flexiblen Katheter. Der Katheter wurde nach Applikation für zwei Stunden geschlossen. Wieder wurde nach jeder rtpa-gabe innerhalb der nächsten 24 Stunden eine cctkontrolle durchgeführt. 16
20 Beim Nachweis einer Nachblutung erfolgte keine weitere Injektion von rtpa. Abb. 3. Darstellung einer rechtsseitigen Stammganglienblutung mit Navigationsmarker in Brain-Lab 17
21 3.4 Einteilungen Das Ausmaß der Blutungen der Gruppe mit intraventrikulären Blutungen wurde mithilfe des Hjidra Score [30] in Punkte eingeteilt: 0 Punkte, kein Blut; 1 Punkt, Blutsedimente im hinteren Anteil des Ventrikels; 2 Punkte, teilweise mit Blut gefüllter Ventrikel; 3 Punkte, komplette Blutfüllung des Ventrikels. Diese Einteilung gilt für jeden einzelnen Ventrikel (beide Seitenventrikel, dritter Ventrikel und vierter Ventrikel), so kann pro Ventrikel ein Maximalscore von drei Punkten erreicht werden, womit sich dann ein Gesamtscore von 0-12 Punkten ergibt. Die Ausdehnung der intraparenchymalen Blutungen wurde mittels der ABC Messmethode [39] ermittelt. Bei dieser Messmethode wird die axiale CT- Schichtung mit der größten Blutausdehnung zur Messung verwendet. Der größte Durchmesser (A) der Blutung, in 5mm- axialen CT-Schichtungen wird gemessen. Danach wird der größte Durchmesser, in derselben CT-Schichtung, im 90 - Winkel zu A gemessen (B). Daraufhin werden alle CT-Schichtungen in der die Blutung sichtbar ist hinzugezogen und ausgemessen um (C) berechnen zu können. Die Bilder in der die Blutung mehr als 75% der gesamten Blutung ausmacht werden mit 1 bewertet, die 5mm axialen CT-Schichtungen mit 25-75% Anteil der Blutung werden mit 0.5 bewertet und CT-Schichtungen mit weniger als 25% der Blutung werden aus der Bewertung ausgeschlossen. (C) ergibt sich also aus der Summe der einzelnen CT-Schicht-Bewertungen. A, B und C werden nun multipliziert und durch 2 dividiert. Daraus ergibt sich das Volumen der ICB in Kubikzentimetern bzw. Millilitern. Alle intrazerebralen Blutungen mit einem Volumen von mehr als 10ml wurden eingeschlossen. Für die Analyse der Volumenreduktion wurde bei beiden Subgruppen in vier weitere Gruppen unterteilt: Volumenreduktion <25%, 25-50%, 51-75% und >75%. 3.5 Glasgow-Coma-Scale Die Glasgow-Coma-Scale [62] (siehe Tab. 1.) ist eine Skala die entwickelt wurde um den Schweregrad einer Bewusstseinsstörung, vor allem bei Patienten mit Schädel- Hirn- Verletzungen zu beurteilen. Die Beurteilung der Patienten erfolgt in drei Kategorien: Augenöffnen, verbale Kommunikation, motorische Reaktion. Die höchste zu erreichende Punktzahl liegt bei 15 Punkten. 18
22 Die Glasgow Coma Scale wurde in unserer Studie für die initiale neurologische Beurteilung des Patienten verwendet. Dadurch war eine klinische Einteilung der Patienten möglich. Tab. 1. Augenöffnen Glasgow Coma Scale spontan 4 auf Aufforderung 3 auf Schmerzreiz 2 keine Reaktion 1 Beste verbale Reaktion orientiert 5 verwirrt 4 einzelne Wörter 3 unverständliche Laute 2 19
23 keine Reaktion 1 Beste motorische Reaktion Befolgen von Aufforderungen 6 gezielte Abwehr von Schmerzreizen 5 Zurückziehen auf Schmerzreiz 4 Beugung auf Schmerzreiz 3 Streckung auf Schmerzreiz 2 keine Reaktion 1
24 3.6 Glasgow-Outcome-Scale Die Glasgow- Outcome- Scale [33] (siehe Tab. 2.) stellt eine Einteilungsskala für Patienten mit erlittenem Schädel-Hirn-Trauma oder zum Beispiel Hirnblutungen dar, die es ermöglicht, den Patienten anhand seines Erholungsgrades objektiv und standardisiert einzuteilen um eine realistische Vorhersage über das Ausmaß der Wiedereingliederung in Beruf und alltägliches Leben zu treffen. Diese Skala verwendeten wir für die klinische Einteilung der Patienten zum Entlassungszeitpunkt. Tab. 2. Glasgow Outcome Scale GOS 1 GOS 2 GOS 3 GOS 4 GOS 5 verstorben infolge der akuten Hirnschädigung apallisch, bleibender vegetativer Zustand schwerbehindert (geistig und/oder körperlich, auf dauernde Versorgung angewiesen, keine Erwerbsfähigkeit) Mittelgradig behindert, weitgehend selbständig, aber deutliche neurologische und/oder psychische Störungen, erhebliche Einschränkung der Erwerbsfähigkeit nicht/leicht behindert, normale Lebensführung trotz eventuell geringer Ausfälle, nur geringe Einschränkung der Erwerbsfähigkeit. 3.7 Publikation Aus der hier aufgeführten Daten entstand eine Publikation mit dem Titel Treatment of Intraventricular Hemorrhage (IVH) by Injection of Recombinant Tissue-type Plasminogen Activator (rtpa) Single Institution Experiences with 80 Patients. Der Artikel wurde am im Journal of Neurological 20
25 Disorders veröffentlicht [44]. Die Arbeit wurde durch die beiden Erstautoren Herrn Dr. Homajoun Maslehaty und mir, Georgios Ntoulias, angefertigt. Herr Dr. Homajoun Maslehaty recherchierte die Datenlage zu oben genanntem Thema in der aktuellen Literatur. Professor Martin Scholz und Professor Werner Hassler stellten die Daten der Patienten für die Publikation zur Verfügung. Herr Dr. Andrej Bitter, Herr Dr. Dukagjin Morina und Frau Franziska Niklewski wirkten bei Korrektur und Formattierung des Geschriebenen mit. Herr Privatdozent Athanassios K. Petridis war bei der Einreichung der Arbeit bei oben genannter Zeitschrift beteiligt. Ich, Georgios Ntoulias, erhob die Daten aller Patienten, führte die volumetrischen Messungen durch, erhob die Statistik und verglich die Ergebnisse mit Ergebnissen der aktuellen Literatur. Des Weiteren trug ich die Daten zusammen und formulierte den geschriebenen Text. 4 Statistische Analyse Für die statistische Analyse wurde der Exakter Test nach Fisher and das Chi- Quadrat mit der Yates- Korrektur verwendet. Der p- Wert wurde zweiseitig berechnet. Eine statistische Signifikanz wurde bei einem p- Wert <0.05 festgelegt. 5 Ergebnisse 5.1 Ergebnisse der Gruppe mit intraventrikulärer Blutung Patientenverteilung Insgesamt wurden die Daten von 80 Patienten (45 männliche Patienten, 35 weibliche Patienten; Verhältnis männlich zu weiblich: 1.3:1) analysiert. Der Anteil der Patienten innerhalb der einzelnen Altersgruppen zeigt ein Überwiegen der Altersgruppe der über 70-Jährigen (Tab.5.). Sechs Patienten waren in einem guten klinischen Zustand zum Zeitpunkt der Aufnahme (GCS 13, 7,5%), 26 Patienten gehörten der Gruppe mit einem mittelmäßigen klinischen Zustand an (GCS 9-12, 32,5%) und 49 der Patienten waren bei Aufnahme in einem schlechten klinischen Zustand (GCS 8, 61.25%). Die Mortalität lag bei 22.5% (n=18). Vierzehn Patienten (17.5%) waren vorher mit Acetylsalicylsäure antikoaguliert worden und 17 Patienten (21.3%) mit Phenprocoumon. Der Hjidra Score der 21
26 intraventrikulären Blutungen bei Aufnahme der Patienten betrug bei den antikoagulierten Patienten 7.60 beziehungsweise Der Hjidra Score bei nichtantikoagulierten Patienten betrug zum Zeitpunkt der Aufnahme Der Hjidra Score nach dreimaliger rtpa-injektion lag bei den mit ASS oder Phenprocoumon antikoagulierten Patienten bei 2.17 beziehungsweise bei Bei den Patienten ohne Antikoagulanzien betrug der Hjidra-Score nach dreimaliger rtpa-injektion Komplikationen Relevante Komplikationen wie Infektionen assoziiert mit der externen Ventrikeldrainage, wie zum Beispiel lokale Wundinfektionen oder Meningitiden traten bei n= 12 Patienten (15%) auf. Davon verstarben 3 Patienten (3.75%). Nachblutungen (siehe Abb. 4.) traten in vier Fällen auf (5%). 17 Patienten (21.3%) entwickelten einen shuntpflichtigen Hydrozephalus. Abb. 4. CT-Darstellung einer Nachblutung bei einem 63- jährigen Patienten mit IVB nach zweimaliger intrathekaler Gabe von rtpa Blutvolumenreduktion Die gesamte prozentuale Volumenreduktion aller Patienten nach der dritten rtpa- Gabe betrug 68.4%. 22
27 Der prozentuale Mittelwert der Blutvolumenreduktion der Subgruppenunterteilungen betrug bei der Patientengruppe mit einem GCS %, bei der Patientengruppe mit einem GCS von % und bei der Patientengruppe mit einem GCS % (Tab.3.). Der Mittelwert des Hjidra Score aller Patienten lag zum Zeitpunkt der Aufnahme bei 8.2 und bei Entlassung bei 2.5. Der Hjidra Score der einzelnen Untergruppen nach GCS-Einteilung bei Aufnahme und Entlassung der Patienten ist in Tab.3. aufgeführt. 49 Patienten wiesen eine assoziierte kleine ICB auf, welche im Mittelwert aller Patienten 11.7 ml betrug. Die größte Volumenreduktion konnte bei den Patienten mit einem intialen GCS von 9-12 erreicht werden. Eine Volumenzunahme konnte bei vier Patienten nach der ersten rtpa- Injektion verzeichnet werden. In diesen Fällen wurde keine weitere Injektion von rtpa getätigt. Tab. 3. Volumenreduktion in Abhängigkeit der GCS Volumenreduktion in Abhängigkeit der GCS- Untergruppen Volumen/ GCS GCS 8 (n= 48) GCS 9-12 (n=26) GCS 13 (n=6) < 25% 1 (2%) 0 0 < 50% 7 (14.3%) 6 (24%) 1 (16.7%) < 75% 22 (44.9%) 7 (28%) 4 (66.7%) > 75% 18 (36.7%) 13 (52%) 1 (16.7%) Ø Volumenreduktion 67.2% 72.5% 63.4% Hjidra Score IVB Aufn. Entl. Aufn. Entl. Aufn. Entl
28 Abb. 5. CT-Darstellung der Abnahme des Blutvolumens bei einem 47- jährigen Patienten mit IVB vom Zeitpunkt der Aufnahme, nach erster und dritter rtpa- Injektion. Abb. 6. CT-Darstellung der Abnahme von Blutvolumina bei einem 77- jährigen Patienten mit IVB nach erster, zweiter und dritter rtpa- Injektion Mortalität und klinischer Zustand der Patienten bei Entlassung Die Mortalität aller Patienten betrug % (n= 18). Der klinische Zustand der Patienten zum Zeitpunkt der Entlassung eingeteilt in GOS ist in Tab.4. aufgelistet. Tab. 4. GOS bei Patienten mit IVB GOS 2 GOS 3 GOS 4 GOS 5 n=7 (8.8%) n= 28 (35%) n= 14 (17.5%) n= 13 (16.3%) 24
29 Für die Statistische Analyse wurden weitere Faktoren einbezogen um deren Auswirkungen auf den klinischen Zustand des Patienten zum Zeitpunkt der Entlassung zu ermitteln. Die Ergebnisse sind in Tab.5. aufgeführt. Tab. 5. Statistische Analyse der klinischen Parameter mit Einfluss auf den GOS Statistische Analyse GOS 1, 2, 3 GOS 4, 5 Chi-Quadrat Fisher Alter < 70 Jahre > 70 Jahre 26 8 Geschlecht 0.047* 0.035* Männlich Weiblich GCS > * 0.003* Komplikation Infektion Nachblutung Shunt Antikoagulation Phenprocoumon nnn ASS Blutungsquelle Aneurysmata 16 7 Hypertensiv Lyse der Blutung < 50% 10 5 > 50%
30 5.2 Ergebnisse der Gruppe mit intraparenchymaler Blutung Patientenverteilung Die intraparenchymatöse Injektion von rtpa in die Blutungshöhle wurde an 22 Patienten (11 männlich und 11 weibliche Patienten) durchgeführt. Das Durchschnittsalter lag bei 64 Jahren (Altersbereich: Jahre). Der GCS zum Zeitpunkt der Aufnahme ist in Tab.6. aufgeführt. Tab. 6. GCS bei Aufnahme bei Patienten mit intraparenchymaler Blutung GCS 8 GCS 9-12 GCS 13 n= 7 (31.8%) n= 11 (50%) n= 4 (18.2%) Blutvolumenreduktion Die Blutvolumina aller Patienten vor der Behandlung mit rtpa lagen zwischen 11.5ml und 67.15ml, im Mittelwert also bei 35.14ml. Nach dem ersten Kontroll- CT lag der Mittelwert bei 22.45ml (Reduktion um 36.1%), nach dem zweiten Kontroll- CT bei 15.93ml (Reduktion um 54.7%) und nach dem dritten cct lag der Mittelwert der Blutvolumina bei 10.88ml (Reduktion um 73.05%). Die Blutvolumina und deren Reduktion einzelner Patienten sind in Tab.5. aufgeführt. In Betracht der einzelnen Gruppen, unterteilt in das Ausmaß der Blutvolumenreduktion, haben wir bei 14 Patienten (63.6%) eine Reduktion von >75%, bei 4 Patienten (18.2%) eine Reduktion zwischen 51% und 75%, bei einem Patienten (0.5%) eine Minderung von 25.50% und bei 3 Patienten (1.5%) eine Reduktion von <25% verzeichnet. In der Abb.7. ist die Abnahme des Blutvolumens vom Zeitpunkt der Aufnahme (A), 24 Stunden nach der dritten Injektion von rtpa (B), sowie 24 Stunden nach Entfernug der Codmann Drainage (C) dargestellt. Der Patient 12, dessen Bilder (Abb.7.) unten aufgeführt sind wurde mit einem GCS von 9 aufgenommen, hatte ASS in der Vormedikation und wurde mit einem GOS von 4 entlassen. In Abb.8. sind die CT-Bilder von Patient 10 aufgeführt. Dieser Patient wies einen intialen GCS von 11 auf, hatte 26
31 keine Antikoagulation in der Prämedikation und wurde mit einem GOS von 5 entlassen. Tab. 7. Blutvolumina (in ml) Patient Blutvolumina bei Patienten mit ICB Initiales Volumen 1. Kontroll- CT 2. Kontroll- CT 3. Kontroll- CT Total (%) Mittelwert
32 Abb. 7. CT-Darstellung der Abnahme von Blutvolumina bei einem 69- jährigen Patienten mit ICB (A: initiales Blutvolumen, B: nach dritter rtpa- Injektion, C: nach Entfernung der Codman Drainage nach dreimaliger rtpa- Injektion). Abb. 8. CT-Darstellung der Abnahme von Blutvolumina bei einem 54- jährigen Patienten mit ICB (A: initiales Blutvolumen, B: nach dritter rtpa- Injektion, C: nach Entfernung der Codman Drainage nach dreimaliger rtpa- Injektion) Komplikationen, Mortalität und GOS In vier Fällen traten Nachblutungen auf (18.2%, siehe Tab.7.; Patient 9, 11, 19 und 21). Von der Gruppe der Patienten mit intraparenchymalen Blutungen sind 3 Patienten gestorben und insgesamt 15 Patienten hatten einen schlechten Outcome 28
33 (GOS 1-3). 4 Patienten (18,1%) entwickelten einen shuntpflichtigen posthämorrhagischen Hydrocephalus. Sowohl bei den intraventrikulären als auch bei den intracerebralen Blutungen sind das fortgeschrittene Alter des Patienten sowie der schlechte initiale GCS sehr wichtige Risikofaktoren für ein schlechtes Outcome. In unserer Studie haben sieben Patienten (77,7%) mit einem Alter von über 70 Jahren ein schlechtes Outcome (GOS 1-3) aufgewiesen. Im Gegensatz dazu, finden wir bei der Altersgruppe unter 70 Jahren nur 61,5% (13 Patienten) mit einem GOS bei Entlassung von 1 bis 3. Sieben Patienten (100%) mit einem initialen GCS von unter 9 haben ein schlechtes Outcome (GOS 1-3). Anderseits weisen nur sieben Patienten (63,6%) mit einem initialen GCS von 9-12 einen schlechten GOS 1-3 bei Entlassung auf. Bei der Patientengruppe mit einem guten initialen GCS (13-15) konnten wir ein gutes Outcome (GOS 4 und 5) bei 75% (3 Patienten) verzeichnen. Nachfolgend sind das Verhältnis von Alter und GOS sowie von GCS und GOS in den Tab.8. und Tab.9. dargestellt. Tab. 8. Verhältnis von Alter und GOS Alter versus GOS Alter GOS 1 GOS 2 GOS 3 GOS 4 GOS 5 <50 Jahre Jahre Jahre >70 Jahre Tab. 9. Verhältnis zwischen GCS und GOS Verhältnis zwischen GCS und GOS GCS/GOS Patienten GOS 1-3 GOS 4 & 5 GCS GCS GCS
34 6 Diskussion Die allgemeine Überalterung der Bevölkerung und die daraus resultierende Zunahme von kardialen Erkrankungen wie koronare Herzkrankheit und Herzrhythmusstörungen erfordern häufig die Anwendung von oralen Antikoagulantien. Häufig verabreichte Medikamente stellen die Gruppen der Vitamin- K- Antagonisten und die der Thrombozytenaggregationshemmer dar. Lovelock et al. [41] veröffentlichten 2007 eine Studie in der sich eine Abnahme der Inzidenz von ICB bei unter 75- Jährigen zeigte, die Inzidenz von ICB in der Gesamtbevölkerung jedoch nicht abnahm. Sie postulierten, dass das Auftreten von maligner Hypertension assoziierter ICB deutlich reduziert worden sei, jedoch das Auftreten von ICB im Rahmen einer antithrombotischen Therapie zugenommen habe. Eine weitere aktuelle Studie zeigte, dass der Anteil von Antikoagulantienassoziierter ICB an der Gesamtinzidenz von ICB im Zeitraum zwischen 1988 und 1999 von 5% auf 17% anstieg [18]. In unserer Arbeit machten die Patienten mit oraler Antikoagulation einen Anteil von 36% (37 Patienten) aus und 42.5% (43 Patienten) waren älter als 70 Jahre. Daraus geht die Notwendigkeit zur Vermeidung eines intraoperativen exzessiven Blutverlustes hervor. Eine minimal- invasive Therapie wie zum Beispiel die kathetergestützte intrazerebrale Applikation von rtpa scheint die geeignete Methode für die schnelle Blutvolumenminderung bei Patienten mit erhöhtem intra- und postoperativem Blutungsrisiko zu sein. 6.1 Diskussion der Ergebnisse der Gruppe mit intraventrikulärer Blutung Abnahme des Blutvolumens Es wird angenommen, dass nicht behandelte intraventrikuläre Blutungen ein schlechteres Outcome bezüglich der Letalität und Morbidität haben. Dies bezieht sich auf die Theorie, dass eine zügige Evakuation des Blutklots eine positive Auswirkung auf die Regenerierung von Hirngewebe aufgrund der Abnahme des Hirndrucks und des Hirnödems sowie auf eine Verbesserung der Hirnperfusion hat [4, 7, 46, 67, 70, 71]. Des Weiteren besteht die Annahme, dass durch die Lyse des Blutklots die Auswirkungen der toxischen Blutzerfallsprodukte auf das 30
35 Hirngewebe geringer sind [10, 24, 45, 55]. Naff et al. (2011) konnten in einer Studie mit 48 Patienten mit intraventrikulärer Blutung nachweisen, dass die Injektion von rtpa in die externe Ventrikeldrainage im Vergleich zu einer Placebo- Kontrollgruppe eine Reduktion des intraventrikulären Blutvolumens erbrachte und zugleich eine Minderung des intrazerebralen Hirndrucks erzielte [50]. Eine Beschleunigung des Abbaus des Blutklots sowie eine Verbesserung des Outcomes durch Injektion von rtpa konnte in einigen Studien von Findlay et al., Jaffe et al. und Morgan et al. [16, 32, 48] beobachtet werden. In Anlehnung an diese oben genannten Ergebnisse der aktuellen Studienlage, zeigt unsere Studie, dass das Potential einer schnellen Blutvolumenminderung des intraventrikulären Blutanteils durch rtpa in einem kurzen Zeitraum (siehe Abb.5. und Abb.6.) gegeben ist. Die durchschnittliche Volumenreduzierung der Blutungskomponente lag bei 68.64% innerhalb von drei Tagen Komplikationen und Outcome Wie schon beschrieben konnten Findlay et al., Jaffe et al. und Morgan et al. eine Verbesserung des Outcomes der Patienten mit intraventrikulärer rtpa- Injektion feststellen [16, 32, 48]. Findlay et al. (2004) postulierten zudem, dass vor allem jüngere Patienten mit aneurysmatischer Blutung in einem schlechten klinischen Zustand zu Beginn der Therapie von einer intraventrikulären rtpa- Injektionen profitierten [16]. Auch die Ergebnisse unserer Arbeit zeigten, dass ein Alter über 70 Jahren und ein schlechter GCS (GCS 8) zum Zeitpunkt der Aufnahme ein signifikant erhöhtes Risiko für ein schlechtes Outcome (GOS 1-3) darstellen. Indes zeigte sich kein signifikanter Einfluss von Geschlecht, postoperativen Infektionen oder initialer Blutungsquelle (aneurysmatisch oder hypertensiv bedingt) auf das Outcome der Patienten. Die Mortalität unserer Patienten lag bei 22.5% und ist somit vergleichbar mit den Daten der CLEAR IVH Trial Studie (19%) [50]. Nachblutungen in das Ventrikelsystem und das Hirnparenchym traten bei vier Fällen und somit bei 5% der Patienten auf. Die Mortalität bei dieser Patientengruppe betrug 75% und ist vergleichbar mit den Daten von Naff et al. 31
36 [50] und Findlay et al. [16]. Auch wenn Nachblutungen, aufgrund der rtpa- Injektionen folglich eine relativ seltene Komplikation darstellen, so müssen sie doch angesichts der hohen Mortalität in der Therapiewahl berücksichtigt werden. Ein weiterer Aspekt der bedacht werden sollte ist das Infektionsrisiko. 12 Patienten der Gruppe der intraventrikulären Blutungen (15%) entwickelten im Verlauf eine Meningitis. Naff et al. (2012) postulierten jedoch eine geringere Meningitis- beziehungsweise Ventrikulitisrate mit 8%. Die Mortalität der Patienten die eine Meningitis oder Ventrikulitis entwickelten lag bei 25% und ist somit nicht maßgeblich höher als die der gesamten Patientengruppe Einfluss der oralen Antikoagulantien In der Gesamtbeobachtung des Patientenguts fiel auf, dass der Hjidra Score zum Zeitpunkt der Aufnahme von Patienten mit oraler Antikoagulation niedriger war als der von Patienten ohne orale Antikoagulantien. Der beste Erfolg, intraventrikulärer rtpa- Injektion konnte bei Patienten mit vorangegangener ASS-Medikation beobachtet werden, was wir auf die irreversible Hemmung der Thrombozytenaggregation durch Inhibierung der Cyclooxygenase von Acetylsalicylsäure zurückführen Posthämorrhagischer Hydrozephalus Jaffe et al. [32] konnten bei der Therapie mit intraventrikulärer Injektion von rtpa bisher keine Ergebnisse hinsichtlich der Notwendigkeit eines Liquorshunts aufgrund eines posthämorrhagischen Hydrozephalus liefern. Unsere Ergebnisse zeigten in Bezug auf die Ausbildung eines shuntpflichtigen posthämorrhagischen Hydrozephalus eine Prävalenz von 21.3 % (17 Patienten). In einem Vergleich mit den Ergebnissen von Rohde et al. konnten wir eine deutlich geringere VP- Shuntpflichtigkeit durch unsere Methode erzielen. Rohde et al. [55] verabreichten 3-5mg rtpa über eine EVD alle 24 Stunden bis zur vollständigen Lyse des Blutklots im dritten und vierten Ventrikel. 55% der in die Studie eingeschlossenen Patienten von Rohde et al. entwickelten im Verlauf einen posthämorrhagischen Hydrocephalus (Siehe Tab. 11.). 32
37 6.1.5 Allgemeine Diskussion Trotz einer schnellen Auflösung des intraventrikulären Blutklots durch die rtpa- Injektion, über eine externe Ventrikeldrainage in das Liquorsystem, stellt die intraventrikuläre Blutung weiterhin eine Erkrankung mit hoher einhergehender Morbidität und Mortalität dar [12, 22]. In Anbetracht der aktuellen Studienlage scheint die intraventrikuläre Injektion von rtpa eine positive Auswirkung auf die schnelle Auflösung des Blutklots und eine damit einhergehende Verbesserung des Outcomes zu erzielen. Erwähnenswert ist jedoch, dass ein fortgeschrittenes Alter (>70 Jahre), sowie ein niedriger GCS (<8) zum Zeitpunkt der Aufnahme eine unabhängige Variable für ein schlechtes Outcome in unserer Arbeit darstellt. Trotzdem stellt die Injektion von rtpa über eine EVD auch bei dieser Patientengruppe eine sinnvolle Alternative zur schnellen Lyse des Blutklots dar um der raumfordernden Masse entgegen zu wirken. In einem Vergleich zu der Studie von Naff et al. [50] bei der Patienten mit IVH alle 12 Stunden 3mg rtpa bis zur vollständigen Durchgängigkeit der Liquorpassage im dritten und vierten Ventrikel über eine EVD erhielten, zeigte sich mit unserer Methode ein deutlich geringeres Nachblutungsrisiko. Während Naff et al. in 23% der Fälle eine Nachblutung nachweisen konnten, so trat in unserer Studie nur bei 5% der Patienten eine Nachblutung auf. Hinsichtlich der Blutvolumenreduktion und der Mortalität konnten wir ähnliche Ergebnisse erzielen, jedoch stellten Infektionen in unserer Studie eine häufigere Komplikation dar (Siehe Tab.10.). Tab. 10. Vergleich unsere Ergebnisse mit denen von Naff et al (2011) Autoren Infektion Nachblutung Mortalität Volumenreduktion in Prozent Naff et al. 8% 23% 19% 61.6% (2011) Ntoulias G. (2013) 15% 5% 22.5% 67.7% Hinsichtlich des GOS konnten wir ähnliche Ergebnisse wie Rohde et al. [55] erzielen, die VP-Shuntpflichtigkeit in unserer Studie war jedoch deutlich geringer 33
38 (Siehe Tab 11.). Webb et al. [70] postulierten 2012 aufgrund der Ergebnisse ihrer aktuellen Studie, dass der Erfolg der rtpa- Therapie vor allem von der Höhe der Dosis abhängig sei und somit die Dosis den entscheidenden Einfluss auf die Reduzierung des Blutvolumens im dritten und vierten Ventrikel habe. Wir erreichten mit der Injektion von 3 mg rtpa alle 24 Stunden für drei Tage eine schnelle Lyse und ein geringeres Nachblutungsrisiko im Vergleich zu der aktuellen Studienlage. Auch das Risiko einer VP-Shuntpflichtigkeit wurde durch diese Methode verringert. Tab. 11. Vergleich unserer Ergebnisse mit denen von Rhode et al (1995) Autoren GOS 1-3 GOS 4&5 VP- Shunt Rohde et al. (1995) 11 Patienten (55%) 9 Patienten (45%) 11 Patienten (55%) Ntoulias G. (2013) 50 Patienten (62.5%) 30 Patienten (37.5%) 17 Patienten (21.25%) Gleichwohl sind weitere Studien mit einer homogenen Patientengruppe hinsichtlich des Blutvolumens, des klinischen Zustands und der Blutungsquelle notwendig, um weitere Aussagen über die Effizienz der intraventrikulären rtpa- Injektion machen zu können. 6.2 Diskussion der Ergebnisse der Gruppe mit intraparenchymaler Blutung Abnahme des Blutvolumens Auch bei intraparenchymalen Blutungen besteht die Vermutung, dass eine frühe Evakuation oder Auflösung der Blutung eine protektive Wirkung auf das umliegende Hirngewebe, durch Beschleunigung der Regenerierung des Hirnparenchyms und Verminderung des Hirnödems und des intrazerebralen Drucks hat [47, 63, 64, 66, 67, 72]. Die Ergebnisse unserer Arbeit zeigen, dass die Injektion von rtpa in die Blutungshöhle eine adäquate Technik ist, das Blutvolumen schnell und effizient zu reduzieren. Durch die dreimalige Injektion von rtpa innerhalb von drei Tagen 34
Westfälische Wilhems-Uni versität Münster. Hauptvorlesung Radiologie. Neuroradiologie II
 Westfälische Wilhems-Uni versität Münster Hauptvorlesung Radiologie Neuroradiologie II Themen Klinische Entitäten II Schlaganfall Zerebrale Ischämie Intrakranielle Blutung Neuroradiologische Interventionen
Westfälische Wilhems-Uni versität Münster Hauptvorlesung Radiologie Neuroradiologie II Themen Klinische Entitäten II Schlaganfall Zerebrale Ischämie Intrakranielle Blutung Neuroradiologische Interventionen
Eine Analyse des Münchner Schlaganfallregisters: Diagnostik und Therapie bei Patienten mit Diabetes mellitus"
 Aus der Forschergruppe Diabetes e.v. am Helmholtz Zentrum München Vorstand: Professor Dr. med. Oliver Schnell Eine Analyse des Münchner Schlaganfallregisters: Diagnostik und Therapie bei Patienten mit
Aus der Forschergruppe Diabetes e.v. am Helmholtz Zentrum München Vorstand: Professor Dr. med. Oliver Schnell Eine Analyse des Münchner Schlaganfallregisters: Diagnostik und Therapie bei Patienten mit
Schlaganfall (Hirnschlag, Apoplex, Stroke)
 Schlaganfall (Hirnschlag, Apoplex, Stroke) Ein Schlaganfall (in der Fachsprache Apoplex oder cerebrovaskulärer Insult genannt) wird verursacht durch eine plötzliche Unterbrechung der Hirndurchblutung in
Schlaganfall (Hirnschlag, Apoplex, Stroke) Ein Schlaganfall (in der Fachsprache Apoplex oder cerebrovaskulärer Insult genannt) wird verursacht durch eine plötzliche Unterbrechung der Hirndurchblutung in
Akute Halbseitenlähmung / akute gekreuzte Symptomatik
 Akute Halbseitenlähmung / akute gekreuzte Symptomatik Meist Schädigung im Bereich der kontralateralen Hemisphäre. Bei gekreuzten Ausfällen Hirnstammschädigung. Ätiologie - überwiegend vaskulär (siehe Vaskuläre
Akute Halbseitenlähmung / akute gekreuzte Symptomatik Meist Schädigung im Bereich der kontralateralen Hemisphäre. Bei gekreuzten Ausfällen Hirnstammschädigung. Ätiologie - überwiegend vaskulär (siehe Vaskuläre
Vorwort. 2 Epidemiologie Inzidenz Mortalität Prävalenz Prognose 7
 Inhalt Vorwort V 1 Definition von Krankheitsbildern 1 1.1 Stadium I (asymptomatische Stenose) 1 1.2 Stadium II (TIA) 1 1.3 Stadium III (progredienter Schlaganfall) 2 1.4 Stadium IV (kompletter Schlaganfall)
Inhalt Vorwort V 1 Definition von Krankheitsbildern 1 1.1 Stadium I (asymptomatische Stenose) 1 1.2 Stadium II (TIA) 1 1.3 Stadium III (progredienter Schlaganfall) 2 1.4 Stadium IV (kompletter Schlaganfall)
Pflege eines Kindes mit externer Ventrikeldrainage (EVD)
 Komplexer Hydrocephalus Pflege eines Kindes mit externer Ventrikeldrainage (EVD) Anja Uftring Grundsätzliches zur EVD Indikationen zur Anlage einer EVD Erhöhte Liquorproduktion auf Grund einer Intrakraniellen
Komplexer Hydrocephalus Pflege eines Kindes mit externer Ventrikeldrainage (EVD) Anja Uftring Grundsätzliches zur EVD Indikationen zur Anlage einer EVD Erhöhte Liquorproduktion auf Grund einer Intrakraniellen
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
 Centrum für Schlaganfall-Forschung Berlin (CSB) Campus Virchow Klinikum Augustenburger Platz, 13353 Berlin Studienleiter: Prof. Dr. med. Eric Jüttler Tel: 030/450 560257, Fax: 030/ 450 560957 Centrum für
Centrum für Schlaganfall-Forschung Berlin (CSB) Campus Virchow Klinikum Augustenburger Platz, 13353 Berlin Studienleiter: Prof. Dr. med. Eric Jüttler Tel: 030/450 560257, Fax: 030/ 450 560957 Centrum für
SPONTANE INTRAZEREBRALE UND VENTRIKULÄRE BLUTUNGEN
 SPONTANE INTRAZEREBRALE UND VENTRIKULÄRE BLUTUNGEN A. Einführung Spontane intrazerebrale und ventrikuläre Blutungen bedingt durch Hypertonie, zerebrale Amyloidose, Gerinnungsanomalien, Antikoagulantien
SPONTANE INTRAZEREBRALE UND VENTRIKULÄRE BLUTUNGEN A. Einführung Spontane intrazerebrale und ventrikuläre Blutungen bedingt durch Hypertonie, zerebrale Amyloidose, Gerinnungsanomalien, Antikoagulantien
Schlaganfall: im Zweifelsfall für die Lyse-Therapie entscheiden
 Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft (DSG) und Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN) Schlaganfall: im Zweifelsfall für die Lyse-Therapie entscheiden Berlin (17. Juli 2012) Deutlich mehr Schlaganfall-Patienten
Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft (DSG) und Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN) Schlaganfall: im Zweifelsfall für die Lyse-Therapie entscheiden Berlin (17. Juli 2012) Deutlich mehr Schlaganfall-Patienten
Grundlagen. Lernerfolg. Übersicht. Klinische Untersuchung. Hirn und seine Hüllen. Gefäße. Rückenmark. Klinik für Neurochirurgie, Hüllen und Stützen
 Neurochirurgische Notfälle Neurochirurgie A. Nabavi Klinik für Neurochirurgie, Direktor Professor H.M. Mehdorn Hirn und seine Hüllen Gefäße Rückenmark Hüllen und Stützen periphere Nerven UKSH Campus Kiel
Neurochirurgische Notfälle Neurochirurgie A. Nabavi Klinik für Neurochirurgie, Direktor Professor H.M. Mehdorn Hirn und seine Hüllen Gefäße Rückenmark Hüllen und Stützen periphere Nerven UKSH Campus Kiel
Fall x: - weiblich, 37 Jahre. Symptome: - Visusminderung, Gangunsicherheit. Neurologischer Befund: - rechtsbetonte spastische Tetraparese - Gangataxie
 Fall x: - weiblich, 37 Jahre Symptome: - Visusminderung, Gangunsicherheit Neurologischer Befund: - rechtsbetonte spastische Tetraparese - Gangataxie Fall x: Liquorbefund: unauffällig mit 2 Leukos, keine
Fall x: - weiblich, 37 Jahre Symptome: - Visusminderung, Gangunsicherheit Neurologischer Befund: - rechtsbetonte spastische Tetraparese - Gangataxie Fall x: Liquorbefund: unauffällig mit 2 Leukos, keine
Intrakranielle Blutungen / Subarachnoidalblutung. Aneurysmen / Angiome
 Intrakranielle Blutungen / Subarachnoidalblutung Aneurysmen / Angiome PD Dr. Ulf Nestler Klinik für Neurochirurgie Direktor: Professor Dr. med. J. Meixensberger Circulus willisii Universitätsmedizin Leipzig:
Intrakranielle Blutungen / Subarachnoidalblutung Aneurysmen / Angiome PD Dr. Ulf Nestler Klinik für Neurochirurgie Direktor: Professor Dr. med. J. Meixensberger Circulus willisii Universitätsmedizin Leipzig:
Antikoagulation und Plättchenaggregationshemmung beim flimmernden KHK-Patienten
 Antikoagulation und Plättchenaggregationshemmung beim flimmernden KHK-Patienten Dr. Ralph Kallmayer, Innere Abteilung Kardiologie HELIOS Klinik Lutherstadt Eisleben Das therapeutische Dilemma: Patient
Antikoagulation und Plättchenaggregationshemmung beim flimmernden KHK-Patienten Dr. Ralph Kallmayer, Innere Abteilung Kardiologie HELIOS Klinik Lutherstadt Eisleben Das therapeutische Dilemma: Patient
2. Kongress: Leben nach erworbener Hirnschädigung
 2. Kongress: Leben nach erworbener Hirnschädigung Hirngeschädigte - ein geeigneter Sammelbegriff, für wen und für wie viele? Andreas Kampfl Abteilung für Neurologie mit Stroke Unit Erworbene Hirnschädigung:
2. Kongress: Leben nach erworbener Hirnschädigung Hirngeschädigte - ein geeigneter Sammelbegriff, für wen und für wie viele? Andreas Kampfl Abteilung für Neurologie mit Stroke Unit Erworbene Hirnschädigung:
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR KARDIOLOGIE HERZ- UND KREISLAUFFORSCHUNG e.v. German Cardiac Society
 Die Herz-Magnet-Resonanz-Tomographie kann Kosten um 50% senken gegenüber invasiven Tests im Rahmen der Abklärung und Behandlung von Patienten mit Verdacht auf eine koronare Herzkrankheit: Resultate von
Die Herz-Magnet-Resonanz-Tomographie kann Kosten um 50% senken gegenüber invasiven Tests im Rahmen der Abklärung und Behandlung von Patienten mit Verdacht auf eine koronare Herzkrankheit: Resultate von
ADSR Qualitätsindikatoren/Kennzahlen 2017
 ADSR Qualitätsindikatoren/Kennzahlen 2017 QI-ID Bezeichnung Zähler/Nenner Referenzbereich 02-003 Rehabilitation Physiotherapie Nenner: Fälle mit Paresen und deutlicher Funktionseinschränkung (operationalisiert
ADSR Qualitätsindikatoren/Kennzahlen 2017 QI-ID Bezeichnung Zähler/Nenner Referenzbereich 02-003 Rehabilitation Physiotherapie Nenner: Fälle mit Paresen und deutlicher Funktionseinschränkung (operationalisiert
Ergebnisse Kasuistiken Beispiel für einen kurzen Krankheitsverlauf
 - 37-3. Ergebnisse 3.1. Kasuistiken T1 T2 3.1.1. Beispiel für einen kurzen Krankheitsverlauf 53-jähriger Mann mit einem Glioblastom des Hirnstamms. 1/5 MRT wegen einer seit 6 Monaten zunehmenden Halbseitensymptomatik.
- 37-3. Ergebnisse 3.1. Kasuistiken T1 T2 3.1.1. Beispiel für einen kurzen Krankheitsverlauf 53-jähriger Mann mit einem Glioblastom des Hirnstamms. 1/5 MRT wegen einer seit 6 Monaten zunehmenden Halbseitensymptomatik.
Krankheitsbild und Epidemiologie des akuten Koronarsyndroms
 Krankheitsbild und Epidemiologie des akuten Koronarsyndroms Uwe Zeymer Herzzentrum Ludwigshafen Institut für Herzinfarktforschung Ludwigshafen Forum Herz: Versorgung bei Akutem Koronarsyndrom Berlin, 26.11.2015
Krankheitsbild und Epidemiologie des akuten Koronarsyndroms Uwe Zeymer Herzzentrum Ludwigshafen Institut für Herzinfarktforschung Ludwigshafen Forum Herz: Versorgung bei Akutem Koronarsyndrom Berlin, 26.11.2015
Schlaganfallbehandlung Neurologische Rehabilitation
 Externe Qualitätssicherung in der stationären Versorgung Schlaganfallbehandlung Neurologische Rehabilitation Jahresauswertung 2010 Geschäftsstelle Qualitätssicherung Hessen Frankfurter Straße 10-14 65760
Externe Qualitätssicherung in der stationären Versorgung Schlaganfallbehandlung Neurologische Rehabilitation Jahresauswertung 2010 Geschäftsstelle Qualitätssicherung Hessen Frankfurter Straße 10-14 65760
Die Thrombin-Therapie beim Aneurysma spurium nach arterieller Punktion
 Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Innere Medizin III der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. K. Werdan) und dem Herzzentrum Coswig Klinik für Kardiologie und
Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Innere Medizin III der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. K. Werdan) und dem Herzzentrum Coswig Klinik für Kardiologie und
Schlaganfalldiagnostik
 Schlaganfalldiagnostik Michael Kirsch Institut für Diagnostische Radiologie und Neuroradiologie Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Schlaganfall Definition Als Schlaganfall bezeichnet man die Folge
Schlaganfalldiagnostik Michael Kirsch Institut für Diagnostische Radiologie und Neuroradiologie Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Schlaganfall Definition Als Schlaganfall bezeichnet man die Folge
Zerebrale Gefäßversorgung
 Zerebrale Gefäßversorgung Zerebrale Gefäßversorgung Zerebrale Gefäßversorgung Umgehungskreisläufe Verschluss oder hämodynamisch wirksame Stenose der A. carotis interna Kontralaterale A. carotis interna
Zerebrale Gefäßversorgung Zerebrale Gefäßversorgung Zerebrale Gefäßversorgung Umgehungskreisläufe Verschluss oder hämodynamisch wirksame Stenose der A. carotis interna Kontralaterale A. carotis interna
Leben nach erworbener Hirnschädigung
 Leben nach erworbener Hirnschädigung Akutbehandlung und Rehabilitation Prim. Univ. Prof. Dr. Andreas Kampfl Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried Abteilung für f Neurologie mit Stroke Unit Schlaganfall
Leben nach erworbener Hirnschädigung Akutbehandlung und Rehabilitation Prim. Univ. Prof. Dr. Andreas Kampfl Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried Abteilung für f Neurologie mit Stroke Unit Schlaganfall
Aus der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie der DRK-Kliniken-Köpenick, akademisches Lehrkrankenhaus der Charité Universität Berlin DISSERTATION
 Aus der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie der DRK-Kliniken-Köpenick, akademisches Lehrkrankenhaus der Charité Universität Berlin DISSERTATION Untersuchungen zur Ätiologie des Karpaltunnelsyndroms
Aus der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie der DRK-Kliniken-Köpenick, akademisches Lehrkrankenhaus der Charité Universität Berlin DISSERTATION Untersuchungen zur Ätiologie des Karpaltunnelsyndroms
Aspirin auch bei Typ-2-Diabetikern nur gezielt zur Sekundärprävention einsetzen
 Neue Erkenntnisse zur Prävention von Gefäßerkrankungen: Aspirin auch bei Typ-2-Diabetikern nur gezielt zur Sekundärprävention einsetzen Bochum (3. August 2009) Herzinfarkt und Schlaganfall sind eine häufige
Neue Erkenntnisse zur Prävention von Gefäßerkrankungen: Aspirin auch bei Typ-2-Diabetikern nur gezielt zur Sekundärprävention einsetzen Bochum (3. August 2009) Herzinfarkt und Schlaganfall sind eine häufige
Aus der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Direktor: Prof. Dr. med. H.
 Aus der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Direktor: Prof. Dr. med. H. Dralle Gastric-banding als Operationsmethode bei morbider Adipositas
Aus der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Direktor: Prof. Dr. med. H. Dralle Gastric-banding als Operationsmethode bei morbider Adipositas
Tabelle 1: Altersverteilung der Patienten (n = 42) in Jahren
 3. Ergebnisse Die 42 Patienten (w= 16, m= 26) hatten ein Durchschnittsalter von 53,5 Jahren mit einem Minimum von und einem Maximum von 79 Jahren. Die 3 Patientengruppen zeigten hinsichtlich Alters- und
3. Ergebnisse Die 42 Patienten (w= 16, m= 26) hatten ein Durchschnittsalter von 53,5 Jahren mit einem Minimum von und einem Maximum von 79 Jahren. Die 3 Patientengruppen zeigten hinsichtlich Alters- und
Vorhofflimmern Alte und Neue Konzepte zur Schlaganfallprävention
 Karl Georg Häusler Vorhofflimmern Alte und Neue Konzepte zur Schlaganfallprävention Vorhofflimmern Aktuell ca. 1 Million Patienten mit Vorhofflimmern in Deutschland Verdoppelung der Prävalenz in den nächsten
Karl Georg Häusler Vorhofflimmern Alte und Neue Konzepte zur Schlaganfallprävention Vorhofflimmern Aktuell ca. 1 Million Patienten mit Vorhofflimmern in Deutschland Verdoppelung der Prävalenz in den nächsten
Monate Präop Tabelle 20: Verteilung der NYHA-Klassen in Gruppe 1 (alle Patienten)
 Parameter zur Beschreibung der Leistungsfähigkeit Klassifikation der New-York-Heart-Association (NYHA) Gruppe 1 (alle Patienten): Die Eingruppierung der Patienten in NYHA-Klassen als Abbild der Schwere
Parameter zur Beschreibung der Leistungsfähigkeit Klassifikation der New-York-Heart-Association (NYHA) Gruppe 1 (alle Patienten): Die Eingruppierung der Patienten in NYHA-Klassen als Abbild der Schwere
handlungsfehler in der präklinischen Versorgung f. Dr. A. Ferbert.2008 10. Jahrestagung der ANB
 handlungsfehler in der präklinischen Versorgung f. Dr. A. Ferbert.2008 10. Jahrestagung der ANB Häufige Fehlerarten in der Prähospitalphase Schlaganfall bzw. TIA nicht diagnostiziert. SAB nicht diagnostiziert
handlungsfehler in der präklinischen Versorgung f. Dr. A. Ferbert.2008 10. Jahrestagung der ANB Häufige Fehlerarten in der Prähospitalphase Schlaganfall bzw. TIA nicht diagnostiziert. SAB nicht diagnostiziert
Aus der Klinik und Poliklinik für kleine Haustiere der Freien Universität Berlin
 Aus der Klinik und Poliklinik für kleine Haustiere der Freien Universität Berlin Klinische Doppelblindstudie über den präoperativen Einsatz von Methylprednisolonsuccinat beim thorakolumbalen Bandscheibenvorfall
Aus der Klinik und Poliklinik für kleine Haustiere der Freien Universität Berlin Klinische Doppelblindstudie über den präoperativen Einsatz von Methylprednisolonsuccinat beim thorakolumbalen Bandscheibenvorfall
Vom unklaren Symptomkomplex zur ganzheitlichen Diagnose
 Morbus Fabry - Niereninsuffizienz Kardiomyopathie Neurologische Störungen - Vom unklaren Sympto Morbus Fabry Niereninsuffizienz Kardiomyopathie Neurologische Störungen Vom unklaren Symptomkomplex zur ganzheitlichen
Morbus Fabry - Niereninsuffizienz Kardiomyopathie Neurologische Störungen - Vom unklaren Sympto Morbus Fabry Niereninsuffizienz Kardiomyopathie Neurologische Störungen Vom unklaren Symptomkomplex zur ganzheitlichen
 Antikoagulation bei DermatochirurgischenEingriffen Bochum 9.9.2017 Dr. Pia Dücker Dilemma -Risikoabwägung Thrombembolieim arteriellen Bereich 20% tödlich, 40% bleibende Behinderung Venöse Thrombembolie6%
Antikoagulation bei DermatochirurgischenEingriffen Bochum 9.9.2017 Dr. Pia Dücker Dilemma -Risikoabwägung Thrombembolieim arteriellen Bereich 20% tödlich, 40% bleibende Behinderung Venöse Thrombembolie6%
Unerklärliche Todesfälle und der Zusammenhang zu Hypoglykämien
 Unerklärliche Todesfälle und der Zusammenhang zu Hypoglykämien Ziel: Untersuchung von unerwarteten Todesfällen bei Patienten mit Typ-1-Diabetes im Alter unter 50 Jahre in Großbritannien. Methode / Klientel:
Unerklärliche Todesfälle und der Zusammenhang zu Hypoglykämien Ziel: Untersuchung von unerwarteten Todesfällen bei Patienten mit Typ-1-Diabetes im Alter unter 50 Jahre in Großbritannien. Methode / Klientel:
4 Ergebnisbeschreibung 4.1 Patienten
 4 Ergebnisbeschreibung 4.1 Patienten In der Datenauswertung ergab sich für die Basischarakteristika der Patienten gesamt und bezogen auf die beiden Gruppen folgende Ergebnisse: 19 von 40 Patienten waren
4 Ergebnisbeschreibung 4.1 Patienten In der Datenauswertung ergab sich für die Basischarakteristika der Patienten gesamt und bezogen auf die beiden Gruppen folgende Ergebnisse: 19 von 40 Patienten waren
Bei näherer Betrachtung des Diagramms Nr. 3 fällt folgendes auf:
 18 3 Ergebnisse In diesem Kapitel werden nun zunächst die Ergebnisse der Korrelationen dargelegt und anschließend die Bedingungen der Gruppenbildung sowie die Ergebnisse der weiteren Analysen. 3.1 Ergebnisse
18 3 Ergebnisse In diesem Kapitel werden nun zunächst die Ergebnisse der Korrelationen dargelegt und anschließend die Bedingungen der Gruppenbildung sowie die Ergebnisse der weiteren Analysen. 3.1 Ergebnisse
Was ist ein Schlaganfall, welche Risken, welche Vorboten gibt es?
 Was ist ein Schlaganfall, welche Risken, welche Vorboten gibt es? Prim. Univ. Prof. Dr. Andreas Kampfl Abteilung für Neurologie mit Stroke Unit Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried im Innkreis
Was ist ein Schlaganfall, welche Risken, welche Vorboten gibt es? Prim. Univ. Prof. Dr. Andreas Kampfl Abteilung für Neurologie mit Stroke Unit Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried im Innkreis
PD Dr. habil. Axel Schlitt et al., Halle
 Deutsche Gesellschaft für Kardiologie Herz- und Kreislaufforschung e.v. (DGK) Achenbachstr. 43, 40237 Düsseldorf Geschäftsstelle: Tel: 0211 / 600 692-0 Fax: 0211 / 600 692-10 E-Mail: info@dgk.org Pressestelle:
Deutsche Gesellschaft für Kardiologie Herz- und Kreislaufforschung e.v. (DGK) Achenbachstr. 43, 40237 Düsseldorf Geschäftsstelle: Tel: 0211 / 600 692-0 Fax: 0211 / 600 692-10 E-Mail: info@dgk.org Pressestelle:
Antikoagulation bei Vorhofflimmern
 Orale Antikoagulation bei VHF Was kommt nach Marcumar? Köln, 17. September 2011 Antikoagulation bei Vorhofflimmern Priv.-Doz. Dr. med. Jochen Müller-Ehmsen muller.ehmsen@uni-koeln.de Klinik III für Innere
Orale Antikoagulation bei VHF Was kommt nach Marcumar? Köln, 17. September 2011 Antikoagulation bei Vorhofflimmern Priv.-Doz. Dr. med. Jochen Müller-Ehmsen muller.ehmsen@uni-koeln.de Klinik III für Innere
Leitliniengerechte Gerinnungshemmung bei Vorhofflimmern und KHK
 Leitliniengerechte Gerinnungshemmung bei Vorhofflimmern und KHK Dr. med. Murat Nar Ambulantes Herz-Kreislaufzentrum Wolfsburg Vorhofflimmern - Inzidenz Vorhofflimmern ist die häufigste anhaltende Herzrhythmusstörung.
Leitliniengerechte Gerinnungshemmung bei Vorhofflimmern und KHK Dr. med. Murat Nar Ambulantes Herz-Kreislaufzentrum Wolfsburg Vorhofflimmern - Inzidenz Vorhofflimmern ist die häufigste anhaltende Herzrhythmusstörung.
EVIDENZ KOMPAKT. Screening auf das Vorliegen einer Carotisstenose bei asymptomatischen Erwachsenen
 EVIDENZ KOMPAKT Screening auf das Vorliegen einer Carotisstenose bei asymptomatischen Erwachsenen Stand: 15.11.2016 Autoren Stefanie Butz (M. Sc. Public Health) Dr. med. Dagmar Lühmann (Oberärztliche Koordinatorin
EVIDENZ KOMPAKT Screening auf das Vorliegen einer Carotisstenose bei asymptomatischen Erwachsenen Stand: 15.11.2016 Autoren Stefanie Butz (M. Sc. Public Health) Dr. med. Dagmar Lühmann (Oberärztliche Koordinatorin
DIE HYPERTENSIVE KRISE. Prim. Univ.Prof. Dr. Michael M. Hirschl. Vorstand der Abteilung für Innere Medizin. Landesklinikum Zwettl
 DIE HYPERTENSIVE KRISE Prim. Univ.Prof. Dr. Michael M. Hirschl Vorstand der Abteilung für Innere Medizin Landesklinikum Zwettl ALLGEMEIN Patienten mit einem hypertensiven Notfall stellen einen erheblichen
DIE HYPERTENSIVE KRISE Prim. Univ.Prof. Dr. Michael M. Hirschl Vorstand der Abteilung für Innere Medizin Landesklinikum Zwettl ALLGEMEIN Patienten mit einem hypertensiven Notfall stellen einen erheblichen
Neue Leitlinien zur Dissektion hirnversorgender Arterien: Was ändert sich im klinischen Alltag?
 Neue Leitlinien zur Dissektion hirnversorgender Arterien: Was ändert sich im klinischen Alltag? Ralf Dittrich Department für Neurologie Klinik für Allgemeine Neurologie Westfälische Wilhelms-Universität
Neue Leitlinien zur Dissektion hirnversorgender Arterien: Was ändert sich im klinischen Alltag? Ralf Dittrich Department für Neurologie Klinik für Allgemeine Neurologie Westfälische Wilhelms-Universität
Grundlagen der Medizinischen Klinik I + II. Dr. Friedrich Mittermayer Dr. Katharina Krzyzanowska
 Grundlagen der Medizinischen Klinik I + II Dr. Friedrich Mittermayer Dr. Katharina Krzyzanowska 1 Was ist Bluthochdruck? Der ideale Blutdruck liegt bei 120/80 mmhg. Bluthochdruck (Hypertonie) ist eine
Grundlagen der Medizinischen Klinik I + II Dr. Friedrich Mittermayer Dr. Katharina Krzyzanowska 1 Was ist Bluthochdruck? Der ideale Blutdruck liegt bei 120/80 mmhg. Bluthochdruck (Hypertonie) ist eine
Zerebrale Notfälle. ? 93 Welches sind die typischen Hirndruckzeichen? a) Kopfschmerz. b) Emesis. c) Sehstörung. d) Miosis. e) Bewusstseinsstörung.
 118 Zerebrale Notfälle Zerebrale Notfälle? 93 Welches sind die typischen Hirndruckzeichen? a) Kopfschmerz. b) Emesis. c) Sehstörung. d) Miosis. e) Bewusstseinsstörung. a) Richtig. Kopfschmerzen gehören
118 Zerebrale Notfälle Zerebrale Notfälle? 93 Welches sind die typischen Hirndruckzeichen? a) Kopfschmerz. b) Emesis. c) Sehstörung. d) Miosis. e) Bewusstseinsstörung. a) Richtig. Kopfschmerzen gehören
Man ist so alt wie seine Gefäße Koronare Herzkrankheit Schlaganfall Prävention Diagnostik - Therapie
 Man ist so alt wie seine Gefäße Koronare Herzkrankheit Schlaganfall Prävention Diagnostik - Therapie Priv.-Doz.Dr.L.Pizzulli Innere Medizin Kardiologie Herz-und Gefäßzentrum Rhein-Ahr Gemeinschaftskrankenhaus
Man ist so alt wie seine Gefäße Koronare Herzkrankheit Schlaganfall Prävention Diagnostik - Therapie Priv.-Doz.Dr.L.Pizzulli Innere Medizin Kardiologie Herz-und Gefäßzentrum Rhein-Ahr Gemeinschaftskrankenhaus
Normaldruckhydrozephalus (NPH)
 Normaldruckhydrozephalus (NPH) In Deutschland sind ca. 60.000 Menschen von einem sogenannten Normaldruckhydrozephalus (NPH) betroffen. Es gibt etwa 20 weitere Begriffe für diese Erkrankung wie z.b. Altershirnduck
Normaldruckhydrozephalus (NPH) In Deutschland sind ca. 60.000 Menschen von einem sogenannten Normaldruckhydrozephalus (NPH) betroffen. Es gibt etwa 20 weitere Begriffe für diese Erkrankung wie z.b. Altershirnduck
Kein zusätzlicher Nutzen durch ultrafrühe Intervention mit Aspirin bei Lysepatienten
 Schlaganfall Kein zusätzlicher Nutzen durch ultrafrühe Intervention mit Aspirin bei Lysepatienten Berlin (10. September 2012) Mit immer wieder neuen Studien ringen Neurologen darum, die Behandlung von
Schlaganfall Kein zusätzlicher Nutzen durch ultrafrühe Intervention mit Aspirin bei Lysepatienten Berlin (10. September 2012) Mit immer wieder neuen Studien ringen Neurologen darum, die Behandlung von
Notfall-Schlaganfall - Gesundheitstag Eutin 2014
 Notfall-Schlaganfall - Schnelles Handeln hilft Gesundheitstag Eutin 2014 Dr. med. Dipl.-Psych. Klaus Stecker Chefarzt der AUGUST-BIER-KLINIK Bad Malente-Gremsmühlen 1 Schlaganfall Ursache Diagnostik Behandlungsmöglichkeiten
Notfall-Schlaganfall - Schnelles Handeln hilft Gesundheitstag Eutin 2014 Dr. med. Dipl.-Psych. Klaus Stecker Chefarzt der AUGUST-BIER-KLINIK Bad Malente-Gremsmühlen 1 Schlaganfall Ursache Diagnostik Behandlungsmöglichkeiten
The impact of iron deficiency and anaemia on exercise capacity and outcomes in patients with chronic heart failure
 The impact of iron deficiency and anaemia on exercise capacity and outcomes in patients with chronic heart failure Dipl.-Biol. Nicole Ebner und PD Dr. Dr. Stephan von Haehling, Berlin Begleiterkrankungen
The impact of iron deficiency and anaemia on exercise capacity and outcomes in patients with chronic heart failure Dipl.-Biol. Nicole Ebner und PD Dr. Dr. Stephan von Haehling, Berlin Begleiterkrankungen
Datensatz Schlaganfall-Akutbehandlung (ADSR) Schlaganfall-Akutbehandlung bei Patienten ab 18 Jahren (inkl. Subarachnoidalblutungen)
 Anwenderinformation QS-Filter Datensatz Schlaganfall-Akutbehandlung (ADSR) Stand: 18. August 2017 (QS-Spezifikation 2018 V01) Textdefinition Schlaganfall-Akutbehandlung bei Patienten ab 18 Jahren (inkl.
Anwenderinformation QS-Filter Datensatz Schlaganfall-Akutbehandlung (ADSR) Stand: 18. August 2017 (QS-Spezifikation 2018 V01) Textdefinition Schlaganfall-Akutbehandlung bei Patienten ab 18 Jahren (inkl.
Fallbeispiele. Fallbeispiel 1
 Fallbeispiele Prof. Dr. med. habil. Paracelsus Harz-Klinik Bad Suderode Medizinische Fakultät der Martin Luther-Universität Halle-Wittenberg 1 Fallbeispiel 1-61-Jähriger - Guter Allgemeinzustand - Adipöser
Fallbeispiele Prof. Dr. med. habil. Paracelsus Harz-Klinik Bad Suderode Medizinische Fakultät der Martin Luther-Universität Halle-Wittenberg 1 Fallbeispiel 1-61-Jähriger - Guter Allgemeinzustand - Adipöser
Mitralklappen-Clipping bei Hochrisikopatienten mit degenerativer oder funktioneller Mitralklappeninsuffizienz
 Deutsche Gesellschaft für Kardiologie Herz- und Kreislaufforschung e.v. (DGK) Achenbachstr. 43, 40237 Düsseldorf Geschäftsstelle: Tel: 0211 / 600 692-0 Fax: 0211 / 600 692-10 E-Mail: info@dgk.org Pressestelle:
Deutsche Gesellschaft für Kardiologie Herz- und Kreislaufforschung e.v. (DGK) Achenbachstr. 43, 40237 Düsseldorf Geschäftsstelle: Tel: 0211 / 600 692-0 Fax: 0211 / 600 692-10 E-Mail: info@dgk.org Pressestelle:
Komorbidität, internistische Komplikationen, Intensivtherapie. Dr. M. Fischer, IFAI Klinik Hirslanden Zürich
 1 Komorbidität, internistische Komplikationen, Intensivtherapie Dr. M. Fischer, IFAI Klinik Hirslanden Zürich Indikationen zur Aufnahme auf die Intensivstation.bzw. wann besser nicht Indikationen zur
1 Komorbidität, internistische Komplikationen, Intensivtherapie Dr. M. Fischer, IFAI Klinik Hirslanden Zürich Indikationen zur Aufnahme auf die Intensivstation.bzw. wann besser nicht Indikationen zur
Schädel-Hirn-Trauma. Univ. Prof. Dr. Eduard Auff
 Schädel-Hirn-Trauma Univ. Prof. Dr. Eduard Auff Schädel-Hirn-Trauma Inzidenz Ca. 8.000/1,000.000 EW pro Jahr Hohe Mortalität (ca. 20%) Schädel-Hirn-Trauma Phasen 1. Primäre Verletzung Abhängig von unmittelbarer
Schädel-Hirn-Trauma Univ. Prof. Dr. Eduard Auff Schädel-Hirn-Trauma Inzidenz Ca. 8.000/1,000.000 EW pro Jahr Hohe Mortalität (ca. 20%) Schädel-Hirn-Trauma Phasen 1. Primäre Verletzung Abhängig von unmittelbarer
Zweigbibliothek Medizin
 Sächsische Landesbibiiothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) Zweigbibliothek Medizin Diese Dissertation finden Sie original in Printform zur Ausleihe in der Zweigbibliothek Medizin Nähere
Sächsische Landesbibiiothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) Zweigbibliothek Medizin Diese Dissertation finden Sie original in Printform zur Ausleihe in der Zweigbibliothek Medizin Nähere
Bedeutung der Bestimmung der Vitamin D 3 - Konzentration im Serum bei dialysepflichtiger terminaler Niereninsuffizienz
 Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Innere Medizin II an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. B. Osten) Bedeutung der Bestimmung der Vitamin D 3 - Konzentration
Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Innere Medizin II an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. B. Osten) Bedeutung der Bestimmung der Vitamin D 3 - Konzentration
Manometrie des Ösophagus mit heliumperfundierten Kathetern im Kindesalter
 Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Kinderchirurgie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Direktor: Prof. Dr. med. habil. R. Finke Manometrie des Ösophagus mit heliumperfundierten
Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Kinderchirurgie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Direktor: Prof. Dr. med. habil. R. Finke Manometrie des Ösophagus mit heliumperfundierten
Der Schlaganfall wenn jede Minute zählt. Andreas Kampfl Abteilung Neurologie und Stroke Unit Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried im Innkreis
 Der Schlaganfall wenn jede Minute zählt Andreas Kampfl Abteilung Neurologie und Stroke Unit Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried im Innkreis Aufgaben des Großhirns Bewegung Sensibilität Sprachproduktion
Der Schlaganfall wenn jede Minute zählt Andreas Kampfl Abteilung Neurologie und Stroke Unit Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried im Innkreis Aufgaben des Großhirns Bewegung Sensibilität Sprachproduktion
Spontane und traumatische intrakranielle Blutungen: Klinische Behandlungsergebnisse in der Akutklinik
 Universität Ulm Klinik für Neurochirurgie Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. med. C.R. Wirtz Spontane und traumatische intrakranielle Blutungen: Klinische Behandlungsergebnisse in der Akutklinik Dissertation
Universität Ulm Klinik für Neurochirurgie Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. med. C.R. Wirtz Spontane und traumatische intrakranielle Blutungen: Klinische Behandlungsergebnisse in der Akutklinik Dissertation
C-2 Intrakranielle Blutungen
 177 C-2 Intrakranielle Blutungen André Grabowski und Bodo Kress C-2.1 Intrazerebrale Blutung Grundlagen Für 10 bis 20 % aller Schlaganfälle kommen intrazerebrale Blutungen (ICB) als Ursache infrage. Die
177 C-2 Intrakranielle Blutungen André Grabowski und Bodo Kress C-2.1 Intrazerebrale Blutung Grundlagen Für 10 bis 20 % aller Schlaganfälle kommen intrazerebrale Blutungen (ICB) als Ursache infrage. Die
Epidemiologische Entwicklungen und altersabhängige Besonderheiten
 Epidemiologische Entwicklungen und altersabhängige Besonderheiten Eine Analyse aus dem TraumaRegister DGU Rolf Lefering Institute for Research in Operative Medicine (IFOM) University Witten/Herdecke Cologne,
Epidemiologische Entwicklungen und altersabhängige Besonderheiten Eine Analyse aus dem TraumaRegister DGU Rolf Lefering Institute for Research in Operative Medicine (IFOM) University Witten/Herdecke Cologne,
3.15 Nieren und ableitende Harnwege
 108 Ergebnisse zur Nieren und ableitende Harnwege 3.15 Nieren und ableitende Harnwege Kernaussagen Inzidenz und Mortalität: In 2004 erkrankten in Deutschland etwa 10.700 und etwa 6.500 an einem bösartigen
108 Ergebnisse zur Nieren und ableitende Harnwege 3.15 Nieren und ableitende Harnwege Kernaussagen Inzidenz und Mortalität: In 2004 erkrankten in Deutschland etwa 10.700 und etwa 6.500 an einem bösartigen
3.1. Überlebenszeiten Zum Ende der Nachuntersuchung waren 19 Patienten (17,8%) am Leben und 88 (82,2%) verstorben (Tab. 3.1.).
 18 3. Ergebnisse 3.1. Überlebenszeiten Zum Ende der Nachuntersuchung waren 19 Patienten (17%) am Leben und 88 (82%) verstorben (Tab. 3.1.). Tabelle 3.1. Häufigkeit der lebenden und verstorbenen Patienten
18 3. Ergebnisse 3.1. Überlebenszeiten Zum Ende der Nachuntersuchung waren 19 Patienten (17%) am Leben und 88 (82%) verstorben (Tab. 3.1.). Tabelle 3.1. Häufigkeit der lebenden und verstorbenen Patienten
Verfasser: Prof. A. Hagendorff
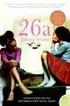 Förderung durch die DEGUM Bericht über die Studie: Analyse der Schlaganfall-Gefährdung bei Patienten mit Indikationsstellung zur transösophagealen Echokardiographie anhand der Vorhofohr- Flussgeschwindigkeiten
Förderung durch die DEGUM Bericht über die Studie: Analyse der Schlaganfall-Gefährdung bei Patienten mit Indikationsstellung zur transösophagealen Echokardiographie anhand der Vorhofohr- Flussgeschwindigkeiten
Multiple Sklerose ohne oligoklonale Banden in Liquor: Prävalenz und klinischer Verlauf
 Aus der Klinik für Neurologie des Jüdischen Krankenhaus Berlin Akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Fakultät der Charité Universitätsmedizin Berlin DISSERTATION Multiple Sklerose ohne oligoklonale
Aus der Klinik für Neurologie des Jüdischen Krankenhaus Berlin Akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Fakultät der Charité Universitätsmedizin Berlin DISSERTATION Multiple Sklerose ohne oligoklonale
Einführung in die Neuroradiologie
 Einführung in die Neuroradiologie B. Turowski 2010 Neuroradiologie Neuroradiologie Diagnostik und Therapie von: Gehirn und Rückenmark = Neuro-Achse Hüll- und Stützstrukturen Kompetenz Frage einer 84-jährigen
Einführung in die Neuroradiologie B. Turowski 2010 Neuroradiologie Neuroradiologie Diagnostik und Therapie von: Gehirn und Rückenmark = Neuro-Achse Hüll- und Stützstrukturen Kompetenz Frage einer 84-jährigen
TIME IS BRAIN! Aktuelles zur Schlaganfallbehandlung. Marianne Dieterich Klinik und Poliklinik für Neurologie
 TIME IS BRAIN! Aktuelles zur Schlaganfallbehandlung Marianne Dieterich Klinik und Poliklinik für Neurologie Interdisziplinäres Schlaganfallzentrum München (Ludwig-Maximilians-Universität München, Standort
TIME IS BRAIN! Aktuelles zur Schlaganfallbehandlung Marianne Dieterich Klinik und Poliklinik für Neurologie Interdisziplinäres Schlaganfallzentrum München (Ludwig-Maximilians-Universität München, Standort
3 Ergebnisse 3.1 Charakterisierung der untersuchten Melanome
 3 Ergebnisse 3.1 Charakterisierung der untersuchten Melanome Untersucht wurden insgesamt 26 Melanome, die zwischen 1991 und 1997 in der Universitätsklinik und Poliklinik für Dermatologie und Venerologie
3 Ergebnisse 3.1 Charakterisierung der untersuchten Melanome Untersucht wurden insgesamt 26 Melanome, die zwischen 1991 und 1997 in der Universitätsklinik und Poliklinik für Dermatologie und Venerologie
Einfluss viszeraler osteopathischer Interventionen bei Kindern mit funktionellen Bauchschmerzen : Eine experimentelle Pilotstudie
 Einfluss viszeraler osteopathischer Interventionen bei Kindern mit funktionellen Bauchschmerzen : Eine experimentelle Pilotstudie Abschlussarbeit zur Erlangung des Titels: Bachelor of Science vorgelegt
Einfluss viszeraler osteopathischer Interventionen bei Kindern mit funktionellen Bauchschmerzen : Eine experimentelle Pilotstudie Abschlussarbeit zur Erlangung des Titels: Bachelor of Science vorgelegt
II. Möglichkeiten zur medikamentösen Behandlung des Schlaganfalls
 Hat Magnesium eine neuroprotektive Wirkung? (Ergebnisse der IMAGES-Studie) K.Wink I. Einführung Der akute Schlaganfall stellt in den entwickelten Ländern die dritthäufigste Todesursache dar. Im Alter von
Hat Magnesium eine neuroprotektive Wirkung? (Ergebnisse der IMAGES-Studie) K.Wink I. Einführung Der akute Schlaganfall stellt in den entwickelten Ländern die dritthäufigste Todesursache dar. Im Alter von
Neue (direkte) orale Antikoagulantien. (DOAKS): Wie damit umgehen? - Copyright nur zum direkten persönlichen Nachlesen bestimmt-
 Neue (direkte) orale Antikoagulantien (DOAKS): Wie damit umgehen? - Copyright nur zum direkten persönlichen Nachlesen bestimmt- vor drei Wochen im Op 67 j. Patient, Jurist, 183 cm, 79 kg latente Bluthochdruckerkrankung
Neue (direkte) orale Antikoagulantien (DOAKS): Wie damit umgehen? - Copyright nur zum direkten persönlichen Nachlesen bestimmt- vor drei Wochen im Op 67 j. Patient, Jurist, 183 cm, 79 kg latente Bluthochdruckerkrankung
S3-LEITLINIE ZUR DIAGNOSTIK, THERAPIE UND NACHSORGE DER PERIPHEREN ARTERIELLEN VERSCHLUSSKRANKHEIT
 S3-LEITLINIE ZUR DIAGNOSTIK, THERAPIE UND NACHSORGE DER PERIPHEREN ARTERIELLEN VERSCHLUSSKRANKHEIT Stand: 30. September 2015 95% der Fälle durch Arteriosklerose Herzinfarkt, Schlaganfall und PAVK In ungefähr
S3-LEITLINIE ZUR DIAGNOSTIK, THERAPIE UND NACHSORGE DER PERIPHEREN ARTERIELLEN VERSCHLUSSKRANKHEIT Stand: 30. September 2015 95% der Fälle durch Arteriosklerose Herzinfarkt, Schlaganfall und PAVK In ungefähr
3.1 Dauerhafter Hochdruck versus temporärer. 3.1 Dauerhafter Hochdruck versus temporärer Hochdruck
 3.1 Dauerhafter Hochdruck versus temporärer 9 3.1 Dauerhafter Hochdruck versus temporärer Hochdruck A Grundsätzlich muss zwischen den dauerhaften und den temporären Blutdrucksteigerungen unterschieden
3.1 Dauerhafter Hochdruck versus temporärer 9 3.1 Dauerhafter Hochdruck versus temporärer Hochdruck A Grundsätzlich muss zwischen den dauerhaften und den temporären Blutdrucksteigerungen unterschieden
Tab. 4.1: Altersverteilung der Gesamtstichprobe BASG SASG BAS SAS UDS SCH AVP Mittelwert Median Standardabweichung 44,36 43,00 11,84
 Im weiteren wird gemäß den allgemeinen statistischen Regeln zufolge bei Vorliegen von p=,5 und
Im weiteren wird gemäß den allgemeinen statistischen Regeln zufolge bei Vorliegen von p=,5 und
Operative Intensivstation Departement Anästhesie. Schädelhirntrauma. Nadine Cueni
 Operative Intensivstation Departement Anästhesie Schädelhirntrauma Nadine Cueni 28.10.2017 Epidemiologie 200-300 Schädelhirntrauma pro 100 000 Einwohner in Europa Häufigste Todesursache bei jungen Erwachsenen
Operative Intensivstation Departement Anästhesie Schädelhirntrauma Nadine Cueni 28.10.2017 Epidemiologie 200-300 Schädelhirntrauma pro 100 000 Einwohner in Europa Häufigste Todesursache bei jungen Erwachsenen
Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Strahlentherapie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
 Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Strahlentherapie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Komm. Direktorin PD Dr. med. Gabriele Hänsgen) Vergleich der Wirksamkeit von Orthovoltbestrahlung
Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Strahlentherapie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Komm. Direktorin PD Dr. med. Gabriele Hänsgen) Vergleich der Wirksamkeit von Orthovoltbestrahlung
Internistische Hausarztpraxis.
 Internistische Hausarztpraxis www.innere-in-lank.de Das Bauch-Aorteneneurysma Zeitbombe im Bauch? Thomas Mann Albert Einstein Charles de Gaulle Johannes Rau litten an einem Bauchaortenaneurysm. Definition
Internistische Hausarztpraxis www.innere-in-lank.de Das Bauch-Aorteneneurysma Zeitbombe im Bauch? Thomas Mann Albert Einstein Charles de Gaulle Johannes Rau litten an einem Bauchaortenaneurysm. Definition
Antithrombotische Therapie nach Koronarintervention bei Vorhofflimmern
 Antithrombotische Therapie nach Koronarintervention bei Vorhofflimmern Priv.-Doz. Dr. Marcel Halbach Klinik III für Innere Medizin Herzzentrum der Universität zu Köln Indikation zur dualen TAH und oralen
Antithrombotische Therapie nach Koronarintervention bei Vorhofflimmern Priv.-Doz. Dr. Marcel Halbach Klinik III für Innere Medizin Herzzentrum der Universität zu Köln Indikation zur dualen TAH und oralen
Datensatz Schlaganfall-Akutbehandlung (nur Rheinland-Pfalz) (APO_RP)
 1 von 6 Anwenderinformation QS-Filter Datensatz Schlaganfall-Akutbehandlung (nur Rheinland-Pfalz) (APO_RP) Stand: 30. Juni 2017 (QS-Spezifikation 2018 V01) Copyright 2017 IQTIG Textdefinition Schlaganfall-Akutbehandlung
1 von 6 Anwenderinformation QS-Filter Datensatz Schlaganfall-Akutbehandlung (nur Rheinland-Pfalz) (APO_RP) Stand: 30. Juni 2017 (QS-Spezifikation 2018 V01) Copyright 2017 IQTIG Textdefinition Schlaganfall-Akutbehandlung
Wie (un-)sicher ist die Computertomographie (Cardio-CT)? Dr. med. D. Enayat
 Wie (un-)sicher ist die Computertomographie (Cardio-CT)? Dr. med. D. Enayat Cardio-CT - Welche Untersuchungen sind möglich? Kalk-Score (Agatston-Score) = Gesamtlast der Kalkeinlagerung Koronarangiographie
Wie (un-)sicher ist die Computertomographie (Cardio-CT)? Dr. med. D. Enayat Cardio-CT - Welche Untersuchungen sind möglich? Kalk-Score (Agatston-Score) = Gesamtlast der Kalkeinlagerung Koronarangiographie
Schädel-Hirn-Trauma beim Kind
 Schädel-Hirn-Trauma beim Kind Erstversorgung Dr. med. A. Müller Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Regensburg Wo bleibt der Neurochirurg?... den brauche ich primär
Schädel-Hirn-Trauma beim Kind Erstversorgung Dr. med. A. Müller Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Regensburg Wo bleibt der Neurochirurg?... den brauche ich primär
Operativer Eingriff: Bridging
 Bridging STEFAN FRANTZ Operativer Eingriff: Bridging 1 Spezialfall: Was machen bei einem operativen Eingriff? Blutungsrisiko der Operation Schlaganfallsrisiko Was sind die Risikofaktoren für thrombembolische
Bridging STEFAN FRANTZ Operativer Eingriff: Bridging 1 Spezialfall: Was machen bei einem operativen Eingriff? Blutungsrisiko der Operation Schlaganfallsrisiko Was sind die Risikofaktoren für thrombembolische
Effektgrößen. Evidenz-basierte Medizin und Biostatistik, Prof. Andrea Berghold
 Effektgrößen 2x2Tafel Therapie Medikament 1 Medikament 2 Summe Misserfolg 450 = a 300 = c 750 = (a+c) Endpunkt Erfolg 550 = b 700 = d 1250 = (b+d) Vergleich von 2 Therapien; Endpunkt binär Summe 1000 =
Effektgrößen 2x2Tafel Therapie Medikament 1 Medikament 2 Summe Misserfolg 450 = a 300 = c 750 = (a+c) Endpunkt Erfolg 550 = b 700 = d 1250 = (b+d) Vergleich von 2 Therapien; Endpunkt binär Summe 1000 =
BAnz AT B4. Beschluss
 Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL): Anlage XII - Beschlüsse über die Nutzenbewertung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen nach 35a SGB
Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Arzneimittel-Richtlinie (AM-RL): Anlage XII - Beschlüsse über die Nutzenbewertung von Arzneimitteln mit neuen Wirkstoffen nach 35a SGB
Externe Qualitätssicherung in der Schlaganfallversorgung Baden-Württemberg. Zuordnung zum Modul 80/1 Schlaganfallversorgung gemäß ICD-Schlüssel
 Zuordnung zum Modul 80/1 Schlaganfallversorgung gemäß ICD-Schlüssel Es soll die relevante Entlassungs-/Verlegungsdiagnose (Haupt- oder Nebendiagnose) aus den Einschlussdiagnosen angegeben werden, die in
Zuordnung zum Modul 80/1 Schlaganfallversorgung gemäß ICD-Schlüssel Es soll die relevante Entlassungs-/Verlegungsdiagnose (Haupt- oder Nebendiagnose) aus den Einschlussdiagnosen angegeben werden, die in
Verletzungen von Gehirn und Wirbelsäule. Dr. C. Mohr - Oberarzt / Neuroradiologie
 Verletzungen von Gehirn und Wirbelsäule Dr. C. Mohr - Oberarzt / Neuroradiologie 26.06.14 Vorlesung ausgefallen wegen Klausurfragen entfallen Erkrankungen Schädel-Hirn-Traumata (SHT) Frakturen von Gesichts-
Verletzungen von Gehirn und Wirbelsäule Dr. C. Mohr - Oberarzt / Neuroradiologie 26.06.14 Vorlesung ausgefallen wegen Klausurfragen entfallen Erkrankungen Schädel-Hirn-Traumata (SHT) Frakturen von Gesichts-
Anlage 3.1: Auslösekriterien Datensatz Schlaganfall-Akutbehandlung (80/1)
 Anwenderinformation QS-Filter (nur Baden-Württemberg) Stand: 30. Juni 2012 (AQUA-Spezifikation 2013) Textdefinition Schlaganfall-Akutbehandlung (Baden-Württemberg) Algorithmus Algorithmus in Textform Eine
Anwenderinformation QS-Filter (nur Baden-Württemberg) Stand: 30. Juni 2012 (AQUA-Spezifikation 2013) Textdefinition Schlaganfall-Akutbehandlung (Baden-Württemberg) Algorithmus Algorithmus in Textform Eine
C-reaktives Protein (CRP)
 Ergebnisse aus EuCliD 3. Quartal 2014 C-reaktives Protein (CRP) 1 Das C-reaktive Protein ist das klassische Akut-Phase-Protein, das unter anderem zur Beurteilung des Schweregrades entzündlicher Prozesse
Ergebnisse aus EuCliD 3. Quartal 2014 C-reaktives Protein (CRP) 1 Das C-reaktive Protein ist das klassische Akut-Phase-Protein, das unter anderem zur Beurteilung des Schweregrades entzündlicher Prozesse
Nachgefragt! - Welche Perspektive haben Menschen nach einem schweren Schlaganfall?
 Nachgefragt! - Welche Perspektive haben Menschen nach einem schweren Schlaganfall? Ergebnisse einer Nachbefragung von Patienten ein Jahr nach der Frührehabilitation Die Neurologische Frührehabilitation
Nachgefragt! - Welche Perspektive haben Menschen nach einem schweren Schlaganfall? Ergebnisse einer Nachbefragung von Patienten ein Jahr nach der Frührehabilitation Die Neurologische Frührehabilitation
Erweiterung der Bauchschlagader. Die tickende Zeitbombe im Bauch?
 Erweiterung der Bauchschlagader = Die tickende Zeitbombe im Bauch? Dr. med. Anke Naumann, Oberärztin Abteilung Gefässchirurgie, Kantonsspital Aarau Aarau, 20.02.2013 Erweiterung der Bauchschlagader = Aortenaneurysma
Erweiterung der Bauchschlagader = Die tickende Zeitbombe im Bauch? Dr. med. Anke Naumann, Oberärztin Abteilung Gefässchirurgie, Kantonsspital Aarau Aarau, 20.02.2013 Erweiterung der Bauchschlagader = Aortenaneurysma
Max. Sauerstoffaufnahme im Altersgang
 Max. Sauerstoffaufnahme im Altersgang Motorische Hauptbeanspruchungsformen im Alter Anteil chronischer Erkrankungen an den Gesamtkosten in Abhängigkeit vom Alter AOK Bundesverband, Bonn, 2002 Prävalenz
Max. Sauerstoffaufnahme im Altersgang Motorische Hauptbeanspruchungsformen im Alter Anteil chronischer Erkrankungen an den Gesamtkosten in Abhängigkeit vom Alter AOK Bundesverband, Bonn, 2002 Prävalenz
S. Vogel, 2003: Ergebnisse nach ventraler Fusion bei zervikalen Bandscheibenvorfällen
 8 Vergleich von - und gruppe 8.1 Postoperative Symptomatik In beiden Patientengruppen hatte der Haupteil der Patienten unmittelbar postoperativ noch leichte ( 57,1%; 47,8% ). Postoperativ vollständig waren
8 Vergleich von - und gruppe 8.1 Postoperative Symptomatik In beiden Patientengruppen hatte der Haupteil der Patienten unmittelbar postoperativ noch leichte ( 57,1%; 47,8% ). Postoperativ vollständig waren
Unverändert höheres Risikoprofil von Frauen in der Sekundärprävention der KHK Sechs-Jahres-Verlauf an Patienten
 Deutsche Gesellschaft für Kardiologie Herz- und Kreislaufforschung e.v. (DGK) Achenbachstr. 43, 40237 Düsseldorf Geschäftsstelle: Tel: 0211 6006920 Fax: 0211 60069267 mail : info@dgk.org Pressestelle:
Deutsche Gesellschaft für Kardiologie Herz- und Kreislaufforschung e.v. (DGK) Achenbachstr. 43, 40237 Düsseldorf Geschäftsstelle: Tel: 0211 6006920 Fax: 0211 60069267 mail : info@dgk.org Pressestelle:
Gastrointestinale Blutungen Bildgebung Peter Heiss
 Institut für Röntgendiagnostik Gastrointestinale Blutungen Bildgebung Peter Heiss 2 Gastrointestinale Blutungen: Bildgebung Indikationen für die Bildgebung (Angiographie, CT, MRT): 1) Major-Blutung oder
Institut für Röntgendiagnostik Gastrointestinale Blutungen Bildgebung Peter Heiss 2 Gastrointestinale Blutungen: Bildgebung Indikationen für die Bildgebung (Angiographie, CT, MRT): 1) Major-Blutung oder
Qualitätsindikatoren für die stationäre Behandlung des akuten Schlaganfalls in Hamburg. Beschreibung der patientenbezogenen Qualitätsindikatoren
 Fachgremium Externe Qualitätssicherung in der Schlaganfallversorgung () Hamburg Qualitätsindikatoren für die stationäre Behandlung des akuten Schlaganfalls in Hamburg Beschreibung der patientenbezogenen
Fachgremium Externe Qualitätssicherung in der Schlaganfallversorgung () Hamburg Qualitätsindikatoren für die stationäre Behandlung des akuten Schlaganfalls in Hamburg Beschreibung der patientenbezogenen
Dossierbewertung A16-10 Version 1.0 Ramucirumab (Kolorektalkarzinom)
 2 Nutzenbewertung 2.1 Kurzfassung der Nutzenbewertung Hintergrund Der G-BA hat das IQWiG mit der Nutzenbewertung des Wirkstoffs Ramucirumab gemäß 35a SGB V beauftragt. Die Bewertung erfolgte auf Basis
2 Nutzenbewertung 2.1 Kurzfassung der Nutzenbewertung Hintergrund Der G-BA hat das IQWiG mit der Nutzenbewertung des Wirkstoffs Ramucirumab gemäß 35a SGB V beauftragt. Die Bewertung erfolgte auf Basis
