Wir machen Bio königlich! Titelthema: Futter. Hoch lebe Eva I. Erste Bayerische Bio-Königin gekrönt. Ohne Kraftfutter: Die Lösung in der Milchkrise?
|
|
|
- Lukas Beltz
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 August 2016 Wir machen Bio königlich! Hoch lebe Eva I. Erste Bayerische Bio-Königin gekrönt. Ohne Kraftfutter: Die Lösung in der Milchkrise? Titelthema: Futter Das Beste vom Grünen So bekommt man gutes Grundfutter.
2 Liebe Leserinnen und Leser, wir als Verband haben uns den Claim Wir machen Bio lebendig auf die Fahne geschrieben. Bio darf Spaß machen, kreativ sein, befreien und verbinden. Im Juli haben die vier großen Bio-Verbände die erste Bayerische Bio-Königin gekrönt. Sie soll eine Schnittstelle zwischen Verbrauchern und Lebensmittelerzeugern bilden. Denn wo und wie unser Essen erzeugt wird davon haben viele von uns nur eine vage Ahnung. Die meisten Menschen leben in Städten und Siedlungen, fernab von der Landwirtschaft. Verarbeitet werden die Rohstoffe in vor uns verschlossenen Werkstätten und Fabriken. Es sind oft zwei Welten die der Lebensmittelerzeuger und die der Verbraucher. Und doch brauchen sie sich gegenseitig, sind aufeinander angewiesen. -3- Bio ist für viele abstrakt, rational, argumentativ geprägt. Die Bio-Königin dagegen kann man ansehen, hören, ansprechen. Und doch soll sie nicht nur schön sein, lächeln und posieren. Als Personifizierung der Bio-Branche soll sie Substanz und Inhalt haben. Dementsprechend wurde ihre Ausstattung ausgewählt: ressourcenschonend, ökologisch, fair. Und dementsprechend wurde sie ausgewählt: eine junge Frau, die aus vollstem Herzen für den Ökolandbau und die ökologische Verarbeitung von Lebensmitteln sprechen kann. Mit der Bio-Königin machen wir Bio nicht nur königlich, sondern ein Stück weit lebendig. Die Krönung im Milchhäusl war ein kleiner Anfang. Sie hat Menschen im Geiste von Bio zusammengeführt, hat gute Laune, Spontanität und Humor herausgefordert. Es hat Spaß gemacht. Es hat geschmeckt. Es war gemütlich. Auch so kann Bio locken. Futter für die Medien liefern wir mit der Bio-Königin, mit Futter für die Tiere beschäftigen wir uns im aktuellen Titelthema. Wer frisst was? Woher kommt es? Und was macht Öko-Futter aus? Antworten finden Sie im aktuellen Heft. Eure
3 bionachrichten Inhalt bionachrichten Inhalt INFO TITEL BIOWELT BIOKREIS FUTTER Biokreis-Produkt 20 Futter-Facts 34 Das Tischgespräch: 40 Landwirte fragen, Berater antworten Das Wegwerfen von Lebensmitteln 07 Das ist der Biokreis 24 Das Beste vom Grünen Bio-Futter gut aufbereitet. kann ich nicht ertragen. Eva I., Bayerische 42 Berg und Tal auf dem Acker Dammanbau nach Turiel. 08 Termine Bio-Königin, im Interview. 10 Notizen 12 Agrarpolitik Ohne Kraftfutter die Lösung in der Milchkrise? 26 Futter für Stall und Acker Zwischenfruchtanbau für Gründüngung und Tiernahrung. 28 Der richtige Mix für jedes Tier In der Futtermühle Wiesbauer wird Mischfutter produziert. 36 Reise: Auf den Spuren der langen weißen Wolke In Neuseeland leben rund vier Millionen Menschen und fünf Millionen Milchkühe. 46 Wir machen Bio königlich: Hoch lebe die erste Bayerische Bio-Königin Eva I. 51 Aktuelles 59 Ihre Biokreis-Ansprechpartner 15 Weniger, aber bessere Milch! 16 Dresdner Erklärung der Öko-Erzeugerverbände Prozent Bio? Eiweiß- und Aminosäurenversorgung in der ökologischen Tierhaltung. 32 Beim Biokreis zugelassene Futtermittelhersteller 38 Nachhaltig leben: Zero Waste. Weniger Müll ist das neue Grün. Shia Su produziert kaum Müll. 60 Marktplatz 66 Personalien 67 Rätsel / Verlosung 70 Bücher / Vorschau / Impressum Bild Milch: Pezibear; pixabay Bild Sonnenblume: thomashendele, pixabay Bild Tasse: condesign; pixabay Bild Neuseeland: Wolrab
4 Produkt Produktbeschreibung Feinfruchtige Aromen mit Anklängen von Birne und Quitte, kräutrig-würzige Geschmackskomponenten, eingebunden in einer ausgewogenen Fruchtsäurestruktur. Ein Silvaner mit Finesse und Aussagekraft. Ideale Trinktemperatur: 8-12 C Bild: Ellen Huenting Wir bilden seit 1979 ein Netzwerk aus 1110 Landwirten, 130 Verarbeitern und 200 Verbrauchern und gestalten gemeinsam kreativ und konsequent ökologischen Landbau. Wir machen keine halben Sachen. Unsere landwirtschaftlichen Betriebe wirtschaften bundesweit nach unseren Richtlinien. Und diese entsprechen einer ganzheitlichen Vorstellung von Ökolandbau. Die EU-Richtlinien sind nur ein Mindeststandard und uns zu wenig. Unsere Landwirte stellen zum Beispiel ihren gesamten Betrieb auf Bio um. Wir kümmern uns in besonderem Maße um das Wohl unserer Tiere. Unser Gemüse darf auf der Erde wachsen. Und unsere Lebensmittel enthalten weniger Zusatzstoffe und stammen größtenteils aus handwerklicher Verarbeitung. Wir sind gleich um die Ecke. Unsere Landwirte und Verarbeiter arbeiten in überschaubaren Regionen zusammen. Unsere Wege sind kurz, unsere Beziehungen verlässlich, unsere Wertschöpfung bleibt in der Region, stiftet Arbeitsplätze und Identität. Die meisten unserer Mitglieder leben und arbeiten in Bayern, Nordrhein-Westfalen und in der Mitte Deutschlands. Wir lassen uns Freiraum. Unsere Richtlinien sind verbindlich. Innerhalb dieses Rahmens haben unsere Landwirte die Freiheit, die ihr Berufsstand seit jeher beansprucht. Sie können ihre Betriebsmittel frei beziehen und ihre Produkte frei vermarkten, ohne Vermarktungsgebühren zu entrichten. Wir kennen uns. Jeder Betrieb hat seinen Berater. Die Sprecher der Landwirte unterstützen die Arbeit vor Ort. Und bei Workshops, Betriebsbesuchen, Veranstaltungen und Exkursionen kommen wir zusammen. Wir sind basisdemokratisch. Auf unseren Mitgliederversammlungen kann sich jeder einbringen. Wir fallen auf. Unsere Menschen, unsere Werte, unsere Arbeit und was in der Öko-Branche sonst los ist, veröffentlichen wir sechs Mal im Jahr in unserer Verbandszeitung bionachrichten. Wir präsentieren uns im Internet ( durch unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, auf Messen und mit unseren Verpackungsmaterialien. Wir mischen mit. Denn wir leisten politische Arbeit. Wir sind Mitglied in den Landesvereinigungen für den ökologischen Landbau in Bayern, Nordrhein Westfalen und Hessen, im Bund ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) und in der Internationalen Vereinigung der ökologischen Landbaubewegungen (IFOAM). Wir setzen uns sowohl auf Landes-, Bundes- als auch auf internationaler Ebene für die Weiterentwicklung des ökologischen Landbaus ein und sind hier als kompetenter Ansprechpartner gefragt. Wir denken quer. Die Gründer unseres Verbandes waren Pioniere. Sie haben sich verbündet, um gemeinsam als Verbraucher für die ökologische Landwirtschaft einzutreten. Neue Ideen sind seit jeher fundamental für unsere Arbeit. Wir haben die Richtlinien für Wald, Hotel/Gastronomie und Tiernahrung sowie das Siegel regional und fair ins Leben gerufen und sind Vorreiter mit dem Projekt 100% Bio-Leder.
5 22. September 2016, 14 bis 17 Uhr Lehrerfortbildung Ökologischer Landbau im Fokus Hofrundgang, Produktkontrolle, Vortrag mit Diskussion, Vorstellung von Unterrichtsmaterialien Ort: Biokreis-Hof Stefan Alterauge, Am Schützenplatz 15, Wenden -8- Veranstaltungen und Termine Biokreis in Bayern Tierschauen in NRW 9. August 2016, 19 Uhr Workshop: Thema Nachsaat von Luzerne praktische Vorführung und Gespräch mit Mark Dietrich von der Becker-Schoell AG Ort: Betrieb Johannes Hirzinger, Rankham 6, Bad Endorf Infos: Ansprechpartner ist Biokreis-Berater Sepp Forstner, Tel.: / , Mobil: 0171/ , forstner@biokreis.de 17. August 2016, Uhr Workshop: Thema Kälberfütterung, Vorstellung der Joghurttränke, Gespräch zur Kälbergesundheit mit Tierarzt Dr. Joachim Berchthold Ort: Betrieb Forstner Gbr., Rankham 3, Bad Endorf Infos: Ansprechpartner ist Biokreis-Berater Sepp Forstner, Tel.: / , Mobil: 0171/ , forstner@biokreis.de 29. September 2016, 13 Uhr Workshop: Thema Kurzrasenweide und andere Weidesysteme - Weidebegehung auf dem Betrieb Berchtold und weitere Berichte von Landwirten zum Thema Weide Ort: Betrieb Franz Berchtold, Kaltbronner Straße 19, Maria-Steinbach Infos: Um Anmeldung wird gebeten bei Biokreis-Berater David Hierenbach, Mobil: 0157/ , hierenbach@biokreis.de 16. August 2016, ab 7.45 Uhr Tierschau Wenden, bei der Wendschen Kärmetze Ort: Rathausvorplatz, Wenden 28. August 2016 Tierschau Reiste, beim Reister Markt Ort: Marktweg, Eslohe 12. September 2016 Tierschau Hüsten, bei der Hüstener Kirmes Ort: rund um die St. Petri Kirche, Kirchplatz 2, Arnsberg-Hüsten 25. September 2016, 10 bis 17 Uhr Tierschau Bergisch Gladbach, beim Tag der Landwirtschaft Ort: Reitanlage Hebborner Hof, Hebborner Hof 1, Bergisch Gladbach 17. bis 25. September 2016 BAYERISCHES ZENTRALLANDWIRTSCHAFTSFEST Ort: München, zeitgleich zum Oktoberfest auf der Theresienwiese Am 23. September findet im ZLF-Festzelt der Tag des Ökolandbaus statt 19. und 20. Oktober 2016 Biokreis-Verarbeitertag Ort: Dennree, Töpen bei Hof (Saale) Infos: ->Termine. Ansprechpartnerin ist Dorothee Ahlers, ahlers@biokreis.de, 0851/ November 2016 Biokreis-Imkertag: Bio-Imkerei. Grundlagen und Praxis. Ort: Tiergarten Nürnberg Infos: ->Termine. Ansprechpartnerin ist Dorothee Ahlers, ahlers@biokreis.de, 0851/ Bayerische Öko-Erlebnistage Vom 3. September bis 3. Oktober 2016 finden bayernweit wieder zahlreiche Veranstaltungen rund um den ökologischen Landbau und ökologisch erzeugte Produkte statt. Auch viele Biokreis-Betriebe öffnen ihre Hoftore für die bayerischen Öko-Erlebnistage. Nähere Informationen zu den Biokreis- Veranstaltungen finden Sie unter www. biokreis.de > Termine, eine Übersicht aller Veranstaltungen der bayerischen Öko-Erlebnistage unter September Kochkurs und Bio-Grill-Event Ort: Metzgerei Meyer, Nürnberg 11. September Hoffest auf Landgut Schloss Hemhofen - Stall-, Wald- und Felderführungen, Markttreiben, Theater, Oldtimer-Schlepper-Parade, tolles Kinderprogramm, leckeres Essen/ Trinken, Schloßbesichtigungen Ort: Landgut Schloss Hemhofen, Hemhofen 16. September Kochkurs: Kulinarische Urlaubserinnerung mit der Ökokiste Kößnach Ort: Regensburg 24. September Wagners Bio-Hausmesse Produktvorstellung regionaler Bio-Hersteller, Informationen über den ökologischen Landbau Ort: Bio-Bäckerei Wagner, Ruderting 24. September Erntedankfest Erntedankgottesdienst, Präsentation regionaler Bio-Produkte, Hofführungen Ort: Müßighof, Absberg 24. September Cowboy-Bio-Tag macht Spaß Ranchworking mit Kaffee und Kuchen, Workshops, Auerochsen-Burger vom Grill, Nachspeisen, Lagerfeuer und countryabend Ort: Biohof Mittelmühle (Kronester), Fladungen 25. September Erntedank bei den Bienenhütern Schnupper-Imkern, Führungen durch die Bio-Imkerei, Stockbrot backen für Kinder, Kerzen drehen, Kürbis- und Kartoffelsuppe und Apfelstrudel Ort: Bio-Imkerei Die Bienenhüter, Nürnberg 1. Oktober Herrmannsdorfer Landwerkstätten auf der Bio-Meile Markstände mit biologischen und regionalen Lebensmitteln, Raclette, Grillwürstl und Bier. Vorträge, Kinder-Gewinnspiel Ort: Elisabethmarkt, München 2. Oktober Erntedankfest Führungen durch Bio-Landwirtschaft und Gärtnerei,Kinderprogramm mit Riesenstrohburg, Kutschfahrten, Basteln und Kettenkarussell, köstliche Bio-Schmankerl im Biergarten umrahmt von Blasmusik, Kunsthandwerksausstellung Ort: Herrmannsdorfer Landwerkstätten, Glonn 8. Oktober Betriebsbesichtigung Metzgerei Kammermeier Ort: Metzgerei Kammermeier, Hauzenberg 9. Oktober Herbstfest: Was kommt hinten raus? Spannendes rund um Losung, Kot und Dung und eine Landmaschinenausstellung Ort: Tiergarten Nürnberg Aktionstage Ökolandbau NRW Vom 27. August bis zum 11. September 2016 öffnen Bio-Bauernhöfe in ganz NRW ihre Hoftore für interessierte Besucherinnen und Besucher. Drei Mitgliedsbetriebe des Biokreis bieten eigene Veranstaltungen im Rahmen der Öko-Aktionstage an. Zudem ist der Biokreis bei der Auftaktveranstaltung der Öko-Aktionstage in Warstein vertreten. Nähere Informationen zu den Biokreis-Veranstaltungen finden Sie unter eine Übersicht aller Veranstaltungen der Aktionstage Ökolandbau NRW unter: August 2016 Auftaktveranstaltung der Öko-Aktionstage mit großem Hoffest, mit Info- Ständen aller Bioverbände Ort: Naturlandbetrieb Gutshof Warstein, Lindenstraße 9-13, Warstein 28. August 2016, 11 bis 17 Uhr Hoffest unter dem Motto Gib dem Horn eine Chance Hofführungen, Informationen, kleiner Markt, kulinarische Köstlichkeiten Ort: Biokreis-Hof Klosterhof Bünghausen, Hömelstr. 12, Gummersbach 11. September 2016, 11 bis 17 Uhr Offene Stalltür auf dem Biokreis-Hof von Frank und Elke Ohrndorf Besuch bei Legehennen, Masthähnchen und Mutterkühen, Verkauf regionaler Produkte, Imbiss und Getränke Ort: Biokreis-Hof Ohrndorf, Bühler Straße 280, Freudenberg-Bühl
6 Notizen Biokreis auf Regionalmessen Der Biokreis präsentiert sich am auf der BioSÜD in Halle 5 dem süddeutschen Bio-Fachhandel mit folgenden Ausstellern: Antersdorfer Mühle GmbH & Co Vertriebs KG, Apfelparadies Winklhof, Innstolz Käsewerk Roiner KG, Chiemgauer Naturfleisch GmbH, Die Biohennen AG, Freiland Puten Fahrenzhausen GmbH, Herrmannsdorfer Landwerkstätten Glonn Gmbh & Co KG, Hofbäckerei Gottschaller, Hofmark Brauerei KG, Landkäserei Herzog e.k., Marx GmbH (Bio-Weihnachtsbäume), Mostelleria Edeldestillerie Farthofer, Ökost, Dr. Hannah Winkler von Mohrenfels und Weingut Lehner. Auf der BioNORD am in Hannover wird der Biokreis in Halle 4 mit folgenden Mitgliedern vertreten sein: Antersdorfer Mühle GmbH & Co Vertriebs KG, Chiemgauer Naturfleisch GmbH, Freiland Puten Fahrenzhausen GmbH, Landkäserei Herzog e.k., Thalhammer Georg e.k. Gesundes von Feld und Wald und Weingut Lehner. red Barbara Scheitz ist Unternehmerin des Jahres 2015 Als Unternehmerin des Jahres 2015 hat der Kreisverband Starnberg der Mittelstands-Union Barbara Scheitz ausgezeichnet. Der Laudator Dr. Marcel Huber, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Sonderaufgaben, betonte in seiner Rede: Sie sind eine Bilderbuchunternehmerin. Sie bringen Fortschritt und Tradition zusammen. Sie haben nicht nur Leidenschaft für Ihre Produkte, sondern kümmern sich auch um das Wohl der Menschen und Tiere. Mit dieser Auszeichnung würdigt die Mittelstands- Union die unternehmerische Leistung der Geschäftsführerin der Andechser Molkerei Scheitz, die das Familienunternehmen zu Europas größter Biomolkerei ausgebaut hat. Die Andechser Molkerei, Mitglied im Biokreis, verarbeitet mit ihren 200 Mitarbeitern jährlich knapp 100 Millionen Liter Bio-Kuhmilch und mehr als neun Millionen Liter Bio-Ziegenmilch, die Bio-Bauern aus dem Alpenvorland an das Unternehmen liefern. red Dr. Ute Eiling-Hütig, Landtagsabgeordnete, Barbara Scheitz, Geschäftsführerin Andechser Molkerei Scheitz GmbH, Manfred Herz, Kreisvorsitzender der MU, und Dr. Marcel Huber, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Sonderaufgaben. Bild: Andechser -10- Lecker aufs Land Biokreis-Bäuerin Carmen Mack kocht im Fernsehen Wer kocht das beste Landmenü? Sechs Landfrauen aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg entdecken neue Regionen und Menschen, erfahren viel Überraschendes und Wissenswertes über die Höfe und Weingüter der anderen und treten gegeneinander an. Jede Woche serviert eine der Frauen den anderen Damen ein köstliches Drei-Gänge-Menü auf ihrem Hof. Die Gäste zücken dabei nach jedem Gang den Stift und vergeben Punkte. Am 24. August um Uhr zeigt Biokreis-Landwirtin Carmen Mack aus Hohenlohe im SWR Fernsehen ihr Können in der Küche. Die Reihe startet am 3. August und wird immer mittwochs ausgestrahlt. red Deutsche Landwirtschaft fachlich top Der Bio-Markt wächst weiter Deutschland ist der mit Abstand größte Bio-Markt in Europa gaben die Verbraucher für Bio- Lebensmittel und Getränke gut 8,6 Mrd. Euro aus. Darüber hinaus wächst dieser Markt schon seit Jahren nahezu ununterbrochen, daran scheint sich auch 2016 nichts geändert zu haben. In den ersten vier Monaten dieses Jahres sind die Verbraucherausgaben für Bio-Frischwaren wie Fleisch, Wurst, Käse, Eier und Brot, aber auch Obst und Gemüse um gut 11 Prozent gestiegen. Diese Warengruppen machen rund 60 Prozent der gesamten Ausgaben für Bio-Lebensmittel und Getränke aus. Die Ausgabensteigerung war zu einem gewissen Teil zwar auch preisbedingt, den größeren Einfluss hatten aber die gestiegenen Einkaufsmengen. AMI -11- Die deutsche Landwirtschaft hat den höchsten Ausbildungs- und Wissensstand ihrer Geschichte erreicht. Nie gab es mehr Studierende in den Fächern Agrarwissenschaften und Agrarökonomie. Nach einer aktuellen Auswertung ist die Zahl der selbstständigen Landwirte mit Abitur im Zeitraum von 2010 bis 2015 von circa auf etwa gestiegen. Die Zahl der Landwirte mit Studium vervierfachte sich sogar von circa auf ungefähr Damit liegt der Anteil der Akademiker unter den selbstständigen Landwirten bei über 10 Prozent. Das zeigt eine aktuelle Studie von Statista Research im Auftrag des Forums Moderne Landwirtschaft. FORUM USA beenden Kükentöten bis 2020 Neuer Bodenfruchtbarkeitsfonds unterstützt Bio-Bauern beim Bodenschutz Fruchtbarer Boden ist die Grundlage allen Lebens und dennoch bekommt er nicht die Aufmerksamkeit, die er verdient. Das will die Stiftung TRIGON mit ihrem Bodenfruchtbarkeitsfonds ändern. Der Fonds unterstützt Bio-Bauern aktiv bei ihren Maßnahmen für den Bodenschutz. Ziel ist es, so nicht nur Boden gutzumachen und aktiven Klimaschutz zu betreiben, sondern auch ein neues Bewusstsein für dessen Bedeutung in der Gesellschaft zu schaffen. Interessierte Bio-Bauern, deren Betrieb im Großraum Bodensee liegt, können sich ab sofort als Partnerhof für die Pilotphase des Bodenfruchtbarkeitsfonds bewerben: red Der größte Verband der Eier produzierenden Industrie in den USA, United Egg Producers (vergleichbar mit dem Bundesverband Deutsches Ei), kündigt an, das Schreddern von männlichen Küken beenden zu wollen. Statt die für die Industrie wertlosen Küken nach dem Schlupf zu töten, solle die Geschlechtsbestimmung künftig bereits im Ei erfolgen. Bis 2020 solle die gesamte Industrie auf das neue Verfahren umgestellt werden. Die Methode der Geschlechtsbestimmung im Ei mit anschließender Vernichtung der Eier lehnt zum Beispiel die Stiftung VIER PFOTEN als Alternative ab, da Hühner-Embryonen bereits ab dem zehnten Tag Schmerzen empfinden können. Außerdem bedeute diese Methode keinen Ausstieg aus der einseitigen Zucht hin auf die Legeleistung. Stattdessen solle vermehrt auf eine nachhaltige Hühnerzucht und die Etablierung von Zweinutzungshühnern gesetzt werden. Vier Pfoten 25 Jahre LACON Das Prüfinstitut LACON feiert heuer sein 25-jähriges Bestehen. Auch Biokreis-Geschäftsführer Sepp Brunnbauer reiste nach Offenburg, um zu gratulieren. Seit 25 Jahren verbindet LACON und den Biokreis eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit, sagt Sepp Brunnbauer. Vor dem Büro der Hauptgeschäftsstelle pflanzten die Geschäftsführer Dr. H.-Joachim Kopp und Alexandra Kopp anlässlich des Jubiläums einen Baum. Die LACON GmbH bietet mit ihren Standorten in Deutschland, Österreich, Südosteuropa und auch weltweit wichtige Zertifizierungen für die Agrar- und Ernährungswirtschaft an. Vom Saatgut oder Futtermittel bis zur Abgabe an den Verbraucher reicht die Lebensmittelkette, die auf dem Prüfstand steht. red
7 INFO Agrarpolitik Ohne Kraftfutter die Lösung in der Milchkrise? Bild: oekomodellregionen.bayern.de BZA / Foto: Max Kratzer Vorschlag: Bayerisches Kulturlandschaftsprogramm Teil A (Kulap-A) Gesamtbetriebliche Maßnahmen Milcherzeugung mit wiederkäuergemäßer Fütterung Für die ersten 30 Großvieheinheiten (GVE) pro GVE: 210,- für jede weitere gehaltene GVE: 105,- Auflagen: Fütterung ausschließlich mit heimischen, gentechnikfreien Futtermitteln Verfütterung von Mais ist ausgeschlossen Verfütterung von Kraftfutter ist auf 1 kg pro Tier und Tag zu begrenzen die abgelieferte Milchmenge darf gegenüber dem durchschnittlichen betriebseigenen Milchkontingent in den Jahren 2014/15 nicht erhöht sein Milcherzeugung ohne Kraftfutter ist wirtschaftlich! Dass eine kraftfutterarme Wirtschaftsweise für Milchviehbetriebe wirtschaftlich tragfähig und krisenfest ist, zeigt eine Studie von Dr. Karin Jürgens und Professor Onno Poppinga (bionachrichten April 2016, auch unter Appell für ein KULAP-Programm Milcherzeugung mit wiederkäuergemäßer Fütterung. Von Andreas Remmelberger Der Autor Andreas Remmelberger ist Biokreis-Landwirt, Träger der bayerischen Staatsmedaille für Landwirtschaft und engagiert sich politisch in verschiedenen Organisationen. Über viele Jahrtausende haben die Bauern ihre Milchkühe nur mit Gras, Klee und Kräutern gefüttert. An diese Futtermittel ist der Verdauungstrakt der Wiederkäuer optimal angepasst. Die Kuh ist das wunderbare Lebewesen, das aus für den Menschen nicht verzehrbaren Pflanzen eine hochwertige Lebensmittelgrundlage produzieren kann. Seit wenigen Jahrzehnten steigt nun der Einsatz von Mais und Kraftfutter und damit einhergehend die Milchmenge pro Kuh. Die Fütterung beeinflusst auch die Inhaltsstoffe der Milch. Tatsächlich belegen mittlerweile viele Studien, dass Kühe, die nur Gras, Klee und Kräuter fressen, eine andere Milch geben als die, deren Futter zu großen Teilen aus Mais und Kraftfutter besteht. Vor allem die Fettsäureverteilung ist verändert. So führt Grünfutter zu einem höheren Anteil an gesundheitsfördernden Omega-3-Fettsäuren, während schon geringe Mais- und Kraftfutteranteile die Gehalte deutlich senken. Mit einer Fütterung von Gras, Klee und Kräutern können Omega-3-Fettsäuren in der Größenordnung von 1,5 g pro 100 g Milchfett erreicht werden das ist doppelt bis drei Mal so viel wie üblicherweise in konventioneller Milch steckt. Wir Milchbauern benötigen von der Politik keine neuen staatlichen Marktregulierungen und vor allem keine finanziellen Almosen in Form von Liquiditätshilfen, Bürgschaften oder Steuergeschenken. Wir Milchbauern benötigen dringend ein neues KULAP-Programm Milcherzeugung mit wiederkäuergemäßer Fütterung. Allein durch die um 30 Prozent niedrigere Milchmenge bei Grünland-Milch ohne Mais und Kraftfutter könnte bei einer Teilnahme von 15 Prozent der Milchbauern die Milcherzeugung insgesamt um rund 4,5 Prozent gesenkt werden. Durchschnittliche Milcherzeugung = 7000 kg/kuh Ohne Mais und Kraftfutter = 4900 kg/kuh ergibt eine Senkung der Milchmenge von 2100 kg/kuh = 30 Prozent Der BDM verlangt eine Förderung von 30 Cent je kg Milch, die nicht produziert werden. Dies kommt jedoch nur den aufgebenden Betrieben zu Gute. Die anderen werden umso mehr produzieren. Statt das Aufgeben zu unterstützen, sollten wir durch die Förderung einer wiederkäuergemäßen Fütterung die aktiven Milchbauern unterstützen. Eine Milch- und Fleischproduktion mit vorwiegend proteinhaltigem Grundfutter (Gras, Heu, Silage) erhält die Landschaft und ist in keiner Weise klimaschädlich. Sie trägt über die Nutzung des Grünlandes und den Humusaufbau sogar zur CO² Senkung bei. Kontrolle: Die Einhaltung der Auflagen wird über die pro GVE zur Verfügung stehende Futterfläche sowie den Omega-3-Gehalt oder den CLA- Gehalt in der Milch kontrolliert. Dazu sollte die Milch bei den monatlichen Milchproben, die zum Beispiel von der Muva in Kempten durchgeführt werden, mindestens einen Gehalt von 1,2 g/100 g Fett bei Omega 3 oder 1,2 g/100 g Fett bei den CLA aufweisen. Bei einer Milchleistung über 6000 Liter muss vom Betrieb eine detaillierte Berechnung der Futterration mit Analysen des Futters vorgelegt werden. Vorteile: Proteinversorgung der Rinder, Schafe und Ziegen durch heimische Futtermittel Ausweitung der Milch- und Fleischerzeugung wird begrenzt Beitrag zum Klimaschutz durch die Verfütterung von Grünlandprodukten Beitrag zur Tiergesundheit durch artgerechte Fütterung der Wiederkäuer Versorgung der Bevölkerung mit den lebensnotwendigen Omega-3-Fettsäuren Vermeidung der Zunahme des Maisanbaus, durch den es verstärkt zu Krankheiten und Schädlingsbefall (Fusarien, Maiszünsler, Maiswurzelbohrer) kommt; der Verzicht vieler Milch- und Fleischerzeuger auf Maisfütterung kann den Krankheits- und Schädlingsdruck insgesamt vermindern höhere Wertschöpfung durch die Vermarktung von Milch und Fleisch als Erzeugnis mit gesundheitsförderndem Zusatznutzen ( functional food ) Kennzeichnung auf Produkten Biokreis-Landwirt Andreas Remmelberger: Wir Milchbauern brauchen dringend eine staatlich festgelegte produktionsbezogene Kennzeichnung für Milch und Milcherzeugnisse, die ausschließlich mit artgerechten Futtermitteln vom eigenen Hof erzeugt werden. Durch eine produktionsbezogene Kennzeichnung wie bei den Eiern könnten die Verbraucher selbst entscheiden, wie die Milch produziert wird, die bei ihnen auf den Tisch kommt. Für eine Milch, die nachweislich Kinder besser vor Allergien und Asthma schützt, wären sicher 10 bis 20 Prozent der Verbraucher bereit, einen höheren Preis zu bezahlen. Bild: LubosHouska; pixabay
8 INFO Agrarpolitik Agrarpolitik INFO Weniger, aber bessere Milch! Verhältnis von Omega 3 zu Omega 6 1 : 2 Kommentar von Sepp Brunnbauer entzündungshemmend besserer Schutz vor Asthma, Allergien, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Depressionen fördert die Lernfähigkeit und die Intelligenz artgerechte Fütterung hat Vorteile für Gesundheit und Langlebigkeit der Kühe bereichert das Landschaftsbild und die Artenvielfalt schützt vor Überproduktion und Preisverfall bringt höhere Gewinne für Milchviehhalter Milch aus Gras, Klee und Kräutern Verhältnis von Omega 3 zu Omega 6 1 : 5 entzündungsfördernd führt zu mehr Asthma, Allergien, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Depressionen behindert die Lernfähigkeit und die Intelligenz nicht artgerechte Fütterung schadet der Gesundheit und Langlebigkeit der Kühe beeinträchtigt das Landschaftsbild und die Artenvielfalt Ursache für Überproduktion und Preisverfall bringt hohe Verluste für Milchviehhalter Quellen und mehr Infos: Bild: Timo Klostermeier; pixelio Milch aus Mais und Kraftfutter Ich selbst trinke keine Milch. Sieht man von der Kaffeemilch oder der Milch in meinem Müsli ab, könnte man sagen, dass ich zu den Menschen gehöre, die relativ wenig Milch brauchen. Auch wenn die Milch billiger oder gar umsonst wäre, würde ich nicht wesentlich mehr Milch trinken. Anders wäre das beim Bier. Wenn Bier billig angeboten wird oder wenn es Freibier gibt, wird unter Umständen auch mal eins mehr getrunken als üblich und das nicht nur von mir. Der Unterschied zwischen Bier und Milch liegt damit auf der Hand. Bier ist relativ preiselastisch, was bedeutet, dass mit einem Rückgang des Preises die Nachfrage schon mal steigt. Milch hingegen ist relativ preisunelastisch, mit dem Ergebnis, dass die Nachfrage nach Milch relativ gleich bleibt, auch wenn sich der Preis für Milch ändert. Zusammengefasst: Bei einer Steigerung der Milchmenge fällt der Preis für Milch überproportional, weil sich der Milchkonsum nicht wesentlich ändert. Selbst wenn man die Milch am Ladentisch verschenken würde sieht man von Hamsterreaktionen der Verbraucher einmal ab würde der Verbrauch relativ gesehen gleich bleiben. Mit Abschaffung der Milchquote wurde dem Weltmarkt ein wesentliches Instrument geopfert, das in der Vergangenheit den Milchpreis einigermaßen stabil gehalten hat. Im Nachgang zur Abschaffung wurden größere Ställe gebaut, noch mehr Kühe eingestallt und mehr Milch denn je aus jeder Kuh gemolken. Die Folge ist, dass mehr Milch auf dem Markt vorhanden ist als getrunken wird. Der Milchpreis verfällt. Der Landwirt reagiert auf den drohenden Einkommensverlust und produziert noch mehr Milch. In der Betriebswirtschaft wird deshalb der Landwirt gerne auch als Mengenanpasser bezeichnet. Die Menge anzupassen ist ein Verfahren, das natürlich nur so lange funktioniert, bis Grenzkosten gleich Grenznutzen und damit der Grenzgewinn gleich Null ist. Im Fall der konventionellen Milcherzeugung ist das schon lange erreicht. Wenn die Produktionskosten bei etwa 35 Cent liegen, deckt der Auszahlungspreis derzeit gerade mal die Hälfte der Produktionskosten. Diese Phase überstehen derzeit nur die Betriebe, die ohne Fremdarbeitskräfte arbeiten, keinen Kapitaldienst zu leisten haben und/oder deren Gebäude abgeschrieben sind. Sie zehren zwar von der Substanz, überstehen aber die Durststrecke am ehesten und hoffen auf bessere Zeiten. Andere sind gezwungen aufzugeben, was mittelfristig die Milchmenge reduziert und diejenigen hoffen lässt, die diese Phase überstanden haben. Die Preise steigen wieder, der Zyklus beginnt von vorne. Dieses Auf und Ab kannten wir bisher nur in der Schweineproduktion. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Milchviehhalter nicht so flexibel reagieren kann wie sein Kollege in der Schweinemast und damit die strukturellen Auswirkungen und Schäden in der Milchproduktion ungleich härter ausfallen werden. Milchbetriebe können ihre Ställe eben nicht mal kurz leer stehen lassen, um bei besseren Zeiten wieder anzufangen. Ein Milchviehbetrieb, der aufhört, ist ein landwirtschaftlicher Betrieb weniger, denn er fängt die Milchviehhaltung nicht mehr an. Überlassen wir diesen Prozess den Prinzipien der Marktwirtschaft, wird der anstehende Strukturwandel erdrutschartig sein. Das Herzstück der Landwirtschaft wird in Frage gestellt. Kulturlandschaften werden sich radikal verändern. Diesen Prozess zu stoppen, ist Aufgabe der Politik. Geeignete Maßnahmen müssen ergriffen werden, um die Milchmenge nachhaltig zu reduzieren. Ein Milchextensivierungsprogramm, das eine Reduzierung von Kraftfutter honoriert, wäre eine Lösung. Heu-Milch, Weidegang, Grundfütterung und die Haltung standortangepasster Rassen könnten wesentliche Bestandteile solcher Programme sein. Der Landwirt erhält einen finanziellen Ausgleich für entgangene Milch und eine Entlohnung für zusätzlichen Aufwand. Als Ergebnis könnte weniger, aber bessere Milch zu höheren Preisen produziert werden. Das funktioniert nur, wenn die Politik geeignete Instrumente anbietet, um eine Reduzierung der Milchmenge langfristig zu sichern. Die Milchviehhalter müssen in der Lage sein, diese Instrumente zu nutzen. Und der Verbraucher muss bereit sein, für beste Milch nämlich Bio-Milch aus der Region einen Preis zu zahlen, der den Milchbauern ein Auskommen sichert. -15-
9 INFO Agrarpolitik Dresdner Erklärung der Öko-Erzeugerverbände zum Haushaltsentwurf des BMEL 2017 Verbände stellen Bundesagrarminister Christian Schmidts Bio-Zukunftsstrategie in Frage Bei einer Klausur der deutschen Bio-Erzeugerverbände in Dresden verabschiedeten deren Vorsitzenden folgende Erklärung zum Haushaltsentwurf des Bundesagrarministeriums 2017: Mit größtem Unverständnis nehmen wir den von Bundesagrarminister Schmidt vorgelegten Haushaltsentwurf für 2017 zur Kenntnis. In Zeiten der Krise der konventionellen Landwirtschaft wird der Ökolandbau mehr und mehr zu einer realistischen Alternative für konventionelle Betriebe. Dieser Weg muss deshalb mit Forschung und einer kohärenten Agrarpolitik unterlegt werden, um dem gestiegenen Verbraucherwunsch nach einheimischer Ware aus ökologischer Erzeugung nachzukommen und die negativen Umweltauswirkungen der konventionellen Landwirtschaft zu mindern. Der Bundesagrarminister arbeitet seit 2014 an einer Zukunftsstrategie Ökolandbau, um das Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung von 20 Prozent Bio- Flächen zu erreichen. Die Bio-Verbände haben die neue Strategie begrüßt, aber ohne die Mittel diese umzusetzen, ist sie das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben wird. Wir haben unsere Unterstützung der Zukunftsstrategie durch aktive Mitarbeit der durch uns vertretenden Verbände mit viel Zeit und Arbeit in das Projekt bewiesen. Jetzt aber festzustellen, dass für eine im Jahr 2017 geplante Umsetzung der Strategie keine Mittel eingeplant sind, obwohl der Agraretat um 300 Millionen ansteigen soll, ist für uns nicht nur unerträglich, sondern nimmt der Schmidt schen Strategie jede Glaubwürdigkeit. Wir fordern den Minister und die Abgeordneten des Bundestags deshalb auf, die gemeinsam mit dem DBV aufgestellte Forderung, die Forschungsmittel für Bio auf 60 Millionen Euro zu erhöhen, umzusetzen. Jan Plagge, Präsident Bioland e.v. Hans Bartelme, Vorstand Naturland e.v. Kornelie Blumenschein, Vorsitzende Gäa e.v. Carsten Niemann, Vorsitzender Biopark e.v. Christoph Zimmer, Geschäftsführer Ecoland e.v. Jürgen Hartmann, Vorstand Verbund Ökohöfe e.v. Alexander Gerber, Vorstand Demeter e.v. Gottfried Erves, Vorstand Biokreis e.v.
10 Bild: petergrn; pixabay Futter
11 TITEL Futter Jährlich fressen Deutschlands Nutztiere insgesamt knapp 79,6 Millionen Tonnen Futter (in Getreideeinheiten, GE). Das Tierfutter setzt sich ungefähr zusammen aus: 52 % Grünlandaufwuchs (Gras und Grasprodukte), Silagen 25 % Mischfutter und 23 % hofeigenes Getreide sowie zugekaufte Einzelfuttermittel. 87 % dieser Menge stammen aus Deutschland. Der Importanteil von vor allem Ölkuchen und -schroten (insbesondere Sojaprodukte) und kleineren Mengen von Getreide beträgt damit knapp 13 %. Futter Facts Was ist Ölkuchen? Ölkuchen nennt man den Pressrückstand bei der Gewinnung pflanzlicher Öle, das als Viehfutter verwendet wird. Bestandteile des Presskuchens sind die nach der Pressung der Ölsaaten und -früchte verbleibenden Feststoffe und der nicht ausgepresste Ölanteil. Gentechnik im Futter Entsprechend der Verteilung im globalen Anbau sind derzeit folgende GVO-Nutzpflanzen und Verarbeitungserzeugnisse von Bedeutung: Sojaschrot, Sojalecithin, Sojaöl sowie Mais, Maiskleberfutter, Maiskeimschrot, Trockenschlempen (bzw. DDGS = Dried Distillers Grains with Solubles), bei Raps, der nicht in der EU angebaut wird, auch die Produkte Rapssaat, Rapsschrot und -expeller sowie Rapsöl. Darüber hinaus kommen zahlreiche Produkte bei ihrem Herstellungsprozess mit Biotechnologie in Berührung, vor allem fermentativ hergestellte Futterzusatzstoffe (Mikroorganismen, mit deren Hilfe die Produkte hergestellt werden, werden mit gentechnischen Verfahren bearbeitet), wie zum Beispiel Aminosäuren, Enzyme und Vitamine. In den Produkten selbst sind weder die GVO an sich noch deren gentechnische Veränderung nachweisbar, sie unterliegen nicht der Kennzeichnungspflicht. Was ist Soja(extraktions)schrot? Sojaschrot ist das bei der Gewinnung von Öl aus Soja anfallende Produkt, das als Futtermittel verwendet wird. Biologische Fütterung Eine ökologische Fütterung von Nutztieren ist Voraussetzung für die Herstellung tierischer Bio-Lebensmittel wie Milch, Fleisch und Eier. Ökologischer Landbau setzt die Einhaltung der EU-weiten Vorschriften zu Erzeugung, Verarbeitung, Handel und Einfuhr von Öko-Produkten voraus. Darin sind Mindeststandards definiert, darunter auch, was die Tierhaltung und speziell die Fütterung angeht. Was ist im Ökofutter enthalten? Neben dem betriebseigenen Grundfutter, beispielsweise in Form von Silage für Schweine und Rinder, darf Mischfutter verfüttert werden, das von Öko-zertifizierten Unternehmen hergestellt wurde. Das Mischfutter besteht hauptsächlich aus verschiedenen ökologisch angebauten Getreidearten, vor allem Weizen, Gerste und Mais. Klare Regeln für die Ökofutterherstellung Von insgesamt circa 24 Millionen Tonnen Mischfutter, die in Deutschland jährlich hergestellt werden, bildet Öko-Futter einen Anteil von schätzungsweise 3 bis 4 Prozent. Die Herstellung, Lagerung, Kennzeichnung und Zertifizierung von Mischfuttermitteln für den ökologischen Landbau ist gesetzlich geregelt. Biokreis-Futter für alle Tierarten muss das Futter zu mind. 50 % vom eigenen Betrieb stammen ganzjährige Silagefütterung ist verboten vorgeschrieben sind mindestens 50 % Grünfütterung EU-Öko-Futter keine Bindung an eigenes Futter ganzjährige Silagefütterung erlaubt Konventionelles Futter Futter zugekauft, durch Mais- und Sojazugabe häufig gentechnisch verändert Synthetische Dotterfarbstoffe, künstliche Eiweiße und gentechnisch veränderte Futtermittel sind erlaubt
12 TITEL Futter Aus den Biokreis-Richtlinien Alle Nutztiere müssen mit hochwertigem ökologisch erzeugtem Futter ernährt werden. Fütterungseinrichtungen und Futtertische sind in einem ordnungsgemäßen, sauberen Zustand zu halten. [ ] Die Futterbeschaffung für alle Tierarten hat nach folgender Prioritätenliste zu erfolgen: A) Futter aus eigenem Anbau und Eigenmischung B) Zukauf von Biokreis-Futter von Landwirten aus der Region und Eigenmischung C) Zukauf von anderen anerkannten, zertifizierten Öko-Landwirten aus der Region und Eigenmischung D) Zukauf von Biokreis-Futter von Landwirten außerhalb der Region und Eigenmischung E) Zukauf von Biokreis-zertifizierten Firmen (Mischfutter und Einzelkomponenten). Mineralfutter darf nur von Firmen bezogen werden, die vom Biokreis oder anderen anerkannten Anbauverbänden zugelassen sind Eiweißversorgung bei Nutztieren Nutztiere haben unterschiedliche Ansprüche an das Futter. Vor allem Schweine und Geflügel brauchen Eiweiß (s. S. 30/31) Wie wird der Eiweißbedarf (Protein) der deutschen Nutztierhaltung derzeit gedeckt? Für die Eiweißversorgung der Nutztiere in Deutschland sind pro Jahr 8,38 Millionen Tonnen verdauliches Rohprotein erforderlich, davon stammen 6,13 Millionen Tonnen (73 Prozent) aus dem heimischen Rauh- und Saftfutter (wirtschaftseigenes Grundfutter) dem wirtschaftseigenen Getreide und heimischen Nebenprodukten der Rapsölgewinnung, der Lebensmittelverarbeitung und der Bioethanolgewinnung sowie Körnerleguminosen (Hülsenfrüchte) wie Erbsen, Ackerbohnen und Lupinen. Der Importbedarf in Höhe von 2,25 Millionen Tonnen (27 Prozent) verdaulichem Rohprotein wird zu mehr als 75 Prozent über den Import von Sojabohnen (ca. 3-4 Millionen Tonnen) und Sojaextraktionsschrot (ca. 2 Millionen Tonnen) gedeckt. Versorgung mit Futterproteinen Die derzeitigen Rohstoffströme sind eine Folge der Standortvorzüglichkeiten und internationaler Arbeitsteilung: Europa nimmt deshalb die Rolle als Getreideexporteur ein die USA sowie Südamerika sind gute Sojastandorte und daher -exporteure. Quellen: Facts: Deutscher Verband Tiernahrung e.v.; BLE; BMEL, Biokreis-Richtlinien; Erzeugunguniversal_lexikon.deacademic.com Skizze: blob=poster&v=2
13 TITEL Grünfutteraufbereitung Das Beste vom Grünen Drei Biokreis-Betriebe aus NRW erklären, was ihnen bei der Futterbereitung vom Grünland wichtig ist Gutes Bio-Futter im Spannungsfeld von hochwertigen Inhaltsstoffen, naturnaher Flächenbewirtschaftung und nachhaltiger Tierzucht. Von Jörn Bender und Eva Lisges 6 Mega-Jule (MJ) Netto-Energie-Laktation (NEL) beziehungsweise 10 MJ Metabolisierbare Energie (ME) und 16 Prozent Rohprotein (RP) : So könnte man ein sehr gutes Grundfutter vom ökologischen Dauergrünland beschreiben. Und tatsächlich wer diese Inhaltsstoffe in seiner Grassilage vorfindet, der liegt weit oberhalb von (oft überschätzter) Getreide-GPS (Ganzpflanzensilage) oder mittleren Grünfuttergehalten und hat vermutlich zum idealen Zeitpunkt dicht am Ähren-/Rispenschieben der Gräser geschnitten. Solch ein Futter braucht, wer leistungsorientiert Milchviehhaltung oder intensive Rindermast im Ökolandbau betreiben und dazu eine hohe Verdaulichkeit (Nährstoffkonzentration) im Grundfutter anbieten möchte. Diese schwankt in der Grassilage schnell zwischen gut 70 Prozent bei frühem Schnitt sowie hochwertigen Gräsern und 50 Prozent im spät gemähten, extensiven Futter. Pro Tag späterem Mähzeitpunkt ist mit rund 0,6 bis 0,7 Prozent Abnahme dieser Verdaulichkeit zu kalkulieren. Gutes Grundfutter weniger Kraftfutter Gutes Grundfutter heißt aber auch weniger Kraftfutter, das im Ökolandbau und in der Milchviehaltung ohnehin nicht im Übermaß gegeben werden sollte. Rund ein Viertel der Trockensubstanzaufnahme über Kraftfutter abzudecken, scheint angesichts der zur Verfügung stehenden Rassen und Zuchtlinien mit den Prinzipien des Ökolandbaus vereinbar. Wer mehr einsetzt, verdrängt je Kilo Mischfutter rund 1/3 Kilo bestes Grundfutter. Ohnehin entscheidet nicht die letzte Nachkommastelle der Inhaltsstoffe über die Gesamtmenge der aufgenommenen Nährstoffe. Weitaus bedeutsamer sind eine gute sensorische Futterqualität, ausreichend Fressplätze, ein ausgewogenes Energie-/Eiweißverhältnis, angemessene Mineralfutterergänzung sowie eine häufige (ständige) und dabei immer frische Futtervorlage. Sichtbares Öko-Profil Gutes Grundfutter für Fleischrinderhaltung und Rinderaufzucht braucht mit Blick auf die Inhaltsstoffe nicht den hohen Anforderungen des Grundfutters in der Milchviehhaltung zu entsprechen. Mit sensorisch einwandfreiem Futter, das rund 5,5 MJ NEL und 12 bis 13 Prozent RP aufweist und in der ersten Hälfte der Blüte gemäht wurde, kommen diese Betriebszweige mehr als gut zurecht. 60 bis 70 Prozent Gräser, 20 bis 30 Prozent Leguminosen und 10 bis 20 Prozent Kräuter bilden hier im Idealfall die Basis artenreicher Mähweiden mit 2- bis 3-schnittiger Nutzung. Um diese nachhaltig zu etablieren und zu erhalten, darf es an (mineralischer) Stickstoffdüngung mangeln, eine stark defizitäre Versorgung mit Kali und Phosphor sowie deutlich zu niedrige ph-werte wirken sich hingegen oft negativ auf solche artenreiche Kulturflächen und deren Futterwert aus. Regelmäßige Wirtschaftsdünger- und Kalkgaben sollten daher beim Grünland in der Wiederkäuerhaltung üblich sein. Auch in der intensiven Rinderhaltung bieten sich dem verantwortungsvoll ökologisch wirtschaftenden Betrieb aber extensive Bewirtschaftungsregime auf einzelnen (Teil-)Flächen an. Kräuterreiches, einwandfreies Heu kann als extensives Strukturfutter manche Milchvieh- oder Kälberration aufwerten. Und manchmal ist es bei allen ökonomischen Zwängen nur ein bewusst angelegter Randstreifen, der tatsächlich einmal im Jahr blühen und aussamen kann und damit der Wirtschaftsweise im Öko-Betrieb auch nach außen sichtbar ein anderes Profil verleiht. Bilder: Bender Lisges Matthias Ante und sein Sohn Fabian bewirtschaften in Winterberg- Elkeringhausen einen 120 Hektar großen reinen Grünlandbetrieb. Bis vor wenigen Jahren war der Hauptbetriebszweig die Mutterkuhhaltung und Mast von Fleischrindern der Rasse Charolais, seit gut einem Jahr, mit dem Einstieg des Sohnes in den Betrieb, werden neben der Mutterkuhhaltung Ziegen gemolken. Je früher gemäht wird, desto besser, wenn man hochwertiges Futter produzieren will, meint Matthias Ante, auf jeden Fall deutlich vor der Blüte. Optimal ist es, wenn sich das Gras im Schossstadium befindet. Den optimalen Zeitpunkt zu treffen, gelingt aber längst nicht immer auf seinem Betrieb, der sich in den hohen Lagen des Rothaargebirges befindet. Wenn genug gewachsen ist, stimmt oft das Wetter nicht mehr, da muss man auch flexibel sein. Die Rundballen-Silage lässt sich die Ante GbR von einem Lohnunternehmer machen, der durch eine hohe Schlagkraft punktet. Das intensive Grünland wird regelmäßig mit einer Weidelgrasmischung nachgesät. Neben dem Intensivgrünland gehören einige Hektar Naturschutzflächen zum Betrieb. Hier wird Heu gemacht, das sowohl von den Kühen als auch den Ziegen zwischendurch gern gefressen wird. Peter Hochhardt hält 90 Milchkühe auf seinem Betrieb in Gummersbach im Bergischen Land, hatte viele Jahre extensiviert und befindet sich seit dem 2. Februar dieses Jahres in der Umstellung auf den ökologischen Landbau. Der optimale Zeitpunkt für den ersten Schnitt ist zeitig im Jahr, aber nicht allzu früh, etwa wenn die Obergräser oben aus dem Bestand herausschauen, berichtet Peter Hochhardt von seiner Erfahrung. Liegt der Zeitpunkt zu früh, wird der Kot der Kühe zu dünn. Etwas später hat das Futter etwas mehr Struktur, ein Zukauf von Stroh oder Luzerneheu, wie dies manche Kollegen tun, ist für mich daher nicht nötig. Der Landwirt gewinnt von seinem Grünland ausschließlich Silage, dabei lässt er den zweiten Schnitt gern etwas stärker trocknen als den ersten. Bis vor drei Jahren hat Peter Hochhardt mit Fahrsilo gearbeitet, hat sich dann eine Rundballenpresse gekauft und schätzt verschiedene Vorteile dieser Technik. Da ist zunächst die größere Flexibilität: Wurden früher für das Fahrsilo große Flächen gleichzeitig gemäht, nutzt er jetzt die Möglichkeit, auf den unterschiedlichen Entwicklungsstand der einzelnen Flächen zu reagieren und den Schnittzeitpunkt entsprechend anzupassen. Die Ration hält er über den Winter konstant, indem er bei jeder Fütterung Rundballen aus dem ersten, zweiten und dritten Schnitt einsetzt. Und er hat heute gegenüber der Fahrsilo-Methode deutlich weniger Abfall beim Futter. Rudolf Mathweis ist Landwirt mit kleiner Mutterkuhhaltung in Eslohe und beschäftigt sich außerdem als Mitarbeiter in der Landschaftspflege bei der Biologischen Station Hochsauerlandkreis mit der Bewirtschaftung von autochthonem Grünland (Grünland, das sich am Standort über längere Zeit entwickelt hat). Das Raufutter im Winter besteht aus drei Komponenten: mehrjähriges Kleegras in der Ackerfruchtfolge, das er etwa um die Monatswende Mai/Juni das erste Mal mäht, Heu oder Heulage aus klassischen Heuwiesen, bei denen er aufgrund einer besseren Struktur Wert legt auf einen gewissen Anteil an Obergräsern, sowie Futter von Extensivgrünland auf Naturschutzflächen. Die Bewirtschaftung von artenreichem Grünland mit einem breiten Spektrum an Gräsern, Leguminosen und Kräutern bietet die Chance, ein diätetisch wertvolles, schmackhaftes, ergänzendes Grundfutter zu herzustellen, vor allem wenn es gelingt, dieses schonend als Heu zu gewinnen, so der Landwirt. Wichtig sei die Kenntnis der Artenzusammensetzung. Hier hilft gegebenenfalls eine Nachfrage bei einer Biologischen Station oder einem Naturschutz- oder Landschaftspflegeverband denn neben den wertvollen Arten können auch problematische oder giftige vorkommen. In einem solchen Fall gilt es, diese manuell zu beseitigen oder die Art der Bewirtschaftung anzupassen, um den Aufwuchs optimal zu nutzen. Die Rundballen kennzeichnet Rudolf Mathweis sorgfältig, um im Winter die jeweiligen Qualitäten gezielt einzusetzen. -25-
14 TITEL Zwischenfruchtanbau Futter für Stall und Acker Der Autor David Hierenbach ist Biokreis-Berater für das Allgäu. Gründüngung und Tiernahrung: Der Zwischenfruchtanbau kann sowohl auf dem Acker als auch im Stall einen wichtigen Beitrag leisten. Von David Hierenbach -26- Das Anbauen von Zwischenfrüchten hat mehrere Ziele, die sich je nach Kultur, Witterung, Boden, Umbruchtermin und Nutzung unterscheiden und sich gegenseitig beeinflussen können. Ziele sind: Nährstoffkonservierung im Herbst und Winter Stickstoffbindung durch Leguminosen Nährstoffbereitstellung für die Nachfrucht Unkrautunterdrückung Verbesserung der Bodenstruktur Erosionsschutz Erhöhung der biologischen Aktivität des Bodens Bereitstellung von zusätzlichem Futter Die Nährstoffkonservierung erfolgt durch die N-Bindung der Pflanze und die Verringerung der N min -Gehalte im Boden in der Zeit von Herbst und Winter. Dies wird mit Nichtleguminosen erzielt, Leguminosen binden zusätzlich Luftstickstoff. Des Weiteren nimmt die Zwischenfrucht Wasser auf, welches nicht weiter versickert und somit die Auswaschung von Nährstoffen verhindert. In trockenen Jahren kann aber eine Konkurrenzsituation mit der Nachfrucht um Wasser entstehen. Abfrierende Pflanzen sollten vor dem Winter genutzt oder eingearbeitet werden, da auch hier die Gefahr der Auswaschung besteht. Bei winterharten Zwischenfrüchten ist dies meist nicht der Fall. Auch Nährstoffe aus tieferen Schichten können von den Zwischenfrüchten erreicht werden und dadurch der Nachfrucht zur Verfügung gestellt werden. Ein wichtiger Nährstoff ist dabei Phosphor. Sortenwahl je nach Klima und Wassermenge Ein häufiger Zwischenfruchtanbau wirkt sich nicht nur direkt auf die Nährstoffbereitstellung für die Nachfrucht aus, sondern bietet auch langfristig eine Verbesserung der Bodenstruktur sowie Erosionsschutz und Unkrautunterdrückung. Eine Erhöhung der biologischen Aktivität des Bodens kommt vor allem durch die Einarbeitung der Pflanzenmasse zustande, aber auch bei Erntenutzung trägt die auf dem Feld verbleibende Wurzelmasse zu mehr Aktivität im Boden bei. Die Schnittnutzung führt bei Leguminosen zu einer höheren Stickstofffixierung. Sowohl eine Sommerzwischenfrucht als auch eine Winterzwischenfrucht kann als Untersaat oder Stoppelsaat etabliert werden. Damit eine positive Wirkung eintritt, sollte die Zwischenfrucht noch mindestens eine Wachstumszeit von 30 bis 50 Tagen im Herbst haben. Bei einer Untersaat in die vorherige Hauptkultur besteht der Vorteil, dass der Zwischenfrucht ein schnellerer Start ermöglicht wird. Wenn nicht mit einer Untersaat gearbeitet wurde, stellt sich die Frage der Bodenbearbeitung nach der Ernte der vorangegangenen Hauptfrucht. Eine tiefe Bodenbearbeitung entzieht dem Boden für die Zwischenfrucht wichtige Feuchtigkeit, hat aber eine bessere Wirkung auf die Unkrautbekämpfung und die Durchwurzelbarkeit des Bodens. Der Saattermin kommt auf die Vornutzung an, auch späte Saattermine sind je nach Pflanzenart und Sorte möglich, jedoch ist das Wachstum dann langsamer. Abhängig ist das Wachstum auch von den am Standort herrschenden Klimabedingungen und der Wasserversorgung. Im Alpenvorland und in Mittelgebirgslagen sind für den Winterzwischenfruchtbau winterharte Sorten einzusetzen. Für eine Futternutzung im Folgejahr ist noch eine ausreichende Dauer von 20 bis 50 Tagen zwischen Vegetationsbeginn und Ernte nötig. Bei einem späten Saattermin der Nachfrucht, ergibt sich somit ein Vorteil für die Winterzwischenfruchtnutzung im Frühjahr. Immer frisches Futter durch versetzte Aussaat Für die Nutzung als Milchvieh- oder Milchziegenfutter bietet sich der Winterzwischenfruchtanbau trotz der hohen Witterungsabhängigkeit an. Nach der Saat sollte durch walzen Bodenschluss eine ebene Fläche geschaffen werden, um bei der Futterernte möglichst wenig Verschmutzungen in das Futter zu bekommen. Die Ernte erfolgt in Kombination mit Mähwerk und Ladenwagen oder Mähladewagen und kann direkt im Stall verfüttert werden. Bei unterschiedlichen Aussaatterminen steht immer junges Futter zur Verfügung, dann muss auf ausreichend Struktur in Form von Heu oder Stroh geachtet werden. Aus dem Fütterungsaspekt heraus bietet sich die Nutzung einer Winterzwischenfrucht für den nachfolgenden Maisanbau an. Damit erzielt der Betrieb mit der Zwischenfrucht eine lang dauernde Grünfütterungsperiode im Herbst und einen frühen Beginn im Folgejahr. Da der Mais spät gesät wird, erhält die Zwischenfrucht eine ausreichende Vegetationsdauer im Frühjahr. Leguminosen für viehlosen Betrieb Eine Beerntung der Zwischenfrucht erzielt aber nicht denselben Effekt wie der Verbleib der Zwischenfrucht auf dem Feld durch Mulchen. So ergab eine Untersuchung der Uni Bonn einen N min -Gehalt von über 100 kg N/ha bei Nichtbeerntung und einen N min -Gehalt von 50 bis 75 kg N/ha mit Beerntung der Zwischenfrucht. Jedoch war beim Trockenmasseertrag der Nachfrucht kein deutlicher Unterschied erkennbar, wobei aber ein positiver Effekt auf die Restpflanzenmasse vermerkt wurde. Durch den Verbleib der Zwischenfrucht auf dem Feld wird eine ausgeglichene Stickstoffbilanz erreicht. Ein viehhaltender Betrieb, der die Zwischenfrucht beerntet, kann über die Rückführung des Wirtschaftsdüngers seine Bilanz ausgleichen. Im ökologischen Landbau übernehmen Leguminosen eine wichtige Funktion, sie binden Luftstickstoff und machen ihn Pflanzen verfügbar. Deshalb bieten sich diese Pflanzen, besonders im viehlos wirtschaftenden Betrieb, aber auch für Betriebe mit Wirtschaftsdünger an, denn Leguminosen bringen Stickstoff von außen in das System und sind als Futter gut verwendbar. Trotz allem kann das Verwenden von Mischungen aus Leguminosen und Gräsern hinsichtlich des Futterwertes, der Ertragssicherheit und der Durchwurzelbarkeit sinnvoll sein. Ein typisches Gemenge für den Winterzwischenfruchtanbau ist das Landsberger Gemenge, welches sich zur Grünfütterung, zur Silagebereitung und zur Gründüngung eignet. Auch Winterwicke und Grünroggen kann als Gemenge sehr gut eingesetzt werden. Insgesamt ist der Zwischenfruchtanbau sehr entscheidend abhängig vom Standort. Quellen: Zwischenfrüchte im ökologischen Landbau - Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft Fachbereich Pflanzliche Erzeugung Bild: hodihu; pixelio
15 TITEL Mischfutterwerk Der richtige Mix für jedes Tier Bild: Schule für Futtermitteltechnik In der Futtermühle Wiesbauer wird Mischfutter für Rinder, Geflügel und Schweine produziert. Von Ronja Zöls Das Werk in Obernberg am Inn nahe der bayerischen Grenze Futter ist nicht gleich Futter. Und die meisten Kühe fressen nicht nur Gras. Etwa 60 verschiedene Sorten Mischfutter werden in der Biokreis-Futtermühle Wiesbauer im oberösterreichischen Obernberg am Inn, nahe der Grenze zu Bayern, hergestellt. Sie alle haben eines gemeinsam: Sie bestehen aus Proteinträgern, Rohfaserträgern und Energieträgern. Proteinträger: zum Beispiel Rapskuchen, Sonnenblumenkuchen, Sojakuchen, Ackerbohnen Rohfaserträger: zum Beispiel Kleie, Luzerne Energieträger: zum Beispiel Mais, Weizen, Gerste, Triticale Für Rinder, Schweine und Geflügel wird hier Futter nach den Rezepturen von Herbert Wiesbauer produziert. Er stützt sich dabei auf die jeweiligen Anforderungen an den Nährstoffbedarf und auf seine Erfahrungswerte. Seit 1929 ist die Mühle in Familienbesitz, 1968 wurde das erste Mischfutterwerk errichtet. Bereits 1993 stiegen die Wiesbauers in die Bio-Schiene ein. Heute wird auf zwei räumlich und technisch getrennten Anlagen zu ungefähr gleichen Produktionsmengen Bio-Futter und konventionelles gentechnikfreies Futter hergestellt. Während in Deutschland in konventionellen Mischfutterwerken oftmals Gentechnik- Soja eingesetzt wird, setzen wir im konventionellen Bereich auch auf Gentechnikfreiheit. Somit haben wir auch auf der konventionellen Produktionslinie keine Risikostoffe, sagt Juniorchef Michael Wiesbauer (26), der der vierten Generation in der Wiesbauer-Mühle angehört. 12 Tonnen pro Stunde Nach der Annahme und Reinigung werden die Bestandteile mit der sogenannten Hammermühle zerkleinert. Per Computer werden die einzelnen Komponenten gewogen und je nach Rezeptur dosiert. Anschließend erfolgt die Mischung und Homogenisierung. Mehliges Futter wie etwa für Geflügel wird sofort verladen, der Rest pelletiert und bei Bedarf granuliert. 12 Tonnen können pro Stunde produziert werden. Erst letztes Jahr wurde in einen Verladeturm sowie in eine neue Presslinie für Bio-Produkte investiert. Ein Lkw kann dort hineinfahren und das Futter wird im Inneren des Turms abgewogen und über eine Schütte auf das Fahrzeug geladen. Dann folgt der Abtransport zum Kunden. Rund die Hälfte der Abnehmer befindet sich in Deutschland, die andere Hälfte in Österreich, vereinzelt kommen noch ein paar Kunden in Südtirol und Tschechien hinzu. In Deutschland wird in erster Linie der süddeutsche Raum vom Bayerischen Wald bis zum Bodensee bedient. Auch die Rohstoffe für das Biokreis-Mischfutter werden vorrangig in Deutschland bezogen. Getreidekomponenten stammen zur Gänze aus Deutschland, bei Rohwaren mit Versorgungsengpässen werden von den Bio-Verbänden Importgenehmigungen erteilt, etwa für italienische Ware. Grundsätzlich gilt bei den deutschen Bio-Verbänden, deutsche Rohwaren vorzuziehen. Wichtig ist in unserer Branche, sichere und einwandfreie Lieferanten zu haben, sagt Michael Wiesbauer. Heimisches Getreide sei meist genügend vorhanden. Engpässe gab es dieses Jahr vor allem bei Ölpresskuchen wie Sonnenblumenkuchen oder Rapskuchen. Bezogen werden diese von Ölproduzenten, bei denen die Rohstoffe als Nebenprodukte der Pressung anfallen. Es sei eine Herausforderung für die Zukunft, sich durch Verträge Rohstoffe in der passenden Qualität zu sichern. Natürlich wird uns immer wieder Soja aus China angeboten, aber das halten wir nicht für sinnvoll, sagt Michael Wiesbauer. Manko zum Grundfutter wird ausgeglichen Die Nachfrage nach Mischfutter sei in den vergangenen Jahren konsequent gestiegen, auch von 2014 auf 2015 sei die Jahrestonnage in Österreich wieder um 5 Prozent gewachsen. In der Bio-Schiene laufe vor allem das Geflügel-Futter sehr gut. Man merke hier, dass Discounter wie Hofer (in Deutschland: Aldi) erfolgreich Bio-Geflügel verkaufen. Bei den Schweinen dagegen werde Bio-Fleisch von den Konsumenten noch nicht so sehr nachgefragt. Bei Schweinen und Geflügel diene das gekaufte Mischfutter oft als Alleinfuttermittel, bei Rindern dagegen als Ergänzung. Drei bis sechs Tonnen umfasst ein durchschnittliches Silo, das meist einmal im Monat aufgefüllt wird. Der Preis beim Rinderfutter ist dabei abhängig von den verarbeiteten Komponenten und dem gewünschten Rohproteingehalt. Und warum so viele unterschiedliche Sorten? Bei Geflügel variiert die Rezeptur je nachdem, ob es sich um Futter für Legehennen, Masthühner oder Elterntiere handelt. Bei Schweinen gibt es Alleinfuttermittel für die Anfangs- und die Endphase, aber auch Ergänzer. Bei Rindern wird es komplizierter: Rinderhalter lassen ihr Grundfutter untersuchen und analysieren, ob es einen Energie- oder Proteinmangel gibt. Dieses Manko wird durch das darauf abgestimmte Mischfutter ausgeglichen. Viele Landwirte sind bestens ausgebildet und kennen sich sehr gut mit dem Thema Fütterung aus, vor allem die jüngeren. Natürlich lassen sich aber auch viele bezüglich des optimalen Futters beraten. Vitamine und Aminosäuren Eine weitere Rolle spielt die Vitaminisierung. Je nach Tierart variieren hier die Bedürfnisse an Vitamin A, Vitamin E, Zink, Mangan und so weiter Die sogenannten Prämixe werden von spezialisierten Werken zugekauft und entsprechend dosiert. Eine neue Herausforderung könnte in Zukunft mit dem Wegfall der 5-Prozent-Klausel Ende 2017 auf die Futtermühlen zukommen. Geflügel und Schweine brauchen die Aminosäuren Lysin und Methionin, die bisher nur konventionell zur Verfügung stehen. Fällt die Ausnahmegenehmigung, dass bis zu 5 Prozent konventionelles Futter gefüttert werden darf, aus der EU-Öko-Verordnung heraus, müssen neue Lösungen her. Wir sind der Meinung, dass es nicht möglich ist, Jungtiere in der Geflügelaufzucht artgerecht zu versorgen, falls die Frist nicht verlängert wird, sagt Michael Wiesbauer. Michael Wiesbauer. Bilder: Wiesbauer
16 TITEL Eiweißlücke 95 Prozent Bio? Die Eiweiß- und Aminosäurenversorgung ist in der ökologischen Tierhaltung nicht ganz einfach. Von Stephanie Witten, Hans Marten Paulsen, Friedrich Weißmann und Ralf Bussemas Tabelle: Beispielrationen aus dem Trenthorster Versuchsbetrieb -30- Einleitung und Zielsetzung Die bedarfsgerechte Versorgung von Monogastriern mit den essenziellen und vor allem den limitierenden Aminosäuren ist von großer Bedeutung. Im ökologischen Landbau wirft dies aufgrund von unbefriedigenden Aminosäureprofilen der zur Verfügung stehenden Futtermittel sowie Restriktionen im Vergleich zur konventionellen Produktion Probleme auf. Durch die Differenz zwischen Aminosäurebedarf und -versorgung entsteht die sogenannte Aminosäurelücke. Um diese zu schließen, ist es nach EU-Öko-Verordnung (EG 834/2007, EG 889/2008 und EU 505/2012) gestattet, die Ration für monogastrische Nutztiere aufzuwerten, indem 5 Prozent der landwirtschaftlich erzeugten Proteinfuttermittel konventioneller Herkunft sein dürfen. Diese Ausnahmegenehmigung ist nur vorübergehend aktiv. Daher sollte herausgefunden werden, ob eine Umstellung auf eine Prozent-Biofütterung Ende 2017 in Bezug auf die Versorgung der Tiere und das Marktgeschehen praktikabel wäre. Methoden Zur Beleuchtung dieses Themas wurden zwei unterschiedliche Ansätze verfolgt. Zum einen fand eine Auswertung anhand exemplarischer Rationsformulierungen (unter anderem vom Trenthorster Versuchsbetrieb) statt, die die Grenzen der Versorgung ökologisch gehaltener Tiere mit Bio-Futtermitteln sowie betriebseigenen Futtermitteln erkennbar machen sollte. Diese Auswertung wurde mit Hilfe von Literaturrecherchen untermauert. Zum anderen wurden in einer Praxisbefragung rund 300 Akteure in Europa kontaktiert. Darunter waren Futtermittelhersteller und -händler, Erzeugergemeinschaften und Landwirte sowie Personen aus der Forschung, Kontrollbehörden und Verbänden. Die Befragten wurden um Auskunft zu folgenden Fragen (sinngemäß im Gespräch) gebeten: 1. Welche Eiweißfuttermittel setzen Sie ein und aus welchen Ländern beziehen Sie diese? 2. Sehen Sie Versorgungsengpässe für ökologisch erzeugte Eiweißfuttermittel auf dem europäischen/internationalen Markt? 3. Welche Mengen des jeweiligen nicht-ökologisch und ökologisch erzeugten Eiweißfuttermittels setzen Sie jährlich ein? 4. Glauben Sie, dass ein vollständiger Ersatz der nicht-ökologischen Eiweißfuttermittel durch ökologische Komponenten möglich ist? Warum? 5. Welche Strategien werden Sie verfolgen, wenn der Einsatz konventioneller Eiweißfuttermittel vollständig untersagt sein wird? Ergebnisse Anhand der exemplarischen Rationsformulierungen wurde erkennbar, dass es bei höchster Managementqualität Möglichkeiten gibt, Schweine und Legehennen bedarfsgerecht, ökologisch und größtenteils mit wirtschaftseigenen Futtermitteln zu ernähren. (Ergebnisübersicht in der Tabelle auf der rechten Seite) Es zeigte sich jedoch, dass das Konzept einer 100-Prozent- Biofütterung in der Broilermast nur schwierig und im Rahmen der Putenmast mit den heute verfügbaren genetischen Herkünften überhaupt nicht umsetzbar ist. Hochwertige Bio-Eiweißkomponenten sind nicht in ausreichender Menge verfügbar. Dabei ist zu bedenken, dass eine knapp formulierte, reine Öko-Futterration tendenziell nicht die hohe Qualität und vor allem Sicherheit einer Mischung mit hochwertigen konventionellen Proteinträgern besitzt. Würden Betriebe mit suboptimalem Management damit konfrontiert werden, eine 100-Prozent-Biofütterung durchzuführen, müsste mit einer nicht hinnehmbaren Gefährdung des Tierwohls gerechnet werden. Diese Einschätzung ergab sich auch in der Praxisbefragung. Eine Versorgung der ökologisch gehaltenen Tiere mit Bio-Rohprotein wäre nach der Meinung der meisten Befragten derzeit unproblematisch, da Bio-Soja auf dem Weltmarkt ausreichend vorhanden sei. Dabei fehlten in der derzeit ansteigenden europäischen Produktion noch Verarbeitungsmöglichkeiten und Öko-Flächen, sodass eine Gegenläufigkeit der präferierten regionalen Versorgung und der 100-Prozent-Biofütterung mehrfach angesprochen wurde. Diese Gegenläufigkeit werde zum Beispiel dadurch verstärkt, dass sich die Haltung von Masttieren in einzelnen großen Betrieben und einzelnen europäischen Ländern besonders konzentriert. Obwohl Rohprotein in Bioqualität scheinbar in ausreichender Menge auf dem Markt zur Verfügung steht, trifft dies nicht für Hochproteinfuttermittel zur Rationsaufwertung auf Basis der Aminosäuren zu. Nur geringe Mengen an Bio-Kartoffeleiweiß und Bio-Maiskleber werden produziert. Alternative hochwertige Proteinträger aus ökologischer Herkunft wie Schlachtabfälle, Insekten- und Bakterienproteine oder auch der Einsatz freier Aminosäuren sind derzeit entweder gesetzlich limitiert oder nicht anwendungsreif. Im Rahmen der Ausnahmeregelung werden heute in erster Linie konventionelles Kartoffeleiweiß und Maiskleber in der Fütterung eingesetzt. Hinzu kommen geringe Mengen anderer Eiweißfuttermittel wie Bierhefe, Raps- und Kürbiskernpresskuchen oder Weizenkleber. Zu ihrer persönlichen Einstellung, die Verlängerung der 5-Prozent-Ausnahmegenehmigung betreffend, machten 57 der befragten Personen konkrete Angaben. Etwa ein Drittel dieser Befragten war gegen eine Verlängerung. Die Gründe hierfür sind vor allem darin zu sehen, dass eine 100-Prozent-Biofütterung für eine Untermauerung der Glaubhaftigkeit der ökologischen Produktion angestrebt und teilweise bereits durchgeführt wird. Zudem würde nach Meinung dieser Befragten die Entwicklung von hochwertigen Bio-Futtermitteln zur Schließung der Aminosäurelücke durch eine Verlängerung der Ausnahmegenehmigung marktwirtschaftlich gehemmt werden. Die übrigen Befragten waren in verschiedenen Abstufungen für eine Verlängerung der Ausnahmegenehmigung. Dabei spielten diverse Gründe eine Rolle. Zusätzlich zu den oben bereits genannten Problemen in der regionalen Erzeugung werden bei einer 100-Prozent-Biofütterung unerwünschte gesundheitliche Auswirkungen durch fehlende Bio-Hochproteinfuttermittel im Jungtier- und Geflügelbereich erwartet, die eine Verlängerung explizit für diese Tiere notwendig machen würden. Ein Ausschleichen, das heißt eine Verringerung von zum Beispiel 1 bis 2 Prozent der zugelassenen Menge jährlich, würde nach Meinung einiger Befragter die Entwicklung des Marktes sowie des Know-hows der tierhaltenden Betriebe unterstützen und somit den Sektor des ökologischen Landbaus fördern und die Gesunderhaltung der gehaltenen Tiere unterstützen. Schlussfolgerung Insgesamt scheint eine 100-Prozent-Biofütterung vor allem für Jungtiere und Mastgeflügel unter den gegenwärtigen Bedingungen schwierig. Es besteht noch immer ein erheblicher Forschungs- und Entwicklungsbedarf zur bedarfsgerechten Versorgung monogastrischer Nutztiere mit essenziellen Aminosäuren. Dieser richtet sich dahin, dass Lösungen gefunden werden müssen, die die Tiergesundheit, die regionale Produktion sowie auch die Entwicklung des Marktes berücksichtigen. Als praxistauglicher Lösungsansatz wurde das Beibehalten der 5-Prozent-Regelung für Jungtiere und Geflügel sowie Regelungen für eine schrittweise Verringerung der eingesetzten konventionellen Proteinfuttermittel zur Deckung des Aminosäurebedarfs favorisiert, um die Marktentwicklung für ökologische Proteinkomponenten zur Schließung der Aminosäurelücke zu fördern. Die Autoren Stephanie Witten, Dr. Hans Marten Paulsen, Dr. Friedrich Weißmann und Ralf Bussemas forschen am Thünen-Institut. Literatur: Witten S., Paulsen H. M., Weißmann F., Bussemas R. (2014): Praxisbefragung zur Aminosäurelücke und praktische Möglichkeiten zur Verbesserung der Eiweißversorgung der Monogastrier in der Fütterung im Ökologischen Landbau. Braunschweig: Johann Heinrich von Thünen-Institut, 76 p, Thünen Working Paper 23.
17 TITEL Futtermittelhersteller Beim Biokreis zugelassene Futtermittelhersteller: Warenhandel Getreide, Düngemittel Raiffeisenbank Gilching eg Ludwig Peinhofer Römerstraße Gilching / 8192 raiffeisen-ware-gilching@t-online.de Futtermittel Neumeier Nachhaltige Futtermittel GmbH Kuno Neumeier Pinkofen Schierling / 1417 Getreide Antersdorfer Mühle GmbH Hans Priemeier Antersdorf Simbach am Inn / info@antersdorfer-muehle.de Futtermittel Raiffeisen Kraftfutterwerk Kehl GmbH Bernhard Stoll Weststraße Kehl / Futtermittel Zschortauer Futtermittel GmbH (RG Adr.:c/o Südzucker AG Maximilianstr. 10,68165 Mannheim) Michael Peschke Eilenburger Straße Rackwitz / michael.peschke@suedzucker.de Die Farben markieren Postleitzahlenbereiche. Futtermittel Mischfutterwerk GSagri eg Gottfried Zurhacke Raiffeisenstraße Schneiderkrug / eva.hoerstmann@agri.de CURO Spezialfutter GmbH & Co.KG Henning Krane Dorfstraße Ostenfelde / info@curo-spezialfutter.de Handel Getreideprodukte DS Agrarhandel GmbH Daniel Schübel Leidendorf Weidenbach / 1343 info@ds-agrarhandel-gmbh.de Bio-Dinkel Bayernhof Bio GmbH Frank Lammer, Stefan Heinrich Prof.-Reger-Straße Hankofen / frank.lammer@bayernhof.de Futtermittelhandel Kaisermühle Gänheim Otmar Kaiser GmbH Frankenstraße Arnstein-Gänheim / info@kaisermuehle.de Futtermittel S.P. Agrar Sebastian Patzelt Altstettenstraße Schwabhausen / s.p.agrar@gmx.de Handel Vermarktungsgesellschaft Bio-Bauern mbh Andreas Hopf Marktplatz Pöttmes / moritz.dohna@bio-vg.de Getreide, Saatgut Öko-Landhandel Allmannsbeck GmbH & Co.KG Thomas Allmannsbeck Straubingerstraße Dingolfing / landhandel.allmannsbeck@t-online.de Getreidehandel ÖKOKORN OHG Bart Gasteiger Siebenecken Pfaffenhofen / t.gasteiger@web.de Handel Getreide Dreher Agrarrohstoffe GmbH Berthold Dreher Hatternholzweg Wangen-Schauwies / berthold.dreher@agrarrohstoffe.eu Futtermittel MEIKA Tierernährung GmbH Thomas Meitinger Bahnhofstraße Großaitingen / meikafutter@t-online.de Bio-Getreide und Bio-Viehhandel Bio Agrar Service GmbH Bernhard Schindler Hauptstraße Münchendorf ÖSTERREICH 0043 / 1676 / schindler.bernhard@gmx.at Futtermittel Sojaverarbeitung Witzmann Mühle GmbH Anton Witzmann Dötting Aspach ÖSTERREICH 0043 / 7755 / info@witzmann-muehle.de Wiesbauer Mühle u. Mischfutterwerk GmbH Herbert Wiesbauer Mühlberg Obernberg am Inn ÖSTERREICH 0043 / 7758 / 2210 office@wiesbauer-muehle.at
18 BIOWELT Das Tischgespräch Das Wegwerfen von Lebensmitteln kann ich nicht ertragen. Eva Gottschaller (27) ist die Tochter eines Biokreis-Landwirts und Biokreis-Bäckers im Rottal. Im Juli wurde sie als erste Bayerische Bio-Königin inthronisiert (Seite 46-48). Im Interview spricht sie über Fleischkonsum, ihre Lieblingsgesellschaft beim Essen und unsere Wegwerf-Mentalität. Von Ronja Zöls Gab es auch mal richtige Ernährungssünden? -34- Eva, was isst denn eine Bio-Königin? Ich höre auf meinen Körper. Ich denke, der Körper sagt uns schon, was wir brauchen. Und wenn wir aufmerksam sind, hören wir es auch. Aber die meisten Menschen haben es verlernt. Ich habe zum Beispiel nie Brokkoli gegessen. Plötzlich sagte mir mein Körper: Ich brauche Brokkoli. Seither esse ich zwei, drei Mal in der Woche Brokkoli. Grundsätzlich esse ich viel Gemüse, wenig Milchprodukte und momentan kein Fleisch und keinen Fisch. Das ist mein kleiner Protest dagegen, wie mit unserer Welt und unseren Tieren umgegangen wird. Ich halte es aber für völlig ok, ein bis zwei Mal die Woche Fleisch aus ökologischer Tierhaltung zu essen. Bist du eine Missionarin, wenn es um Ernährung geht? Nein, aber in meinem Freundeskreis wird viel diskutiert. Zu meinen Freunden gehören auch einige Vegetarier und Veganer und es gibt immer Reibungen und spannende Gespräche. Mit welcher Art von Ernährung bist du als Tochter eines Bio-Landwirts aufgewachsen? Bei uns zu Hause haben meist Oma und Opa gekocht. Wenn ein Hahn geschlachtet wurde, gab es Gickerl, und wenn ein Schwein geschlachtet wurde, saure Leber. Ich würde sagen, es war eine gute bayerisch-bürgerliche Küche. Es gab immer die böse Schokolade (lacht). Ich habe mir mit 13 Jahren zum ersten Mal Gedanken gemacht über meine Ernährung und war damals ein Jahr lang Vegetarierin. Aber es gab auch Zeiten, in denen ich zu McDonalds gegangen bin. Das mache ich heute nicht mehr. Du bist Schauspielerin und jobbst nebenbei in einem Bio-Imbiss. War das eine gezielte Entscheidung? Als ich für ein Schauspiel-Projekt nach München gekommen bin, dachte ich: Ich brauche unbedingt einen Nebenjob. Ich beschäftige mich viel mit dem Thema Bio. Deshalb habe ich im Biokreis-Imbiss Milchhäusl angefragt. Dort gehören vor allem Touristen zu den Kunden, aber auch Menschen, vor allem Mütter mit ihren Kindern, die bewusst herkommen wegen der Bio-Qualität. Wie gestalten sich in deiner WG in Schwabing Einkaufen und Kochen? Meine zwei Mitbewohner und ich versuchen, möglichst oft zusammen zu kochen und zu essen. Es gibt bei uns fast ausnahmslos vegane oder vegetarische Gerichte. Und daheim im Rottal? Früher hat meine Mama immer viel und gut gekocht, wenn ich daheim war. Jetzt bringe ich meiner Mama etwas bei. Ich koche immer einfach und leicht, zum Beispiel Brokkoli mit Brechbohnen und Reis oder einen veganen Kuchen. Meine Mama ist immer begeistert! Was kannst du besonders gut kochen? Brokkoli (lacht). Nein, ich bin keine ausgefeilte Köchin. Ich kann Pizza und Lasagne und gute Salate und Kuchen. Mehr brauche ich nicht. Wen würdest du gerne mal zum Abendessen einladen? Den österreichischen Filmregisseur Ulrich Seidl. Ich habe so viele Filme von ihm gesehen. Sie sind abschreckend und faszinierend zugleich und gehen an die Substanz. Über seine Sicht der Welt und über das Leben würde ich mich gerne mal mit ihm unterhalten. Wo macht dir Essen am meisten Spaß? Wo, ist mir egal. Mir ist nur wichtig: in Gesellschaft. Ich mag beim Essen nette Leute um mich herum haben. Allein esse ich ungern. Da esse ich lieber gar nicht. Welche Botschaft hast du als erste Bayerische Bio-Königin an uns alle? Ich würde mir wünschen, dass sich mehr Menschen bewusst machen, was sie essen, und mit der Welt bewusster umgehen. Wenn man in sich hineinhört, braucht man nicht viel. Ich denke, dass es durchaus möglich ist, mit biologischer Landwirtschaft die Welt zu ernähren. Jeder kann ganz klein bei sich selbst anfangen, indem man zum Beispiel Bio-Fleisch isst. Was mich fassungslos macht, ist, wie viel weggeworfen wird. Ich habe kürzlich für meinen Papa eine Verkostung in einem Supermarkt gemacht. Abends wurde dort die Fisch-Frischetheke leergeräumt und alles weggeworfen anstatt gespendet. Und in München umzäunen Supermärkte ihre Container, damit keiner was klauen kann. Diesen Umgang mit Lebensmitteln kann ich nicht ertragen. Bild: Chantal Alexandra Pilsl
19 BIOWELT Reise Auf den Spuren der langen, weißen Wolke In Neuseeland leben rund vier Millionen Menschen und fünf Millionen Milchkühe. Von Julia Wolrab Julia Wolrab ist Historikerin und lebt und arbeitet seit sechs Jahren in Berlin. Aufgewachsen auf einem Bauernhof in Oberbayern, verbrachte sie sechs Monate auf einer Dairy Farm in Neuseeland. Aotearoa übersetzt lange, weiße Wolke ist eine der ursprünglichen Bezeichnungen der Māori für den Inselstaat Neuseeland. Das Land wurde vermutlich im 13. Jahrhundert von den aus Polynesien stammenden Māori erstmals besiedelt. Dort, etwa Kilometer von Mitteleuropa entfernt, leben heute rund vier Millionen Menschen, circa 32 Millionen Schafe und über fünf Millionen Milchkühe. Allein diese Zahlen geben einen kleinen Eindruck davon, welchen Stellenwert die Landwirtschaft in Neuseeland heute einnimmt. Der landwirtschaftliche Sektor wuchs seit dem Beginn der europäischen Besiedlung Neuseelands im 18. Jahrhundert kontinuierlich an. Das Land und seine vielfältige Vegetation haben in den vergangenen Jahrhunderten jedoch auch stark unter der forcierten landwirtschaftlichen Nutzung gelitten. Ein Großteil des ursprünglichen Buschwaldes zum Beispiel wurde bis zum Ende des 19. Jahrhundert gerodet, um den fruchtbaren Boden als Weideland nutzbar zu machen. Waren im zwölften Jahrhundert noch etwa 80 Prozent des Landes mit Wäldern bedeckt, so wachsen heute noch auf gut 24 Prozent der Landesfläche einheimische Wälder, von deren Fläche rund 77 Prozent unter Schutz stehen. Auf rund fünf Prozent der Landesfläche werden von der neuseeländischen Forstwirtschaft schnellwachsende, nicht einheimische Baumarten wie die Monterey-Kiefer (Pinus radiata) und der Küstenmammutbaum (Sequoia sempervirens) angebaut. Milchpreis auch bedrohlich für Dairy Farmer Vor allem die neuseeländische Milchwirtschaft hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen: 90 Prozent der neuseeländischen Milchprodukte werden exportiert, überwiegend nach China, nur rund fünf bis zehn Prozent werden im Inland konsumiert. Damit ist Neuseeland seit einiger Zeit der weltweit größte Exporteur von Milchprodukten. Der niedrige Milchpreis macht jedoch auch vor dem Inselstaat nicht Halt und bedroht dort derzeit die Existenz zahlreicher Milchbauern (Dairy Farmer). Ein gutes halbes Jahr habe ich auf einer Dairy Farm im Herzen der Nordinsel Neuseelands verbracht und dort vieles gelernt, über die Menschen, die Tierhaltung und die enge Verbindung zwischen den Kulturen der Māori und der Pākehā, wie die europäisch-stämmigen Bewohner auch genannt werden. Auffällig und für das europäische Auge zunächst ungewohnt sind neben der üppigen Vegetation zum einen die riesigen landwirtschaftlichen Flächen und zum anderen die Tatsache, dass das Vieh ganzjährig ausschließlich von Weidefutter genährt wird. Die Tiere sind dementsprechend kräftig und toben auch gerne einmal ausgelassen auf den hügeligen paddocks (Weiden). Allerdings muss die Milchwirtschaft auch immer wieder mit extremen Dürreperioden rechnen, wie im Frühjahr Anders als in anderen Ländern schlägt sich der fehlende Grasaufwuchs aufgrund der fast ausschließlichen Weidehaltung sofort in eine Minderleistung der Milchproduktion um. Die Aufgabe der Farmer besteht außerhalb dieser zum Glück noch nicht regelmäßigen Trockenzeiten vor allem darin, die Herde etwa 200 bis 500 Tiere zwei Mal pro Tag in den offenen Melkstand zu begleiten, die Melkmaschine anzuwerfen und die Tiere nach dem milking auf ein neues paddock zu entlassen. Unterstützt werden sie dabei meist von ein paar an den Herdentrieb gewöhnten Hunden und einem motorisierten Fahrzeug, zum Beispiel einem Quad, da die großen Distanzen zu Fuß nur schwer zu bewältigen wären. Auch wenn das alles ganz einfach klingt, so ist es doch echt harte Arbeit, wie ich während meines Aufenthalts selbst erfahren durfte. Kühe weg, Milch weg ein spannender Tag in Neuseeland Nach einigen Wochen auf der Farm der Christensens in der Nähe der Stadt Hamilton auf der Nordinsel sollte ich die Herde ein paar Tage ohne die Hilfe meiner Gastfamilie melken, damit sie in den Urlaub fahren konnten. Kein Problem!, dachte ich, kann ja eigentlich nichts schief gehen. Natürlich kam es anders Eine Kuh kalbte in der Nacht. Bevor sie separat gemolken werden konnte, sollte die Nachgeburt entfernt werden. Mein Gastvater Sven hatte mir zuvor gesagt, was in solch einem Fall zu tun wäre. Ich zog die Plazenta gemäß seinen Ausführungen langsam aus dem Kuhinneren. Die Kuh schien zufrieden zu sein. In diesem Moment bemerkte ich jedoch, dass sich das Gatter des Melkstands gelöst hatte. Ich setzte geistesgegenwärtig zum Sprint an, um das Gatter zu schließen, rutschte jedoch auf der am Boden liegenden Plazenta aus und knallte mit der Schulter und in hohem Bogen auf die Kante des Melkganges. Starr vor Schmerz saß ich da und konnte nun nur noch mitansehen, wie alle Kühe an mir vorbeitrabten, ohne gemolken worden zu sein. Shit! war das einzige Wort, das mir in diesem Moment durch den Kopf schoss. Glücklicherweise konnte ich durch lautes Rufen Mobiltelefone, geschweige denn Empfang gab es auf der Farm nicht auf mich aufmerksam machen. Eine sehr nette Nachbarin kam zufällig vorbei und fuhr mich schließlich zum Arzt. Schulter ausgekugelt, Kühe weg, Milch weg. Ein äußerst erfolgreicher Tag Neuseeland wäre jedoch nicht Neuseeland, wenn gerade in solchen Situationen nicht das eigentliche Lebensmotto herausgekramt würde: Take it easy and have a beer, mate! Die Warmherzigkeit und Offenheit der Neuseeländer habe ich in meinen sechs Monaten dort sehr zu schätzen gelernt. Eigentlich ist immer alles möglich, solange du keinen festen Plan verfolgst und dich und die Welt nicht so ernst nimmst. Informationen rund um ein Auslands-Farm-Jahr in Neuseeland bieten zum Beispiel die Seiten: arbeiten-in-neuseeland.html oder Bilder: Wolrab -37-
20 BIOWELT Nachhaltig leben -38- Zero Waste. Weniger Müll ist das neue Grün. Unter diesem Titel hat die Bloggerin Shia Su (32) ihr erstes Buch veröffentlicht. Die Bochumerin hat es sich zur Aufgabe gemacht, möglichst keinen Müll zu produzieren. Den Müll, den sie und ihr Mann Hanno (34) in zehn Monaten produziert haben, präsentiert sie auf dem Buch-Cover in einem Einmachglas. Im Interview verrät sie Tipps und Tricks. Von Ronja Zöls Shia, was genau ist für dich Müll? Alles, was für die Tonne produziert wird, also bereits auf Kurzlebigkeit ausgelegt ist, wie Verpackungen und qualitativ minderwertige Sachen. Du hast den Müll von einem Jahr in ein 0,75 Liter Einmachglas gesteckt. Was ist da alles drin? Da ist zum Beispiel eine kaputte Keramiktasse enthalten, viele Kassenzettel, die nicht in die Papiertonne sollen, weil sie aus Thermospapier sind und eine gesundheitsgefährende BPA-Beschichtung haben, die Verpackung eines Anti-Allergikums und die Plastikfolie einer neuen Klobrille. Unsere alte war kaputt und ohne Einschweißung war keine zu bekommen. Ich geb dir ein paar Stichwörter und du sagst mir die Zero-Waste-Lösung Bier? Gibt es mit Plopp-Verschluss. Eine Brauerei hier in Bochum bietet die zum Beispiel an. Oder direkt vom Fass. Klopapier? Man kann ein Bidet nutzen. Wer keins hat, kann eins simulieren. Es gibt sogar eine Po-Dusche als Flasche. Papier? Unsere Zeitungen haben wir abbestellt und lesen sie online. Bücher gibt es als E-Books, für Notizen benutzen wir Schmierpapier, zum Beispiel Briefumschläge, die wir ja auch per Post bekommen. Es klappt sehr gut mit dem fast papierlosen Haushalt. Medikamente? Wir setzen auf Hausmittel. Wenn wir einmal richtig krank werden, also mehr als eine läppische Erkältung bekommen, Bilder: Wasteland Rebel werden wir welche nehmen müssen. Aber durch Zero Waste lebt man zum Glück auch gesünder. Verhütung? Hormonspirale in meinem Fall, aber es gibt auch andere Langzeit-Verhütungsmittel wie das Implantat, die Kupferspirale oder die Sterilisation für diejenigen, die sich ganz sicher sind. Klar, dass Kondome in gewissen Situationen gebraucht werden, aber dann empfehle ich fair produzierte vegane Kondome. Sonnencreme? Da habe ich bisher keine Alternative gefunden. Im vergangenen Sommer brauchte ich keine, weil ich es geschafft habe, mich als Sonnenschutz vor allem im Schatten aufzuhalten und ein Käppi zu tragen. Zu lange in der Sonne ist sowieso nicht mein Ding, da werde ich matschig im Kopf. Wer aber gerne sonnenbaden geht, sollte sich natürlich eincremen. Ginge das Leben ohne Müll auch ohne Unverpackt-Läden? Ja, aber man käme vielleicht nicht ganz so weit, die letzten 5 bis 10 Prozent lassen sich dann schwerer ausmerzen. Bei der Müllvermeidung muss man in erster Linie die Augen aufhalten und nachfragen. In kleinen Bio-Läden kann man sich die Waren in die eigene Dose packen lassen. Kein Gesetz verbietet das und kleine Läden machen es auch. Ich selbst kaufe viel frisches Obst und Gemüse im Bio-Laden und fülle Trockenvorräte nur alle sechs bis acht Wochen auf. Bei jeder Kinokasse bekommst du eine Eintrittskarte. Verzichtest du zum Zwecke der Müllvermeidung auf bestimmte Freizeitaktivitäten? Es gibt inzwischen Kinos, bei denen man Handy-Tickets ordern kann. Auch Fahrkarten für den Zug beziehe ich aufs Handy. Selbst im Theater haben wir schon das online gebuchte Ticket einfach auf dem Handy vorgezeigt und das wurde akzeptiert. Welchen Müll nimmst du in Kauf? Papier, Glas und Bio-Müll, aber auch da reduzieren wir natürlich, wo es geht. Der Rest ist im Einmachglas. Auf meinem Blog Wasteland Rebel veröffentliche ich regelmäßig Müllstatistiken. Da kann man nachlesen, wie viel Plastik-, Rest-, Papier-, Glas-, Metall- und Bio-Müll wir produziert haben. Wie kleidet Ihr Euch? Ich kaufe eigentlich fast ausschließlich Secondhand, mein Mann Fairtrade- Bio-Kleidung, weil es für Männer leider sehr schwer ist, an modische Secondhand-Kleidung zu kommen. Secondhand, weil man so keine neuen Ressourcen anzapfen muss; Fairtrade- Bio, um dennoch eine Nachfrage bei den Produzenten zu generieren, die versuchen, es besser zu machen. Ziel ist, die Konkurrenz zur bestehenden ausbeuterischen Industrie zu stärken. Sonst ändert sich ja leider nichts. Gibt es etwas, das du definitiv nicht mehr essen kannst, weil es das Produkt nur verpackt gibt? Essen kann ich alles, was ich will. Naja, bis auf die ganzen Sachen, gegen die ich allergisch bin. Es ist eher so, dass wir nicht wollen, weil wir denken, dass der Nutzen in keinem Verhältnis zum angerichteten Schaden steht. Wenn uns etwas wirklich wichtig ist, würden wir uns das auch verpackt kaufen. Nehmen wir Chips. Chips gibt es nur verpackt. Wir haben einmal selbst welche gemacht, dann aber nie wieder. Anscheinend sind uns Chips generell nicht wichtig genug, sonst würden wir uns auch die Mühe machen, sie als Alternative selber zu machen. Besteht ein Zero-Waste-Leben noch aus etwas anderem als aus Müllvermeidung? Ja, denn ich spare viel Zeit durch die wegfallenden Einkäufe. In den Drogeriemarkt muss ich zum Beispiel nur einmal im Jahr. Alles, was wir brauchen, um Geschirrreiniger, Waschmittel, Zahnpasta und alles Mögliche abzudecken, passt ohne Problem in den Spülunterschrank. Das Anmischen, falls überhaupt nötig, geht meistens unter einer Minute und dauert höchstens fünf Minuten. Natron, Waschsoda, Zitronensäure und Olivenölseife: Die Zutaten gibt es alle in Papier-Verpackung oder ganz ohne und sind sehr ergiebig. So trage ich vom Drogeriemarkt meinen ganzen Jahreseinkauf ganz locker auf einmal nach Hause. REZEPT FÜR FLÜSSIGWASCHMITTEL: 30 g Olivenölseife, 4 El Natron oder 3 EL Waschsoda, 600 bis 700 ml Wasser, optional 10 Tropfen ätherisches Öl. Seife klein raspeln. Wasser in einem Topf aufkochen, Seifenflocken und ggf. ätherisches Öl dazugeben. Sollten sich nicht alle Flocken gut auflösen, kann die Masse noch einmal auf dem Herd unter Rühren erwärmt (erwärmen, nicht kochen!) werden, bis sich die gesamte Seife aufgelöst hat. Die Mischung abkühlen lassen, dann das Natron oder Waschsoda dazugeben und verrühren. 2 EL pro Waschgang, bei stark verschmutzter Wäsche kann man noch bis zu 1 EL Waschsoda zusätzlich zur Wäsche dazu geben.
21 BIOKREIS Fachberatung Landwirte fragen Berater antworten Wintererbse -40- Ohne Kraftfutter Ist eine Milchproduktion ohne Kraftfutter sinnvoll? Josef Forstner: Eine Fütterung ohne Kraftfutter ist aus meiner Sicht eine Variante, die momentan sehr stark in Betracht zu ziehen ist. Zum einen ist die Kuh ohnehin von Natur aus ein Grobfutterfresser. Dabei empfiehlt es sich, sie mit aerobem Futter zu füttern, also mit Heu und/oder Gras, denn auf diese Weise kann sie das Grundfutter optimal ausnutzen. Die Kuh erzielt mit einem guten Grundfutter auch eine gute Leistung. Diese Leistung ist mit sehr geringen Kosten zu erzeugen und außerdem gesund für die Kuh. Über getrocknetes Heu lässt sich die Leistung noch anheben beziehungsweise das Leistungspotenzial der Kuh noch besser ausschöpfen. Dabei ist aber zu beachten, dass dies Kosten und Energieaufwand mit sich bringt. Zum anderen wäre es angesichts der derzeitigen Situation auf dem Milchmarkt, also der aktuellen Überproduktion, auch sinnvoll, weniger Milch auf den Markt zu bringen. Der Verzicht auf Kraftfutter würde dies automatisch bewirken. Fazit: Kosten sparen, gesündere Tiere und Schaffung eines stabilen Milchmarkts. Das sind die Vorteile einer Milchproduktion ohne Kraftfutter. Bienenfutter Was muss ich bei der Fütterung von Bienen beachten? Marc Schüller: Als Bienenfutter wird in der Bio-Imkerei in der Regel die Süße aus Zuckerrüben sowie aus Zuckerrohr verwendet. Die Nachfrage nach Produkten aus europäischen Zuckerrüben übersteigt derzeit bei weitem das aus unterschiedlichsten Gründen sehr knappe Angebot, was besonders in diesem Jahr zu deutlichen Preisanstiegen geführt hat. Zudem ist die Rückverfolgung der Herkunft schwierig, auch wenn die Verarbeitung in Süd- oder Norddeutschland stattfindet. Alternativ wird deshalb vermehrt Rohrzucker aus Südamerika oder Südostasien verwendet. Inzwischen gibt es auch hier weißen beziehungsweise hellbraunen, also mineralstoffarmen Zucker. Wegen der besseren Ökobilanz kann auch dann weiterhin das regional&fair -Siegel genutzt werden, besonders wenn fair gehandelte Ware bevorzugt wird. Bei der Fütterung muss auf die richtige Balance geachtet werden. Zwischendurch sollte gewogen werden, um Überfütterung oder eine eventuelle Räuberei zu bemerken. Dabei spielt auch eine Spättracht wie Springkraut eine nicht zu unterschätzende Rolle. Von selbst versteht sich und von den Richtlinien wird gefordert, dass den Bienen zur Überwinterung ein möglichst hoher Anteil an eigenem Honig belassen wird. Ziel der Imkerberater ist es, bei Bedarf in Zukunft gebündelt für die Biokreis-Imker mit Anbietern zu verhandeln und Hilfestellung bei der Verteilung zu leisten. Umgestellte Auslauffläche Auf welche Weise kann ich als Umstellungsbetrieb möglichst schnell eine anerkannte Auslauffläche für Öko-Geflügel schaffen? Jörn Bender: Wenn ein Umstellungsbetrieb zum Beispiel Öko-Junghennen zukauft und mit diesen unmittelbar in eine ökologische Produktion startet, muss den Tieren eine umgestellte Auslauffläche angeboten werden. Andernfalls verliert die Partie in der Regel ihren Öko-Status. Die Regelung nach Artikel 21 der EG- Öko-VO 889/2008 (Einsatz von 20 % Erstjahresfutter von Flächen des Dauergrünlandes/mehrjährigen Futterkulturen) findet leider in diesem Zusammenhang keine Anwendung. Von daher muss die Auslauffläche einen nach Artikel 37 der oben genannten Verordnung geregelten, verkürzten Umstellungsprozess durchlaufen. Die Umstellung einer konventionellen Fläche nimmt demnach zwölf Monate in Anspruch. Diese Dauer kann auf sechs Monate reduziert werden, wenn der Bewirtschafter gegenüber der Kontrollstelle verbindlich erklärt, dass auf der Fläche im vergangenen Jahr keine im Öko-Landbau nicht zulässigen Düngeund Pflanzenschutzmittel ausgebracht wurden. Sollte für die Fläche eine mehrjährige Vornutzung im Vertragsnaturschutz/Kulap, bei dem der Einsatz von PSM und Mineraldünger verboten sind, nachweisbar sein, kommt auch eine rückwirkende sofortige Anerkennung als Öko-Fläche in Betracht. Welche Erfahrungen gibt es beim Anbau der Wintererbse E.F.B. 33? Gerhard Falter: Der Anbau von Leguminosen ist im ökologischen Landbau die wichtigste Quelle für die Zufuhr von Stickstoff. Winterformen der Körnerleguminosen werden hierzulande jedoch kaum angebaut. Der Anbau der Wintererbse E.F.B. 33 ist aufgrund der guten Winterhärte eine gute Möglichkeit zur Winterbegrünung und Futternutzung im darauffolgenden Jahr. Neben dem Erosionsschutz und der geringen Auswaschungsgefahr ist auch die effektive Beikrautregulierung zu erwähnen. Interessant sind Mischungen mit Triticale zur Futtererzeugung. Als Ganzpflanzensilage (GPS) im Frühsommer geerntet, bietet das Gemenge den Betrieben eine interessante Alternative zum herkömmlichen Futterbau. Die Aussaat erfolgt am besten zwischen Anfang bis Mitte Oktober auf humosen, leichten bis mittleren Böden. Gesät wird auf etwa drei Zentimetern Tiefe. Ein Mischungsverhältnis von 40 bis 50 kg Erbsen und 120 bis 150 kg Triticale sollte anvisiert werden. Neben der Erzeugung von schmackhaftem Futter wirkt sich das Erbsengemenge auch positiv auf die Bodenfruchtbarkeit aus und bietet alle Möglichkeiten für einen hervorragenden Sommerzwischenfruchtanbau. Auch als überwinternde Zwischenfrucht für den Gemüsebau ist so eine Mischung bestens geeignet. Quellen/Literatur: Eigene Erfahrungen/Landwirte sowie wintererbsen-fuer-den-oekolandbau/ Weidegang beim Milchvieh Wie oft muss ich meine Tiere nach draußen lassen? David Hierenbach: Jeder Bio-Betrieb ist dazu verpflichtet, seinen Kühen Freigeländezugang oder Weidegang zu gewähren. Weidegang ist von Mai bis Oktober vorgeschrieben. Dies bedeutet, dass ab Vegetationsbeginn, spätestens aber ab Anfang Mai, eine Weide mit Weidezaun zur Verfügung stehen muss. Der Weidebeginn sollte vor dem ersten Schnitt liegen. Dies hat den Vorteil, dass man die Tiere zum einen langsam an die Grünfütterung und zum anderen an den Austrieb gewöhnen kann. Ein Beginn des Weidegangs nach dem ersten Schnitt ist zu spät! Die Besatzdichte der Weide ist so zu wählen, dass die Grasnarbe nicht unverhältnismäßig stark geschädigt wird. Die Weide muss immer dann genutzt werden, wenn: der physiologische Zustand der Tiere die klimatischen Bedingungen und der Bodenzustand dies gestatten. Dies bedeutet bei einem so nassen Jahr wie diesem, dass aus Rücksicht auf die Weide und vor allem auf den Bereich des Ein- und Austriebs, aber auch auf die Klauengesundheit, nicht immer ausgetrieben werden kann. Jedoch ist trotzdem eine Weide ab Mai bereitzustellen, die bei entsprechender Witterung genutzt wird. Je nach betrieblicher Ausrichtung und Gegebenheiten kann alternativ ganzjährig (365 Tage/Jahr) ein Laufhof angeboten werden. Ein Zugang zu Freigelände beziehungsweise Weidegang ist unbedingt erforderlich!
22 BIOKREIS Fachberatung Berg und Tal auf dem Acker: Dammanbau nach Turiel Ertragstarker, beikrautfreier Dinkelbestand mit Turiel- Dammkultur. Der Biokreis veranstaltete zwei Feldtage zur Dammkultur auf den Betrieben Siegfried Rettermayer in Vohburg und Thomas und Alfred Pschorn in Wackerstein. Von Hans Schiefereder Bild unten: Grundrahmen mit Eisenstäben für Beikrautregulierung Bilder: Schiefereder Auf den Feldtagen stellte Johannes Doppelbauer aus Wels in Österreich gemeinsam mit Julian Turiel, dem Erfinder der sogenannten Dammkultur, dieses spezielle Anbauverfahren vor. Die überraschenden und überzeugenden Erkenntnisse über das gesunde Bodenleben der Dammkultur wurden durch die praktische Darbietung auf den Feldern noch eindrucksvoll veranschaulicht. Die Betriebsleiter berichteten direkt aus ihrer Praxis und schilderten neben ihren Erfolgen auch ihre Fehler, die sie bei der Umstellung auf das Turiel- System machten. Kein Licht für Unkraut Julian Turiel stammt aus Spanien und ist dort auf seinem elterlichen, landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen. Schon im Alter von zwölf Jahren beobachtete er, dass der Boden der Nachbarn, die Dammkultur betrieben, wesentlich dunkler war, als der gepflügte Boden seiner Familie. In einem sehr niederschlagsreichen Jahr es hatte von September bis Oktober ununterbrochen geregnet wucherte das Unkraut so sehr, dass die Felder aussahen wie grüne Wiesen. Die Flächen der Turiels mussten im Herbst drei Mal gegrubbert, danach geeggt und dann eingesät werden. Die Nachbarn mit der Dammkultur hingegen beließen ihre Dämme wie sie waren und warteten, bis sie abgetrocknet waren. Dann eggten sie lediglich die erhabenen Dammkämme ab, bis diese unkrautfrei waren. Das Unkraut in den Dammtälern wurde dort so belassen. Auf die so entstandenen gestreiften Felder streute man dann das Saatgut flächig aus. Anschließend wurden die Dämme mit einem Spezialpflug auseinandergepflügt, so dass das Saatgut in den Dammtälern von der Erde bedeckt wurde, mit dem erfreulichen Nebeneffekt, dass das Unkraut in den Tälern dadurch kein Licht mehr bekam und abgetötet wurde. Diese Methode faszinierte Julian Turiel so sehr, dass er anfing, geeignete Arbeitsgeräte für den Dammanbau zu entwickeln. Seinem Vater, der an seiner konventionellen Arbeitsweise festhalten wollte, war das jedoch ein Dorn im Auge und es kam zum familiären Bruch. Turiel ging vor 30 Jahren nach Deutschland, wo er acht Jahre auf einem Bio-Gemüseanbaubetrieb tätig war. Auch dort stieß er immer wieder auf Zweifel und Widerstände und sein Kampf für die Dammanbaukultur ging weiter. Mühsam konnte er mit der Zeit zeigen und beweisen, dass man nicht nur Kartoffeln, sondern auch Karotten und andere Gemüsekulturen auf diese Weise optimal anbauen kann. Schließlich überzeugten die enormen ökologischen und ökonomischen Vorteile dieses Verfahrens, gerade in witterungsextremen Jahren. Im Laufe der Zeit entwickelte Turiel immer mehr Materialien und Arbeitsgeräte, um die Handhabung des Anbaus auf den Dämmen zu optimieren. System Turiel Notwendig: Grundrahmen, Hackrahmen, Särahmen und Kettenwalze. Kraftbedarf: 120 bis 140 PS am Anfang je nach Boden erforderlich, nach zwei bis drei Jahren, wenn der Boden aufgebaut ist, reichen 100 PS. Schlepper mit schmalen und hohen Reifen sind besser als solche mit breiten und kleineren Reifen. Die Begründung liegt darin, dass eine schmale Spur von verdichtetem Boden von Bodenlebewesen wesentlich schneller wieder erobert wird als eine breite Verdichtungsspur. Dammkultur: Dammkultur hat nichts mit den bekannten Kartoffeldämmen zu tun, die mit Hilfe von Geräten wie Dammfräsen oder Häufelkörper aus zerkleinerter und vermischter Erde geformt werden. Diese Dämme verschlämmen an der Oberfläche, weil die Tonteilchen bei Regen eingewaschen werden und die Kapillaren des Bodens verstopfen. Damit sind ein Luftaustausch und das Eindringen von Wasser zumindest erschwert, bei Starkregen nicht mehr möglich. Der Damm verkrustet, trocknet aus und es gibt Risse. Dieses Konstrukt funktioniert nicht mehr. Die Dämme von Turiel sind vergleichbar mit einem Maulwurfshaufen. Die Oberfläche ist grobporig und offen. Zwischen den Dämmen wird der Boden mit dem Turiel-System 15 bis 20 Zentimeter angehoben und verschoben, aber nicht gemischt. Geschüttelt, nicht gerührt Das Herzstück dieses Verfahrens ist nur ein Rohr mit fünf Zentimetern Durchmesser und 5 Millimetern Wandstärke von 20 Zentimetern Länge, das schräg nach unten am Trageholm befestigt ist. Durch die Schräge der Werkzeuge zieht sich das Gerät in den Boden und zusätzlich kommt durch diesen Zug nach unten ein Druck direkt auf die Hinterachse
23 BIOKREIS Fachberatung -44- des Traktors, was der Kraftübertragung auf den Boden zu Gute kommt. Damit wenig Boden geschnitten, verschmiert oder gequetscht wird, ist die richtige Bodenfeuchte zu beachten und eine Fahrgeschwindigkeit von maximal 7 km/h einzuhalten. Dadurch hat der Boden genug Zeit auszuweichen, da er bricht und dadurch auch nicht geschädigt wird. Bei zu nasser Bodenbearbeitung oder zu schneller Fahrt werden nur Schlitze gezogen, der Boden verschmiert und wird verdichtet. Außerdem ist der Kraftaufwand über 7 km/h überproportional hoch. Die Dammkultur will die Bodenschichten nicht vermischen, sondern nur anheben und zur Seite schieben und damit das Bodenleben in der für sie passenden Umgebung belassen (Turiel: Geschüttelt, nicht gerührt ). Unkraut verschwindet schnell Durch die Lockerung zwischen den Dämmen wird das überschüssige Wasser bei Regen in den Boden abgeführt und es kommt zu keiner Abschwemmung des Bodens, auch nicht bei plötzlichem Starkregen an Hängen. Viele meinen, ein Damm habe eine größere Oberfläche und die Verdunstung von Wasser werde erhöht. Turiel widerlegt diese Annahme und argumentiert, dass in den Trockengebieten Afrikas und Südamerikas die Dammkultur seit Jahrtausenden gepflegt wurde. Wichtig sei, dass die Kapillarwirkung an der Oberfläche unterbrochen sei. Dies geschieht bei den Arbeitsgängen durch zwei Drähte (eigentlich gebogene Rundeisen), die hinter der Schar verstellbar angebracht sind und flach unter der Oberfläche die Erde anheben und häufeln. Dadurch wird auch das Unkraut entwurzelt, oben abgelegt oder durch die Anhäufung zugeschüttet. Die Praxiserfahrung mit diesem Gerät mit stark verunkrauteten Ampfer-, Distel- und Queckenflächen lässt einen nur staunen, wie schnell diese unerwünschten Pflanzen verschwinden oder so stark reduziert werden, dass sie kein Problem mehr darstellen so die Aussagen der Praktiker. Wurzelmassen im Frühjahr Grundrahmen mit Drähten und Häufelkörper. Die Aussaat von Getreide, Erbsen, Ackerbohnen, Soja und Sonnenblumen erfolgt auf 45 Zentimeter, Mais auf 60 Zentimeter breiten Dämmen mit einer exakten Ablage durch eine Sä-Schar in der Dammmitte. Die Saatgutmenge ist gleich pro Hektar wie bei normaler Aussaat. Nach der Sä-Schar folgt eine Anhäufung des Dammes, so dass das Saatgut 6 bis 10 Zentimeter tief in der Erde liegt. Versuche zeigen, dass krümelige Dämme eine Keimung bei Buchweizen aus 18 Zentimeter, bei Mais aus 15 Zentimeter und Getreide aus 10 Zentimeter Tiefe ermöglicht. Ackerbohnen keimen auch aus noch tieferen Schichten (hat man früher auch untergepflügt). Dadurch kann die Kultur später gut gestriegelt werden, ohne die Saat zu schädigen. Die letzte Bearbeitung mit Turiel bei Getreide sollte abgeschlossen sein, wenn sich die Ähre vom letzten Knoten hebt. Der Zwischenfruchtanbau erfolgt flächig und kann auf 75 Zentimeter beziehungsweise 90 Zentimeter Dammbreite erfolgen, je nach Schlepperspur. Hier ist nicht die gebildete Blattmasse das wichtigste, sondern die gebildete Wurzelmasse. Das heißt, man kann Anfang September etwa mit einer Raps-, Kleeund Ölrettich-Mischung noch ausreichend Wurzelmasse im Damm bilden. Nach Angaben der Bio-Bauern waren die Dämme im Frühjahr ganz weiß von der Wurzelmasse, als sie aufgepflügt wurden, um die Einteilung der Dämme für die neue Aussaat vorzunehmen. Enormes Potenzial für Ökolandbau Ein gesunder Boden besteht zu 50 Volumenprozent aus Gestein (festen Bestandteilen) und zu 50 Prozent aus organischem Material. Bestes Beispiel ist der Regenwald, der auf einer 30 Zentimeter dicken lebendigen Bodenschicht steht. Nach einer Abholzung und konventionellen Nutzung wird diese Schicht innerhalb von wenigen Jahren abgebaut (zerstört) und übrig bleibt eine unfruchtbare Fläche, weil der Kreislauf von Ab- und Umbau organischer Masse mit Hilfe von Bodenleben unterbrochen worden ist. Ein echtes Krümel (Ton-Humus-Verbauung) ist elastisch und wird selbst bei Frost nicht zerstört, was wiederum eine Verschlämmung und Austrocknung des Oberbodens verhindert. Bei degenerierten Böden verschlämmt der Boden, trocknet aus und bekommt Risse. Die Resultate solcher Böden konnte man dieses Jahr in den enormen Auswaschungen an Maisfeldern nach Starkregen sehen. Johannes Doppelbauer bezeichnete dies treffend mit dem Ausspruch: Der Boden hat Durchfall. Abschließend waren die besichtigten Kulturen der eindeutige Beweis dafür, dass dieses System ein enormes Potenzial im ökologischen Landbau hat im Hinblick auf die Nährstoffversorgung und die Beikrautregulierung der Pflanzen, besonders in GV-losen beziehungsweise GV-armen Betrieben mit Ackerbau. Weitere Infos unter: oder auf YouTube einfach Turiel-Dammkultur eingeben. Hier gibt es viele Videos für die Praxis. Die Investitionssumme für die Grundausstattung liegt bei ,- bis ,- Euro. Mit Steinsicherung liegt man bei etwa ,- Euro. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, die Geräte für eine bestimmte Zeit zu leasen, um das System erst einmal auszuprobieren, und wieder zurückzugeben. Grundrahmen mit Kettenwalze im Frontanbau. v.l.n.r.: Thomas Pschorn, Julian Turiel, Siegfried Rettermayer, Alfred Pschorn.
24 BIOKREIS Bio-Königin Wir machen Bio königlich: Hoch lebe die erste Bayerische Bio-Königin Eva I. Eva Gottschaller wird ein Jahr lang charmantes Gesicht und starke Stimme für die bayerische Bio-Branche sein. Von Ronja Zöls -46- Bild oben: Vasalleneid der Bio-Verbände: (von links) Biokreis-Vorstandsvorsitzender Franz Strobl, Naturland- Landesvorsitzender Hubert Heigl, Bioland-Landesvorsitzender und LVÖ-Vorsitzender Josef Wetzstein und LVÖ-Geschäftsführer Harald Ulmer schwören ihrer Königin auf Knien die Treue. Bayerisch, authentisch und laut Biokreis-Winzer Gerhard Hoffmann aus echt zertifiziertem Anbau ist die erste Bayerische Bio-Königin, die im Namen der Bio-Verbände Biokreis, Bioland, Naturland und Demeter hochoffiziell im Biergarten des Biokreis-Imbiss Milchhäusl im Englischen Garten durch Hubert Bittlmayer, Amtschef des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, gekrönt wurde. Der Biokreis hat die 27-jährige Eva Gottschaller aus München für das Amt ausgewählt. Im kommenden Jahr wird sie die bayerische Bio-Branche vertreten und ihr ein Gesicht geben. Nachhaltig ausgestattet Vor der offiziellen Inthronisierung durfte sich Eva I. ihre Ausstattung für die Auftritte im kommenden Jahr aussuchen. Einige Frauen waren in den Englischen Garten gekommen, um der Bio-Königin ihr Dirndl zu leihen. Die Anprobe erfolgte prompt unter freiem Himmel. Was am besten passte und am schönsten war, wurde geliehen. Sogar per Post bekam die Bio-Königin ein Dirndl zugeschickt. Ich freu mich total, dass mir die Mädels ihre wunderschönen Kleider für ein Jahr anvertrauen, sagt Eva Gottschaller, die im Sinne der Nachhaltigkeit in ihrer Amtszeit etwas Gebrauchtes tragen wird. Vom Biokreis bekam Eva darüber hinaus eine maßgeschneiderte Bio-Lederhose, die nach den Biokreis-Leder-Richtlinien des Anbauverbands zertifiziert ist, sowie ein Hemd aus GOTS-zertifiziertem Mühlviertler Leinen. Außerdem trug sie Biokreis-zertifizierte Lederschuhe von Waschbär. Vasalleneid der Bio-Verbände auf Knien Nach der Kleiderwahl erfolgte unter der Moderation von Biokreis-Winzer Gerhard Hoffmann die Inthronisierung. Hubert Bittlmayer überreichte der Bayerischen Bio-Königin ihr Zepter aus kunstvoll gestaltetem Pappmaché und krönte sie mit einem Kranz aus getrockneten Hortensien. Die neue
25 BIOKREIS Bio-Königin -48- Bilder: Biokreis/ Chantal Alexandra Pilsl Bio-Königin wird charmantes Gesicht und starke Stimme für die Bio-Branche sein, sagte der Amtschef des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Bio bietet einen hohen Wert für den Umweltschutz, die Biodiversität und dafür, unsere schöne Heimat zu erhalten. Und die Menschen wollen Bio-Produkte! Damit die Bio-Königin möglichst viel Unterstützung als Botschafterin erfahre, forderte er die Vorsitzenden der Öko-Verbände auf, einen Vasalleneid zu leisten. Bioland-Landesvorsitzender und LVÖ-Vorsitzender Josef Wetzstein, Biokreis-Vorstandsvorsitzender Franz Strobl, Naturland-Landesvorsitzender Hubert Heigl und LVÖ-Geschäftsführer Harald Ulmer gingen daraufhin auf die Knie, um der Bio-Königin ihre Treue zu schwören. Zünftige Musik vom Biokreis-Landwirt Johann Schauer, Frühstücken, Entspannen auf Bierbänken und Liegestühlen, Fotoshootings und Gespräche mit den Gästen: So ging es bis über den Mittag hinaus. Eva Gottschaller Die erste Bayerische Bio-Königin Eva Gottschaller wurde 1989 in Rotthalmünster (Landkreis Passau) geboren und wuchs naturverbunden auf einem Biokreis-Bauernhof auf. Schon früh arbeitete sie auf dem Hof und in der Biohofbäckerei ihres Vaters mit und machte sich mit biologischer Landwirtschaft vertraut. Nach der Schule und einem Praktikum am Landestheater Niederbayern entschied sie sich 2011, darstellende Kunst zu studieren. Seit 2015 lebt Eva als freischaffende Schauspielerin in München und arbeitet im Biokreis-Imbiss Milchhäusl im Englischen Garten. Eva wünscht sich vor allem, dass sich mehr Menschen bewusst machen, was sie essen. Es empört mich, wie wir mit unseren Lebensmitteln und Tieren umgehen. Wir werfen alles wahllos weg, weil wir es im Überfluss haben. Wir behandeln die Tiere als wären sie Produkte und keine Lebewesen. Audienz mit der Bio-Königin Biokreis-Geschäftsführer Sepp Brunnbauer freut sich, dass die bayerische Bio-Branche nun eine Repräsentantin hat. Ich hoffe, dass die Idee, die der Biokreis initiiert und umgesetzt hat, weitergetragen wird, sagt er. Die Bio-Königin ist auf Facebook als Bio-Königin Eva zu finden. Sie nutzt das soziale Netzwerk, um Fragen der Verbraucher über Bio zu beantworten. Anfragen können auch über gestellt werden. Ihren nächsten großen Auftritt wird Eva I. auf dem Zentralen Landwirtschaftsfest haben, das zeitgleich zum Oktoberfest auf der Münchener Theresienwiese stattfindet. Am Tag des Ökolandbaus am 23. September wird sie im Festzelt bei einer gemeinsamen Veranstaltung der Landesvereinigung für ökologischen Landbau in Bayern (LVÖ) und des Bayerischen Bauernverbandes dabei sein. Hubert Bittlmayer gratuliert der ersten Bayerischen Bio-Königin nach ihrer Krönung. Bio-Königin Eva I. und (von links) LVÖ-Geschäftsführer Harald Ulmer, Naturland-Landesvorsitzender Hubert Heigl, Bioland-Landesvorsitzender und LVÖ-Vorsitzender Josef Wetzstein, Hubert Bittlmayer, Amtschef des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, und Biokreis-Vorstandsvorsitzender Franz Strobl. Hubert Bittlmayer, Harald Ulmer und Sepp Brunnbauer, Biokreis-Geschäftsführer, haben gute Laune. Die Inthronisierung der Bio-Königin Eva I. wurde unterstützt von der LVÖ, den Herrmannsdorfer Landwerkstätten, Basic, Denn s, Ökoring, Neumarkter Lammsbräu und der Biohofbäckerei Gottschaller.
26 Anzeige Aktuelles Aktuelles: Bayern Umstellertag des Biokreis: ein Appell zum Querdenken Mehr als 30 Interessenten kamen zum Biokreis-Umstellertag auf die Betriebe von Alois und Martina Egger in Bad Griesbach sowie von Anton Dapont in Egglham (Landkreis Passau). Biokreis-Berater Gerhard Falter stellte zunächst den Biokreis und dessen Aufgaben und regionale Vernetzung mit Mühlen, Fleischverarbeitern und Bäckern vor. Er erklärte, dass sich immer mehr Landwirte für die biologische Landwirtschaft interessieren. Dass man dabei auch neue Wege beschreiten kann, zeigen die beiden Betriebe Egger und Dapont. Auch Niko Gottschaller von der Hofbäckerei Gottschaller ermutigte die Landwirte, nicht immer nur das übliche anzubauen. Es gebe interessante Absatzmöglichkeiten für Kulturen und Produkte wie Lein, Kürbis- oder Sonnenblumenkerne und Kümmel, für die er einen klaren Bedarf bei den deutschen Bio-Bäckern sehe. Auf dem Betrieb von Familie Egger wurde bisher hauptsächlich Angus-Mutterkuhhaltung mit Direktvermarktung von Fleischmischpaketen und Getreidebau betrieben. Hiervon und von der kürzlich begonnenen extensiven Form der Mast von Turopolje-Schweinen, die in Kooperation mit Anton Dapont und seinem Tierleasing (siehe bionachrichten Juni/Juli) erfolgt, konnten sich die Besucher ein Bild machen. Nach der Besichtigung der Getreidebestände ging es weiter auf den Betrieb von Anton Dapont. Hier konnte sich die Gruppe die Turopolje-Schweine anschauen, die sich in der Freilandhaltung mit den einfachen Hütten als Unterstand sichtbar sauwohl fühlen. Auch seine Mutterkuhherde der Rasse Aubrac konnte im angrenzenden Tal beim Weiden beobachtet werden. Die Tiere bekommen nur Gras und Heu. Das sei entscheidend für die Qualität des Fleisches, so Dapont. Mit den besonderen Rassen, der naturnahen Haltung und Fütterung geht Anton Dapont aber auch neue Wege in der Vermarktung. Er verkauft die Tiere nicht an einen Schlachthof oder eine Metzgerei, sondern er verleast seine Tiere. Das bedeutet, seine Kunden bezahlen pro Tier einen bestimmten Obolus pro Monat für die Aufzucht des Tieres. Am Ende des Umstellertages konnten die Teilnehmer in der Jausenstation am Hausberghof von Anton Dapont exklusive Schinken- und Speckprodukte sowie leckere Bratwürste kosten. Anton Daponts Turopolje-Schweine. Bild: Zöls -51- Betriebsleiter Mack erklärt die Putenhaltung im Biobetrieb. Bild: Falter Putenhaltung und Ackerbau Um ökologische Putenhaltung und Ackerbau in der Praxis ging es bei einem weiteren Umstellertag des Biokreis und der BAGeno Bad Mergentheim. Etwa 35 Landwirte kamen auf dem Putenhof Sternhof Weikersholz der Familie Mack in Rot am See zusammen, um sich zeigen zu lassen, wie ökologische Bewirtschaftung auch für den eigenen Betrieb funktionieren könnte. BAGeno-Geschäftsführer Bertold Walter stellte sein Unternehmen vor und betonte den Wunsch der Genossenschaft, Waren von Bio-Landwirten abzunehmen und zu vermarkten. Gastgeber Michael Mack verdeutlichte am eigenen Betrieb, wie Ökolandbau in der Praxis aussehen kann. Seit 2003 mästet der Sternhof Puten nach biologischen Richtlinien. Im Stall haben die Tiere mehr als doppelt so viel Platz zur Verfügung wie in der konventionellen Putenmast üblich, abwechslungsreiche Einstreu und Gestaltung der Ställe ermöglichen arteigenes Verhalten, bei guter Witterung steht den Tieren ein Auslauf zur Verfügung. Auch dürfen die Tiere langsamer an Gewicht zulegen und werden später geschlachtet als in der konventionellen Haltung üblich. Das Futter der Puten stammt aus ökologischem Anbau, ein Teil des Getreides baut der Sternhof selbst an. Und so gehörte zu der Hofführung auch eine Felderbegehung zu den Kulturen Mais, Sonnenblumen, Weizen und Wintergerste. Biokreis-Berater Gerhard Falter freut sich besonders über die Rückmeldung, dass der Umstellertag dazu beigetragen hat, die Landwirte in ihrem Vorhaben zu bestärken und lädt weitere Interessenten ein, die Umstellungsberatung des Biokreis in Anspruch zu nehmen (Kontakt: ,
27 Aktuelles: Bayern Bild: Antersdorfer Die Gruppe mit Betriebsleiter Alfons Brütting vor einem Dinkelfeld... Trotz Hochwasserschaden Getreideanlieferung wie gewohnt möglich Das verheerende Hochwasser im Juni in Simbach hat auch die Antersdorfer Mühle nicht verschont. Der Mühlbach, der im Normalfall eine Wassertiefe von regulär 30 Zentimetern aufweist, erreichte in kürzester Zeit 5,40 Meter und flutete die Mühle vom Keller bis zum ersten Stockwerk. Durch die Gewalt des Wassers wurden nicht nur alle elektrischen wie elektronischen Bauteile zerstört, es wurden auch Verbindungsrohre aus ihren Verankerungen gerissen und Maschinen durch Wasser und Schlamm unbrauchbar gemacht. Die Familie Priemeier ist froh, dass trotz der bedrohlichen Lage keine Menschen zu Schaden gekommen sind. Für die Biokreis-Bauern der Region ist die Antersdorfer Mühle, die einzige 100-Prozent-Biomühle in Niederbayern, ein wichtiger Partner, der flexibel reagiert und auch kleine Mengen verarbeitet, so Sepp Brunnbauer, Biokreis-Geschäftsführer. Die Familie Priemeier hat es geschafft, dass zur Erntesaison die Getreideanlieferung zur Antersdorfer Mühle fast ohne Einschränkungen wieder durchgeführt werden kann. Das ist besonders für die regionalen Kleinbauern wichtig, denn sie sind aufgrund fehlender Lagermöglichkeiten auf die Direktanlieferung vom Feld zur Mühle angewiesen. Da die Brücke über den Mühlbach und damit die Zufahrt zur Mühle noch nicht wiederhergestellt ist, blieb das verkehrstechnische Problem der Anlieferung. Da halfen nun die Bauern rund um die Mühle mit Durchfahrtsrechten durch ihre Wiesen aus. Antersdorfer Mühle Nährstoffdynamik, Situation und Praxis Beim Hof- und Feldtag im Juni auf den Betrieben Alfons Brütting und Roswitha und Leonhard Poser in Waischenfeld (Oberfranken) konnte Biokreis-Berater Gerhard Falter viele interessierte Landwirte willkommen heißen. Ziel war, ein grundsätzliches Verständnis für den Nährstoffbedarf der Hauptkulturen im viehlosen Ackerbau zu schärfen. Neben einer standortangepassten Fruchtfolge wurden auch Flächen mit Grünschnitt- und Silage-gedüngten Flächen begutachtet und bewertet. Bei einem weiteren Workshop im Juli auf dem Biokreis-Hof von Christiane und Klaus Dietz mit Gerhard Falter ging es um Nährstoffdynamik, Situation und Praxis im viehhaltenden Betrieb. da Klaus Dietz erläutert seine Erfahrungen mit dem Triticale-Erbsen- Gemenge.... und mit Landwirt Leo Poser vor einer Rotkleevermehrung. Bilder: Falter -53- Albert Strobl, landwirtschaftlicher Verwalter am Müßighof. Bild: Falter Stickstoffkreislauf in der Landwirtschaft Bei einem Workshop auf dem Müßighof der Regens-Wagner-Stiftung mit Biokreis-Berater Gerhard Falter ging es vor allem darum, das Verständnis für den Stickstoffkreislauf im landwirtschaftlichen Betrieb zu schärfen. Anhand praktischer Übungen und der Beurteilung der Feldbestände wurden die Landwirte für eine sinnvolle Fruchtfolge und die Aufbereitung beziehungsweise Anwendung des hofeigenen organischen Düngers sensibilisiert. Entscheidend seien neben klimatischen Voraussetzungen vor allem die Bodenart sowie die Bodenbeschaffenheit. Hinzu komme die Verfügbarkeit von organischem Dünger aus der Viehhaltung und dessen Eigenschaften. gf Hof- und Felderbegehung auf Gut Mittelbüg Einen interessanten Tag erlebten die Teilnehmer der Hof- und Felderbegehung auf dem ökologisch geführten Hofgut Mittelbüg, zu dem Biokreis-Berater Gerhard Falter eingeladen hatte. Auf dem Gut wird das Futter für die Tiere des Tiergartens der Stadt Nürnberg angebaut. Neben dem Maschinenpark sowie der Aufbereitung des anfallenden Mists und der angebauten Kulturen, wie etwa Gras, Mais und Topinambur, wurde der Futterhof am Tiergarten besichtigt. Die Landwirte waren erstaunt über die Vielfalt und Menge des notwendigen Futters. Im Anschluss ging es durch den Tiergarten zum ökologisch geführten Tiergartenrestaurant Waldschänke, wo man den Tag gemütlich bei einer Bio-Brotzeit ausklingen ließ. da Futtermeister Gerd Schlieper bei seinen Ausführungen am Gut Mittelbüg.
28 Aktuelles: NRW -54- Tierwohl im ökologischen Landbau Fachgespräch Tierwohl im Landwirtschaftsministerium Nordrhein-Westfalen. Im Rahmen einer Fachveranstaltung zum Tierwohl beziehungsweise der Tierwohlkontrolle in ökologisch wirtschaftenden Betrieben kamen zahlreiche Vertreter der Behörden, Ökoverbände, Kontrollstellen, aber auch wissenschaftlicher Einrichtungen am 6. Juni 2016 in Düsseldorf zusammen. Im Zentrum des Austauschs standen zum einen die Ergebnisse der Tierwohlprojekte der Öko-Verbände in NRW, die in den Jahren 2013 bis 2015 durchgeführt wurden. Dabei wurden auf knapp 500 Betrieben der vier im Land vertretenen Ökoverbände Tierwohlchecks mit anschließenden Beratungsgesprächen durchgeführt. Zudem gab es einen Wissenstransfer im Zuge von ganztägigen Fachveranstaltungen sowie Vorträgen im Zuge von regionalen Gruppentreffen. Zum anderen berichteten beteiligte Wissenschaftler sowie Mitarbeiter der beauftragten Kontrollstelle GfRS vom gemeinsamen Projekt der Landwirtschaftsministerien NRW und Niedersachsen. Hierbei sollten, auch mit Blick auf die zahlreichen EU-Bio-Betriebe ohne Verbandsmitgliedschaft, wesentliche Indikatoren identifiziert werden, die im Zuge der Bio-Regelkontrolle hinsichtlich des Tierwohls sicher abgeprüft werden können. Schulungsmaterial für die hier tätigen Kontrolleure soll entwickelt und verbessert werden. Ergänzend berichtete auch die AG Tierwohl der Ökoverbände von der seit 2013 bestehenden Tierwohlkontrolle der Ökoverbände Biokreis, Bioland, Naturland, Demeter und Gäa. Hierbei werden jährlich rund 8000 tierhaltende Bio-Betriebe hinsichtlich definierter Tierwohlstandards überprüft. Mit Blick auf zukünftige Entwicklungen bleibt festzuhalten, dass nur wenige Tierwohlindikatoren vor dem Hintergrund zeitlicher Vorgaben in den Kontrollabläufen wissenschaftlich sicher beurteilt werden können. Mehr Zeit oder aber die Beschränkung auf entsprechende Indikatoren scheint eine logische Schlussfolgerung. jb Vermarktungsprojekt Uria-West nimmt Fahrt auf Bild: Bender Zweitägige Exkursion zum Thema Mutterkühe und Fleischrinder Wie bereits mehrfach angekündigt, findet am 19. und 20. Oktober 2016 eine zweitägige Exkursion beziehungsweise Fachveranstaltung zu aktuellen Themen der Fleischrinderhaltung statt. Die Verbände Biokreis und Bioland veranstalten diese bundesweite Fachtagung gemeinsam am Standort Fulda. Am ersten Tag, der den Exkursionen gewidmet ist, werden unter anderem drei Biokreis-Betriebe angeschaut. Nach einem gemütlichen Abend widmet sich der zweite Tag vielfältigen Vorträgen rund ums Thema Rindfleisch und Mutterkühe. Für die Teilnehmer aus Nordrhein-Westfalen wird ein besonderer Anreiseservice angeboten. Von Eslohe aus wird ein Reisebus über Olpe, Siegen sowie Wilnsdorf und weiter über Gießen den Tagungsort ansteuern und auch am Exkursionstag sowie zur Rückreise zur Verfügung stehen. Die Anreise per Bus wird circa 20 Euro je Teilnehmer kosten. Wir bitten alle Mitglieder mit Interesse an einer Teilnahme um eine baldige Rückmeldung an die Geschäftsstelle NRW unter Tel Ein detaillierter Anmelde-Flyer zum Programm der Exkursion sollte dieser Ausgabe der bionachrichten beiliegen beziehungsweise kann alternativ auch über die Geschäftsstelle in NRW bezogen werden. jb Exkursionsvorbereitung Orkney mit Turbulenzen Die Vorbereitung der diesjährigen Biokreis-Exkursion vom 11. bis 15./16.8. nach Orkney hat mehr Turbulenzen verursacht, als wir dies in den Vorjahren gewohnt waren. Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten bei der ursprünglich vorgesehenen Fluggesellschaft mussten An- und Abreise kurzfristig komplett neu organisiert werden. Durch freundliche Unterstützung des Reisebüros Kersting und einige Überstunden in der Biokreis-Geschäftsstelle konnte der ursprüngliche Non-Stop-Charterflug nun für die 34 Reiseteilnehmer aus NRW in zwei Linienflüge samt abschließender sechsstündiger Fährpassage von Aberdeen nach Kirkwall umgewandelt werden, sodass dieser Tage einer erneut faszinierenden Exkursion nichts im Wege stehen sollte. Zukünftig werden wir vermutlich aber verstärkt auf die bewährte Anreise per Bus zurückgreifen. jb Fleischrinderhalter können lokale Vermarktungsgruppen bilden. Projektleiter Thomas Baecker informierte anlässlich von mehreren Beratungsstammtischen zum Vermarktungsprojekt Uria-West, dass im Großraum Westerwald, Altenkirchen, Lahn-Dill und Südwestfalen interessante und hochwertig vergütete Absatzmöglichkeiten für Fleischrinder geboten werden sollen. Hierzu werden Betriebe oder lose Zusammenschlüsse kleinerer Betriebe gesucht, die regelmäßig (etwa alle zwei bis vier Wochen) Schlachttiere anbieten können. Für diese Schlachttiere wird eine sachgerechte Betäubung beziehungsweise Tötung mittels Weideschuss und anschließendem Ausbluten durch Uria-West in Abstimmung mit dem Tierhalter organisiert. Anschließend sollte ein lokaler Metzger die weitere Schlachtung des Tieres übernehmen. Nach ein bis zwei Tagen wird der gekühlte Schlachtkörper dann von Uria-West übernommen und zur Reifung, Zerlegung sowie Rinderwurstherstellung an einen zentralen Standort gebracht. Die Vermarktung der hochwertigen Produkte Rindfleisch und Rinderwurstaufschnitt ist über den gehobenen Biofachhandel vorgesehen. Interessenten melden sich bitte beim Biokreis NRW unter Tel jb Aktionstage nachhaltige Ernährung Köln isst joot lautet das Motto der Aktionstage nachhaltige Ernährung, die das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (MKULNV) auf den Weg gebracht hat. Das Thema Ernährung in die Mitte der Bevölkerung zu bringen, für die Lebensmittelverschwendung zu sensibilisieren und die Wertschätzung unserer Lebensmittel zu fördern, ist dabei das vorrangige Ziel. Die Versorgung mit regionalen Produkten spielt beim nachhaltigen Konsum eine wichtige Rolle. Akteure aus den verschiedensten Bereichen beteiligen sich an den Aktionstagen, lokale Unternehmen aus der Ernährungsbranche, Verbände und Vereine, lokale Initiativen, Kitas, Kirchen und viele mehr, auch die LVÖ NRW, der Dachverband der ökologischen Anbauverbände, ist eingebunden. Den Auftakt bildet am 3. September eine Veranstaltung auf dem Rudolfplatz in Köln mit vielen Ausstellungsund Infoständen und einem vielfältigen Bühnenprogramm. el
29 Aktuelles: Mitte Peronospora-Befall im Öko-Weinbau Das massive Auftreten des falschen Mehltaus (Reben- Peronospora) in vielen Weinbaugebieten in Deutschland gefährdet einen erheblichen Teil der diesjährigen Bio-Traubenernte mit existenzbedrohenden Folgen für die Winzer. Das feuchtwarme Wetter und viel Regen hatte den Befall extrem gefördert. Öko-Winzer können den Schadpilz nur mit Präparaten auf Kupfer-Basis bekämpfen, die bei stärkerem Regen jedoch von den Reben abgewaschen werden. Anders als in anderen Weinbau-Ländern, in denen die Winzer bis zu 6 kg Kupfer pro Hektar und Jahr verwenden dürfen, ist der Kupfer-Einsatz in Deutschland auf 3 kg pro Hektar und Jahr begrenzt. Bis 2013 war im Öko-Weinbau auch das regenstabile Pflanzenstärkungsmittel Kaliumphosphonat zugelassen. Eine Wiederzulassung scheiterte bisher an fehlender Unterstützung aus anderen Weinbau-Staaten der EU. Die Bio-Verbände in Deutschland verfolgen eine ambitionierte Kupfer-Minimierungsstrategie, diese Bemühungen werden Ich bin der Meinung, allerdings im Weinbau durch den Verlust von Kaliumphosphonat konterkariert. Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden- Württemberg und Bayern haben angesichts der massiven Schäden im Rahmen eines Großversuchs den Einsatz von Kaliumphosphonat in Öko-Weinbauflächen bis zur abgehenden Blüte ermöglicht. Durch den Versuch soll die nach der Anwendung notwendige Umstellungszeit auf Bio auf ein Jahr verkürzt werden. Da allerdings die rechtlichen und finanziellen Folgen des Einsatzes noch nicht absehbar sind, konnten sich viele betroffene Betriebe bisher nicht zur Teilnahme am Versuch entscheiden. Der BÖLW fordert Bundesminister Schmidt auf, mit seinen Kollegen aus den anderen Weinbauländern einen gemeinsamen Vorstoß für eine Wiederzulassung von Kaliumphosphonat im Öko-Weinbau zu initiieren. Der Einsatz soll dabei auf die Zeit bis zur abgehenden Blüte beschränkt bleiben, um Rückstände in den Trauben zu vermeiden. BÖLW dass die AÖL als Vertretung der ökologischen Verbände für Rheinland-Pfalz (RLP) und Saarland das Richtige fordert. Doch der Reihe nach... Landwirte und Winzer buchstabieren den Klimawandel dieses Mal so: 2015 war es viel zu trocken ist es viel zu nass. Schon jetzt ist in einem halben Jahr so viel Regen gefallen wie sonst das ganze Jahr. Die Pflanzen sind gestresst, ganze Ernten sind schon verloren. Im Ackerbau als auch im Weinbau geht es um Existenzen. Die Kupfermengen zur Bekämpfung von Schädlingen wurden bereits hochgesetzt. BÖLW und AÖL hatten von der EU eindringlich gefordert, den Sonderstatus eines Notfalles festzustellen und die Landesregierung in RLP zum Handeln aufgefordert. Das hat die Regierung versucht, doch Brüssel interessiert es nicht. Dann wäre der Einsatz von Kaliumphosphonat (KP) auch für ökologisch wirtschaftende Weinbaubetriebe möglich. Stattdessen so funktioniert Politikaktionismus initiierten das Wirtschaftsministerium und das Umweltministerium einen wissenschaftlichen Großversuch mit KP auf dem ökologischen Staatsweingut Bad Kreuznach, um die kurative Wirkung in einer Epidemielage zu prüfen. Weinbauländer wie Hessen, Baden- Württemberg und Bayern praktizieren ähnliche Initiativen. Daran könnten sich ökologische Winzer beteiligen. Das werden diese weder in RLP noch woanders tun, denn ihr Ökostatus wäre gefährdet. Beim Staatsweingut Bad Kreuznach zahlt der Steuerzahler ja die Verluste daraus. Ursprünglich war KP ein Stärkemittel und wurde vor drei Jahren für die Ökos gesperrt. Gegen den Willen der Umweltministerin Höfken. Wer es jetzt benutzt, kann diese Flächen nicht mehr ökologisch ausweisen und auf eine reduzierte erneute Umstellungszeit bestehen. Es gibt keine Rechtssicherheit. Wer Absicht dahinter vermutet, ist bestimmt Verschwörungstheoretiker. Der Plan funktioniert aber, denn erste Betriebe mit EU-Bio oder Verbandszugehörigkeit geben auf oder suchen abenteuerliche Konstruktionen einer Mixbewirtschaftung von biologischer und konventioneller Anbauweise. Da hilft auch nicht mehr der ewig gleiche politische Lösungsansatz mit den verbilligten Krediten. Gerhard Hoffmann (1. Vorstand Biokreis Mitte) Göcklingen trotzt dem Wetter Gerhard Hoffmann moderiert den Gockel Von Volker Born Einmal im Jahr erobert im 980-Seelendorf Göcklingen das Krähen, Gackern und Piepsen den Rathausplatz. Die Zeit der Gockelkrähmeisterschaft ist angebrochen. Auf der 3. Offiziellen Deutschen Gockelkrähmeisterschaft amüsierten sich trotz Fußball-Europameisterschaft wieder rund 1500 Menschen. Erstmals wurde die Veranstaltung mit einem Sicherheitskonzept versehen. Initiator und Moderator Gerhard Hoffmann, 1. Vorstand des Biokreis Erzeugerrings Mitte e.v., begrüßte aus dem Kärntener St. Andrä das 13-köpfige Team, welches in Österreich über mindestens zehn Tage das Gackerfest (www. gackern.net) veranstaltet. Wir sind total überrascht gewesen von der Stimmung und der besonderen Machart der deutschen Gockelkrähmeisterschaft, so Dr. Karl Feichtinger, Leiter des dortigen Organisationskomitees. Mit 24 Teams und Einzelpersonen ist die Gockelkrähmeisterschaft auf Wachstumskurs. Das mediale Interesse war überwältigend. Neben Hörfunkteams und vier Fernsehteams (SWR Landesschau Mainz, Baden-Baden, der Österreichische Rundfunk und der Offene Kanal aus Landau) ist auch die Deutsche Presseagentur (dpa) mit Fotografen dabei gewesen. Sie berichteten nicht nur über die Sieger in den drei Kategorien, sondern auch über die oftmals phantasievollen Kostüme und Choreographien. Traditionell treten Männer, Frauen und Kinder in den Kategorien Krähen und Stolzieren, Gackern und Glucksen sowie Piepsen und Gackern gegeneinander an. Gender-Neutralität ist garantiert, so dass Männer bei den Hennen und Frauen bei den Hähnen antreten können. Seit der zweiten Meisterschaft existiert eine offizielle Jury, die sich aus Persönlichkeiten der Landes- oder Bundespolitik, Journalisten und lokalen Größen wie Janina Huhn (Deutsche Weinkönigin 2014/1015) zusammensetzt. Wichtige Voraussetzung: Sie müssen Eier zählen und lachen können sowie intelligent sein. Der Ideengeber und Initiator Gerhard Hoffmann moderierte wieder im Pfälzer Dialekt und freute sich über das gestiegene hohe Niveau des Wettbewerbes. Es ist immer wieder schön, dass es Menschen gibt, die sich nicht so tierisch ernst nehmen. Das helfe auch der Dorfgemeinschaft und sei zudem eine touristische Bereicherung für Göcklingen wurde der Wettbewerb zur Aufwertung des örtlichen Weinfestes initiiert, heute sprechen alle nur noch von der Gockelkrähmeisterschaft Bild: Born Bilder: gockelkraehmeisterschaft.de
30 Aktuelles: Mitte DEINE BIOKREIS-ANSPRECHPARTNER Regionale Stammtische ein Weg zum kollegialen Austausch Von Volker Born Bundesverband / Geschäftsstelle Passau Sepp Brunnbauer Geschäftsführung Tel.: 0851 / brunnbauer@biokreis.de Michaela Mendl Leitung Geschäftsstelle, Messe- und Veranstaltungsorganisation Tel.: 0851 / mendl@biokreis.de -58- Hin und wieder muss man es sich vor Augen halten: Der Biokreis Erzeugerring Mitte e.v. umfasst vier Bundesländer. Also vier Regierungen, vier Auslegungen der ökologischen Förderung und eine große Fläche, die es hinsichtlich der Vernetzung zu bewältigen gilt. Deswegen hat sich der Vorstand entschlossen, in Kooperation mit Gerald Kamphaus (Ansprechpartner der Verarbeiter vom Bundesverband) Regionale Stammtische anzubieten. Unser erster Regionaler Stammtisch für Westerwald, Nordhessen und Rhön fand in Busek statt. Und er dauerte bis kurz vor Mitternacht, denn Thomas Baecker von Uriawest GmbH ( de) referierte das Konzept der Weidebetäubung durch den Kugelschuss. In langen Diskussionen wurde klar, dass hier konsequent das Tierwohl umgesetzt wird und die Landwirte eine bessere Bezahlung von bis zu 50 Prozent im Vergleich zu Schlachthofpreisen erzielen können. Die EU erlaubt die Weidebetäubung mit Kugelschuss bisher als Ausnahme, einen Regelbetrieb würde der Vorstand des Biokreis Erzeugerring Mitte e.v. befürworten. Peter Dänner (3. Vorstand) war vom Projekt so beeindruckt, dass er wie andere auch einsteigen will. Auf dem zweiten Regionalen Stammtisch für die Regionen Südhessen, Rheinhessen, Pfalz sowie nordbadische Biokreis-Betriebe als Gäste wurden die Teilnehmer auf dem ökologischen Pilotprojekt Klosterhof Neuburg GmbH & Co.KG ( mit dem umfassenden Konzept einer ökologischen Wertschöpfungskette vertraut gemacht. Geschäftsführer Hartmut Jäger und Landwirt Jan Sund erläuterten ihre Konzeption einer extensiven Landwirtschaft mit Viehhaltung auf der Weide über die größten zusammenhängenden Streuobstwiesen in Baden-Württemberg bis hin zur angeschlossenen Brauerei nebst Hofladen und Gastronomie. Dieses Kleinod der Naherholung liegt vor den Toren Heidelbergs und verbindet Ökologie, sinnhafte Ökonomie und Bildungsarbeit mit der Natur. Der Klosterhof Neuburg ist seit 2015 Biokreis-Mitglied. Der dritte Regionale Stammtisch wird für die Regionen Mosel, Eifel, Hunsrück und Saarland in Wittlich nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe stattfinden. Auch dort werden Biokreis-Mitglieder und Interessenten den kollegialen Austausch pflegen und hoffentlich voneinander profitieren. Biokreis Erzeugerring Bayern e. V. Gerald Kamphaus Beratung Verarbeitung Tel.: / Mobil: 0170 / kamphaus@biokreis.de David Hierenbach Beratung landwirtschaftliche Erzeugung Allgäu Tel.: / Mobil: 0157 / hierenbach@biokreis.de Sepp Forstner Beratung Oberbayern Mobil: 0171 / Forstner@biokreis.de Hubert Dietrich Beratung Imker Oberbayern Tel.: / Mobil: 0175 / dietrich@biokreis.de Anton Reisinger Beratung landwirtschaftliche Erzeugung Oberpfalz Tel.: / Mobil: 0171 / reisinger@biokreis.de Marc Schüller Beratung Imker Tel.: schueller@biokreis.de Gerhard Falter Beratung landwirtschaftliche Erzeugung Niederbayern und Franken Mobil: 0151 / falter@biokreis.de Hans Schiefereder Beratung Oberbayern Ost und Schwaben (Donau-Ries) Tel.: 0851 / schiefereder@biokreis.de Markus Heck Beratung Mecklenburg- Vorpommern, Brandenburg und Schleswig-Holstein Tel.: 0163 / heck@biokreis.de Gemeinsam denken statt einzeln kämpfen Der Biokreis gehört zu den kleineren, aber feinen Verbänden. Da wird Kollegialität groß geschrieben, und man freut sich, wenn ein grenzüberschreitender Stammtisch zwischen den Erzeugerringen (ER) NRW und Mitte stattfindet. Der diesjährige hessische Gastgeber Giso Jacobi (Biokreis-Mitglied seit 2015) begleitete die etwa 20 Landwirte aus den beiden Erzeugerringen auf seine Grün- und Weideflächen mit etwa 60 Kühen. Dabei erläuterte er die Bedingungen für die Haltung der Tiere im Winter auf der Weide. Bei den Jacobis müssen noch alle anpacken, die vier Kinder ebenso wie die Ehefrau. Giso Jacobi ist Landwirt im Nebenerwerb und arbeitet tagsüber bei einer großen Firma als Zerspanungsmechaniker. Der größere Teil seiner Vermarktung liegt im Bereich von NRW. Kein Wunder, ist das große Nachbarbundesland gerade mal ein paar Kilometer entfernt. Biokreis-NRW-Geschäftsführer Jörn Bender referierte beim abschließenden Imbiss über die Preisentwicklung der Rindervermarktung und aktuelle Gesetzgebungen. Volker Born von der Geschäftsstelle Mitte erläuterte die neuen Herausforderungen und Möglichkeiten des ER Mitte. vb Biokreis Erzeugerring Nordrhein-Westfalen Jörn Bender Geschäftsführung, Beratung landwirtschaftliche Erzeugung Tel.: / oder / nrw@biokreis.de Eva Lisges Stellv. Geschäftsführung, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit Tel.: / nrw@biokreis.de Biokreis Erzeugerring Mitte e. V. Biokreis e. V. Stelzlhof 1, D Passau Tel.: +49 (0) 851 / Fax: +49 (0) 851 / info@biokreis.de Biokreis Erzeugerring Bayern e. V. Stelzlhof 1, D Passau Tel.: +49 (0) 851 / Fax: +49 (0) 851 / info@biokreis.de Biokreis Erzeugerring NRW e. V. Dammstraße 19, D Hilchenbach Tel.: / Fax: / nrw@biokreis.de Volker Born Koordination der Geschäftsstelle Tel.: 0611 / mitte@biokreis.de Alle Ansprechpartner findest du auf Biokreis Erzeugerring Mitte e. V. Wasserrolle 2, Wiesbaden Tel.: +49 (0) 611 / Beratung: Tel.: +49 (0) 151 / mitte@biokreis.de
31 BIOKREIS Marktplatz Marktplatz BIOKREIS Warenbörse-Angebote -60- Futter, Bayern Winterweizen, Gerste und Triticale zu verkaufen Rita Weinberger, Pleiskirchen; Tel ; Biokreis Silorundballen und Strohquaderballen aus 2014 zu verkaufen. Josef Ebner, Deggendorf; Tel ; Biokreis Wintergerste, 8,4 to Bio A-Ware. Trocken eingefahren aus Ernte /to; Auburger, Bernhardswald; Tel ; Biokreis Bieten Heu, 1. Schnitt aus der Ernte 2015, unverregnet, trocken eingefahren, Ampferarm, günstig vor der neue Ernte an. Quaderballen 2m*0,8*1,2m per LKW oder zur Selbstabholung. Auch für Pferde geeignet. Auburger, Bernhardswald; Tel ; Biokreis Biete mehrere Silagerundballen aus 2 und folgenden Schnitten an. Gute Qualität, da luftdicht gewickelt, fest gepresst. Bio, A-Ware; Auburger, ; Tel ; Biokreis Klee-Luzernegras Silageballen; Aus Umstellungsbetrieb 1. oder 2. Schnitt 2016; Andrea Oberpriller, Ergolding; Tel ; Biokreis Kleegras-Siloballen Ernte 2016; Resele, Baindlkirch; Tel / ; Biokreis Kleegrasrundballen, Siloballen; Resele, Baindlkirch; Tel / ; Biokreis Rundballen, beste Qualität, Heu, Heuballen; Resele, Baindlkirch; Tel / ; Biokreis Hafer, gereinigt und abgesackt in 40 kg Säcke. 12 Sack; Richard Heinloth, Berngau- Röckersbühl; Tel ; Biokreis Bio-Heu in RB, Ernte 2016, zu verkaufen. Mobil: ; Gerhard und Ingrid Hufnagl, Pörnbach; Tel ; Biokreis Biete sehr gutes Heu in Quader- und Rundballen aus 2016; Resele, Baindlkirch; Tel / ; Biokreis Top Bioheu-Rundballen 2016; Kufer, Obergünzburg; Tel. 0171/ ; Biokreis Heu und Futterstroh; Peter Mayr, Schwabmünchen; Tel ; Biokreis Bio-Stroh; Thomas Schleier, Zimmerau; Tel ; Biokreis Bio-Rotklee Silage; Thomas Schleier, Zimmerau; Tel ; Biokreis 150 RB Heu, 1,20 m Durchmesser, 1. Schnitt 2016, zu verkaufen; Rita Weinberger, Pleiskirchen; Tel ; Biokreis Bio Heu; 1. Schnitt 2016, gute Qualität, 50 Großpacken 2,20 x 1,20 x 0,70 günstig abzugeben. Tel ; Michael Hartmann, Markt Wald; Tel ; Biokreis Futter, andere Regionen Ackerbohnen neue Ernte 2016; Reinhold Möller, Kalbach; Tel ; Biokreis Triticale, So-Gerste, Hafer. Alles neue Ernte 2016; Reinhold Möller, Kalbach; Tel ; Biokreis Heulage, sehr gute Qualität, 8-fach gewickelt; Rudolf Mathweis, Eslohe; Tel od ; Biokreis 30 Bio-Rundballen Heu, regenfrei; Christoph Schulze, Wenden; Tel ; Biokreis Sonstiges, alle Regionen Pferdekutsche zu verschenken. Wohnwagen zu verkaufen, 500 Euro. Rita Weinberger, Pleiskirchen; Tel ; Biokreis Fressgitter für Kälber, 5er, 6er, 7er. Preis VB; Rita Weinberger, Pleiskirchen; Tel ; Biokreis Bio-Almhütte; voll ausgestattete Ferienwohnung, Obb. Lkr.Traunstein, 60 qm, ganzjährig ab 34 E p.p./tag; und/oder info@ winklbauer.de Tel ; Bio-Obstgehölze/bäume, Kern-, Stein- u. Beerenobst, Nüsse großfr. Holunder als Stämmchen Bio-Baumschule PFLANZLUST Ampferstecher von Firma Krenhof, stabile Qualität. Im Sommer unentbehrlich zur mechanischen Unkrautbekämpfung. 32 Euro Netto, zzgl. Versandkosten. Zu bestellen bei: Biokreis e.v., Passau; Tel ; scheitza@biokreis.de Bio-Hühnermist; abgelagert, sehr kalkhaltig, auch zum Einmischen in die Güllegrube gut geeignet, zu verkaufen. Auf Nährstoffwerte untersucht: Gesamtstickstoff (N), Amoniumstickstoff (NH4-N), Phospat (P205), Kalium (K20). Detaillierter Befund auf Anfrage. LKW Transport kann organsiert werden. Josef Ebner; Tel / 26802; Biokreis Achtung Legehennenhalter! Eierschachteln, 10er-Pack mit Biokreis und regional&fair Emblem. Verpackungseinheit = 236 Schachteln, 49,90 Euro/Netto zuzüglich Versandkosten. Biokreis e.v Passau, Tel. 0851/ oder scheitza@ biokreis.de Bio-Vielfalt im Nutz-/Gemüsegarten! Saatgut alter Sorten, Blumen, Kräuter. Tel / Liebe Biokreis- Bäuerinnen und Bauern, dieses Jahr findet wieder das Bayerische Zentral-Landwirtschaftsfest beim Oktoberfest in München statt. Zelt 3 gehört dem ökologischen Landbau. Dort präsentiert sich auch der Biokreis mit einem Infostand und Verkostungsständen der Biokreis-Mitglieder Herrmannsdorfer Landwerkstätten und der Gottschaller Biohofbäckerei. Für die Betreuung des Biokreis-Infostandes suchen wir Bäuerinnen und Bauern, die dort den Biokreis repräsentieren und unsere Berater bei der Ansprache interessierter Landwirte und Verbraucher unterstützen. Wer also bereit ist, in der Zeit vom 17. bis 25. September 2016 gegen Aufwandsentschädigung einen Tag am Infostand des Biokreis auszuhelfen, meldet sich bitte in der Biokreis-Geschäftsstelle unter Tel: 0851 / oder per unter mendl@biokreis.de. -61-
32 BIOKREIS Marktplatz Marktplatz BIOKREIS Aus eigener Herstellung; BioApfelsaft naturtrüb (100% Direktsaft), sortenrein in ca. 20 verschiedenen Sorten, in 5 u. 10 kg Bag in Box Gebinden. Bio- Säfte aus Birnen, Quitten, Kriecherl, Pflaumen, Zwetschgen, Kirschen u. Holunderbeeren. BioSirup aus Blüten von Akazien, Holunder, Linden, Rosen u. Mädesüß. BioSirup von Johannisbeeren, Zitronenmelisse u. Maiwipferl. BioApfelmost (ungeschwefelt), Beeren- u. Kräuteressig, BioMostpunsch u. BioHimbeerpunsch(alkoholfrei) zu verkaufen. Eder Alois, Naßkamping 2, Windorf, Tel /8220 Tiere, Bayern Schwäbisch Hällisch x Pit Ferkel zu verkaufen.; Thomas Pils, Denklingen; Tel ; Biokreis Mehrere gebrauchte Kälberiglus, pro Stck. 180 Euro zu verkaufen. Rita Weinberger, Pleiskirchen; Tel ; Biokreis Tiere, andere Regionen Aberdeen, Angus Zuchtbulle, gekört, ca. 15 Monate alt, zu verkaufen. Preis: VB. Tel Marc u. Holger Born, Battenberg; Tel ; Biokreis Milchschaf/ Coburger Kreuzungen, Kaschmir Böcke, Tauernschecken Bock; Muttertiere mit, ohne, oder ausschließlich Lämmer; Kaschmirböcke, 4 Mon. und 7 Wochen alt, Tauernschecke 1 jährig; Rüdiger Aderhold, Bad Berleburg; Tel ; Biokreis 2 Limousin-Deckbullen, behornt, kein Herdbuch, 31 Mon. u. 12 Mon. Alt und 1 männl. Zuchtkalb, geb , zu verkaufen. Tel od. Tel ; Kurt Sagel, Bundenbach; Biokreis Regelmäßig Kreuzungskälber, Blonde x Braunvieh; Mendler, Legau; Tel ; Biokreis BV Jungkuh; 12,5 % SB-Anteil 24 ltr. Milch, gekalbt am Preis 1300 ; Otto Riedele, Ottobeuren; Tel ; Biokreis Stier, Pinzgauer, 20 Mon. alt, enthornt, weidegewohnt. Biete unseren Deckstier an. Sehr ruhiger Kerl, läuft in der Herde auf der Weide mit. Peter Schinnagl, Tuntenhausen; Tel ; Biokreis Biete frischmelkende Fleckvieh-Kuh, 3. Kalb; Resele, Baindlkirch; Tel ; Biokreis 6 trächtige Kalbinnen. Maria-Magdalena Heser, Fuchsmühl; Tel ; Biokreis Deutsche Landrasse x Duroc, Ferkel, je ca kg zu verkaufen.; Thomas Winklbauer, Burgkirchen; Tel ; Biokreis Limousin Herbuchabsetzer; zwei Limousin HB Absetzer, geb.am u Vater Baran Reservesieger Alsfeld 2016 in Alsfeld; Wigbert Jost, Großentaft; Tel ; Biokreis Zwei schwarze Galloway-Färsen (2 Jahre) für Zucht oder Schlachtung; Anne Steiner, Harsewinkel; Tel ; Biokreis Fünf männl. Galloway-Absetzer (8 Monate alt); Anne Steiner, Harsewinkel; Tel ; Biokreis Vier einjährige Aubrac-Jungrinder; voller Gesundheitsstatus, für Mast und Zucht geeignet; Anne Steiner, Harsewinkel; Tel / ; Biokreis Sieben Suffolk Mutterschafe und 3 einjährige Suffolk Böcke; Wegen Aufgabe der Schafzucht abzugeben. Preis VS. Können auch als Schlachttiere (oder bereits ausgeschlachtet) abgegeben werden.; Anne Steiner, Harsewinkel; Tel ; Biokreis Warenbörse-Gesuche Futter, Bayern Bio-Heu; aus Ernte 2016, Quaderballen, zu kaufen gesucht. Mobil: ; Klaus und Christiane Dietz GbR, Bundorf; Tel ; Biokreis Suche Weizen- oder Gerstenstroh, neue oder alte Ernte. Diem, Altusried; Tel ; Biokreis Erbsen und Ackerbohnen zu kaufen gesucht. Neumeier Nachhaltige Futtermittel GmbH, Schierling; Tel ; Biokreis Futtergetreide zu kaufen gesucht. Neumeier Nachhaltige Futtermittel GmbH, Schierling; Tel ; Biokreis
33 NRW und Mitte Warenbörse Heu und Stroh in Ballen zu kaufen gesucht. Neumeier Nachhaltige Futtermittel GmbH, Schierling; Tel ; Biokreis Tausche Silage gegen Heu Rundballen; Rüdiger Aderhold, Bad Berleburg; Tel ; Biokreis Mensch & Land Praktikantin vom gesucht, für Haus- und Landwirtschaft (Küche, Ferienwohnung) Franz und Irmgard Kinker, Roßhaupten; Tel ; Biokreis Sonstiges Angebote Angus-Herdbuchtiere, Kühe mit und ohne Kalb, gekörte Bullen, Tel Kreuzungs-Mutterkühe mit Kälbern, Kleegras in Silage RB neue Ernte, Heu RB 1,25m neue Ernte, Futtergetreide sowie Kverneland Packer mit Zugarm, Arbeitsbreite 2m zum Nachlauf o. Front geeignet, Raum Vogelsberg/ Rhön, Tel o Mehrere ruhige, gut bemuskelte, gen. hornlose (teilw. homozygot) Limousin-Herdbuch-Zuchtbullen sowie Li-Rinder zu verkaufen. Bio-Limousinzucht Josef Hubbeling, Vreden, Tel oder FOTO Bunte Bentheimer, 2 Zuchtsauen zu verkaufen, Tel Limousin, weibl. Absetzer im Herbst sowie tragende Rinder abzugeben, Tel Biete ab 2017 Pensionsviehweide für den Sommer (Raum Olpe) für 6-8 GVE, Tel Tragende Fleckvieh-Rinder sowie ca. 2 Tonnen Roggen und Triticale zu verkaufen, Tel RB Heulage, sehr gute Qualität, 8-fach gewickelt, Tel RB Rundballen, Bergwiesenheu ca. 1,35 Durchmesser, ohne Düngung, Ernte 2016, unberegnet, Scheunengelagert, Fam. Vey, Ehrenberg, Tel Biokreis-Betrieb aus Siegen sucht für eine kleine Gallowayherde (6 Kühe, 1 Bulle, Nachzucht) einen neuen Platz, da der Biokreis-Betrieb, bei dem die Tiere jetzt stehen, die Fläche mittelfristig selbst benötigt. Der Betrieb sollte im Umkreis von ca km um Siegen liegen, die Weidefläche sowie das Winterfutter (Heu, Silage) bereit stellen. Die tägliche Versorgung der Tiere wird von der Eigentümerin vorgenommen. Bei Interesse und für mehr Informationen rufen Sie gerne an bei Gudrun Jung, Tel oder Mail: jung-gudrun@web.de Limousin-Zuchtbulle ab 4 Jahre, reinerbig genetisch hornlos gesucht, Tel Bio-Dünger, Mist, Kompost, zu Gesuche kaufen gesucht. Niederbayern, Raum bionachrichten Bl. Aquitaine Jungbullen aus Herdbuchzucht laufend zu verkaufen,tel. Deg., Tel ; Max Anzeigen/Heidi Scheitza -64- Fritz, Hengersberg; Tel Stelzlhof 1, Passau , Der Biokreis NRW sucht für mehrere Mastbetriebe ständig männliche Abgabe von Angeboten und Gesu- Bezüglich aller o.g. Angebote und zur 6758; Biokreis Tel.: 0851 / Fax 0851 / scheitza@biokreis.de Fleckvieh-Zuchtbulle, 3,5 Jahre, Absetzer (möglichst keine Einzeltiere) chen für die nächste Ausgabe können gen. hornlos, sehr ruhig, im Herbst der gängigen Fleischrassen aus dem sie sich auch unter abzugeben, Tel Großraum NRW zu aktuellen Preisnotierungen, an die Biokreis Geschäftsstelle in Tel NRW wenden! Pflanzenölpresse; suche gebrauchte, elektrische Schneckenpresse (auch defekt) zur Herstellung kaltgepresster Speiseöle; Familie Beck, Oettingen; Tel ; Biokreis Tiere, Bayern Suche Fleckvieh oder Rotbunte Kalbinnen oder Milchkühe; Franz Spindler, Steingaden; Tel ; Biokreis Weibl. Limousin-Absetzer für Biohof, weidefähig, gesucht. Tel ; Oskar Grün, Bechhofen; Tel ; Biokreis Achtung: Bio-Hühner Ausstaller! Suche für Sept ca gesunde Bio-Althühner (Legealter ca. 1 Jahr) zum Weiterlegen. Zahle weit über Schlachtpreis. Barzahlung! Josef Ebner, Deggendorf; Tel ; Biokreis Die nächste Ausgabe der bionachrichten erscheint am 04. Oktober 2016 Anzeigenschluss für die Warenbörse im nächsten Heft: 16. September 2016
34 Personalien Rätsel / Verlosung BIOKREIS Anja Biedermann Neue Expertin für Qualität Anja Biedermann (43) verstärkt das Biokreis-Team in der Geschäftsstelle in Passau und hat im Juni die Leitung des Bereichs Qualitätssicherung übernommen. Als Diplom-Agraringenieurin, die neun Jahre lang für das synlab Umweltinstitut als Qualitätsmanagementbeauftragte tätig war, freut Anja sich, nun wieder zu ihren Wurzeln zurückgekehrt zu sein. Ihr Studium hat sie an der Universität Hohenheim in der Fachrichtung Pflanzenbau mit Vertiefung Umwelt absolviert. In ihrer Diplomarbeit befasste sie sich mit Beratungslehre. Im Biokreis steht für sie nun zunächst vor allem die Optimierung des Rohwarenmanagements an. Hans Schiefereder Beratung Mein Name ist Hans Schiefereder, ich bin 60 Jahre alt und lebe in Fürstenzell bei Passau. Als neuer Biokreis-Berater für Ackerbau, Grünland, Tierhaltung und Betriebsmanagement seit Juli 2016, möchte ich mich bei Ihnen kurz vorstellen. Aufgewachsen auf dem elterlichen, landwirtschaftlichen Betrieb bei Pocking, stand für mich schon als Kind fest, dass ich eines Tages meiner Leidenschaft und Berufung, Landwirt zu werden, folgen würde erhielt ich meinen landwirtschaftlichen Meisterbrief. Schon vor dieser Zeit beschäftigte und begeisterte mich der ökologische Landbau und ich besuchte viele Kurse (Kompostierung, Bodenbearbeitung etc.) der Familie Lübke, die damaligen Pioniere aus Peuerbach in Oberösterreich. Mir wurde sehr schnell klar, dass der konventionelle Landbau nicht meinen Werten und Visionen einer nachhaltigen Bewirtschaftung unserer wichtigsten Lebensgrundlage, dem Boden, unserer Erde, entsprach. So begann 1988 meine Laufbahn als Bio-Bauer beim Biokreis, mit einem 40-Hektar-Ackerbaubetrieb bei Pocking im Rottal, für den mein Herz über 25 Jahre lang schlug. Auf dem Acker bauten wir ein breites Spektrum an, das von Feldgemüse, den verschiedensten Getreidesorten bis zu Kartoffeln reichte. Zur Tierhaltung auf dem Hof zählten Zucht- und Mastschweine, Legehennen und Mutterschafe. Wir betrieben Direktvermarktung im eigenen Hofladen und auf drei verschiedenen Wochenmärkten in Passau und Pocking. Dazu kam die Herstellung von Vollkornbrot und Apfelsaft in Bio-Qualität verfolgte ich einen neuen privaten und beruflichen Lebenstraum. Eine mehrjährige intensive Ausbildung zum Life- und Business-Coach geben mir die Befähigung, Menschen in problematischen und schwierigen Lebenssituationen zu beraten und zu begleiten. Seit 2012 arbeite ich zudem freiberuflich für die Lacon-Kontrollstelle in Passau. Gerne stelle ich Euch all mein Erfahrungswissen als Bio-Bauer, Vermarkter, Kontrolleur, Coach und Mensch zur Verfügung. Ich freue mich darauf, Euch kennenlernen zu dürfen. Verlosung: Wir verlosen ein Paket mit drei Flaschen Silvaner 2015 des Biokreis-Weinguts Marienhof in Volkach (Franken). Bitte sende das Lösungswort aus dem Kreuzworträtsel mit Adresse an: R scheitza@biokreis.de oder eine Postkarte an bionachrichten, Biokreis e.v., Stelzlhof 1, Passau Viel Glück! F Bei der Juni-Verlosung hat Resi Middel, Oberveischeder Str. 29, Olpe, ein Geschenkpaket von der Bio-Imkerei Bio-Biene, bestehend aus einem Glas Wildblütenhonig, einem Glas Blütenhonig und einem Glas Waldhonig, gewonnen. -67-
35 Samstag. 08. Oktober und Sonntag, 09. Oktober Krimidinner Mördernacht Madonna Mia Tel / Safttpresse Passau Ab 10. September Saft gibt Kraft - die mobile Saftpresse am Stelzlhof und unterwegs im Passauer Land Anmeldung erfoderlich und ausschließlich unter: Tel / Weitere Infos unter: Bayernhof Bio GmbH Ihre südostbayerische Bio Dinkel Schälmühle Bio Dinkel Bio Emmer Dinkel Spelzen für Einstreu Dinkel-Lohnschälung Bio Getreide Herr Lammer, Herr Petzenhauser Tel.: / Bayernhof Bio GmbH Prof.-Reger-Str Hankofen Fax: / info@bayernhof.de Bund Naturschutz Samstag, 01. Oktober Kräuter-Weibchen und Wurzel-Zwerge Bild: condesign; pixabay Samstag, 08. Oktober Pilze im Neuburger Wald Tel / Ökologisches Zentrum Passau-Stelzlhof e.v. Ökostation des Bund Naturschutz für Niederbayern Stelzlhof 1, Passau Telefon: Stadtbus-Linie 6 Stelzlhof
36 BIOKREIS Bücher / Vorschau / Impressum Bücher Saatgut. Wer die Saat hat, hat das Sagen FAIRreisen Zero Waste -70- Wer die Saat hat, hat das Sagen. Dieses Sprichwort bringt es auf den Punkt: Wer unser Saatgut kontrolliert, kontrolliert die gesamte Nahrungsmittelkette. Die Agrarindustrie versucht weltweit, die Kontrolle über die Saat zu übernehmen. Doch vielerorts kämpfen Bauern und Gärtner dafür, über ihr Saatgut und ihre Art der Landwirtschaft selbst zu bestimmen. Sie geben ihr Saatgutwissen weiter, tauschen bäuerliche Sorten und erproben zukunftsfähige Wege der Zusammenarbeit. Welche Wege Samengärtner, Züchter und Aktivisten finden, um die Sortenvielfalt zu erhalten, schildert dieses liebevoll gestaltete Buch - und macht dabei Lust, beim Samengärtnern selbst dabei zu sein Der Tourismus boomt. Ungeachtet von Krieg, Terror und Flüchtlingskrisen reisen jährlich rund 1,2 Milliarden Menschen rund um den Globus das sind achtmal mehr als noch im Jahr Doch wie viel Tourismus verträgt unsere Erde? Fest steht, dass die Grenzen der Belastbarkeit vielerorts erreicht, wenn nicht bereits überschritten sind. Welche Probleme der immer weiter wachsende Massentourismus für Mensch, Umwelt und Klima mit sich bringt und wie wir einen umweltverträglicheren Tourismus leben können, zeigt der Tourismusexperte und Reisebuchautor Frank Herrmann in seinem neuen Buch. Wie der verantwortungsbewusste Tourismus der Zukunft aussieht? Ökologisch, sozial verträglich, klimafreundlich und politisch korrekt, so Frank Herrmann, und er liefert in seinem Buch zahlreiche Tipps, Ideen und Adressen zu dessen Realisierung. Zusätzlich stellt der Autor über 300 faire und grüne Länderreisetipps exklusiv und kostenlos im Internet zur Verfügung. Jeder Konsument hat sich schon einmal über die zigfache Verpackung eines Produkts geärgert. Müll ist ein gravierendes Problem unserer Zeit. Dieses Problem wächst so rasant, wie die Müllberge an Größe zunehmen. Zeit, endlich einmal etwas Effektives dagegen zu tun! Und da Otto Normalverbraucher meist nicht im Gemeinderat sitzt, bleibt nur der Anfang bei sich selbst. Shia Su hat schon als Erstklässlerin die Bäckerei-Verkäuferin darauf aufmerksam gemacht, dass diese das Gebäck in viel zu viele Tütchen einpacke. Und verstand die Welt nicht mehr, als sie sah, wie Erwachsene Müll auf die Straße warfen. Heute lebt sie mit ihrem Mann seit fast zwei Jahren Zero Waste, das heißt annähernd müllfrei, und ist überzeugt davon, dass dieser Lebensstil gar nichts mit Verzicht zu tun hat, sondern im Gegenteil das Leben viel angenehmer macht! Auf ihrem Blog Wasteland Rebel gibt sie praktische Tipps zur Müllvermeidung und zum Verkleinern des eigenen ökologischen Fußabdrucks. Anja Banzhaf: Saatgut. Wer die Saat hat, hat das Sagen. oekom verlag 2016, 272 S., Euro Frank Herrmann: FAIRreisen. Das Handbuch für alle, die umweltbewusst unterwegs sein wollen, oekom Verlag 2016, ca. 320 S., 19,95 Euro Shia Su: Zero Waste: Weniger Müll ist das neue Grün. Freya Verlag 2016, 160 S., 14,90 Euro Impressum Bild: Biokreis Vorschau bionachrichten Oktober/November Unser Titelthema für die nächste Ausgabe: Honig. Welche Sorten gibt es? Was lässt sich alles damit zubereiten? Was ist der Unterschied zwischen konventionell und biologisch hergestelltem Honig? Wie sieht es mit Gentechnik aus und welche Bienenkrankheiten können die Honig-Produktion beeinflussen? Mehr dazu in den nächsten bionachrichten. Herausgeber: Biokreis e.v. Stelzlhof 1 D Passau Tel.: +49 (0) 851 / Fax: +49 (0) 851 / info@biokreis.de Auflage: 6000 Gründer: Heinz Jacob Redaktion: Ronja Zöls Josef Brunnbauer Autoren: Dorothee Ahlers Jörn Bender Volker Born Ralf Bussemas Gerhard Falter Josef Forstner David Hierenbach Gerhard Hoffmann Eva Lisges Hans Marten Paulsen Toni Reisinger Andreas Remmelberger Hans Schiefereder Marc Schüller Friedrich Weißmann Stephanie Witten Julia Wolrab Satz und Layout: Stefanie Raith Titelbild: Biokreis, Chantal Alexandra Pilsl Druck: Druckerei Ostler Anzeigen: Heidi Scheitza Tel.: +49 (0) 851 / Fax: +49 (0) 851 / scheitza@biokreis.de Gedruckt auf 100% Recyclingpapier mit Blauem Engel
37
Ökologischer Landbau - Rechtliche Rahmenbedingungen, Umsetzung und Förderpolitik Erfahrungen aus Deutschland
 Ökologischer Landbau - Rechtliche Rahmenbedingungen, Umsetzung und Förderpolitik Erfahrungen aus Deutschland Moskau, 27.06.2016, Dr. Stefan Dreesmann Gesetzliche Grundlagen des Ökolandbaus in der EU Entwicklung
Ökologischer Landbau - Rechtliche Rahmenbedingungen, Umsetzung und Förderpolitik Erfahrungen aus Deutschland Moskau, 27.06.2016, Dr. Stefan Dreesmann Gesetzliche Grundlagen des Ökolandbaus in der EU Entwicklung
Umstellung auf ökologischen Ackerbau - Fruchtfolge, Düngung und Unkrautregulierung
 Umstellung auf ökologischen Ackerbau - Fruchtfolge, Düngung und Unkrautregulierung Hirschfeld, den 27.11.2014 Martin Hänsel Bioland Beratung Elemente einer Fruchtfolge Klee und Luzerne > N-Fixierung aus
Umstellung auf ökologischen Ackerbau - Fruchtfolge, Düngung und Unkrautregulierung Hirschfeld, den 27.11.2014 Martin Hänsel Bioland Beratung Elemente einer Fruchtfolge Klee und Luzerne > N-Fixierung aus
Dafür stehen wir ein: Tierwohl
 Dafür stehen wir ein: Tierwohl Die Knospe garantiert Bio-Qualität Biologische Produkte entstehen im Einklang mit der Natur. Das bedeutet artgerechte Tierhaltung und Fütterung sowie strikten Verzicht auf
Dafür stehen wir ein: Tierwohl Die Knospe garantiert Bio-Qualität Biologische Produkte entstehen im Einklang mit der Natur. Das bedeutet artgerechte Tierhaltung und Fütterung sowie strikten Verzicht auf
Dafür stehen wir ein: Tierwohl
 Dafür stehen wir ein: Tierwohl Die Knospe garantiert Bio-Qualität Biologische Produkte entstehen im Einklang mit der Natur. Das bedeutet artgerechte Tierhaltung und Fütterung sowie strikter Verzicht auf
Dafür stehen wir ein: Tierwohl Die Knospe garantiert Bio-Qualität Biologische Produkte entstehen im Einklang mit der Natur. Das bedeutet artgerechte Tierhaltung und Fütterung sowie strikter Verzicht auf
Sojabohnen aus der Region für Futtermittelerzeugung
 Sojabohnen aus der Region für Futtermittelerzeugung RKW Kehl GmbH Vorstellung Tochterunternehmen der ZG Raiffeisen eg Karlsruhe, 3.700 Mitglieder (davon die Mehrzahl Landwirte) Herstellung konventionelle
Sojabohnen aus der Region für Futtermittelerzeugung RKW Kehl GmbH Vorstellung Tochterunternehmen der ZG Raiffeisen eg Karlsruhe, 3.700 Mitglieder (davon die Mehrzahl Landwirte) Herstellung konventionelle
Lösungen zu den Aufgaben
 Informationsmaterialien über den ökologischen Landbau und zur Verarbeitung ökologischer Erzeugnisse für die Aus und Weiterbildung im Ernährungshandwerk und in der Ernährungswirtschaft (Initiiert durch
Informationsmaterialien über den ökologischen Landbau und zur Verarbeitung ökologischer Erzeugnisse für die Aus und Weiterbildung im Ernährungshandwerk und in der Ernährungswirtschaft (Initiiert durch
Tierschutz ist Klimaschutz - das Ende eines vermeintlichen Zielkonflikts
 Tierschutz ist Klimaschutz - das Ende eines vermeintlichen Zielkonflikts Gemeinsame Forderungen der Allianz für Tiere in der Landwirtschaft Dr. Brigitte Rusche Klimarelevanz der Landwirtschaft Tierbestand
Tierschutz ist Klimaschutz - das Ende eines vermeintlichen Zielkonflikts Gemeinsame Forderungen der Allianz für Tiere in der Landwirtschaft Dr. Brigitte Rusche Klimarelevanz der Landwirtschaft Tierbestand
Förderprojekt Junges Gemüse. 1. Das Förderprojekt. 2. Die Tüte für s Junge Gemüse. 3. Ökologischer Landbau ökologische Lebensmittel
 Förderprojekt Junges Gemüse in der / dem Schule /Kindergarten 1. Das Förderprojekt 2. Die Tüte für s Junge Gemüse 3. Ökologischer Landbau ökologische Lebensmittel Das Förderprojekt Darum geht s uns: Die
Förderprojekt Junges Gemüse in der / dem Schule /Kindergarten 1. Das Förderprojekt 2. Die Tüte für s Junge Gemüse 3. Ökologischer Landbau ökologische Lebensmittel Das Förderprojekt Darum geht s uns: Die
FRÜCHTE UND GEMÜSE IN KNOSPE-QUALITÄT
 FRÜCHTE UND GEMÜSE IN KNOSPE-QUALITÄT MIT DER NATUR- NICHT GEGEN SIE Bio-Gemüse und -Früchte gehören zu den beliebtesten, aber auch zu den anspruchsvollsten Erzeugnissen des Biolandbaus. Früchte und Gemüse
FRÜCHTE UND GEMÜSE IN KNOSPE-QUALITÄT MIT DER NATUR- NICHT GEGEN SIE Bio-Gemüse und -Früchte gehören zu den beliebtesten, aber auch zu den anspruchsvollsten Erzeugnissen des Biolandbaus. Früchte und Gemüse
Karl Ludwig Schweisfurth
 Karl Ludwig Schweisfurth Symbiosen in der Landbewirtschaftung Essen ist schicksalhaft für unser Leben, unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden, je nachdem ob wir lebensfördernde Lebens-Mittel oder billige
Karl Ludwig Schweisfurth Symbiosen in der Landbewirtschaftung Essen ist schicksalhaft für unser Leben, unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden, je nachdem ob wir lebensfördernde Lebens-Mittel oder billige
Suisse Garantie und Bio Suisse Lehrerinformation
 Lehrerinformation 1/5 Arbeitsauftrag Ziel Die beiden Label werden vorgestellt. Die SuS bilden Zweiergruppen. Ein Schüler erhält den Lückentext über Suisse Garantie, der andere über Bio Suisse. Zuerst lösen
Lehrerinformation 1/5 Arbeitsauftrag Ziel Die beiden Label werden vorgestellt. Die SuS bilden Zweiergruppen. Ein Schüler erhält den Lückentext über Suisse Garantie, der andere über Bio Suisse. Zuerst lösen
DAVID: und David vom Deutschlandlabor. Wir beantworten Fragen zu Deutschland und den Deutschen.
 Manuskript In Deutschland ist Bio ein großes Thema. Die Menschen kaufen gerne Biolebensmittel, auch wenn diese oft teurer sind. Nina und David wollen herausfinden, was bei Biolebensmitteln anders ist.
Manuskript In Deutschland ist Bio ein großes Thema. Die Menschen kaufen gerne Biolebensmittel, auch wenn diese oft teurer sind. Nina und David wollen herausfinden, was bei Biolebensmitteln anders ist.
DAS GELD LIEGT AUF DER WIESE
 DAS GELD LIEGT AUF DER WIESE Mehr Milch aus dem Grünland von Dipl.-HLFL-Ing. Josef Galler Das Dauergrünland verfügt über ein enormes Eiweißpotenzial. Auf heimischen Wiesen können 1.000 2.500 kg Rohprotein
DAS GELD LIEGT AUF DER WIESE Mehr Milch aus dem Grünland von Dipl.-HLFL-Ing. Josef Galler Das Dauergrünland verfügt über ein enormes Eiweißpotenzial. Auf heimischen Wiesen können 1.000 2.500 kg Rohprotein
Zustand und Zukunft des Grünlandes im Schwarzwald. Siegfried Jäckle
 Zustand und Zukunft des Grünlandes im Schwarzwald Zustand und Zukunft des Grünlandes im Schwarzwald Berggrünland zwischen Markt und Agrarpolitik Berggrünland zwischen Markt und Agrarpolitik 1. Die Rolle
Zustand und Zukunft des Grünlandes im Schwarzwald Zustand und Zukunft des Grünlandes im Schwarzwald Berggrünland zwischen Markt und Agrarpolitik Berggrünland zwischen Markt und Agrarpolitik 1. Die Rolle
Biotradition seit 1986
 Biotradition seit 1986 Inhalt Was ist der Martinshof? Was ist der Martinshof? Die Martinshof-Qualität 3 4 Monika und Gerhard Kempf leiten den Martinshof Ansässig im idyllischen Osterbrücken in St.Wendel,
Biotradition seit 1986 Inhalt Was ist der Martinshof? Was ist der Martinshof? Die Martinshof-Qualität 3 4 Monika und Gerhard Kempf leiten den Martinshof Ansässig im idyllischen Osterbrücken in St.Wendel,
Vermarktung von Getreide, Kartoffeln, Zwiebeln & Feldgemüse
 Vermarktung von Getreide, Kartoffeln, Zwiebeln & Feldgemüse Steffen Mucha ÖBS Öko-Bauernhöfe Sachsen GmbH, ÖBS Öko-Bauernhöfe Sachsen GmbH ÖBS Wer sind wir? ist eine Erzeugergemeinschaft von Öko-Landwirte
Vermarktung von Getreide, Kartoffeln, Zwiebeln & Feldgemüse Steffen Mucha ÖBS Öko-Bauernhöfe Sachsen GmbH, ÖBS Öko-Bauernhöfe Sachsen GmbH ÖBS Wer sind wir? ist eine Erzeugergemeinschaft von Öko-Landwirte
Grasland Schweiz. Oberstufe/Hauswirtschaft. Name:
 Die Schweiz ist ein typisches Grasland. Ihre Gesamtfläche beträgt 41 285 km 2. Neben dem Wald ist das Wiesland flächenmässig das wichtigste Landschaftselement der Schweiz. Die natürlichen Bedingungen wie
Die Schweiz ist ein typisches Grasland. Ihre Gesamtfläche beträgt 41 285 km 2. Neben dem Wald ist das Wiesland flächenmässig das wichtigste Landschaftselement der Schweiz. Die natürlichen Bedingungen wie
Gentechnik in Landwirtschaft und Lebensmitteln
 Vermeidbare Risiken für Mensch und Umwelt: Gentechnik in Landwirtschaft und Lebensmitteln Dr. sc. agr. Ina Walenda BUND Schleswig-Holstein e. V. Lerchenstraße 22 24103 Kiel 1 Was ist Gentechnik? Isolierung
Vermeidbare Risiken für Mensch und Umwelt: Gentechnik in Landwirtschaft und Lebensmitteln Dr. sc. agr. Ina Walenda BUND Schleswig-Holstein e. V. Lerchenstraße 22 24103 Kiel 1 Was ist Gentechnik? Isolierung
Bedeutung des heimischen Sojas für die Eiweißversorgung in Deutschland
 Standbild Bedeutung des heimischen Sojas für die Eiweißversorgung in Deutschland 1. Tag des deutschen Sojas 5. / 6. August 2010 in Dasing bei Augsburg Referenten-Folie Dr. Bernd Christiansen Regierungsdirektor
Standbild Bedeutung des heimischen Sojas für die Eiweißversorgung in Deutschland 1. Tag des deutschen Sojas 5. / 6. August 2010 in Dasing bei Augsburg Referenten-Folie Dr. Bernd Christiansen Regierungsdirektor
Tierfutter auf dem Weg durch die Welt. 07a / Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft
 Tierfutter auf dem Weg durch die Welt 07a / Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft Produktion von Tierfutter Weltweit sind fast 60% der Gersten-, Roggen-, Hirse- und Maisernte zum Tierfutter bestimmt. Knapp
Tierfutter auf dem Weg durch die Welt 07a / Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft Produktion von Tierfutter Weltweit sind fast 60% der Gersten-, Roggen-, Hirse- und Maisernte zum Tierfutter bestimmt. Knapp
Ist Ökolandbau eine Alternative für die Landwirtschaft? Dipl. Agr. Ing. Urte Grauwinkel
 Ist Ökolandbau eine Alternative für die Landwirtschaft? Gliederung IN SACHSEN E.V. 1. Welche Entwicklungstendenzen ergeben sich für die Landwirtschaft aus den gesellschaftlichen Anforderungen? 2. Was kann
Ist Ökolandbau eine Alternative für die Landwirtschaft? Gliederung IN SACHSEN E.V. 1. Welche Entwicklungstendenzen ergeben sich für die Landwirtschaft aus den gesellschaftlichen Anforderungen? 2. Was kann
Ohne Gentechnik Kennzeichnung Rechtliche Grundlagen und Marktentwicklung
 Ohne Gentechnik Kennzeichnung Rechtliche Grundlagen und Marktentwicklung Alexander Hissting Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.v. (VLOG) 10. November 2012 München Kleine VLOG Historie Mai 2008 EGGenTDurchfG
Ohne Gentechnik Kennzeichnung Rechtliche Grundlagen und Marktentwicklung Alexander Hissting Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.v. (VLOG) 10. November 2012 München Kleine VLOG Historie Mai 2008 EGGenTDurchfG
Aktuelle Studie im Auftrag der Andechser Molkerei Scheitz: Wie bio is(s)t Stuttgart?
 Presseinformation Aktuelle Studie im Auftrag der Andechser Molkerei Scheitz: Wie bio is(s)t Stuttgart? Andechs, 10. Oktober 2016 Was verstehen die Verbraucher in Stadt und Kreis Stuttgart unter bio? Aus
Presseinformation Aktuelle Studie im Auftrag der Andechser Molkerei Scheitz: Wie bio is(s)t Stuttgart? Andechs, 10. Oktober 2016 Was verstehen die Verbraucher in Stadt und Kreis Stuttgart unter bio? Aus
Auf einen Blick: Informationen zum Bio-Siegel
 Auf einen Blick: Informationen zum Bio-Siegel Klarheit für Verbraucher Auf einen Blick Eine Vielzahl unterschiedlicher Öko-/Bio- Kennzeichen machte es noch vor wenigen Jahren den Verbrauchern schwer, den
Auf einen Blick: Informationen zum Bio-Siegel Klarheit für Verbraucher Auf einen Blick Eine Vielzahl unterschiedlicher Öko-/Bio- Kennzeichen machte es noch vor wenigen Jahren den Verbrauchern schwer, den
Arbeitsauftrag. Ökolandbau. Klima-SnackBar. 1. Arbeitsauftrag für die Gruppe (15 Min.): Mind-Map zum ökologischen Landbau
 Arbeitsauftrag 1. Arbeitsauftrag für die Gruppe (15 Min.): Mind-Map zum ökologischen Landbau Schneiden Sie die Begriffskarten aus. Ordnen Sie die Karten inhaltlich nach Gruppen. Überlegen Sie, ob Sie noch
Arbeitsauftrag 1. Arbeitsauftrag für die Gruppe (15 Min.): Mind-Map zum ökologischen Landbau Schneiden Sie die Begriffskarten aus. Ordnen Sie die Karten inhaltlich nach Gruppen. Überlegen Sie, ob Sie noch
Wie viel Öko hätten Sie denn gerne?
 EU Bio und Naturland Öko im Vergleich Wie viel Öko hätten Sie denn gerne? EU Bio und Naturland Öko im direkten Vergleich www.naturland.de Naturland setzt höhere Maßstäbe Bio und Öko sind zwar geschützte,
EU Bio und Naturland Öko im Vergleich Wie viel Öko hätten Sie denn gerne? EU Bio und Naturland Öko im direkten Vergleich www.naturland.de Naturland setzt höhere Maßstäbe Bio und Öko sind zwar geschützte,
BIO kinderleicht erklärt!
 BIO kinderleicht erklärt! Arbeitsunterlage für den Sachunterricht FINANZIERT MIT FÖRDERMITTELN DER EUROPÄISCHEN UNION UND MITTELN DER AGRARMARKT AUSTRIA MARKETING GESMBH. WIR SIND EUROPAMEISTER! Nicht
BIO kinderleicht erklärt! Arbeitsunterlage für den Sachunterricht FINANZIERT MIT FÖRDERMITTELN DER EUROPÄISCHEN UNION UND MITTELN DER AGRARMARKT AUSTRIA MARKETING GESMBH. WIR SIND EUROPAMEISTER! Nicht
Mit einem Vorwort von. Warum sie wirklich gesünder sind
 D R. A N D R E A F L E M M E R Mit einem Vorwort von Warum sie wirklich gesünder sind Was ist eigentlich Bio? 15 verantwortungsbewusster Landwirte (siehe Kapitel Artgerechte Tierhaltung nützt den Tieren,
D R. A N D R E A F L E M M E R Mit einem Vorwort von Warum sie wirklich gesünder sind Was ist eigentlich Bio? 15 verantwortungsbewusster Landwirte (siehe Kapitel Artgerechte Tierhaltung nützt den Tieren,
Regionale und überregionale Vermarktungsmöglichkeiten für ökologisch erzeugte Druschfrüchte
 Regionale und überregionale Vermarktungsmöglichkeiten für ökologisch erzeugte Druschfrüchte Steffen Mucha ÖBS Öko-Bauernhöfe Sachsen GmbH, ÖBS Öko-Bauernhöfe Sachsen GmbH ÖBS Wer sind wir? ist eine Erzeugergemeinschaft
Regionale und überregionale Vermarktungsmöglichkeiten für ökologisch erzeugte Druschfrüchte Steffen Mucha ÖBS Öko-Bauernhöfe Sachsen GmbH, ÖBS Öko-Bauernhöfe Sachsen GmbH ÖBS Wer sind wir? ist eine Erzeugergemeinschaft
Jetzt Mitglied werden! BIOBODEN. AUS GUTEM GRUND.
 BIOBODEN. AUS GUTEM GRUND. Jetzt Mitglied werden! Liebe Leserinnen und Leser, wir möchten Sie zu einer Reise in eine gesunde Zukunft einladen. Unser gemeinsames Ziel: Ein Land, in dem sich die Menschen
BIOBODEN. AUS GUTEM GRUND. Jetzt Mitglied werden! Liebe Leserinnen und Leser, wir möchten Sie zu einer Reise in eine gesunde Zukunft einladen. Unser gemeinsames Ziel: Ein Land, in dem sich die Menschen
Milch ohne Gentechnik" auf dem Vormarsch was bedeutet das für Milchviehhalter und Futtermittellieferanten?
 Milch ohne Gentechnik" auf dem Vormarsch was bedeutet das für Milchviehhalter und Futtermittellieferanten? 1 GVO freie Fütterung Es geht NICHT um: - Ökologische Milchproduktion - Einsatz von Futtermitteln
Milch ohne Gentechnik" auf dem Vormarsch was bedeutet das für Milchviehhalter und Futtermittellieferanten? 1 GVO freie Fütterung Es geht NICHT um: - Ökologische Milchproduktion - Einsatz von Futtermitteln
Einführung in die ökologische Tierhaltung
 Informationsmaterialien über den ökologischen Landbau (Landwirtschaft einschließlich Wein-, Obst- und Gemüsebau) für den Unterricht an landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen (Initiiert durch das
Informationsmaterialien über den ökologischen Landbau (Landwirtschaft einschließlich Wein-, Obst- und Gemüsebau) für den Unterricht an landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen (Initiiert durch das
Analyse. Beratung. Fortbildung. Büro für Bodenschutz & Ökologische Agrarkultur. Analysis. Consultancy.
 Analyse Analysis Beratung Consultancy Fortbildung Training Büro für Bodenschutz & Klimabilanz tierisch gut? Tierhaltung und Klima Die Landwirtschaft ist bedeutende Mitverursacherin des Klimawandels. In
Analyse Analysis Beratung Consultancy Fortbildung Training Büro für Bodenschutz & Klimabilanz tierisch gut? Tierhaltung und Klima Die Landwirtschaft ist bedeutende Mitverursacherin des Klimawandels. In
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Staatsminister Helmut Brunner Bio aus Bayern - wo stehen wir im heimischen Markt und wo wollen wir hin? Erster Runder Tisch BioRegio
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Staatsminister Helmut Brunner Bio aus Bayern - wo stehen wir im heimischen Markt und wo wollen wir hin? Erster Runder Tisch BioRegio
Gentechnikfreie Regionen Hintergrundinformationen
 Hintergrundinformationen Bauernverband Schleswig-Holstein e.v. Definition Gentechnik Verfahren, mit denen Erbgut durch besondere Techniken in Organismen eingebracht und dadurch neu kombiniert werden.*
Hintergrundinformationen Bauernverband Schleswig-Holstein e.v. Definition Gentechnik Verfahren, mit denen Erbgut durch besondere Techniken in Organismen eingebracht und dadurch neu kombiniert werden.*
Eiweißalternativen in der Milchviehfütterung
 Eiweißalternativen in der Milchviehfütterung Hohe und schwankende Preise zur gleichen Zeit für Eiweißfuttermittel zwingen zum Einsatz günstiger Komponenten in der Milchviehfütterung. Hier besteht Einsparpotential
Eiweißalternativen in der Milchviehfütterung Hohe und schwankende Preise zur gleichen Zeit für Eiweißfuttermittel zwingen zum Einsatz günstiger Komponenten in der Milchviehfütterung. Hier besteht Einsparpotential
Gentechnisch verändert?
 Gentechnisch verändert? So wird gekennzeichnet! VERBRAUCHERSCHUTZ ERNÄHRUNG LANDWIRTSCHAFT Gentechnik in Lebensmitteln gibt es das schon? In Europa und Deutschland wurden bislang kaum gentechnisch veränderte
Gentechnisch verändert? So wird gekennzeichnet! VERBRAUCHERSCHUTZ ERNÄHRUNG LANDWIRTSCHAFT Gentechnik in Lebensmitteln gibt es das schon? In Europa und Deutschland wurden bislang kaum gentechnisch veränderte
Artgerechte Tierhaltung als Alternative?
 Nachhaltige Lebensstile Welchen Beitrag kann ein bewussterer Fleischkonsum zu artgerechter Tierhaltung und gesunder Ernährung leisten? Artgerechte Tierhaltung als Alternative? 27.08.2013 NEULAND e.v. Verena
Nachhaltige Lebensstile Welchen Beitrag kann ein bewussterer Fleischkonsum zu artgerechter Tierhaltung und gesunder Ernährung leisten? Artgerechte Tierhaltung als Alternative? 27.08.2013 NEULAND e.v. Verena
Bio, gut für die Natur, gut für uns.
 Bio, gut für die Natur, gut für uns. Certisys BE-BIO-01 FÜR S GEFLÜGEL ACTI KÜKENMEHL [438000000] Komplettes Kraftfutter für Küken. Aufmachung in Form von Mehl. Acti Küken besteht aus hundertprozentig
Bio, gut für die Natur, gut für uns. Certisys BE-BIO-01 FÜR S GEFLÜGEL ACTI KÜKENMEHL [438000000] Komplettes Kraftfutter für Küken. Aufmachung in Form von Mehl. Acti Küken besteht aus hundertprozentig
Die Geschichte stets fortschrittlicher Pionierarbeit
 Die Geschichte stets fortschrittlicher Pionierarbeit 1980 Verarbeitung von ökologisch erzeugter Milch 1908 Gründung 1986 Unverstrahltes Futter für Kühe der Andechser Milchlieferanten 1995 Zertifizierung
Die Geschichte stets fortschrittlicher Pionierarbeit 1980 Verarbeitung von ökologisch erzeugter Milch 1908 Gründung 1986 Unverstrahltes Futter für Kühe der Andechser Milchlieferanten 1995 Zertifizierung
Der Ökolandbau am Oberrhein in Zahlen
 Der Ökolandbau am Oberrhein in Zahlen Jürgen RECKNAGEL Schlagzeilen aus Die Bio-Branche 2013 (BÖLW) 9% mehr Bio-Umsatz in Europa 2011 (+ 6% in Deutschland, + 11% in Frankreich) Anteile Öko am Lebensmittelmarkt
Der Ökolandbau am Oberrhein in Zahlen Jürgen RECKNAGEL Schlagzeilen aus Die Bio-Branche 2013 (BÖLW) 9% mehr Bio-Umsatz in Europa 2011 (+ 6% in Deutschland, + 11% in Frankreich) Anteile Öko am Lebensmittelmarkt
Lebensmittel und Gentechnik
 Lebensmittel und Gentechnik Die wichtigsten Fakten www.bmelv.de 1 Gentechnik in Lebensmitteln ist ein sensibles Thema. Nach einer Umfrage im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft
Lebensmittel und Gentechnik Die wichtigsten Fakten www.bmelv.de 1 Gentechnik in Lebensmitteln ist ein sensibles Thema. Nach einer Umfrage im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft
Ohne Gentechnik - Damit Sie die Wahl haben!
 Ohne Gentechnik - Damit Sie die Wahl haben! Wahlfreiheit in Sachen Gentechnik. Die große Mehrheit der Verbraucherinnen und Verbraucher lehnt Genveränderungen in Lebensmitteln ab. Um Transparenz im gesamten
Ohne Gentechnik - Damit Sie die Wahl haben! Wahlfreiheit in Sachen Gentechnik. Die große Mehrheit der Verbraucherinnen und Verbraucher lehnt Genveränderungen in Lebensmitteln ab. Um Transparenz im gesamten
NATUR NÜTZEN. NATUR SCHÜTZEN.
 NATUR NÜTZEN. NATUR SCHÜTZEN. HALTUNG & ERHALTUNG Dem Land verbunden. Der Zukunft verpflichtet. Als freiwillige Interessenvertretung der Eigentümer von land- und forstwirtschaftlich bewirtschaftetem Boden
NATUR NÜTZEN. NATUR SCHÜTZEN. HALTUNG & ERHALTUNG Dem Land verbunden. Der Zukunft verpflichtet. Als freiwillige Interessenvertretung der Eigentümer von land- und forstwirtschaftlich bewirtschaftetem Boden
... Milch und Käse...
 ... Milch und Käse... Bio-Warenkunde Bio-Milch & Bio-Käse Seite 1 Bio-Milch und Bio-Käse Milch besteht zu 86% aus Wasser. Milch ist sehr nährstoffreich, versorgt uns mit hochwertigem Eiweiß, enthält leicht
... Milch und Käse... Bio-Warenkunde Bio-Milch & Bio-Käse Seite 1 Bio-Milch und Bio-Käse Milch besteht zu 86% aus Wasser. Milch ist sehr nährstoffreich, versorgt uns mit hochwertigem Eiweiß, enthält leicht
Vermarktung von Öko-Soja in Nord- Westdeutschland
 1 1988: Andreas und Klaus Engemann übernehmen den elterlichen Hof 1990: Gründung der A&K Engemann GbR (Handel Obst- & Gemüse) 1991: Gründung der Bioland Kyffhäuser GbR (184ha) 1994: Gründung der von Bismarck
1 1988: Andreas und Klaus Engemann übernehmen den elterlichen Hof 1990: Gründung der A&K Engemann GbR (Handel Obst- & Gemüse) 1991: Gründung der Bioland Kyffhäuser GbR (184ha) 1994: Gründung der von Bismarck
Bio in deutschen Metropolen hoch im Kurs
 Verbraucher-Studie Wie bio is(s)t Deutschland Bio in deutschen Metropolen hoch im Kurs Vom Nischen- zum Trendprodukt: Jeder dritte Verbraucher in Metropolen kauft ausschließlich oder regelmäßig Bio-Lebensmittel.
Verbraucher-Studie Wie bio is(s)t Deutschland Bio in deutschen Metropolen hoch im Kurs Vom Nischen- zum Trendprodukt: Jeder dritte Verbraucher in Metropolen kauft ausschließlich oder regelmäßig Bio-Lebensmittel.
Wer Huhn sagt, muss auch Hahn sagen
 P R E S S E M E L D U N G Wer Huhn sagt, muss auch Hahn sagen Huhn & Hahn Initiative der Werbegemeinschaft-08-Eier aus Baden- Württemberg e. V. für Aufzucht männlicher Küken in der Legehennenhaltung Mühlingen,
P R E S S E M E L D U N G Wer Huhn sagt, muss auch Hahn sagen Huhn & Hahn Initiative der Werbegemeinschaft-08-Eier aus Baden- Württemberg e. V. für Aufzucht männlicher Küken in der Legehennenhaltung Mühlingen,
Anbindehaltung in Bayern Sicht des Bayerischen Bauernverbandes
 Anbindehaltung in Bayern Sicht des Bayerischen Bauernverbandes Janne Richelsen Fachbereich Erzeugung und Vermarktung Bayerischer Bauernverband Milchviehhaltung in Bayern 16.000 Zeitliche Entwicklung Haltungsform
Anbindehaltung in Bayern Sicht des Bayerischen Bauernverbandes Janne Richelsen Fachbereich Erzeugung und Vermarktung Bayerischer Bauernverband Milchviehhaltung in Bayern 16.000 Zeitliche Entwicklung Haltungsform
Bio-Forschung und Umsetzung Gemeinsam Ziele erreichen
 Bio-Forschung und Umsetzung Gemeinsam Ziele erreichen Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder Bio-Institut der HBLFA Raumberg-Gumpenstein A-8952 Irdning www.raumberg-gumpenstein.at DANKE für Unterstützung und
Bio-Forschung und Umsetzung Gemeinsam Ziele erreichen Priv.-Doz. Dr. Andreas Steinwidder Bio-Institut der HBLFA Raumberg-Gumpenstein A-8952 Irdning www.raumberg-gumpenstein.at DANKE für Unterstützung und
Betriebs- und Flächenentwicklung verbandsangehöriger Bio-Erzeugerbetriebe
 Betriebs- und Flächenentwicklung verbandsangehöriger Bio-Erzeugerbetriebe 2001-2003 Biobetriebe 9500 414.507 ha 467.097 ha 488.094 ha Fläche in ha 500.000 9000 8500 8000 7500 7000 7.807 8.989 9.333 2001
Betriebs- und Flächenentwicklung verbandsangehöriger Bio-Erzeugerbetriebe 2001-2003 Biobetriebe 9500 414.507 ha 467.097 ha 488.094 ha Fläche in ha 500.000 9000 8500 8000 7500 7000 7.807 8.989 9.333 2001
Bioland-Bayern Wintertagung 2016 _ Kloster Plankstetten _ _ Klaus Engemann. 1988: Andreas und Klaus Engemann übernehmen den elterlichen Hof
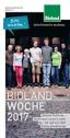 von in der Region 1 von in der Region 1988: Andreas und Klaus Engemann übernehmen den elterlichen Hof 1990: Gründung der A&K Engemann GbR (Handel Obst- & Gemüse) 1991: Gründung der Bioland Kyffhäuser GbR
von in der Region 1 von in der Region 1988: Andreas und Klaus Engemann übernehmen den elterlichen Hof 1990: Gründung der A&K Engemann GbR (Handel Obst- & Gemüse) 1991: Gründung der Bioland Kyffhäuser GbR
IST BIO DRIN WO BIO DRAUF STEHT?
 IST BIO DRIN WO BIO DRAUF STEHT? Ja - In EU-Rechtsvorschriften sind Standards definiert für: Öko-Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse Verarbeitungsrichtlinien von Öko- Lebensmitteln Kennzeichnungsvorschriften
IST BIO DRIN WO BIO DRAUF STEHT? Ja - In EU-Rechtsvorschriften sind Standards definiert für: Öko-Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse Verarbeitungsrichtlinien von Öko- Lebensmitteln Kennzeichnungsvorschriften
Nachhaltige Produkte bei Transgourmet. Stand: 6. April 2017
 bei Transgourmet Stand: 6. April 2017 Für mehr Nachhaltigkeit bei Lebensmitteln Alternativen zu konventionell erzeugten Lebensmitteln Tierwohl Bioland MSC Bio Siegel & Zertifikate Naturland Fairtrade ASC
bei Transgourmet Stand: 6. April 2017 Für mehr Nachhaltigkeit bei Lebensmitteln Alternativen zu konventionell erzeugten Lebensmitteln Tierwohl Bioland MSC Bio Siegel & Zertifikate Naturland Fairtrade ASC
Zweck. Definition. Übersicht. Status Version 06: freigegeben vom Vorstand am Seite 1 / 5
 ANFORDERUNGEN 06, Version 06 Sojaverarbeitungsbetrieb bis Vermarkter Zweck Festlegung der Anforderungen, die von Betrieben zu erfüllen sind, die in der Produktions- und Verarbeitungskette dem Mischfutterwerk
ANFORDERUNGEN 06, Version 06 Sojaverarbeitungsbetrieb bis Vermarkter Zweck Festlegung der Anforderungen, die von Betrieben zu erfüllen sind, die in der Produktions- und Verarbeitungskette dem Mischfutterwerk
Chancen und Risiken der Gentechnik aus berufsständischer Sicht
 Chancen und Risiken der Gentechnik aus berufsständischer Sicht Vortrag zum Workshop: Ist gentechnikfreie Regionalvermarktung möglich? Saerbeck, 29. April 2014 Verena Kämmerling Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband
Chancen und Risiken der Gentechnik aus berufsständischer Sicht Vortrag zum Workshop: Ist gentechnikfreie Regionalvermarktung möglich? Saerbeck, 29. April 2014 Verena Kämmerling Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband
UNION ZUR FÖRDERUNG VON OEL- UND PROTEINPFLANZEN E.V. Eiweiß vom Acker! Körnerleguminosen mehr als nur Futter.
 UNION ZUR FÖRDERUNG VON OEL- UND PROTEINPFLANZEN E.V. Eiweiß vom Acker! Körnerleguminosen mehr als nur Futter www.ufop.de Eiweißpflanzen auf dem Feld Eine ausgewogene und gesunde Ernährung besteht aus
UNION ZUR FÖRDERUNG VON OEL- UND PROTEINPFLANZEN E.V. Eiweiß vom Acker! Körnerleguminosen mehr als nur Futter www.ufop.de Eiweißpflanzen auf dem Feld Eine ausgewogene und gesunde Ernährung besteht aus
Erfahrungsbericht OGT Fütterung am Eiermarkt und Empfehlungen für weitere Projekte
 Erfahrungsbericht OGT Fütterung am Eiermarkt und Empfehlungen für weitere Projekte Hr. Bgm. BBKO Franz Karlhuber, Obm.stv. EZG Frischei 07.Juni 2011 03.Österr. Soja Symposium 1 Nährstoffbombe Ei Quelle
Erfahrungsbericht OGT Fütterung am Eiermarkt und Empfehlungen für weitere Projekte Hr. Bgm. BBKO Franz Karlhuber, Obm.stv. EZG Frischei 07.Juni 2011 03.Österr. Soja Symposium 1 Nährstoffbombe Ei Quelle
Die Produktlinie Heimische Öle auf Erfolgskurs
 Die Produktlinie Heimische Öle auf Erfolgskurs 3. Fachtagung ökologischer Ölpflanzenanbau, 19. Februar 2016 Warum eigentlich? Verteilung Bio-Ölsaaten-Anbauflächen in der EU Quelle: Agence BIO, 2013 (Erhebungszeitraum:
Die Produktlinie Heimische Öle auf Erfolgskurs 3. Fachtagung ökologischer Ölpflanzenanbau, 19. Februar 2016 Warum eigentlich? Verteilung Bio-Ölsaaten-Anbauflächen in der EU Quelle: Agence BIO, 2013 (Erhebungszeitraum:
Meinungen und Einstellungen der Bürger zur Milchwirtschaft in Deutschland 2017
 der Bürger zur Milchwirtschaft 2017 Auftraggeber: Landesvereinigung Milchwirtschaft Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen e.v. 21. April 2017 34619/Q7381 Le/Wi Datengrundlage Grundgesamtheit: Bevölkerung
der Bürger zur Milchwirtschaft 2017 Auftraggeber: Landesvereinigung Milchwirtschaft Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen e.v. 21. April 2017 34619/Q7381 Le/Wi Datengrundlage Grundgesamtheit: Bevölkerung
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Staatsminister Helmut Brunner Landesweite Eröffnung Tag des offenen Hofes 2012 16. Juni 2012, Eßleben Es gilt das gesprochene Wort!
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Staatsminister Helmut Brunner Landesweite Eröffnung Tag des offenen Hofes 2012 16. Juni 2012, Eßleben Es gilt das gesprochene Wort!
Produkte aus ökologischem Landbau beschaffen
 Informationsmaterialien über den ökologischen Landbau und zur Verarbeitung ökologischer Erzeugnisse für die Aus- und Weiterbildung im Ernährungshandwerk und in der Ernährungswirtschaft (Initiiert durch
Informationsmaterialien über den ökologischen Landbau und zur Verarbeitung ökologischer Erzeugnisse für die Aus- und Weiterbildung im Ernährungshandwerk und in der Ernährungswirtschaft (Initiiert durch
Das Beste von der Sommerfrische...
 Das Beste von der Sommerfrische...... gibt s für unsere Kühe auch im Winter. MIT UNTERSTÜTZUNG VON BUND UND EUROPÄISCHER UNION Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums:
Das Beste von der Sommerfrische...... gibt s für unsere Kühe auch im Winter. MIT UNTERSTÜTZUNG VON BUND UND EUROPÄISCHER UNION Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums:
Deutscher Bauernve. Faktencheck Haltung von Milchkühen. faktencheck-landwirtschaft.de
 Deutscher Bauernve Faktencheck Haltung von Milchkühen faktencheck-landwirtschaft.de Behauptet wird, dass Milchkühe in Deutschland nicht tiergerecht gehalten werden und Anbindehaltung immer noch weit verbreitet
Deutscher Bauernve Faktencheck Haltung von Milchkühen faktencheck-landwirtschaft.de Behauptet wird, dass Milchkühe in Deutschland nicht tiergerecht gehalten werden und Anbindehaltung immer noch weit verbreitet
MITTWOCHS IM MULEWF. Mitreden! Politik im Dialog. Bio: Gut für Gesundheit und Umwelt. Mittwoch, 17. Juni 2015, Uhr
 MINISTERIUM FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNG, WEINBAU UND FORSTEN MITTWOCHS IM MULEWF Bio: Gut für Gesundheit und Umwelt Mitreden! Politik im Dialog Mittwoch, 17. Juni 2015, 16.00 Uhr Sehr geehrte
MINISTERIUM FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNG, WEINBAU UND FORSTEN MITTWOCHS IM MULEWF Bio: Gut für Gesundheit und Umwelt Mitreden! Politik im Dialog Mittwoch, 17. Juni 2015, 16.00 Uhr Sehr geehrte
Weniger Kraftfutter, mehr Erfolg Entwicklung von Betrieben in. Baden-Württemberg
 Entwicklung von Betrieben in Baden-Württemberg Uwe Eilers Landwirtschaftliches Zentrum für Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und Fischerei Baden-Württemberg Atzenberger Weg 99, 88326
Entwicklung von Betrieben in Baden-Württemberg Uwe Eilers Landwirtschaftliches Zentrum für Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und Fischerei Baden-Württemberg Atzenberger Weg 99, 88326
Bedeutung von Clostridien in Futter, Stall und Milch für die Käsetauglichkeit
 Bedeutung von Clostridien in Futter, Stall und Milch für die Käsetauglichkeit Xanten, 2. Dezember 2014 Dr. E. Leisen, Öko-Team der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 1 Schwerpunkte des Vortrages
Bedeutung von Clostridien in Futter, Stall und Milch für die Käsetauglichkeit Xanten, 2. Dezember 2014 Dr. E. Leisen, Öko-Team der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 1 Schwerpunkte des Vortrages
Kurze Geschichte des Biolandbaus Christoph Schinagl
 Kurze Geschichte des Biolandbaus Christoph Schinagl Plankstetten, 07.02.2017 Entwicklung der Landwirtschaft in Europa bis zum 20.Jh. Kartoffel Klee Zucht: Saatgut &Tier Ertragszuwächse? Tierhaltung Mistdüngung
Kurze Geschichte des Biolandbaus Christoph Schinagl Plankstetten, 07.02.2017 Entwicklung der Landwirtschaft in Europa bis zum 20.Jh. Kartoffel Klee Zucht: Saatgut &Tier Ertragszuwächse? Tierhaltung Mistdüngung
InnoPlanta Forum 2010 Grüne Biotechnologie ist weltweit Realität - Die Sicht eines Pflanzenzüchtungsunternehmens
 InnoPlanta Forum 2010 Grüne Biotechnologie ist weltweit Realität - Die Sicht eines Pflanzenzüchtungsunternehmens Philip von dem Bussche KWS SAAT AG Üplingen, 6. September 2010 Globale Herausforderungen
InnoPlanta Forum 2010 Grüne Biotechnologie ist weltweit Realität - Die Sicht eines Pflanzenzüchtungsunternehmens Philip von dem Bussche KWS SAAT AG Üplingen, 6. September 2010 Globale Herausforderungen
Name: Schweizer Nahrungsmittel-Labels
 Hinweis Eine Übersicht über alle Labels kann beim Landwirtschaftlichen Informationsdienst (LID) bestellt oder als PDF-Dokument heruntergeladen werden: www.lid.ch > Service > PDF-Dokumente > Minibroschüren
Hinweis Eine Übersicht über alle Labels kann beim Landwirtschaftlichen Informationsdienst (LID) bestellt oder als PDF-Dokument heruntergeladen werden: www.lid.ch > Service > PDF-Dokumente > Minibroschüren
Erfahrungen mit dem Einsatz von Luzerne in der Milchviehfütterung. Jules Vermunt Berghof GbR Wölferlingen (Westerwald)
 Erfahrungen mit dem Einsatz von Luzerne in der Milchviehfütterung Jules Vermunt Berghof GbR Wölferlingen (Westerwald) Gliederung Persönliche Vorstellung Vorstellung Betrieb Fütterung Milchkühe Luzerneanbau
Erfahrungen mit dem Einsatz von Luzerne in der Milchviehfütterung Jules Vermunt Berghof GbR Wölferlingen (Westerwald) Gliederung Persönliche Vorstellung Vorstellung Betrieb Fütterung Milchkühe Luzerneanbau
Gesunde Ernährung Eine Broschüre in leicht verständlicher Sprache
 Gesunde Ernährung Eine Broschüre in leicht verständlicher Sprache von Anna-Katharina Jäckle Anika Sing Josephin Meder Was steht im Heft? 1. Erklärungen zum Heft Seite1 2. Das Grund-Wissen Seite 3 3. Die
Gesunde Ernährung Eine Broschüre in leicht verständlicher Sprache von Anna-Katharina Jäckle Anika Sing Josephin Meder Was steht im Heft? 1. Erklärungen zum Heft Seite1 2. Das Grund-Wissen Seite 3 3. Die
Sehr verehrter Herr Minister, sehr verehrter Prinz zu Löwenstein, meine sehr verehrten Damen und Herren!
 Rede des niederländischen Ministers für Landwirtschaft, Martijn van Dam, anlässlich des Empfangs des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft auf der Grünen Woche in Berlin, 15. Januar 2016 Sehr verehrter
Rede des niederländischen Ministers für Landwirtschaft, Martijn van Dam, anlässlich des Empfangs des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft auf der Grünen Woche in Berlin, 15. Januar 2016 Sehr verehrter
Der Bauernhof. als. Klassenzimmer
 Der Bauernhof als Klassenzimmer Der Bauernhof als Klassen- zimmer Die CD-Serie für Schulen Der Bauernhof als Klassenzimmer Die CD-Serie für Schulen und alle, die sich dafür interessieren, wie unsere Lebensmittel
Der Bauernhof als Klassenzimmer Der Bauernhof als Klassen- zimmer Die CD-Serie für Schulen Der Bauernhof als Klassenzimmer Die CD-Serie für Schulen und alle, die sich dafür interessieren, wie unsere Lebensmittel
Eigenversorgung mit Eiweißfutter in Bayern
 Eigenversorgung mit Eiweißfutter in Bayern Möglichkeiten und Grenzen Sojatag 2013 16. Januar 2013 im Bauernmarkt Dasing Robert Schätzl Institut für Agrarökonomie Deutschland: Erzeugung von und Außenhandel
Eigenversorgung mit Eiweißfutter in Bayern Möglichkeiten und Grenzen Sojatag 2013 16. Januar 2013 im Bauernmarkt Dasing Robert Schätzl Institut für Agrarökonomie Deutschland: Erzeugung von und Außenhandel
Label-Salat : Ist wirklich bio drin, wo bio drauf steht?
 Label-Salat : Ist wirklich bio drin, wo bio drauf steht? Fachbetreuung (Verarbeitung Fleisch) f.mayer@abg.at +43 664 88424316 Königsbrunner Straße 8 2202 Enzersfeld S 1 Wir sind die Bio Garantie Vom Seewinkel
Label-Salat : Ist wirklich bio drin, wo bio drauf steht? Fachbetreuung (Verarbeitung Fleisch) f.mayer@abg.at +43 664 88424316 Königsbrunner Straße 8 2202 Enzersfeld S 1 Wir sind die Bio Garantie Vom Seewinkel
Herausforderungen der Futtertrocknungen in der Zukunft
 Regionalkonferenz am 26. Juni 2015 zu Europäischen Innovationspartnerschaften in der Landwirtschaft Herausforderungen der Futtertrocknungen in der Zukunft Matthias Vögele: Geschäftsführer Futtertrocknung
Regionalkonferenz am 26. Juni 2015 zu Europäischen Innovationspartnerschaften in der Landwirtschaft Herausforderungen der Futtertrocknungen in der Zukunft Matthias Vögele: Geschäftsführer Futtertrocknung
Weltagrarhandel am Beispiel Soja
 Weltagrarhandel am Beispiel Soja AK 1 des 16. Landesschulgeographentag 2014, Universität Vechta Dr. Aline Veauthier (WING, Universität Vechta) 1 Gliederung Strukturen des Anbaus und Handels Ausweitung
Weltagrarhandel am Beispiel Soja AK 1 des 16. Landesschulgeographentag 2014, Universität Vechta Dr. Aline Veauthier (WING, Universität Vechta) 1 Gliederung Strukturen des Anbaus und Handels Ausweitung
Eiweiß-Futtermittel aus der Bioethanolproduktion
 Eiweiß-Futtermittel aus der Bioethanolproduktion Walter Schragen AGRANA Hollabrunn,, 13. Feber 2007 ZUCKER. STÄRKE. FRUCHT. Schlempe - DDGS Distillers Dried Grains with Solubles Sprechen wir über DDGS
Eiweiß-Futtermittel aus der Bioethanolproduktion Walter Schragen AGRANA Hollabrunn,, 13. Feber 2007 ZUCKER. STÄRKE. FRUCHT. Schlempe - DDGS Distillers Dried Grains with Solubles Sprechen wir über DDGS
Wer garantiert besseres Fleisch? Vergleich von Gütesiegeln für nachhaltig produziertes Fleisch 1
 Wer garantiert besseres Fleisch? Vergleich von Gütesiegeln für nachhaltig produziertes Fleisch 1 Futter Umstellung des gesamten Betriebes auf Bioerzeugung Gentechnisch Veränderte Organismen (GVO) Synthetische
Wer garantiert besseres Fleisch? Vergleich von Gütesiegeln für nachhaltig produziertes Fleisch 1 Futter Umstellung des gesamten Betriebes auf Bioerzeugung Gentechnisch Veränderte Organismen (GVO) Synthetische
Schweine leben in Deutschland Quelle: Statista
 Deutschland HARAM, Schweinegülle HARAM Deutsche Bauern mästen viel mehr Schweine, als für die Versorgung der Bundesbürger nötig wäre. Das ist gut fürs Geschäft. Tonnenweise wird das Fleisch aus Deutschland
Deutschland HARAM, Schweinegülle HARAM Deutsche Bauern mästen viel mehr Schweine, als für die Versorgung der Bundesbürger nötig wäre. Das ist gut fürs Geschäft. Tonnenweise wird das Fleisch aus Deutschland
Durchblick im Logo-Dschungel
 Durchblick im Logo-Dschungel eda / pixelio.de Industrie- und Handelskammer für die Pfalz Stand: Dezember 2010 1 Durchblick im Logo-Dschungel Immer mehr Produkte und Dienstleistungen sind mit immer mehr
Durchblick im Logo-Dschungel eda / pixelio.de Industrie- und Handelskammer für die Pfalz Stand: Dezember 2010 1 Durchblick im Logo-Dschungel Immer mehr Produkte und Dienstleistungen sind mit immer mehr
Butterstudie der Universität Gießen
 Butterstudie der Universität Gießen Butter aus Weidemilch schneidet am besten ab mehr Vitamine und gesunde Omega-3-Fettsäuren Der Gehalt an wertvollen Inhaltsstoffen ist bei Butter aus Weidemilch erheblich
Butterstudie der Universität Gießen Butter aus Weidemilch schneidet am besten ab mehr Vitamine und gesunde Omega-3-Fettsäuren Der Gehalt an wertvollen Inhaltsstoffen ist bei Butter aus Weidemilch erheblich
Im Einklang mit der Natur
 Im Einklang mit der Natur Grundlage des ökologischen Landbaus ist ein ganzheitliches Konzept der Landbewirtschaftung. Es steht im Einklang mit der Natur. Wesentliches Ziel ist es, durch die ökologische
Im Einklang mit der Natur Grundlage des ökologischen Landbaus ist ein ganzheitliches Konzept der Landbewirtschaftung. Es steht im Einklang mit der Natur. Wesentliches Ziel ist es, durch die ökologische
Eigenversorgung mit Eiweißfuttermitteln in Deutschland: eine Utopie?
 Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Eigenversorgung mit Eiweißfuttermitteln in Deutschland: eine Utopie? Robert Schätzl Deutschland: Erzeugung von und Außenhandel mit Eiweißträgern* Importe: 4,0
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Eigenversorgung mit Eiweißfuttermitteln in Deutschland: eine Utopie? Robert Schätzl Deutschland: Erzeugung von und Außenhandel mit Eiweißträgern* Importe: 4,0
Das Kontrollsystem für den Ökologischen Landbau
 Das Kontrollsystem für den Ökologischen Landbau Grundsätzliches... 1 Pflanzenbau...1 Tierhaltung... 2 Verarbeitung... 4 Das EU-Öko-Kontrollsystem... 5 Grundsätzliches Vorschriften der EU-Verordnung 2092/91
Das Kontrollsystem für den Ökologischen Landbau Grundsätzliches... 1 Pflanzenbau...1 Tierhaltung... 2 Verarbeitung... 4 Das EU-Öko-Kontrollsystem... 5 Grundsätzliches Vorschriften der EU-Verordnung 2092/91
Der Bio-Milchmarkt Einführungskurs Plankstetten (gemeinsamer Teil) Montag,
 Bio-Milch: Daten & Fakten Deutschland 45 Molkereien 708 Mio kg Bio-Milch Anlieferung (2,3 % von gesamt, Basis 2014) & Käsereien: (+ ca. 40-60 Mio.kg Direktvermarktung) Der Bio-Milchmarkt Einführungskurs
Bio-Milch: Daten & Fakten Deutschland 45 Molkereien 708 Mio kg Bio-Milch Anlieferung (2,3 % von gesamt, Basis 2014) & Käsereien: (+ ca. 40-60 Mio.kg Direktvermarktung) Der Bio-Milchmarkt Einführungskurs
Pressemitteilung. Sojabohne mit Donau Soja auf Erfolgsspur
 Presse und Internet Linz, 17. März 2017 Pressemitteilung Sojabohne mit Donau Soja auf Erfolgsspur Die Sojabohne spielt weltweit eine überragende Rolle als Eiweißquelle, aber auch als Lieferant pflanzlichen
Presse und Internet Linz, 17. März 2017 Pressemitteilung Sojabohne mit Donau Soja auf Erfolgsspur Die Sojabohne spielt weltweit eine überragende Rolle als Eiweißquelle, aber auch als Lieferant pflanzlichen
Gentechnikfrei aus Prinzip
 Gentechnikfrei aus Prinzip Der Einsatz von gentechnisch veränderten Pflanzen in der Landwirtschaft ist weltweit auf dem Vormarsch - so wird uns dies fast täglich suggeriert. Fakt ist jedoch auch, dass
Gentechnikfrei aus Prinzip Der Einsatz von gentechnisch veränderten Pflanzen in der Landwirtschaft ist weltweit auf dem Vormarsch - so wird uns dies fast täglich suggeriert. Fakt ist jedoch auch, dass
Futterleguminosen in der Milchviehfütterung
 Futterleguminosen in der Milchviehfütterung Rudolf Leifert Landwirtschaftlicher Berater Bedeutung der Leguminosen Leguminosen: eine wesentliche Grundlage für den biologischen Landbau. Sie gewährleisten:
Futterleguminosen in der Milchviehfütterung Rudolf Leifert Landwirtschaftlicher Berater Bedeutung der Leguminosen Leguminosen: eine wesentliche Grundlage für den biologischen Landbau. Sie gewährleisten:
Wie funktioniert ein Bauernhof?
 Rural Action Learning (RAL) Module Wie funktioniert ein Bauernhof? Materialien für das handlungsorientierte Lernen in ländlichen Räumen 1 Allgemeines Projektregion: Projektinstitution: Titel: Zielgruppe:
Rural Action Learning (RAL) Module Wie funktioniert ein Bauernhof? Materialien für das handlungsorientierte Lernen in ländlichen Räumen 1 Allgemeines Projektregion: Projektinstitution: Titel: Zielgruppe:
Durchführung: Zuerst versuchten wir die Frage zu klären: Was ist eigentlich Bio? Über das Internet finden die Schüler folgendes heraus:
 Bio find ich kuh-l Wir, die LauF-Gruppe der Pestalozzi-Schule Göppingen (Lernen in außerschulischen Feldern) und die begleitenden Lehrerinnen Frau Büchele und Frau Rapp waren sofort Feuer und Flamme für
Bio find ich kuh-l Wir, die LauF-Gruppe der Pestalozzi-Schule Göppingen (Lernen in außerschulischen Feldern) und die begleitenden Lehrerinnen Frau Büchele und Frau Rapp waren sofort Feuer und Flamme für
Landwirtschaft in den Bergen Die vielen Seiten des alpinen Grünlandes
 Berglandwirtschaft Es gibt ein Leben nach der Milchquote Landwirtschaft in den Bergen Die vielen Seiten des alpinen Grünlandes von Univ. niv.doz. Dr. Karl Buchgraber LFZ Raumberg-Gumpenstein Institut für
Berglandwirtschaft Es gibt ein Leben nach der Milchquote Landwirtschaft in den Bergen Die vielen Seiten des alpinen Grünlandes von Univ. niv.doz. Dr. Karl Buchgraber LFZ Raumberg-Gumpenstein Institut für
Mais in der Rinderfütterung
 Seite 1 von 9 Mais in der Rinderfütterung Aufgabe 1 Fügen Sie in der Darstellung zur Verdaulichkeit der Maispflanze die folgenden, fehlenden Angaben an der richtigen Stelle ein: Restpflanze, Spindel, Blatt,
Seite 1 von 9 Mais in der Rinderfütterung Aufgabe 1 Fügen Sie in der Darstellung zur Verdaulichkeit der Maispflanze die folgenden, fehlenden Angaben an der richtigen Stelle ein: Restpflanze, Spindel, Blatt,
Wirtschaftlichkeit einer Milchviehhaltung mit wenig bzw. ohne Kraftfutter. Dr. Karin Jürgens Prof. Dr. Onno Poppinga Urs Sperling
 Wirtschaftlichkeit einer Milchviehhaltung mit wenig bzw. ohne Kraftfutter Dr. Karin Jürgens Prof. Dr. Onno Poppinga Urs Sperling Ausgangspunkte zur Untersuchung Praxis: Gute Erfahrung mit kraftfutterarmer
Wirtschaftlichkeit einer Milchviehhaltung mit wenig bzw. ohne Kraftfutter Dr. Karin Jürgens Prof. Dr. Onno Poppinga Urs Sperling Ausgangspunkte zur Untersuchung Praxis: Gute Erfahrung mit kraftfutterarmer
Bayerisches Bio-Siegel
 Bayerisches Bio-Siegel Das vom Freistaat Bayern verliehene Bio-Siegel mit Herkunftsnachweis steht für über den gesetzlichen Standards liegende Leistungsinhalte dreistufiges Kontrollsystem einen lückenlosen
Bayerisches Bio-Siegel Das vom Freistaat Bayern verliehene Bio-Siegel mit Herkunftsnachweis steht für über den gesetzlichen Standards liegende Leistungsinhalte dreistufiges Kontrollsystem einen lückenlosen
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
 Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Staatsminister Helmut Brunner Eröffnung 2. Internationaler Donau-Soja Kongress 25. November 2013, Augsburg Es gilt das gesprochene
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Staatsminister Helmut Brunner Eröffnung 2. Internationaler Donau-Soja Kongress 25. November 2013, Augsburg Es gilt das gesprochene
Kontrolle des ökologischen Landbaus in Hessen
 Regierungspräsidium Gießen Kontrolle des ökologischen Landbaus in Hessen Regierungspräsidium Gießen Dezernat 51.2 Schanzenfeldstraße 8 35578 Wetzlar Telefon: 0641 303-5142 Fax: +49611327644502 E-Mail:
Regierungspräsidium Gießen Kontrolle des ökologischen Landbaus in Hessen Regierungspräsidium Gießen Dezernat 51.2 Schanzenfeldstraße 8 35578 Wetzlar Telefon: 0641 303-5142 Fax: +49611327644502 E-Mail:
Wie rentabel ist die Erzeugung ohne Gentechnik für den Landwirt?
 Wie rentabel ist die Erzeugung ohne Gentechnik für den Landwirt? - Kalkulationsgrundlagen - Ludwig Asam Ludwig Asam 1 Gliederung 1. Vorstellung 2. Futterwert gentechnikfreier Eiweißfuttermittel - importiert
Wie rentabel ist die Erzeugung ohne Gentechnik für den Landwirt? - Kalkulationsgrundlagen - Ludwig Asam Ludwig Asam 1 Gliederung 1. Vorstellung 2. Futterwert gentechnikfreier Eiweißfuttermittel - importiert
Kühe und Schweine. Auf dem Bauernhof. 1. Wie werden Kühe gemolken? 1. Was gehört alles zu einem Bauernhof?
 Auf dem 1. Was gehört alles zu einem? Schreibe die Zahlen an die passenden Stellen im Bild. Finde für die Zahlen 6 8 selbst Dinge oder Lebewesen, die auf einen gehören, schreibe sie auf und ergänze die
Auf dem 1. Was gehört alles zu einem? Schreibe die Zahlen an die passenden Stellen im Bild. Finde für die Zahlen 6 8 selbst Dinge oder Lebewesen, die auf einen gehören, schreibe sie auf und ergänze die
