Die Phänomenologie Heideggers und ihre politische Dimension
|
|
|
- Catrin Schreiber
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 1 Die Phänomenologie Heideggers und ihre politische Dimension 1. Horizont der Entgegensetzung von Husserl und Heidegger Mein Thema ist: Heidegger und die Husserlsche Phänomenologie, mit besonderer Betonung auf der politischen Dimension dieses Verhältnisses. Damit dieses Thema überhaupt spannend wird, ist zunächst einmal zu bemerken, dass wir Heidegger heute nicht mehr, wie es vor allem durch Emmanuel Levinas und Maurice Merleau-Ponty früher gängig war, als bloßen Husserl-Schüler verstehen können. Für beide galt es noch als ausgemacht, dass sich dunkle Stellen in Sein und Zeit umstandslos aus Husserl heraus aufklären lassen. Entsprechend sollte z.b. Heideggers Begriff der Sorge dort letztlich nichts anderes meinen als die Husserlsche Intentionalität. Diesem Interpretationsansatz stehen inzwischen die veröffentlichten Vorlesungen und Briefe Heideggers entgegen. Sie zeigen deutlich, dass Heidegger sich bereits vor Sein und Zeit radikal von Husserl losgesagt hat. Dessen phänomenologische Beschreibungen werden ausdrücklich als»fehldeskriptionen«verworfen (GA 63, 91). Jaspers gegenüber stellte Heidegger Sein und Zeit sogar als in erster Linie gegen Husserl geschrieben vor (Brief #39). Diese Vorlesungen werfen auch ein ganz neues Licht auf den 7 von Sein und Zeit. Dort wird erklärt, die Ausarbeitung der Seinsfrage für eine Neukonzeption der Phänomenologie insgesamt nutzen zu wollen. Da Sein und Zeit nie vollendet wurde, blieb lange Zeit unklar, wie diese Neukonzeption aussehen sollte. Früher verstand man den 7 daher als klares Bekenntnis zu Husserl. Nunmehr jedoch wissen wir, dass er aus zwei Vorlesungen von 1923/24 und 25 zusammengestückt wurde. Eben diese Vorlesungen sind zugleich auch jene, in denen Heidegger seine Kritik an Husserl am schärfsten entfaltet, um ihm einen radikal anders gearteten Gegenbegriff von Phänomenologie entgegenzuhalten. Heidegger wollte demnach auch in Sein und Zeit letztendlich bereits auf eine Kritik an Husserl hinaus, machte dies hier jedoch wohl nicht von Anfang an im selben Ausmaß deutlich, weil diese Schrift ausgerechnet von Husserl veröffentlicht werden sollte. Die Kritik an ihm klingt lediglich noch an, insofern Phänomenologie und Ontologie von Anfang an gänzlich synonym verwendet werden, d.h. der Husserlsche Ansatz vollständig in die Ontologie zurückgenommen wird. Heideggers Vorlesungen lässt sich entnehmen, dass seine Kritik vor allem Husserls Zielsetzung gilt. Diese bestand bekanntermaßen aus einer Erkenntnis der allgemein-logischen Strukturen jeglicher Wahrnehmung. Deren Bestimmung sollte ein festes Fundament abgeben, von dem aus sich über den Gültigkeitsanspruch von Aussagen allgemeinverbindlich urteilen lässt. Husserl ging es solcherart darum, die Bedingung der Möglichkeit tatsächlicher Gewiss-
2 2 heit freizulegen, seine Philosophie zielte auf objektive Erkenntnis im Sinne von notwendig allgemeinverbindlich. Damit stellte er sich ausdrücklich in die von Descartes eröffnete Tradition; Innerhalb ihrer nahm er jedoch noch insofern eine Sonderstellung ein, als dass er als erster eine radikal ergriffene Erkenntnistheorie zum Fundament jeglicher Erkenntnis erhob. Genau diesem Anspruch zufolge sollte seine Phänomenologie zur Fundamentalwissenschaft aller Einzeldisziplinen werden. Niemand vor ihm hatte die Notwendigkeit objektiver Begründung aller Bereiche menschlicher Erkenntnis derart kompromisslos eingefordert. Indem er immer wieder die Dringlichkeit solcher Begründung herausstrich, hat er das Gesicht der Philosophie verwandelt -- nämlich das Erspringen von Objektivität zu ihrer vordringlichsten Aufgabe gemacht und zugleich Descartes Traum von der Philosophie als Mutter aller Wissenschaften wiederbelebt. Man könnte solcherart sagen, dass z.b. die Analytische Philosophie das Husserlsche Projekt lediglich in verwandelter Form wieder aufgegriffen habe. Das scheint mir angesichts der heutigen Situation universitärer Philosophie jedoch zu eng gegriffen. Denn inzwischen ist zum allgemeinen Kriterium jeglichen Wissens dessen Verwertbarkeit geworden. Als Folge davon muss die Philosophie heute zunehmend Verbindlichkeit in Anspruch nehmen, damit andere Einzeldisziplinen ihre Ergebnisse aufgreifen und anwenden. Die Zielsetzung Husserls ist solcherart nunmehr die Zielsetzung fast der gesamten Philosophie. Und sogar die Kritik am letztlich bloß äußerlichen Verwertbarkeitsdruck artikuliert sich oft dahingehend, dass man den Naturwissenschaften vorwirft, ihrerseits noch gar nicht objektiv genug zu sein. Denn deren letztliches Wahrheitskriterium ist schließlich stets nur die Anwendbarkeit ihrer theoretischen Konstruktionen auf konkrete Phänomenbereiche, niemals aber vermag z.b. die Physik zu erweisen, dass es Raum, Zeit oder Energie im physikalischen Sinne tatsächlich gibt. Zum einzigen Kriterium von Wahrheit die praktische Verwendbarkeit zu erheben, heißt jedoch, jeglichen Anspruch auf eine im strengen Sinne objektive Wahrheit preiszugeben. Entsprechend argumentiert man häufig, dass eben solche Wahrheit in den genuinen Gegenstandsbereich der Philosophie falle und diese genau deshalb auch weiterzuführen vermöge als die Naturwissenschaften, wenn man sie nur endlich einmal in Ruhe ließe. Man träumt solcherart auch und gerade aus der Absage an bloße Verwertbarkeit heraus davon, das Husserlsche Projekt doch einmal auf irgendeine Weise zu Ende zu führen. Auf beiden Seiten erscheint so als Ideal der Philosophie die objektive Erkenntnis, die Auseinandersetzung mit der Husserlschen Zielsetzung ist daher zu einem großen Stück nichts anderes als eine Reflexion auf den gegenwärtigen Stand der Philosophie.
3 3 Von hier aus wird dann auch Heideggers Kritik an eben dieser Zielsetzung interessant. Und zwar kritisiert er genau diesen Anspruch auf objektive Erkenntnis als eigentlich mit der Würde der Philosophie unvereinbar. Ihm zugrunde liege stets die»annahme, dass die Wahrheit nicht Wahrheit sei, wenn sie nicht für jedermann gelte. [ ] Man vergisst [dabei] zu fragen, ob nicht das eigentliche Wesen der Wahrheit gerade darin besteht, dass sie nicht für jedermann gilt und dass Jedermannswahrheiten das Nichtigste sind, was sich im Felde der Wahrheit auftreiben lässt«(ga 31, 198). Die Philosophie also dürfe sich nicht mit bloß objektiver Erkenntnis zufrieden geben. Was Heidegger wesentlich ausmacht, ist eben diese Position, eine subjektive bzw. jemeinige Erkenntnis ungleich höherwertig anzusetzen als eine allgemeinverbindliche. Genau dies wird ihm zur eigentlichen Wurzel seiner Kritik an Husserl und die von ihm angestrebte Neukonzeption der Phänomenologie läuft in seinen Vorlesungen auf deren gänzliche Subjektivierung hinaus. Das ist insofern bemerkenswert, als dass man üblicher Weise genau umgekehrt urteilt: Die Subjektivität gilt als verzerrend. Eine Wahrheit wird als um so reiner ausgegeben, je mehr ihr subjektiver Anteil reduziert ist (bei Husserl eben durch Zugrundelegung von transzendentaler Reduktion und Epoché). Bei Heidegger hingegen fällt gerade die Aggressivität auf, mit der er diese Wertung exakt umkehrt. Von hier aus stellen sich folgende Fragen: 1) Erhebt seine Zurückweisung objektiver Wahrheit nicht in sich ebenfalls einen verbindlichen Anspruch? 2) Ist systematische Philosophie überhaupt möglich, wenn man jeglichen Anspruch auf Objektivität preisgibt, oder verkommt sie dadurch zwangsläufig zu einer bloßen Weltanschauung? 3) Wie wird begründet, dass gerade subjektive Erkenntnis prinzipiell höherwertig sei? Diese Fragen sollen beantwortet werden aus einer knappen Skizzierung des Heideggerschen Ansatzes insgesamt heraus. Das soll uns ermöglichen, das heute so verbreitete Streben nach Objektivität aus einer anderen Perspektive zu sehen. 2. Heideggers Interpretation von Platon Heideggers philosophische Position lässt sich am schnellsten knapp umreißen, wenn man sie direkt seiner Interpretation von Platon entgegensetzt. Um diese Vorgehensweise plausibler zu machen, sei kurz vorausgeschickt, dass Bewandtnis, dieser Zentralbegriff aus Sein und Zeit, Heideggers Vorlesungen zufolge nichts anderes ist als eine Übersetzung von δέα, ε δος. Solcherart handelt Sein und Zeit über weite Stellen hinweg eben von den traditionell- Platonischen Ideen und fokussiert deren Verhandlung dabei auf die Frage, was für eine Bedeutung ihnen hinsichtlich eines praktisch orientierten Umgangs mit der Welt zukommt.
4 4 Des weiteren ist Heideggers Platon-Interpretation untrennbar verbunden mit seiner Perspektive auf die Philosophiegeschichte insgesamt. Dieser zufolge entdeckten als erstes die Pythagoräer, dass wir Seiendes als solches stets nur im Ausgang von einer Idee her wahrnehmen. Dazu muss man sich klar machen, dass unsere Sinnlichkeit immer nur unzusammenhängende Sinnesdaten liefert (etwa bloße Farbpunkte). Wahrnehmung hingegen liegt erst dort vor, wo wir Sinnesdaten mit Zusammenhang ausstatten, d.h. sie auf die ideale Einheit einer Gegenständlichkeit beziehen. Diese ideale Einheit ist der stets schon zugrundeliegende Begriff als notwendige Grundbedingung jeglicher Wahrnehmung, d.h. die Platonische Idee. Diese Entdeckung begründete das, was man später als Metaphysik bezeichnete -- Nämlich das, was über alle Techniken eines Umgangs mit Seiendem (unter dem Sammelnamen Physik zusammengefasst) noch hinausgeht ( meta ), und zwar hinaus in Richtung hin auf deren Ermöglichungsgrund. Von Platon an konstituierte sich die eben so verstandene Metaphysik zentral um die Frage herum, warum wir unsere Außenwelt immer schon durch genau solche Begriffe bzw. Ideen hindurch angehen. Dabei wurde die Gesamtheit der immer schon zugrundeliegenden Ideen als Sein (φύσις, ε ναι) bezeichnet, um sie als den genetischen Grund dafür herauszuheben, dass allein aufgrund ihrer Seiendes für uns überhaupt ist. Die Metaphysik fragte solcherart von Platon an in erster Linie, weshalb unsere Wahrnehmung immer schon Ideen zugrundelegt, d.h. was sie damit will. In diesem Frageansatz beschlossen lag bereits, dass unsere Wahrnehmung von Haus aus intentional ist, d.h. immer schon irgendeiner unbekannten Zielsetzung untersteht und eben aus dieser heraus auf Ideen zurückgreift. Die Rätselhaftigkeit der Wahrnehmung aufzuklären, heißt daher metaphysisch, herauszustellen, worum es ihr von Anfang an ging -- und d.h. zugleich aufzuklären, was auch uns selbst von der basalsten Form unseres Umgangs mit der Außenwelt an umtrieb. Deshalb war der eigentliche Gegenstand der Metaphysik von Platon an das Begehren (griechisch: ε βουλία, πιθυµία, ρεξις; bei Heidegger: Sorge ). Eben dieses fungierte formal als Grund dafür, dass wir überhaupt Zugang zum Sein, d.h. ein Seinsverständnis haben. Platon situierte dieses Begehren in der Vernunft (νο ς), die dahingehend bestimmt wurde, dass sie von sich aus bestrebt sei, die Ideen bereits vorgängig jeglicher Wahrnehmung zu vernehmen (νοε ν). Diese Vernunft war solcherart ursprünglich ein Begehrungsvermögen, ehe sie später zu einem bloßen Vermögen der Urteile herabsank. Das Vernehmen der Ideen nun sollte eine Erfüllung des die Vernunft ausmachenden Begehrens bedeuten, weil Platon annahm, dass wir die Ideen immer schon vor Eintritt in unsere leibliche Existenz geschaut haben und diese nur Gegenstand einer Wiedererinnerung durch
5 5 die Vernunft werden, weil diese Vernunft in sich danach strebe, sich von der Leiblichkeit wieder frei zu machen. Denn diese Leiblichkeit ihrerseits wurde als durchaus aktives Vermögen vorgestellt, das die Seele durch Leidenschaften beunruhige und ebenfalls in jegliche Wahrnehmung mit hineinspiele. Platon zufolge galt es daher in der Philosophie, das in der Vernunft liegende Begehren eines Schauens der Ideen aufzugreifen und zu tatsächlicher Vollendung zu führen -- nämlich sich in der eigens ergriffenen Ideenschau (θεωρία) der eigenen Unabhängigkeit vom Leib zu versichern. Dies zusammenfassend erklärte der Phaidon:»Eben dies ist also das Geschäft des Philosophen, Befreiung und Absonderung der Seele von dem Leibe«(67d). Der von Platon vorgezeichnete Grundansatz der Metaphysik bestand demnach darin, einerseits das Seinsverständnis als Ermöglichungsbedingung aller Objektbezüge stark zu machen und es andererseits noch in einem ontologisch tieferen Begehren zu begründen. Wahrheit ( λήθεια) bzw. im wörtlichen Sinne Unverborgenheit galt als erreicht, wenn das am Grunde aller Bezüge auf Seiendes liegende Seinsverständnis als solches entborgen war -- Und d.h. zugleich: Wenn ans Licht trat, von wo aus das Sein stets schon vorverstanden wurde, d.h. warum wir uns dieses immer schon gegeben haben. 3. Der Heideggersche Gegenentwurf Heidegger kritisiert daran, dass die Vernunft solcherart als stets schon im Menschen bereitliegendes Naturvermögen angesetzt wurde und wesentlich aus einer Entgegensetzung zur Leiblichkeit bzw. Sinnlichkeit heraus begriffen wurde. Dagegen stellt er eine Konzeption, die er Aristoteles entnimmt: Die Leidenschaften des Leibes werden als in sich ebenso intentional begriffen wie die Vernunft. Durch sie hindurch erstrebe jeder seine je eigene Vorstellung vom Glück, die wesentlich auf Erfahrungen des Kleinkindes vorgängig jeglichem Bezug zum Seienden als Seienden zurückgehe -- nämlich, wie die Nikomachische Ethik formuliert, jegliches Dasein schon»von Kindesbeinen an«anleite (1105a2-4). Inhaltlich soll seine Sorge eben ein solches Aussein auf die Wiederholung frühkindlicher Erfahrungen des Guten bedeuten als in sich bereits verantwortlich für die Ausbildung des Seinsverständnisses. Mit anderen Worten: Wir legen uns nur ein Seinsverständnis zu und konstituieren durch dieses hindurch Objektbeziehungen, weil wir von der Außenwelt immer schon eine Wiederholung vergangener Erfahrungen des Glücks, eine Wiederkehr unserer Gewesenheit erwarten. Diesem Ansatz entsprechend wird die Sorge in Sein und Zeit als ursprüngliche Einheit von Befindlichkeit, Verstehen und Verfallen vorgestellt. In der Befindlichkeit zeigt sich an, wie es um unser Streben nach einer Wiederholung von vergangenem Glück jeweils gerade bestellt ist
6 6 -- Z.B. ob wir in einer jeweiligen Besorgung solcher Wiederholung in gespannter Vorfreude entgegenstehen, ob dieses Streben bereits enttäuscht wurde oder ob die Außenwelt gerade keinerlei Möglichkeit für eine solche Wiederholung bietet und daher langweilt. Das Verstehen hingegen ist in sich ursprünglich das Verstehen von Sein und sodann auch von Seiendem, das in sich zugleich stets ein Selbstverstehen der eigenen Sorge bedeuten soll. Die ursprüngliche Zusammengehörigkeit von Befindlichkeit und Verstehen entspringt solcherart der Veranschlagung der intellektuellen Fähigkeiten als ursprünglich aus der Sorge heraus erwachsen. Das Verfallen hingegen meint ein Vergessen unserer zu wiederholenden Gewesenheit, mit dem das verstehende Gegenwärtigen von Seiendem sich verselbständigt, so dass Befindlichkeit und Verstehen auseinandertreten. Dass auch dieses Verfallen ursprünglich mit zur Sorge gehören soll, ist unmittelbar einsichtig. Denn wenn alle unsere Objektbeziehungen stets im Dienst einer Wiederholung vergangenen Glücks stehen, so muss dies eine grundsätzliche Überforderung bedeuten, da Glück immer nur eine Kontrasterfahrung sein kann. Aufgrund genau dieser Überforderung kehrt sich das Dasein immer schon von seiner je eigenen Sorge ab, um sich mit Anderen als Man-selbst gleichzusetzen und ihren Umgang mit Seiendem schlicht zu übernehmen. In diesem Verfallen gründet solcherart die Möglichkeit, dass unser an Anderen orientierter Umgang mit Seiendem uns mitunter als nichtig erscheint und wir dem erneuten Sich-melden unserer Sorge in Angst begegnen. Der entscheidende Punkt dieser Konzeption ist, dass ihr zufolge jede Sorge ihre je eigene Zielsetzung hat, weil sie von je eigenen Erfahrungen des Guten geprägt wurde. Genau dies übernimmt Heidegger von Aristoteles her und macht gegen Platon stark, dass die Sorge keineswegs bei allen das Gleiche will -- nämlich eine Unabhängigkeit vom Leib und seinen Leidenschaften (was für Heidegger ein bloßes Verfallsprodukt ist). Weil die Sorge in dieser Weise jemeinig ist, hat auch jedes Dasein ursprünglich sein je eigenes Seinsverständnis. Entsprechend kritisiert Heidegger scharf jenen angeblichen» Tiefsinn [...], das Sein sei doch, und es zuallererst, etwas Objektives «(GA 49, 67). Von hier aus unterlegt Heidegger der Metaphysik insgesamt eine neue Zielsetzung: Sie soll stets nach der eigenen Sorge in ihrer Jemeinigkeit fragen und solcherart eine Aufklärung der eigenen Individualität erlauben, statt den Menschen weiterhin bloß als Gattungswesen anzugehen. Entsprechend erklärt auch Sein und Zeit, dass Wahrheit im höchsten Sinne die Erschlossenheit des je eigenen Seins sei (SZ 220f). Die dieser Zielsetzung unterstellte Philosophie sei unentbehrlich, weil wir trotz allen Verfallens das Bedrängende unserer Sorge niemals endgültig loswerden können und uns daher letztlich keine andere Wahl bleibe, als eine entsprechende Selbsterkenntnis zu suchen -- und zwar
7 7 im Dienst einer ganz praktischen Ausgestaltung des eigenen Lebens gemäß der je eigenen Vorstellung vom Glück. Besonders hervorzuheben ist, dass die Jemeinigkeit unseres Seinsverständnisses dabei letztlich besagt, dass wir dieses Seinsverständnis stets entsprechend unseres jeweiligen Ausseins und der zugehörigen Befindlichkeit konstituieren. Die Ideen werden solcherart ursprünglich gebildet aus dem Hinblick auf ihre mögliche Bedeutsamkeit für uns, d.h. als unter Anhalt an unserer Befindlichkeit ausgelegte. Die solcherart stets einer Auslegung bedürftige Bewandtnis identifiziert Heidegger umstandslos mit den Aristotelischen zweiten Wesenheiten und dem Hegelschen Begriff. Der Nachvollzug der Auslegungen Anderer vollzieht sich dabei als Rückgang hinter ihre umsichtige Sicht auf Seiendes auf die jeweils zugrundeliegende Befindlichkeit ( hermeneutische Exegese ). Dass diese Befindlichkeit die Sicht auf Seiendes mitunter sogar insgesamt bestimmen kann, lässt sich illustrieren am Beispiel etwa eines unglücklich Liebenden, der nunmehr die ganze Welt schwarz sieht. Die Evidenz einer Auslegung gründet dabei wesentlich darin, dass wir uns einfühlend in die Befindlichkeit eines Anderen hineinversetzen und von hier aus seine Sicht auf Seiendes als in sich sinnvoll erfahren. Genau diese einfühlende Evidenz spielt Heidegger in zweierlei Hinsicht gegen die bloß logische Evidenz aus: 1) Sie umfasst den Menschen im Ganzen und nicht nur dessen Intellekt. 2) Sie muss die ursprünglichere Form von Evidenz sein, wenn man nicht an der Veranschlagung der Vernunft als naturgegeben festhalten will. Dies muss man so stark herausstellen, damit einsichtig wird, was für eine Evidenz Heideggers grundsätzliche Abwertung bloß objektiver Erkenntnis für sich in Anspruch nimmt: Sie will einfühlend evident sein, d.h. für alle wahr, die sich in der so eröffneten Perspektive wiederfinden können. Ihr hingegen vorzuwerfen, dass sie ihrerseits doch ebenfalls Verbindlichkeit beanspruche, verkennt den Angebotscharakter dieser Perspektive und bricht ihre Evidenz auf eine bloß logische herunter. D.h. man reduziert das Problem, vor dem man sich bei Einbezug der Subjektivität in die Philosophie gestellt sieht, auf ein bloß formal-abstraktes von der Struktur: A behauptet zu lügen. Darf ihm geglaubt werden? Erstens kann eine Philosophie, die aus der Subjektivität heraus sprechen und sich in ihr halten will, also durchaus Aussagen treffen, die scheinbar allgemeinen Charakter haben, dabei aber eigentlich nur eine allen angebotene Perspektive beinhalten. Zweitens bedeutet ein solcher Ansatz keineswegs, die Philosophie letztlich bloß der Willkür der Befindlichkeit zu überlassen. Heidegger argumentiert genau umgekehrt, dass das Ziel einer Selbsterkenntnis die eigentliche Grundbedingung dafür sei, dass das zuvor auf der Ebene der Wahrnehmung immer bloß unbewusst zur Verfügung stehende Denken überhaupt nur als eigenständiges Vermögen
8 8 ergriffen werden könne. Der Grundakt jeglichen Denkens soll solcherart ein Hineinlauschen in sich selbst sein. Das Haupthindernis des Denkens sei dabei das Sich-halten-wollen in einer Verfallenheit, d.h. der Versuch einer Selbsttäuschung. Gerade um dieser zu begegnen, dürfe das Denken sich nicht von der Ansicht einer bloßen Stimmung hin zur nächsten treiben lassen, sondern müsse deren Widersprüche als solche auf ihren eigentlichen Grund hin zurückverfolgen. Heidegger unternimmt solcherart mit Fichte und Hegel eine ontologische Begründung des Satzes der Identität, des Widerspruchs und des zureichenden Grunds auf das Selbstverstehen als ursprünglichste Form willentlich unternommenen Denkens. Er wirft entsprechend genau umgekehrt jeglicher bloß logischen Argumentation vor, eine solche ontologische Begründung in keiner Weise mehr leisten zu können, und erhebt solcherart gerade das Ziel einer Selbsterkenntnis zur eigentlichen Quelle aller Strenge im Denken. Kurzum: Seine Subjektivierung der Philosophie steht jeglicher postmodernen Beliebigkeit radikal entgegen. Auf genau diese Neukonzeption der Metaphysik hin sollte auch seine Verwandlung der Husserlschen Phänomenologie hinauslaufen. Husserl wird insgesamt vorgeworfen, noch am Platonischen Seinsbegriff festzuhalten und seine Intentionalität entsprechend zu konzipieren als aus der sinnlichen Anschauung Begriffe (Ideen, das Sein) in einer für alle verbindlichen Weise heraussehend. Solcherart klammere Husserl die Bedeutsamkeit als zum Wesen selbst gehörig aus, d.h. unterscheide in traditioneller Weise noch zwischen νούµενον und φαινόµενον, um bloß einseitig für das νούµενον Partei zu ergreifen. Die Phänomenologie hingegen sei bereits ihrem Namen nach dazu verpflichtet, das Seiende in seiner jeweils bedeutsamen Erscheinungsweise für ein konkretes Dasein zu thematisieren. Eben deshalb erklärt auch der 7 in Sein und Zeit Phänomenologie für ein bloßes Synonym von Ontologie, womit letztlich nichts anderes gemeint ist als die Aristotelische Metaphysik, die νούµενον und φαινόµενον tatsächlich versöhnt habe. Heideggers eigener Begriff der Sorge fungiert dabei als direkter Gegenbegriff zur Husserlschen Intentionalität, welche ausdrücklich von allen sogenannten»nicht-objektkonstituierenden Akten (wie Freuden, Wünschen, Wollungen)«unterschieden wird (LU II/1, 498). Heidegger hingegen lässt sie als Sorge in genau diesen Akten anheben und unternimmt letztlich auf eben sie hin auch die von Husserl angestrebte Letztbegründung jeglicher Erkenntnis. 4. Die politische Dimension dieser Neukonzeption der Phänomenologie Damit haben wir nun den Boden ersprungen, von dem aus wir Heideggers prinzipielle Abwertung objektiver Erkenntnis nachvollziehen können. Zunächst einmal muss dieser grundsätzlich vorgeworfen werden, am eigentlichen Ziel jeglichen Denkens als auf eine
9 9 Durchsichtigkeit der eigenen Sorge hinauswollend vorbeizugehen. Zweitens ist sie dahingehend zu kritisieren, dass sie keinerlei Anhalt an der je eigenen Befindlichkeit nimmt und deshalb das Dasein immer nur in partieller Weise betrifft. -- Bis hierhin erscheint sie insofern gerade aus dem Interesse einer Selbsterkenntnis heraus als ungenügend. Diese Perspektive wird man jedoch nur teilen können, wenn man die Selbsterkenntnis bereits ebenfalls zum höchsten Ziel der Philosophie erhoben hat, als gäbe es in der Welt nichts Dringlicheres. Deshalb ist es wichtig, abschließend auch noch Heideggers dritten Grund für seine Abwertung objektiver Erkenntnis in den Blick zu bekommen, mit dem diesmal zentral die mögliche politische Relevanz der Philosophie zur Verhandlung steht. Heidegger lädt uns nämlich ein, die von ihm eingeforderte Privatisierung der Philosophie im Dienst bloßer Selbsterkenntnis als eigentlich deren Politisierung bedeutend zu denken. Den Boden für diese überraschende Wendung gibt die These ab, dass das Selbstverstehen die Grundform jeglichen Denkens sei und es dem Dasein deshalb auch in seiner Verfallenheit stets noch um eine Selbstdurchsichtigkeit des eigenen Seins gehe. Von hier aus entfaltet Sein und Zeit in den die Analyse der Alltäglichkeit als dieses Drängen der eigenen Sorge zunächst und zumeist als Sorge um Abständigkeit missverstehend -- nämlich als Sorge, sich gegenüber Anderen durch Besitz oder Status auszeichnen zu müssen und sich solcherart der eigenen Einzigartigkeit zu vergewissern. Auf diese Weise wird faktisch eine Erklärung der Ursprünge sozialer Ungleichheit vorgelegt. Gegen diese stellt der 26 die Möglichkeit eines eigentlichen Miteinanderseins: Das zu sich selbst gefunden habende Dasein braucht sich von Anderen nicht mehr durch Äußerliches abzusetzen und ist nunmehr in der Lage, diese als ebenso einzigartig wie sich selbst zu verstehen. Vorgelegt wird hier ein Stück sozialer Utopie: Das eigentlich gewordene Dasein ist sich selbst durchsichtig als sein Glück eigentlich vom Mitdasein her erwartend, konkurriert entsprechend nicht mehr mit diesem Mitdasein und verspricht sich das Glück nicht länger von etwa der Einführung neuer Technologien oder eines immer höheren Konsumstandards. Heideggers Phänomenologie will eine politische sein, insofern sie die aktuellen politischen Probleme auf eine bestimmte Subjektform (das alltägliche Man-selbst) zurückführt, eben diese Subjektform zu ändern sucht und solcherart den Weg für eine Wandlung der gesellschaftlichen Verhältnisse vorbereitet. Genau umgekehrt wird deshalb auf der anderen Seite jeglicher Verpflichtung hin auf intersubjektiv verbindliche Wahrheiten vorgeworfen, letztlich bloß auf eine»normierung«des Daseins hinauszulaufen (GA 17, 86; GA 20, 151), nämlich die Austauschbarkeit des Manselbst zu befördern und damit die gesellschaftliche Rivalität zu verstärken. Dass Heidegger
10 10 diesen Zusammenhang knüpft, erklärt die aggressive Weise, in der er seine eigene radikale Subjektivierung der Philosophie gegen die Husserlsche Phänomenologie wendet und letztere noch zu übersteigen beansprucht. Dabei handelt es sich nicht bloß um eine Defensiv- Strategie, die einem hegemonial gewordenen Anspruch auf objektive Erkenntnis lediglich mit gleicher Münze heimzahlt, um bestehende Freiräume abzusichern. Genau umgekehrt folgt aus der Heideggerschen Perspektive auf das Denken unmittelbar, dass jeglicher Versuch objektiver Erkenntnis und damit einer Begründung von Wahrheit auf etwas anderes als auf das eigene Dasein letztlich nur eine Abwehr gegen das Denken darstellen kann und genau diese Abwehr in gewisser Weise der Ursprung alles Bösen sein muss. Entsprechend gebietet aus dieser Perspektive heraus gerade die Verantwortung Anderen gegenüber, stets nur für sich selbst zu sprechen und sich gegen jegliche Objektivität als eigentlich nur eine Normalisierung bedeutend zu wenden. 5. Fazit Letztendlich kann die solcherart eröffnete Perspektive lediglich beanspruchen, bloße Perspektive zu sein, wenn auch eine in sich überaus konsistente. Das diskreditiert sie nur unter der Voraussetzung, dass es grundsätzlich mehr als bloße Perspektiven geben könnte. Festzuhalten, dass genau diese Voraussetzung eventuell schädlich bis gefährlich sein könnte, scheint insofern äußerst produktiv, als es die Vertreter dieser Voraussetzung (wie z.b. Husserl) nötigt, sie weitergehend zu explizieren und zu rechtfertigen. Solcherart kann die vorgelegte Perspektive letztendlich bislang viel zu wenig ergriffene Dialoge befördern und eine tatsächliche Auseinandersetzung im ureigensten Sinne der Philosophie vorantreiben. Auch wenn man die skizzierte Perspektive von und auf Heidegger nicht teilt, so sollte somit dennoch der Wert eines Bedenkens ihrer deutlich geworden sein. Für welche Position man sich auch immer entscheiden will: Ich glaube, dass die gegenwärtig größte Herausforderung der Philosophie darin liegt, sich zur Möglichkeit ihrer gänzlichen Subjektivierung zu verhalten -- und dass es überaus bedauerlich ist, dass die momentane Situation der Forschung solchen grundsätzlichkritischen Überlegungen direkt entgegensteht. Jannis Oberdieck Roonstraße Bremen
Die Phänomenologie Heideggers und ihre politische Dimension
 Die Phänomenologie Heideggers und ihre politische Dimension Referiert und zur Diskussion gestellt werden soll Heideggers Konzeption der Philosophie als Phänomenologie. Im ersten Schritt gilt es dabei vor
Die Phänomenologie Heideggers und ihre politische Dimension Referiert und zur Diskussion gestellt werden soll Heideggers Konzeption der Philosophie als Phänomenologie. Im ersten Schritt gilt es dabei vor
Kunst, Wirklichkeit und Affirmation
 Kunst, Wirklichkeit und Affirmation Einige Gedanken zu Heideggers Kunstwerkaufsatz THOMAS HILGERS In welchem Verhältnis stehen Kunst, Wirklichkeit und Affirmation? Gehen wir davon aus, dass es hier überhaupt
Kunst, Wirklichkeit und Affirmation Einige Gedanken zu Heideggers Kunstwerkaufsatz THOMAS HILGERS In welchem Verhältnis stehen Kunst, Wirklichkeit und Affirmation? Gehen wir davon aus, dass es hier überhaupt
Uwe Schulz SELBSTBESTIMMUNG UND SELBSTERZIEHUNG DES MENSCHEN
 Uwe Schulz SELBSTBESTIMMUNG UND SELBSTERZIEHUNG DES MENSCHEN Untersuchungen im deutschen Idealismus und in der geisteswissenschaftlichen Pädagogik /Ä«fe/M-Verlag Stuttgart Inhaltsverzeichnis Einleitung
Uwe Schulz SELBSTBESTIMMUNG UND SELBSTERZIEHUNG DES MENSCHEN Untersuchungen im deutschen Idealismus und in der geisteswissenschaftlichen Pädagogik /Ä«fe/M-Verlag Stuttgart Inhaltsverzeichnis Einleitung
Folien zur Vorlesung Perspektivität und Objektivität von Prof. Martin Seel. Sitzung vom 1. November 2004
 Folien zur Vorlesung Perspektivität und Objektivität von Prof. Martin Seel Sitzung vom 1. November 2004 1 Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 74: Unsre Erkenntnis entspringt aus zwei Grundquellen des Gemüts,
Folien zur Vorlesung Perspektivität und Objektivität von Prof. Martin Seel Sitzung vom 1. November 2004 1 Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 74: Unsre Erkenntnis entspringt aus zwei Grundquellen des Gemüts,
INHALTSVERZEICHNIS.
 INHALTSVERZEICHNIS Vorwort Sein und Zeit - Einleitende Bemerkungen Sein und Zeit - Einführende Interpretationen und erschließende Fragen/Aufgaben Einleitung (Exposition der Frage nach dem Sinn von Sein)
INHALTSVERZEICHNIS Vorwort Sein und Zeit - Einleitende Bemerkungen Sein und Zeit - Einführende Interpretationen und erschließende Fragen/Aufgaben Einleitung (Exposition der Frage nach dem Sinn von Sein)
Einführung in die Literaturtheorie
 Einführung in die Literaturtheorie GER Q-2,2+2, Q-6,2, O-2,3 ; L3 FW 6, 1-2 Prof. E. Geulen Neuere deutsche Literaturwissenschaft Sprechstunde: Montags, 18.00 19.00 h oder nach Vereinbarung Kontakt: sekretariat.geulen@lingua.uni-frankfurt.de
Einführung in die Literaturtheorie GER Q-2,2+2, Q-6,2, O-2,3 ; L3 FW 6, 1-2 Prof. E. Geulen Neuere deutsche Literaturwissenschaft Sprechstunde: Montags, 18.00 19.00 h oder nach Vereinbarung Kontakt: sekretariat.geulen@lingua.uni-frankfurt.de
Michel Henry. Inkarnation. Eine Philosophie des Fleisches. Aus dem Französischen von Rolf Kühn. Verlag Karl Alber Freiburg/München
 Michel Henry Inkarnation Eine Philosophie des Fleisches Aus dem Französischen von Rolf Kühn Verlag Karl Alber Freiburg/München Inhalt Einleitung: Die Frage der Inkarnation 13 I. Der Umsturz der Phänomenologie
Michel Henry Inkarnation Eine Philosophie des Fleisches Aus dem Französischen von Rolf Kühn Verlag Karl Alber Freiburg/München Inhalt Einleitung: Die Frage der Inkarnation 13 I. Der Umsturz der Phänomenologie
Immanuel Kant. *22. April 1724 in Königsberg +12. Februar 1804 in Königsberg
 Immanuel Kant *22. April 1724 in Königsberg +12. Februar 1804 in Königsberg ab 1770 ordentlicher Professor für Metaphysik und Logik an der Universität Königsberg Neben Hegel wohl der bedeutendste deutsche
Immanuel Kant *22. April 1724 in Königsberg +12. Februar 1804 in Königsberg ab 1770 ordentlicher Professor für Metaphysik und Logik an der Universität Königsberg Neben Hegel wohl der bedeutendste deutsche
Joachim Ritter, 1961 Aristoteles und die theoretischen Wissenschaften
 Aristoteles und die theoretischen Wissenschaften Die theoretische Wissenschaft ist so für Aristoteles und das gilt im gleichen Sinne für Platon später als die Wissenschaften, die zur Praxis und ihren Künsten
Aristoteles und die theoretischen Wissenschaften Die theoretische Wissenschaft ist so für Aristoteles und das gilt im gleichen Sinne für Platon später als die Wissenschaften, die zur Praxis und ihren Künsten
GEORG PICHT ARISTOTELES'»DEANIMA«
 ' < - ' ' - ' *,, GEORG PICHT ARISTOTELES'»DEANIMA«Mit einer Einführung von Enno Rudolph- >«.». -Klett-Cotta- INHALT Enno Rudolph Einführung XI EINLEITUNG 1. Die Gegenwärtigkeit des aristotelischen Denkens..
' < - ' ' - ' *,, GEORG PICHT ARISTOTELES'»DEANIMA«Mit einer Einführung von Enno Rudolph- >«.». -Klett-Cotta- INHALT Enno Rudolph Einführung XI EINLEITUNG 1. Die Gegenwärtigkeit des aristotelischen Denkens..
MARX: PHILOSOPHISCHE INSPIRATIONEN
 09.11.2004 1 MARX: PHILOSOPHISCHE INSPIRATIONEN (1) HISTORISCHER RAHMEN: DIE DEUTSCHE TRADITION KANT -> [FICHTE] -> HEGEL -> MARX FEUERBACH (STRAUSS / STIRNER / HESS) (2) EINE KORRIGIERTE
09.11.2004 1 MARX: PHILOSOPHISCHE INSPIRATIONEN (1) HISTORISCHER RAHMEN: DIE DEUTSCHE TRADITION KANT -> [FICHTE] -> HEGEL -> MARX FEUERBACH (STRAUSS / STIRNER / HESS) (2) EINE KORRIGIERTE
Die Frage nach dem Sinn des Seins Antworten der Metaphysik Europas
 Die Frage nach dem Sinn des Seins Antworten der Metaphysik Europas Prof. Dr. Gerald Weidner Metapysik Definition Metaphysik war seit Aristoteles die erste Philosophie, weil sie Fragen der allgemeinsten
Die Frage nach dem Sinn des Seins Antworten der Metaphysik Europas Prof. Dr. Gerald Weidner Metapysik Definition Metaphysik war seit Aristoteles die erste Philosophie, weil sie Fragen der allgemeinsten
INHALTSVERZEICHNIS ERSTER TEIL: KANT VORWORT... 7 INHALTSVERZEICHNIS... 9 SIGLENVERZEICHNIS... 15
 INHALTSVERZEICHNIS VORWORT... 7 INHALTSVERZEICHNIS... 9 SIGLENVERZEICHNIS... 15 EINLEITUNG: DIE KOPERNIKANISCHE WENDE IN DER PHILOSOPHIE... 17 ZUSAMMENFASSUNG... 27 ERSTER TEIL: KANT... 31 KAPITEL 1 EINFÜHRUNG
INHALTSVERZEICHNIS VORWORT... 7 INHALTSVERZEICHNIS... 9 SIGLENVERZEICHNIS... 15 EINLEITUNG: DIE KOPERNIKANISCHE WENDE IN DER PHILOSOPHIE... 17 ZUSAMMENFASSUNG... 27 ERSTER TEIL: KANT... 31 KAPITEL 1 EINFÜHRUNG
Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung über Theologische Fragen an die Hirnforschung. Erste Lieferung
 Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung über Theologische Fragen an die Hirnforschung Erste Lieferung Zum Thema: Einführung: Verbreitete Ansichten, die für die Theologie relevant
Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung über Theologische Fragen an die Hirnforschung Erste Lieferung Zum Thema: Einführung: Verbreitete Ansichten, die für die Theologie relevant
DER DEUTSCHE IDEALISMUS (FICHTE, SCHELLING, HEGEL) UND DIE PHILOSOPHISCHE PROBLEMLAGE DER GEGENWART
 MARTIN HEIDEGGER DER DEUTSCHE IDEALISMUS (FICHTE, SCHELLING, HEGEL) UND DIE PHILOSOPHISCHE PROBLEMLAGE DER GEGENWART El VITTORIO KLOSTERMANN FRANKFURT AM MAIN L }0 -/* INHALT EINLEITUNG Die gegenwärtige
MARTIN HEIDEGGER DER DEUTSCHE IDEALISMUS (FICHTE, SCHELLING, HEGEL) UND DIE PHILOSOPHISCHE PROBLEMLAGE DER GEGENWART El VITTORIO KLOSTERMANN FRANKFURT AM MAIN L }0 -/* INHALT EINLEITUNG Die gegenwärtige
Was ist? Was soll sein? Was wirkt?
 Was ist? Was soll sein? Was wirkt? Was ist? ist eine der grossen Fragen der Philosophie. Sie ist die Frage danach, was gegeben ist, wie u.a. Immanuel Kant es formuliert. Sie stellt alles in Frage: unsere
Was ist? Was soll sein? Was wirkt? Was ist? ist eine der grossen Fragen der Philosophie. Sie ist die Frage danach, was gegeben ist, wie u.a. Immanuel Kant es formuliert. Sie stellt alles in Frage: unsere
Bernd Prien. Kants Logik der Begrie
 Bernd Prien Kants Logik der Begrie Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 4 2 Die Struktur der Erkenntnis 8 2.1 Erkenntnis im eigentlichen Sinne........................ 8 2.2 Die objektive Realität von Begrien......................
Bernd Prien Kants Logik der Begrie Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 4 2 Die Struktur der Erkenntnis 8 2.1 Erkenntnis im eigentlichen Sinne........................ 8 2.2 Die objektive Realität von Begrien......................
Aus: Peter Fischer Phänomenologische Soziologie. Oktober 2012, 144 Seiten, kart., 12,50, ISBN
 Aus: Peter Fischer Phänomenologische Soziologie Oktober 2012, 144 Seiten, kart., 12,50, ISBN 978-3-8376-1464-0 Die Phänomenologie erfährt in der Soziologie gegenwärtig eine Renaissance. Insbesondere die
Aus: Peter Fischer Phänomenologische Soziologie Oktober 2012, 144 Seiten, kart., 12,50, ISBN 978-3-8376-1464-0 Die Phänomenologie erfährt in der Soziologie gegenwärtig eine Renaissance. Insbesondere die
Entwicklung der modernen Naturwissenschaft (speziell der Physik/Mechanik) in Abgrenzung von der mittelalterlich-scholastischen Naturphilosophie
 René Descartes (1596-1650) Meditationen über die Grundlagen der Philosophie (1641) Geistes- bzw. wissenschaftsgeschichtlicher Hintergrund Entwicklung der modernen Naturwissenschaft (speziell der Physik/Mechanik)
René Descartes (1596-1650) Meditationen über die Grundlagen der Philosophie (1641) Geistes- bzw. wissenschaftsgeschichtlicher Hintergrund Entwicklung der modernen Naturwissenschaft (speziell der Physik/Mechanik)
Profilkurs. Schulinternes Curriculum Philosophie. Einführung in das Philosophieren
 Schulinternes Curriculum Philosophie Profilkurs Einführung in das Philosophieren Anhand der vier Fragen Kants Philosophiegeschichte im Überblick sowie Überblick über die zentralen Fragen der Reflexionsbereiche
Schulinternes Curriculum Philosophie Profilkurs Einführung in das Philosophieren Anhand der vier Fragen Kants Philosophiegeschichte im Überblick sowie Überblick über die zentralen Fragen der Reflexionsbereiche
Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie in der Einführungsphase der Gesamtschule Aachen-Brand
 Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie in der Einführungsphase der Gesamtschule Aachen-Brand Stand: August 2014 Unterrichtsvorhaben I Eigenart philosophischen Fragens und Denkens - Was heißt es
Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie in der Einführungsphase der Gesamtschule Aachen-Brand Stand: August 2014 Unterrichtsvorhaben I Eigenart philosophischen Fragens und Denkens - Was heißt es
Stefan Oster. Mit-Mensch-Sein. Phänomenologie und Ontologie der Gabe bei Ferdinand Ulrich. Verlag Karl Alber Freiburg/München
 Stefan Oster Mit-Mensch-Sein Phänomenologie und Ontologie der Gabe bei Ferdinand Ulrich Verlag Karl Alber Freiburg/München Vorwort 5 Einführung 11 I Weisen des Zugangs 17 1. Ein aktueller Entwurf!" - Das
Stefan Oster Mit-Mensch-Sein Phänomenologie und Ontologie der Gabe bei Ferdinand Ulrich Verlag Karl Alber Freiburg/München Vorwort 5 Einführung 11 I Weisen des Zugangs 17 1. Ein aktueller Entwurf!" - Das
Hegels»Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften«
 Hegels»Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften«(1830) Hermann Drüe, Annemarie Gethmann-Siefert, Christa Hackenesch, Walter Jaeschke, Wolfgang Neuser und Herbert Schnädelbach Ein Kommentar zum Systemgrundriß
Hegels»Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften«(1830) Hermann Drüe, Annemarie Gethmann-Siefert, Christa Hackenesch, Walter Jaeschke, Wolfgang Neuser und Herbert Schnädelbach Ein Kommentar zum Systemgrundriß
Phänomenologie. Wissen Wissenschaft Wissenschaftstheorie. Prof. Dr. Anselm Böhmer MBA Allgemeine Pädagogik
 Phänomenologie Wissen Wissenschaft Wissenschaftstheorie Prof. Dr. Anselm Böhmer MBA Allgemeine Pädagogik Was Sie heute zur Phänomenologie erwartet 1. Überblick a) Husserl b) Heidegger c) Merleau-Ponty
Phänomenologie Wissen Wissenschaft Wissenschaftstheorie Prof. Dr. Anselm Böhmer MBA Allgemeine Pädagogik Was Sie heute zur Phänomenologie erwartet 1. Überblick a) Husserl b) Heidegger c) Merleau-Ponty
Die Reflexion des Wirklichen
 Riccardo Dottori Die Reflexion des Wirklichen Zwischen Hegels absoluter Dialektik und der Philosophie der Endlichkeit von M. Heidegger und H. G. Gadamer Mohr Siebeck Inhaltsverzeichnis Vorwort V Einleitung
Riccardo Dottori Die Reflexion des Wirklichen Zwischen Hegels absoluter Dialektik und der Philosophie der Endlichkeit von M. Heidegger und H. G. Gadamer Mohr Siebeck Inhaltsverzeichnis Vorwort V Einleitung
Lehrplan Philosophie
 D S T Y Deutsche Schule Tokyo Yokohama Lehrplan Philosophie Sekundarstufe II Vorbemerkung: An der DSTY ist ein zweistündiger, aus den Jgst. 12 und 13 kombinierter Philosophiekurs eingerichtet. Daraus ergibt
D S T Y Deutsche Schule Tokyo Yokohama Lehrplan Philosophie Sekundarstufe II Vorbemerkung: An der DSTY ist ein zweistündiger, aus den Jgst. 12 und 13 kombinierter Philosophiekurs eingerichtet. Daraus ergibt
Seele und Emotion bei Descartes und Aristoteles
 Geisteswissenschaft Anne-Kathrin Mische Seele und Emotion bei Descartes und Aristoteles Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 2 2. Das Leib-Seele-Verhältnis bei Descartes und Aristoteles...
Geisteswissenschaft Anne-Kathrin Mische Seele und Emotion bei Descartes und Aristoteles Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 2 2. Das Leib-Seele-Verhältnis bei Descartes und Aristoteles...
Paul Natorp. Philosophische Propädeutik. in Leitsätzen zu akademischen Vorlesungen
 Paul Natorp Philosophische Propädeutik (Allgemeine Einleitung in die Philosophie und Anfangsgründe der Logik, Ethik und Psychologie) in Leitsätzen zu akademischen Vorlesungen C e l t i s V e r l a g Bibliografische
Paul Natorp Philosophische Propädeutik (Allgemeine Einleitung in die Philosophie und Anfangsgründe der Logik, Ethik und Psychologie) in Leitsätzen zu akademischen Vorlesungen C e l t i s V e r l a g Bibliografische
Freiheit und Gnade" und weitere Beiträge zu Phänomenologie und Ontologie
 Edith Stein Freiheit und Gnade" und weitere Beiträge zu Phänomenologie und Ontologie (1917 bis 1937) bearbeitet und eingeführt von Beate Beckmann-Zöller und Hans Rainer Sepp Jk. HERDER \fj) FREIBURG BASEL
Edith Stein Freiheit und Gnade" und weitere Beiträge zu Phänomenologie und Ontologie (1917 bis 1937) bearbeitet und eingeführt von Beate Beckmann-Zöller und Hans Rainer Sepp Jk. HERDER \fj) FREIBURG BASEL
Kernlehrplan Philosophie - Einführungsphase
 Kernlehrplan Philosophie - Einführungsphase Einführungsphase Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie unterscheiden philosophische
Kernlehrplan Philosophie - Einführungsphase Einführungsphase Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie unterscheiden philosophische
Lehrveranstaltungen von Wilhelm G. Jacobs
 Lehrveranstaltungen von Wilhelm G. Jacobs WS 65/66 Begriff und Begründung der Philosophie (Vorlesung). Fichte: Über die Bestimmung des Gelehrten ( Seminar). WS 66/67 Descartes: Meditationes de prima philosophia
Lehrveranstaltungen von Wilhelm G. Jacobs WS 65/66 Begriff und Begründung der Philosophie (Vorlesung). Fichte: Über die Bestimmung des Gelehrten ( Seminar). WS 66/67 Descartes: Meditationes de prima philosophia
Gebrauch oder Herstellung?
 Gebrauch oder Herstellung? Heidegger über Eigentlichkeit, Wahrheit und phänomenologische Methode von Tobias Henschen 1. Auflage Gebrauch oder Herstellung? Henschen schnell und portofrei erhältlich bei
Gebrauch oder Herstellung? Heidegger über Eigentlichkeit, Wahrheit und phänomenologische Methode von Tobias Henschen 1. Auflage Gebrauch oder Herstellung? Henschen schnell und portofrei erhältlich bei
"Die Struktur, das Zeichen und das Spiel im Diskurs der Wissenschaften vom Menschen"
 Pädagogik Daniel Lennartz "Die Struktur, das Zeichen und das Spiel im Diskurs der Wissenschaften vom Menschen" Essay über den Erkenntnisgewinn durch Dekonstruktion Essay Jaques Derrida: Die Struktur,
Pädagogik Daniel Lennartz "Die Struktur, das Zeichen und das Spiel im Diskurs der Wissenschaften vom Menschen" Essay über den Erkenntnisgewinn durch Dekonstruktion Essay Jaques Derrida: Die Struktur,
Syllabus Beschreibung der Lehrveranstaltung
 Syllabus Beschreibung der Lehrveranstaltung Titel der Lehrveranstaltung Einleitung in die Philosophie Code der Lehrveranstaltung Wissenschaftlichdisziplinärer Bereich der M-Fil/03 M-Fil/01 Lehrveranstaltung
Syllabus Beschreibung der Lehrveranstaltung Titel der Lehrveranstaltung Einleitung in die Philosophie Code der Lehrveranstaltung Wissenschaftlichdisziplinärer Bereich der M-Fil/03 M-Fil/01 Lehrveranstaltung
Was ist ein Gedanke?
 Lieferung 8 Hilfsgerüst zum Thema: Was ist ein Gedanke? Thomas: Es bleibt zu fragen, was der Gedanke selbst [ipsum intellectum] ist. 1 intellectus, -us: Vernunft, Wahrnehmungskraft usw. intellectum, -i:
Lieferung 8 Hilfsgerüst zum Thema: Was ist ein Gedanke? Thomas: Es bleibt zu fragen, was der Gedanke selbst [ipsum intellectum] ist. 1 intellectus, -us: Vernunft, Wahrnehmungskraft usw. intellectum, -i:
N. Westhof (Februar 2006)
 Die Frage des Menschen nach sich selbst im Philosophieunterricht der Oberstufe und die Notwendigkeit einer doppelten Relativierung der historischen Hinsichten. N. Westhof (Februar 2006) Einleitung Daß
Die Frage des Menschen nach sich selbst im Philosophieunterricht der Oberstufe und die Notwendigkeit einer doppelten Relativierung der historischen Hinsichten. N. Westhof (Februar 2006) Einleitung Daß
Schulinternes Curriculum Philosophie Gymnasium Schloss Holte-Stukenbrock
 Schulinternes Curriculum Philosophie Gymnasium Schloss Holte-Stukenbrock EF Unterrichtsvorhaben Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und
Schulinternes Curriculum Philosophie Gymnasium Schloss Holte-Stukenbrock EF Unterrichtsvorhaben Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und
Themenvorschläge Philosophie
 Themenvorschläge Philosophie Der Philosophieunterricht: Wie wurde in den vergangenen Jahrhunderten an den Gymnasien des Kantons Luzern Philosophie unterrichtet? Welche Lehrbücher wurden verwendet? Was
Themenvorschläge Philosophie Der Philosophieunterricht: Wie wurde in den vergangenen Jahrhunderten an den Gymnasien des Kantons Luzern Philosophie unterrichtet? Welche Lehrbücher wurden verwendet? Was
Leitthema: Wille zur Macht
 Leitthema: Wille zur Macht 6 Ort Die folgenden Vorträge werden gemeinsam mit dem entresol durchgeführt und finden im Restaurant Weisser Wind, Weggenstube, Oberdorfstrasse 20, 8001 Zürich statt. Eintritt
Leitthema: Wille zur Macht 6 Ort Die folgenden Vorträge werden gemeinsam mit dem entresol durchgeführt und finden im Restaurant Weisser Wind, Weggenstube, Oberdorfstrasse 20, 8001 Zürich statt. Eintritt
Prof. Dr. Jürgen Neyer. Einführung in die Politikwissenschaft. - Was ist Wissenschaft? Di
 Prof. Dr. Jürgen Neyer Einführung in die Politikwissenschaft - 25.4.2008 Di 11-15-12.45 Wissenschaft ist die Tätigkeit des Erwerbs von Wissen durch Forschung, seine Weitergabe durch Lehre, der gesellschaftliche,
Prof. Dr. Jürgen Neyer Einführung in die Politikwissenschaft - 25.4.2008 Di 11-15-12.45 Wissenschaft ist die Tätigkeit des Erwerbs von Wissen durch Forschung, seine Weitergabe durch Lehre, der gesellschaftliche,
Aristoteles Definition der Seele in "De Anima II", 1-5
 Geisteswissenschaft Martin Hagemeier Aristoteles Definition der Seele in "De Anima II", 1-5 Studienarbeit INHALT 1. HINFÜHRUNG...2 2. DIE DEFINITIONEN DER SEELE...3 2.1. DER RAHMEN DER SEELENDEFINITIONEN...3
Geisteswissenschaft Martin Hagemeier Aristoteles Definition der Seele in "De Anima II", 1-5 Studienarbeit INHALT 1. HINFÜHRUNG...2 2. DIE DEFINITIONEN DER SEELE...3 2.1. DER RAHMEN DER SEELENDEFINITIONEN...3
Was es gibt und wie es ist
 Was es gibt und wie es ist Dritte Sitzung Existenzfragen 0. Zur Erinnerung Benjamin Schnieder Philosophisches Seminar der Universität Hamburg 0 1 Was ist die Ontologie? Platons Bart Eine Standard-Antwort
Was es gibt und wie es ist Dritte Sitzung Existenzfragen 0. Zur Erinnerung Benjamin Schnieder Philosophisches Seminar der Universität Hamburg 0 1 Was ist die Ontologie? Platons Bart Eine Standard-Antwort
Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie
 Philosophie schulinternes Curriculum für die EF Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie - unterscheiden philosophische Fragen
Philosophie schulinternes Curriculum für die EF Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie - unterscheiden philosophische Fragen
-> Die drei Argumentationsformen u. ihr jeweiliges Kriterium
 Gliederung -> Die drei Argumentationsformen u. ihr jeweiliges Kriterium -> Worauf rekurriert eine Naturrechtstheorie? -> Kurzer Einstieg: Der naturrechtliche Ansatz Martha C. Nussbaums in der modernen
Gliederung -> Die drei Argumentationsformen u. ihr jeweiliges Kriterium -> Worauf rekurriert eine Naturrechtstheorie? -> Kurzer Einstieg: Der naturrechtliche Ansatz Martha C. Nussbaums in der modernen
Rudolf Steiner DR. HEINRICH V. SCHOELER. KRITIK DER WISSENSCHAFTLICHEN ERKENNTNIS
 Rudolf Steiner DR. HEINRICH V. SCHOELER. KRITIK DER WISSENSCHAFTLICHEN ERKENNTNIS Eine vorurteilslose Weltanschauung. Leipzig 1898 Magazin für Literatur, 68. g., Nr. 47 u. 69, 25. Nov. 1898 u. 6. anuar
Rudolf Steiner DR. HEINRICH V. SCHOELER. KRITIK DER WISSENSCHAFTLICHEN ERKENNTNIS Eine vorurteilslose Weltanschauung. Leipzig 1898 Magazin für Literatur, 68. g., Nr. 47 u. 69, 25. Nov. 1898 u. 6. anuar
Ekkehard Martens/ Herbert Schnädelbach (Hg.) Philosophie. Ein Grundkurs. rowohlts enzyklopädie
 Ekkehard Martens/ Herbert Schnädelbach (Hg.) Philosophie Ein Grundkurs rowohlts enzyklopädie Inhalt Ekkehard Martens/Herbert Schnädelbach 1 Vorwort 9 Ekkehard Martens/Herbert Schnädelbach 2 Zur gegenwärtigen
Ekkehard Martens/ Herbert Schnädelbach (Hg.) Philosophie Ein Grundkurs rowohlts enzyklopädie Inhalt Ekkehard Martens/Herbert Schnädelbach 1 Vorwort 9 Ekkehard Martens/Herbert Schnädelbach 2 Zur gegenwärtigen
Schulinterner Kernlehrplan EF PL Leonardo-da-Vinci-Gymnasium Köln-Nippes
 Schulinterner Kernlehrplan EF PL Leonardo-da-Vinci-Gymnasium Köln-Nippes Thema 1: Kompetenzen: Was ist Philosophie? Welterklärung in Mythos, Naturwissenschaft und Philosophie Sachkompetenz (SK) - unterscheiden
Schulinterner Kernlehrplan EF PL Leonardo-da-Vinci-Gymnasium Köln-Nippes Thema 1: Kompetenzen: Was ist Philosophie? Welterklärung in Mythos, Naturwissenschaft und Philosophie Sachkompetenz (SK) - unterscheiden
Unterrichtsvorhaben I
 Lehrplan Philosophie für die Einführungsphase (Jgst. 10) Übersichtsraster der verbindlichen Unterrichtsvorhaben Thema: Was ist Philosophie? Unterrichtsvorhaben I arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt
Lehrplan Philosophie für die Einführungsphase (Jgst. 10) Übersichtsraster der verbindlichen Unterrichtsvorhaben Thema: Was ist Philosophie? Unterrichtsvorhaben I arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt
Idsteiner Mittwochsgesellschaft
 Dieter Kunz 11. April 2012 www.idsteiner-mittwochsgesellschaft.de/dokumente/2012/20120411.pdf Der Philosoph (1770 1831), porträtiert von Jakob Schlesinger 1 gilt als der bedeutendste Vertreter des deutschen
Dieter Kunz 11. April 2012 www.idsteiner-mittwochsgesellschaft.de/dokumente/2012/20120411.pdf Der Philosoph (1770 1831), porträtiert von Jakob Schlesinger 1 gilt als der bedeutendste Vertreter des deutschen
Der metaethische Relativismus
 Geisteswissenschaft Julia Pech Der metaethische Relativismus Was spricht für/gegen eine relativistische Position in der Moral? Essay Julia Pech 8.5.2011 Universität Stuttgart Proseminar: Einführung in
Geisteswissenschaft Julia Pech Der metaethische Relativismus Was spricht für/gegen eine relativistische Position in der Moral? Essay Julia Pech 8.5.2011 Universität Stuttgart Proseminar: Einführung in
Gültig für Studierende, die ab dem Wintersemester 2012/13 mit ihrem Studium beginnen.
 Institut für Philosophie Stand 21.08.2014 Gültig für Studierende, die ab dem Wintersemester 2012/13 mit ihrem Studium beginnen. Modulhandbuch M.A. (2-Fach) Philosophie Das Studienziel des MA-Studiengangs
Institut für Philosophie Stand 21.08.2014 Gültig für Studierende, die ab dem Wintersemester 2012/13 mit ihrem Studium beginnen. Modulhandbuch M.A. (2-Fach) Philosophie Das Studienziel des MA-Studiengangs
Kritik der Urteilskraft
 IMMANUEL KANT Kritik der Urteilskraft Anaconda INHALT Vorrede...................................... 13 Einleitung..................................... 19 I. Von der Einteilung der Philosophie..............
IMMANUEL KANT Kritik der Urteilskraft Anaconda INHALT Vorrede...................................... 13 Einleitung..................................... 19 I. Von der Einteilung der Philosophie..............
PAUL HABERLIN I PHILOSOPHIA PERENNIS
 PAUL HABERLIN I PHILOSOPHIA PERENNIS PAUL HABERLIN PHILOSOPHIA PERENNIS EINE ZUSAMMENFASSUNG SPRINGER-VERLAG BERLIN GOTTINGEN. HEIDELBERG 195 2 ISBN 978-3-642-49531-1 DOl 10.1007/978-3-642-49822-0 ISBN
PAUL HABERLIN I PHILOSOPHIA PERENNIS PAUL HABERLIN PHILOSOPHIA PERENNIS EINE ZUSAMMENFASSUNG SPRINGER-VERLAG BERLIN GOTTINGEN. HEIDELBERG 195 2 ISBN 978-3-642-49531-1 DOl 10.1007/978-3-642-49822-0 ISBN
Sein und Zeit ( 31-33) Zusammenfassung des Kommentars von LUCKNER
 Sein und Zeit ( 31-33) Zusammenfassung des Kommentars von LUCKNER 31 - Das Da-sein als Verstehen! Verstehen ist neben der Befindlichkeit ein weiteres Strukturmoment wie wir in der Welt da sind: nicht nur
Sein und Zeit ( 31-33) Zusammenfassung des Kommentars von LUCKNER 31 - Das Da-sein als Verstehen! Verstehen ist neben der Befindlichkeit ein weiteres Strukturmoment wie wir in der Welt da sind: nicht nur
Die analytische Tradition
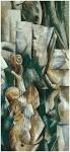 Die analytische Tradition lingustic turn : Wende von der Bewusstseins- zur Sprachphilosophie ab Ende des 19. bzw. Beginn des 20. Jahrhunderts Die analytische Tradition Die Philosophie ist ein Kampf gegen
Die analytische Tradition lingustic turn : Wende von der Bewusstseins- zur Sprachphilosophie ab Ende des 19. bzw. Beginn des 20. Jahrhunderts Die analytische Tradition Die Philosophie ist ein Kampf gegen
2. Seinsweise, die in der Angleichung von Ding und Verstand besteht. 3. Unmittelbare Wirkung dieser Angleichung: die Erkenntnis.
 THOMAS VON AQUIN - De veritate (Quaestio I) - Zusammenfassung Erster Artikel: Was ist Wahrheit?! Ziel ist die Erschließung des Wortes Wahrheit und der mit diesem Begriff verwandten Wörter.! 1. Grundlage
THOMAS VON AQUIN - De veritate (Quaestio I) - Zusammenfassung Erster Artikel: Was ist Wahrheit?! Ziel ist die Erschließung des Wortes Wahrheit und der mit diesem Begriff verwandten Wörter.! 1. Grundlage
Kants,Kritik der praktischen Vernunft'
 Giovanni B. Sala Kants,Kritik der praktischen Vernunft' Ein Kommentar Wissenschaftliche Buchgesellschaft Inhalt Einleitung des Verfassers 11 Der Werdegang der Ethik Kants 1. Kants Ethik und die Tradition
Giovanni B. Sala Kants,Kritik der praktischen Vernunft' Ein Kommentar Wissenschaftliche Buchgesellschaft Inhalt Einleitung des Verfassers 11 Der Werdegang der Ethik Kants 1. Kants Ethik und die Tradition
Schulinternes Curriculum für das Fach Philosophie
 1 Schulinternes Curriculum für das Fach Philosophie Einführungsphase EPH.1: Einführung in die Philosophie Was ist Philosophie? (Die offene Formulierung der Lehrpläne der EPH.1 lässt hier die Möglichkeit,
1 Schulinternes Curriculum für das Fach Philosophie Einführungsphase EPH.1: Einführung in die Philosophie Was ist Philosophie? (Die offene Formulierung der Lehrpläne der EPH.1 lässt hier die Möglichkeit,
Liebe als eine Leidenschaft bei Descartes.
 Andre Schuchardt präsentiert Liebe als eine Leidenschaft bei Descartes. Inhaltsverzeichnis Liebe als eine Leidenschaft bei Descartes...1 1. Einleitung...1 2. Körper und Seele....2 3. Von Liebe und Hass...4
Andre Schuchardt präsentiert Liebe als eine Leidenschaft bei Descartes. Inhaltsverzeichnis Liebe als eine Leidenschaft bei Descartes...1 1. Einleitung...1 2. Körper und Seele....2 3. Von Liebe und Hass...4
Über die Möglichkeit, gegen das Gehirn ein Veto einzulegen
 Medien Marius Donadello Über die Möglichkeit, gegen das Gehirn ein Veto einzulegen Können bewusste mentale Prozesse kausal wirksam sein? Magisterarbeit Schriftliche Hausarbeit für die Prüfung zur Erlangung
Medien Marius Donadello Über die Möglichkeit, gegen das Gehirn ein Veto einzulegen Können bewusste mentale Prozesse kausal wirksam sein? Magisterarbeit Schriftliche Hausarbeit für die Prüfung zur Erlangung
Ästhetik ist die Theorie der ästhetischen Erfahrung, der ästhetischen Gegenstände und der ästhetischen Eigenschaften.
 16 I. Was ist philosophische Ästhetik? instrumente. Die Erkenntnis ästhetischer Qualitäten ist nur eine unter vielen möglichen Anwendungen dieses Instruments. In diesem Sinn ist die Charakterisierung von
16 I. Was ist philosophische Ästhetik? instrumente. Die Erkenntnis ästhetischer Qualitäten ist nur eine unter vielen möglichen Anwendungen dieses Instruments. In diesem Sinn ist die Charakterisierung von
Vorlesung. Willensfreiheit. Prof. Dr. Martin Seel 8. Dezember Kant, Kritik der reinen Vernunft, B472:
 Vorlesung Willensfreiheit Prof. Dr. Martin Seel 8. Dezember 2005 Kant, Kritik der reinen Vernunft, B472: Die Kausalität nach Gesetzen der Natur ist nicht die einzige, aus welcher die Erscheinungen der
Vorlesung Willensfreiheit Prof. Dr. Martin Seel 8. Dezember 2005 Kant, Kritik der reinen Vernunft, B472: Die Kausalität nach Gesetzen der Natur ist nicht die einzige, aus welcher die Erscheinungen der
Inhaltsverzeichnis. I. Geschichte der Philosophie 1. Inhaltsverzeichnis. Vorwort
 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Vorwort Einleitung XI XIII I. Geschichte der Philosophie 1 1 Antike 3 1.1 Einführung 3 1.2 Frühe griechische Philosophen 4 1.3 Die sophistische Bewegung und Sokrates
Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Vorwort Einleitung XI XIII I. Geschichte der Philosophie 1 1 Antike 3 1.1 Einführung 3 1.2 Frühe griechische Philosophen 4 1.3 Die sophistische Bewegung und Sokrates
Sicherer, nicht sinnvoll bezweifelbarer Ausgangspunkt des Denkens: Ich existiere.
 Descartes, Zweite Meditation Sicherer, nicht sinnvoll bezweifelbarer Ausgangspunkt des Denkens: Ich existiere. Das ist selbst dann nicht bezweifelbar, wenn ich in Betracht ziehe, dass es einen allmächtigen
Descartes, Zweite Meditation Sicherer, nicht sinnvoll bezweifelbarer Ausgangspunkt des Denkens: Ich existiere. Das ist selbst dann nicht bezweifelbar, wenn ich in Betracht ziehe, dass es einen allmächtigen
Nietzsches Philosophie des Scheins
 Nietzsches Philosophie des Scheins Die Deutsche Bibliothek CIP-Einheitsaufnahme Seggern, Hans-Gerd von: Nietzsches Philosophie des Scheins / von Hans-Gerd von Seggern. - Weimar : VDG, 1999 ISBN 3-89739-067-1
Nietzsches Philosophie des Scheins Die Deutsche Bibliothek CIP-Einheitsaufnahme Seggern, Hans-Gerd von: Nietzsches Philosophie des Scheins / von Hans-Gerd von Seggern. - Weimar : VDG, 1999 ISBN 3-89739-067-1
Vorlesung Der Begriff der Person : WS 2008/09 PD Dr. Dirk Solies Begleitendes Thesenpapier nur für Studierende gedacht!
 Vorlesung Der Begriff der Person : WS 2008/09 PD Dr. Dirk Solies Begleitendes Thesenpapier nur für Studierende gedacht! Die Person im Existenzialismus Rückgriff: Kierkegaard o Person als Selbstverhältnis
Vorlesung Der Begriff der Person : WS 2008/09 PD Dr. Dirk Solies Begleitendes Thesenpapier nur für Studierende gedacht! Die Person im Existenzialismus Rückgriff: Kierkegaard o Person als Selbstverhältnis
Inhaltsverzeichnis. Vorwort 11
 Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 1. Einleitung 13 1.1 Vorblick 13 1.2 Aufgaben der Ethik als eines Prozesses der Reflexion 13 1.2.1 Ohne Fragestellung kein Zugang zur ethischen Reflexion 13 1.2.2 Was bedeutet
Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 1. Einleitung 13 1.1 Vorblick 13 1.2 Aufgaben der Ethik als eines Prozesses der Reflexion 13 1.2.1 Ohne Fragestellung kein Zugang zur ethischen Reflexion 13 1.2.2 Was bedeutet
Aristoteles über die Arten der Freundschaft.
 1 Andre Schuchardt präsentiert Aristoteles über die Arten der Freundschaft. Inhaltsverzeichnis Aristoteles über die Freundschaft...1 1. Einleitung...1 2. Allgemeines...2 3. Nutzenfreundschaft...3 4. Lustfreundschaft...4
1 Andre Schuchardt präsentiert Aristoteles über die Arten der Freundschaft. Inhaltsverzeichnis Aristoteles über die Freundschaft...1 1. Einleitung...1 2. Allgemeines...2 3. Nutzenfreundschaft...3 4. Lustfreundschaft...4
Platons Symposion. Die Rede des Sokrates: Bericht einer Rede der Diotima über das wahre Wesen des Eros. Hilfsfragen zur Lektüre von: Sechste Lieferung
 Hilfsfragen zur Lektüre von: Platons Symposion Die Rede des Sokrates: Bericht einer Rede der Diotima über das wahre Wesen des Eros 201 D 212 C Sechste Lieferung [1] Woher hat Sokrates seine Kenntnisse
Hilfsfragen zur Lektüre von: Platons Symposion Die Rede des Sokrates: Bericht einer Rede der Diotima über das wahre Wesen des Eros 201 D 212 C Sechste Lieferung [1] Woher hat Sokrates seine Kenntnisse
L E H R P L A N P H I L O S O P H I E
 L E H R P L A N P H I L O S O P H I E Das Schulcurriculum stützt sich auf die in der Obligatorik für das Fach Philosophie vorgesehenen Schwerpunkte und gibt den Rahmen für die individuelle Unterrichtsgestaltung
L E H R P L A N P H I L O S O P H I E Das Schulcurriculum stützt sich auf die in der Obligatorik für das Fach Philosophie vorgesehenen Schwerpunkte und gibt den Rahmen für die individuelle Unterrichtsgestaltung
Prof. Dr. Tim Henning
 Prof. Dr. Tim Henning Vorlesung Einführung in die Metaethik 127162001 Mittwoch, 11.30-13.00 Uhr M 18.11 19.10.2016 PO 09 / GymPO PO 14 / BEd 1-Fach-Bachelor: BM4 KM2 Bachelor Nebenfach (neu): KM2 KM2 Lehramt:
Prof. Dr. Tim Henning Vorlesung Einführung in die Metaethik 127162001 Mittwoch, 11.30-13.00 Uhr M 18.11 19.10.2016 PO 09 / GymPO PO 14 / BEd 1-Fach-Bachelor: BM4 KM2 Bachelor Nebenfach (neu): KM2 KM2 Lehramt:
INHALTSÜBERSICHT I. TRANSZENDENTALE ELEMENTARLEHRE.. 79
 INHALTSÜBERSICHT Zueignung 19 Vorrede zur zweiten Auflage 21 Einleitung 49 I. Von dem Unterschiede der reinen und empirischen Erkenntnis 49 II. Wir sind im Besitze gewisser Erkenntnisse a priori, und selbst
INHALTSÜBERSICHT Zueignung 19 Vorrede zur zweiten Auflage 21 Einleitung 49 I. Von dem Unterschiede der reinen und empirischen Erkenntnis 49 II. Wir sind im Besitze gewisser Erkenntnisse a priori, und selbst
PHÄNOMENOLOGIE UND IDEE
 JÜRGEN BRANKEL PHÄNOMENOLOGIE UND IDEE VERLAG TURIA + KANT WIEN BERLIN Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
JÜRGEN BRANKEL PHÄNOMENOLOGIE UND IDEE VERLAG TURIA + KANT WIEN BERLIN Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Erkenntnistheorie I. Der klassische Wissensbegriff: Wissen ist wahre, gerechtfertigte Überzeugung
 Erkenntnistheorie I Platon II: Das Höhlengleichnis Die Ideenlehre Wiederholung Der klassische Wissensbegriff: Wissen ist wahre, gerechtfertigte Überzeugung Was kann man ( sicher ) wissen? Wahrheiten über
Erkenntnistheorie I Platon II: Das Höhlengleichnis Die Ideenlehre Wiederholung Der klassische Wissensbegriff: Wissen ist wahre, gerechtfertigte Überzeugung Was kann man ( sicher ) wissen? Wahrheiten über
Voransicht. Bilder: Optische Täuschungen.
 S II A Anthropologie Beitrag 5 1 Eine Einführung in die Erkenntnistheorie Juliane Mönnig, Konstanz Bilder: Optische Täuschungen. Klasse: 11/12 Dauer: 12 Stunden Arbeitsbereich: Anthropologie / Erkenntnistheorie
S II A Anthropologie Beitrag 5 1 Eine Einführung in die Erkenntnistheorie Juliane Mönnig, Konstanz Bilder: Optische Täuschungen. Klasse: 11/12 Dauer: 12 Stunden Arbeitsbereich: Anthropologie / Erkenntnistheorie
Das präreflexive Cogito.
 Das präreflexive Cogito. Sartres Theorie des unmittelbaren Selbstbewusstseins im Vergleich mit Fichtes Selbstbewusstseinstheorie in den Jenaer Wissenschaftslehren Dissertation zur Erlangung der Würde eines
Das präreflexive Cogito. Sartres Theorie des unmittelbaren Selbstbewusstseins im Vergleich mit Fichtes Selbstbewusstseinstheorie in den Jenaer Wissenschaftslehren Dissertation zur Erlangung der Würde eines
Religionsunterricht wozu?
 Religionsunterricht wozu? Mensch Fragen Leben Gott Beziehungen Gestalten Arbeit Glaube Zukunft Moral Werte Sinn Kirche Ziele Dialog Erfolg Geld Wissen Hoffnung Kritik??? Kompetenz Liebe Verantwortung Wirtschaft
Religionsunterricht wozu? Mensch Fragen Leben Gott Beziehungen Gestalten Arbeit Glaube Zukunft Moral Werte Sinn Kirche Ziele Dialog Erfolg Geld Wissen Hoffnung Kritik??? Kompetenz Liebe Verantwortung Wirtschaft
kultur- und sozialwissenschaften
 Kurt Röttgers Redaktion: Juli 2014 Einführung in die Geschichtsphilosophie Kurseinheit 03 von 04 kultur- und sozialwissenschaften Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
Kurt Röttgers Redaktion: Juli 2014 Einführung in die Geschichtsphilosophie Kurseinheit 03 von 04 kultur- und sozialwissenschaften Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
Realität Virtualität Wirklichkeit
 Virtualität 2. Vorlesung (24.4.12): und Christoph Hubig (1)/Scholastik: Duns Scotus, Antonius Trombetta res realitas (actualis) was eine res als res konstituiert/ ausmacht (rationes) quidditas / Washeit
Virtualität 2. Vorlesung (24.4.12): und Christoph Hubig (1)/Scholastik: Duns Scotus, Antonius Trombetta res realitas (actualis) was eine res als res konstituiert/ ausmacht (rationes) quidditas / Washeit
Name: Liyang Zhao Jahrgangsstufe: EF Lehrkraft: Frau Jeske Städtisches Gymnasium Hennef Fritz-Jacobi- Str Hennef
 Bundes- und Landeswettbewerb - Philosophischer Essay (2013) Name: Liyang Zhao Jahrgangsstufe: EF Lehrkraft: Frau Jeske Städtisches Gymnasium Hennef Fritz-Jacobi- Str. 18 53773 Hennef Gibt es beständiges
Bundes- und Landeswettbewerb - Philosophischer Essay (2013) Name: Liyang Zhao Jahrgangsstufe: EF Lehrkraft: Frau Jeske Städtisches Gymnasium Hennef Fritz-Jacobi- Str. 18 53773 Hennef Gibt es beständiges
Philosophische Anthropologie
 Gerd Haeffner Philosophische Anthropologie Grundkurs Philosophie 1 4., durchgesehene und ergänzte Auflage Verlag W. Kohlhammer Inhalt Einleitung 11 A. Die Frage nach dem rechten Ansatz 17 1. Ein Vorbegriff
Gerd Haeffner Philosophische Anthropologie Grundkurs Philosophie 1 4., durchgesehene und ergänzte Auflage Verlag W. Kohlhammer Inhalt Einleitung 11 A. Die Frage nach dem rechten Ansatz 17 1. Ein Vorbegriff
Eine Untersuchung zu Verstand und Vernunft
 Joachim Stiller Eine Untersuchung zu Verstand und Vernunft Eine Untersuchung Alle Rechte vorbehalten Eine Untersuchung zu Verstand und Vernunft Was ist der Unterschied zwischen Verstand und Vernunft? Zunächst
Joachim Stiller Eine Untersuchung zu Verstand und Vernunft Eine Untersuchung Alle Rechte vorbehalten Eine Untersuchung zu Verstand und Vernunft Was ist der Unterschied zwischen Verstand und Vernunft? Zunächst
- Im 20. Jahrhundert wurde das Thema der Emotionen dagegen in der Philosophie des Geistes und in der Psychologie kaum behandelt.
 1 Vorlesung: Einführung in die Philosophie des Geistes Martine Nida-Rümelin Sommer 03 1. und 2. Vorlesung nach Vertretungszeit 19.5.03 und 20.5.03 Thema: Philosophie der Emotionen 1. Vorbemerkungen - Emotionen
1 Vorlesung: Einführung in die Philosophie des Geistes Martine Nida-Rümelin Sommer 03 1. und 2. Vorlesung nach Vertretungszeit 19.5.03 und 20.5.03 Thema: Philosophie der Emotionen 1. Vorbemerkungen - Emotionen
GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL WERKE 8
 GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL WERKE 8 Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830) Erster Teil Die Wissenschaft der Logik Mit den mündlichen Zusätzen SUHRKAMP INHALT Vorrede zur
GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL WERKE 8 Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830) Erster Teil Die Wissenschaft der Logik Mit den mündlichen Zusätzen SUHRKAMP INHALT Vorrede zur
Zeit eine Illusion - oder in. tempus praesens
 Zeit eine Illusion - oder in tempus praesens I. Exposition der Problemstellung Welche Bedeutung hat die Zeit? 1. Deckt der Begriff der Illusion die Facetten das Phänomens ab? 2. Die Philosophie der Moderne
Zeit eine Illusion - oder in tempus praesens I. Exposition der Problemstellung Welche Bedeutung hat die Zeit? 1. Deckt der Begriff der Illusion die Facetten das Phänomens ab? 2. Die Philosophie der Moderne
Zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a priori
 Geisteswissenschaft Pola Sarah Zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a priori Essay Essay zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a
Geisteswissenschaft Pola Sarah Zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a priori Essay Essay zu Immanuel Kant: Die Metaphysik beruht im Wesentlichen auf Behauptungen a
ETHIK UND ÖKONOMIE IN HEGELS PHILOSOPHIE UND IN MODERNEN WIRTSCHAFTSETHISCHEN ENTWÜRFEN
 ETHIK UND ÖKONOMIE IN HEGELS PHILOSOPHIE UND IN MODERNEN WIRTSCHAFTSETHISCHEN ENTWÜRFEN von ALBENA NESCHEN FELIX MEINER VERLAG HAMBURG INHALT VORWORT 9 EINLEITUNG :.:.:;.....:... 11 ERSTES KAPITEL, Der
ETHIK UND ÖKONOMIE IN HEGELS PHILOSOPHIE UND IN MODERNEN WIRTSCHAFTSETHISCHEN ENTWÜRFEN von ALBENA NESCHEN FELIX MEINER VERLAG HAMBURG INHALT VORWORT 9 EINLEITUNG :.:.:;.....:... 11 ERSTES KAPITEL, Der
Rainer Totzke Buchstaben-Folgen
 Rainer Totzke Buchstaben-Folgen Schriftlichkeit, Wissenschaft, und Heideggers Kritik an der Wissenschaftsideologie VELBRÜCK WISSENSCHAFT Inhalt Einleitung 9 TEIL I SCHRIFT UND WISSENSCHAFT I MÜNDLICHKEIT
Rainer Totzke Buchstaben-Folgen Schriftlichkeit, Wissenschaft, und Heideggers Kritik an der Wissenschaftsideologie VELBRÜCK WISSENSCHAFT Inhalt Einleitung 9 TEIL I SCHRIFT UND WISSENSCHAFT I MÜNDLICHKEIT
Predigt am Sonntag Jubilate (17. April 2016) 2. Korinther 4,16 18 Illustrationen zu Platons Höhlengleichnis!
 Predigt am Sonntag Jubilate (17. April 2016) 2. Korinther 4,16 18 Illustrationen zu Platons Höhlengleichnis! Liebe Gemeinde! Jubilate, heißt dieser Sonntag, aber worüber sollte man sich besonders angesichts
Predigt am Sonntag Jubilate (17. April 2016) 2. Korinther 4,16 18 Illustrationen zu Platons Höhlengleichnis! Liebe Gemeinde! Jubilate, heißt dieser Sonntag, aber worüber sollte man sich besonders angesichts
Oliver Sensen. Die Begründung des Kategorischen Imperativs
 Oliver Sensen Die Begründung des Kategorischen Imperativs Erschienen in: Dieter Schönecker (Hrsg.), Kants Begründung von Freiheit und Moral in Grundlegung III ISBN 978-3-89785-078-1 (Print) mentis MÜNSTER
Oliver Sensen Die Begründung des Kategorischen Imperativs Erschienen in: Dieter Schönecker (Hrsg.), Kants Begründung von Freiheit und Moral in Grundlegung III ISBN 978-3-89785-078-1 (Print) mentis MÜNSTER
Pestalozzi-Gymnasium Unna im Januar Schulinternes Curriculum Praktische Philosophie für die Jahrgangsstufen 9 und 10 bzw.
 Pestalozzi-Gymnasium Unna im Januar 2010 Schulinternes Curriculum Praktische Philosophie für die Jahrgangsstufen 9 und 10 bzw. 8 und 9: Fragenkreis 1. Die dem Selbst Körper Leib Seele Freiheit ( obligatorisch)
Pestalozzi-Gymnasium Unna im Januar 2010 Schulinternes Curriculum Praktische Philosophie für die Jahrgangsstufen 9 und 10 bzw. 8 und 9: Fragenkreis 1. Die dem Selbst Körper Leib Seele Freiheit ( obligatorisch)
Formale Logik. 1. Sitzung. Allgemeines vorab. Allgemeines vorab. Terminplan
 Allgemeines vorab Formale Logik 1. Sitzung Prof. Dr. Ansgar Beckermann Sommersemester 2005 Wie es abläuft Vorlesung Übungszettel Tutorien Es gibt ca. in der Mitte und am Ende des Semesters je eine Klausur
Allgemeines vorab Formale Logik 1. Sitzung Prof. Dr. Ansgar Beckermann Sommersemester 2005 Wie es abläuft Vorlesung Übungszettel Tutorien Es gibt ca. in der Mitte und am Ende des Semesters je eine Klausur
Joachim Stiller. Platon: Menon. Eine Besprechung des Menon. Alle Rechte vorbehalten
 Joachim Stiller Platon: Menon Eine Besprechung des Menon Alle Rechte vorbehalten Inhaltliche Gliederung A: Einleitung Platon: Menon 1. Frage des Menon nach der Lehrbarkeit der Tugend 2. Problem des Sokrates:
Joachim Stiller Platon: Menon Eine Besprechung des Menon Alle Rechte vorbehalten Inhaltliche Gliederung A: Einleitung Platon: Menon 1. Frage des Menon nach der Lehrbarkeit der Tugend 2. Problem des Sokrates:
Thema des Unterrichtsvorhabens: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie. Kompetenzerwartungen
 Schulcurriculum Philosophie EF Leibniz Gymnasium 2014 Erstes Unterrichtsvorhaben: Inhaltsfeld: Der Mensch und sein Handeln Eigenart philosophischen Fragens und Denkens Metaphysische Probleme als Herausforderung
Schulcurriculum Philosophie EF Leibniz Gymnasium 2014 Erstes Unterrichtsvorhaben: Inhaltsfeld: Der Mensch und sein Handeln Eigenart philosophischen Fragens und Denkens Metaphysische Probleme als Herausforderung
Philosophische Semantik
 Erst mit Frege kam es zur endgültigen Bestimmung des eigentlichen Gegenstandes der Philosophie: Nämlich erstens, daß das Ziel der Philosophie die Analyse der Struktur von Gedanken ist; zweitens, daß die
Erst mit Frege kam es zur endgültigen Bestimmung des eigentlichen Gegenstandes der Philosophie: Nämlich erstens, daß das Ziel der Philosophie die Analyse der Struktur von Gedanken ist; zweitens, daß die
Referenten: Tim Dwinger, Sven Knoke und Leon Mischlich
 Kurs: GK Philosophie 12.2 Kurslehrer: Herr Westensee Referatsthema: Wahrheit vs. Logik Referenten: Tim Dwinger, Sven Knoke und Leon Mischlich Gliederung 1. Einleitung 2. Wahrheit 2.1.Thomas v. Aquin 2.1.1.
Kurs: GK Philosophie 12.2 Kurslehrer: Herr Westensee Referatsthema: Wahrheit vs. Logik Referenten: Tim Dwinger, Sven Knoke und Leon Mischlich Gliederung 1. Einleitung 2. Wahrheit 2.1.Thomas v. Aquin 2.1.1.
Philosophie Ergänzungsfach
 Philosophie Ergänzungsfach A. Stundendotation Klasse 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse Wochenlektion 0 0 0 4 B. Didaktische Konzeption Überfachliche Kompetenzen Das Ergänzungsfach Philosophie fördert
Philosophie Ergänzungsfach A. Stundendotation Klasse 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse Wochenlektion 0 0 0 4 B. Didaktische Konzeption Überfachliche Kompetenzen Das Ergänzungsfach Philosophie fördert
Bachelor of Arts Sozialwissenschaften und Philosophie (Kernfach Philosophie)
 06-03-101-1 Pflicht Einführung in die Theoretische Philosophie 1. Semester jedes Wintersemester Vorlesung "Einführung in die Theoretische Philosophie" (2 SWS) = 30 h Präsenzzeit und 70 h Seminar "Philosophische
06-03-101-1 Pflicht Einführung in die Theoretische Philosophie 1. Semester jedes Wintersemester Vorlesung "Einführung in die Theoretische Philosophie" (2 SWS) = 30 h Präsenzzeit und 70 h Seminar "Philosophische
Einführungsphase. Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was ist und was soll Philosophie? Mythos, Religion und Wissenschaft
 Einführungsphase Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was ist und was soll Philosophie? Mythos, Religion und Wissenschaft erkennen die Besonderheit philosophischen Denkens und d.h. philosophischen Fragens und
Einführungsphase Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was ist und was soll Philosophie? Mythos, Religion und Wissenschaft erkennen die Besonderheit philosophischen Denkens und d.h. philosophischen Fragens und
