SPEKTRUM. Mitteilungsblatt der Fachgruppe. Spektroskopie. der Vereinigung der Sternfreunde e.v. Ausgabe Nr. 34 ( 2007 )
|
|
|
- August Franke
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 SPEKTRUM Mitteilungsblatt der Fachgruppe Spektroskopie der Vereinigung der Sternfreunde e.v. Ausgabe Nr. 34 ( 2007 ) Einzelheft: 3,50 Euro ( plus Porto ) Herausgeber: Ernst Pollmann Emil Nolde Straße Leverkusen 1
2 Impressum Das Mitteilungsblatt SPEKTRUM erscheint halbjährlich als Kommunikationsorgan der Fachgruppe SPEKTROSKOPIE der Vereinigung der Sternfreunde e.v. Für den Inhalt sind die Autoren selbst verantwortlich. Kontakt Ernst Pollmann Emil Nolde Straße Leverkusen Telefon: Bankverbindung: Konto Nr ; Bankleitzahl ; Sparkasse Leverkusen Inhalt Seite Bernd Hanisch Die Beobachtung des spektroskopischen Doppelsterns β Aurigae Ernst Pollmann Bericht zur Teilnahme an der Sternparty für Astro-Physik am Observatorium de Haute Provence....7 Ernst Pollmann Die Jahrestagung der VdS-FG Spektroskopie Joachim Draeger Ein Verfahren zur Subtraktion des Hintergrundes für spaltlose Flash-Spektren 16 2
3 Die Beobachtung des spektroskopischen Doppelsterns β Aurigae (von Bernd Hanisch, Lebus) Nachfolgend wird über den Versuch berichtet, einen spektroskopischen Doppelstern mit einem einfachen Amateur-Objektivprismenspektrografen zu beobachten. Dieser Bericht stellt gleichzeitig eine Zusammenfassung wesentlicher Teile des auf der Jahrestagung der Fachgruppe Spektroskopie vom Mai 2006 in Sonneberg gehaltenen Vortrages Erste Erfahrungen bei der Beobachtung spektroskopischer Doppelsterne dar. 1. Theoretische Überlegungen zu spektroskopischen Doppelsternen Spektroskopische Doppelsterne sind Sternsysteme mit zwei oder mehreren Komponenten, die sich nach den Keplerschen Gesetzen um einen gemeinsamen Schwerpunkt bewegen und die so eng beieinander stehen, dass sie optisch nicht mehr getrennt werden können [1]. Die Bewegung der Komponenten wird aber in ihren Spektren durch periodische Linienverschiebungen bzw. Linienaufspaltungen sichtbar, wodurch diese Sterne letztlich als Mehrkomponentensysteme identifiziert werden können. Ob lediglich die periodische Verschiebung einer Linie oder die Aufspaltung zu einem Linienpaar beobachtet werden kann, hängt praktisch vom Helligkeitsunterschied der Komponenten des Systems ab. Beträgt dieser nicht mehr als 1 bis 2 Magnituden, können unter Amateurbedingungen bei helleren Sternen in der Regel beide Komponenten beobachtet werden. Das Prinzip der Verschiebung bzw. Aufspaltung der Linien infolge der Bewegung des Systems bzw. der Komponenten zeigt Abb. 1. v r =0 B v r = + v max λ 0 = Laborwellenlänge C S A λ s =Verschiebung durch v s des Systems v r = -v max λ B v r =0 A C λ s v s Beobachter B Abb.1: Bahnbewegung eines spektroskopischen Doppelsterns und Spektrum (in Anlehnung an [7]) 3
4 Zunächst wird eine Spektrallinie mit der Laborwellenlänge λ 0 durch die Bewegung des gesamten Systems relativ zum Beobachter mit der Geschwindigkeit v s (im dargestellten Fall auf den Beobachter zu) zu kürzeren Wellenlängen verschoben. Diese Linienverschiebung wird durch die periodisch veränderliche Bewegung der hier farblich unterschiedlich dargestellten Einzelkomponenten relativ zum Beobachter überlagert. So werden in den Stellungen A und C, in denen sich jeweils eine Komponente auf den Beobachter zu bzw. von ihm weg bewegt, die Linien dieser Komponenten zu kürzeren bzw. längeren Wellenlängen verschoben. Bei etwa gleichen Helligkeiten wird eine Linienaufspaltung mit der Wellenlängendifferenz λ sichtbar. In der Stellung B sind die radialen Geschwindigkeitsanteile v r der Komponenten jeweils Null und es kommt zu keiner Linienaufspaltung. Gegenüber der Laborwellenlänge der Spektrallinie bleibt lediglich die durch die Relativbewegung des Gesamtsystems zum Beobachter verursachte Linienverschiebung λ 0 zu λ s bestehen. Aus dem Betrag der Wellenlängendifferenz bei der maximalen Linienaufspaltung λ max kann nach Gleichung (1) der maximale radiale Geschwindigkeitsanteil v r max der Einzelkomponenten bzw. die Radialgeschwindigkeitsdifferenz beider Komponenten errechnet werden. Gleichung (1): v r max = ½ ( λ max * c/λ) bzw. v r max = 2 v r max = ( λ max * c/λ) Ziel der praktischen Beobachtung ist die Ermittlung von λ bzw. v r zu möglichst vielen Zeitpunkten, um letztlich die Radialgeschwindigkeit v r über die Zeit t aufzutragen und somit eine Radialgeschwindigkeits-Zeit-Kurve zu erhalten. Aus der so erhaltenen Radialgeschwindigkeits-Zeit-Kurve lassen sich für ein Zwei- Komponenten-System dann (im Idealfall, Inklination i = 90 ) Aussagen zur mittleren Bahngeschwindigkeit v r der Einzelkomponenten in der Sichtebene des Beobachters (Gleichung (1)), zur Umlaufperiode T der Komponenten um den gemeinsamen Schwerpunkt, zum Bahnradius r (nach Gleichung (2)), zum Massenverhältnis m A :m B der Komponenten (nach Gleichung (3)) sowie zur Gesamtmasse des Systems m A +m B (nach Gleichung (4)) treffen. Gleichung (2): r A = v ra * T wenn i = 90 und Kreisbahn 2π r A = v ra * T sinx * 2π wenn i = x und Kreisbahn Gleichung (3): m A : m B = r B : r A Gleichung (4): m A + m B = 4π² *(r A + r B )³ G * T². v r : Radialgeschwindigkeit in km/s i. Inklinationswinkel zwischen Bahn- und Tangentialebene in m A und m B : Massen der Komponenten A und B in m r A und r B : Sternradien der Komponenten A und B in r T : Umlaufperiode in d 4
5 Aber auch hinsichtlich der Bahnexzentrizität e und des Periastronwinkels ω, der u.a. die Lage der Bahn im Raum beschreibt, kann die Radialgeschwindigkeits-Zeit-Kurve wertvolle Aufschlüsse geben. In Abb. 2 ist beispielhaft die Abhängigkeit des Aussehens der Radialgeschwindigkeits-Zeit-Kurve allein von diesen beiden Parametern dargestellt. Es wird dabei deutlich, dass Radialgeschwindigkeits-Zeit-Kurven nicht unbedingt symmetrisch sein müssen und dass sich die Bewegung einer Komponente nahe des gemeinsamen Schwerpunktes (bei großer Bahnexzentrizität) zeitgleich mit der maximalen Bewegung vom Beobachter weg (oder zum Beobachter hin) zu maximalen Radialgeschwindigkeitsbeträgen addieren können (siehe Abb. 2, rechts oben). In der Realität wird das Erscheinungsbild dieser Kurve aber noch von weiteren Parametern beeinflusst. Eine Vorstellung, in welcher Weise die Radialgeschwindigkeits-Zeit-Kurve in einem Zwei-Komponenten-System von den beiden Sternmassen, dem Abstand der Sterne voneinander, der Bahnexzentrizität, dem Inklinationswinkel und dem Knotenwinkel abhängt, vermittelt in sehr anschaulicher Weise das Modellierungsprogramm ORBITING BINARY STARS von Terry Herter [5]. Abb. 2: Einfluss von Exzentrizität e und Periastronwinkel ω auf die Radialgeschwindigkeits-Zeit-Kurve (aus H.H. Voigt: Abriss der Astronomie [4]) 2. Spektroskopische Beobachtungen an β Aurigae Das Doppelsternsystem β Aurigae ist in vielfacher Weise besonders gut für den Anfänger der spektroskopischen Doppelsternbeobachtung geeignet. β Aurigae ist ein Zwei-Komponenten- System vom Spektraltyp A2 mit zwei annähernd gleich großen (r A = 2,77 r, r B = 2,63 r ), etwa gleich schweren (m A = 2,38 m, m B = 2,31 m ) und (wegen des geringen Abstandes voneinander) nahezu gleich hellen Einzelkomponenten [2]. Letzteres lässt erwarten, dass im Spektrum auch die Linien beider Komponenten gleichberechtigt sichtbar werden. Das gesamte System, das sich mit - 18 km/s [8] auf uns zu bewegt, ist von der Erde etwa 24,8 pc [2] entfernt. Es besitzt eine scheinbare Helligkeit von 1, m 9 und ist damit auch für Besitzer kleinerer Fernrohre leicht zu spektroskopieren. Beide Einzelkomponenten umkreisen einen gemeinsamen Schwerpunkt auf einer kreisrunden Bahn (e = 0, [3]) mit einer Periode von 3, d [6]. Wegen des Inklinationswinkels der Bahnebene zur Tagentialebene von 76,71 [2] entspricht 5
6 der radiale (aus dem Spektrum ableitbare) Anteil der Bahngeschwindigkeit annähernd der tatsächlichen Bahngeschwindigkeit. Die beschriebene Konstellation des Systems lässt für jede Komponente eine um 180 verschobene, symmetrische Radialgeschwindigkeits-Zeit-Kurve der in Abb.2 oben links dargestellten Form erwarten. Die in der Literatur angegebene maximale Linienaufspaltung v r, die jeweils in den Phasen 0,25 und 0,75 erreicht wird, beträgt 217,92 km/s [3] bzw. 219 km/s [2]. In Abb. 3 sind einzelne spektroskopische Beobachtungen des Systems β Aurigae im Bereich der K-Linie des einfach ionisierten Kalziums bei 3934 Ǻ bei verschiedenen Phasen (P) dargestellt. Die Spektren wurden jeweils im Frühjahr 2005 und 2006 mit einem Objektivprismenspektrografen (Zeiss Meniscas 180/1800 mit einem vorgesetzten 45 -BK2- Prisma von 120 mm Kantenlänge auf Ilford Delta 400 plus und KODAK T MAX 400 aufgenommen. Die Dispersion betrug bei der K-Linie 42 Ǻ/mm. In Abhängigkeit von der Phase werden die Aufspaltung der Linie um die Phase 0,75 bzw. die fehlende Aufspaltung (scharfe Linie) um die Phasen 0 und 0,5 sichtbar. Verglichen mit den benachbarten starken Balmerlinien Hε und Hζ eignet sich die wesentlich schärfere K-Linie, die bei einem A 2-Stern dennoch die Bahnbewegungen der Komponenten widerspiegelt, für derartige Beobachtungen besser. K-Linie bei 3934 Ǻ JD ,31 P = 0,36 JD ,35 P = 0,48 JD ,31 P = 0,61 JD ,31 P = 0,76 JD ,31 P = 0,82 JD ,31 P = 0,07 Abb.3: Aufspaltung der K-Linie bei β Aurigae als Nachweis der Doppelsternnatur des Systems Die für den jeweiligen Aufnahmezeitpunkt gültigen Phasen wurden anhand der Daten für das Minimum HJD = ,7269 und der Periodendauer von 3, d [6] berechnet. 6
7 Weiterhin wurde das Spektrum mit der größten sichtbaren Linienaufspaltung (JD ,31; P=0,76) im Bereich der K-Linie gescannt und wellenlängennormiert (siehe Abb. 4), um aus der Wellenlängendifferenz der Absorptionsmaxima der aufgespaltenen K-Linie die Radialgeschwindigkeitsdifferenz der Komponenten zu berechnen und mit den Literaturwerten (217,92 km/s [3] bzw. 219 km/s [2]) zu vergleichen. Die so erhaltene Wellenlängendifferenz der aufgespaltenen K-Linie beträgt 2,8 Ǻ. Dies entspricht nach Gleichung (1) einer Radialgeschwindigkeitsdifferenz von 213 km/s, die im dargestellten Fall recht gut mit den Literaturwerten übereinstimmt. Insgesamt gesehen muss aber für die Radialgeschwindigkeitsbestimmung unter den beschriebenen Bedingungen (unvollständige Linientrennung bei relativ geringer Dispersion, spaltlose Aufnahmetechnik) von einem (abgeschätzten) Fehler von etwa 20 % ausgegangen werden. β Aurigae JD ,31 P = 0,76 Ca II 3933,67 Å 3932,8 Å 3935,6 Å H ζ 3889,06 Å Hε 3970,07 Å Abb. 4: Spektrum von β Aurigae im Bereich der K-Linie zum Zeitpunkt der maximalen Linienaufspaltung Die dargestellten Beobachtungen zeigen, dass die Beobachtung spektroskopischer Doppelsterne durchaus auch ein Arbeitsgebiet des Amateurs mit einfacher Ausrüstung sein kann. Eine Auflistung von 53 spektroskopischen Doppelsternen heller als 4, m 0 und nördlich von - 40 Deklination ist [3] dargestellt. Allerdings sollte die Auswahl geeigneter Beobachtungsobjekte zu Übungszwecken nach sorgfältiger Planung und unter Berücksichtigung folgender Fragen erfolgen: 7
8 1. Wie groß ist der Helligkeitsunterschied der Komponenten? 2. Wie groß ist die maximal zu erwartende Aufspaltung λ? Reicht die Dispersion des Spektrografen? 3. Wie groß sind Periode und Bahnexzentrizität, d.h., wie viele Spektren sind zu welcher Zeit erforderlich? 4. Wie genau kann die Wellenlängenkalibration erfolgen? Literatur: [1] Weigert/Zimmermann, Brockhaus ABC Astronomie, 5. Aufl., Brockhaus Verlag Leipzig, 1977, S. 285 f. [2] Nordström B., Johansen K.T.; Radii and masses for β Aurigae, Astron. Astrophys., 291, (1994) [3] Ahnert P., Kleine praktische Astronomie, Johann Ambrosius Barth Leipzig, S. 103 [4] Voigt, H.H., Abriss der Astronomie, 1980 [5] [6] Johansen K.T., Sörensen H.; Times of minimum for AR Aur and β Aur and a new period determination for β Aurigae; Commissions 27 and 42 of the IAU Information Bulletin on variable stars, Number 4533 (1997) [7] [8] The Bright Star Catalogue, 5th Revised Ed. (preliminary version) Hoffleit+, 1991), 8
9 Bericht zur Teilnahme an der Stern Party für Astrophysik am Observatorium de Haute Provence (St. Michel) (von Ernst Pollmann) Unsere spektroskopierenden französischen Nachbarn von der ARAS-Gruppe veranstalteten vom 20. bis zum 24. August ihre dritte Sternparty für Astrophysik in den Räumlichkeiten und des nachts auf dem Gelände des Observatoriums de Haute Provence (St. Michel). Das OHP aus der Ferne gesehen (Aufnahme: Ulrich Diehl) Teilansicht zweier Observatorien mit Blick auf St. Michel (Aufnahme: Ulrich Diehl) 9
10 Diese Sternparty ist gestaltet von Amateuren für Amateure die sich für die Spektroskopie unter wissenschaftlicher Zielsetzung interessieren. Die Mehrzahl der über dreißig Teilnehmer ist mit dem Auto und somit mit ihrem eigenen Equipment, d.h. Teleskop und Spektrograph angereist. Insgesamt waren die Nationen Costa Rica, Portugal, England, Italien, Frankreich und mit unserem FG-Mitglied Hugo Kalbermatten ein Teilnehmer aus der Schweiz, sowie Ulrich Diel und ich aus Deutschland vertreten. Selbst ohne eigenes Equipment bestand die Möglichkeit an anderen Ausrüstungen praktisch mitzuarbeiten. wie etwa Hugo bei der Spektrenaufnahme an Olivier Thizy s Instrument Diese dritte Party wurde gestaltet aus dem Erkenntnisgewinn und dem feedback früherer Veranstaltungen. Thematisch nahm erwartungsgemäß die Anwendung des Spektrographen LHIRES III bzw. der nächtliche praktische Umgang am Teleskop, aber auch die Anwendung verschiedener Spektrenverarbeitungsprogramme wie VSPEC, IRIS, SPIRIS und SPCAUDACE einen großen Raum ein. Darüber hinaus wurden aber auch Präsentationen zum Thema bisherige Erfahrungen bei der aktiven Beobachtung verschiedener Objekte veranstaltet. Das Tagungsprogramm von Montag bis Freitag sah im Einzelnen wie folgt aus: Montag: Dienstag: Begrüßung, Einteilung in Gruppenprojekte, Auswahl der wissenschaftlichen Themen, Hinweise zur Spektrengewinnung, Software setup, Geschichte der Spektroskopie, OHP Besichtigung, Nachbeobachtungen. Workshop und Übersicht über die verfügbaren Spektrographen; Be-Sterne und BeSS-Datenbank; Workshop zur Spektrenverarbeitung; Nachtvorbereitungen und Überblick über die Ergebnisse der Vornacht, Nachtbeobachtungen. 10
11 Francois Cochard erläutert das Datenbankprojekt BeSS Mittwoch: Workshop Spektralanalyse; Spektrenbearbeitung und Projekte. Vortrag Jose Ribeiro (Portugal): Spektroheliographie Vortrag Ernst Pollmann: Vorstellung der VdS-Spektroskopie-Gruppe und Ergebnisse aus 10 Jahren spektroskopischer Beobachtung. Vortrag Robin Leadbeater (England): Entwicklung eines niedrigdispersiven Star-Analysers mit Ergebnispräsentation Den Anfang der Vortragsreihe machte Jose Ribeiro, er präsentierte seine Ergebnisse zur LIHRES-Spektroheliographie. 11
12 .gefolgt von mir, mit meiner Ergebnispräsentation aus eigenen Beobachtungen der letzten 10 Jahre verbunden mit der Vorstellung der VdS-Spektroskopiegruppe..und schließlich Robin Leadbeater zur Entwicklung seines niedrigdispersiven Star-Analysers mit Ergebnispräsentation. Donnerstag: Ergebnispräsentation der Projektgruppen, Fachvortrag eines professionellen OHP-Astronomen zur spektroskopischen Entdeckung von Exo-Planeten, Nachtbeobachtungen. 12
13 Freitag: Abschlußbesprechung in großer Runde, zukünftige Intensivierung der Zusammenarbeit, feedback und Vorschläge für die Sternparty Nachtbeobachtungen. Der Wissensdurst, wie Spektren nach welchen Kriterien zu interpretieren und auszuwerten sind, ist bei den Teilnehmern enorm gewesen. Aus persönlichen Gesprächen konnte ich entnehmen, dass es ein starkes Anliegen der Veranstalter ist, die derzeitige Amateurspektroskopie der ARAS-Gruppe in Frankreich langfristig in Zusammenarbeit mit unserer VdS-Gruppe auf eine europäische Ebene überzuführen, um auf diese Weise auch die Aktivitäten in anderen europäischen Ländern stärker in gemeinschaftliche, zukunftsorientierte Zielsetzungen miteinzubeziehen. Für mich ergibt sich daraus die Frage, in welcher Weise unsere VdS-Gruppe an dieser Zielsetzung de facto mitwirken kann. Gruppenfoto aller Teilnehmer des OHP-Meetings Die Präsentationen zu den oben genannten Anwendungsprogrammen zeigten deutlich, dass die MIDAS-Philosophie, so wie sie in unserer Gruppe bevorzugt vorangetrieben wird, in der ARAS-Gruppe ganz offensichtlich keine Rolle spielt. Außerdem scheinen die Mentoren des Meetings die Beobachtung von Be-Sternen als vorrangig zu betrachten. Ich habe den Eindruck, dass dies wesentlich mit dem Mitwirken von Coralie Neiner (Be-Stern-Forscherin am Observatorium Paris-Meudon) in der französischen Gruppe zusammenhängt. Dieser Eindruck bestätigt sich u.a. anlässlich einer abendfüllenden Präsentation zum Thema BeSS-Datenbank Die detailierten Erläuterungen zu Anforderungskriterien zum upload von Spektren in BeSS, war unangebracht, weil die Mehrzahl der Teilnehmer gerade einmal den Einstieg in die Spektroskopie über die Anwendung des LIHES-Spektrographen vollzogen hat. Außerdem scheint es so zu sein, daß beispielsweise niedrigdispersive Beobachtungen, mit der Zielsetzung etwa der Spektralklassifikation kaum gefördert werden. Umso erstaunlicher war, dass der Vortrag von Robin Leadbeater mit Präsentation von Ergebnissen aus niedrigdispersiver Spektroskopie diverser Objekte (Veränderliche, Novae u.a.) eine ungewöhnlich starke Beachtung fand. 13
14 Theoretischen Grundlagen, wie sie in unserer Gruppe deutlich intensiver diskutiert und vermittelt werden, überlässt man seitens der Mentoren fast ausschließlich jedem selbst. Dies scheint mir ein wesentlicher Unterschied in der philosophischen Arbeit unserer Gruppen zu sein. Francios Cochard teilte mir in einem ausführlichen Gespräch seine Erwartungshaltung hinsichtlich der Akzeptanz zur Datenbank BeSS mit. Er hatte sich bereits jetzt schon eine stärkere Annahme dieser Datenspeicherung von Ergebnissen an Be-Sternen in unserer FG erhofft. Ich konnte ihm lediglich darauf erwidern, dass z.zt. die BeSS-Akteptanz noch eher eine persönlich, individuelle Angelegenheit bei einzelnen Beobachtern ist. Der tiefere Sinn der Einrichtung ist bis jetzt zumindest in unserer Gruppe noch nicht richtig angekommen. Ich habe vorgeschlagen, auf unserer nächsten Tagung Mai 2008 in Heidelberg eine Kurzpräsentation für effektiv interessierte Teilnehmern anzubieten. Ganz allgemein habe ich den Eindruck, dass die Begeisterung zur spektroskopischen Beobachtung doch größer ist als bei uns. Dies liegt möglicherweise daran, dass sämtliche Spektrenbearbeitungsprogramme in französischer Sprache verfasst sind, aber auch daran, dass eine intensive Betreuung beim Umgang bzw. bei der Anwendung durch kompetente Beratung durch Valerie Desnoux, Christain Buil und Francois Cochard angeboten worden ist. Diese Verteilung der Beratungs- und Betreuungsarbeit ist intensiv durch die Teilnehmer genutzt worden. Ob eine solche Form einer mehrtägigen Beratungstagung auf unsere Verhältnisse zu übertragen ist, erscheint fraglich. Eine Umfrage diesbezüglich in unserer FG erscheint mir auf jedenfalls sinnvoll. Nach einer sehr offenen Unterhaltung mit Hugo und Ulrich hinsichtlich der Frage, was aus dem unbestreitbaren Erfolg des OHP-Meetings zum Nutzen unserer Gruppe übernommen werden könnte, wäre nach Hugos Einschätzung die nahezu ausschließliche praktisch Ausrichtung der Veranstaltung. Fragen, die sich aus der praktischen Auseinandersetzung mit der Spektrengewinnung und der Spektrenbearbeitung ergeben, konnten direkt im Austausch mit anderen Teilnehmern sowie durch unmittelbare kompetente Betreuung beantwortet werden. Durch diese Art der individuellen Auseinandersetzung verbunden mit dem Erfolgserlebnis der Lösung/Klärung individueller/persönlicher Fragen, scheint ein höherer Motivationsgrad für die eigene praktische Tätigkeit erreicht zu werden als bei unserer Veranstaltungsform mit Vorträgen. Andererseits ist eine 1:1 Übertragung auf unsere deutschen Verhältnisse nicht so ohne weiteres möglich. Z.B. hat im Monat August ganz Frankreich Urlaub, was erklärt, dass die OHP- Veranstaltung so gut besucht worden war. Für mich stellt sich dennoch die Frage, in welcher Weise, wir durch Veränderungen in der inhaltlichen Ausgestaltung unserer Tagungen einen höheren Motivationsgrad als bisher erzielen können. Die Vertiefung persönlicher Kontakte war mir beim Besuch des OHP-Meetings ein besonderes Anliegen. Die vier Hauptakteure Valerie Desnoux, Christian Buil, Olivier Thizy und Francois Cochard, nach Jahren schriftlicher -korrespondenz nun in persona kennenzulernen, hat mit sehr gefallen. Deshalb hier einige Fotos meiner neuen Freunde. 14
15 Olivier Thizy Francois Cochard Christian Buil, Valerie Desnoux 15
16 Ankündigung Jahrestagung der VdS-Fachgruppe Spektroskopie 2008 (von Ernst Pollmann) Die nächste Tagung der VdS-Fachgruppe Spektroskopie findet vom Mai 2008 in den Räumlichkeiten der Landesternwarte Heidelberg statt. Herrn Dr. Otmar Stahl von der LSW und Mitglied der Fachgruppe, möchte ich bereits jetzt schon an dieser Stelle meinen herzlichen Dank für seine dankenswerten Bemühungen aussprechen, dass die Jahrestagung 2008 auf dem Gelände dieser ehrwürdigen astronomischen Forschungsstätte veranstaltet werden kann. Die Verbundenheit der FG Spektroskopie zur LSW-Heidelberg geht bereits bis auf die frühen Anfangsjahre unserer FG zurück. Dr. Stahl, Dr. Andreas Kaufer (ESO) und Dr. Thomas Rivinius (ESO), letztere ebenfalls Mitglieder der FG und ehemalige Mitarbeiter der LSW, standen in den unterschiedlichsten astrospektroskopischen Belangen der FG viele Jahre gewissermaßen als Beraterteam zu Seite. Ohne diese fachkompetente, oftmals sehr individuelle Hilfe und beratende Unterstützung wäre die FG Spektroskopie nicht das, was sie heute ist. Nach wie vor können wir auch heute noch in fachlichen Angelegenheiten unserer astrospektroskopischen Tätigkeit der Unterstützung und Beratung durch Herrn Dr. Stahl gewiss sein. Wie im Rahmen unserer Tagungen üblich, werden wir Freitagabend ( ) ein erstes gemütliches Beisammensein bereits eingetroffener Tagungsteilnehmer im Hotel Molkenkur, Klingenteichstraße 31, Heidelberg (Telefon: ; Fax: ; veranstalten. An den beiden darauf folgenden Tagen (Samstag und Sonntag) werden dort auch die gemeinsamen Mittag- und Abendessen eingenommen. Ein Zimmerkontingent von 8 (leider nur) Doppelzimmern (zum Preis von 104 incl. Frühstück) konnte für Tagungsteilnehmer reserviert werden. 16
17 Das beabsichtigte Tagungsprogramm wird bei freier Themenwahl Vorträge aus dem Kreis der FG wie auch aus der professionellen Astronomie beinhalten. Ich möchte deshalb an dieser Stelle an die Mitglieder unserer Fachgruppe die Bitte richten, aktiv mit Beiträgen aus der eigenen, individuellen Beobachtungspraxis oder aus sonstigen praktisch/theoretisch, spektroskopisch orientierten Tätigkeitsbereichen, wie etwa Instrumenten- /Gerätebau oder auch Fragen zur Meßsicherheit bei der Spektrenauswertung zur Programmgestaltung beizutragen. Auch sind natürlich wieder Posterausstellungen und Gerätedemonstrationen geplant, an denen sich jedermann beteiligen kann. In diesem Sinne möchte ich Sie ermuntern, eigene Beobachtungen, Ideen, Vorstellungen oder Selbstbaugerätschaften vorzustellen. Der Tagungsbeitrag wird 7,- betragen. Konkrete Informationen mit verbindlichen Details zur Tagung werden gegen Ende diesen Jahres bekannt gegeben. 17
Doppler-Effekt und Bahngeschwindigkeit der Erde
 Astronomisches Praktikum Aufgaben für eine Schlechtwetter-Astronomie U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen Doppler-Effekt und Bahngeschwindigkeit der Erde 1 Einleitung Nimmt man im Laufe eines Jahres
Astronomisches Praktikum Aufgaben für eine Schlechtwetter-Astronomie U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen Doppler-Effekt und Bahngeschwindigkeit der Erde 1 Einleitung Nimmt man im Laufe eines Jahres
Radialgeschwindigkeitsvariation bei Exoplaneten - dargestellt mit Geogebra 1
 Form der Radialgeschwindigkeitskurve 1 Radialgeschwindigkeitsvariation bei Exoplaneten - dargestellt mit Geogebra 1 Exoplanetensuche mit der Radialgeschwindigkeitsmethode Die Radialgeschwindigkeit v r
Form der Radialgeschwindigkeitskurve 1 Radialgeschwindigkeitsvariation bei Exoplaneten - dargestellt mit Geogebra 1 Exoplanetensuche mit der Radialgeschwindigkeitsmethode Die Radialgeschwindigkeit v r
Beobachtung von Exoplaneten durch Amateure von Dr. Otmar Nickel (AAG Mainz)
 Beobachtung von Exoplaneten durch Amateure von Dr. Otmar Nickel (AAG Mainz) 25.6.2012 Seit der ersten Entdeckung eines Planeten um einen Stern außerhalb unseres Sonnensystems (1995) sind bereits über 400
Beobachtung von Exoplaneten durch Amateure von Dr. Otmar Nickel (AAG Mainz) 25.6.2012 Seit der ersten Entdeckung eines Planeten um einen Stern außerhalb unseres Sonnensystems (1995) sind bereits über 400
Messung der Astronomischen Einheit durch Spektroskopie der Sonne
 Astronomisches Praktikum Aufgaben für eine Schlechtwetter-Astronomie U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen Messung der Astronomischen Einheit durch Spektroskopie der Sonne (mit Lösungen) 1 Einleitung
Astronomisches Praktikum Aufgaben für eine Schlechtwetter-Astronomie U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen Messung der Astronomischen Einheit durch Spektroskopie der Sonne (mit Lösungen) 1 Einleitung
Spektren von Himmelskörpern
 Spektren von Himmelskörpern Inkohärente Lichtquellen Tobias Schulte 25.05.2016 1 Gliederung Schwarzkörperstrahlung Spektrum der Sonne Spektralklassen Hertzsprung Russell Diagramm Scheinbare und absolute
Spektren von Himmelskörpern Inkohärente Lichtquellen Tobias Schulte 25.05.2016 1 Gliederung Schwarzkörperstrahlung Spektrum der Sonne Spektralklassen Hertzsprung Russell Diagramm Scheinbare und absolute
Der Tanz der Jupiter-Monde
 T.H. Der Tanz der Jupiter-Monde V1.1 Thomas Hebbeker 27.10.2012 Motivation Messung der Bahndaten der 4 Galileischen Jupitermonde Umlaufzeiten, Bahnradien Überprüfung des III. Keplerschen Gesetzes Berechnung
T.H. Der Tanz der Jupiter-Monde V1.1 Thomas Hebbeker 27.10.2012 Motivation Messung der Bahndaten der 4 Galileischen Jupitermonde Umlaufzeiten, Bahnradien Überprüfung des III. Keplerschen Gesetzes Berechnung
Eigenbewegung und Parallaxe von Barnards Pfeilstern (mit Lösungen)
 Astronomisches Praktikum Aufgaben für eine Schlechtwetter-Astronomie U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen Eigenbewegung und Parallaxe von Barnards Pfeilstern (mit Lösungen) 1 Einleitung Der Parallaxeneffekt
Astronomisches Praktikum Aufgaben für eine Schlechtwetter-Astronomie U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen Eigenbewegung und Parallaxe von Barnards Pfeilstern (mit Lösungen) 1 Einleitung Der Parallaxeneffekt
P r o t o k o l l: P r a k t i s c h e A s t r o n o m i e
 Praktische Astronomie Sommersemester 08 Klaus Reitberger csaf8510@uibk.ac.at 0516683 P r o t o k o l l: P r a k t i s c h e A s t r o n o m i e von Klaus Reitberger 1 1 Zusammenfassung Ein Teil der Vorlesung
Praktische Astronomie Sommersemester 08 Klaus Reitberger csaf8510@uibk.ac.at 0516683 P r o t o k o l l: P r a k t i s c h e A s t r o n o m i e von Klaus Reitberger 1 1 Zusammenfassung Ein Teil der Vorlesung
T.Hebbeker T.H. V1.0. Der Tanz der Jupiter-Monde. oder. Auf den Spuren Ole Rømers
 T.H. Der Tanz der Jupiter-Monde V1.0 oder Auf den Spuren Ole Rømers Thomas Hebbeker 25.06.2012 Motivation Messung der Bahndaten der 4 Galileischen Jupitermonde Umlaufzeiten, Bahnradien Überprüfung des
T.H. Der Tanz der Jupiter-Monde V1.0 oder Auf den Spuren Ole Rømers Thomas Hebbeker 25.06.2012 Motivation Messung der Bahndaten der 4 Galileischen Jupitermonde Umlaufzeiten, Bahnradien Überprüfung des
YY Boo, ein durch Zufall entdeckter Bedeckungsveränderlicher mit Pulsationskomponente
 YY Boo, ein durch Zufall entdeckter Bedeckungsveränderlicher mit Pulsationskomponente F.-J. (Josch) Hambsch und P. Wils Am 5. Februar wurde YY Boo von mir unter der Annahme beobachtet, dass ich das primäre
YY Boo, ein durch Zufall entdeckter Bedeckungsveränderlicher mit Pulsationskomponente F.-J. (Josch) Hambsch und P. Wils Am 5. Februar wurde YY Boo von mir unter der Annahme beobachtet, dass ich das primäre
Citizen Sky (und veränderliche Sterne allgemein)
 Volkssternwarte Paderborn e.v. Citizen Sky (und veränderliche Sterne allgemein) Ein Projekt auch für Schulen Referent: Heinz-Bernd Eggenstein Bild: Brian Thieme, courtesy www.citizensky.org Was Sie jetzt
Volkssternwarte Paderborn e.v. Citizen Sky (und veränderliche Sterne allgemein) Ein Projekt auch für Schulen Referent: Heinz-Bernd Eggenstein Bild: Brian Thieme, courtesy www.citizensky.org Was Sie jetzt
Einführung in die Astronomie
 Einführung in die Astronomie Teil 2 Peter H. Hauschildt yeti@hs.uni-hamburg.de Hamburger Sternwarte Gojenbergsweg 112 21029 Hamburg part2.tex Einführung in die Astronomie Peter H. Hauschildt 30/10/2014
Einführung in die Astronomie Teil 2 Peter H. Hauschildt yeti@hs.uni-hamburg.de Hamburger Sternwarte Gojenbergsweg 112 21029 Hamburg part2.tex Einführung in die Astronomie Peter H. Hauschildt 30/10/2014
JRK-Kampagne Be part of it!
 Dokumentation JRK-Kampagne 2017- Be part of it! Themen-Werkstatt 04.-06. September 2015 in Magdeburg 1 Inhaltsverzeichnis Inhalte des Workshops und Programm S. 3 JRK-Kampagnen im Rückblick S. 4 Rückblick
Dokumentation JRK-Kampagne 2017- Be part of it! Themen-Werkstatt 04.-06. September 2015 in Magdeburg 1 Inhaltsverzeichnis Inhalte des Workshops und Programm S. 3 JRK-Kampagnen im Rückblick S. 4 Rückblick
8. Die Milchstrasse Milchstrasse, H.M. Schmid 1
 8. Die Milchstrasse Die Galaxis unsere Milchstrasse ist eine grosse Spiralgalaxie (oder Scheibengalaxie) mit folgenden Parametern: Hubble Typ SBc (ausgedehnte Balkenspirale) Masse ca. 10 12 M S Anzahl
8. Die Milchstrasse Die Galaxis unsere Milchstrasse ist eine grosse Spiralgalaxie (oder Scheibengalaxie) mit folgenden Parametern: Hubble Typ SBc (ausgedehnte Balkenspirale) Masse ca. 10 12 M S Anzahl
U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen. Die Mondentfernung. (mit Lösungen)
 Astronomisches Praktikum Aufgaben für eine Schlechtwetter-Astronomie U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen 1 Einleitung Die Mondentfernung (mit Lösungen) Als Aristarch versuchte, die Sonnenentfernung
Astronomisches Praktikum Aufgaben für eine Schlechtwetter-Astronomie U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen 1 Einleitung Die Mondentfernung (mit Lösungen) Als Aristarch versuchte, die Sonnenentfernung
Erfüllt eine Funktion f für eine feste positive Zahl p und sämtliche Werte t des Definitionsbereichs die Gleichung
 34 Schwingungen Im Zusammenhang mit Polardarstellungen trifft man häufig auf Funktionen, die Schwingungen beschreiben und deshalb für den Ingenieur von besonderer Wichtigkeit sind Fast alle in der Praxis
34 Schwingungen Im Zusammenhang mit Polardarstellungen trifft man häufig auf Funktionen, die Schwingungen beschreiben und deshalb für den Ingenieur von besonderer Wichtigkeit sind Fast alle in der Praxis
Planetenschleifen mit Geogebra 1
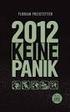 Planetenschleifen Planetenschleifen mit Geogebra Entstehung der Planetenschleifen Nach dem dritten Kepler schen Gesetz stehen die Quadrate der Umlaufzeiten zweier Planeten im gleichen Verhältnis wie die
Planetenschleifen Planetenschleifen mit Geogebra Entstehung der Planetenschleifen Nach dem dritten Kepler schen Gesetz stehen die Quadrate der Umlaufzeiten zweier Planeten im gleichen Verhältnis wie die
Bei den Planetenwegen, die man durchwandern kann, sind die Dinge des Sonnensystems 1 Milliarde mal verkleinert dargestellt.
 Distanzen und Grössen im Planetenweg Arbeitsblatt 1 Bei den Planetenwegen, die man durchwandern kann, sind die Dinge des Sonnensystems 1 Milliarde mal verkleinert dargestellt. Anders gesagt: Der Massstab
Distanzen und Grössen im Planetenweg Arbeitsblatt 1 Bei den Planetenwegen, die man durchwandern kann, sind die Dinge des Sonnensystems 1 Milliarde mal verkleinert dargestellt. Anders gesagt: Der Massstab
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Kopiervorlagen Astrophysik und astronomische Beobachtungen
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Kopiervorlagen Astrophysik und astronomische Beobachtungen Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Inhaltsverzeichnis
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Kopiervorlagen Astrophysik und astronomische Beobachtungen Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Inhaltsverzeichnis
deutschsprachige Planetarien gute Gründe, das Ereignis nicht zu verpassen
 deutschsprachige Planetarien 5 gute Gründe, das Ereignis nicht zu verpassen Der Merkurtransit 2016 - darum gibt es gute Gründe, dieses Ereignis nicht zu verpassen! 5 http:// Weitere Links (eine kleine
deutschsprachige Planetarien 5 gute Gründe, das Ereignis nicht zu verpassen Der Merkurtransit 2016 - darum gibt es gute Gründe, dieses Ereignis nicht zu verpassen! 5 http:// Weitere Links (eine kleine
Entdeckungsmethoden für Exoplaneten - Interferometrie
 Entdeckungsmethoden für Exoplaneten - Interferometrie Wiederholung: Der direkte Nachweis eines Exoplaneten (in dem er in einem Teleskop aufgelöst und von seinem Mutterstern getrennt wird) ist extrem schwierig
Entdeckungsmethoden für Exoplaneten - Interferometrie Wiederholung: Der direkte Nachweis eines Exoplaneten (in dem er in einem Teleskop aufgelöst und von seinem Mutterstern getrennt wird) ist extrem schwierig
Klassische Theoretische Physik: Elektrodynamik
 Klassische Theoretische Physik: Elektrodynamik Kaustuv Basu (Deutsche Übersetzung: Jens Erler) Argelander-Institut für Astronomie Auf dem Hügel 71 kbasu@astro.uni-bonn.de Website: www.astro.uni-bonn.de/tp-l
Klassische Theoretische Physik: Elektrodynamik Kaustuv Basu (Deutsche Übersetzung: Jens Erler) Argelander-Institut für Astronomie Auf dem Hügel 71 kbasu@astro.uni-bonn.de Website: www.astro.uni-bonn.de/tp-l
Aufgaben Astrophysik Klasse 10 Mai 2010
 Aufgaben Astrophysik Klasse 10 Mai 2010 Forschungsinstrumente und Forschungsmethoden : Stelle eine Übersicht über wichtige Instrumente der astronomischen Forschung zusammen! Fernrohre (Refraktoren, Reflektoren),
Aufgaben Astrophysik Klasse 10 Mai 2010 Forschungsinstrumente und Forschungsmethoden : Stelle eine Übersicht über wichtige Instrumente der astronomischen Forschung zusammen! Fernrohre (Refraktoren, Reflektoren),
Messung der Astronomischen Einheit nach Ole Römer
 Astronomisches Praktikum Aufgaben für eine Schlechtwetter-Astronomie U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen Messung der Astronomischen Einheit nach Ole Römer Einleitung Misst man um die Zeit der Jupiteropposition
Astronomisches Praktikum Aufgaben für eine Schlechtwetter-Astronomie U. Backhaus, Universität Duisburg-Essen Messung der Astronomischen Einheit nach Ole Römer Einleitung Misst man um die Zeit der Jupiteropposition
Eine einfache Methode zur Bestimmung des Bahnradius eines Planetoiden
 Eine einfache Methode zur Bestimmung des Bahnradius eines Planetoiden Von Eckhardt Schön Erfurt Mit 1 Abbildung Die Bewegung der Planeten und Kleinkörper des Sonnensystems verläuft scheinbar zweidimensional
Eine einfache Methode zur Bestimmung des Bahnradius eines Planetoiden Von Eckhardt Schön Erfurt Mit 1 Abbildung Die Bewegung der Planeten und Kleinkörper des Sonnensystems verläuft scheinbar zweidimensional
Der Bewohnerbeirat Wir vertreten uns selbst!
 1 6. Landesweites Treffen der Bewohnerbeiräte in Schleswig-Holstein Der Bewohnerbeirat Wir vertreten uns selbst! 07. bis 09. Juni 2011 im Seehof in Plön - in Kooperation mit dem Institut für berufliche
1 6. Landesweites Treffen der Bewohnerbeiräte in Schleswig-Holstein Der Bewohnerbeirat Wir vertreten uns selbst! 07. bis 09. Juni 2011 im Seehof in Plön - in Kooperation mit dem Institut für berufliche
Selbstbeobachtungstagebuch
 Ihr Tagebuch verschafft Ihnen einen genauen Überblick über den Verlauf Ihrer n Tragen Sie ein, wie Sie diese Empfindung,, nach, und erleben. Notieren Sie unbedingt, was Ihre Körperempfindung jeweils beeinflusst
Ihr Tagebuch verschafft Ihnen einen genauen Überblick über den Verlauf Ihrer n Tragen Sie ein, wie Sie diese Empfindung,, nach, und erleben. Notieren Sie unbedingt, was Ihre Körperempfindung jeweils beeinflusst
QY Cas und EF Cnc - zwei besondere RRc-Sterne QY Cas and EF Cnc - two very spezial RRc stars
 QY Cas und EF Cnc - zwei besondere RRc-Sterne QY Cas and EF Cnc - two very spezial RRc stars Gisela Maintz Abstract : CCD observations of QY Cas (RA = 23:59:05.15, DE = +54:01:00.70) and EF Cnc (RA = 08:40:38.82,
QY Cas und EF Cnc - zwei besondere RRc-Sterne QY Cas and EF Cnc - two very spezial RRc stars Gisela Maintz Abstract : CCD observations of QY Cas (RA = 23:59:05.15, DE = +54:01:00.70) and EF Cnc (RA = 08:40:38.82,
Einführung in die Astronomie und Astrophysik I
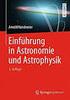 Einführung in die Astronomie und Astrophysik I Teil 5 Jochen Liske Hamburger Sternwarte jochen.liske@uni-hamburg.de Themen Einstieg: Was ist Astrophysik? Koordinatensysteme Astronomische Zeitrechnung Sonnensystem
Einführung in die Astronomie und Astrophysik I Teil 5 Jochen Liske Hamburger Sternwarte jochen.liske@uni-hamburg.de Themen Einstieg: Was ist Astrophysik? Koordinatensysteme Astronomische Zeitrechnung Sonnensystem
Verantwortung des Vorgesetzten für Brandschutz
 Verantwortung des Vorgesetzten für Brandschutz TT.MM.JJJJ Referentenunterlage Für Unternehmer/Vorgesetzte ist im täglichen Betriebsablauf das Produktionsergebnis von hoher Priorität. In der Regel sind
Verantwortung des Vorgesetzten für Brandschutz TT.MM.JJJJ Referentenunterlage Für Unternehmer/Vorgesetzte ist im täglichen Betriebsablauf das Produktionsergebnis von hoher Priorität. In der Regel sind
Umlaufzeit: 75.5 Jahre Letzter Periheldurchgang: Inklination (Winkel zw. Ekliptik und Bahnebene) Länge des aufsteigenden Knotens
 (ORI) Aktivitätszeitraum: 02. Oktober 07. November Maximum: λ = 208 (~21. Oktober) Radiant: α = 06h 20min (95 ) δ = +16 Stündliche Zenitrate: ZHR max = 20 (bezogen auf Zenit und Grenzhelligkeit +6.5 mag)
(ORI) Aktivitätszeitraum: 02. Oktober 07. November Maximum: λ = 208 (~21. Oktober) Radiant: α = 06h 20min (95 ) δ = +16 Stündliche Zenitrate: ZHR max = 20 (bezogen auf Zenit und Grenzhelligkeit +6.5 mag)
Beispiel. Schriftliche Prüfung zur Aufnahme in Klassenstufe 7 eines Gymnasiums mit vertiefter mathematisch-naturwissenschaftlicher Ausbildung
 Beispiel Schriftliche Prüfung zur Aufnahme in Klassenstufe 7 eines Gymnasiums mit vertiefter mathematisch-naturwissenschaftlicher Ausbildung Teil 2: Klausur Schreibe deinen Namen und deine jetzige Schule
Beispiel Schriftliche Prüfung zur Aufnahme in Klassenstufe 7 eines Gymnasiums mit vertiefter mathematisch-naturwissenschaftlicher Ausbildung Teil 2: Klausur Schreibe deinen Namen und deine jetzige Schule
Physik-Skript. Teil IV Astrophysik. Melanchthon-Gymnasium Nürnberg
 Physik-Skript Teil IV Astrophysik Melanchthon-Gymnasium Nürnberg Volker Dickel 3. überarbeitete Auflage, 2014 2. überarbeitete Auflage, 2012 1. Auflage 2011 Inhaltsverzeichnis 1. ASTRONOMISCHE BEOBACHTUNGSOBJEKTE...
Physik-Skript Teil IV Astrophysik Melanchthon-Gymnasium Nürnberg Volker Dickel 3. überarbeitete Auflage, 2014 2. überarbeitete Auflage, 2012 1. Auflage 2011 Inhaltsverzeichnis 1. ASTRONOMISCHE BEOBACHTUNGSOBJEKTE...
b.) Geschwindigkeit eines Beobachters am Äquator: Etwa Kilometer pro Stunde.
 L - Hausaufgabe Nr... Schätzen und berechnen unter vereinfachenden Annahmen Sie die Geschwindigkeit der Erde um die Sonne und eines Beobachters am Äquator ( in Kilometern ( km ) pro Stunde ( h ) ). Lösungs
L - Hausaufgabe Nr... Schätzen und berechnen unter vereinfachenden Annahmen Sie die Geschwindigkeit der Erde um die Sonne und eines Beobachters am Äquator ( in Kilometern ( km ) pro Stunde ( h ) ). Lösungs
Nachweis des Flächensatzes am Beispiels des Doppelsterns γ Virginis
 Nachweis des Flächensatzes am Beispiels des Doppelsterns γ Virginis Stefan Völker 1 1 AG Fachdidaktik Physik und Astronomie der Friedrich-Schiller-Universität Jena 1 Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen 3 1.1
Nachweis des Flächensatzes am Beispiels des Doppelsterns γ Virginis Stefan Völker 1 1 AG Fachdidaktik Physik und Astronomie der Friedrich-Schiller-Universität Jena 1 Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen 3 1.1
Astronomie Unser Sonnensystem in Zahlen
 Ausgabe 2007-10 Astronomie Unser Sonnensystem in Zahlen Seite 1. Erde, Mond, Sonne in Zahlen 2 1.1 Die Erde als Himmelskörper 2 1.2 Der Erdmond 3 1.3 Die Sonne 4 2. Unser Planetensystem 5 1. Erde, Mond,
Ausgabe 2007-10 Astronomie Unser Sonnensystem in Zahlen Seite 1. Erde, Mond, Sonne in Zahlen 2 1.1 Die Erde als Himmelskörper 2 1.2 Der Erdmond 3 1.3 Die Sonne 4 2. Unser Planetensystem 5 1. Erde, Mond,
Primzahlen Darstellung als harmonische Schwingung
 Primzahlen Darstellung als harmonische Schwingung Die natürliche Sinusschwingung wird hier in Zusammenhang mit der Zahlentheorie gebracht um einen weiteren theoretischen Ansatz für die Untersuchung der
Primzahlen Darstellung als harmonische Schwingung Die natürliche Sinusschwingung wird hier in Zusammenhang mit der Zahlentheorie gebracht um einen weiteren theoretischen Ansatz für die Untersuchung der
Das Hubble-Gesetz. J. Lietz. Physikalisches Proseminar, Der Weg zum Hubble-Gesetz Das Hubble-Gesetz Kosmologische Entfernungsbestimmungen
 J. Lietz Physikalisches Proseminar, 2013 J. Lietz Übersicht 1 Der Weg zum Hubble-Gesetz 2 3 J. Lietz Motivation Wie weit sind Galaxien und Sterne entfernt? Wie groß und wie alt ist das Universum? J. Lietz
J. Lietz Physikalisches Proseminar, 2013 J. Lietz Übersicht 1 Der Weg zum Hubble-Gesetz 2 3 J. Lietz Motivation Wie weit sind Galaxien und Sterne entfernt? Wie groß und wie alt ist das Universum? J. Lietz
Astronomische Beobachtungen und Weltbilder
 Astronomische Beobachtungen und Weltbilder Beobachtet man den Himmel (der Nordhalbkugel) über einen längeren Zeitraum, so lassen sich folgende Veränderungen feststellen: 1. Die Fixsterne drehen sich einmal
Astronomische Beobachtungen und Weltbilder Beobachtet man den Himmel (der Nordhalbkugel) über einen längeren Zeitraum, so lassen sich folgende Veränderungen feststellen: 1. Die Fixsterne drehen sich einmal
Eine Methode zur Positionsberechnung aus Relativmessungen. Von Eckhardt Schön, Erfurt
 Eine Methode zur Positionsberechnung aus Relativmessungen Von Eckhardt Schön, Erfurt Mit 4 Abbildungen Die Bewegung der Sterne und Planeten vollzieht sich für einen irdischen Beobachter scheinbar an einer
Eine Methode zur Positionsberechnung aus Relativmessungen Von Eckhardt Schön, Erfurt Mit 4 Abbildungen Die Bewegung der Sterne und Planeten vollzieht sich für einen irdischen Beobachter scheinbar an einer
Die Bestimmung der Umlaufzeiten und Geschwindigkeiten der Jupitermonde sowie die Bestimmung der Jupitermasse
 Die Bestimmung der Umlaufzeiten und Geschwindigkeiten der Jupitermonde sowie die Bestimmung der Jupitermasse Arbeitsgemeinschaft Astronomie der Deutschen Schule Málaga Projekt Jungend forscht, Sevilla
Die Bestimmung der Umlaufzeiten und Geschwindigkeiten der Jupitermonde sowie die Bestimmung der Jupitermasse Arbeitsgemeinschaft Astronomie der Deutschen Schule Málaga Projekt Jungend forscht, Sevilla
Computational Astrophysics 1. Kapitel: Sonnensystem
 Computational Astrophysics 1. Kapitel: Sonnensystem Wilhelm Kley Institut für Astronomie & Astrophysik Kepler Center for Astro and Particle Physics Sommersemester 2011 W. Kley: Computational Astrophysics
Computational Astrophysics 1. Kapitel: Sonnensystem Wilhelm Kley Institut für Astronomie & Astrophysik Kepler Center for Astro and Particle Physics Sommersemester 2011 W. Kley: Computational Astrophysics
Veranstaltungen im Kunsthaus Bregenz im Rahmen der Ausstellung Jean-Marc Bustamante -beautifuldays-" (29. Jänner bis 19.
 Kunsthaus Bregenz Veranstaltungen im Kunsthaus Bregenz im Rahmen der Ausstellung Jean-Marc Bustamante -beautifuldays-" (29. Jänner bis 19. März 2006) Aktuelle Termine, Veranstaltungen, Vorträge und Aktivitäten
Kunsthaus Bregenz Veranstaltungen im Kunsthaus Bregenz im Rahmen der Ausstellung Jean-Marc Bustamante -beautifuldays-" (29. Jänner bis 19. März 2006) Aktuelle Termine, Veranstaltungen, Vorträge und Aktivitäten
Wie das unsichtbare Infrarotweltall seine Geheimnisse Preis gibt Cecilia Scorza
 Wie das unsichtbare Infrarotweltall seine Geheimnisse Preis gibt Cecilia Scorza Einen großen Teil ihrer Information über die kosmischen Objekte erhalten die Astronomen im Infrarotbereich, einem Bereich
Wie das unsichtbare Infrarotweltall seine Geheimnisse Preis gibt Cecilia Scorza Einen großen Teil ihrer Information über die kosmischen Objekte erhalten die Astronomen im Infrarotbereich, einem Bereich
Berechnung der Zeitgleichung
 Berechnung der Zeitgleichung Um eine Sonnenuhr berechnen zu können, muss man zu jedem Zeitpunkt den infallswinkel der Sonne relativ zur Äquatorebene (= Deklination δ) sowie den Winkel, um den sich die
Berechnung der Zeitgleichung Um eine Sonnenuhr berechnen zu können, muss man zu jedem Zeitpunkt den infallswinkel der Sonne relativ zur Äquatorebene (= Deklination δ) sowie den Winkel, um den sich die
Der Mond des Zwergplaneten Makemake
 Der Mond des Zwergplaneten Makemake [22. Juni] Mithilfe neuer Beobachtungen haben Astronomen bei einem von fünf Zwergplaneten [1] im äusseren Bereich unseres Sonnensystems [1] einen kleinen, lichtschwachen
Der Mond des Zwergplaneten Makemake [22. Juni] Mithilfe neuer Beobachtungen haben Astronomen bei einem von fünf Zwergplaneten [1] im äusseren Bereich unseres Sonnensystems [1] einen kleinen, lichtschwachen
Kepler sche Gesetze. = GMm ; mit v = 2rπ. folgt 3. Keplersches Gesetz
 Kepler sche Gesetze 1. 3. Keplersche Gesetz (a) Wie kann man das 3. Keplersche Gesetz aus physikalischen Gesetzen ableiten? Welche vereinfachenden Annahmen werden dazu gemacht? (b) Welche Verfeinerung
Kepler sche Gesetze 1. 3. Keplersche Gesetz (a) Wie kann man das 3. Keplersche Gesetz aus physikalischen Gesetzen ableiten? Welche vereinfachenden Annahmen werden dazu gemacht? (b) Welche Verfeinerung
Einführung in die Astronomie & Astrophysik 5.5 Extrasolare Planeten
 Einführung in die Astronomie & Astrophysik 5.5 Extrasolare Planeten Wilhelm Kley & Klaus Werner Institut für Astronomie & Astrophysik Kepler Center for Astro and Particle Physics Sommersemester 2011 Astronomie
Einführung in die Astronomie & Astrophysik 5.5 Extrasolare Planeten Wilhelm Kley & Klaus Werner Institut für Astronomie & Astrophysik Kepler Center for Astro and Particle Physics Sommersemester 2011 Astronomie
Inhaltsverzeichnis Vorwort Einleitung Kapitel 1: Sonnensystem Kapitel 2: Sterne, Galaxien und Strukturen aus Galaxien
 Inhaltsverzeichnis Vorwort Einleitung Kapitel 1: Sonnensystem Objekte des Sonnensystems Sonne Innere Gesteinsplaneten und deren Monde Asteroidengürtel Äußere Gas- und Eisplaneten und deren Monde Zentauren
Inhaltsverzeichnis Vorwort Einleitung Kapitel 1: Sonnensystem Objekte des Sonnensystems Sonne Innere Gesteinsplaneten und deren Monde Asteroidengürtel Äußere Gas- und Eisplaneten und deren Monde Zentauren
Das Jahr der Mathematik
 Das Jahr der Mathematik Eine mathematische Sammlung - kinderleicht Thomas Ferber Forschung und Lehre Sun Microsystems GmbH Die Themen 1 2 Sind die Zahlen universell? π-day 3 Die Eine Million $-Frage 4
Das Jahr der Mathematik Eine mathematische Sammlung - kinderleicht Thomas Ferber Forschung und Lehre Sun Microsystems GmbH Die Themen 1 2 Sind die Zahlen universell? π-day 3 Die Eine Million $-Frage 4
Mittel- und Oberstufe - MITTEL:
 Praktisches Arbeiten - 3 nrotationsgeschwindigkeit ( 2 ) Mittel- und Oberstufe - MITTEL: Ein Solarscope, Eine genau gehende Uhr, Ein Messschirm, Dieses Experiment kann in einem Raum in Südrichtung oder
Praktisches Arbeiten - 3 nrotationsgeschwindigkeit ( 2 ) Mittel- und Oberstufe - MITTEL: Ein Solarscope, Eine genau gehende Uhr, Ein Messschirm, Dieses Experiment kann in einem Raum in Südrichtung oder
Quasare Hendrik Gross
 Quasare Hendrik Gross Gliederungspunkte 1. Entdeckung und Herkunft 2. Charakteristik eines Quasars 3. Spektroskopie und Rotverschiebung 4. Wie wird ein Quasar erfasst? 5. Funktionsweise eines Radioteleskopes
Quasare Hendrik Gross Gliederungspunkte 1. Entdeckung und Herkunft 2. Charakteristik eines Quasars 3. Spektroskopie und Rotverschiebung 4. Wie wird ein Quasar erfasst? 5. Funktionsweise eines Radioteleskopes
Astronavigation
 Astronavigation 1. Lektion: Nordsternbreite Der Nordstern steht genau über dem Nordpol (stimmt nicht, ich weiß, aber die Differenz ignorieren wir zunächst mal). Mit einem Sextanten misst man den Winkel
Astronavigation 1. Lektion: Nordsternbreite Der Nordstern steht genau über dem Nordpol (stimmt nicht, ich weiß, aber die Differenz ignorieren wir zunächst mal). Mit einem Sextanten misst man den Winkel
P1-12,22 AUSWERTUNG VERSUCH RESONANZ
 P1-12,22 AUSWERTUNG VERSUCH RESONANZ GRUPPE 19 - SASKIA MEIßNER, ARNOLD SEILER 0.1. Drehpendel - Harmonischer Oszillator. Bei dem Drehpendel handelt es sich um einen harmonischen Oszillator. Das Trägheitsmoment,
P1-12,22 AUSWERTUNG VERSUCH RESONANZ GRUPPE 19 - SASKIA MEIßNER, ARNOLD SEILER 0.1. Drehpendel - Harmonischer Oszillator. Bei dem Drehpendel handelt es sich um einen harmonischen Oszillator. Das Trägheitsmoment,
Feedback-Bogen (Feebo)
 Feedback-Bogen (Feebo) Ein Instrument zur Prävention von Ausbildungsabbrüchen Warum ein Feedback-Bogen? Im Betriebsalltag stellen Ausbildungsabbrüche eine nicht zu unterschätzende Größe dar. Der Anteil
Feedback-Bogen (Feebo) Ein Instrument zur Prävention von Ausbildungsabbrüchen Warum ein Feedback-Bogen? Im Betriebsalltag stellen Ausbildungsabbrüche eine nicht zu unterschätzende Größe dar. Der Anteil
Formelsammlung Astronomie
 Joachim Stiller Formelsammlung Astronomie Alle Rechte vorbehalten Formelsammlung Astronomie In diesem Thread möchte ich einmal eine Formelsammlung zur Astronomie für die Galerie vorinstallieren... Zunächst
Joachim Stiller Formelsammlung Astronomie Alle Rechte vorbehalten Formelsammlung Astronomie In diesem Thread möchte ich einmal eine Formelsammlung zur Astronomie für die Galerie vorinstallieren... Zunächst
Umgestaltung des deutschen Chemikalienrechts. durch europäische Chemikalienpolitik
 Institut für Europarecht - Abteilung Umweltrecht - Umgestaltung des deutschen Chemikalienrechts durch europäische Chemikalienpolitik Neunte Osnabrücker Gespräche zum deutschen und europäischen Umweltrecht
Institut für Europarecht - Abteilung Umweltrecht - Umgestaltung des deutschen Chemikalienrechts durch europäische Chemikalienpolitik Neunte Osnabrücker Gespräche zum deutschen und europäischen Umweltrecht
8 Extremwerte reellwertiger Funktionen
 8 Extremwerte reellwertiger Funktionen 34 8 Extremwerte reellwertiger Funktionen Wir wollen nun auch Extremwerte reellwertiger Funktionen untersuchen. Definition Es sei U R n eine offene Menge, f : U R
8 Extremwerte reellwertiger Funktionen 34 8 Extremwerte reellwertiger Funktionen Wir wollen nun auch Extremwerte reellwertiger Funktionen untersuchen. Definition Es sei U R n eine offene Menge, f : U R
Die Keplerschen Gesetze ==================================================================
 Die Keplerschen Gesetze ================================================================== Astronomische Daten, die bei den folgenden Berechnungen verwendet werden dürfen: Große Halbachse Sonne-Erde: 1
Die Keplerschen Gesetze ================================================================== Astronomische Daten, die bei den folgenden Berechnungen verwendet werden dürfen: Große Halbachse Sonne-Erde: 1
Abschlusstest der Unterrichtseinheit Astronomische Entfernungsbestimmung
 Abschlusstest der Unterrichtseinheit Astronomische sbestimmung Codename: Expertengruppe: 1. Vielleicht haben Sie nun eine Vorstellung über Größen und en im Sonnensystem: Stellen Sie sich vor, die Sonne
Abschlusstest der Unterrichtseinheit Astronomische sbestimmung Codename: Expertengruppe: 1. Vielleicht haben Sie nun eine Vorstellung über Größen und en im Sonnensystem: Stellen Sie sich vor, die Sonne
Satellitennavigation-SS 2011
 Satellitennavigation-SS 011 LVA.-Nr. 183.060 Gerhard H. Schildt Buch zur Vorlesung: ISBN 978-3-950518-0-7 erschienen 008 LYK Informationstechnik GmbH www.lyk.at office@lyk.at Satellitennavigation GPS,
Satellitennavigation-SS 011 LVA.-Nr. 183.060 Gerhard H. Schildt Buch zur Vorlesung: ISBN 978-3-950518-0-7 erschienen 008 LYK Informationstechnik GmbH www.lyk.at office@lyk.at Satellitennavigation GPS,
Astro Night - Programm
 Herzlich willkommen zur Astro Night Discover Freitag, 15. Juni 2012, 17:00-22:30, Universitätssternwarte Wien Ein kurzer Überblick über unser Programm. Die Vorträge () Die Universitätssternwarte Wien Von
Herzlich willkommen zur Astro Night Discover Freitag, 15. Juni 2012, 17:00-22:30, Universitätssternwarte Wien Ein kurzer Überblick über unser Programm. Die Vorträge () Die Universitätssternwarte Wien Von
Die Eigenbewegung von Barnards Stern
 Ein Beispiel für die Benutzung von virtuellen Observatorien Die Eigenbewegung von Barnards Stern Florian Freistetter, ZAH, Heidelberg florian@ari.uni-heidelberg.de Sterne sind keine Fixsterne Auch wenn
Ein Beispiel für die Benutzung von virtuellen Observatorien Die Eigenbewegung von Barnards Stern Florian Freistetter, ZAH, Heidelberg florian@ari.uni-heidelberg.de Sterne sind keine Fixsterne Auch wenn
E I N L A D U N G u n d C A L L F O R A B S T R A C T S
 E I N L A D U N G u n d C A L L F O R A B S T R A C T S 22. Arbeitstagung Experimentelle Neuroonkologie am 26. April und 27. April 2013 Kinderklinik am Johannes Wesling Klinikum Minden Sehr geehrte Frau
E I N L A D U N G u n d C A L L F O R A B S T R A C T S 22. Arbeitstagung Experimentelle Neuroonkologie am 26. April und 27. April 2013 Kinderklinik am Johannes Wesling Klinikum Minden Sehr geehrte Frau
2. Elementare Stöchiometrie I Definition und Gesetze, Molbegriff, Konzentrationseinheiten
 Inhalt: 1. Regeln und Normen Modul: Allgemeine Chemie 2. Elementare Stöchiometrie I Definition und Gesetze, Molbegriff, Konzentrationseinheiten 3.Bausteine der Materie Atomkern: Elementarteilchen, Kernkräfte,
Inhalt: 1. Regeln und Normen Modul: Allgemeine Chemie 2. Elementare Stöchiometrie I Definition und Gesetze, Molbegriff, Konzentrationseinheiten 3.Bausteine der Materie Atomkern: Elementarteilchen, Kernkräfte,
Planetenkonjunktionen, der Stern von Bethlehem und das Ende der Welt im Jahr 2012
 Ein Beispiel für die Benutzung von virtuellen Observatorien Planetenkonjunktionen, der Stern von Bethlehem und das Ende der Welt im Jahr 2012 Florian Freistetter, ZAH, Heidelberg florian@ari.uni-heidelberg.de
Ein Beispiel für die Benutzung von virtuellen Observatorien Planetenkonjunktionen, der Stern von Bethlehem und das Ende der Welt im Jahr 2012 Florian Freistetter, ZAH, Heidelberg florian@ari.uni-heidelberg.de
Ute Kraus, Spiel mit dem Schwarzen Loch 1
 Ute Kraus, Spiel mit dem Schwarzen Loch 1 Spiel mit dem Schwarzen Loch Ute Kraus Beim Spiel mit einem virtuellen Schwarzen Loch kann man in der Computersimulation mit den Auswirkungen der gravitativen
Ute Kraus, Spiel mit dem Schwarzen Loch 1 Spiel mit dem Schwarzen Loch Ute Kraus Beim Spiel mit einem virtuellen Schwarzen Loch kann man in der Computersimulation mit den Auswirkungen der gravitativen
Atombau, Elektronenkonfiguration und das Orbitalmodell:
 Bohrsches Atommodell: Atombau, Elektronenkonfiguration und das Orbitalmodell: Nachdem Rutherford mit seinem Streuversuch bewiesen hatte, dass sich im Kern die gesamte Masse befindet und der Kern zudem
Bohrsches Atommodell: Atombau, Elektronenkonfiguration und das Orbitalmodell: Nachdem Rutherford mit seinem Streuversuch bewiesen hatte, dass sich im Kern die gesamte Masse befindet und der Kern zudem
Hans Scheitter GmbH & Co.KG
 2010 Beschläge in Schmiedeeisen, Messing und Kupfer JANUAR Neujahr 01 Samstag 02 Sonntag 03 Montag 04 Dienstag 05 Mittwoch 06 Donnerstag 07 Freitag 08 Samstag 09 Sonntag 10 Montag 11 Dienstag 12 Mittwoch
2010 Beschläge in Schmiedeeisen, Messing und Kupfer JANUAR Neujahr 01 Samstag 02 Sonntag 03 Montag 04 Dienstag 05 Mittwoch 06 Donnerstag 07 Freitag 08 Samstag 09 Sonntag 10 Montag 11 Dienstag 12 Mittwoch
Astronomie für Nicht Physiker SS 2013
 Astronomie für Nicht Physiker SS 2013 18.4. Astronomie heute (Just, Fendt) 25.4. Sonne, Erde, Mond (Fohlmeister) 2.5. Das Planetensystem (Fohlmeister) 16.5. Teleskope, Instrumente, Daten (Fendt) 23.5.
Astronomie für Nicht Physiker SS 2013 18.4. Astronomie heute (Just, Fendt) 25.4. Sonne, Erde, Mond (Fohlmeister) 2.5. Das Planetensystem (Fohlmeister) 16.5. Teleskope, Instrumente, Daten (Fendt) 23.5.
Formelsammlung. Lagrange-Gleichungen: q k. Zur Koordinate q k konjugierter Impuls: p k = L. Hamilton-Funktion: p k. Hamiltonsche Gleichungen: q k = H
 Formelsammlung Lagrange-Gleichungen: ( ) d L dt q k L q k = 0 mit k = 1,..., n. (1) Zur Koordinate q k konjugierter Impuls: p k = L q k. (2) Hamilton-Funktion: n H(q 1,..., q n, p 1,..., p n, t) = p k
Formelsammlung Lagrange-Gleichungen: ( ) d L dt q k L q k = 0 mit k = 1,..., n. (1) Zur Koordinate q k konjugierter Impuls: p k = L q k. (2) Hamilton-Funktion: n H(q 1,..., q n, p 1,..., p n, t) = p k
Rotation. Versuch: Inhaltsverzeichnis. Fachrichtung Physik. Erstellt: U. Escher A. Schwab Aktualisiert: am 29. 03. 2010. Physikalisches Grundpraktikum
 Fachrichtung Physik Physikalisches Grundpraktikum Versuch: RO Erstellt: U. Escher A. Schwab Aktualisiert: am 29. 03. 2010 Rotation Inhaltsverzeichnis 1 Aufgabenstellung 2 2 Allgemeine Grundlagen 2 2.1
Fachrichtung Physik Physikalisches Grundpraktikum Versuch: RO Erstellt: U. Escher A. Schwab Aktualisiert: am 29. 03. 2010 Rotation Inhaltsverzeichnis 1 Aufgabenstellung 2 2 Allgemeine Grundlagen 2 2.1
Schwierigkeitsgrad Projekt 3 Die Rotation der Sonne ( 1 ) Grundschule
 Schwierigkeitsgrad Projekt 3 Die Rotation der Sonne ( 1 ) Grundschule - GERÄTE: ein Solarscope eine genau gehende Uhr einen Messschirm Dieses Experiment kann in einem nach Süden gerichteten Raum oder an
Schwierigkeitsgrad Projekt 3 Die Rotation der Sonne ( 1 ) Grundschule - GERÄTE: ein Solarscope eine genau gehende Uhr einen Messschirm Dieses Experiment kann in einem nach Süden gerichteten Raum oder an
Spektrale Besonderheiten an Be-Sternen
 Spektrale Besonderheiten an Be-Sternen eine Arbeit von Tristan Zinn Klasse 8a des Gymnasiums Köln-Pesch 1 Inhaltsverzeichnis Was ich vermitteln möchte... 3 Warum ich dieses Thema gewählt habe... 3 Was
Spektrale Besonderheiten an Be-Sternen eine Arbeit von Tristan Zinn Klasse 8a des Gymnasiums Köln-Pesch 1 Inhaltsverzeichnis Was ich vermitteln möchte... 3 Warum ich dieses Thema gewählt habe... 3 Was
Große Teleskope für kleine Wellen
 Große Teleskope für kleine Wellen Deutsche Zusammenfassung der Antrittsvorlesung von Dr. Floris van der Tak, zur Gelegenheit seiner Ernennung als Professor der Submillimeter-Astronomie an der Universität
Große Teleskope für kleine Wellen Deutsche Zusammenfassung der Antrittsvorlesung von Dr. Floris van der Tak, zur Gelegenheit seiner Ernennung als Professor der Submillimeter-Astronomie an der Universität
Meteoroid von Tscheljabinsk: Bahnberechnung im Unterricht
 Meteoroid von Tscheljabinsk: Bahnberechnung im Unterricht In Bezug auf Aktuelles am Himmel: Das Sonnensystem / Meteore: Mai-Aquariden in der Zeitschrift»Sterne und Weltraum«5/2015. (Die Mai-Aquariden (19.
Meteoroid von Tscheljabinsk: Bahnberechnung im Unterricht In Bezug auf Aktuelles am Himmel: Das Sonnensystem / Meteore: Mai-Aquariden in der Zeitschrift»Sterne und Weltraum«5/2015. (Die Mai-Aquariden (19.
Grundlagen der Sternspektroskopie mit dem Baader DADOS- Spaltspektrografen ein Workshop mit Bernd Koch
 Grundlagen der Sternspektroskopie mit dem Baader DADOS- Spaltspektrografen ein Workshop mit Bernd Koch Workshop "Grundlagen der Sternspektroskopie mit dem Baader DADOS-Spaltspektrografen" Dozent: Diplomphysiker
Grundlagen der Sternspektroskopie mit dem Baader DADOS- Spaltspektrografen ein Workshop mit Bernd Koch Workshop "Grundlagen der Sternspektroskopie mit dem Baader DADOS-Spaltspektrografen" Dozent: Diplomphysiker
Unterrichtsverlauf zur UE Kinder hier und anderswo, 4 Std., Klasse 3, MeNuK, Grundschule
 Unterrichtsverlauf zur UE Kinder hier und anderswo, 4 Std., Klasse 3, MeNuK, Grundschule Zeit U-Phase 1. Std Unterrichtsinhalt (Lehrer- und Schüleraktivitäten) Angestrebte Kompetenzen/Ziele Arbeitsform
Unterrichtsverlauf zur UE Kinder hier und anderswo, 4 Std., Klasse 3, MeNuK, Grundschule Zeit U-Phase 1. Std Unterrichtsinhalt (Lehrer- und Schüleraktivitäten) Angestrebte Kompetenzen/Ziele Arbeitsform
In nur wenigen Tagen knallen zu Neujahr die Korken und ganz Deutschland wird Sterne sehen. Im Januar beginnt das Internationale Jahr der Astronomie
 In nur wenigen Tagen knallen zu Neujahr die Korken und ganz Deutschland wird Sterne sehen. Im Januar beginnt das Internationale Jahr der Astronomie 2009 (IYA 2009). Das ehrgeizige Ziel: das Weltall für
In nur wenigen Tagen knallen zu Neujahr die Korken und ganz Deutschland wird Sterne sehen. Im Januar beginnt das Internationale Jahr der Astronomie 2009 (IYA 2009). Das ehrgeizige Ziel: das Weltall für
120 Gekoppelte Pendel
 120 Gekoppelte Pendel 1. Aufgaben 1.1 Messen Sie die Schwingungsdauer zweier gekoppelter Pendel bei gleichsinniger und gegensinniger Schwingung. 1.2 Messen Sie die Schwingungs- und Schwebungsdauer bei
120 Gekoppelte Pendel 1. Aufgaben 1.1 Messen Sie die Schwingungsdauer zweier gekoppelter Pendel bei gleichsinniger und gegensinniger Schwingung. 1.2 Messen Sie die Schwingungs- und Schwebungsdauer bei
<Extrasolare Planeten>
 ASTROID Stundenbild Project-based Learning [1] [2] Dr. Christian Reimers reimers@astro.univie.ac.at http://www.virtuelleschule.at/cosmos/ [1] Künstlerische Darstellung des 55 Cnc
ASTROID Stundenbild Project-based Learning [1] [2] Dr. Christian Reimers reimers@astro.univie.ac.at http://www.virtuelleschule.at/cosmos/ [1] Künstlerische Darstellung des 55 Cnc
Lösung zur Übung 2. Lösung durch Ausrechnen Die Funktion lässt sich durch die Doppelwinkelfunktion des Sinus ausdrücken.
 Lösung zur Übung Aufgabe 5 Berechnen Sie die kleinste Periode folgender Funktionen a) y(x) = sin(x) cos(x) Lösung durch Ausrechnen Die Funktion lässt sich durch die Doppelwinkelfunktion des Sinus ausdrücken.
Lösung zur Übung Aufgabe 5 Berechnen Sie die kleinste Periode folgender Funktionen a) y(x) = sin(x) cos(x) Lösung durch Ausrechnen Die Funktion lässt sich durch die Doppelwinkelfunktion des Sinus ausdrücken.
Asteroid stürzt auf Jupiter!
 Asteroid stürzt auf Jupiter! Bezug auf den SuW-Beitrag Asteroideneinschlag auf Jupiter / Blick in die Forschung (SuW 5/2011) Olaf Hofschulz Im vorliegenden Material wird ein Arbeitsblatt für die Schüler
Asteroid stürzt auf Jupiter! Bezug auf den SuW-Beitrag Asteroideneinschlag auf Jupiter / Blick in die Forschung (SuW 5/2011) Olaf Hofschulz Im vorliegenden Material wird ein Arbeitsblatt für die Schüler
Die Suche nach der zweiten Erde
 Die Suche nach der zweiten Erde Planeten um fremde Welten Ein Exoplanet, was ist das? Ein extrasolarer Planet, kurz Exoplanet, ist ein Planet außerhalb (griech. ἔξω) des vorherrschenden gravitativen Einflusses
Die Suche nach der zweiten Erde Planeten um fremde Welten Ein Exoplanet, was ist das? Ein extrasolarer Planet, kurz Exoplanet, ist ein Planet außerhalb (griech. ἔξω) des vorherrschenden gravitativen Einflusses
Schülergruppe des Instituto Ballester aus Argentinien in Bayern Berichte der Betreuungslehrerin und der Schüler
 Schülergruppe des Instituto Ballester aus Argentinien in Bayern Berichte der Betreuungslehrerin und der Schüler Bericht der Betreuungslehrerin Eine Gruppe von 11 Schülern von der Deutschen Schule Villa
Schülergruppe des Instituto Ballester aus Argentinien in Bayern Berichte der Betreuungslehrerin und der Schüler Bericht der Betreuungslehrerin Eine Gruppe von 11 Schülern von der Deutschen Schule Villa
ASIM-Fachgruppensitzung am 20. Mai 2009 an der Universität Karlsruhe 1. Bericht der Arbeitsgruppe Unikatprozesse
 ASIM-Fachgruppensitzung am 20. Mai 2009 an der Universität Karlsruhe 1. Bericht der Arbeitsgruppe Unikatprozesse 1 Gliederung des Berichts: 1. Aufgaben und Ziele der Arbeitsgruppe 2. Einladung zur konstituierenden
ASIM-Fachgruppensitzung am 20. Mai 2009 an der Universität Karlsruhe 1. Bericht der Arbeitsgruppe Unikatprozesse 1 Gliederung des Berichts: 1. Aufgaben und Ziele der Arbeitsgruppe 2. Einladung zur konstituierenden
Meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute hier im Namen der Frankfurt School of Finance und Management begrüßen zu dürfen.
 Meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute hier im Namen der Frankfurt School of Finance und Management begrüßen zu dürfen. Manch einer wird sich vielleicht fragen: Was hat eigentlich die Frankfurt
Meine Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute hier im Namen der Frankfurt School of Finance und Management begrüßen zu dürfen. Manch einer wird sich vielleicht fragen: Was hat eigentlich die Frankfurt
7. Klausur am
 Name: Punkte: Note: Ø: Profilkurs Physik Abzüge für Darstellung: Rundung: 7. Klausur am 8.. 0 Achte auf die Darstellung und vergiss nicht Geg., Ges., Formeln, Einheiten, Rundung...! Angaben: h = 6,66 0-34
Name: Punkte: Note: Ø: Profilkurs Physik Abzüge für Darstellung: Rundung: 7. Klausur am 8.. 0 Achte auf die Darstellung und vergiss nicht Geg., Ges., Formeln, Einheiten, Rundung...! Angaben: h = 6,66 0-34
Lösung zum Parabolspiegel
 Lösung zum Parabolspiegel y s 1 s 2 Offensichtlich muss s = s 1 + s 2 unabhängig vom Achsenabstand y bzw. über die Parabelgleichung auch unabhängig von x sein. f F x s = s 1 + s 2 = f x + y 2 + (f x) 2
Lösung zum Parabolspiegel y s 1 s 2 Offensichtlich muss s = s 1 + s 2 unabhängig vom Achsenabstand y bzw. über die Parabelgleichung auch unabhängig von x sein. f F x s = s 1 + s 2 = f x + y 2 + (f x) 2
Fot o: Ber nd Koc h. März 2013 Dipl.-Phys. Bernd Koch Seite 1. Abbildung 1: Stellar- und Nebelspektroskopie mit dem DADOS-Spektrographen
 Studie zur Sternspektroskopie mit einem Gitter 1800 L/mm im DADOS-Spektrographen In dieser Studie wird ein Gitter mit 1800 L/mm vorgestellt, welches zur höherauflösenden Spektroskopie eingeschränkt im
Studie zur Sternspektroskopie mit einem Gitter 1800 L/mm im DADOS-Spektrographen In dieser Studie wird ein Gitter mit 1800 L/mm vorgestellt, welches zur höherauflösenden Spektroskopie eingeschränkt im
Einführung in die Astronomie und Astrophysik (I) Jürgen Schmitt Hamburger Sternwarte
 Einführung in die Astronomie und Astrophysik (I) Jürgen Schmitt Hamburger Sternwarte Vorlesung: Stellarphysik II Was wird behandelt? Schwarzkörperstrahlung Raumwinkel und Intensität Eektivtemperatur Photometrische
Einführung in die Astronomie und Astrophysik (I) Jürgen Schmitt Hamburger Sternwarte Vorlesung: Stellarphysik II Was wird behandelt? Schwarzkörperstrahlung Raumwinkel und Intensität Eektivtemperatur Photometrische
Ein Programm für Studentinnen, Doktorandinnen und promovierte Nachwuchswissenschaftlerinnen
 Universität Potsdam Career Service Mentoring Plus Mentoring für Studentinnen Nicole Körner Am Neuen Palais 10, Haus 9 14469 Potsdam E-Mail: nkoerner@uni-potsdam.de, Tel.: 0331 9771400, Fax: 0331 977 1179
Universität Potsdam Career Service Mentoring Plus Mentoring für Studentinnen Nicole Körner Am Neuen Palais 10, Haus 9 14469 Potsdam E-Mail: nkoerner@uni-potsdam.de, Tel.: 0331 9771400, Fax: 0331 977 1179
Moderne Kosmologie. Michael H Soffel. Lohrmann Observatorium TU Dresden
 Moderne Kosmologie Michael H Soffel Lohrmann Observatorium TU Dresden Die Expansion des Weltalls NGC 1300 1 Nanometer = 1 Millionstel mm ; 10 Å = 1 nm Fraunhofer Spektrum Klar erkennbare Absorptionslinien
Moderne Kosmologie Michael H Soffel Lohrmann Observatorium TU Dresden Die Expansion des Weltalls NGC 1300 1 Nanometer = 1 Millionstel mm ; 10 Å = 1 nm Fraunhofer Spektrum Klar erkennbare Absorptionslinien
Einführung in die Astronomie
 Einführung in die Astronomie Teil 1 Peter H. Hauschildt yeti@hs.uni-hamburg.de Hamburger Sternwarte Gojenbergsweg 112 21029 Hamburg part1.tex Einführung in die Astronomie Peter H. Hauschildt 21/10/2014
Einführung in die Astronomie Teil 1 Peter H. Hauschildt yeti@hs.uni-hamburg.de Hamburger Sternwarte Gojenbergsweg 112 21029 Hamburg part1.tex Einführung in die Astronomie Peter H. Hauschildt 21/10/2014
Haus St. Monika, Begegnungsstätte Caritasverband für Stuttgart e.v. Seeadlerstr Stuttgart Telefon 0711/ Fax 0711/
 Haus St. Monika, Begegnungsstätte Caritasverband für Stuttgart e.v. Seeadlerstr.7-70378 Stuttgart Telefon 0711/95322-0 Fax 0711/95322-2700 Die Begegnungsstätte im Haus St. Monika ist ein Treffpunkt für
Haus St. Monika, Begegnungsstätte Caritasverband für Stuttgart e.v. Seeadlerstr.7-70378 Stuttgart Telefon 0711/95322-0 Fax 0711/95322-2700 Die Begegnungsstätte im Haus St. Monika ist ein Treffpunkt für
14. Mechanische Schwingungen und Wellen
 14. Mechanische Schwingungen und Wellen Schwingungen treten in der Technik in vielen Vorgängen auf mit positiven und negativen Effekten (z. B. Haarrisse, Achsbrüche etc.). Deshalb ist es eine wichtige
14. Mechanische Schwingungen und Wellen Schwingungen treten in der Technik in vielen Vorgängen auf mit positiven und negativen Effekten (z. B. Haarrisse, Achsbrüche etc.). Deshalb ist es eine wichtige
Physikalische Grundlagen
 Physikalische Grundlagen Inhalt: - Bahn und Bahngeschwindigkeit eines Satelliten - Die Energie eines Satelliten - Kosmische Geschwindigkeiten Es wird empfohlen diese Abschnitte der Reihe nach zu bearbeiten.
Physikalische Grundlagen Inhalt: - Bahn und Bahngeschwindigkeit eines Satelliten - Die Energie eines Satelliten - Kosmische Geschwindigkeiten Es wird empfohlen diese Abschnitte der Reihe nach zu bearbeiten.
Weißt du, wie die Sterne stehen?
 Martin Doering Sabine von der Wense Weißt du, wie die Sterne stehen? Astrologie erlebt und hinterfragt Es darf also spekuliert werden, wie die Astrologen mit diesen Tatsachen umgehen werden... 1.3.2Astrologisch
Martin Doering Sabine von der Wense Weißt du, wie die Sterne stehen? Astrologie erlebt und hinterfragt Es darf also spekuliert werden, wie die Astrologen mit diesen Tatsachen umgehen werden... 1.3.2Astrologisch
& sind die Vektorkomponenten von und sind die Vektorkoordinaten von. A x. a) Der Betrag eines Vektors
 Einführu hnung Was ist ein Vektor? In Bereichen der Naturwissenschaften treten Größen auf, die nicht nur durch eine Zahlenangabe dargestellt werden können, wie Kraft oder Geschwindigkeit. Zur vollständigen
Einführu hnung Was ist ein Vektor? In Bereichen der Naturwissenschaften treten Größen auf, die nicht nur durch eine Zahlenangabe dargestellt werden können, wie Kraft oder Geschwindigkeit. Zur vollständigen
Physik 2 (GPh2) am
 Name: Matrikelnummer: Studienfach: Physik 2 (GPh2) am 17.09.2013 Fachbereich Elektrotechnik und Informatik, Fachbereich Mechatronik und Maschinenbau Zugelassene Hilfsmittel zu dieser Klausur: Beiblätter
Name: Matrikelnummer: Studienfach: Physik 2 (GPh2) am 17.09.2013 Fachbereich Elektrotechnik und Informatik, Fachbereich Mechatronik und Maschinenbau Zugelassene Hilfsmittel zu dieser Klausur: Beiblätter
