BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.v. Reinhardtstraße Berlin. Stellungnahme. zum Entwurf eines
|
|
|
- Teresa Gärtner
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Stellungnahme BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.v. Reinhardtstraße Berlin zum Entwurf eines Gesetzes zur Einsparung von Energie und zur Nutzung Erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden Gebäudeenergiegesetz (GEG) Berlin, 1. Februar 2017
2 Am haben die Bundesministerien für Wirtschaft und Energie (BMWi) und für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) den Referentenentwurf für ein Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung Erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (GEG) vorgelegt. Der BDEW begrüßt, dass die Bundesregierung damit die Ankündigung im Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz aus dem Jahr 2014 umsetzt. Der Aktionsplan sieht darin einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Vereinheitlichung und Vereinfachung des rechtlichen Rahmens im Gebäudesektor. Diese Zusammenlegung hatte der BDEW lange gefordert. Das Ergebnis der Zusammenführung von EnEG und EEWärmeG sieht der BDEW allerdings noch verbesserungswürdig. Das vorgelegte Gesetz kann nur ein erster Schritt auf dem Weg zu einem sinnvollen und schlüssigen Rechtsrahmen im Gebäudesektor sein. Ursprünglich sollte mit der Zusammenführung von EnEG/EnEV und EEWärmeG auch eine Vereinfachung der gesetzlichen Regelung erreicht werden. Dieses Ziel wird im vorliegenden Entwurf nicht mehr genannt. Es ist auch fraglich, ob dies mit dem vorliegenden Entwurf erreicht werden würde. Bisher waren im Energieeinsparrecht zwei Anforderungsgrößen an Gebäude enthalten (Primärenergiebedarf und baulicher Wärmeschutz) und im EEWärmeG eine Anforderungsgröße (Anteil Erneuerbarer Energieträger an der Deckung von Wärme- und Kälteenergiebedarf). Der jetzige Entwurf übernimmt diese drei Anforderungsgrößen. Ob dies die bauliche Planung von Gebäude in der Praxis vereinfacht ist fraglich. Nach wie vor ergeben sich durch die Anforderungen an den Primärenergieverbrauch und den Wärmeschutz (ehem. EnEV) und den Wärme- und Kälteenergiebedarf (ehem. EEWärmeG) nahezu die gleichen Wechselwirkungen bei der Nachweisführung und Pflichterfüllung wie in den getrennten Regelungen. Für die am Bau eines Gebäudes Beteiligten sind die Zusammenhänge sowie ein wirtschaftlich und technisch sinnvoller Weg zur Erfüllung der weiterhin bestehenden Anforderungen nur schwer erkennbar. Entsprechendes gilt auch für die Nachweisführung für die Anforderungen der Förderprogramme des MAP und der KfW. An einigen Stellen läuft der Gesetzentwurf auch den Bestrebungen zur Förderung der Integration erneuerbarer Energieträger in den Wärmemarkt entgegen. Insbesondere die Bedeutung der vorhandenen Versorgungsinfrastruktur für Heizenergieträger wird nicht ausreichend berücksichtigt. Der BDEW schlägt zudem vor, zusätzlich zum Primärenergiefaktor zukünftig eine CO 2 Komponente einzuführen. Die insgesamt sehr kurze Frist für die öffentliche Diskussion des Gesetzentwurfs ist der Bedeutung eines Gebäudeenergiegesetzes nicht angemessen. Gerade vor dem Hintergrund der großen Bedeutung, die dem Gebäudesektor bei der Erreichung der klimapolitischen Ziele zukommt, wäre eine breiter aufgestellte öffentliche Diskussion der einzelnen Regelungen notwendig. Seite 2 von 12
3 Die wesentlichen Kritikpunkte des BDEW am vorgelegten Gesetzentwurf: Er führt nicht zu einer systematischen Vereinfachung der Regelungen im Neubaubereich Er verlagert die Verantwortung zur Festlegung von Primärenergiefaktoren vom DIN auf die Politik Die wichtige Rolle der Wärmenetzinfrastruktur, die von Energieversorgern über die Hocheffizienz-KWK hin zu erneuerbaren Energien umgebaut wird, wird zu wenig berücksichtigt. Die Position von Bio-Erdgas (Biomethan) als eine Erneuerbare Energie für den Wärmebereich wird weiter verschlechtert Er führt zu einer partiellen Verschlechterung der Wettbewerbsposition von Strom im Wärmemarkt Er sieht eine zu kurze Übergangsregelung für die ausschließliche Anwendung der DIN V bei Wohngebäuden vor. Es fehlen Regelungen zur Fernwärme als Quartierslösungen Seite 3 von 12
4 Die Kritikpunkte im Einzelnen 3, Begriffsdefinitionen, Absatz 1, Nr. 2 Stromdirektheizungen Nach dieser Definition umfasst der Begriff Stromdirektheizungen auch Widerstandsheizungen in Verbindung mit Festkörper-Wärmespeichern. Diese Definition ist falsch und in sich widersprüchlich. Zudem steht sie den Bestrebungen zur Förderung der Sektorkopplung entgegen. Die Verbindung von elektrischer Widerstandsheizung und Wärmespeicher ermöglicht es ja gerade, eine bedarfsunabhängige Stromerzeugung dem tatsächlichen Wärmebedarf auch zeitlich besser anzupassen. Stromdirektheizung ein Gerät zur direkten Erzeugung von Raumwärme durch Ausnutzung des elektrischen Widerstands auch in Verbindung mit Festkörper-Wärmespeichern, Absatz 2, Nummer 3 und 4, Definition von erneuerbarer Energien aus Photovoltaikanlagen und Windkraftanlagen In der Definition wird, anders als bei den Definitionen in Absatz 2 Nr. 1, 2, 5 und 6, der unmittelbare räumliche Zusammenhang der Anlage mit dem Gebäude gefordert. Diese Definition ist nicht hinreichend eindeutig und kann dadurch sinnvolle Nutzungsoptionen für Strom aus PV- oder Windenergieanlagen im Gebäude ausschließen. Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien, insbesondere Photovoltaik- und Windenergieanlagen, sind auf eine optimale Platzierung bzw. Ausrichtung zur maximalen Stromgewinnung angewiesen. Eine zu starke Einschränkung der Positionierung durch die Definition in diesem Gesetz lässt bestehende Potenziale ungenutzt. Dass das Erfordernis der unmittelbaren räumlichen Nähe zu Rechtsunsicherheiten führen kann, hat eine gleichlautende Formulierung in 6 Abs. 3 EEG 2012 gezeigt, die aus diesem Grund in der Nachfolgeversion des 9 Abs. 3 EEG 2014 durch die Bezugnahme auf das Gebäude ersetzt wurde. Das wiederum wäre im Anwendungsbereich des GEG jedoch nicht zielführend. Denn auch gemeinsam von mehreren Gebäuden genutzte PV-Anlagen (Quartiersversorgung) sollten aus Sicht des BDEW erfasst und die Nutzung des Stroms auch aus solchen PV- oder Windkraftanlagen durch eine zu enge Definition nicht ausgeschlossen sein. Auch die Definition für Windkraftanlagen zur Stromerzeugung schränkt die Anwendungsoptionen unnötig ein. 3. die technisch durch im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit dem Gebäude im Zusammenhang stehenden Photovoltaikanlagen oder durch solarthermische Anlagen zur Wärme- oder Kälteerzeugung nutzbar gemachte solare Strahlungsenergie 4. die technisch durch gebäudeintegrierte im Zusammenhang mit dem Gebäude stehende Windkraftanlagen zur Wärme- oder Kälteerzeugung nutzbar gemachte Energie Seite 4 von 12
5 Absatz 2, Nummer 7 (zu ergänzen), Definition von erneuerbarer Energien Im aktuellen GEG-Entwurf wird sogenanntes Speichergas nicht berücksichtigt. Speichergas ist jedes Gas, das zum Zweck der Zwischenspeicherung von Strom aus erneuerbaren Energien überwiegend unter Einsatz von Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt wurde (Power to Gas) und in der Regel über die vorhandene Gasinfrastruktur genutzt wird. Absatz 2, Nummer 7 (zu ergänzen): aus Speichergas erzeugte Wärme; 6 Verordnungsermächtigung Verteilung der Betriebskosten, Abrechnungs- und Verbrauchsinformationen Mit der Verordnungsermächtigung werden weitreichende Optionen zur Regelung der Betriebskostenverteilung sowie der Abrechungs- und Verbrauchsinformation geschaffen. Über die Anforderung, dass diese Regelungen für den Energieverbrauch von heizungs-, kühloder raumlufttechnischen oder der Versorgung mit Warmwasser dienenden gemeinschaftlichen Anlagen oder Einrichtungen getroffen werden sollen, sind alle im Gebäude genutzten Energieträger betroffen. Damit besteht die Gefahr der Überschneidung mit den spezialgesetzlichen Regelungen des EnWG und der AVBFernwärmeV, die ähnliche Vorgaben für Strom, Erdgas und Fernwärme bereits vorsehen. Aus diesen Überschneidungen können sich widersprüchliche Regelungen ergeben, die zu Verunsicherungen der Nutzer und Anbieter dieser Energieträger führen. So sind zum Beispiel Regelungen zum Abrechnungsrhythmus für Strom- und Gaslieferungen im 40 Absatz 3 EnWG festgelegt. Auch im Bereich der Fernwärme existieren speziellere Regelungen hierzu, etwa in den 18 ff AVBFernwärmeV. Hier sollte zumindest die Einschränkung getroffen werden, dass die Ermächtigung nur in bisher ungeregelten Bereichen gilt. (1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates und soweit keine anderen Rechtsvorschriften bestehen vorzuschreiben, dass ( ) 10, Grundsatz In 10 werden die Grundsätze für die Errichtung eines Gebäudes festgelegt. Er stellt die Zusammenführung der Anforderungen aus der Energieeinsparverordnung und dem Erneuerbare Energien Wärme Gesetz dar. Eine Vereinfachung der Anforderungen bzw. des Anforderungsprofils ist mit dieser Zusammenführung nicht verbunden, nach wie vor müssen alle drei Parameter berücksichtigt werden. Spätestens zur aufgrund der Vorgaben der europäischen Gebäuderichtlinie kurzfristig notwendigen nächsten Gesetzesnovelle muss geprüft werden, ob hier, auch aufgrund der dann Seite 5 von 12
6 weiter verschärften Anforderungen, alle drei Vorgaben noch erforderlich sind. Eine damit verbundene Flexibilisierung der Anforderungen würde voraussichtlich auch die Einhaltung des Wirtschaftlichkeitsprinzips erleichtern. Insbesondere die weiter steigenden Anforderungen an den Primärenergiebedarf mit Einführung des Niedrigstenergiegebäudestandards bedingen in der Regel den Einsatz erneuerbarer Energieträger. 16 Referenzgebäude Der überwiegende Teil der Gebäude in Deutschland wird mit dem klimaschonenden Energieträger Erdgas beheizt. Dies gilt für Bestandsbauten und Neubauten gleichermaßen. Daher ist es aus Sicht des BDEW zu begrüßen, dass ein effizienter Erdgas-Brennwertkessel Bestandteil des Referenzgebäudes ist, auch wenn sich durch diese Änderungen leichte Verschärfungen der Anforderungen ergeben. 21 Nichtwohngebäude im Eigentum der öffentlichen Hand als Niedrigstenergiegebäude Im 21 werden erstmals Vorgaben für ein Niedrigstenergiegebäude eingeführt. Die Anlehnung bzw. Übernahme der Anforderungen aus dem KfW-Effizienzhausstandard 55 ist aus Sicht des BDEW sachgerecht und als Grundlage auch der anstehenden Diskussion um die generelle Definition des Niedrigstenergiegebäudestandards geeignet. 22 Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarf von Wohngebäuden Für nahezu alle Wohngebäude erfolgt heute noch die Nachweisführung zur EnEV und dem EEWärmeG mit den Berechnungsnormen DIN V und DIN V Die Umstellung auf die ausschließliche Nutzung der komplexen DIN V ist aufwendig. Zudem führt dies zumindest für einige marktdominierenden Technologien zu Verschärfungen der Anforderungen. Es sind Anpassungen an Software und Ausführungsplan sowie Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen erforderlich. Der BDEW schlägt vor, für Wohngebäude die Übergangszeit zur ausschließlichen Nutzung der DIN V auf das Datum der Einführung des Niedrigstenergiegebäudestandards für Wohngebäude ( ) auszudehnen. 24, Primärenergiefaktoren und Verordnungsermächtigung Absatz 1 Primärenergiefaktor von gasförmiger Biomasse (Bio-Erdgas /Biomethan) Der BDEW schlägt vor, den Primärenergiefaktor für Biomethan von derzeit 0,5 auf einen Wert von 0,4 abzusenken. Basis dafür ist ein wissenschaftlicher Vergleich der Primärenergiefaktoren biogener Energieträger im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadt- Seite 6 von 12
7 entwicklung aus dem Jahr Verwaltungstechnische oder politische Bewertungskriterien sollten bei der Berücksichtigung dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse keine Rolle spielen. Biomethan auf Erdgasqualität aufbereitete gasförmige Biomasse ist in seiner Anwendung flexibel und hat eine gute Ökobilanz. Auch bietet Biomethan unter Nutzung des Erdgasnetzes ein großes Potenzial für die Anwendung ökologisch und ökonomisch sinnvoller Lösungen im Wärmesektor, um die Ziele der Bundesregierung für diesen Sektor insbesondere in Städten und Ballungsräumen zu erreichen. Der BDEW fordert daher die Anerkennung von Biomethan auch in effizienten Brennwertkesseln analog dem Ansatz für öffentliche Bestandgebäude mit dem Primärenergiefaktor von 0,4. Eine Beschränkung auf die Nutzung in KWK ist nicht sachgerecht. Der im Entwurf des GEG neu definierte Primärenergiefaktor von 0,6 für KWK-Anlagen die mehrere Gebäude versorgen ist eine deutliche Verschlechterung für Biomethan. Diese Anlagen konnten bisher mit bis zu 0,0 bewertet werden. Laut Klimaschutzplan lassen sich durch die Umrüstung auf effiziente Brennwertkessel insbesondere im Gebäudebestand in erheblichem Umfang CO 2 -Emissionen einsparen. Mit der Nutzung von Biomethan wird ein Erneuerbarer Energieträger mit vorhandener Infrastruktur im Wärmemarkt nutzbar gemacht. Somit ist die Verschlechterung der Position von Biomethan im GEG für den BDEW nicht nachvollziehbar und muss angepasst werden. Absatz 1, Nr. 3: für flüssige Biomasse im Sinne des 3 Absatz 2 Nummer 5 kann für den nicht erneuerbaren Anteil der Wert 0,5, für gasförmige Biomasse im Sinne des 3 Absatz 2 Nummer 5 der Wert 0,4 verwendet werden, ( ) Absatz 1, Nr. 4: für gasförmige Biomasse im Sinne des 3 Absatz 2 Nummer 5, die aufbereitet und in das Erdgasnetz eingespeist worden ist (Biomethan) und in zu errichtenden Gebäuden eingesetzt wird, kann für den nicht erneuerbaren Anteil der Wert 0,4 verwendet werden, wenn, ( ) Absatz 1, Nr. 4, lit. a): die Nutzung des Biomethans in einer hocheffizienten KWK-Anlage im Sinne der Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG (ABl. L 315 vom S. 1) oder in einem Brennwertkessel erfolgt Absatz 1, Nr. 5: für die Versorgung eines neu zu errichtenden Gebäudes mit aus Erdgas erzeugter Wärme darf für den nicht erneuerbaren Anteil der Wert bis zu 0 verwendet werden, wenn Absatz 1, Nr. 5, lit. a): die Wärme in einer hocheffizienten KWK-Anlage im Sinne der Richtlinie 2012/27/EU oder in einem Brennwertkessel erfolgt 1 Primärenergiefaktoren von biogenen Energieträgern, Abwärmquellen und Müllverbrennungsanlagen, BMVBS, Juni 2012 Seite 7 von 12
8 Absatz 2: Verordnungsermächtigung Primärenergiefaktoren haben erheblichen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit und damit auf die Auswahlentscheidung von Gebäudeeigentümern/Bauverantwortlichen bezüglich der eingesetzten Heiztechnologie. Mit dem Absatz 2 wird eine Verordnungsermächtigung zur Festlegung von Primärenergiefaktoren eingeführt, mit der die Verantwortung zur Bestimmung und Festlegung der zugrundeliegenden Primärenergiefaktoren von den Normungsgremien des DIN auf die Bundesregierung übertragen wird. Diese Übertragung lehnt der BDEW ab. Die Festlegung der Primärenergiefaktoren muss von einem unabhängigen Fachgremium auf Basis transparenter und nachvollziehbarerer Kriterien vorgenommen werden und darf keinesfalls stärkeren politischen Einflüssen unterliegen. Der BDEW setzt sich zudem dafür ein, dass zusätzlich zum Primärenergiefaktor zukünftig eine CO 2 Komponente berücksichtigt wird, um die Klimawirkung der Wärmeversorgung des Gebäudes stärker zu berücksichtigen. Absatz 2 und Absatz 3 streichen Absatz 4: Primärenergiefaktoren für Wärmenetze Absatz 4 erweitert die Verordnungsermächtigung auf die Festlegung eines Primärenergiefaktors, den Wärme- und Kältenetze erreichen müssen, um die Anforderungen nach 46 Absatz 2 Satz 1 zu erfüllen. Davon ausgehend, dass hiermit 45 gemeint ist, stellt der Absatz 4, anders als in der Gesetzesbegründung angeführt, eine zusätzliche Restriktion für Fernwärme- und kältenetze dar. Die Anforderungen an diese Netze sind im 45 hinreichend beschrieben und haben sich in der Praxis bewährt. Die Einführung einer weiteren Grenze, die zudem auf dem Verordnungswege kurzfristig geändert werden könnte, führt im Gegenteil zu einer zusätzlichen Planungsunsicherheit und erschwert die Nutzung von Fernwärme und kälte. So wäre für dasselbe Wärmenetz und ohne Änderung der Wärmezusammensetzung (z.b. aus hocheffizienten KWK-Anlagen, Abwärme, Wärme aus EE od. biogenem Abfall) aufgrund der Änderung des zulässigen Primärenergiefaktors durch Verordnung die Anrechenbarkeit als Ersatzmaßnahme rückwirkend nicht mehr gegeben. Absatz 4 Nr. 1 streichen 25, Anrechnung von Strom aus erneuerbaren Energien Absatz 1 Nr. 1 Die Anforderung, dass der Strom im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit dem Gebäude erzeugt werden muss, ist einerseits unklar und kann dadurch sinnvolle Nutzungsoptionen für Strom aus erneuerbaren Energien im Gebäude ausschließen. So können gemeinsam von mehreren Gebäuden genutzte Erzeugungsanlagen (Quartiersversorgung, s. auch 107) Seite 8 von 12
9 durch diese Definition von der Nutzung dieses Stroms ausgeschlossen sein (siehe auch bereits die Anmerkungen zu 3). Zudem steht die Anforderung im Widerspruch zum aktuellen Entwurf der Gebäudeeffizienzrichtlinie der Europäischen Kommission. Hier schlägt die Kommission für die Bestimmung des Primärenergiefaktors unter Einbeziehung Erneuerbarer Energien folgende Regelung vor: Primary energy factors shall discount the share of renewable energy in energy carriers so that calculations equally treat: (a) the energy from renewable source that is generated on-site (behind the individual meter, i.e. not accounted as supplied), and (b) the energy from renewable energy sources supplied through the energy carrier. Sie erkennt damit auch die Nutzung von Erneuerbaren Energien an, die über die leitungsgebundenen Energieträger (Strom, Gas, Fernwärme) eingebracht werden. Dies sollte bei der Formulierung des Gebäudeenergiegesetzes, bei gleichzeitiger Festlegung angemessener Qualitätskriterien, ebenfalls berücksichtigt werden. Auch muss sichergestellt sein, dass auch für Wohngebäude die Anrechnung von Strom aus Anlagen nach 3 Absatz 2 Nr. 3 und Nr. 4 die Berechnung der primärenergetischen Kennwerte auf der Grundlage der Berechnung der DIN V / 2016 erfolgt. Bei der Anrechenbarkeit von Strom von PV-Dachflächen sollten die Gebäudeabmessungsrelationen von Dachfläche zu Gebäudenutzfläche berücksichtigt werden. Je höher das Gebäude, desto größer muss der ansetztbare kw-wert für PV-Dachflächen werden. Der Ansatz des Gesetzesentwurfs (150 kwh) funktioniert insbesondere nur für Einfamilienhäuser, nicht aber für mehrstöckige städtische Gebäude wie Büros, Schulen, Einkaufszentren und Wohnblöcke. Absatz 1 Nr. 1 streichen Absatz 1 Nr. 3 Strom, der für Stromdirektheizungen genutzt wird, darf nicht in Abzug gebracht werden. Nicht nur, weil die Definition in 3 Nr. 20 von Stromdirektheizungen fachlich falsch ist, ist diese Regelung nicht sachgerecht. Insbesondere vor dem Hintergrund der angestrebten Sektorkopplung und der Flexibilisierung des Stromverbrauchs, wird hier eine Option zur Steigerung der Nutzung erneuerbarer Energieträger im Wärmemarkt nicht berücksichtigt. Gerade im Neubaubereich, wo unter der Maßgabe dieses Gesetzes der Bedarf an zusätzlicher Heizenergie nur noch gering ist, stellt die Stromdirektheizung insbesondere im Bereich der Ein- und Zweifamilienhäuser eine effiziente Zusatzheizung zur Deckung kurzfristigen Wärmebedarfs dar. Diesen kurzfristigen Bedarf über Strom aus erneuerbaren Energien zu decken ist sinnvoll und effizient und steht den Zielen des Gesetzes nicht entgegen. Absatz 1 Nr. 3 streichen Seite 9 von 12
10 38, Nutzung von Geothermie und Umweltwärme Absatz 2 In Absatz zwei werden die Anforderungen an die Arbeitszahl von Luft/Wasser- und Luft/Luft- Wärmepumpen gegenüber der geltenden Regelung von 3,5 auf 3,7 bzw. 3,3 auf 3,5 erhöht, was zu einer Verschlechterung der Wettbewerbsposition von Strom im Wärmemarkt führt. In der Gesetzesbegründung wird dafür die Verbesserung der Sicherung der Qualität der Wärmepumpe angeführt. Dies ist aber nicht das Ergebnis einer Verschärfung der Anforderungen. Die Qualität und Effizienz einer Wärmepumpenanlage hängt von der qualifizierten Planung und ihrem fachgerechten Einbau ab. Gleichzeitig steht die Verschärfung den Bemühungen um die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit elektrischer Systeme unter der Zielsetzung der Sektorkopplung entgegen, wie sie noch im Grünbuch Energieeffizienz, Kapitel 4.4, abgefragt wurden: Wie können in den verschiedenen Sektoren die Wettbewerbsbedingungen zwischen erneuerbarem Strom und fossilen Brennstoffen verbessert werden?. Rücknahme der Verschärfung der Anforderungen aus Absatz 2 41 Nutzung von gasförmiger Biomasse Hohe spezifische Investitionskosten in Kombination mit der seit dem EEG 2014 deutlich abgesenkten EEG-Vergütung für Strom aus Biomethan in KWK schließen diese Erfüllungsoption praktisch aus. Es ist unverständlich, weshalb z.b. der Einsatz von Palmöl als flüssige Biomasse gemäß 40 hier deutlich besser gestellt wird. Angleichung der Anforderungen an die Anforderungen für flüssige Biomasse: (2) Die Nutzung muss in einer hocheffizienten KWK-Anlage im Sinne der Richtlinie 2012/27/EU oder in einem Brennwertkessel erfolgen. Nutzung von Speichergas Aktuell ist sogenanntes Speichergas im GEG-Entwurf nicht vorgesehen. Um die Entwicklung der Technologie zur Speicherung von aktuell nicht sinnvoll nutzbarem Strom aus erneuerbaren Energien in Form von Gas (Power to Gas) zu fördern, sollte auch diese Option vorgesehen werden. 41a Nutzung von Speichergas Die Anforderung nach 10 Absatz 1 Nummer 3 ist erfüllt, wenn durch die Nutzung von Speichergas der Wärme- und Kälteenergiebedarf zu mindestens 10 Prozent gedeckt wird. Seite 10 von 12
11 45 Fernwärme oder Fernkälte In Absatz 2 Nummer 4 müssen die Wörter durch eine ersetzt werden durch die Wörter aus einer. Ansonsten passt die aus Anhang VIII Nr. 1d EEWärmeG übernommene Formulierung nicht in 45 Abs. 2 Nr. 4 des GEG. 86 Einteilung in Energieeffizienzklassen von Wohngebäuden 86 stellt die Einteilung der Energieeffizienzklassen von Wohngebäuden um und verweist dazu auf Anlage 5, in der die Klassen A+ bis H definiert sind. Gleichzeitig wird von endenergetischer auf primärenergetische Bewertung umgestellt. Das führt bei der gleichzeitig nur geringen Anpassung der Schwellenwerte zu einer unproportionalen Verschiebung der Klasseneinteilung und damit unzureichender Vergleichbarkeit mit bereits bewerteten Gebäuden. Hier sollte eine fundierte Neubewertung der Klassengrenzwerte erfolgen. Im Sinne der Akzeptanz und Wirkung einer solchen Klasseneinteilung sollte gleichzeitig in Anlehnung an die in Kürze erwartete europäische Energieverbrauchskennzeichnungsrahmenverordnung eine Umstellung auf die einheitliche Klassenbezeichnung A bis G erfolgen. 89 und 90 Fördermittel und Geförderte Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien In den Paragraphen 89 und 90 werden Maßnahmen zur Förderung der Nutzung von Wärme oder Kälte aus Erneuerbaren Energien in Bestandsgebäuden aufgelistet, die durch den Bund gefördert werden können. Hier sollten auch solche Maßnahmen aufgenommen werden, die den Anteil von Wärme aus Erneuerbaren Energien in Fernwärme- und Fernkältenetzen unabhängig von der Netzgröße erhöhen. 107 Quartierslösungen Der BDEW begrüßt die Öffnung des Gebäudeenergiegesetzes für die Betrachtung gebäudeübergreifender Quartierskonzepte. Er empfiehlt der Bundesregierung, diese Betrachtungsweise auch in den aktuellen Prozess der Novellierung der europäischen Gebäudeeffizienz- Richtlinie (EPBD) einzubringen. Absatz 1 Fernwärme ist als Quartiersversorgung zu betrachten und muss als solche bilanziert werden können. Insbesondere in Ballungsräumen, wo dezentrale Wärmelösungen an ihre Grenzen stoßen, kommt der Fernwärme zukünftig vermehrt auf Basis erneuerbarer Energien eine wesentliche Rolle bei der Umsetzung der städtischen Wärmewende zu. Analog sollte die Fernwärme in den 107 integriert werden. Der BDEW steht für die Diskussionen zur Ausgestaltung dieser Quartiers-Bilanzierung für die Fernwärme gerne bereit. 1. die Errichtung und der Betrieb gemeinsamer Anlagen zur dezentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Wärme und Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung sowie die Nutzung von Fernwärmenetzen im Sinne des 45; Seite 11 von 12
12 Absatz 2 Die hier vorgesehene gemeinsame Nutzung von Anlagen, die Strom, Wärme oder Kälte aus Erneuerbaren Energien erzeugen, zur Erfüllung der Erneuerbaren-Pflicht in zusammenhängenden Gebäudekomplexen (Quartieren) ist zu begrüßen. Dass diese Flexibilität aber auf die Nutzung Erneuerbarer Energien begrenzt bleibt ist unverständlich. Auch hinsichtlich der Vorgaben zum Primärenergieverbrauch sollten Quartiere als virtuelle Gebäude berechnet werden können, eine Einhaltung der Vorgaben für jedes einzelne Gebäude kann demgegenüber ineffizienter sein. (2) Die Anforderungen nach 10 Absatz 1 Nummern 1 und 2 und nach 51 Absatz 1 in Verbindung mit 49 sind für die Gesamtheit der Gebäude, die von einer Vereinbarung im Sinne des Absatzes 1 erfasst wird, einzuhalten. Die Anerkennung der besonderen Bedeutung der Energieversorgungsunternehmen bei der Planung und Umsetzung von Quartierslösungen im Absatz 4 begrüßt der BDEW ausdrücklich. Seite 12 von 12
von Bundesverband Bioenergie e.v. (BBE) Deutscher Bauernverband e.v. (DBV) Fachverband Biogas e.v. (FvB) Fachverband Holzenergie (FVH)
 Stand: 30.01.2017 Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Einsparung von Energie und zur Nutzung Erneuerbarer Energien zur Wärmeund Kälteerzeugung in Gebäuden vom 23.01.2017 von Bundesverband
Stand: 30.01.2017 Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Einsparung von Energie und zur Nutzung Erneuerbarer Energien zur Wärmeund Kälteerzeugung in Gebäuden vom 23.01.2017 von Bundesverband
Dieses Bild kann durch ein eigenes Bild ersetzt werden oder löschen Sie diesen Hinweis. Anforderungen des EEWärmeG an Kälteanlagen
 Dieses Bild kann durch ein eigenes Bild ersetzt werden oder löschen Sie diesen Hinweis Anforderungen des EEWärmeG an Kälteanlagen Netzwerktreffen Kälteenergie, 4. September 2013 Dr. Friederike Mechel,
Dieses Bild kann durch ein eigenes Bild ersetzt werden oder löschen Sie diesen Hinweis Anforderungen des EEWärmeG an Kälteanlagen Netzwerktreffen Kälteenergie, 4. September 2013 Dr. Friederike Mechel,
2. BMUB-Fachtagung Klimaschutz durch Abwärmenutzung
 2. BMUB-Fachtagung Klimaschutz durch Abwärmenutzung Industrielle Abwärme im Kontext des Gebäudeordnungsrechts Die Nutzung von industrieller Abwärme und die Regelungen zur Eigenversorgung mit Strom im EEG
2. BMUB-Fachtagung Klimaschutz durch Abwärmenutzung Industrielle Abwärme im Kontext des Gebäudeordnungsrechts Die Nutzung von industrieller Abwärme und die Regelungen zur Eigenversorgung mit Strom im EEG
Richtlinie der Universitätsstadt Marburg. zur Förderung von solarthermischen Anlagen
 60/11 Richtlinie der Universitätsstadt Marburg zur Förderung von solarthermischen Anlagen 1. Ziel der Förderung Ziel dieser Richtlinien ist die finanzielle Unterstützung von Eigentümern und Betreibern,
60/11 Richtlinie der Universitätsstadt Marburg zur Förderung von solarthermischen Anlagen 1. Ziel der Förderung Ziel dieser Richtlinien ist die finanzielle Unterstützung von Eigentümern und Betreibern,
Gesetz zur Förderung Erneuerbare Energien im Wärmebereich (EEWärmeG) Nachweisführung nach 10 EEWärmeG. Ersatzmaßnahmen
 Gesetz zur Förderung Erneuerbare Energien im Wärmebereich (EEWärmeG) Nachweisführung nach 10 EEWärmeG Ersatzmaßnahmen Diese Vorlage dient als Hilfestellung bei der Nachweisführung und ist der unteren Bauaufsicht
Gesetz zur Förderung Erneuerbare Energien im Wärmebereich (EEWärmeG) Nachweisführung nach 10 EEWärmeG Ersatzmaßnahmen Diese Vorlage dient als Hilfestellung bei der Nachweisführung und ist der unteren Bauaufsicht
Das EEWärmeG Erfüllung der Nutzungspflicht für Neubauten durch Ersatzmaßnahmen. Messekongress ITAD-Stand Donnerstag, 16.
 Das EEWärmeG Erfüllung der Nutzungspflicht für Neubauten durch Ersatzmaßnahmen Messekongress ITAD-Stand Donnerstag, 16. September 2010 Ullrich Müller AGFW Der Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und
Das EEWärmeG Erfüllung der Nutzungspflicht für Neubauten durch Ersatzmaßnahmen Messekongress ITAD-Stand Donnerstag, 16. September 2010 Ullrich Müller AGFW Der Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und
Energiegespräch 2016 II ES. Zukunft der Energieversorgung im Wohngebäude. Klaus Heikrodt. Haltern am See, den 3. März 2016
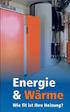 Energiegespräch 2016 II ES Zukunft der Energieversorgung im Wohngebäude Klaus Heikrodt Haltern am See, den 3. März 2016 Struktur Endenergieverbrauch Deutschland Zielsetzung im Energiekonzept 2010 und in
Energiegespräch 2016 II ES Zukunft der Energieversorgung im Wohngebäude Klaus Heikrodt Haltern am See, den 3. März 2016 Struktur Endenergieverbrauch Deutschland Zielsetzung im Energiekonzept 2010 und in
Erneuerbare-Energien- Wärmegesetz
 Der Wärmemarkt und das Erneuerbare-Energien- Wärmegesetz Dr. jur. Volker Hoppenbrock, M.A. Ecologic-Institut im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit Überblick Situation
Der Wärmemarkt und das Erneuerbare-Energien- Wärmegesetz Dr. jur. Volker Hoppenbrock, M.A. Ecologic-Institut im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit Überblick Situation
Zweck und Ziel des Gesetzes ( 1 EEWärmeG)
 Zweck und Ziel des Gesetzes ( 1 EEWärmeG) Zweck dieses Gesetzes ist es, insbesondere im Interesse des Klimaschutzes, der Schonung fossiler Ressourcen und der Minderung der Abhängigkeit von Energieimporten,
Zweck und Ziel des Gesetzes ( 1 EEWärmeG) Zweck dieses Gesetzes ist es, insbesondere im Interesse des Klimaschutzes, der Schonung fossiler Ressourcen und der Minderung der Abhängigkeit von Energieimporten,
Bedarfsanalyse und Szenarienentwicklung für Europa: Die Heat Roadmap Europe 2050
 Bedarfsanalyse und Szenarienentwicklung für Europa: Die Heat Roadmap Europe 2050 10.12.2015 Fachveranstaltung Exportchancen für erneuerbare Wärme- und Kältetechnologien Niedrigstenergiegebäude (NZEB) gemäß
Bedarfsanalyse und Szenarienentwicklung für Europa: Die Heat Roadmap Europe 2050 10.12.2015 Fachveranstaltung Exportchancen für erneuerbare Wärme- und Kältetechnologien Niedrigstenergiegebäude (NZEB) gemäß
EEWärmeG 2009: Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz. Neue Wege zum nachhaltigen Bauen. Dipl.-Ing. Christian Schiebel, Regierung von Oberbayern:
 Dipl.-Ing. Christian Schiebel, Regierung von Oberbayern: : Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz Tagung am 17.07.2009 Christian Schiebel: Das Erneuerbare-Energien- Wärmegesetz (EEWärmeG) 1 EnEG EnEV EEG
Dipl.-Ing. Christian Schiebel, Regierung von Oberbayern: : Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz Tagung am 17.07.2009 Christian Schiebel: Das Erneuerbare-Energien- Wärmegesetz (EEWärmeG) 1 EnEG EnEV EEG
EnEV Bei Fragen zur Anwendung des Gutachtens können Sie sich gerne an das HEXIS Produktmanagement wenden. Kontakt:
 EnEV 2014 Seit dem 1. Februar 2002 ist die Energieeinsparverordnung (EnEV) in Kraft. Sie hat die Wärmeschutzverordnung und die Heizungsanlagenverordnung zusammengeführt, zugleich aber auch eine ganz neue
EnEV 2014 Seit dem 1. Februar 2002 ist die Energieeinsparverordnung (EnEV) in Kraft. Sie hat die Wärmeschutzverordnung und die Heizungsanlagenverordnung zusammengeführt, zugleich aber auch eine ganz neue
BMWi / IIC2 Berlin, 15. Januar 2016
 BMWi / IIC2 Berlin, 15. Januar 2016 Bund-/Ländergespräch am 20. Januar 2016 zur Weiterentwicklung des Energieeinsparrechts bei Gebäuden (EEWärmeG; EnEG/EnEV) Diskussionspapier I. Hintergrund Bis Ende 2016
BMWi / IIC2 Berlin, 15. Januar 2016 Bund-/Ländergespräch am 20. Januar 2016 zur Weiterentwicklung des Energieeinsparrechts bei Gebäuden (EEWärmeG; EnEG/EnEV) Diskussionspapier I. Hintergrund Bis Ende 2016
Das Erneuerbare-Energien- Wärmegesetz Informationen
 Klimaschutz und Energie Das Erneuerbare-Energien- Wärmegesetz Informationen Solarthermie Gasförmige Biomasse Die Bestimmungen in Kurzform Bei Neubauten besteht für die Bauherren eine Pflicht zur (zumindest
Klimaschutz und Energie Das Erneuerbare-Energien- Wärmegesetz Informationen Solarthermie Gasförmige Biomasse Die Bestimmungen in Kurzform Bei Neubauten besteht für die Bauherren eine Pflicht zur (zumindest
27. Juni EnEV 2013 Heutige und zukünftige Anforderungen an Betreiber und Industrieimmobilien. Hettich Forum, Kirchlengern
 EnEV 2013 Heutige und zukünftige Anforderungen an Betreiber und Industrieimmobilien 27. Juni 2012 Hettich Forum, Kirchlengern Ernst Merkschien Ingenieurbüro für Energieberatung Bielefeld EnEV 2013 Heutige
EnEV 2013 Heutige und zukünftige Anforderungen an Betreiber und Industrieimmobilien 27. Juni 2012 Hettich Forum, Kirchlengern Ernst Merkschien Ingenieurbüro für Energieberatung Bielefeld EnEV 2013 Heutige
Neuerungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) 2014
 46. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft der Technischen Abteilungen (ATA) an wissenschaftlichen Hochschulen Neuerungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) 2014 ATA-Tagung 2014 in Saarbrücken Ralf-Dieter
46. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft der Technischen Abteilungen (ATA) an wissenschaftlichen Hochschulen Neuerungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) 2014 ATA-Tagung 2014 in Saarbrücken Ralf-Dieter
Energieeinsparverordnung aktueller Planungsstand
 Energieeinsparverordnung 2012 - aktueller Planungsstand Leiter des Referates Gebäude- und Anlagentechnik, technische Angelegenheiten des energiesparenden Bauens und der Nutzung Erneuerbarer Energien im
Energieeinsparverordnung 2012 - aktueller Planungsstand Leiter des Referates Gebäude- und Anlagentechnik, technische Angelegenheiten des energiesparenden Bauens und der Nutzung Erneuerbarer Energien im
Gebäudeenergiegesetz (GEG)
 Geplante Neuregelungen im Bereich, Referentin im Referat Gebäude- und Anlagentechnik, technische Angelegenheiten im Bereich Energie und Bauen im BMUB Gliederung des Vortrags Klimaschutzziele bis 2050 Geltende
Geplante Neuregelungen im Bereich, Referentin im Referat Gebäude- und Anlagentechnik, technische Angelegenheiten im Bereich Energie und Bauen im BMUB Gliederung des Vortrags Klimaschutzziele bis 2050 Geltende
EnEV 2009 Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz
 Fortbildung im MBV Energieeffizienz von Nichtwohngebäuden EnEV 2009 Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz 05. Oktober 2010 Dipl.-Ing. Architekt Michael Scharf, Öko-Zentrum NRW Einführung Leistungsprofil Ingenieurleistungen
Fortbildung im MBV Energieeffizienz von Nichtwohngebäuden EnEV 2009 Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz 05. Oktober 2010 Dipl.-Ing. Architekt Michael Scharf, Öko-Zentrum NRW Einführung Leistungsprofil Ingenieurleistungen
. Das Bundeskabinett hat die Verordnung verabschiedet.
 Mitte Oktober hat der Bundesrat. der EnEV 2014 zugestimmt. Das Bundeskabinett hat die Verordnung verabschiedet. Mit der Verkündung der Zweiten Verordnung zur Änderung der Energieeinsparverordnung im Bundesgesetzblatt
Mitte Oktober hat der Bundesrat. der EnEV 2014 zugestimmt. Das Bundeskabinett hat die Verordnung verabschiedet. Mit der Verkündung der Zweiten Verordnung zur Änderung der Energieeinsparverordnung im Bundesgesetzblatt
Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Förderung von Mieterstrom (Mieterstromgesetz) vom
 Stand: 30.03.2017 Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Förderung von Mieterstrom (Mieterstromgesetz) vom 17.03.2017 von Bundesverband Bioenergie e.v. (BBE) Deutscher Bauernverband e.v.
Stand: 30.03.2017 Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Förderung von Mieterstrom (Mieterstromgesetz) vom 17.03.2017 von Bundesverband Bioenergie e.v. (BBE) Deutscher Bauernverband e.v.
Gesetze und Verordnungen
 Gesetze und Verordnungen Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland legt großen Wert auf Klimaschutz und Energieeinsparung. Deshalb ist der Einsatz von Erneuerbaren Energien im Bestand und im Neubau
Gesetze und Verordnungen Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland legt großen Wert auf Klimaschutz und Energieeinsparung. Deshalb ist der Einsatz von Erneuerbaren Energien im Bestand und im Neubau
Berliner Energietage. Berliner Energietage EnEV in der Praxis. MR Peter Rathert
 Berliner Energietage 2016 EnEV in der Praxis Leiter des Referates Gebäude- und Anlagentechnik, technische Angelegenheiten im Bereich Energie und Bauen im BMUB Gliederung des Vortrags Was fordert das Energieeinsparrecht?
Berliner Energietage 2016 EnEV in der Praxis Leiter des Referates Gebäude- und Anlagentechnik, technische Angelegenheiten im Bereich Energie und Bauen im BMUB Gliederung des Vortrags Was fordert das Energieeinsparrecht?
Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz EEWärmeG
 Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz EEWärmeG Stand: November 2008 Bundesverband Solarwirtschaft e.v. (BSW-Solar) EEWärmeG - Eckpunkte 2 Ziel: 14% erneuerbarer Wärme bis 2020 (derzeit: 6%). Mindestanteil
Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz EEWärmeG Stand: November 2008 Bundesverband Solarwirtschaft e.v. (BSW-Solar) EEWärmeG - Eckpunkte 2 Ziel: 14% erneuerbarer Wärme bis 2020 (derzeit: 6%). Mindestanteil
Vorgaben der Energieeinsparverordnung ab Jan Karwatzki Öko-Zentrum NRW GmbH
 Vorgaben der Energieeinsparverordnung ab 2016 Jan Karwatzki Öko-Zentrum NRW GmbH Entwicklung von Vorgaben Quelle: Vortrag Erhorn, 20.01.2015 EU-Richtlinie (EPBD) EU-Richtlinie (EPBD) Was ist ein Niedrigstenergiegebäude?
Vorgaben der Energieeinsparverordnung ab 2016 Jan Karwatzki Öko-Zentrum NRW GmbH Entwicklung von Vorgaben Quelle: Vortrag Erhorn, 20.01.2015 EU-Richtlinie (EPBD) EU-Richtlinie (EPBD) Was ist ein Niedrigstenergiegebäude?
Viertes Gesetz. zur Änderung des Energieeinsparungsgesetzes 1. Vom 4. Juli Artikel 1. Änderung des. Energieeinsparungsgesetzes
 Haftungsausschluss: Bei den im Internetangebot Info-Portal Energieeinsparung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt und Raumforschung enthaltenen Verordnungs- und Gesetzestexten handelt es sich um unverbindliche
Haftungsausschluss: Bei den im Internetangebot Info-Portal Energieeinsparung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt und Raumforschung enthaltenen Verordnungs- und Gesetzestexten handelt es sich um unverbindliche
FKT Fachtagung Lünen EnEV 2007 und Energieausweise in Nichtwohngebäuden. Dipl.-Ing. Architekt Michael Scharf Öko-Zentrum NRW
 FKT Fachtagung Lünen - 28.2.2008 EnEV 2007 und Energieausweise in Nichtwohngebäuden Dipl.-Ing. Architekt Michael Scharf Öko-Zentrum NRW Einführung Leistungsprofil Weiterbildungen - Gebäudeenergieberatung
FKT Fachtagung Lünen - 28.2.2008 EnEV 2007 und Energieausweise in Nichtwohngebäuden Dipl.-Ing. Architekt Michael Scharf Öko-Zentrum NRW Einführung Leistungsprofil Weiterbildungen - Gebäudeenergieberatung
Erneuerbaren-Energien-Wärmegesetz
 Heilbronn, den 23.10.2014 Kurt Weissenbach, Vorstandsvorsitzender Modell Hohenlohe e.v. Tel. 0170/313 97 93 Mail: moho1@t-online.de Energiepolitische Ziele der Bundesregierung Senkung des Primärenergieverbrauchs
Heilbronn, den 23.10.2014 Kurt Weissenbach, Vorstandsvorsitzender Modell Hohenlohe e.v. Tel. 0170/313 97 93 Mail: moho1@t-online.de Energiepolitische Ziele der Bundesregierung Senkung des Primärenergieverbrauchs
ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
 Berechneter Energiebedarf des Gebäudes 2 "Gesamtenergieeffizienz" Dieses Gebäudes 125,6 kwh/(m² a) CO 2 -Emissionen 1) 30,6 kg/(m²a) EnEV-Anforderungswert Neubau (Vergleichswert) EnEV-Anforderungswert
Berechneter Energiebedarf des Gebäudes 2 "Gesamtenergieeffizienz" Dieses Gebäudes 125,6 kwh/(m² a) CO 2 -Emissionen 1) 30,6 kg/(m²a) EnEV-Anforderungswert Neubau (Vergleichswert) EnEV-Anforderungswert
Und sind sie nicht willig wie EnEV und KfW den Markt bewegen
 Und sind sie nicht willig wie EnEV und KfW den Markt bewegen 22. September 2011 Kreishaus Herford Ernst Merkschien Ingenieurbüro für Energieberatung Bielefeld Das Integrierte Energie- und Klimaprogramm
Und sind sie nicht willig wie EnEV und KfW den Markt bewegen 22. September 2011 Kreishaus Herford Ernst Merkschien Ingenieurbüro für Energieberatung Bielefeld Das Integrierte Energie- und Klimaprogramm
Neue Energie durch kommunale Kompetenz
 Neue Energie durch kommunale Kompetenz Uwe Barthel Mitglied des Vorstandes 28. Februar 2009 Chemnitz Ziele von Bund und Land Bund / BMU Roadmap Senkung CO 2 -Ausstoß bis 2020 gegenüber 1990 um 40 % im
Neue Energie durch kommunale Kompetenz Uwe Barthel Mitglied des Vorstandes 28. Februar 2009 Chemnitz Ziele von Bund und Land Bund / BMU Roadmap Senkung CO 2 -Ausstoß bis 2020 gegenüber 1990 um 40 % im
Das Erneuerbarbe-Energien-Wärmegesetz und die Erfüllungsmöglichkeiten über Mini-BHKW s VNG Marco Kersting Operatives Marketing
 Das Erneuerbarbe-Energien-Wärmegesetz und die Erfüllungsmöglichkeiten über Mini-BHKW s Marco Kersting Operatives Marketing Primärenergieverbrauch in Deutschland 0591 Erdgasverbrauch in Deutschland 0384c
Das Erneuerbarbe-Energien-Wärmegesetz und die Erfüllungsmöglichkeiten über Mini-BHKW s Marco Kersting Operatives Marketing Primärenergieverbrauch in Deutschland 0591 Erdgasverbrauch in Deutschland 0384c
Energieeffizienz von Gebäuden Anforderungen und Fördermöglichkeiten
 Energieeffizienz von Gebäuden Anforderungen und Fördermöglichkeiten Michael Hörnemann Öko-Zentrum NRW GmbH Öko-Zentrum NRW Planen Beraten Qualifizieren Wir sind. Ansprechpartner für alle Fragen rund um
Energieeffizienz von Gebäuden Anforderungen und Fördermöglichkeiten Michael Hörnemann Öko-Zentrum NRW GmbH Öko-Zentrum NRW Planen Beraten Qualifizieren Wir sind. Ansprechpartner für alle Fragen rund um
Die Kosten im Blick Erfüllung der Pflichten nach EEWärmeG, EWärmeG und EnEV»
 Die Kosten im Blick Erfüllung der Pflichten nach EEWärmeG, EWärmeG und EnEV» EnBW Energie Baden-Württemberg AG V-CE Rudolf Schiller Zukunft Biomethan - Ergebnisse Berlin 2. Dezember 2014 Ihr Referent Rudolf
Die Kosten im Blick Erfüllung der Pflichten nach EEWärmeG, EWärmeG und EnEV» EnBW Energie Baden-Württemberg AG V-CE Rudolf Schiller Zukunft Biomethan - Ergebnisse Berlin 2. Dezember 2014 Ihr Referent Rudolf
Strategien der Novelle Bundesregierung
 Gebäude-Energiewende: Regionale Strategien für die energetische Sanierung kleinerer Wohngebäude Energiewende Sachstand zur im EnEV-EEWärmeG Gebäudebereich Strategien der Novelle Bundesregierung André Hempel
Gebäude-Energiewende: Regionale Strategien für die energetische Sanierung kleinerer Wohngebäude Energiewende Sachstand zur im EnEV-EEWärmeG Gebäudebereich Strategien der Novelle Bundesregierung André Hempel
Bewertung der Fernwärme im Rahmen der EnEV 2013
 e&u energiebüro gmbh Markgrafenstr. 3, 33602 Bielefeld Telefon: 0521/17 31 44 Fax: 0521/17 32 94 Internet: www.eundu-online.de Bewertung der Fernwärme im Rahmen der EnEV 2013 Düsseldorf, 21. April 2016
e&u energiebüro gmbh Markgrafenstr. 3, 33602 Bielefeld Telefon: 0521/17 31 44 Fax: 0521/17 32 94 Internet: www.eundu-online.de Bewertung der Fernwärme im Rahmen der EnEV 2013 Düsseldorf, 21. April 2016
Spielraum für die Novellierung von EnEG & EnEV vor dem Hintergrund von Wirtschaftlichkeit und Kostenoptimalität
 Spielraum für die Novellierung von EnEG & EnEV vor dem Hintergrund von Wirtschaftlichkeit und Kostenoptimalität Die Vorgaben der Bundesregierung Integriertes Energie- und Klimaschutzprogramm (IEKP) vom
Spielraum für die Novellierung von EnEG & EnEV vor dem Hintergrund von Wirtschaftlichkeit und Kostenoptimalität Die Vorgaben der Bundesregierung Integriertes Energie- und Klimaschutzprogramm (IEKP) vom
Vollkostenvergleich von Heizungs- und Warmwassersystemen
 Wärmeversorgung im Umbruch Vollkostenvergleich von Heizungs- und Warmwassersystemen Prof. Dr.-Ing. Bert Oschatz Institut für Technische Gebäudeausrüstung Dresden Forschung und Anwendung GmbH Gravierende
Wärmeversorgung im Umbruch Vollkostenvergleich von Heizungs- und Warmwassersystemen Prof. Dr.-Ing. Bert Oschatz Institut für Technische Gebäudeausrüstung Dresden Forschung und Anwendung GmbH Gravierende
Die geplante EnEV 2012 Wesentliche Änderungen und Konsequenzen für die Baupraxis
 Die geplante EnEV 2012 Wesentliche Änderungen und Konsequenzen für die Baupraxis von RA Johannes Bohl Fachanwalt für Verwaltungsrecht 05.10.2012 BDB Bamberg Gliederung Rechtsgrundlage für den Erlass der
Die geplante EnEV 2012 Wesentliche Änderungen und Konsequenzen für die Baupraxis von RA Johannes Bohl Fachanwalt für Verwaltungsrecht 05.10.2012 BDB Bamberg Gliederung Rechtsgrundlage für den Erlass der
Förderprogramme des Landes Rheinland-Pfalz
 Förderprogramme des Landes Rheinland-Pfalz 01.12.2009 EffNet Netzwerkpartner-Treffen Dipl.-Ing. Irina Kollert Gliederung Änderungen EnEV 2009 MUFV - Förderprogramm für hochenergieeffiziente Gebäude MUFV
Förderprogramme des Landes Rheinland-Pfalz 01.12.2009 EffNet Netzwerkpartner-Treffen Dipl.-Ing. Irina Kollert Gliederung Änderungen EnEV 2009 MUFV - Förderprogramm für hochenergieeffiziente Gebäude MUFV
Erklärung des Betreibers einer EEG-, KWKG- oder konventionellen Erzeugungsanlage zur EEG-Umlagepflicht
 Stadtwerke Baden-Baden Waldseestraße 24 76530 Baden-Baden Abt. EDM / Netzzugang Erklärung des Betreibers einer EEG-, KWKG- oder konventionellen Erzeugungsanlage zur EEG-Umlagepflicht Die Erklärung erfolgt
Stadtwerke Baden-Baden Waldseestraße 24 76530 Baden-Baden Abt. EDM / Netzzugang Erklärung des Betreibers einer EEG-, KWKG- oder konventionellen Erzeugungsanlage zur EEG-Umlagepflicht Die Erklärung erfolgt
Pflichten und Fristen zu Wärmeschutz und Heizungsanlagen im Rahmen der Energieeinsparverordnung
 Pflichten und Fristen zu Wärmeschutz und Heizungsanlagen im Rahmen der Energieeinsparverordnung (EnEV, Fassung vom 2. Dezember 2004) Folie 1 von 7 Die Energieeinsparverordnung vereint die Wärmeschutz-
Pflichten und Fristen zu Wärmeschutz und Heizungsanlagen im Rahmen der Energieeinsparverordnung (EnEV, Fassung vom 2. Dezember 2004) Folie 1 von 7 Die Energieeinsparverordnung vereint die Wärmeschutz-
Erneuerbare Energien Wärmegesetz (EEWärmeG) Dr.-Ing. Dirk Gust/Dr. Andreas Neff Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz
 Erneuerbare Energien Wärmegesetz (EEWärmeG) Dr.-Ing. Dirk Gust/Dr. Andreas Neff Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz Folie 1 EEWärmeG - Übersicht Erneuerbare Energien im Wärmemarkt Gründe
Erneuerbare Energien Wärmegesetz (EEWärmeG) Dr.-Ing. Dirk Gust/Dr. Andreas Neff Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz Folie 1 EEWärmeG - Übersicht Erneuerbare Energien im Wärmemarkt Gründe
EnEV 2016 Ziegelwerk Staudacher. Klaus Meyer Technischer Bauberater
 EnEV 2016 Ziegelwerk Staudacher Klaus Meyer Technischer Bauberater Niedrigstenergie- Standard 2019/21 Ausblick EnEV 2021 - I Grundlage Beratungen NABau Schettler-Köhler BBSR: Anhörung zur neuen EnEV 2021
EnEV 2016 Ziegelwerk Staudacher Klaus Meyer Technischer Bauberater Niedrigstenergie- Standard 2019/21 Ausblick EnEV 2021 - I Grundlage Beratungen NABau Schettler-Köhler BBSR: Anhörung zur neuen EnEV 2021
Leseprobe. EnEV Erdgas-Technologien sind zukunftsfähig. EnEV
 EnEV 2016 Erdgas-Technologien sind zukunftsfähig Leseprobe www.asue.de EnEV 2016 1 Inhalt 1 Hintergrund und Zweck dieser Broschüre 3 2 Anforderungen des Gesetzgebers an Wohngebäude 4 3 Erdgastechnologien
EnEV 2016 Erdgas-Technologien sind zukunftsfähig Leseprobe www.asue.de EnEV 2016 1 Inhalt 1 Hintergrund und Zweck dieser Broschüre 3 2 Anforderungen des Gesetzgebers an Wohngebäude 4 3 Erdgastechnologien
Entschließung des Bundesrates zur Stärkung der Stromerzeugung aus Biomasse im EEG 2016
 Bundesrat Drucksache 555/15 (Beschluss) 18.12.15 Beschluss des Bundesrates Entschließung des Bundesrates zur Stärkung der Stromerzeugung aus Biomasse im EEG 2016 Der Bundesrat hat in seiner 940. Sitzung
Bundesrat Drucksache 555/15 (Beschluss) 18.12.15 Beschluss des Bundesrates Entschließung des Bundesrates zur Stärkung der Stromerzeugung aus Biomasse im EEG 2016 Der Bundesrat hat in seiner 940. Sitzung
Entwicklung des Wärmebedarfs in Deutschland was sind die Auswirkungen auf die KWK-Ziele?
 Hannes Seidl Entwicklung des Wärmebedarfs in Deutschland was sind die Auswirkungen auf die KWK-Ziele? 9. Mai 2012, Berlin 1 Energiepolitische Ziele der Bundesregierung. Senkung des Primärenergieverbrauchs
Hannes Seidl Entwicklung des Wärmebedarfs in Deutschland was sind die Auswirkungen auf die KWK-Ziele? 9. Mai 2012, Berlin 1 Energiepolitische Ziele der Bundesregierung. Senkung des Primärenergieverbrauchs
Bewertung und Förderung von Energieholz aus Sicht des BMU
 NABU-Fachtagung Kurzumtriebsplantagen: Ein sinnvoller Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz? Berlin, 12. November 2008 Bewertung und Förderung von Energieholz aus Sicht des BMU Dr. Bernhard Dreher Bundesministerium
NABU-Fachtagung Kurzumtriebsplantagen: Ein sinnvoller Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz? Berlin, 12. November 2008 Bewertung und Förderung von Energieholz aus Sicht des BMU Dr. Bernhard Dreher Bundesministerium
Ergänzung zu den TAB 2007*
 Ergänzung zu den TAB 2007* Umsetzung des 33 Abs. 2 EEG 2009 und des 4 Abs. 3a KWK-G 2009 zum 1. Januar 2009: Auswirkungen auf Zählerplatz Ausgabe: Oktober 2009 *Technische Anschlussbedingungen für den
Ergänzung zu den TAB 2007* Umsetzung des 33 Abs. 2 EEG 2009 und des 4 Abs. 3a KWK-G 2009 zum 1. Januar 2009: Auswirkungen auf Zählerplatz Ausgabe: Oktober 2009 *Technische Anschlussbedingungen für den
Wärmewende in Kommunen. Leitfaden für den klimafreundlichen Um der Wärmeversorgung
 Wärmewende in Kommunen. Leitfaden für den klimafreundlichen Um der Wärmeversorgung Herausgeber/Institute: Heinrich-Böll-Stiftung, ifeu Autoren: Hans Hertle et al. Themenbereiche: Schlagwörter: KWK, Klimaschutz,
Wärmewende in Kommunen. Leitfaden für den klimafreundlichen Um der Wärmeversorgung Herausgeber/Institute: Heinrich-Böll-Stiftung, ifeu Autoren: Hans Hertle et al. Themenbereiche: Schlagwörter: KWK, Klimaschutz,
Die neuen Konditionen des KWKG 2016
 Die neuen Konditionen des KWKG 2016 Das KWK-Gesetz 2016 Neue Regelungen für KWK-Anlagen Stand: 25. Februar 2016, Berlin Energie- und Wasserwirtschaft e.v. www.bdew.de Konditionen des Kraft- Wärme-Kopplungsgesetzes
Die neuen Konditionen des KWKG 2016 Das KWK-Gesetz 2016 Neue Regelungen für KWK-Anlagen Stand: 25. Februar 2016, Berlin Energie- und Wasserwirtschaft e.v. www.bdew.de Konditionen des Kraft- Wärme-Kopplungsgesetzes
Mikro-KWK mit Heizöl. Perspektiven des Einsatzes flüssige Energieträger in der Kraft-Wärme-Kopplung. Lutz Mertens Osnabrück, 11.
 Mikro-KWK mit Heizöl Perspektiven des Einsatzes flüssige Energieträger in der Kraft-Wärme-Kopplung Lutz Mertens Osnabrück, 11. November 2011 Inhalt Energieträger Heizöl EL: Einsatzbereiche, Potenziale
Mikro-KWK mit Heizöl Perspektiven des Einsatzes flüssige Energieträger in der Kraft-Wärme-Kopplung Lutz Mertens Osnabrück, 11. November 2011 Inhalt Energieträger Heizöl EL: Einsatzbereiche, Potenziale
2. Nach Nummer 7.4 wird ein neuer Absatz eingefügt und dieser mit Nummer 7.5 bezeichnet. Aus Nummer 7.5 (alt) wird Nummer 7.6.
 Änderung der Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt Vom 17. Februar 2010 Die Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im
Änderung der Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt Vom 17. Februar 2010 Die Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im
Wärmeszenario Erneuerbare Energien 2025 in Schleswig-Holstein
 Wärmeszenario Erneuerbare Energien 2025 in Schleswig-Holstein Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, in Schleswig-Holstein bis zum Jahr 2020 einen Anteil von 18% des Endenergieverbrauchs (EEV)
Wärmeszenario Erneuerbare Energien 2025 in Schleswig-Holstein Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, in Schleswig-Holstein bis zum Jahr 2020 einen Anteil von 18% des Endenergieverbrauchs (EEV)
Kleine Einführung in die ENEV Dipl.Ing. Architektin Claudia Gehse- Dezernat VI.3- Bauen und Liegenschaften
 Kleine Einführung in die ENEV 2014 Das größte Einsparpotential privater Haushalte in Deutschland liegt beim Heizenergieverbrauch. Energieverbrauch im Haushalt 80 % für das Heizen 10 % für die Versorgung
Kleine Einführung in die ENEV 2014 Das größte Einsparpotential privater Haushalte in Deutschland liegt beim Heizenergieverbrauch. Energieverbrauch im Haushalt 80 % für das Heizen 10 % für die Versorgung
Praxis der Energieeffizienz» EnBW Energie Baden-Württemberg AG Rudolf Schiller Herbstveranstaltung Energiegemeinschaft 1.
 Praxis der Energieeffizienz» EnBW Energie Baden-Württemberg AG Rudolf Schiller Herbstveranstaltung Energiegemeinschaft 1. Dezember 2015 Inhalt 1 2 3 4 5 EnEV 2016 anstehende und zukünftige Änderungen EWärmeG
Praxis der Energieeffizienz» EnBW Energie Baden-Württemberg AG Rudolf Schiller Herbstveranstaltung Energiegemeinschaft 1. Dezember 2015 Inhalt 1 2 3 4 5 EnEV 2016 anstehende und zukünftige Änderungen EWärmeG
Effiziente Technik und Erneuerbare Energien
 Effiziente Technik und Erneuerbare Energien Schloß Holte-Stukenbrock, 25. September Dr. Jochen Arthkamp, ASUE www.asue.de Herausforderungen an die Energieversorgung zunehmender Energiebedarf weltweit begrenzte
Effiziente Technik und Erneuerbare Energien Schloß Holte-Stukenbrock, 25. September Dr. Jochen Arthkamp, ASUE www.asue.de Herausforderungen an die Energieversorgung zunehmender Energiebedarf weltweit begrenzte
Die Entwicklungen von energetischen Gebäudestandards auf EU-Ebene
 Die Entwicklungen von energetischen Gebäudestandards auf EU-Ebene Mag. Dr. Susanne Geissler ÖGNB Österreichische Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen Nearly Zero-Energy Building (NZEB) Article 2 EPBD Recast
Die Entwicklungen von energetischen Gebäudestandards auf EU-Ebene Mag. Dr. Susanne Geissler ÖGNB Österreichische Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen Nearly Zero-Energy Building (NZEB) Article 2 EPBD Recast
EnEV-Novelle: Was kommt auf Bauherren zu?
 Artikel Ralph Diermann EnEV-Novelle: Was kommt auf Bauherren zu? Der Bund hat die Energieeinsparverordnung (EnEV) überarbeitet. Künftig gelten strengere Vorgaben für den Energiebedarf von Neubauten. Das
Artikel Ralph Diermann EnEV-Novelle: Was kommt auf Bauherren zu? Der Bund hat die Energieeinsparverordnung (EnEV) überarbeitet. Künftig gelten strengere Vorgaben für den Energiebedarf von Neubauten. Das
Energieforum West, Essen, Buderus Fachforum Trends und Entwicklungen im Geschosswohnungsbau. 23. Januar 2017
 Energieforum West, Essen, Buderus Fachforum Trends und Entwicklungen im Geschosswohnungsbau 23. Januar 2017 Energieeffizienz im Kontext der Energiepolitik Bosch Thermotechnik GmbH Dr.-Ing. Rainer Ortmann
Energieforum West, Essen, Buderus Fachforum Trends und Entwicklungen im Geschosswohnungsbau 23. Januar 2017 Energieeffizienz im Kontext der Energiepolitik Bosch Thermotechnik GmbH Dr.-Ing. Rainer Ortmann
2.3 Energetische Bewertung von
 Seite 1 Die Norm DIN V 18599 entstand im Ergebnis der Arbeit eines gemeinsamen Arbeitsausschusses der DIN- Normenausschüsse Bauwesen, Heiz- und Raumlufttechnik und Lichttechnik. Die Veröffentlichung der
Seite 1 Die Norm DIN V 18599 entstand im Ergebnis der Arbeit eines gemeinsamen Arbeitsausschusses der DIN- Normenausschüsse Bauwesen, Heiz- und Raumlufttechnik und Lichttechnik. Die Veröffentlichung der
ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude gemäß den 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
 Berechneter Energiebedarf des Gebäudes 2 "Gesamtenergieeffizienz" Dieses Gebäudes 301,3 kwh/(m² a) CO 2 -Emissionen 1) 69,9 kg/(m²a) EnEV-Anforderungswert Neubau (Vergleichswert) EnEV-Anforderungswert
Berechneter Energiebedarf des Gebäudes 2 "Gesamtenergieeffizienz" Dieses Gebäudes 301,3 kwh/(m² a) CO 2 -Emissionen 1) 69,9 kg/(m²a) EnEV-Anforderungswert Neubau (Vergleichswert) EnEV-Anforderungswert
EnEV Gesetzliche Forderungen im Bestand und der Energieausweis" Dipl. Ing. (FH) für Energetik Ulrich Kleemann Freiberuflicher Energieberater
 EnEV Gesetzliche Forderungen im Bestand und der Energieausweis" Dipl. Ing. (FH) für Energetik Ulrich Kleemann Freiberuflicher Energieberater Energieverbrauchsanteile für Industrienationen: mit über 1/3
EnEV Gesetzliche Forderungen im Bestand und der Energieausweis" Dipl. Ing. (FH) für Energetik Ulrich Kleemann Freiberuflicher Energieberater Energieverbrauchsanteile für Industrienationen: mit über 1/3
1 Service und Verzeichnisse Expertenservice. 1.1 Gesamtinhaltsverzeichnis
 Seite 1 1.1 1.1 1 Service und Verzeichnisse Expertenservice 1.1 1.2 Herausgeber und Autoren 1.3 Stichwortverzeichnis 1.4 Verzeichnis zum bau-energieportal.de 2 Die aktuelle EnEV 2.1 Praxisbezogene Auslegung
Seite 1 1.1 1.1 1 Service und Verzeichnisse Expertenservice 1.1 1.2 Herausgeber und Autoren 1.3 Stichwortverzeichnis 1.4 Verzeichnis zum bau-energieportal.de 2 Die aktuelle EnEV 2.1 Praxisbezogene Auslegung
WINGAS PRODUKTE BIO- ERDGAS. Ein Multitalent im Einsatz.
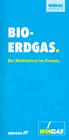 WINGAS PRODUKTE BIO- ERDGAS. Ein Multitalent im Einsatz. Neue Energiekonzepte. Die Zeichen stehen auf Erneuerung denn die Energiewende hat Deutschland so stark beeinflusst wie wenig vergleichbare politische
WINGAS PRODUKTE BIO- ERDGAS. Ein Multitalent im Einsatz. Neue Energiekonzepte. Die Zeichen stehen auf Erneuerung denn die Energiewende hat Deutschland so stark beeinflusst wie wenig vergleichbare politische
Altbautage Mittelfranken - EnEV 2014 Energieausweis. Wolfgang Seitz Alexander Schrammek 21./22. Febr. 2015
 Altbautage Mittelfranken - EnEV 2014 Energieausweis Wolfgang Seitz Alexander Schrammek 21./22. Febr. 2015 Energieverbrauch private Haushalte 2 Entwicklung Wärmeschutzverordnung - EnEV Die EnEV begrenzt
Altbautage Mittelfranken - EnEV 2014 Energieausweis Wolfgang Seitz Alexander Schrammek 21./22. Febr. 2015 Energieverbrauch private Haushalte 2 Entwicklung Wärmeschutzverordnung - EnEV Die EnEV begrenzt
Aktuelle EU-Gebäude-Richtlinie 2010 Auf dem Weg zum energieneutralen Gebäude
 Aktuelle EU-Gebäude-Richtlinie 2010 Auf dem Weg zum energieneutralen Gebäude Dr.-Ing. Dagmar Bayer Regierung von Oberbayern, Projektgruppe Sonderaufgaben Städtebau Vielfache Gründe der EU zum Handeln Klimawandel
Aktuelle EU-Gebäude-Richtlinie 2010 Auf dem Weg zum energieneutralen Gebäude Dr.-Ing. Dagmar Bayer Regierung von Oberbayern, Projektgruppe Sonderaufgaben Städtebau Vielfache Gründe der EU zum Handeln Klimawandel
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz EEWärmeG seit in Kraft
 i Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz EEWärmeG seit 01.01.2009 in Kraft Welchen Zweck und welches Ziel hat das Gesetz? Das Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (Erneuerbare-Energien-
i Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz EEWärmeG seit 01.01.2009 in Kraft Welchen Zweck und welches Ziel hat das Gesetz? Das Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (Erneuerbare-Energien-
Anforderungen an den Energiebedarf. Teil III
 Teil III Zum Thema Energiekonzepte Gesetze und Verordnungen Anforderungen an den Energiebedarf Förderwege Energiebedarf-Ermittlung Energiequellen Heizungstechniken Wirtschaftlichkeit Beispiele für Energiekonzepte
Teil III Zum Thema Energiekonzepte Gesetze und Verordnungen Anforderungen an den Energiebedarf Förderwege Energiebedarf-Ermittlung Energiequellen Heizungstechniken Wirtschaftlichkeit Beispiele für Energiekonzepte
Wärmepumpen in der Praxis richtige Planung und korrekte Installation als Grundlage für beste Anlageneffizienz
 Wärmepumpen in der Praxis richtige Planung und korrekte Installation als Grundlage für beste Anlageneffizienz Alexander Sperr Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.v. Überblick Warum Effizienz? Status quo Was
Wärmepumpen in der Praxis richtige Planung und korrekte Installation als Grundlage für beste Anlageneffizienz Alexander Sperr Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.v. Überblick Warum Effizienz? Status quo Was
Datum: und andere Organisationen
 An alle mit uns in Verbindung stehenden Berater, Kammern, Verbände, Ministerien Datum: 04.08.2009 und andere Organisationen Sehr geehrte Damen und Herren, Informationen und Hinweise erhalten Sie zu folgenden
An alle mit uns in Verbindung stehenden Berater, Kammern, Verbände, Ministerien Datum: 04.08.2009 und andere Organisationen Sehr geehrte Damen und Herren, Informationen und Hinweise erhalten Sie zu folgenden
Erneuerbare-Wärme-Gesetz. Gesetz zur Nutzung erneuerbarer Wärmeenergie in Baden-Württemberg. Erneuerbare-Wärme-Gesetz
 Gesetz zur Nutzung erneuerbarer Wärmeenergie in Baden-Württemberg Erneuerbare-Wärme-Gesetz Folie 1, 10.04.2008 Anwendungsbereich: Kernpunkte EWärmeG BW Wohngebäude Neubau und Bestand Pflichtanteil: 20
Gesetz zur Nutzung erneuerbarer Wärmeenergie in Baden-Württemberg Erneuerbare-Wärme-Gesetz Folie 1, 10.04.2008 Anwendungsbereich: Kernpunkte EWärmeG BW Wohngebäude Neubau und Bestand Pflichtanteil: 20
Bestimmung der Werte der Primärenergiefaktoren im Sinne der Energieeinsparverordnung
 Bestimmung der Werte der Primärenergiefaktoren im Sinne der Energieeinsparverordnung 2016 Deutscher Bundestag Seite 2 Bestimmung der Werte der Primärenergiefaktoren im Sinne der Energieeinsparverordnung
Bestimmung der Werte der Primärenergiefaktoren im Sinne der Energieeinsparverordnung 2016 Deutscher Bundestag Seite 2 Bestimmung der Werte der Primärenergiefaktoren im Sinne der Energieeinsparverordnung
AGFW-Stellungnahme. Frankfurt am Main, /5
 AGFW-Stellungnahme Zum Entwurf eines Gesetzes zur grundlegenden Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und zur Änderung weiterer Vorschriften des Energiewirtschaftsrechts Frankfurt am Main, 12.03.2014
AGFW-Stellungnahme Zum Entwurf eines Gesetzes zur grundlegenden Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und zur Änderung weiterer Vorschriften des Energiewirtschaftsrechts Frankfurt am Main, 12.03.2014
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
 Berechneter Energiebedarf des Gebäudes 2 Energiebedarf CO 2 -Emissionen 3 16 kg/(m² a) Endenergiebedarf dieses Gebäudes 53,3 kwh/(m² a) A+ A B C D E F G H 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250 66,1 kwh/(m²
Berechneter Energiebedarf des Gebäudes 2 Energiebedarf CO 2 -Emissionen 3 16 kg/(m² a) Endenergiebedarf dieses Gebäudes 53,3 kwh/(m² a) A+ A B C D E F G H 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250 66,1 kwh/(m²
Erfahrungen mit dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz Baden-Württemberg
 Berliner Energietage 2009 Fachgespräch EEWärmeG: Spielräume für Landesgesetze zum Klimaschutz Erfahrungen mit dem Baden-Württemberg Gregor Stephani Umweltministerium Baden-Württemberg Referatsleiter Grundsatzfragen
Berliner Energietage 2009 Fachgespräch EEWärmeG: Spielräume für Landesgesetze zum Klimaschutz Erfahrungen mit dem Baden-Württemberg Gregor Stephani Umweltministerium Baden-Württemberg Referatsleiter Grundsatzfragen
Umsetzung des 33 Abs. 2 EEG 2009 und des 4 Abs. 3a KWK G 2009 zum 01. Januar 2009:
 Ergänzung zu den TAB 2007* Umsetzung des 33 Abs. 2 EEG 2009 und des 4 Abs. 3a KWK G 2009 zum 01. Januar 2009: Auswirkungen auf Zählerplatz und Messung Ausgabe: Oktober 2009 * Technische Anschlussbedingungen
Ergänzung zu den TAB 2007* Umsetzung des 33 Abs. 2 EEG 2009 und des 4 Abs. 3a KWK G 2009 zum 01. Januar 2009: Auswirkungen auf Zählerplatz und Messung Ausgabe: Oktober 2009 * Technische Anschlussbedingungen
100 % erneuerbar wie ist das möglich, was kostet das und was bedeutet das für die Wohnungswirtschaft?
 100 % erneuerbar wie ist das möglich, was kostet das und was bedeutet das für die Wohnungswirtschaft? Hans-Martin Henning Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE WohnZukunftsTag Berlin, 18. September
100 % erneuerbar wie ist das möglich, was kostet das und was bedeutet das für die Wohnungswirtschaft? Hans-Martin Henning Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE WohnZukunftsTag Berlin, 18. September
Bilanzierung. Energiebezug: Brennstoffe (Gas, Heizöl, Kohle usw.) (Endenergie): Elektrischer Strom, Fernwärme. Energiewiederverwendung
 Bilanzierung Energiebezug: Brennstoffe (Gas, Heizöl, Kohle usw.) (Endenergie): Elektrischer Strom, Fernwärme Energiewiederverwendung η η Umwandlung Verteilung Nutzung Entsorgung: Ab-luft, Ab-gas, Ab-wasser,
Bilanzierung Energiebezug: Brennstoffe (Gas, Heizöl, Kohle usw.) (Endenergie): Elektrischer Strom, Fernwärme Energiewiederverwendung η η Umwandlung Verteilung Nutzung Entsorgung: Ab-luft, Ab-gas, Ab-wasser,
Energiewende Nordhessen
 Energiewende Nordhessen Technische und ökonomische Verknüpfung des regionalen Strom- und Wärmemarktes Stand 12. November 2013 Dr. Thorsten Ebert, Vorstand Städtische Werke AG Energiewende Nordhessen:
Energiewende Nordhessen Technische und ökonomische Verknüpfung des regionalen Strom- und Wärmemarktes Stand 12. November 2013 Dr. Thorsten Ebert, Vorstand Städtische Werke AG Energiewende Nordhessen:
Grundlagen der Kraft-Wärme-Kopplung
 Grundlagen der Kraft-Wärme-Kopplung Funktionsweise der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) Bei der Erzeugung von elektrischem Strom entsteht als Nebenprodukt Wärme. In Kraftwerken entweicht sie häufig ungenutzt
Grundlagen der Kraft-Wärme-Kopplung Funktionsweise der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) Bei der Erzeugung von elektrischem Strom entsteht als Nebenprodukt Wärme. In Kraftwerken entweicht sie häufig ungenutzt
01. Februar Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Scharnhorststr Berlin. Kontakt:
 Deutsche Umwelthilfe e.v. Hackescher Markt 4 10178 Berlin Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Scharnhorststr. 34-37 10115 Berlin BUNDESGESCHÄFTSSTELLE BERLIN Hackescher Markt 4 Eingang: Neue Promenade
Deutsche Umwelthilfe e.v. Hackescher Markt 4 10178 Berlin Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Scharnhorststr. 34-37 10115 Berlin BUNDESGESCHÄFTSSTELLE BERLIN Hackescher Markt 4 Eingang: Neue Promenade
Wärmeversorgung der Region Brandenburg- Berlin auf Basis Erneuerbarer Energien
 Wärmeversorgung der Region Brandenburg- Berlin auf Basis Erneuerbarer Energien Jochen Twele Brandenburg + Berlin = 100 % Erneuerbar Aus Visionen Wirklichkeit machen Cottbus, 20.04.2012 Wärmeverbrauch der
Wärmeversorgung der Region Brandenburg- Berlin auf Basis Erneuerbarer Energien Jochen Twele Brandenburg + Berlin = 100 % Erneuerbar Aus Visionen Wirklichkeit machen Cottbus, 20.04.2012 Wärmeverbrauch der
e&u energiebüro gmbh Markgrafenstr Bielefeld Telefon: 0521/ Fax: 0521/
 Klimaschutzkonzept Remscheid e&u energiebüro gmbh Markgrafenstr. 3 33602 Bielefeld Telefon: 0521/17 31 44 Fax: 0521/17 32 94 Arbeitsgruppe Einsparungen bei Wohngebäuden 13.03.2013 Inhalt 1 Einleitung...3
Klimaschutzkonzept Remscheid e&u energiebüro gmbh Markgrafenstr. 3 33602 Bielefeld Telefon: 0521/17 31 44 Fax: 0521/17 32 94 Arbeitsgruppe Einsparungen bei Wohngebäuden 13.03.2013 Inhalt 1 Einleitung...3
Effizienzgewinn in der dezentralen Gebäudeversorgung
 Effizienzgewinn in der dezentralen Gebäudeversorgung Alexander Kamm Im Februar 2016 Kompetenz im Verbund: URBANA und KALO Im Gebäude In Gebäudekomplexen In Quartieren Anlagenbau und Anlagenbetrieb Metering
Effizienzgewinn in der dezentralen Gebäudeversorgung Alexander Kamm Im Februar 2016 Kompetenz im Verbund: URBANA und KALO Im Gebäude In Gebäudekomplexen In Quartieren Anlagenbau und Anlagenbetrieb Metering
Zusammenfassung zum Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes (GEG)
 Zusammenfassung zum Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB)
Zusammenfassung zum Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB)
EnEV 2009/2012 und EEWärmeG
 Neue Rahmenbedingungen fürf Energieeffiziente Gebäude EnEV 2009/2012 und EEWärmeG Energieeffiziente Gebäude Neue Trends in Praxis und Forschung WIKO 2008 Internationale Wissenschaftskonferenz Zittau/Görlitz
Neue Rahmenbedingungen fürf Energieeffiziente Gebäude EnEV 2009/2012 und EEWärmeG Energieeffiziente Gebäude Neue Trends in Praxis und Forschung WIKO 2008 Internationale Wissenschaftskonferenz Zittau/Görlitz
Energieeffizienter Brühl
 Energieeffizienter Brühl Städtische Versorgungsinfrastruktur im Zeichen der Energiewende Innovativ, zuverlässig und bezahlbar Andreas Hennig, Geschäftsführer eins 24.01.2012 Die städtische Versorgungs-Infrastruktur
Energieeffizienter Brühl Städtische Versorgungsinfrastruktur im Zeichen der Energiewende Innovativ, zuverlässig und bezahlbar Andreas Hennig, Geschäftsführer eins 24.01.2012 Die städtische Versorgungs-Infrastruktur
Herzlich Willkommen zur Online-Pressekonferenz
 Herzlich Willkommen zur Online-Pressekonferenz Wirtschaftlichkeitsgutachten zur Energieeffizienz von Immobilien Vorstellung erster Ergebnisse und Erläuterung eigener Branchenmaßnahmen zur Verbesserung
Herzlich Willkommen zur Online-Pressekonferenz Wirtschaftlichkeitsgutachten zur Energieeffizienz von Immobilien Vorstellung erster Ergebnisse und Erläuterung eigener Branchenmaßnahmen zur Verbesserung
Stellungnahme. zum. Frankfurt am Main, 21. April 2016 JK / BS 1/5
 Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Einführung von Ausschreibungen für Strom aus erneuerbaren Energien und zu weiteren Änderungen des Rechts der erneuerbaren Energien i.d.f. vom 14.
Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Einführung von Ausschreibungen für Strom aus erneuerbaren Energien und zu weiteren Änderungen des Rechts der erneuerbaren Energien i.d.f. vom 14.
COFELY in Germany. Erneuerbare Energien Wärmegesetz (EEWärmeG) 7 Abwärmenutzung. Rebranding Campaign. Dipl. Ing. M. Enzensperger
 Erneuerbare Energien Wärmegesetz (EEWärmeG) 7 Abwärmenutzung COFELY in Germany Rebranding Campaign Dipl. Ing. M. Enzensperger Seite 1 Gesetz zur Förderung der Erneuerbarer Energien im Wärmebereich 1 Zweck
Erneuerbare Energien Wärmegesetz (EEWärmeG) 7 Abwärmenutzung COFELY in Germany Rebranding Campaign Dipl. Ing. M. Enzensperger Seite 1 Gesetz zur Förderung der Erneuerbarer Energien im Wärmebereich 1 Zweck
Themenblock 1: Geschichte der Verordnungen
 Themenblock 1: Geschichte der Verordnungen 07. Oktober 2010 Seite: 1 Inhaltsverzeichnis Grundlagen Seite 03 Wärmeschutzverordnung 17.08.1977 Seite 04 07 Wärmeschutzverordnung 24.02.1982 Seite 08 09 Wärmeschutzverordnung
Themenblock 1: Geschichte der Verordnungen 07. Oktober 2010 Seite: 1 Inhaltsverzeichnis Grundlagen Seite 03 Wärmeschutzverordnung 17.08.1977 Seite 04 07 Wärmeschutzverordnung 24.02.1982 Seite 08 09 Wärmeschutzverordnung
Verordnung zur Änderung der Lösemittelhaltige Farben- und Lack-Verordnung *)
 Bonn, 17. Dezember 2012 Verordnung zur Änderung der Lösemittelhaltige Farben- und Lack-Verordnung *) Vom Auf Grund des 17 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a bis c sowie Absatz 5 des Chemikaliengesetzes in der
Bonn, 17. Dezember 2012 Verordnung zur Änderung der Lösemittelhaltige Farben- und Lack-Verordnung *) Vom Auf Grund des 17 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a bis c sowie Absatz 5 des Chemikaliengesetzes in der
Der Dachs im Geschossbau
 Der Dachs im Geschossbau Die Wurzeln der SenerTec Kraft-Wärme-Energiesysteme GmbH liegen im Hause Fichtel & Sachs. Dort wurde der legendäre Dachs Einzylinder-Verbrennungsmotor speziell entwickelt. Die
Der Dachs im Geschossbau Die Wurzeln der SenerTec Kraft-Wärme-Energiesysteme GmbH liegen im Hause Fichtel & Sachs. Dort wurde der legendäre Dachs Einzylinder-Verbrennungsmotor speziell entwickelt. Die
Erneuerbare Energien Wärmegesetz (EEWärmeG) ab
 Erneuerbare Energien Wärmegesetz (EEWärmeG) ab 01.01.2009 EEWärmeG Erneuerbare Energien sind seit dem 01.01.2009 Pflicht für die Wärmeversorgung im Neubau. EEWärmeG Gilt seit 01.01.2009 in ganz Deutschland
Erneuerbare Energien Wärmegesetz (EEWärmeG) ab 01.01.2009 EEWärmeG Erneuerbare Energien sind seit dem 01.01.2009 Pflicht für die Wärmeversorgung im Neubau. EEWärmeG Gilt seit 01.01.2009 in ganz Deutschland
Positionierung zur Zusammenführung von Energieeinspargesetz (EnEG)/Energieeinsparverordnung (EnEV) und Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz
 POSITIONSPAPIER Positionierung zur Zusammenführung von Energieeinspargesetz (EnEG)/Energieeinsparverordnung (EnEV) und Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) 23/05/2016 Allgemein Die angestrebte Zusammenführung
POSITIONSPAPIER Positionierung zur Zusammenführung von Energieeinspargesetz (EnEG)/Energieeinsparverordnung (EnEV) und Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) 23/05/2016 Allgemein Die angestrebte Zusammenführung
Änderungen der neuen EnEV und deren Auswirkungen auf die WEG
 Änderungen der neuen EnEV und deren Auswirkungen auf die WEG Dipl. Ing. (FH) Alexander Lyssoudis Energieberater, Sachverständiger nach ZVEnEV 1. Daten zur Energieversorgung 2. Der Begriff Energieeffizienz
Änderungen der neuen EnEV und deren Auswirkungen auf die WEG Dipl. Ing. (FH) Alexander Lyssoudis Energieberater, Sachverständiger nach ZVEnEV 1. Daten zur Energieversorgung 2. Der Begriff Energieeffizienz
Energieausweis. Einführung in Pflicht ab Inhalt und Zweck des Energieausweises. Fristen und Übergangsfristen
 Energieausweis Einführung in 2007 - Pflicht ab 2008 Ob als Energieausweis oder Energiepass bezeichnet: Ab 2008 müssen Verkäufer oder Vermieter im Falle eines geplanten Verkaufs oder einer Vermietung den
Energieausweis Einführung in 2007 - Pflicht ab 2008 Ob als Energieausweis oder Energiepass bezeichnet: Ab 2008 müssen Verkäufer oder Vermieter im Falle eines geplanten Verkaufs oder einer Vermietung den
17. Fachtagung ERDGAS UMWELT ZUKUNFT
 17. Fachtagung ERDGAS UMWELT ZUKUNFT Klimaschutz und Wärmeversorgung in der Zukunft Leipzig 28.01.2016 Prof. Dr.-Ing. Bert Oschatz Institut für Technische Gebäudeausrüstung Dresden Forschung und Anwendung
17. Fachtagung ERDGAS UMWELT ZUKUNFT Klimaschutz und Wärmeversorgung in der Zukunft Leipzig 28.01.2016 Prof. Dr.-Ing. Bert Oschatz Institut für Technische Gebäudeausrüstung Dresden Forschung und Anwendung
ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude
 Gültig bis: 2017 1 Hauptnutzung / Adresse teil Baujahr 2007 Baujahr Wärmeerzeuger 2007 Baujahr Klimaanlage 2007 Nettogrundfläche 9.051,6 Anlass der Ausstellung des Energiasuweises Bürogebäude Bockenheimer
Gültig bis: 2017 1 Hauptnutzung / Adresse teil Baujahr 2007 Baujahr Wärmeerzeuger 2007 Baujahr Klimaanlage 2007 Nettogrundfläche 9.051,6 Anlass der Ausstellung des Energiasuweises Bürogebäude Bockenheimer
