Aus der Medizinischen Kleintierklinik. Lehrstuhl für Innere Medizin der kleinen Haustiere und Heimtiere. der Tierärztlichen Fakultät
|
|
|
- Victor Lorenz
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Aus der Medizinischen Kleintierklinik Lehrstuhl für Innere Medizin der kleinen Haustiere und Heimtiere der Tierärztlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München Vorstand: Univ.-Prof. Dr. Katrin Hartmann Angefertigt unter der Leitung von: Prof. Dr. Katrin Hartmann Sensitivität und Spezifität von Serum-Ammoniak und Serum-Gallensäuren zur Diagnose portosystemischer Shunts bei Hunden und Katzen Inaugural-Dissertation zur Erlangung der tiermedizinischen Doktorwürde der Tierärztlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München von Kristina Ruland aus Ahrweiler München 2009
2 Gedruckt mit der Genehmigung der Tierärztlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München Dekan: Univ.-Prof. Dr. J. Braun Referent: Univ.-Prof. Dr. K. Hartmann Koreferent: PD Dr. H. Kaltner Tag der Promotion: 17. Juli 2009
3 Meiner Familie und meinem Verlobten
4 Inhaltsverzeichnis IV INHALTSVERZEICHNIS I. EINLEITUNG...1 II. LITERATURÜBERSICHT Definition Einteilung der Portosystemischen Shunts Angeborene Shunts Intrahepatische Shunts Extrahepatische Shunts Erworbene Shunts Prävalenz Prädispositionen Rasseprädispositionen Hunde Katzen Geschlechtsprädispositionen Altersprädispositionen Klinische Symptome Hepatoenzephales Syndrom Einteilung des Hepatoenzephalen Syndroms Pathophysiologie des Hepatoenzephalen Syndroms Ammoniak-Hypothese Gamma-Aminobuttersäure/Benzodiazepin-Hypothese Falsche-Neurotransmitter-Hypothese Begünstigende Faktoren Proteinzufuhr Störungen des Elektrolytgleichgewichts Infektionen Sedativa Gastrointestinale Symptome Vomitus Diarrhoe Symptome durch Veränderungen des Harntraktes...20
5 Inhaltsverzeichnis V Harnsteine Polydipsie/Polyurie Renomegalie Weitere Symptome Laborveränderungen Hämatologie Anämie Mikrozytose Poikilozytose Targetzellen Serumchemie Hypoalbuminämie Veränderungen der Cholesterolkonzentration Hypoglykämie Erniedrigte Harnstoffkonzentration Veränderung der Globulinkonzentration Anstieg der Leberenzymaktivitäten Veränderungen von Leberfunktionstests Ammoniak Messung des Serum-Ammoniaks Serum-Gallensäuren Messung der Serum-Gallensäuren Urinanalyse...34 III. IV. KAPITEL I: SENSITIVITY AND SPECIFICITY OF FASTED AMMONIA AND SERUM BILE ACIDS IN THE DIAGNOSIS OF PORTOSYSTEMIC SHUNTS IN DOGS AND CATS...35 KAPITEL II: PORTOSYSTEMIC SHUNTS IN CATS EVALUATION OF SIX CASES AND A REVIEW OF THE LITERATURE...57 V. DISKUSSION...78 VI. ZUSAMMENFASSUNG...92 VII. SUMMARY...94 VIII. LITERATURVERZEICHNIS...96
6 Inhaltsverzeichnis VI IX. LEBENSLAUF X. DANKSAGUNG...118
7 Abkürzungsverzeichnis VII ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS ADH ALT AST AS AP AUC Cl Dipl. ACVIM antidiuretisches Hormon Alanin-Amino-Transferase Aspartat-Amino-Transferase Aminosäuren Alkalische Phosphatase Area under the curve Chloridion Diplomate, American College of Veterinary Internal Medicine Dipl. ECVIM-CA Diplomate, European College of Veterinary Internal Medicine Companion Animals Dipl. ECVN Dipl. ECVS Dr. med. vet. EHD et al. GABA g Gln Glu habil. H + HES HMD kg Diplomate, European College of Veterinary Neurology Diplomate, European College of Veterinary Surgery Doktor der Vetrinärmedizin Extrahepatic disease (Extrahepatische Krankheit) et alii, et aliae (und andere) Gamma-Aminobuttersäure Gramm Glutamin Glutamat habilitiert Proton Hepatoenzephales Syndrom Hepatische mikrovaskuläre Dysplasie Kilogramm
8 Abkürzungsverzeichnis VIII l LMU mg n NH 3 NH 4 + p PD PHD p(nh 3 ) pp Prof. PSS ROC curve SBA µmol WSAVA Liter Ludwig-Maximilians-Universität München Milligramm number of samples (Anzahl der Proben) Ammoniak Ammoniumion Wahrscheinlichkeit Privatdozent Parenchymal hepatic disease (Krankheit des Leberparenchyms) Ammoniak-Partialdruck pages (Seiten) Professor Portosystemischer Shunt Receiver-operating characteristic Kurve Serum Bile Acids (Serum-Gallensäuren) Mikromol World Small Animal Veterinary Association z. B. zum Beispiel
9 I. Einleitung 1 I. EINLEITUNG In der Veterinärmedizin sind portosystemische Shunts (PSS) die häufigste Ursache für eine Hepatoenzephalopathie (TABOADA & DIMSKI, 1995). Die Diagnosestellung ist schwierig, da das klinische Bild mannigfaltig und das Routinelabor meist unauffällig ist. Die beiden Laborparameter Serum-Ammoniak und Serum-Gallensäuren geben erste Anhaltspunkte für einen PSS; von ihren Ergebnissen hängt der weitere Weg in der Diagnostik ab. Die Spezifität von Serum-Ammoniak und Serum-Gallensäuren zur Diagnose des PSS beim Hund wurde kürzlich untersucht (GERRITZEN-BRUNING, et al., 2006), eine entsprechende Studie bei Katzen und der Vergleich der Aussagekraft von Serum- Ammoniak und Serum-Gallensäuren als diagnostische Parameter für PSS zwischen Hunden und Katzen fehlen bislang. Ziel der Studie war daher, die Sensitivität und Spezifität ( overall diagnostic accuracy ) der beiden Laborparameter Serum-Ammoniak und Serum- Gallensäuren im Nachweis eines PSS zu bestimmen. Zudem sollten die beiden Parameter zwischen Hund und Katze verglichen und jeweils ein optimaler Cutoff-Wert, der die höchste Sensitivität und Spezifität erzielt, ermittelt werden. Dafür wurden alle Messungen von Serum-Ammoniak und Serum-Gallensäuren, die in einem Zeitraum von zehn Jahren (1996 bis 2006) in der Medizinischen Kleintierklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München bei Hunden und Katzen durchgeführt wurden, retrospektiv ausgewertet. Im zweiten Teil der Arbeit wurde eine deskriptive Analyse von Katzen mit PSS durchgeführt, da die letzte Fallbeschreibung von PSS bei Katzen mit medizinischem Fokus in Europa 20 Jahre zurückliegt (BLAXTER, et al., 1988). Die analysierten Daten des zweiten Teils umfassten Signalement, klinische Symptome, Laborwerte, bildgebende Diagnostik, Therapie und Verlauf.
10 II. Literaturübersicht 2 II. LITERATURÜBERSICHT 1. Definition PSS sind abnormale, kollaterale vaskuläre Verbindungen zwischen dem portalen und systemischen venösen Gefäßsystem (PAYNE, et al., 1990). Zwei bedeutende Konsequenzen resultieren aus diesen Shunt-Verbindungen: zum einen wird aus dem Verdauungstrakt stammendes Blut um die Leber herumgeführt und direkt in den systemischen Kreislauf geleitet. Dadurch entgehen im Darm produzierte Toxine (z. B. Ammoniak und andere Enzephalotoxine, intestinale Bakterien, Endotoxine) der Entgiftung durch die Leber (Umgehung des first-pass effects) und führen durch ihre Exposition im zentralen Nervensystem zum Krankheitsbild des hepatoenzephalen Syndroms (HES). Zum anderen kommt es zu einer Minderversorgung der Leber durch hepatotrophe Faktoren (Insulin und Insulin like growth Factor aus Darm und Pankreas) und Sauerstoff, mit dem die Leber vom Portalblut üblicherweise zu 50 % versorgt wird. Mikrohepathie und Leberfunktionsstörungen sind die Folge (PAYNE, et al., 1990). Zum ersten Mal fanden HICKMANN und Mitarbeiter (HICKMAN, et al., 1949) 1949 zufällig einen portoazygalen Shunt während der Obduktion eines infolge einer Brochopneumonie gestorbenen, zehn Monate alten Hunde-Mischlings. Die ersten Berichte über klinische Symptome, Laborveränderungen, bildgebende Diagnostik und pathologische Veränderungen bei Hund und Katze wurden darauf folgend in den 70er und 80er Jahren veröffentlicht (KHAN & VITUMS, 1971; EWING, et al., 1974; BARRETT, et al., 1976; MEYER, et al., 1978; VULGAMOTT, 1979; LEVESQUE, et al., 1982; ROTHUIZEN & VAN DEN INGH, 1982a; KOBLIK & HORNOF, 1983; CENTER, et al., 1985a; JOHNSON, et al., 1985; VULGAMOTT, 1985; BERGER, et al., 1986; CENTER, et al., 1986; MEYER, 1986; SCAVELLI, et al., 1986; WRIGLEY, et al., 1987a). Auch bei anderen Säugern wie Pferd, Fohlen, Kalb und Alpac Cria gibt es Beschreibungen von Anomalien der Portalvene (BEECH, et al., 1977; BUONANNO, 1988; REIMER, et al., 1988; HILLYER, et al., 1993; FORTIER, et al., 1996; IVANY, et al., 2002).
11 II. Literaturübersicht 3 2. Einteilung der Portosystemischen Shunts Portosystemische Shunts werden in angeboren/erworben und singulär/multipel unterschieden. Abhängig von ihrer Lokalisation innerhalb oder außerhalb des Leberparenchyms werden sie zusätzlich in intra- und extrahepatisch klassifiziert (PAYNE, et al., 1990; CULLEN, et al., 2006) (Abb. 1) Angeborene Shunts Angeborene Shunts können sowohl intra- als auch extrahepatisch vorliegen. Sie sind in der Regel singulär (PAYNE, et al., 1990, SZATMARI & ROTHUIZEN, 2006) Intrahepatische Shunts Intrahepatische Shunts resultieren aus einem fehlenden Schluss des Ductus venosus in den ersten zwei bis drei Lebenstagen. Daher sind sie meist im linken Leberlappen lokalisiert, können jedoch auch zentral (Lobus hepatis dexter medialis, Lobus quadratus) und in den rechtsseiten Leberlappen (Processus caudatus, Lobus hepatis dexter lateralis) vorkommen (ROTHUIZEN & VAN DEN INGH, 1982a; PAYNE, et al., 1990; LAMB, et al., 1996; WHITE & BURTON, 2000). Bei 6 bis 39 % der Hunde sind intrahepatische Shunts beschrieben. Meist sind große Rassen betroffen (VULGAMOTT, 1985; JOHNSON, et al., 1987; CENTER & MAGNE, 1990; HUNT, 2004). Intrahepatische Shunts sind bei der Katze selten. Sie sind bei etwa 10 bis 22 % der der Katzen mit PSS beschrieben (ROTHUIZEN & VAN DEN INGH, 1982a; BIRCHARD & SHERDING, 1992; LEVY, et al., 1995; WHITE, et al., 1996; HUNT, 2004) Extrahepatische Shunts Angeborene extrahepatische Shunts stellen Verbindungen zwischen der Portalvene oder einem ihrer Zuflüsse (Vena gastrica sinistra, Vena lienalis, Vena mesenterica cranialis und caudalis, Vena gastroduodenalis) und der Vena cava caudalis, Vena thoracica interna oder der Vena azygos (PAYNE, et al., 1990). Beim Hund entspringen extrahepatische Shunts meist aus der Vena lienalis oder Vena gastrica sinistra, bei Katzen besteht eine große Variabilität der verschiedenen Shuntverbindungen. Von extrahepatischen Shunts sind vornehmlich kleine Hunderassen betroffen, außerdem sind sie bei Hunden
12 II. Literaturübersicht 4 häufiger als bei Katzen zu finden (SZATMARI & ROTHUIZEN, 2006). Abb. 1. Shunt-Typen des Hundes (ROTHUIZEN & VAN DEN INGH, 1982a). 1. Vena mesenterialis cranialis, 2. Vena gastrosplenica, 3. Vena gastroduodenalis, 4. Vena portae, 5. linker Ast der Vena portae, 6. Vena cava cranialis, 7. Vena azygos. A = intrahepatischer rechter bestehender Ductus venosus, B = intrahepatischer linker bestehender Ductus venosus, C = portocavaler Shunt via Vena gastroduodenalis, D = portocavaler Shunt via Vena gastrosplenica, E = portoazygaler Shunt. S = Shuntgefäß Erworbene Shunts Erworbene Kollateralgefäße sind immer extrahepatisch. Sie sind als multiple, krumme Gefäße (1) im Mediastinum an der Kardia entspringend entlang des Oesophagus laufend (cardiooesophageale Anastomose), (2) kranial der linken Niere im Omentum zwischen Milz und Bauchwand (splenorenale Anastomose) und (3) im Mesokolon und Mesorektum (mesenterische Anastomose) zu finden. Erworbene PSS sind beim Hund häufig, bei der Katze selten zu finden (CULLEN, et al., 2006; SZATMARI & ROTHUIZEN, 2006).
13 II. Literaturübersicht 5 Erworbene Shunts entstehen durch die Reperfusion ehemals rudimentärer, nicht funktioneller Anastomosen zwischen dem portalen und systemischen, venösen Gefäßsystem. Ursächlich für diese Reperfusion ist eine portale Hypertension und der daraus entstehende Druckgradient zwischen der Portalvene und der systemischen, venösen Zirkulation. Erworbene Shunts sind daher beim Hund häufig mit Aszites verbunden. Portale Hypertension wird in prä-, intra- und posthepatische Hypertension eingeteilt. Posthepatische portale Hypertension infolge rechtsseitigen, kongenstiven Herzversagens ist jedoch nie mit der Bildung von Kollateralgefäßen assoziiert, da in diesem Fall kein Druckgradient zwischen der Portalvene und der Vena cava caudalis besteht, sondern sich der Druck in beiden Gefäßen erhöht. Prähepatische portale Hypertension kann sich infolge einer Kompression (durch eine Neoplasie oder eine Zyste) oder Obstruktion (durch einen Thrombus, einen Abszess oder eine Neoplasie) der Portalvene entwickeln. Intrahepatische portale Hypertension kann durch parenchymale, hepatische Erkrankungen (chronische Hepatitis, makro- oder mikronoduläre Zirrhose, biliäre Fibrose, portale Fibrose) oder durch eine primäre Hypoplasie der Portalvene verursacht werden. Die primäre Hypoplasie der Portalvene ist kongenital und kann sowohl intra- als auch extrahepatische Anteile der Vena portae betreffen. Ihre Diagnose basiert auf einer histologischen Untersuchung (CULLEN, et al., 2006; SZATMARI & ROTHUIZEN, 2006). Es wurde beobachtet, dass die portale Hypoplasie häufig mit arteriovenösen Fisteln vergesellschaftet ist. Diese stellen kongenitale, intrahepatische Verbindungen zwischen der Arteria hepatica und der Vena portae und führen zu retrogradem Blutfluss in die Portalvene. Sie sind sowohl beim Hund als auch bei der Katze beschrieben (LEGENDRE, et al., 1976; MOORE & WHITING, 1986). Die hepatische mikrovaskuläre Dysplasie (HMD) wurde lange als Sonderform des kongenitalen intrahepatischen Shunts betrachtet (BAER, et al., 1991; ALLEN, et al., 1999). Da sie das identische histologische Bild einer portalen Hypoperfusion zeigt, wurde dieses Krankheitsbild 2006 von der internationalen Liver Standardization Group in Kooperation mit der World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) in primäre portale Hypoplasie der Portalvene umbenannt (CULLEN, et al., 2006). Sie ist sowohl beim Hund als auch bei der Katze beschrieben, kommt aber selten vor (BAER, et al., 1991; SCHERMERHORN, et al., 1996; ALLEN, et al., 1999; CHRISTIANSEN, et al.,
14 II. Literaturübersicht ; D'ANJOU, et al., 2004). 3. Prävalenz Die aussagekräftigsten Daten zur Prävalenz von PSS bei Hunden und Katzen stammen aus zwei Multicenter-Studien mit Daten aus nordamerikanischen Tierkliniken (LEVY, et al., 1995; TOBIAS & ROHRBACH, 2003). Die Prävalenz von 2,5/10000 ist bei Katzen mit PSS (LEVY, et al., 1995) weitaus niedriger als bei Hunden mit 18/10000 (TOBIAS & ROHRBACH, 2003). Allerdings wird diese Krankheit seit den 80er Jahren mit Zunahme ihrer Kenntnis und Verbesserungen der diagnostischen Möglichkeiten (Ultraschall) öfter diagnostiziert (die Veterinary Medical Database of North American teaching hospitals verzeichnete einen Anstieg der Prävalenz von : 1/2000 im Jahr 1980 auf 1/200 im Jahr 2001) (TOBIAS & ROHRBACH, 2003). 4. Prädispositionen Die Rasse- und Geschlechtsprädispositionen wurden bei Hunden und Katzen untersucht. Eine tatsächliche genetische Ätiologie wurde bislang weder bei Hunden noch bei Katzen festgestellt (MARTIN, 1993; TOBIAS & ROHRBACH, 2003; HUNT, 2004) Rasseprädispositionen Rasseprädispositionen sind bei Hunden zahlreich beschrieben (ROTHUIZEN & VAN DEN INGH, 1982a; VULGAMOTT, 1985; JOHNSON, et al., 1987; BOSTWICK & TWEDT, 1995; VAN DEN INGH, et al., 1995; WOLSCHRIJN, et al., 2000) und in zwei groß angelegten Studien bei insgesamt über 2600 Hunden untersucht worden (TOBIAS & ROHRBACH, 2003; HUNT, 2004). Bei Katzen konnte keine Rasseprädisposition gesichert werden (MARTIN, 1993) Hunde In den Vereinigten Staaten wurde eine Prävalenz von PSS bei Hunden von 0,5 % bei folgenden Hunderassen festgestellt: Havanese, Yorkshire Terrier, Malteser, Dandie Dinmont Terrier, Mops, Zwergschnauzer, Shi Tzu, Berner
15 II. Literaturübersicht 7 Sennenhund, Bichon Frise, Cairn Terrier, Irischer Wolfshund und Langhaardackel (Tab. 1) (TOBIAS & ROHRBACH, 2003). In Australien wurde von einer Prädisposition bei Maltesern und bei Australian cattle dogs berichtet (MADDISON, 1992; TISDALL, et al., 1994). Von kongenitalen extrahepatischen Shunts sind typischerweise kleine Rassen betroffen, während kongenitale intrahepatische Shunts hingegen vorwiegend bei größeren Hunden zu finden sind. Eine jährlich ansteigende Prävalenz und familiäre Tendenzen von PSS wurde bei Yorkshire Terriern (TOBIAS, 2003), Irischen Wolfshunden (UBBINK, et al., 1989; MEYER, et al., 1995; UBBINK, et al., 1998), Cocker Spaniels (RAND, et al., 1988) und Cairn Terriern (VAN STRATEN, et al., 2005) beobachtet Katzen Bei Katzen kommen PSS zu 70 % bei Europäischen Kurzhaarkatzen vor (MARTIN, 1993), eine tatsächliche Prädisposition bei Europäischen Kurzhaarkatzen konnte jedoch nicht bewiesen werden (BLAXTER, et al., 1988; CENTER & MAGNE, 1990; HOLT, et al., 1995; LEVY, et al., 1995; LAMB, et al., 1996; HAVIG & TOBIAS, 2002; TILLSON & WINKLER, 2002; TOBIAS & ROHRBACH, 2003; HUNT, 2004). Zu den Rassekatzen, bei denen ein PSS beschrieben wurde, gehören Perser-, Himalaya-, Siam-, Burma- und Havannah- Katzen (BERGER, et al., 1986; SCAVELLI, et al., 1986; HOLT, et al., 1995; WHITE, et al., 1996; HUNT, 2004). HUNT (2004) berichtet von einer signifikanten Überrepräsentation von Himalaya Katzen, während in einer Studie von LEVY und BUNCH (1992) Himalaya- und Perserkatzen mit je 23 % der Rassekatzen mit PSS am häufigsten vertreten waren. Bei Katzen sind die Gefäßanomalien zumeist angeboren, extrahepatisch und singulär. Erworbene Shunts sind beschrieben, aber viel seltener als bei Hunden (LANGDON, et al., 2002).
16 II. Literaturübersicht 8 Tab. 1. Rasseverteilung von Hunden mit kongenitalen, portosystemischen Shunts (modifiziert nach TOBIAS (2003), Veterinary Medical Database of North American Teaching Hospitals von 1/1980 bis 2/2002). (n = Anzahl der Hunde). Rasse Klinikpopulation (n) Tiere mit PSS (n) Tiere mit PSS (%) Havanese ,20 Yorkshire Terrier ,90 Maltese ,60 Dandie Dinmont Terrier ,60 Mops ,30 Zwergschnauzer ,00 Schnauzer ,82 Shi Tzu ,78 Berner Sennenhund ,76 Bichon Frise ,67 Cairn Terrier ,54 Irischer Wolfshund ,50 Langhaardackel ,50 Jack Russel Terrier ,43 Pekinese ,36 Zwergpinscher ,36 West Highland White Terrier ,31 Pomeranian ,29 Lhasa Apso ,28 Altenglischer Schäferhund ,26 Schottischer Schäferhund ,26 Chihuahua ,25 Schottischer Terrier ,23 Zwergdackel ,20 Pudel ,17 Zwergpudel ,16 Beagle ,16 Samoyede ,15 Golden Retriever ,14 Cocker Spaniel ,14 Dobermann Pinscher ,14 Sibirischer Husky ,13 Labrador Retriever ,10 Mischling , Geschlechtsprädispositionen Eine gesicherte Geschlechtsprädispositon konnte weder bei Hunden noch bei Katzen festgestellt werden. Bei Hunden mit PSS allerdings überwiegen weibliche Tiere (WHITE, et al., 1998; TOBIAS & ROHRBACH, 2003), während bei
17 II. Literaturübersicht 9 Katzen die männlichen Tiere häufiger betroffen sind (SCAVELLI, et al., 1986; BLAXTER, et al., 1988; BIRCHARD & SHERDING, 1992; HOLT, et al., 1995; WHITE, et al., 1996). In drei Publikationen jedoch wird von einer Geschlechter- Proportion von sieben Katzen versus vier Katern (HOLT, et al., 1995), zwölf Katzen versus elf Katern (KYLES, et al., 2002) und fünf Katzen versus vier Katern (HUNT, 2004) berichtet Altersprädispositionen Die meisten Tiere mit einer Gefäßanomalie sind zum Zeitpunkt der Diagnosestellung noch Welpen oder Jungadulte. Hunde sind bei Vorstellung in der Regel jünger als zwei Jahre (JOHNSON, et al., 1987; CENTER & MAGNE, 1990; KOMTEBEDDE, et al., 1991; BOSTWICK & TWEDT, 1995; WHITE, et al., 1998; WINKLER, et al., 2003), während die meisten Katzen jünger als ein Jahr sind (BIRCHARD & SHERDING, 1992, LEVY, et al., 1995). Die klinischen Symptome beginnen jedoch meist schon deutlich früher (CENTER & MAGNE, 1990). Von Hunden und Katzen mit kongenitalem PSS, die erst im Erwachsenenalter vorgestellt wurden, ist ebenfalls berichtet (VULGAMOTT, 1985; BERGER, et al., 1986; SCAVELLI, et al., 1986; BOSTWICK & TWEDT, 1995; HOLT, et al., 1995; VAN DEN INGH, et al., 1995; LAMB, et al., 1996; SCHUNK, 1997), einige Tiere waren bei Vorstellung sogar schon zehn Jahre alt und älter (BLAXTER, et al., 1988; JOHNSON, et al., 1989; TOBIAS & ROHRBACH, 2003). 5. Klinische Symptome Symptome, die Tiere mit PSS zeigen können, sind neurologischen, gastrointestinalen und urologischen Ursprungs und resultieren aus der Leberinsuffizienz. Die Symptome der Hepatoenzephalopathie überwiegen. Häufig kümmern die Tiere und sind infolge reduzierter Futteraufnahme und gastrointestinaler Malabsorption kachektisch (WEBSTER, 2005). Vor allem die neurologischen Symptome kommen intermittierend vor und verschlimmern sich häufig nach den Aufnahme von Nahrung, besonders nach proteinreicher Nahrung (MARTIN, 1993).
18 II. Literaturübersicht Hepatoenzephales Syndrom Das hepatoenzephale Syndrom (HES) ist eine neuropsychiatrische Störung infolge fehlender Entgiftung toxischer Metaboliten durch die Leber (MADDISON, 1992). Diese toxischen Metaboliten kommen vor allem aus dem Gastrointestinaltrakt. Zwei Hauptmechanismen führen zu dieser Exposition durch Neurotoxine; hochgradiges Leberversagen und die Umleitung portalen Blutes in den systemischen Kreislauf ohne hepatische Detoxifikation (PSS) (HÄUSSINGER, et al., 2000; CORDOBA & BLEI, 2003). Das HES äußert sich klinisch in Anfallsleiden, Ataxie, Bewusstseinstrübung (Somnolenz, Stupor, Koma), Wesensänderung (Depression, Kläffen, starrer Blick, Fliegenschnappen, und, vor allem bei der Katze, Aggression), Drangwandern, Laufen gegen Gegenstände, Kopf-an-die-Wand-Pressen und zentraler Blindheit (SCAVELLI, et al., 1986; BLAXTER, et al., 1988; CENTER & MAGNE, 1990; HARDY, 1990; VANGUNDY, et al., 1990; BIRCHARD & SHERDING, 1992; MADDISON, 1992; HOLT, et al., 1994; LAMB, et al., 1996; SCHUNK, 1997; KYLES, et al., 2002; TILLSON & WINKLER, 2002; WINKLER, et al., 2003). Bei Hunden ist zudem starker Juckreiz beschrieben (CENTER & MAGNE, 1990). Etwa 75 % der Katzen mit PSS zeigen Hypersalivation, daher sollte dieses Symptom bei einer Katze unbedingt an eine Hepatoenzephalopathie denken lassen (BERGER, et al., 1986; SCAVELLI, et al., 1986; BLAXTER, et al., 1988; CENTER & MAGNE, 1990; VANGUNDY, et al., 1990; MARTIN, 1993; LEVY, et al., 1995; TABOADA & DIMSKI, 1995; HAVIG & TOBIAS, 2002) Einteilung des Hepatoenzephalen Syndroms Die Consensus-Konferenz über die Nomenklatur der Hepatoenzephalopathie (Wien, 1998) hat die klassische West Haven Grading Scale zur Einteilung des HES in vier Grade vorgeschlagen (Tab. 2).
19 II. Literaturübersicht 11 Tab. 2. Klassifikation der Hepatoenzephalopathie (nach FERENCI, 2002). Grad 1 unbedeutende Bewusstseinstrübung Euphorie oder Angst verkürzte Aufmerksamkeitsspanne Grad 2 Lethargie oder Apathie geringgradige Orientierungslosigkeit in Raum und Zeit geringgradige Änderung der Persönlichkeit unpassendes Verhalten Grad 3 Somnolenz oder Semistupor, aber Reaktion auf vertebrale Stimuli Verwirrtheit hochgradige Orientierungslosigkeit Grad 4 Koma In Anlehnung an die Glasgow Koma Skala aus der Humanmedizin haben PLATT und Mitarbeiter (2001) eine Komaskala für Kleintiere entwickelt (Tab. 3). Diese kann alternativ zu der West Haven Grading Scale eingesetzt werden (PLATT, et al., 2001) Pathophysiologie des Hepatoenzephalen Syndroms Die Pathophysiologie der Hepatoenzephalopathie ist trotz intensiver Nachforschungen noch nicht endgültig geklärt (FAINT, 2006; MAS, 2006). Man geht jedoch davon aus, dass die Hepatoenzephalopathie Folge gestörter Neurotransmissionen und Umstellung der Astrozytenfunktion mit nachfolgender gestörter glianeuronaler Kommunikation ist (HÄUSSINGER, 2006). Da das HES funktioneller Natur ist, ist es potentiell reversibel (HÄUSSINGER, 2006). In der Humanmedizin ist Leberzirrhose und eine daraus resultierende portale Hypertension mit erworbenem PSS die häufigste Ursache eines HES (MAS, 2006), während in der Veterinärmedizin angeborene PSS am häufgsten sind (VULGAMOTT, 1985; MARTIN, 1993; TABOADA & DIMSKI, 1995).
20 II. Literaturübersicht 12 Tab. 3. Modifzierte Glasgow Kleintierkomaskala (nach PLATT et al, 2001). Motorik normaler Gang, normale spinale Reflexe 6 Hemiparese, Tetraparese oder decerebrate activity 5 Seitenlage, Gliedmaßen nur zeitweise in Streckstellung 4 Seitenlage, Gliedmaßen in Streckstellung 3 Seitenlage, Gliedmaßen in Streckstellung und Opistotonus 2 Seitenlage, reduzierter Muskeltonus, reduzierte oder fehlende spinale Reflexe 1 Hirnstammreflexe normaler Pupillarreflex, normale occulozephale Reflexe 6 reduzierter Pupillarreflex, normale/reduzierte occulozephale Reflexe 5 bilaterale Miosis, kein Pupillarreflex, normale/reduzierte occulozephale Reflexe 4 stecknadelkopfgroße Pupillen, reduzierte/fehlende occulozephale Reflexe 3 unilaterale Mydriasis, kein Pupillarreflex, reduzierte/fehlende occulozephale Reflexe 2 bilaterale Mydriasis, kein Pupillarreflex, reduzierte/fehlende occulozephale Reflexe 1 Bewusstsein gelegentlich aufmerksam, reagiert auf Umgebung 6 Depression oder Delirium, reagiert auf Umgebung, aber nicht adäquat 5 semikomatös, reagiert auf visuelle Stimuli 4 semikomatös, reagiert auf akkustische Stimuli 3 semikomatös, reagiert nur auf wiederholte Schmerzreize 2 komatös, reagiert nicht auf Schmerzreize 1 Prognose Punktzahl 3 8 Punktzahl 9 14 Punktzahl schlecht ungünstig - vorsichtig gut
21 II. Literaturübersicht 13 Aktuell bestehen drei Haupttheorien über die Pathophysiologie des HES: (1) die Ammoniak-Hypothese mit synergistischen Effekten zusätzlicher, aus dem Intestinum stammender Neurotoxine (Merkaptane, kurz- und mittelkettige Fettsäuren und Phenole), (2) die Gamma-Aminobuttersäure-(GABA-)/Benzodiazepin-Hypothese und (3) die falsche-neurotransmitter-hypothese auf der Basis von Konzentrationsveränderungen verzweigtkettiger und aromatischer Aminosäuren. In allen Fällen kommt es zu Veränderungen in der Neurotransmission, die eine große Rolle in der Entwicklung der neurologischen Störungen spielen. Ammoniak spielt eine Schlüsselrolle in allen drei Theorien (MAS, 2006). Ammoniak stört das dynamische Gleichgewicht zwischen dem GABA-Stoffwechsel und der Synthese von Glutamin und Glutamat. Verschiebungen in der Konzentration des Glutamins ziehen Verschiebungen der Konzentration des Glutamat nach sich und anders herum (MADDISON, 1992) Ammoniak-Hypothese Ammoniak hat als primäres Neurotoxin sowohl auf exzitatorische als auch auf inhibitorische Neurotransmitter Einfluss (BUTTERWORTH, 2000). Verschiedene Gründe sprechen für die Bewertung von Ammoniak als Haupt-Neurotoxin. Ammoniak wird zu 75 % im Kolon von der intestinalen Flora durch Harnstoffbildende, anaerobe Bakterien und coliforme Keime gebildet (CENTER & MAGNE, 1990). Die Konzentration von Ammoniak ist im Portalblut am höchsten. Bei normaler Leberfunktion werden % des portalen Ammoniaks durch die Leber extrahiert und im Harnstoffzyklus entgiftet. Die Mehrheit der infolge Leberversagen erkrankten Patienten mit HES sind hyperammonämisch und können durch therapeutische Maßnahmen zur Erniedrigung der Ammoniak- Konzentration im Blut sehr effektiv behandelt werden (CORDOBA & BLEI, 2003; MAS, 2006). Es gibt viele Erklärungen, auf welchem Weg Ammoniak die Funktionsabläufe des Gehirns verändern kann. Am weitesten verbreitet ist die These, dass Ammoniak zu einer Energie-Unterversorgung im Gehirn führt und Veränderungen in der Neurotransmission hervorruft. Zudem werden eine Erhöhung der Permeabilität der Blut-Hirn-Schranke für Aminosäuren und Veränderungen des Rezeptorbesatzes gefunden (MAS, 2006). In hyperammonämischen Zuständen wird Ammoniak durch die Zellen des
22 II. Literaturübersicht 14 Nervensystems vermehrt aufgenommen. Im Nervensystem aufgenommer Ammoniak wird in den Astrozyten in einer energieabhängigen Reaktion durch die Glutaminsynthetase unter Bildung von Glutamin an Glutamat gebunden und entgiftet. Dadurch akkumuliert Glutamin intrazellulär. Aus dem Anstieg der intrazellulären Konzentration des osmotisch wirksamen Glutamins in den Astrozyten resultiert eine Schwellung durch Wassereinstrom (Abb. 2.). Dadurch degenerieren langsam die Astrozyten. Dies zeigt sich morphologisch in der sogenannten Alzheimer-Typ-II-Degeneration. Astrozyten (=Makroglia) sind sternförmige Neurozyten mit zahlreichen Zellfortsätzen, die mit Neuronen und mikrovaskulären Endothelzellen strukturell und funktionell in enger Verbindung stehen und mit ihrer Gliagrenzmembran (Membrana limitans gliae superficialis und perivascularis) einen Teil der Blut- Hirn-Schranke bilden. Zusammen mit den Oligodenrozyten (= Oligodendroglia) und den Hortega-Zellen (= Mikroglia) stellen sie einen großen Anteil des Hüllund Stützgewebe des Nervensystems (= Neuroglia). Astrozyten erfüllen nutritive Funktionen und sind maßgeblich an der Aufrechterhaltung der Homöostase der Ionen- und Neurotransmitter-Konzentrationen im extrazellulären Raum des zentralen Nervensystems beteiligt. Mithilfe ihrer Zellfortsätze erfolgt ein reger Stoffaustausch mit anderen Neuronen über die Kontakte zu den Blutgefäßen. (HÄUSSINGER, et al., 2000; CORDOBA & BLEI, 2003). Neben dem Überangebot von intrazellulärem Glutamin kommt es zu einem Glutamat-Mangel und infolge dessen zu einem chronischen Mangel an Glutamat. Glutamat ist der wichtigste exzitatorische Neurotransmitter (BUTTERWORTH, 2000; CORDOBA & BLEI, 2003). Die Astrozytenschwellung unterdrückt die Genexpression des astrozytären Glutamat-Transporters, infolge dessen Glutamat im extrazellulären Raum im synaptischen Spalt kumuliert und die glutamaterge Neurotransmission stört (Abb. 2.). Zusätzlich beeinträchtigt Ammoniak den astrozytären Zitrat-Zyklus durch Hemmung der Ketoglutarat-Dehydrogenase und behindert so die Energiegewinnung der Astrozyten (BUTTERWORTH, 2000; CORDOBA & BLEI, 2003). Die Rolle oben genannter, intestinaler Substanzen als zusätzliche Neurotoxine (Mercaptane, kurz- und mittelkettige Fettsäuren und Phenole) ist noch nicht ganz geklärt, ihnen werden aber synergistische Effekte auf Ammoniak zugesprochen (BUTTERWORTH, 2000; JONES, 2002; CORDOBA & BLEI, 2003; MAS, 2006).
23 II. Literaturübersicht 15 Abb. 2. Schwellung der Astrozyten bei Hyperammonämie (CORDOBA & BLEI, 2003). (Gln = Glutamin, Glu = Glutamat, NH 3 = Ammoniak) Gamma-Aminobuttersäure/Benzodiazepin-Hypothese GABA ist der Hauptinhibitor der Neurotransmission (TABOADA & DIMSKI, 1995). Die hemmende Wirkung wird über spezifische GABA-Rezeptorkomplexe vermittelt. Diese sind für Chlorid- und Bikarbonat-Ionen durchlässig. GABA- Rezeptorkomplexe kommen an Neuronen und Astrozyten vor. Neben einer Bindungsstelle für GABA besitzt der GABA-Rezeptorkomplex weitere Bindungsstellen für Benzodiazepine, Barbiturate und Neurosteroide. Die inhibitorische Wirkung wird durch einen Chlorid-Einstrom über die postsynaptische Membran mit nachfolgender Hyperpolarisation vermittelt (MADDISON, 1992) (Abb. 3). Die inhibitorische Wirkung kann durch zusätzliche Bindung Benzodiazepin-ähnlicher Substanzen verstärkt werden. (HARDY, 1983). Im enzephalopathischen Patienten aktiviert die Astrozytenschwellung eine vermehrte Expression von GABA-Rezeptoren. Die Folge der vermehrten Expression der peripheren GABA-Rezeptoren in den Astrozyten ist eine Induktion der Synthese von Neurosteroiden, die die
24 II. Literaturübersicht 16 inhibitorische Neurotransmission durch GABA verstärken (BUTTERWORTH, 2000; CORDOBA & BLEI, 2003). Im hepatoenzephalopathischen Zustand wird GABA außerdem vermindert in die Astrozyten aufgenommen, was zu einer Akkumulation von GABA im synaptischen Spalt führt. Im Rahmen der agonistischen Effekte auf GABA-gesteuerte inhibitorische Neurotransmissionen und des Glutamatmangels kann es bis zum Koma kommen (ARONSON, et al., 1997). Abb. 3. Der Gamma-Aminobuttersäure-(GABA-)/Benzodiazepin-Rezeptorkomplex (TABOADA & DIMSKI, 1995). (A = inaktiver Rezeptorblock mit nicht gebundenem GABA; B = Aktivierung des Rezeptors durch Bindung von GABA oder GABA-ähnliche Stoffe mit nachfolgendem Einstrom von Chloridionen durch den Chloridkanal und Hyperpolarisation der Zelle) Falsche-Neurotransmitter-Hypothese In der falsche-neurotransmitter-hypothese spielt die Zusammensetzung der Aminosäuren im Blut eine entscheidende Rolle. Die Konzentrationen der aromatischen Aminosäuren Tyrosin, Phenylalanin und Tryptophan steigen im
25 II. Literaturübersicht 17 hepatoenzephalopatischen Zustand an, während die Konzentrationen der verzweigtkettigen Aminosäuren Valin, Leucin und Isoleucin abfallen (MADDISON, 1992). Die Konzentrationen aromatischer Aminosäuren sind erhöht, weil sie in der Leber vermindert abgebaut werden, während die Konzentrationen verzweigtkettiger Aminosäuren erniedrigt sind, da sie in extrahpatischen Geweben wie Muskulatur- und Fettzellen vermehrt katabolisiert werden. Das molare Verhältnis verzweigtkettiger zu aromatischer Aminosäuren liegt bei gesunden Hunden bei 3,5, während es bei Hunden mit Hepatoenzephalopathie häufig auf 1 1,5 sinkt (VULGAMOTT, 1985). Die aromatischen und verzweigtkettigen Aminosäuren konkurrieren an der Blut-Hirn- Schranke um das gleiche Carrier-System. Da aromatische Aminosäuren im hepatoenzephalopatischen Zustand jedoch in höheren Konzentrationen vorliegen, gelangen sie vermehrt in das Gehirn. Eine erhöhte Aufnahme der aromatischen Aminosäuren wiederum hemmt die intrazerebrale Synthese der exzitatorischen Neurotransmitter Dopamin und Noradrenalin. Stattdessen werden vermehrt so genannte falsche inaktive Neurotransmitter Phenylethanolamin und Octopamin, dessen Vorstufe Tyramin sowie der inhibitorische Neurotransmitter Serotonin gebildet (Abb. 4.). Diese falschen Neurotransmitter sind in der Lage, an entsprechende Rezeptoren zu binden und inhibitorische Transmissionen auszulösen (JAMES, 2002; FAINT, 2006). Ammoniak ist auch in dieser Theorie in die Entstehung des HES verwickelt. In hyperammonämischen Zuständen werden verzweigtkettige Aminosäuren im Ammoniak-Stoffwechsel durch die Synthese von Glutamin aus Ammoniak und Glutamat verbraucht und es kommt daher zusätzlich zu erniedrigten Konzentrationen dieser Aminosäuren (JAMES, 2002).
26 II. Literaturübersicht 18 Abb. 4. Entstehung falscher Neurotransmitter. (AS = Aminosäuren) Begünstigende Faktoren Die Entstehung des HES kann durch verschiedene Faktoren begünstigt und verschlimmert werden. Hierzu zählen Störungen des Elektrolygleichgewichtes, gastrointestinale Blutungen, proteinreiche Nahrung, Infektionen, Konstipation und einige Sedativa (TABOADA & DIMSKI, 1995; FAINT, 2006; MAS, 2006) Proteinzufuhr Die Aufnahme großer Mengen an Protein kann bei PSS zu Hyperammonämie führen. Eine hohe Proteinaufnahme ist bei proteinreicher Nahrung, aber auch bei gastrointestinalen Blutungen gegeben. Letztere führen zudem zu einer erhöhten Absorption GABA-ähnlicher Stoffe, die wie GABA eine hemmende Wirkung über die GABA-Rezeptorkomplexe vermitteln können. Konstipation begünstigt infolge der längeren Passagezeit der Ingesta direkt eine erhöhte Ammoniak- Aufnahme aus dem Darm. (HARDY, 1983) Störungen des Elektrolytgleichgewichts Hypokaliämie entsteht häufig bei Patienten mit PSS, z. B. durch Verlust infolge
27 II. Literaturübersicht 19 Vomitus, Diarrhoe, Polydipsie/Polyurie oder durch verminderte Zufuhr bei Anorexie. Hypokaliämie greift in die Säure-Base-Homöostase ein mit nachfolgender Alkalose. Bei Hypokaliämie vermindert sich die Aktivität der Natrium-Kalium-Pumpe mit nachfolgendem Anstieg der intrazellulären Natrium- Konzentration. Durch den intrazellulären Anstieg von Natrium wird infolge des niedrigeren Konzentrationsgefälles für Natrium von intra- nach extrazellulär der Auswärtstransport der Protonen im Austausch mit Natrium gehemmt. Daher kommt es zu einer Verschiebung von Protonen von extra- nach intrazellulär mit dem Ergebnis einer extrazellulären Alkalose und einer intrazellulären Azidose (FORTH, et al., 2006). Das HES wird bei Hypokaliämie begünstigt, da in alkalotischen Zuständen die molekulare Form des Ammoniak überwiegt, welche besser durch Zellmembranen oder über die Blut-Hirn-Schranke diffundieren kann als die ionisierte Form (NH 3 gegenüber NH + 4 ) ( ROTHUIZEN & VAN DEN INGH, 1982b; YURDAYDIN, 2003) Infektionen Auf welchem Wege Infektionen in die Entstehung des HES verwickelt sind, ist noch nicht geklärt. Es wird eine gesteigerte Wirkung des zerebralen Effekts von Ammoniak durch inflammatorische Substanzen (Interleukin-6, Interleukin-β1 und Tumor-Nekrose-Faktor) vermutet (ROLANDO, et al., 2000; SHAWCROSS, et al., 2004) Sedativa Der GABA-Rezeptorkomplex besitzt neben einer Bindestelle für GABA weitere Bindestellen für Benzodiazepine, Barbiturate und Neurosteroide. Daher kann die inhibitorische Wirkung der GABA-Rezeptorkomplexe durch zusätzliche Bindung Benzodiazepin-ähnlicher Substanzen oder Barbiturate verstärkt werden. (HARDY, 1983). Aufgrund des erhöhten GABA-ergen Tonus im Fall einer Hepatoenzephalopathie kann somit die Sedierung mit Benzodiazepinen und Barbituraten das HES auslösen oder verschlimmern (FAINT, 2006; MAS, 2006) Gastrointestinale Symptome Symptome gastrointestinaler Art sind häufig unspezifisch und äußern sich zumeist in Vomitus, Diarrhoe, und Polyphagie (VULGAMOTT, 1985; SCAVELLI, et al., 1986; BLAXTER, et al., 1988; CENTER & MAGNE, 1990; VANGUNDY, et al., 1990; BIRCHARD & SHERDING, 1992; MARTIN, 1993; HOLT, et al., 1994;
28 II. Literaturübersicht 20 LAMB, et al., 1996; SCHUNK, 1997; KYLES, et al., 2002; TILLSON & WINKLER, 2002). Etwa 30 % der Hunde mit PSS zeigen gastrointestinale Symptome (JOHNSON, et al., 1987), bei Katzen ist ihr Auftreten mit weniger als 10 bis 71 % beschrieben (LEVY, et al., 1995; LAMB, et al., 1996; SCHUNK, 1997; HAVIG & TOBIAS, 2002) Vomitus Die Entstehung von Vomitus bei Patienten mit PSS erfolgt über das Brechzentrum und die Chemorezeptor-Trigger-Zone. Das Brechzentrum liegt in der Nähe der Area postrema innerhalb der Blut-Hirn-Schranke. Die ihm vorgeschaltete Chemorezeptor-Trigger-Zone liegt außerhalb der Blut-Hirn-Schranke in der Area postrema am Boden des vierten Ventrikels und führt durch Aktivierung afferenter Nervenimpulse zur Erregung des Brechzentrums (FORTH, et al., 2006). Die bei PSS um die Leber herumgeführten toxischen Metaboliten stimulieren sowohl das Brechzentrum direkt als auch die Chemorezeptor-Trigger-Zone (WEBSTER, 2005) Diarrhoe Diarrhoe entsteht bei Tieren mit PSS häufig infolge gleichzeitiger entzündlicher Veränderungen im Darm mit nachfolgender sekretorischer Diarrhoe. Eine Malabsorption durch Transportstörungen infolge enteraler vaskulärer Beeinträchtigung bei portaler Hypertension ist ein weiterer Pathomechanismus für die Genese der Dünndarm-Diarrhoe bei Tieren mit PSS (WEBSTER, 2005) Symptome durch Veränderungen des Harntraktes Zu den Veränderungen des Harntraktes gehören die Bildung von Harnsteinen mit ihren nachfolgenden Symptomen (CENTER & MAGNE, 1990; MARTIN, 1993; TILLSON & WINKLER, 2002) und die Entstehung einer Renomegalie (VULGAMOTT, 1985; CENTER & MAGNE, 1990; TISDALL, et al., 1996). Häufig tritt auch Polyurie/Polydipsie auf (GRAUER & PITTS, 1987; SCAVELLI, 1989; CENTER & MAGNE, 1990; MARTIN, 1993) Harnsteine Patienten mit PSS entwickeln infolge Hyperuratämie und Hyperammonämie häufig eine (Ammoniumbi-)Urat-Kristallurie oder (Ammoniumbi-)Urat- Urolithiasis. Im Proteinabbau entstehendes Urat wird bei gesunden Tieren mittels
29 II. Literaturübersicht 21 hepatischer Urikase zum löslichen Allantoin abgebaut, das über die Nieren ausgeschieden werden kann. Durch die hepatische Dysfunktion bei Tieren mit PSS findet eine Umwandlung von Urat in Allantoin und eine Umwandlung von Ammoniak in Harnstoff nicht mehr ausreichend statt. Die Folge ist eine vermehrte Ausscheidung von Urat und Ammoniak im Urin und Ausfällung von Kristallen oder Steinen, da Ammoniak und Urat deutlich schlechter löslich sind als Harnstoff und Allantoin (BARTGES, et al., 1999). Ammoniumbiurat- oder Uratsteine, die sich infolge der Leberinsuffizienz im Harntrakt bilden, führen durch die mechanische Reizung zu Strangurie, Pollakisurie und Hämaturie (CENTER & MAGNE, 1990; MARTIN, 1993; TILLSON & WINKLER, 2002). Sie treten unabhängig vom Urin-pH auf und sind nur teilweise röntgendicht (HARDY, 1983; VULGAMOTT, 1985; VANGUNDY, et al., 1990; LEVY, et al., 1995; HARVEY & ERB, 1998). Sie kommen bei 64 % der Tiere mit PSS vor (VULGAMOTT, 1985). Das Auftreten von Uratsteinen ist sonst vorwiegend bei Dalmatinern bekannt. Daher haben sie hohe diagnostische Relevanz (VULGAMOTT, 1985). Beim Dalmatiner wird aufgrund eines autosomal rezessiv vererbten Defekts der Urikase nur ein Bruchteil des Urats in der Leber zu Allantoin abgebaut (LING, et al., 1998) Polydipsie/Polyurie Polydipsie/Polyurie ist bei Hunden und Katzen mit PSS beschrieben (GRAUER & PITTS, 1987; SCAVELLI, 1989; CENTER & MAGNE, 1990; MARTIN, 1993). Es wird zwischen primärer Polydipsie und primärer Polyurie unterschieden. Die genaue Ursache der primären Polydipsie bei Tieren mit PSS ist nicht geklärt. Möglich sind sowohl eine psychogene Polydipsie im Zusammenhang mit den Veränderungen der Neurotransmitter-Zusammensetzung und der direkten Stimulation des Durstzentrums in hepatoenzephalopatischen Zuständen als auch Veränderungen der Osmorezeptoren in der Vena portae (EWING, et al., 1974; GRAUER & PITTS, 1987). Sekundäre Polyurie mit Hypostenurie ist die Folge. Die Nieren sind jedoch in der Lage, Urin zu konzentrieren. In zwei Studien wurde ein Urin-Konzentrationstest bei Hunden mit PSS durchgeführt; drei von fünf, und fünf von elf Hunden konnten nach Wasserentzug ihren Urin konzentrieren. Somit war der Verdacht einer primären (psychogenen) Polydipsie bestätigt. Bei den Patienten, die ihren Urin nicht konzentrieren konnten, wurde ein medullary washout sekundär zur primären Polydipsie oder eine primäre Polyurie vermutet
30 II. Literaturübersicht 22 (EWING, et al., 1974; GRAUER & PITTS, 1987). Eine primäre Polyurie kann bei Tieren mit PSS durch Abnahme des Konzentrationsgradienten in der Niere oder infolge Hypokaliämie und Hyperkortisolämie entstehen (EWING, et al., 1974; GRAUER & PITTS, 1987; MEYER & ROTHUIZEN, 1994; STERCZER, et al., 1999). Die Verminderung des Konzentrationsgradienten in der Niere resultiert aus der verminderten Synthese von Harnstoff in der Leber, während Hypokaliämie häufig bei Patienten mit PSS durch Vomitus, Diarrhoe, Anorexie oder Polydipsie/Polyurie entsteht. Hypokaliämie führt zu einer geringeren Ansprechbarkeit von antidiuretischem Hormon (ADH) an dem ADH-Rezeptor in der Niere mit nachfolgender Polyurie (GRAUER & PITTS, 1987; CENTER & MAGNE, 1990). Hyperkortisolämie entsteht bei Tieren mit PSS durch vermehrte Bildung von adrenokortikotropem Hormon infolge Überstimulation der Hypophyse oder verminderten Abbaus von Steroiden in der Leber. Kortisol führt, wie Hypokaliämie, zu einer geringeren Ansprechbarkeit von ADH an den ADH-Rezeptoren in der Niere (EWING, et al., 1974; GRAUER & PITTS, 1987) Renomegalie Renomegalie wurde sowohl bei Hunden als auch bei Katzen mit PSS beobachtet (VULGAMOTT, 1985). Ihre Ursache ist allerdings unklar. Da die Niere im hyperammonämischen Zustand in der Glutaminsynthese vermehrt Ammoniak entgiftet und vermehrt Glukoneogenese zur Energiegewinnung betreibt, wird eine Vergrößerung der Nieren durch Arbeitshypertrophie diskutiert. Zudem ist eventuell eine vermehrte Durchblutung durch Volumenüberladung mit nachfolgender erhöhter glomerulärer Filtration und vermehrter Bereitstellung renotropher Faktoren eine mögliche Ursache. Die Volumenüberladung ensteht wahrscheinlich durch unzureichenden Abbau von ADH und Aldosteron infolge eingeschränkter Leberfunktion bei Tieren mit PSS (CENTER & MAGNE, 1990; TISDALL, et al., 1996) Weitere Symptome Weitere Symtpome bei Tieren mit PSS können Folge zugleich vorhandener anderer angeborener Fehlbildungen sein. Häufig liegt Kryptorchismus vor. Vierundzwanzig bis 35 % der Kater (LEVY, et al., 1995; TILLSON & WINKLER, 2002) und 36 bis 50 % der Rüden (JOHNSON, et al., 1987;
31 II. Literaturübersicht 23 WATSON & HERRTAGE, 1998) mit PSS sind Kryptorchiden. LUNNEY (1992) berichtet von einer Katze mit kongenitaler Peritoneoperikardhernie und gleichzeitigem PSS ( LUNNEY, 1992). Ein weiteres, aber sowohl bei Hunden als auch bei Katzen seltenes Symptom ist intermittierendes Fieber (CENTER & MAGNE, 1990; TILLSON & WINKLER, 2002; WESS, et al., 2003). Eine dem Intestinum entstammende Bakteriämie und/oder Endotoxinämie mit nachfolgender Freisetzung von inflammatorischen Substanzen (Interleukin-6, Interleukin-β1 und Tumor-Nekrose-Faktor) und Pyrogenen wird als Ursache für das Fieber angesehen. Hierbei stimulieren die Pyrogene die Produktion von Prostaglandin-2, das im Hypothalamus den thermostatischen Richtwert der Körpertemperatur erhöht (CENTER & MAGNE, 1990; WESS, et al., 2003). Bei Katzen wurden in der klinischen Untersuchung bei 13 % der Tiere mit PSS ein Herzgeräusch gefunden (LEVY, et al., 1995). Ursache könnte hier ein Strömungsgeräusch sein, das durch Volumenüberladung infolge unzureichenden Abbaus von ADH und Aldosteron bei eingeschränkter Leberfunktion entsteht. Zudem kann auch hier ein zusätzlicher angeborener Herzfehler mögliche Ursache sein. Außerdem sind wiederkehrende Erkrankungen des oberen Respirationstraktes und eine gold- bis kupferfarbene Iris beschrieben, deren Ätiologie nicht geklärt ist (ROTHUIZEN & VAN DEN INGH, 1982a; SCAVELLI, et al., 1986; CENTER & MAGNE, 1990; BIRCHARD & SHERDING, 1992; LUNNEY, 1992; LEVY, et al., 1995; LAMB, et al., 1996; SCHUNK, 1997; TILLSON & WINKLER, 2002). 6. Laborveränderungen Das Routinelabor (Differentialblutbild, Serumprofil, Urinanalyse) ergibt meist nur geringe Abweichungen (CENTER & MAGNE, 1990; MARTIN, 1993; TILLSON & WINKLER, 2002). Gezieltere diagnostische Untersuchungen, die im Labor durchgeführt werden können, sind die Leberfunktionstests präprandialer Serum- Ammoniak, präprandiale Serum-Gallensäuren, Ammoniak-Stimulationstest und die Messung postprandialer Serum-Gallensäuren (CENTER & MAGNE, 1990; WEBSTER, 2005).
32 II. Literaturübersicht Hämatologie Hämatologische Veränderungen können eine milde, nichtregenerative Anämie, Mikrozytose, Poikilozytose oder Targetzellformation umfassen (SCAVELLI, et al., 1986; CENTER & MAGNE, 1990; LEVY, et al., 1995; HAVIG & TOBIAS, 2002; TILLSON & WINKLER, 2002). Mikrozytose und Targetzellen kommen typischerweise bei Hunden mit PSS vor, während Poikilozytose eher bei Katzen mit PSS zu finden ist (CENTER & MAGNE, 1990) Anämie Die Anämie von Patienten mit PSS ist nichtregenerativ und normo- oder hypochrom. Anämie wird bei Katzen mit PSS seltener gefunden (15 %) als bei Hunden (47 % bis 51 %) (SCAVELLI, 1989; CENTER & MAGNE, 1990; TILLSON & WINKLER, 2002). Gründe für die Anämie können funktioneller Eisenmangel und Anämie durch chronischen Blutverlust infolge Koagulopathie sein. Funktioneller Eisenmangel liegt bei inflammatorischer Anämie im Rahmen von chronischen Entzündungen vor. Bei der funktionellen Eisenmangelanämie steht zu wenig Eisen für den Einbau in das Hämoglobin zur Verfügung, weil vorhandene Eisendepots nicht mobilisiert werden können. Häufig ist der Eisengehalt in der Leber sogar erhöht, während Serum-Eisen normal oder niedrig sein kann (FELDMAN, et al., 1981; MEYER & HARVEY, 1994). Verantwortlich für die funktionelle Eisenmangelanämie ist hauptsächlich Hepicidin, ein vor allem in der Leber infolge der akute-phase-reaktion synthetisiertes Protein, das die Eisenresorption im Darm und die Freisetzung des Eisens aus den Depots hemmt. Bei Tieren mit PSS wird vermutet, dass aus dem Intestinum stammende metabolische Toxine den Eisenmetabolismus stören und zu dem funktionellen Eisenmangel führen. Im Zuge dieses Pathomechanismus kommt es neben der Anämie zur Hypochromasie und Mikrozytose (FELDMAN, et al., 1981; CENTER & MAGNE, 1990; BUNCH & MC GAHAN, 1994; MEYER & HARVEY, 1994; SIMPSON, et al., 1997). Eine Koagulopathie, die zu chronischem Blutverlust führen kann, rührt bei Tieren mit PSS aus einer verminderten Synthese von Gerinnungsfaktoren durch die Hepatopathie. Fünfzig Prozent der Hunde mit PSS zeigten eine Verlängerung der partiellen Thromboplastinzeit und 30 % eine Hypofibrinogenämie (CENTER & MAGNE, 1990).
33 II. Literaturübersicht Mikrozytose Mikrozytose wurde erstmalig von EWING 1974 bei einem Hund mit PSS beschrieben (EWING, et al., 1974). Sie ist bei % der Katzen und bei % der Hunde mit PSS nachweisbar (CENTER & MAGNE, 1990, LEVY & BUNCH, 1992). Die Ätiologie der Mikrozytose im Zusammenhang mit PSS ist noch nicht ganz geklärt. Sie wird als Folge der funktionellen Eisenmangelanämie diskutiert. Zudem wird vermutet, dass die metabolischen Toxine bei Tieren mit PSS zusätzlich einen abnormalen Lipidmetabolismus in der Leber auslösen, der die Integrität der Erythozytenmembranen stört (CENTER & MAGNE, 1990) Poikilozytose Poikilozytose tritt vor allem bei Katzen auf. Obwohl nicht als pathognomonisch für PSS anzusehen, ist das Auffinden von Poikilozytose in Blutausstrichen ein Indiz für eine schwere hepatobiliäre Erkrankung bei der Katze (SCAVELLI, et al., 1986; CENTER & MAGNE, 1990). Die morphologischen Veränderungen der Erythrozyten sind wahrscheinlich auf abnormale Cholersterol- oder Lipoproteingehalte in der Erythrozytenmembran zurückzuführen. Es wird vermutet, dass sie aufgrund eines gestörten Lipidmetabolismus durch metabolische Toxine in der Leber bei Tieren mit PSS hervorgerufen werden (CENTER & MAGNE, 1990) Targetzellen Targetzellen sind bei Hunden mit PSS häufiger als bei Katzen zu finden. Als Ursache für die Targetzellformation werden, ähnlich des Mechanismus bei der Mikrozytose und Poikilozytose, Konzentrationsänderungen im Cholesterol- und Lipoproteingehalt der Erythrozytenmembranen diskutiert (CENTER & MAGNE, 1990) Serumchemie Die Veränderungen der Serumchemie spiegeln vor allem die Leberinsuffizienz wider (CENTER & MAGNE, 1990; TILLSON & WINKLER, 2002). Die Leber ist für die Synthese des gesamten körpereigenen Albumins und etwa der Hälfte des Cholesterols verantwortlich, sie erhält die Glukose-Homöostase aufrecht, synthetisiert Harnstoff im Krebs-Henseleit-Harnstoffzyklus in der Detoxifikation von Ammoniak, sowie einen großen Teil der anderen Serum-Proteine (α- und β- Globuline, Gerinnungsfaktoren). Leberinsuffizienz kann daher zu zahlreichen
Stoffwechsel der essentiellen Aminosäuren
 Stoffwechsel der essentiellen Aminosäuren Andrea Schulte aus: Löffler/Petrides, Biochemie und Pathobiochemie, 7. Aufl., Kap. 15.3 Gliederung Einleitung: essentielle Aminosäuren, Biosynthese Abbau, Stoffwechselbedeutung
Stoffwechsel der essentiellen Aminosäuren Andrea Schulte aus: Löffler/Petrides, Biochemie und Pathobiochemie, 7. Aufl., Kap. 15.3 Gliederung Einleitung: essentielle Aminosäuren, Biosynthese Abbau, Stoffwechselbedeutung
Die Blutgasanalyse Was ist außerklinisch tolerabel? KAI 2014 Dr. med. Günter Schrot
 Die Blutgasanalyse Was ist außerklinisch tolerabel? KAI 2014 Dr. med. Günter Schrot Normale Blutgasanalyse ph 7,36-7,44 po2 >80 mmhg pco2 35-45 mmhg HCO3-22 -26 mmol/l berechnet Das Säure-Basen-System
Die Blutgasanalyse Was ist außerklinisch tolerabel? KAI 2014 Dr. med. Günter Schrot Normale Blutgasanalyse ph 7,36-7,44 po2 >80 mmhg pco2 35-45 mmhg HCO3-22 -26 mmol/l berechnet Das Säure-Basen-System
neurologische Grundlagen Version 1.3
 neurologische Grundlagen Version 1.3 ÜBERBLICK: Neurone, Synapsen, Neurotransmitter Neurologische Grundlagen Zentrale Vegetatives Peripheres Überblick: Steuersystem des menschlichen Körpers ZNS Gehirn
neurologische Grundlagen Version 1.3 ÜBERBLICK: Neurone, Synapsen, Neurotransmitter Neurologische Grundlagen Zentrale Vegetatives Peripheres Überblick: Steuersystem des menschlichen Körpers ZNS Gehirn
neurologische Grundlagen Version 1.3
 neurologische Version 1.3 ÜBERBLICK: Überblick: Steuersystem des menschlichen Körpers ZNS Gehirn Rückenmark PNS VNS Hirnnerven Sympathicus Spinalnerven Parasympathicus 1 ÜBERBLICK: Neurone = Nervenzellen
neurologische Version 1.3 ÜBERBLICK: Überblick: Steuersystem des menschlichen Körpers ZNS Gehirn Rückenmark PNS VNS Hirnnerven Sympathicus Spinalnerven Parasympathicus 1 ÜBERBLICK: Neurone = Nervenzellen
Aus der Klinik und Poliklinik für kleine Haustiere der Freien Universität Berlin
 Aus der Klinik und Poliklinik für kleine Haustiere der Freien Universität Berlin Klinische Doppelblindstudie über den präoperativen Einsatz von Methylprednisolonsuccinat beim thorakolumbalen Bandscheibenvorfall
Aus der Klinik und Poliklinik für kleine Haustiere der Freien Universität Berlin Klinische Doppelblindstudie über den präoperativen Einsatz von Methylprednisolonsuccinat beim thorakolumbalen Bandscheibenvorfall
Allgemeine Pathologie. Kreislaufstörungen
 Allgemeine Pathologie Kreislaufstörungen 6. Teil Ödem Ödem (1): Definition: vermehrte Ansammlung von Flüssigkeit im Gewebe bzw. in Körperhöhlen deshalb müssen unterschieden werden: Ursachen Grad Lage Intrazelluläre
Allgemeine Pathologie Kreislaufstörungen 6. Teil Ödem Ödem (1): Definition: vermehrte Ansammlung von Flüssigkeit im Gewebe bzw. in Körperhöhlen deshalb müssen unterschieden werden: Ursachen Grad Lage Intrazelluläre
Die in den Mundspeicheldrüsen und im Pankreas gebildete Alpha- Amylase (α-amylase) ist ein Enzym der Kohlenhydratverdauung.
 16 2 Laborwerte A Z 2.1 α-amylase Die in den Mundspeicheldrüsen und im Pankreas gebildete Alpha- Amylase (α-amylase) ist ein Enzym der Kohlenhydratverdauung. 2.1.1 Normalbereich im Blut < 140 U/l. Messung
16 2 Laborwerte A Z 2.1 α-amylase Die in den Mundspeicheldrüsen und im Pankreas gebildete Alpha- Amylase (α-amylase) ist ein Enzym der Kohlenhydratverdauung. 2.1.1 Normalbereich im Blut < 140 U/l. Messung
Cindy Former & Jonas Schweikhard
 Cindy Former & Jonas Schweikhard Definition Krankheitsbild Entdeckung Ursachen Biochemische Grundlagen Diagnostik Therapie Quellen Morbus Parkinson ist eine chronisch progressive neurodegenerative Erkrankung
Cindy Former & Jonas Schweikhard Definition Krankheitsbild Entdeckung Ursachen Biochemische Grundlagen Diagnostik Therapie Quellen Morbus Parkinson ist eine chronisch progressive neurodegenerative Erkrankung
Kein Hinweis für eine andere Ursache der Demenz
 die später nach ihm benannte Krankheit. Inzwischen weiß man, dass die Alzheimer-Krankheit eine sogenannte primär-neurodegenerative Hirnerkrankung ist. Das bedeutet, dass die Erkrankung direkt im Gehirn
die später nach ihm benannte Krankheit. Inzwischen weiß man, dass die Alzheimer-Krankheit eine sogenannte primär-neurodegenerative Hirnerkrankung ist. Das bedeutet, dass die Erkrankung direkt im Gehirn
Sie werden doch nicht
 Sie werden doch nicht Zur Erstbehandlung - aber sicher! Emeprid : sicherer Einsatz dank tiergerechter Dosierungen 0.5-1 mg Metoclopramid/kg/Tag verteilt auf 2 bis 3 Gaben Emeprid 5 mg/ml Injektionslösung
Sie werden doch nicht Zur Erstbehandlung - aber sicher! Emeprid : sicherer Einsatz dank tiergerechter Dosierungen 0.5-1 mg Metoclopramid/kg/Tag verteilt auf 2 bis 3 Gaben Emeprid 5 mg/ml Injektionslösung
Biochemische Labor-Diagnostik der akuten und chronischen Porphyrien
 Biochemische Labor-Diagnostik der akuten und chronischen Porphyrien Dr. Harald Ertl, 5.6.2013 Biochemische Labor-Diagnostik der akuten und chronischen Porphyrien Einleitung Biochemische Parameter - Allgemeines
Biochemische Labor-Diagnostik der akuten und chronischen Porphyrien Dr. Harald Ertl, 5.6.2013 Biochemische Labor-Diagnostik der akuten und chronischen Porphyrien Einleitung Biochemische Parameter - Allgemeines
Allgemeine Pathologie. Störungen im Kupfer- Stoffwechsel
 Allgemeine Pathologie Störungen im Kupfer- Stoffwechsel Physiologie (1): - das Übergangsmetall Kupfer ist als essentielles Spurenelement Bestandteil einer Reihe wichtiger Enzyme: - Ferro-oxidase I (Coeruloplasmin),
Allgemeine Pathologie Störungen im Kupfer- Stoffwechsel Physiologie (1): - das Übergangsmetall Kupfer ist als essentielles Spurenelement Bestandteil einer Reihe wichtiger Enzyme: - Ferro-oxidase I (Coeruloplasmin),
Aspekte der Eisenresorption. PD Dr. F.S. Lehmann Facharzt für Gastroenterologie FMH Oberwilerstrasse Binningen
 Aspekte der Eisenresorption PD Dr. F.S. Lehmann Facharzt für Gastroenterologie FMH Oberwilerstrasse 19 4102 Binningen Chemische Eigenschaften Fe-II wird leichter aufgenommen als Fe-III wegen der besseren
Aspekte der Eisenresorption PD Dr. F.S. Lehmann Facharzt für Gastroenterologie FMH Oberwilerstrasse 19 4102 Binningen Chemische Eigenschaften Fe-II wird leichter aufgenommen als Fe-III wegen der besseren
Akute Dekompensation der Niere bei Herzinsuffizienz. Uwe Heemann Abteilung für Nephrologie Klinikum rechts der Isar Technische Universität München
 Akute Dekompensation der Niere bei Herzinsuffizienz Uwe Heemann Abteilung für Nephrologie Klinikum rechts der Isar Technische Universität München Das Cardiorenale Syndrom Einleitung Pathophysiologie Therapeutische
Akute Dekompensation der Niere bei Herzinsuffizienz Uwe Heemann Abteilung für Nephrologie Klinikum rechts der Isar Technische Universität München Das Cardiorenale Syndrom Einleitung Pathophysiologie Therapeutische
Zusatzinformationen Fremdwörter QuickVet
 Antigen Antikörper Auf einer Struktur (in diesem Falle Erythrozyten) gelegenes Protein. Gegen solche Proteine können Antikörper gebildet werden. Antigen- Antikörper Verbindungen können zur Zerstörung der
Antigen Antikörper Auf einer Struktur (in diesem Falle Erythrozyten) gelegenes Protein. Gegen solche Proteine können Antikörper gebildet werden. Antigen- Antikörper Verbindungen können zur Zerstörung der
Zellulärer Abbau von Proteinen in Aminosäuren:! Proteine werden in Zellen durch Proteasom-Komplexe in! einzelne Aminosäuren abgebaut.!
 Zellulärer Abbau von Proteinen in Aminosäuren: Proteine werden in Zellen durch Proteasom-Komplexe in einzelne Aminosäuren abgebaut. Abbau von Aminosäuren: Uebersicht über den Aminosäureabbau Als erster
Zellulärer Abbau von Proteinen in Aminosäuren: Proteine werden in Zellen durch Proteasom-Komplexe in einzelne Aminosäuren abgebaut. Abbau von Aminosäuren: Uebersicht über den Aminosäureabbau Als erster
Spezielle Pathologie der Leber
 Spezielle Pathologie der Leber 5. Teil Stoffwechselstörungen (= nicht-entzündliche Leberveränderungen) Hepatosen Hepatosen: allg. Anmerkung (1): - die Reaktionen der Leber (wie die vieler anderer Organe)
Spezielle Pathologie der Leber 5. Teil Stoffwechselstörungen (= nicht-entzündliche Leberveränderungen) Hepatosen Hepatosen: allg. Anmerkung (1): - die Reaktionen der Leber (wie die vieler anderer Organe)
Der Harnstoff ist das Endprodukt des Proteinstoffwechsels.
 Der Harnstoff ist das Endprodukt des Proteinstoffwechsels. Proteinabbau: Protein AS + Stickstoff Stickstoff zu Ammoniak (NH 3, Zellgift) Ammoniak wird an CO 2 gebunden Harnstoff entsteht (H 2 N- CO-NH
Der Harnstoff ist das Endprodukt des Proteinstoffwechsels. Proteinabbau: Protein AS + Stickstoff Stickstoff zu Ammoniak (NH 3, Zellgift) Ammoniak wird an CO 2 gebunden Harnstoff entsteht (H 2 N- CO-NH
Bedeutung der Bestimmung der Vitamin D 3 - Konzentration im Serum bei dialysepflichtiger terminaler Niereninsuffizienz
 Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Innere Medizin II an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. B. Osten) Bedeutung der Bestimmung der Vitamin D 3 - Konzentration
Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Innere Medizin II an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. B. Osten) Bedeutung der Bestimmung der Vitamin D 3 - Konzentration
Zu den pathologischen Ursachen eines Eisenmangels gehören Blutungen sowie Aufnahmestörungen.
 Pathologische Ursachen Zu den pathologischen Ursachen eines Eisenmangels gehören Blutungen sowie Aufnahmestörungen. Blutungen Während Regelblutungen zu den natürlichen Ursachen gehören, ist jegliche sonstige
Pathologische Ursachen Zu den pathologischen Ursachen eines Eisenmangels gehören Blutungen sowie Aufnahmestörungen. Blutungen Während Regelblutungen zu den natürlichen Ursachen gehören, ist jegliche sonstige
Ute Gritzka. Hämatologisch- Onkologisches. Speziallabor
 Sepsis Ute Gritzka Hämatologisch- Onkologisches Vivantes GmbH Klinikum Am Urban Dieffenbachstr. 1 10967 Berlin Tel. 030/ 130 222 130 UteGritzka@aol.com www.gritzka.de Speziallabor Inzidenz der Sepsis (USA)
Sepsis Ute Gritzka Hämatologisch- Onkologisches Vivantes GmbH Klinikum Am Urban Dieffenbachstr. 1 10967 Berlin Tel. 030/ 130 222 130 UteGritzka@aol.com www.gritzka.de Speziallabor Inzidenz der Sepsis (USA)
Spezielle Pathologie der Leber
 Spezielle Pathologie der Leber 3. Teil Lageveränderungen und Zusammenhangstrennungen Lageveränderungen (1): - Torsion von Leberlappen: v.a. des linken Lappens beim Schwein (kommt aber auch bei Hund und
Spezielle Pathologie der Leber 3. Teil Lageveränderungen und Zusammenhangstrennungen Lageveränderungen (1): - Torsion von Leberlappen: v.a. des linken Lappens beim Schwein (kommt aber auch bei Hund und
ahus: Entstehung, Symptome und Diagnostik
 ahus: Entstehung, Symptome und Diagnostik Prof. Dr. med. Thorsten Feldkamp 3. ahus-patienten- und Angehörigentag Universitätsklinikum Mainz 20. Juni 2015 Atypisches hämolytisches urämisches Syndrom Einführung
ahus: Entstehung, Symptome und Diagnostik Prof. Dr. med. Thorsten Feldkamp 3. ahus-patienten- und Angehörigentag Universitätsklinikum Mainz 20. Juni 2015 Atypisches hämolytisches urämisches Syndrom Einführung
Jürgen Sandkühler. Downloads:
 Jürgen Sandkühler Downloads: http://cbr.meduniwien.ac.at Neuroinflammation beim Schmerz - Optionen für die Prävention und Therapie chronischer Schmerzen Jürgen Sandkühler Zentrum für Hirnforschung Medizinische
Jürgen Sandkühler Downloads: http://cbr.meduniwien.ac.at Neuroinflammation beim Schmerz - Optionen für die Prävention und Therapie chronischer Schmerzen Jürgen Sandkühler Zentrum für Hirnforschung Medizinische
Inhaltsverzeichnis. Geleitwort... Vorwort... Abkürzungsverzeichnis... 1 Theorie und Praxis von Nebenwirkungen... 1
 Inhaltsverzeichnis Geleitwort...................................................................................... Vorwort... Abkürzungsverzeichnis... V VI XIII 1 Theorie und Praxis von Nebenwirkungen...
Inhaltsverzeichnis Geleitwort...................................................................................... Vorwort... Abkürzungsverzeichnis... V VI XIII 1 Theorie und Praxis von Nebenwirkungen...
Dissertation an der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Institut für Tierzucht und Vererbungsforschung (Leitung Professor Distl)
 Tierärztliche Hochschule Hannover Institut für Tierzucht und Vererbungsforschung Bünteweg 17 p 30559 Hannover Tel. 0511 / 953-8876 Fax: 0511 / 953-8582 Email: abglab@tiho-hannover.de Dissertation an der
Tierärztliche Hochschule Hannover Institut für Tierzucht und Vererbungsforschung Bünteweg 17 p 30559 Hannover Tel. 0511 / 953-8876 Fax: 0511 / 953-8582 Email: abglab@tiho-hannover.de Dissertation an der
Diagnostische Verfahren
 6. Diagnostische s Jede Registrierung oder Auswertung einer Information mit dem Ziel der Erkennung einer Erung oder eines speziellen Zustandes wird diagnostischer genannt. Beispiele Reaktion auf Ansprechen
6. Diagnostische s Jede Registrierung oder Auswertung einer Information mit dem Ziel der Erkennung einer Erung oder eines speziellen Zustandes wird diagnostischer genannt. Beispiele Reaktion auf Ansprechen
Akkumulation von Metallen im Gehirn? Pathomechanismen und klinische Bedeutung. Dr. rer. nat. Katrin Huesker, IMD Berlin
 Akkumulation von Metallen im Gehirn? Pathomechanismen und klinische Bedeutung Dr. rer. nat. Katrin Huesker, IMD Berlin Metallquellen Atemluft Zahnersatz Lebensmittel Trinkwasser Eßgeschirr Kosmetik Endoprothesen
Akkumulation von Metallen im Gehirn? Pathomechanismen und klinische Bedeutung Dr. rer. nat. Katrin Huesker, IMD Berlin Metallquellen Atemluft Zahnersatz Lebensmittel Trinkwasser Eßgeschirr Kosmetik Endoprothesen
Raumfahrtmedizin. darauf hin, dass es auch einen Zusammenhang zwischen Knochenabbau, Bluthochdruck und Kochsalzzufuhr gibt. 64 DLR NACHRICHTEN 113
 Raumfahrtmedizin Gibt es einen Die geringe mechanische Belastung der unteren Extremitäten von Astronauten im All ist eine wesentliche Ursache für den Knochenabbau in Schwerelosigkeit. Gleichzeitig haben
Raumfahrtmedizin Gibt es einen Die geringe mechanische Belastung der unteren Extremitäten von Astronauten im All ist eine wesentliche Ursache für den Knochenabbau in Schwerelosigkeit. Gleichzeitig haben
9 Ergebnisse. 9.1 Kontrolltiere. Das Signalement und die Ergebnisse der Kontrolltiere sind Tabelle 5 zu entnehmen:
 9 Ergebnisse 9. Kontrolltiere Das Signalement und die Ergebnisse der Kontrolltiere sind Tabelle 5 zu entnehmen: Tabelle : Übersicht über die Kontrolltiere Patient Rasse Alter in Jahren Geschlecht Gewicht
9 Ergebnisse 9. Kontrolltiere Das Signalement und die Ergebnisse der Kontrolltiere sind Tabelle 5 zu entnehmen: Tabelle : Übersicht über die Kontrolltiere Patient Rasse Alter in Jahren Geschlecht Gewicht
Multiple Sklerose ohne oligoklonale Banden in Liquor: Prävalenz und klinischer Verlauf
 Aus der Klinik für Neurologie des Jüdischen Krankenhaus Berlin Akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Fakultät der Charité Universitätsmedizin Berlin DISSERTATION Multiple Sklerose ohne oligoklonale
Aus der Klinik für Neurologie des Jüdischen Krankenhaus Berlin Akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Fakultät der Charité Universitätsmedizin Berlin DISSERTATION Multiple Sklerose ohne oligoklonale
Beurteilung der striatalen Dopamin-D2-Rezeptorblockade durch Neuroleptika mit Hilfe der
 Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Nuklearmedizin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Direktorin: Frau Prof. Dr. med. habil. T. Mende Beurteilung der striatalen Dopamin-D2-Rezeptorblockade
Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Nuklearmedizin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Direktorin: Frau Prof. Dr. med. habil. T. Mende Beurteilung der striatalen Dopamin-D2-Rezeptorblockade
Sonographie bei portaler Hypertonie
 Sonographie bei portaler Hypertonie Gian-Marco Semadeni 2 Klinik Hepatische Encephalopathie Spontane bakterielle Peritonitis Hepatorenale Syndrom 3 Posthepatisch Intrahepatisch Prähepatisch HVPG norm
Sonographie bei portaler Hypertonie Gian-Marco Semadeni 2 Klinik Hepatische Encephalopathie Spontane bakterielle Peritonitis Hepatorenale Syndrom 3 Posthepatisch Intrahepatisch Prähepatisch HVPG norm
Das Säure-Basen- Gleichgewicht. Warum wichtig? Optimierung des/der: Metabolismus Eiweißtransport über Membranen hinweg Signalübertragung
 Das Säure-Basen- Gleichgewicht Warum wichtig? Optimierung des/der: Metabolismus Eiweißtransport über Membranen hinweg Signalübertragung BGA Blutgasanalyse Normalkost körpereigener Stoffwechsel Überschuss
Das Säure-Basen- Gleichgewicht Warum wichtig? Optimierung des/der: Metabolismus Eiweißtransport über Membranen hinweg Signalübertragung BGA Blutgasanalyse Normalkost körpereigener Stoffwechsel Überschuss
Expression und Funktion. von Neurotransmitterrezeptoren auf Astrozyten im intakten. Hirngewebe der Maus
 Expression und Funktion von Neurotransmitterrezeptoren auf Astrozyten im intakten Hirngewebe der Maus Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doctor rerum naturalium (Dr. rer. nat.) von Dipl.-Biochem.
Expression und Funktion von Neurotransmitterrezeptoren auf Astrozyten im intakten Hirngewebe der Maus Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doctor rerum naturalium (Dr. rer. nat.) von Dipl.-Biochem.
Th1-Th2-Zytokine bei entzündlicher Herzmuskelerkrankung
 Aus der medizinischen Klinik II, Abteilung für Kardiologie und Pulmonologie des Universitätsklinikums Benjamin Franklin der Freien Universität Berlin Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. H.-P. Schultheiss Th1-Th2-Zytokine
Aus der medizinischen Klinik II, Abteilung für Kardiologie und Pulmonologie des Universitätsklinikums Benjamin Franklin der Freien Universität Berlin Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. H.-P. Schultheiss Th1-Th2-Zytokine
1 EINLEITUNG Definition und Klassifikation neuroendokriner Tumoren des gastroenteropankreatischen Systems
 1 EINLEITUNG 6 1. EINLEITUNG 1.1 Definition und Klassifikation neuroendokriner Tumoren des gastroenteropankreatischen Systems Neuroendokrine Tumoren des Gastrointestinaltraktes stellen eine heterogene
1 EINLEITUNG 6 1. EINLEITUNG 1.1 Definition und Klassifikation neuroendokriner Tumoren des gastroenteropankreatischen Systems Neuroendokrine Tumoren des Gastrointestinaltraktes stellen eine heterogene
1. Teil Stoffwechselphysiologie
 A TIERPHYSIOLOGISCHES PRAKTIKUM Martin-Luther-King-Platz KLAUSUR WS 2011/12 D-20146 Hamburg Name:... Matrikel Nr... (Ausweis vorlegen) 0.02.2012 1. Teil Stoffwechselphysiologie Fachbereich Biologie Biozentrum
A TIERPHYSIOLOGISCHES PRAKTIKUM Martin-Luther-King-Platz KLAUSUR WS 2011/12 D-20146 Hamburg Name:... Matrikel Nr... (Ausweis vorlegen) 0.02.2012 1. Teil Stoffwechselphysiologie Fachbereich Biologie Biozentrum
 Abbildungen Schandry, 2006 Quelle: www.ich-bin-einradfahrer.de Abbildungen Schandry, 2006 Informationsvermittlung im Körper Pioniere der Neurowissenschaften: Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) Camillo
Abbildungen Schandry, 2006 Quelle: www.ich-bin-einradfahrer.de Abbildungen Schandry, 2006 Informationsvermittlung im Körper Pioniere der Neurowissenschaften: Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) Camillo
Die zwei Ps Polyurie und Polydipsie
 Die zwei Ps Polyurie und Polydipsie Dr. Christiane Stengel Dipl. ECVIM-CA (IM) FTÄ für Kleintiere Definition POLYDIPSIE vermehrte Wasseraufnahme POLYURIE erhöhte Harnproduktion = erhöhtes Harnvolumen Pollakisurie
Die zwei Ps Polyurie und Polydipsie Dr. Christiane Stengel Dipl. ECVIM-CA (IM) FTÄ für Kleintiere Definition POLYDIPSIE vermehrte Wasseraufnahme POLYURIE erhöhte Harnproduktion = erhöhtes Harnvolumen Pollakisurie
Aus der Klinik für Wiederkäuer und Schweine (Innere Medizin und Chirurgie) der Justus-Liebig-Universität Gießen Betreuer: Prof. Dr. K.
 Aus der Klinik für Wiederkäuer und Schweine (Innere Medizin und Chirurgie) der Justus-Liebig-Universität Gießen Betreuer: Prof. Dr. K. Doll und dem Institut für Veterinär-Physiologie der Justus-Liebig-Universität
Aus der Klinik für Wiederkäuer und Schweine (Innere Medizin und Chirurgie) der Justus-Liebig-Universität Gießen Betreuer: Prof. Dr. K. Doll und dem Institut für Veterinär-Physiologie der Justus-Liebig-Universität
Das Säure-Basen- Gleichgewicht. Warum wichtig? Optimierung des/der: Metabolismus Eiweißtransport über Membranen hinweg Signalübertragung
 Das Säure-Basen- Gleichgewicht Warum wichtig? Optimierung des/der: Metabolismus Eiweißtransport über Membranen hinweg Signalübertragung BGA Blutgasanalyse Normalkost körpereigener Stoffwechsel Überschuss
Das Säure-Basen- Gleichgewicht Warum wichtig? Optimierung des/der: Metabolismus Eiweißtransport über Membranen hinweg Signalübertragung BGA Blutgasanalyse Normalkost körpereigener Stoffwechsel Überschuss
Synaptische Übertragung und Neurotransmitter
 Proseminar Chemie der Psyche Synaptische Übertragung und Neurotransmitter Referent: Daniel Richter 1 Überblick Synapsen: - Typen / Arten - Struktur / Aufbau - Grundprinzipien / Prozesse Neurotransmitter:
Proseminar Chemie der Psyche Synaptische Übertragung und Neurotransmitter Referent: Daniel Richter 1 Überblick Synapsen: - Typen / Arten - Struktur / Aufbau - Grundprinzipien / Prozesse Neurotransmitter:
Insulinom. Cécile Rohrer Kaiser Dr. med. vet. Dipl. ACVIM und ECVIM-CA (Internal Medicine)
 Insulinom Cécile Rohrer Kaiser Dr. med. vet. Dipl. ACVIM und ECVIM-CA (Internal Medicine) Fall Whisky Signalement Appenzeller-Mischling, m, 13 jährig, 25 kg Anamnese Seit mehreren Monaten sehr häufige
Insulinom Cécile Rohrer Kaiser Dr. med. vet. Dipl. ACVIM und ECVIM-CA (Internal Medicine) Fall Whisky Signalement Appenzeller-Mischling, m, 13 jährig, 25 kg Anamnese Seit mehreren Monaten sehr häufige
Mikrozytäre Anämien. 5. Wiler Symposium der SRFT Dr. Lukas Graf, ZLM St. Gallen
 Mikrozytäre Anämien 5. Wiler Symposium der SRFT 27.11.2014 Dr. Lukas Graf, ZLM St. Gallen MCV < 80 fl Hb
Mikrozytäre Anämien 5. Wiler Symposium der SRFT 27.11.2014 Dr. Lukas Graf, ZLM St. Gallen MCV < 80 fl Hb
Zelltypen des Nervensystems
 Zelltypen des Nervensystems Im Gehirn eines erwachsenen Menschen: Neurone etwa 1-2. 10 10 Glia: Astrozyten (ca. 10x) Oligodendrozyten Mikrogliazellen Makrophagen Ependymzellen Nervenzellen Funktion: Informationsaustausch.
Zelltypen des Nervensystems Im Gehirn eines erwachsenen Menschen: Neurone etwa 1-2. 10 10 Glia: Astrozyten (ca. 10x) Oligodendrozyten Mikrogliazellen Makrophagen Ependymzellen Nervenzellen Funktion: Informationsaustausch.
Signalement. Kleintierabend 17.09.2008. Anamnese 24.09.2008. Neurologische Untersuchung. Allgemeine Untersuchung. Orthopädische Untersuchung
 Klinikum Veterinärmedizin Justus-Liebig Universität Gießen Klinik für Kleintiere Prof. M. Kramer Signalement Kleintierabend 17.09.2008 Fallvorstellung Kristina-S. Grohmann Collie Langhaar 9 Jahre männlich
Klinikum Veterinärmedizin Justus-Liebig Universität Gießen Klinik für Kleintiere Prof. M. Kramer Signalement Kleintierabend 17.09.2008 Fallvorstellung Kristina-S. Grohmann Collie Langhaar 9 Jahre männlich
Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Innere Medizin II an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
 Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Innere Medizin II an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Direktor: Prof. Dr. med. habil. Bernd Osten Bedeutung der Osteodensitometrie mittels Ultraschall
Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Innere Medizin II an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Direktor: Prof. Dr. med. habil. Bernd Osten Bedeutung der Osteodensitometrie mittels Ultraschall
Magen-Darm-Trakt und Sjögren-Syndrom 7. Deutscher Sjögren Tag,
 Magen-Darm-Trakt und Sjögren-Syndrom 7. Deutscher Sjögren Tag, 08.03.2008 Dr. med. J. Rosendahl Department für Innere Medizin Medizinische Klinik & Poliklinik II Übersicht I -Speiseröhre - Schluckstörungen
Magen-Darm-Trakt und Sjögren-Syndrom 7. Deutscher Sjögren Tag, 08.03.2008 Dr. med. J. Rosendahl Department für Innere Medizin Medizinische Klinik & Poliklinik II Übersicht I -Speiseröhre - Schluckstörungen
Auch heute wird noch diskutiert, ob Fluor zu den
 Spurenelement. Die höchsten Konzentrationen an Kupfer liegen in Leber und Gehirn sowie Herz und Nieren vor. Auf Knochen und Muskulatur entfallen rund 20 und 40 Prozent des Gesamtgehalts. Nur ein sehr kleiner
Spurenelement. Die höchsten Konzentrationen an Kupfer liegen in Leber und Gehirn sowie Herz und Nieren vor. Auf Knochen und Muskulatur entfallen rund 20 und 40 Prozent des Gesamtgehalts. Nur ein sehr kleiner
Zusammenfassung in deutscher Sprache
 Zusammenfassung in deutscher Sprache Zusammenfassung Man schätzt, dass in den Niederlanden einer von 200 Erwachsenen (=60.000) eine verborgene Nierenschädigung hat. Ungefähr 40.000 Menschen sind bekennt
Zusammenfassung in deutscher Sprache Zusammenfassung Man schätzt, dass in den Niederlanden einer von 200 Erwachsenen (=60.000) eine verborgene Nierenschädigung hat. Ungefähr 40.000 Menschen sind bekennt
Geschichte. Entdeckung 1808 durch Humphry Davy (zusammen mit Natrium) 1926 Entdeckung der Essenzialität für normales Wachstum
 Kalium Geschichte Entdeckung 1808 durch Humphry Davy (zusammen mit Natrium) 1926 Entdeckung der Essenzialität für normales Wachstum Chemie Ist ein Alkalimetal Erste Hauptgruppe Ordnungszahl 19 Massezahl
Kalium Geschichte Entdeckung 1808 durch Humphry Davy (zusammen mit Natrium) 1926 Entdeckung der Essenzialität für normales Wachstum Chemie Ist ein Alkalimetal Erste Hauptgruppe Ordnungszahl 19 Massezahl
Dr. med. Joachim Teichmann
 Aus dem Zentrum für Innere Medizin Medizinische Klinik und Poliklinik III Klinikum der Justus-Liebig-Universität Giessen (Direktor: Prof. Dr. med. R.G. Bretzel) Knochenstoffwechsel und pathogenetisch relevante
Aus dem Zentrum für Innere Medizin Medizinische Klinik und Poliklinik III Klinikum der Justus-Liebig-Universität Giessen (Direktor: Prof. Dr. med. R.G. Bretzel) Knochenstoffwechsel und pathogenetisch relevante
Chronische Niereninsuffizienz bei Katzen NIEREN. THERAPIE Tag für Tag
 Chronische Niereninsuffizienz bei Katzen NIEREN THERAPIE Tag für Tag NierenTHerapie Tag für Tag Wenn Ihre Katze an Niereninsuffizienz leidet Die chronische Niereninsuffizienz ( CNI ) ist eine häufig auftretende
Chronische Niereninsuffizienz bei Katzen NIEREN THERAPIE Tag für Tag NierenTHerapie Tag für Tag Wenn Ihre Katze an Niereninsuffizienz leidet Die chronische Niereninsuffizienz ( CNI ) ist eine häufig auftretende
Taurin. Ursprung. Vorkommen
 Ursprung Taurin oder 2-Aminoethansulfonsäure ist eine organische Säure mit einer Aminogruppe und wird deshalb oft als Aminosäure bezeichnet es handelt sich jedoch um eine Aminosulfonsäure, da es statt
Ursprung Taurin oder 2-Aminoethansulfonsäure ist eine organische Säure mit einer Aminogruppe und wird deshalb oft als Aminosäure bezeichnet es handelt sich jedoch um eine Aminosulfonsäure, da es statt
Allgemeines: Konzentration des Hämoglobins im Blut: 160 g/l Verpackung im Erythrocyten -> kolloidosmotisch unwirksam -> beeinträchtigt nicht den Wasse
 Hämoglobin Allgemeines: Konzentration des Hämoglobins im Blut: 160 g/l Verpackung im Erythrocyten -> kolloidosmotisch unwirksam -> beeinträchtigt nicht den Wasseraustausch im Kapillarbereich Durch die
Hämoglobin Allgemeines: Konzentration des Hämoglobins im Blut: 160 g/l Verpackung im Erythrocyten -> kolloidosmotisch unwirksam -> beeinträchtigt nicht den Wasseraustausch im Kapillarbereich Durch die
Tierhalterhaftpflichtversicherung für Hunde. - Meistversicherte Hunderassen 2014 - Günstige Versicherungstarife Hundehalterhaftpflicht
 Tierhalterhaftpflichtversicherung für Hunde - Meistversicherte Hunderassen 2014 - Günstige Versicherungstarife Hundehalterhaftpflicht Stand: Februar/März 2015 CHECK24 2015 Agenda 1. Zusammenfassung 2.
Tierhalterhaftpflichtversicherung für Hunde - Meistversicherte Hunderassen 2014 - Günstige Versicherungstarife Hundehalterhaftpflicht Stand: Februar/März 2015 CHECK24 2015 Agenda 1. Zusammenfassung 2.
Kapitel 2.2 Kardiopulmonale Homöostase. Kohlendioxid
 Kapitel 2.2 Kardiopulmonale Homöostase Kohlendioxid Transport im Plasma Bei der Bildung von im Stoffwechsel ist sein Partialdruck höher als im Blut, diffundiert folglich ins Plasmawasser und löst sich
Kapitel 2.2 Kardiopulmonale Homöostase Kohlendioxid Transport im Plasma Bei der Bildung von im Stoffwechsel ist sein Partialdruck höher als im Blut, diffundiert folglich ins Plasmawasser und löst sich
Was ist insulin. Gegenspieler
 Was ist insulin Insulin ist eine Eiweissverbindung Hormon. dass in bestimmten Zellen (Betazellen) der Bauchspeicheldrüse gebildet wird und im Kohlehydratstoffwechsel eine zentrale Rolle spielt. Welche
Was ist insulin Insulin ist eine Eiweissverbindung Hormon. dass in bestimmten Zellen (Betazellen) der Bauchspeicheldrüse gebildet wird und im Kohlehydratstoffwechsel eine zentrale Rolle spielt. Welche
Geschichte. 1807/08 Herstellung von elementarem Natrium durch Humphry Davy
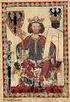 NATRIUM Geschichte 1807/08 Herstellung von elementarem Natrium durch Humphry Davy 1930 erkannte St. John die Essentialität (Lebensnotwendigkeit) des Natriums für normales Wachstum Clark erkannte die Bedeutung
NATRIUM Geschichte 1807/08 Herstellung von elementarem Natrium durch Humphry Davy 1930 erkannte St. John die Essentialität (Lebensnotwendigkeit) des Natriums für normales Wachstum Clark erkannte die Bedeutung
Epilepsie. ein Vortrag von Cara Leonie Ebert und Max Lehmann
 Epilepsie ein Vortrag von Cara Leonie Ebert und Max Lehmann Inhaltsverzeichnis Definition Epilepsie Unterschiede und Formen Ursachen Exkurs Ionenkanäle Diagnose Das Elektroenzephalogramm (EEG) Therapiemöglichkeiten
Epilepsie ein Vortrag von Cara Leonie Ebert und Max Lehmann Inhaltsverzeichnis Definition Epilepsie Unterschiede und Formen Ursachen Exkurs Ionenkanäle Diagnose Das Elektroenzephalogramm (EEG) Therapiemöglichkeiten
Wichtige Fakten zur Hyperthyreose (1) Wichtige Fakten zur Hyperthyreose (3) Wichtige Fakten zur Hyperthyreose (2) Medikamente
 Hyperthyreose bei der Katze Dr. med. vet. C. Rohrer Kaiser Dipl. ACVIM und ECVIM-CA (Innere Medizin) Hyperthyreose (1) Häufigste endokrine Erkrankung bei älteren Katzen 98% gutartiges Adenom/Hyperplasie
Hyperthyreose bei der Katze Dr. med. vet. C. Rohrer Kaiser Dipl. ACVIM und ECVIM-CA (Innere Medizin) Hyperthyreose (1) Häufigste endokrine Erkrankung bei älteren Katzen 98% gutartiges Adenom/Hyperplasie
Synaptische Transmission
 Synaptische Transmission Wie lösen APe, die an den Endknöpfchen der Axone ankommen, die Freisetzung von Neurotransmittern in den synaptischen Spalt aus (chemische Signalübertragung)? 5 wichtige Aspekte:
Synaptische Transmission Wie lösen APe, die an den Endknöpfchen der Axone ankommen, die Freisetzung von Neurotransmittern in den synaptischen Spalt aus (chemische Signalübertragung)? 5 wichtige Aspekte:
Klebsiella oxytoca als Ursache der hämorrhagischen
 Klebsiella oxytoca als Ursache der hämorrhagischen Antibiotikacolitis a.o. Univ. Prof. Dr. Christoph Högenauer, Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Universitätsklinik für Innere Medizin Graz.
Klebsiella oxytoca als Ursache der hämorrhagischen Antibiotikacolitis a.o. Univ. Prof. Dr. Christoph Högenauer, Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Universitätsklinik für Innere Medizin Graz.
Aus dem Institut für Veterinär-Anatomie des Fachbereiches Veterinärmedizin der Freien Universität Berlin
 Aus dem Institut für Veterinär-Anatomie des Fachbereiches Veterinärmedizin der Freien Universität Berlin Makroskopisch und mikroskopisch-anatomische Untersuchungen an Nieren und Nebennieren von Schweinen
Aus dem Institut für Veterinär-Anatomie des Fachbereiches Veterinärmedizin der Freien Universität Berlin Makroskopisch und mikroskopisch-anatomische Untersuchungen an Nieren und Nebennieren von Schweinen
Was gibt s Neues in der Ursachenforschung bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen?
 Was gibt s Neues in der Ursachenforschung bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen? Carl M. Oneta Abteilung für Gastroenterologie Inselspital CH-3010 Bern Zwei Hauptformen Morbus Crohn Colitis ulcerosa
Was gibt s Neues in der Ursachenforschung bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen? Carl M. Oneta Abteilung für Gastroenterologie Inselspital CH-3010 Bern Zwei Hauptformen Morbus Crohn Colitis ulcerosa
Multiple Sklerose DIE KRANKHEIT MIT TAUSEND GESICHTERN
 Multiple Sklerose DIE KRANKHEIT MIT TAUSEND GESICHTERN DAMARIS WALLMEROTH JACQUELIN KASEMIR 25.07.2017 1 Inhaltsverzeichnis Myelinscheide Ionenkanäle am Axon Definition Multiple Sklerose (MS) Krankheitsbild
Multiple Sklerose DIE KRANKHEIT MIT TAUSEND GESICHTERN DAMARIS WALLMEROTH JACQUELIN KASEMIR 25.07.2017 1 Inhaltsverzeichnis Myelinscheide Ionenkanäle am Axon Definition Multiple Sklerose (MS) Krankheitsbild
Faktor-V-Leiden Mutation: Diagnose und Klinik
 INRswiss-Tag Solothurn, 21. November 2009 Faktor-V-Leiden Mutation: Diagnose und Klinik Dr. Giuseppe Colucci Universitätsklinik für Hämatologie und Hämatologisches Zentrallabor Inselspital Bern Faktor-V-Leiden
INRswiss-Tag Solothurn, 21. November 2009 Faktor-V-Leiden Mutation: Diagnose und Klinik Dr. Giuseppe Colucci Universitätsklinik für Hämatologie und Hämatologisches Zentrallabor Inselspital Bern Faktor-V-Leiden
Leben mit chronischer Erschöpfung - CFS
 Leben mit chronischer Erschöpfung - CFS Ein Ratgeber für Patienten von J. Strienz überarbeitet Leben mit chronischer Erschöpfung - CFS Strienz schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG
Leben mit chronischer Erschöpfung - CFS Ein Ratgeber für Patienten von J. Strienz überarbeitet Leben mit chronischer Erschöpfung - CFS Strienz schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG
Gluconeognese Neusynthese von Glucose aus Pyruvat
 Gluconeognese Neusynthese von Glucose aus Pyruvat Warum notwendig? Das Gehirn ist auf eine konstante Versorgung mit Glucose angewiesen. Eine Unterzuckerung (< 3 4 mmol/l) führt unweigerlich zur Bewußtlosigkeit
Gluconeognese Neusynthese von Glucose aus Pyruvat Warum notwendig? Das Gehirn ist auf eine konstante Versorgung mit Glucose angewiesen. Eine Unterzuckerung (< 3 4 mmol/l) führt unweigerlich zur Bewußtlosigkeit
Transmitterstoff erforderlich. und Tremor. Potenziale bewirken die Erregungsübertragung zwischen den Nervenzellen. Begriffen
 4 Kapitel 2 Nervensystem 2 Nervensystem Neurophysiologische Grundlagen 2.1 Bitte ergänzen Sie den folgenden Text mit den unten aufgeführten Begriffen Das Nervensystem besteht aus 2 Komponenten, dem und
4 Kapitel 2 Nervensystem 2 Nervensystem Neurophysiologische Grundlagen 2.1 Bitte ergänzen Sie den folgenden Text mit den unten aufgeführten Begriffen Das Nervensystem besteht aus 2 Komponenten, dem und
Geschichte. 1807/08 Herstellung von elementarem Natrium durch Humphry Davy
 NATRIUM Geschichte 1807/08 Herstellung von elementarem Natrium durch Humphry Davy 1930 erkannte St. John die Essentialität (Lebensnotwendigkeit) des Natriums für normales Wachstum Clark erkannte die Bedeutung
NATRIUM Geschichte 1807/08 Herstellung von elementarem Natrium durch Humphry Davy 1930 erkannte St. John die Essentialität (Lebensnotwendigkeit) des Natriums für normales Wachstum Clark erkannte die Bedeutung
Anhang 2 zu Anlage 12. Diagnosenliste (ICD 10 Kodierungen) Stand: Vertrag vom BKK.Mein Facharzt Modul Gastroenterologie
 Diagnosenliste ( Kodierungen) Stand: 02.03.2016 Wie in Anlage 12 beschrieben, ist die Angabe einer gesicherten Diagnose in Form eines endstelligen und korrekten - Codes Bestandteil der gastroenterologischen
Diagnosenliste ( Kodierungen) Stand: 02.03.2016 Wie in Anlage 12 beschrieben, ist die Angabe einer gesicherten Diagnose in Form eines endstelligen und korrekten - Codes Bestandteil der gastroenterologischen
Vorwort zur dritten Auflage Vorwort zur zweiten Auflage o Vorwort zur ersten Auflage
 Inhalt Vorwort zur dritten Auflage Vorwort zur zweiten Auflage o Vorwort zur ersten Auflage V VI VII Einleitung 1 Was bedeutet chronisches Erschöpfungssyndrom? 1 Wie wird die Diagnose gestellt? 2 Wie wird
Inhalt Vorwort zur dritten Auflage Vorwort zur zweiten Auflage o Vorwort zur ersten Auflage V VI VII Einleitung 1 Was bedeutet chronisches Erschöpfungssyndrom? 1 Wie wird die Diagnose gestellt? 2 Wie wird
Zusammenfassung: Bilirubin
 Zusammenfassung: Bilirubin 1. Setzen Sie richtig ein: Lipophil, wasserlöslich, wasserunlöslich, mit Glucuronsäure konjugiert, konjugiertes Bilirubin, unkonjugiertes Bilirubin, an Albumin gebunden, kann
Zusammenfassung: Bilirubin 1. Setzen Sie richtig ein: Lipophil, wasserlöslich, wasserunlöslich, mit Glucuronsäure konjugiert, konjugiertes Bilirubin, unkonjugiertes Bilirubin, an Albumin gebunden, kann
Aus dem Julius-Bernstein-Institut für Physiologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. habil. G.
 Aus dem Julius-Bernstein-Institut für Physiologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. habil. G. Isenberg) Der desynchronisierende Effekt des Endothels auf die Kinetik
Aus dem Julius-Bernstein-Institut für Physiologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. habil. G. Isenberg) Der desynchronisierende Effekt des Endothels auf die Kinetik
1 Bau von Nervenzellen
 Neurophysiologie 1 Bau von Nervenzellen Die funktionelle Einheit des Nervensystems bezeichnet man als Nervenzelle. Dendrit Zellkörper = Soma Zelllkern Axon Ranvier scher Schnürring Schwann sche Hüllzelle
Neurophysiologie 1 Bau von Nervenzellen Die funktionelle Einheit des Nervensystems bezeichnet man als Nervenzelle. Dendrit Zellkörper = Soma Zelllkern Axon Ranvier scher Schnürring Schwann sche Hüllzelle
Bei kranken Katzen ist die wahre Ursache oft unklar.
 Lethargie Appetitlosigkeit Dehydratation Gewichtsverlust Zurückziehen Bei kranken Katzen ist die wahre Ursache oft unklar. IDEXX Diavet Verschaffen Sie sich schnell ein klares Bild über den Pankreasstatus
Lethargie Appetitlosigkeit Dehydratation Gewichtsverlust Zurückziehen Bei kranken Katzen ist die wahre Ursache oft unklar. IDEXX Diavet Verschaffen Sie sich schnell ein klares Bild über den Pankreasstatus
Eine Analyse des Münchner Schlaganfallregisters: Diagnostik und Therapie bei Patienten mit Diabetes mellitus"
 Aus der Forschergruppe Diabetes e.v. am Helmholtz Zentrum München Vorstand: Professor Dr. med. Oliver Schnell Eine Analyse des Münchner Schlaganfallregisters: Diagnostik und Therapie bei Patienten mit
Aus der Forschergruppe Diabetes e.v. am Helmholtz Zentrum München Vorstand: Professor Dr. med. Oliver Schnell Eine Analyse des Münchner Schlaganfallregisters: Diagnostik und Therapie bei Patienten mit
Leben mit chronischer Erschöpfung CFS
 Leben mit chronischer Erschöpfung CFS Ein Ratgeber für Patienten von Joachim Strienz überarbeitet W. Zuckschwerdt 2015 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de ISBN 978 3 86371 169 6 Zu Leseprobe schnell
Leben mit chronischer Erschöpfung CFS Ein Ratgeber für Patienten von Joachim Strienz überarbeitet W. Zuckschwerdt 2015 Verlag C.H. Beck im Internet: www.beck.de ISBN 978 3 86371 169 6 Zu Leseprobe schnell
V. Diskussion. 1. Patientengut Rasseverteilung
 106 V. Diskussion Der angeborene portosystemische Shunt des Hundes ist eine Anomalie des Gefäßsystems der Leber und gewinnt in der heutigen Praxis zunehmend an Bedeutung. In dieser Studie wurde in einem
106 V. Diskussion Der angeborene portosystemische Shunt des Hundes ist eine Anomalie des Gefäßsystems der Leber und gewinnt in der heutigen Praxis zunehmend an Bedeutung. In dieser Studie wurde in einem
Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Medizin (Dr. med.)
 Aus der Universitätsklinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin an der Martin Luther Universität Halle Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. J. Radke) Der Einfluss der perioperativen systemischen
Aus der Universitätsklinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin an der Martin Luther Universität Halle Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. J. Radke) Der Einfluss der perioperativen systemischen
Aminosäuren 1. Aufbau der Aminosäuren
 Aminosäuren 1 Aufbau der Aminosäuren Aminosäuren bestehen aus einer Carbonsäuregruppe und einer Aminogruppe. Die einfachste Aminosäure ist das Glycin mit 2 Kohlenstoffatomen. Das Kohlenstoffatom nach der
Aminosäuren 1 Aufbau der Aminosäuren Aminosäuren bestehen aus einer Carbonsäuregruppe und einer Aminogruppe. Die einfachste Aminosäure ist das Glycin mit 2 Kohlenstoffatomen. Das Kohlenstoffatom nach der
Anhang. O nein O ja O rechts O links O dauernd O intermittierend
 Anhang Patientenbogen Datum: Patienten Nr.: Besitzer: Name: Rasse: Alter: Gewicht: Geschlecht: CT Nr.: Gewichtsgruppe: Klinische Allg. US: Spezielle Untersuchung nach Koch et al. (1998) und Grundmann et
Anhang Patientenbogen Datum: Patienten Nr.: Besitzer: Name: Rasse: Alter: Gewicht: Geschlecht: CT Nr.: Gewichtsgruppe: Klinische Allg. US: Spezielle Untersuchung nach Koch et al. (1998) und Grundmann et
Exzitatorische (erregende) Synapsen
 Exzitatorische (erregende) Synapsen Exzitatorische Neurotransmitter z.b. Glutamat Öffnung von Na+/K+ Kanälen Membran- Potential (mv) -70 Graduierte Depolarisation der subsynaptischen Membran = Erregendes
Exzitatorische (erregende) Synapsen Exzitatorische Neurotransmitter z.b. Glutamat Öffnung von Na+/K+ Kanälen Membran- Potential (mv) -70 Graduierte Depolarisation der subsynaptischen Membran = Erregendes
ERBRECHEN UND ANTIEMETIKA THEORETISCHE GRUNDLAGEN
 ERBRECHEN UND ANTIEMETIKA THEORETISCHE GRUNDLAGEN Univ.Prof.Dr.Herbert Watzke Klinik für Innere Medizin I Medizinische Universität Wien Slide 1 CHEMOTHERAPIE INDUZIERTES ERBRECHEN MECHANISMEN ERBRECHEN
ERBRECHEN UND ANTIEMETIKA THEORETISCHE GRUNDLAGEN Univ.Prof.Dr.Herbert Watzke Klinik für Innere Medizin I Medizinische Universität Wien Slide 1 CHEMOTHERAPIE INDUZIERTES ERBRECHEN MECHANISMEN ERBRECHEN
Inhaltsverzeichnis. 1 Einleitung 1
 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 2 Literaturübersicht 3 2.1. Anämie 3 2.2 Hämatologische Besonderheiten bei der Katze 3 2.2.1 Normoblasten und Retikulozyten 5 2.2.2 Howell-Jolly-Körperchen 7 2.2.3 Knochenmark
Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 2 Literaturübersicht 3 2.1. Anämie 3 2.2 Hämatologische Besonderheiten bei der Katze 3 2.2.1 Normoblasten und Retikulozyten 5 2.2.2 Howell-Jolly-Körperchen 7 2.2.3 Knochenmark
Clusteranalyse und - therapie besser verstehen und sinnvoller nutzen auf der Basis neuester Erkenntnisse der Clustermedizin
 Clusteranalyse und - therapie besser verstehen und sinnvoller nutzen auf der Basis neuester Erkenntnisse der Clustermedizin Die kristallinen Texturen der Heilpflanzen (aus Spagyrik die medizinische
Clusteranalyse und - therapie besser verstehen und sinnvoller nutzen auf der Basis neuester Erkenntnisse der Clustermedizin Die kristallinen Texturen der Heilpflanzen (aus Spagyrik die medizinische
Habilitation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Medizin (Dr. med. habil.)
 Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Innere Medizin I an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. Wolfgang E. Fleig) Der transjuguläre intrahepatische portosystemische
Aus der Universitätsklinik und Poliklinik für Innere Medizin I an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Direktor: Prof. Dr. med. Wolfgang E. Fleig) Der transjuguläre intrahepatische portosystemische
Schizophrenie. Krankheitsbild und Ursachen
 Schizophrenie Krankheitsbild und Ursachen Inhalt Definition Zahlen und Daten Symptomatik Positivsymptome Negativsymptome Ursachen Diagnostik Klassifikation Verlauf und Prognose 2 Schizophrenie - Krankheitsbild
Schizophrenie Krankheitsbild und Ursachen Inhalt Definition Zahlen und Daten Symptomatik Positivsymptome Negativsymptome Ursachen Diagnostik Klassifikation Verlauf und Prognose 2 Schizophrenie - Krankheitsbild
DIABETES MELLITUS «ZUCKERKRANKHEIT» Jasmin Hess Interne Weiterbildung
 DIABETES MELLITUS «ZUCKERKRANKHEIT» Jasmin Hess Interne Weiterbildung 1.2.16 350 000 Menschen HÄUFIGKEIT IN DER SCHWEIZ 20-84 Jahre: Männer 4,8%, Frauen 3,7% 75-84 Jahre: Männer 16%, Frauen 12% Anteil
DIABETES MELLITUS «ZUCKERKRANKHEIT» Jasmin Hess Interne Weiterbildung 1.2.16 350 000 Menschen HÄUFIGKEIT IN DER SCHWEIZ 20-84 Jahre: Männer 4,8%, Frauen 3,7% 75-84 Jahre: Männer 16%, Frauen 12% Anteil
Einführung in die Neuroradiologie
 Einführung in die Neuroradiologie B. Turowski 2010 Neuroradiologie Neuroradiologie Diagnostik und Therapie von: Gehirn und Rückenmark = Neuro-Achse Hüll- und Stützstrukturen Kompetenz Frage einer 84-jährigen
Einführung in die Neuroradiologie B. Turowski 2010 Neuroradiologie Neuroradiologie Diagnostik und Therapie von: Gehirn und Rückenmark = Neuro-Achse Hüll- und Stützstrukturen Kompetenz Frage einer 84-jährigen
Was verstehen wir unter Säuren und Basen?
 Was verstehen wir unter Säuren und Basen? Säuren: Unter Säuren verstehen wir alle organischen und anorganischen Verbindungen, die in Lösungen Wasserstoffionen H + abgeben. Sie werden auch Protonen Donatoren
Was verstehen wir unter Säuren und Basen? Säuren: Unter Säuren verstehen wir alle organischen und anorganischen Verbindungen, die in Lösungen Wasserstoffionen H + abgeben. Sie werden auch Protonen Donatoren
Akuter muskuloskeletaler Schmerz
 Akuter muskuloskeletaler Schmerz Einführung Bei akutem muskuloskeletalen Schmerz handelt es sich um Schmerz, der in einer Körperregion wahrgenommen wird und von dem vermutet wird, dass er von den Muskeln,
Akuter muskuloskeletaler Schmerz Einführung Bei akutem muskuloskeletalen Schmerz handelt es sich um Schmerz, der in einer Körperregion wahrgenommen wird und von dem vermutet wird, dass er von den Muskeln,
Heilmethoden, die für Linderung sorgen Das können Sie selbst tun
 DR. MED. HEIKE BUESS-KOVÁCS BIRGIT KALTENTHALER Chronische Schmerzen natürlich behandeln Heilmethoden, die für Linderung sorgen Das können Sie selbst tun Das Schmerzgedächtnis Verursacher chronischer Schmerzen
DR. MED. HEIKE BUESS-KOVÁCS BIRGIT KALTENTHALER Chronische Schmerzen natürlich behandeln Heilmethoden, die für Linderung sorgen Das können Sie selbst tun Das Schmerzgedächtnis Verursacher chronischer Schmerzen
Atopische Dermatitis/Allergie bei Hunden
 Atopische Dermatitis/Allergie bei Hunden Auch genannt: Atopie, allergische Dermatitis, Allergie Hunde haben auch Allergien Wie wir Menschen, können auch Hunde an Allergien leiden. Fast jeder fünfte Hund
Atopische Dermatitis/Allergie bei Hunden Auch genannt: Atopie, allergische Dermatitis, Allergie Hunde haben auch Allergien Wie wir Menschen, können auch Hunde an Allergien leiden. Fast jeder fünfte Hund
WIE HORMONE UNSER GEWICHT BEEINFLUSSEN
 GEWICHTSMANAGEMENT WIE HORMONE UNSER GEWICHT BEEINFLUSSEN Übergewicht ist ein Risikofaktor für viele Krankheiten und ein erstzunehmendes Problem unserer Gesellschaft. Mit zunehmendem Gewicht steigt das
GEWICHTSMANAGEMENT WIE HORMONE UNSER GEWICHT BEEINFLUSSEN Übergewicht ist ein Risikofaktor für viele Krankheiten und ein erstzunehmendes Problem unserer Gesellschaft. Mit zunehmendem Gewicht steigt das
kommt es aufgrund Mehrsekretion von ACTH zur NNR-Hyperplasie.
 Pädiatrie Adrenogenitales Syndrom (AGS) Stellglied = Kortisolplasmaspiegel Bei Kortisolmangel kommt es aufgrund Mehrsekretion von ACTH zur NNR-Hyperplasie. Adrenale Steroidsynthese normal bei AGS: Kortisolmangel
Pädiatrie Adrenogenitales Syndrom (AGS) Stellglied = Kortisolplasmaspiegel Bei Kortisolmangel kommt es aufgrund Mehrsekretion von ACTH zur NNR-Hyperplasie. Adrenale Steroidsynthese normal bei AGS: Kortisolmangel
