Riskantes Sterben wie das Lebensende in der reflexiven Moderne zu erforschen ist?
|
|
|
- Kirsten Müller
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Riskantes Sterben wie das Lebensende in der reflexiven Moderne zu erforschen ist? Werner Schneider, Sursee, (unveröffentlichtes Manuskript, nicht zitierfähig, Weitergabe nur mit Zustimmung des Verfassers, Literaturhinweise beim Verfasser) Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr über die Einladung zu der Tagung des NFP 67 vielen Dank an die Organisatoren für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen. Erlauben Sie mir eine kurze Vorbemerkung: In meinen Ausführungen wird es weniger um konkrete Empirie bzw. Datenerhebung / Datenauswertung und mehr um theoretische und methodologische Hinweise, Anmerkungen und Überlegungen gehen, da heute den ganzen weiteren Tag ja empirische Projekte diskutiert werden sollen. Dennoch möchte ich mit einem konkreten empirischen Datum beginnen mit meinem personal day of death : Ich werde am Donnerstag, den 7. September 2034, 7 Wochen vor meinem 74. Geburtstag, sterben. Woher ich das weiß? Jeder kann sein Todesdatum im Internet abrufen. Man füllt einen kurzen Fragebogen aus, der einige Grunddaten (Alter, Geschlecht, Body-Maß-Index) und Informationen zum Lebensstil (Rauchen und Trinken oder Sport und gesundes Essen, verheiratet oder ledig usw.) abklärt. Auf dieser Basis wird dann mittels aktueller Sterbetafeln die daraus resultierende durchschnittliche Lebenserwartung hochgerechnet und statistisch nicht mehr nachvollziehbar, aber das ist selbstverständlich die Pointe dabei auf ein ganz bestimmtes Datum hin projiziert, das jetzt wahrscheinlich schon ohne mein Zutun in meinem Google-Kalender eingetragen ist. Doch genau betrachtet, ist das konkrete WANN meines Todes für sich genommen gar nicht so entscheidend wichtiger, spannender wäre das WIE des Sterbens, also die Minuten, Stunden, Tage, Wochen, Monate davor Vor dem Hintergrund der Bewusstheit des Menschen hinsichtlich seiner Sterblichkeit ist das individuelle wie kollektive, das gesellschaftliche Fragen und kulturelle Bearbeiten von Sterben und Tod einerseits eine Conditio Humana. Das Phänomen menschlicher Kulturentwicklung ist schlechthin nicht zu verstehen, wenn es nicht von diesem Bewusstsein der Sterblichkeit her betrachtet wird. Andererseits ist es bemerkenswert, dass wir heutzutage in unserem westlichen Denken, mit der dominanten Vorstellung eines natürlichen, möglichst gesunden Todes, den uns die Gesundheitsgesellschaft am Ende eines möglichst langen Lebens gewährleisten soll, es offenbar für plausibel halten, unser zukünftiges Lebensende anhand vermeintlich objektiver Daten zur körperlichen Verfassung und zum Lebensstil, mit Wahrheit im Sinne statistischer Wahrscheinlichkeit errechnen zu können. Mir geht es im Folgenden genau um solche Fragen nach dem Wandel unseres gesellschaftlichen Denkens und gesellschaftlichen Tuns rund um Sterben und Tod. Ich bin ein beobachtender Soziologe, der seit Mitte der 1990er erstaunt mitverfolgt, wie unsere Gesellschaft seither ihren Umgang mit Sterben und Tod weniger mit dem Tod, aber insbesondere mit dem Sterben radikal verändert hat. Warum ich im Titel vom riskanten Sterben spreche, wird sich hoffentlich im Verlauf meines Vortrags aufklaren. 1
2 Ich möchte im Folgenden erläutern, was diesen veränderten, neuen gesellschaftlichen Umgang mit Sterben, mit Sterbenden kennzeichnet und ihn im Rahmen einer reflexiv-modernisierungstheoretischen Perspektive deuten (2); davor aber kurz ausweisen, was aus soziologischer Perspektive gemeint ist, wenn vom Sterben die Rede ist (1); und schließlich daraus resultierende methodologisch-methodische Folgerungen benennen, wie dieses riskante Sterben in der reflexiv-modernen Gesellschaft empirisch in den Blick zu nehmen ist (3). (1) Das Lebensende aus soziologischer Perspektive: Sterben als sozialer Prozess Was ist Sterben soziologisch gesehen? Hier ein kurzes Zitat des Soziologen Klaus Feldmann: Orthodoxe Juden erklärten in früheren Zeiten Mitglieder ihrer Gemeinde, die Nicht-Juden geheiratet hatten, für tot und führten ein symbolisches Begräbnis für diese Personen durch. (Feldmann, Klaus: Tod und Gesellschaft. Sozialwissenschaftliche Thanatologie im Überblick. Wiesbaden: VS 2010, S.126) Mit diesem Zitat ist exemplarisch benannt, was man als den sozialen Tod bezeichnet: Ein Mitglied einer Gruppe wird von dieser als irrelevant, als nicht mehr existent, metaphorisch formuliert als gestorben definiert. Das kann in geschlossenen Gruppen sogar dazu führen, dass die Betroffenen dann tatsächlich physisch sterben, obwohl es keine objektive medizinische Indikation für dieses Sterben gibt. Man spricht dann etwas missverständlich vom psychogenen Tod, wobei es eigentlich um soziale Ausgrenzung geht, die so stark wirkt, dass sie sogar die physische Existenz in Frage stellt. Umgekehrt gilt ebenso: Bei einer infausten Prognose ist ein wichtiger Aspekt, inwieweit schon mit der Erkrankung und dann mit dem anstehenden physischen Sterben ein soziales Sterben im Sinne einer solchen Ausgrenzung einhergeht, der soziale Ausschluss also dem physischen Ableben vorausläuft. Man denke dabei an die HIV-positiven Patienten der 1980er Jahre, deren stigmatisierende AIDS-Diagnose damals das soziale Todesurteil bedeutete. Nicht zufällig hat die Hospizbewegung eine ihrer Wurzeln in der Betreuung jener damals Kranken, die aufgrund ihrer Stigmatisierung als Infizierte von der Gesellschaft ausgeschlossen wurden. Sterben ist also immer schon mehr als ein primär physiologisch bestimmter Vorgang Sterben ist immer auch und vor allem ein sozialer Prozess. Soziologisch gesehen ist Sterben als ein umfassender Ausgliederungsprozess zu kennzeichnen wohlgemerkt: Ausgliederung, nicht Ausgrenzung(!), der im Kern auf eine umfassende Transformation, eine grundlegende Um- und Neudefinition der gemeinsam geteilten Wirklichkeit durch alle am Sterbensverlauf Beteiligten zielt. Dabei macht sich die betreffende Gemeinschaft deutlich, dass eines ihrer Mitglieder sie unwiederbringlich verlassen wird, wobei die noch Weiterlebenden den sinnhaften Übergang in eine neue Alltagswirklichkeit ohne diesen dann nicht mehr lebenden Anderen vollziehen müssen. Im Zentrum der gesellschaftlichen Gestaltung des Sterbens steht somit soziologisch betrachtet keineswegs, wie man auf den ersten Blick meint, der Sterbende selbst. Sondern es geht vielmehr um die noch Weiterlebenden bzw. um deren Bewältigung der Erfahrung des Sterbens eines für sie wichtigen Anderen in ihren konkreten alltagspraktischen Bezügen ebenso wie in der sinnhaften Ordnung ihrer Welt. 2
3 Die Gemeinschaft bzw. die Gesellschaft der noch Weiterlebenden kümmert sich in der Regel in der Art und Weise um den Sterbenden, wie sie nach dem Gestorben-Sein des Betreffenden mit der Erfahrung dieses Sterbens möglichst gut d.h. im Glauben an die Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens trotz der Erfahrung des Todes durch das Sterben eines Anderen weiterleben kann. Deshalb wird das Sterben eines Menschen immer von der Gesellschaft, in der er lebt, bestimmt und ausgestaltet entlang: 1. der je vorherrschenden Leitvorstellungen, der geltenden Werten und Normen, die das Handeln orientieren, 2. der vorhandenen institutionellen Bezüge, in denen das Sterben raum-zeitlich situiert ist (z.b. Klinik, Palliativstation, Hospiz, Zuhause mit ihren jeweiligen Rollendefinitionen) und 3. der entsprechenden sozialen Beziehungen zwischen dem Sterbenden, den Angehörigen, den ehren- oder hauptamtlichen Sterbearbeitern. Kurzum: Wir sterben nicht einfach so, sondern wir werden sterben gemacht! (2) Die Modernisierung des modernen Lebensendes: Das gute Sterben Doch dieses gesellschaftliche Sterben Machen unterliegt seit den 1970ern einem grundlegenden Wandel. Wir erleben gleichsam seit Jahren ein großes gesellschaftliches Laborexperiment, das die Modernisierung des modernen Lebensendes betreibt, mit aus meiner Sicht durchaus ungewissem Ausgang. Dazu drei Thesen: 1. Wir leben in einer Gesellschaft, deren öffentliche, normativ wirksame Diskurse uns unentwegt mit dem richtigen Umgang mit Sterben und Tod, mit Sterbenden und Toten vertraut machen (sollen). 2. Das Lebensende, das zukünftige, zu antizipierende eigene Sterben, die Sorge um den eigenen Tod wird zu einem individuellen Projekt, gleichsam zu einem letzten Lebensprojekt, welches von jedem selbst selbstbestimmt und vorsorglich zu gestalten ist. 3. Hierzu entwickelt sich eine finale, d.h. auf das je eigene Lebensende hin ausgerichtete Sorge-Kultur mit entsprechenden organisationalen Handlungsfeldern der Versorgung, Betreuung und Begleitung von Sterbenden und ihren Angehörigen, mit denen ein gutes Sterben als letzte Lebensphase des modernen Individuums institutionalisiert wird. In der Praxis bedeutet dies für die Menschen: Es müssen Überlegungen angestellt werden, wie man sich das eigene Sterben vorstellt (Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht). Es müssen Gespräche geführt werden mit der Familie, mit Ärzten, mit vertrauten Personen. Es müssen zu gegebener Zeit möglichst verlässliche Versorgungs- und Betreuungsnetze geknüpft, Behandlungsoptionen geprüft und der Umfang an gewünschter Begleitung geklärt werden: Sind Angehörige verfügbar, Hausarzt, Pflegedienst, ambulanter Hospizdienst, hat das nahe Klinikum eine Palliativstation oder gibt es gar ein stationäres Hospiz in der Nähe usw.? Wenn es soweit ist, müssen Entscheidungen getroffen und wirksame Maßnahmen in der Schmerzbehandlung, in der psychosozialen Unterstützung umgesetzt werden, am besten wäre noch alternativ dazu die Möglichkeit zu haben, alledem selbstbestimmt, nach eigenem Willen und zum gegebenen Zeitpunkt ein Ende setzen zu können Und dabei geht es gar nicht so sehr nur um die großen, einmal zu treffenden Entscheidungen zu Leben und Tod, 3
4 sondern insbesondere um die vielen kleinen, ganz praktischen Prozesse des alltäglichen Tuns oder Lassens am Lebensende, um das Prozessieren eines Mehr oder Weniger oder Gar nicht im Alltag der außeralltäglichen Krisensituation einer existenziell gefährdenden Erkrankung. All das bedeutet: Sterben geschieht nicht mehr einfach so, sondern: Sterben wird zunehmend riskanter! Und: Man hat nur einen Versuch, nichts kann rückgängig gemacht oder neu versucht werden. Eine falsche Berufsentscheidung kann durch eine Fortbildung gemildert oder durch eine Umschulung revidiert werden, der zweiten Ehe kann eine dritte folgen. Aber aus der Erfahrung des eigenen Sterbens kann aus Sicht des Betroffenen nichts gelernt werden, sollte es beim ersten Mal nicht so richtig geklappt haben. Dieses neue, riskante Sterben-Machen kontrastiert signifikant jenen gesellschaftlichen Umgang mit dem Sterben, wie er in der Terminologie der Theorie der Reflexiven Modernisierung nach Ulrich Beck u.a. für die einfache bürgerliche Moderne des 20 Jahrhunderts charakteristisch war. Es geht heute nicht nur um die bloße medizinische Versorgung von Sterbenden, und schon gar nicht um ein verstecktes, isoliertes einsames Gestorben-werden hinter den Kulissen, wie es der modernen Klinik der 1950er/60er vorgehalten wurde. Vielmehr radikalisiert die seit dem Ausgang des 20. Jahrhunderts deutlich erkennbare Modernisierung des Lebensendes die normative Vorstellung des je eigenen Lebens, welches das moderne, nun in allen Lebensbereichen durch und durch individualisierte Individuum aktiv gestaltend zu leben habe, und erweitert sie bis hin zum letzten Atemzug. Das bürgerliche Individuum organisiert, meistert, gestaltet sein Alltagsleben selbst, selbstbestimmt im Glauben darauf, dass es selbst entscheidet und handelt. Dieser Glauben, diese Grundeinstellung heißt nichts anderes: Wir wollen, sollen, ja müssen in vielen Bereichen unseres Lebens unser eigener Herr und Meister sein, der für sich all die großen und kleinen Lebensentscheidungen zu treffen hat und dabei das je eigene Leben möglichst gut zu gestalten sucht. Diesem je eigenen Leben des individualisierten Individuums korrespondiert in der radikalisierten Normativität das von jedem selbst selbstbestimmt und vorsorglich zu gestaltenden je eigenen guten Sterben, das möglichst schmerzfrei zu erfolgen hat und je selbstbestimmter umso würdevoller, gelungener erscheint. Diese Vorstellung ist der Dreh- und Angelpunkt der verschiedenen fach- und professionsspezifischen wie der öffentlichen, medial-politischen Diskurse rund um das gute Sterben, welche die institutionelle Programmatik all der neu entstandenen und noch entstehenden und ebenso der alten, aber neu auszurichtenden Sterbe-Organisationen liefern. Dort das herkömmliche Alten-/Pflegeheim und die Klinik, für die es jetzt gilt, Hospizkultur und Palliativkompetenz zu implementieren; hier die seit den 1980ern sich ausbreitenden Palliativstationen und Hospizeinrichtungen; und nicht zu vergessen selbstverständlich das Sterben zuhause mit dem Hausarzt, dem ambulanten Pflegedienst, ggf. ehrenamtlichen Helfern oder einem ambulanten multiprofessionellen Palliative Care Team. Noch in den 1950/60ern war Sterben als ein möglichst lange hinauszuschiebender, aber letztlich unvermeidlicher Betriebsunfall des modernen Gesundheitssystems zu kaschieren. Deshalb erfolgte das Abschieben des Sterbenden in das Stationsbadezimmer in der Klinik, wo die Ärzte einen großen Bogen darum machten und das Pflegepersonal verunsichert versuchte, die den klinischen Ablauf störende Sterbesituation irgendwie zu bewältigen. Sterben musste dem modernen Medizinsystem als Störfall gelten, weil die große Verheißung der Moderne darin bestand, jegliches Leid, welches in irgendeiner Form gesellschaftlich bearbeitbar erschien, aus dem Leben der Menschen auszutreiben. 4
5 Und dass immer mehr an menschlichen Leiderfahrungen für immer mehr Menschen als gesellschaftlich bearbeitbar, vermeidbar erschienen und durch moderne Institutionen minimiert oder gar vermieden werden konnten, ist eine große Erfolgsgeschichte der Moderne. Eng verbunden mit dieser Erfolgsgeschichte steht am Lebensende das moderne Versprechen des natürlichen Todes d.h. jeden Menschen bis an das Ende seiner natürlichen Lebensspanne zu bringen, die sich selbst in ihrer Natürlichkeit immer weiter nach hinten verschieben ließ durch bessere Lebensbedingungen, Ernährung, Hygiene, medizinische Versorgung, Wohlstand. Hier liegt die entscheidende Differenz zur vormodernen, traditionalen Gesellschaft, in der der Mensch sein diesseitiges Leben permanent von seiner Endlichkeit her gestaltete, die sich gleichsam zu jeder Zeit, zu jeden Tag, zu jeder Stunde manifestieren konnte. Im Zentrum jenes Denkens stand zum einen die Organisation des Alltagslebens im Angesicht des großen Gleichmachers Tod, der jeden, ob Herr oder Knecht, gleichermaßen traf und zum anderen das von der Religion dominierte Bewusstsein, jederzeit und bloß nicht unvorbereitet in den Status des ewigen Lebens im Jenseits (im Himmel oder in der Hölle) hinüberzuwechseln zu müssen. Das moderne Versprechen des natürlichen Todes hingegen erlaubt dem modernen Menschen heute, sein gesamtes, immer länger dauerndes Leben in der Bewusstseinshaltung von potentieller Unsterblichkeit zu leben. Wahrscheinlich haben die wenigstens der hier Anwesenden heute in der Früh ihr Zuhause verlassen mit der Überlegung, was noch erledigt sein, was noch vorsorglich in Ordnung gebracht sein müsste für den Fall, dass man am Abend und nie mehr wieder zurückkehren würde. Das alltägliche Leben in der Haltung von potentieller Unsterblichkeit zu leben gemeint als Austreibung von Lebensunsicherheit über die gesamte Lebensspanne hinweg, gilt bis heute. Und doch erleben, erfahren wir heute gleichzeitig ein Ende dieser Unsterblichkeit, eine Rückkehr des Bewusstseins von Sterblichkeit, aber ganz anders als in einem traditionalen Wahrnehmungs- und Deutungskontext wie vor 500 Jahren. Die Rede von der Rückkehr einer Ars Moriendi, auch wenn sie als Ars Moriendi Nova tituliert werden mag, ist aus meiner Sicht irreführend, denn es geht nicht nur um individuelle Vorbereitung im Glauben und die gottgefällige Gestaltungskunst des Gläubigen. Im Kern der Modernisierung des Lebensendes heute stehen diskursive Prozesse in Verbindung mit institutionell-organisatorischen Strukturierungsprozessen, die mit Macht, Herrschaft und mit sozialer Ungleichheit verbunden sind sowie neue Rollenanforderungen, neue Subjekte produzieren. Zu nennen sind der aktive, der aktivierte gute Sterbende, der deshalb gut stirbt, weil er vorgesorgt hat und selbstbestimmt agieren kann. Zu nennen sind auch die ihn in welchen Formen auch immer unterstützenden Angehörigen und die verschiedenen Sterbe-Arbeiter vom Hausarzt bis zum Ehrenamtlichen sowie viele andere, die alle an dem zu organisierenden letzten Lebensprojekt zu beteiligen sind und damit die institutionelle Aufbereitung des Lebensendes betreiben. Ich fasse kurz zusammen: Weil unsere alltagsweltliche Perspektive als Mitglieder dieser Gesellschaft heute wesentlich durch eine radikal individualistische Sichtweise geprägt ist, erscheint es uns so plausibel, das individualisierte Individuum mit Selbstbestimmung, Autonomie bis zum allerletzten Atemzug ins Zentrum unseres gesellschaftlichen Denkens zu rücken. Und deshalb korrespondiert die Vorstellung vom langen, selbstbestimmten, erfüllten, leidfreien und untersterblichen Leben der Moderne zwangsläufig mit dem mittlerweile ebenfalls als gestaltbar, bearbeitbar gedachten und als frei von Leid gewünschten Sterben in einer Reflexiven Moderne, in der sich die institutionelle Ordnung des Lebensende wie angedeutet grundlegend verändert. 5
6 Das individualisierte Sterben wird zunehmend riskanter, weil es reflexiv wird. Für wen genau in welchem Ausmaß dieses möglichst gute, riskante Sterben mit welchen Folgen möglich wird oder nicht erreichbar ist das wissen wir noch gar nicht, weil uns dazu die empirischen Erkenntnisse fehlen und wir noch mittendrin stecken in diesem großen gesellschaftlichen Laborexperiment der Neu-Ordnung des Lebensendes. (3) Folgerungen für den empirischen Blick auf das riskante Sterben in der Reflexiven Moderne In meinem letzten Schritt werde ich versuchen, eine knappe, schlaglichtförmige Forschungsprogrammatik für den empirischen Blick auf das riskante Sterben in der Reflexiven Moderne zu skizzieren, die sich aus den bisherigen Überlegungen ergibt. Wenn ich diese Skizze jetzt als Soziologe zeichne, der, aus der Tradition der Verstehenden Soziologie und der Theorie der Symbolischen Interaktion kommend, sich intensiver mit der Wissenssoziologie und vor allem mit dem Denken Michel Foucaults beschäftigt hat, geht es mir selbstredend nicht darum, apodiktisch genau dieses also mein Forschungsprogramm einzufordern. Vielmehr soll es hier nur als Diskussionsanregung dienen, was davon aus Sichtweise der hier verfolgten Projekte für eine Diskussion interessant, hilfreich oder vernachlässigbar bzw. einfach beiseite zu lassen wäre. Meine Forschungsprogrammatik umfasst vier Punkte: 1. Welche Forschungsstrategie am Lebensende? Weil wir uns mittendrin in einem gesellschaftlichen Labor-Experiment befinden, benötigen wir derzeit eine umfassende, häufig eher qualitative, weil explorative Empirie wir wissen noch gar nicht genau, wonach wir Ausschau halten, mit welchen Kategorien, Operationalisierungen und Hypothesen wir hantieren könnten. Deshalb gilt es, einen quantitativen und qualitativen Empirismus zu vermeiden und theoriegenerierend vorzugehen, weil nur eine empirisch gestützte Theoriebildung die Praxis informieren kann, indem sie die Theorie die Praxis über ihre eigenen praktischen Selbstverständlichkeiten und Unhinterfragbarkeiten aufklären kann. Ebenso gilt es für uns Wissenschaftler einer vorschnellen methodologischen Kanonisierung im Sinne einer Pseudo- Objektivierung des methodischen Vorgehens zu widerstehen. Denn es geht aus meiner Sicht weniger um das Sterben als ein objektiv abbildbares Phänomen, als vielmehr ganz grundlegend um Sterben als einem sozialen Prozess, mit dem Fokus auf die Wissens- und Handlungsebene des Sterben Machens. 2. Vom Diskurs zum Dispositiv: Diskurse als Generatoren wahren Sterbewissens und die Praxis des Sterben Machens Vor diesem Hintergrund gilt es, empirisch zu rekonstruieren, wie welche Leitvorstellungen, Werte und Normen zum guten Sterben, die das Denken, Wahrnehmen und Handeln von Menschen orientieren, entstehen, durchgesetzt und als wahres Wissen prozessiert werden. Der theoretischmethodologisch passende Instrument für die Rekonstruktion der diskursiven Herstellung und Durchsetzung wahren, d.h. Geltung beanspruchenden Wissens, das als für-wahr-genommen dann handlungswirksam wird, sind Diskursanalysen zu Sterben und Tod. Welche Wissenspolitiken fungieren wie als Wahrheitspolitiken und produzieren welche für wen geltende symbolische Ordnung(en) des Lebensendes? 6
7 Weil es dem empirischen Blick aber nicht nur um das Orientierung gebende, handlungsleitende wahre Wissen, um Leitvorstellungen, Normen und Werte, sondern auch um die Praxis selbst gehen muss, braucht es den empirisch-methodischen Zugriff auf die konkreten Formen des Sterben Machens (im Simmelschen Sinn). Empirisch zu rekonstruieren sind folglich die institutionellen Kontexte, in denen das riskanten Sterben raum-zeitlich situiert und mit Sterbe-Dingen (von der Schmerzpumpe bis zum Pflegebett) ausgestattet wird, mit Rollenerwartungen verbunden in konkreten sozialen Beziehungsformen alltagspraktisch ausgestaltet wird. Vor dem Hintergrund des Reflexiv-werdens dieser institutionellen Ausgestaltung des Sterbens, geht es dabei insbesondere darum, wie Deutungsungewissheit und Handlungsunsicherheit im praktischen Tun bearbeitet wird, wie versucht wird, Deutungsgewissheit und Handlungssicherheit herzustellen und eventuell gerade dadurch diese erneut irritiert werden, generell prekär bleiben oder solche Versuche letztlich auch scheitern mit welchen institutionellen Folgen und Nebenfolgen? Ein solcher Blick auf die Praxis, der in enger Verbindung zu den oben genannten Diskursanalysen steht, kann durch das Dispositivkonzept theoretisch begründet und mittels Dispositivanalysen methodologisch-methodisch umgesetzt werden. Welche Diskurse zum guten Sterben stehen mit welchen institutionellen Praktiken des Sterben Machens in einem erkennbaren Zusammenhang und verändern das moderne Sterbe-/Todesdispositiv zu einem reflexiv-modernen Sterbe- /Todesdispositiv? 3. Macht und Herrschaft Eng verbunden mit dieser Frage nach gesellschaftlichem Wandel entlang des Diskurs- und Dispositivkonzepts, welches auf das Zusammenspiel von Diskursen, Praktiken, ihren Objektivationen und die Herstellung von Subjekten abstellt (der gute Sterbende, der palliativ kompetente Hausarzt, der ehrenamtliche Sterbebegleiter), ist die Frage nach Macht und Herrschaft. Wem kommt in welchem institutionellen Setting praktisch die Definitions- und Deutungshoheit über das gute, das gelingende Sterben im Vergleich zum schlechten Sterben zu? Wer hat in welchem raumzeitlichen Setting Verfügungsmacht worüber über welche Sterbedinge, über Zeit, über Wissen, über welche Akteure des Sterbens usw., so dass sich letztlich z.b. die Differenz zwischen einem vom Sterbenden selbst zu disponierenden Sterben und dem von anderen, z.b. den Angehörigen, den Sterbearbeitern disponierten Sterben des Sterbenden erkennen lässt. 4. Schließlich: Die Frage nach sozialer Ungleichheit Die soweit skizzierte Frage nach Macht und Herrschaft in der praktischen Ausgestaltung des Sterben Machens führt zwangsläufig zur Frage nach sozialer Ungleichheit im riskanten, guten Sterben. Denn: Je mehr potentielle Unsterblichkeit durch das Bewusstsein des Sterbens als ein selbst zu gestaltendes letztes Lebensprojekt ersetzt wird, je mehr Sterben gestaltbar, organisierbar, riskanter wird, umso mehr wird dieses Sterben zu einem ungleichen Sterben, umso mehr wird Sterben selbst zum Ungleichheitsgenerator. Unser gesamtes Gesundheitssystem erweist sich bis heute deutlich als sozial ungleich. Bildung, Einkommen, Beruflicher Status und berufliches Prestige bestimmen wesentlich das Krankheitsrisiko über den Lebensverlauf hinweg sowie die durchschnittliche Lebenserwartung. Je höher die Positionierung in der Sozialstruktur unserer Gesellschaft, umso gesünder und länger lebt man. Es gibt keinen empirischen Grund anzunehmen, dass soziale Ungleichheitsverhältnisse in der Schwerstkrankheit am Lebensende, beim Sterben, sich plötzlich umkehren oder gänzlich auflösen. So 7
8 ist davon auszugehen: Je mehr Palliative Care und Hospizarbeit im Gesundheitssystem als Versorgung integriert sein werden, umso stärker werden sie die sozialen Ungleichheiten in unserer Gesellschaft beim Sterben reproduzieren und vielleicht sogar verstärken. Das ist eine empirisch zu klärende, aus meiner Sicht aber zentrale Frage. Schluss Dies führt mich direkt zum Schluss: Wie eingangs bei der Verkündung meines gegoogelten Sterbedatums bereits benannt, ist das WANN meines Todes gar nicht so interessant, das WIE meines Sterbens erscheint wichtiger. Aber auch über das WIE meines Lebensendes weiß ich schon einiges, denn ich bin Jahrgang 1960 und kenne meine Generation: Die Baby Boomer waren immer schon zu viele. Im Kindergarten, in der Schule, bei der Lehrstellen- und Studienplatzsuche, später in der Rente wird es genauso sein. Wir waren immer zu viele und werden immer zu viele sein. Wir werden auch am Lebensende, in den Krankenhäusern, Pflegeheimen zu viele sein, ja wir werden uns noch auf den Friedhöfen wechselseitig im Weg liegen, wenn nicht zumindest dort der Wandel der Bestattungskultur vom großen Sarg zur platzsparenden Urne für Entlastung sorgen wird. Und dieses Zuviel wird auch den mit hoher statistischer Wahrscheinlichkeit in hohem Alter, in multimorbidem Zustand, von uns zu durchlaufenden längeren Sterbensprozess kennzeichnen, häufig allein, ohne Familienpflege, zuviel an Einsamkeit, zuviel an Angewiesensein auf Fremde... und das alles wird für die Gesellschaft vor allem eine Kostenfrage sein: ein zuviel an Kosten! Und wie sehr mich dieses Schicksal treffen wird, wird vor allem eine Frage des sozialen Status sein als bayerischer Beamter mag das für mich zugegebenermaßen nicht ganz so ängstigend sein, als Soziologe, der auf die Gesellschaft schaut, ist diese Perspektive extrem beunruhigend. Wie jemand stirbt, palliativmedizinisch/-pflegerisch gut versorgt, wenn gewünscht ehrenamtlich begleitet etc., hängt derzeit z.b. vom Wohnort, von der umgebenden institutionell-organisatorischen Infrastruktur und dem jeweils zuhandenen sozialen Beziehungsgefüge ab (im Krankenhaus, Altenheim, zuhause etc.). Mehr noch: Wie viel Kapital braucht man heute und in Zukunft, um in dieser Gesellschaft gut sterben zu können? Z.B. als ökonomisches Kapital bei der Auswahl von Behandlungs- und Betreuungsoptionen?; als soziales Kapital im Sinne der Verfügbarkeit, des Zuhandenseins von unterstützenden sozialen Beziehungen? Je weniger Familie verfügbar sein wird, umso wichtiger werden weitere soziale Netzwerke, am besten mit Kontakten zu medizinischpflegerischen Profis, vielleicht kennt man auch Ehrenamtliche oder die Koordinatorin eines Hospizvereins? Wie viel kulturelles Kapital braucht es im Sinne von kulturell spezifischem Wissen darüber, wie unsere sozialen Unterstützungssysteme funktionieren, wo welche Formulare zu bewältigen sind, welche Informationsangebote wichtig sind? Kurz gesagt: Wer arm ist, hat nicht nur kein Geld, sondern auch keine Netzwerke und wenig Vertrauen in Institutionen. Er wird sich schwer tun mit dem guten Sterben. Sterben wird immer riskanter das bedeutet auch: Sterben benötigt immer mehr Vertrauen: in Personen ebenso wie in Institutionen. Dabei gilt: Je integrierter sich Menschen in eine Gesellschaft sehen, umso mehr Vertrauen können sie in die Institutionen und Organisationen, die diese Gesellschaft für die soziale Organisationen des Sterben-Machens bietet, entwickeln. Kann es also gutes Sterben für alle geben? Meine Antwort lautet: Nein, ein gutes Sterben für alle wird es nicht geben! 8
9 Die Ausgestaltung des gesellschaftlichen Zukunftslabors des guten Sterbens wird folglich anspruchsvoll und schwierig, aber ich selbst bin guter Dinge. Als junger Alter mit 50+, als best ager habe ich anders als diese merkwürdige Wahrscheinlichkeitsrechnung zu meiner Lebenserwartung mir weismachen will nach meinem Dafürhalten noch ca Jahre vor mir, bis das Ende kommt. Und damit habe ich noch jede Menge Zeit zur Vorsorge, zur Organisation meines riskanten Sterbens, das so will es die Gesellschaft der Weiterlebenden ein gutes Sterben sein soll. VIELEN DANK! 9
Riskantes Sterben Das Lebensende als sozialer Prozess
 Riskantes Sterben Das Lebensende als sozialer Prozess Werner Schneider, München, 10.7.2015 (unveröffentlichtes Manuskript, nicht zitierfähig und nicht zur Weitergabe bestimmt, weitere Literaturhinweise
Riskantes Sterben Das Lebensende als sozialer Prozess Werner Schneider, München, 10.7.2015 (unveröffentlichtes Manuskript, nicht zitierfähig und nicht zur Weitergabe bestimmt, weitere Literaturhinweise
Die Würde des Menschen ist unantastbar Eine Herausforderung moderner Palliativmedizin
 1 Die Würde des Menschen ist unantastbar Eine Herausforderung moderner Palliativmedizin Rede zur Eröffnung der Palliativstation am St.-Josef-Hospital in Bochum am 10.02.2016 Sehr geehrter Herr Dr. Hanefeld
1 Die Würde des Menschen ist unantastbar Eine Herausforderung moderner Palliativmedizin Rede zur Eröffnung der Palliativstation am St.-Josef-Hospital in Bochum am 10.02.2016 Sehr geehrter Herr Dr. Hanefeld
WHO Definition von "Palliative Care
 Palliative Care WHO Definition von "Palliative Care Palliative Care entspricht einer Haltung und Behandlung, welche die Lebensqualität von Patienten und ihren Angehörigen verbessern soll, wenn eine lebensbedrohliche
Palliative Care WHO Definition von "Palliative Care Palliative Care entspricht einer Haltung und Behandlung, welche die Lebensqualität von Patienten und ihren Angehörigen verbessern soll, wenn eine lebensbedrohliche
Unheilbar krank und jetzt?
 Unheilbar krank und jetzt? Wenn eine schwere Krankheit fortschreitet und keine Hoffnung auf Heilung besteht, treten schwierige Fragen in den Vordergrund: Wie viel Zeit bleibt mir noch? Wie verbringe ich
Unheilbar krank und jetzt? Wenn eine schwere Krankheit fortschreitet und keine Hoffnung auf Heilung besteht, treten schwierige Fragen in den Vordergrund: Wie viel Zeit bleibt mir noch? Wie verbringe ich
Fleherstraße Düsseldorf-Bilk Tel Fax
 Fleherstraße 1 40223 Düsseldorf-Bilk www.krebsberatungduesseldorf.de Tel. 0211-30 20 17 57 Fax. 0211-30 32 63 46 09.04.2014 Sabine Krebsgesellschaft Deiss - Krebsberatung NRW Düsseldorf Thema Psychoonkologische
Fleherstraße 1 40223 Düsseldorf-Bilk www.krebsberatungduesseldorf.de Tel. 0211-30 20 17 57 Fax. 0211-30 32 63 46 09.04.2014 Sabine Krebsgesellschaft Deiss - Krebsberatung NRW Düsseldorf Thema Psychoonkologische
Der Tod und die Familie Anmerkungen eines Familiensoziologen zur Modernisierung des Lebensendes
 Der Tod und die Familie Anmerkungen eines Familiensoziologen zur Werner Schneider, Universität Augsburg Tutzing 10. Dezember 2015 1 Kinder und Jugendliche sind unsterblich! Kindheit und Jugend sind gesellschaftlich
Der Tod und die Familie Anmerkungen eines Familiensoziologen zur Werner Schneider, Universität Augsburg Tutzing 10. Dezember 2015 1 Kinder und Jugendliche sind unsterblich! Kindheit und Jugend sind gesellschaftlich
Hospizarbeit und palliative Versorgung in Bayern - Bestandsaufnahme und Handlungsbedarf
 Margarethe Beck Hospizarbeit und palliative Versorgung in Bayern - Bestandsaufnahme und Handlungsbedarf Publikation Vorlage: Datei des Autors Eingestellt am 15. Mai 2009 unter www.hss.de/downloads/090428_rm_beck.pdf
Margarethe Beck Hospizarbeit und palliative Versorgung in Bayern - Bestandsaufnahme und Handlungsbedarf Publikation Vorlage: Datei des Autors Eingestellt am 15. Mai 2009 unter www.hss.de/downloads/090428_rm_beck.pdf
Dem Sterben Leben geben - Hospizarbeit im Landkreis Böblingen
 Dem Sterben Leben geben - Hospizarbeit im Landkreis Böblingen Natascha Affemann Gesamtleitung Ökumenischer Hospizdienst im Kirchenbezirk Böblingen Gesellschaftliche und demographische Rahmenbedingungen
Dem Sterben Leben geben - Hospizarbeit im Landkreis Böblingen Natascha Affemann Gesamtleitung Ökumenischer Hospizdienst im Kirchenbezirk Böblingen Gesellschaftliche und demographische Rahmenbedingungen
Wie sterben Menschen in Deutschland
 Südwestrundfunk Impuls Aufnahme: 15.11.2012 Sendung: 21.11.2012 Dauer: 05 38 Autor: Mirko Smiljanic Redaktion: Rainer Hannes ARD-Themenwoche Leben mit dem Tod (3) Wie sterben Menschen in Deutschland 2
Südwestrundfunk Impuls Aufnahme: 15.11.2012 Sendung: 21.11.2012 Dauer: 05 38 Autor: Mirko Smiljanic Redaktion: Rainer Hannes ARD-Themenwoche Leben mit dem Tod (3) Wie sterben Menschen in Deutschland 2
Ehrenamtlichkeit in Palliativnetzen - Die Hospizbewegung -
 Ehrenamtlichkeit in Palliativnetzen - Die Hospizbewegung - Workshop im Rahmen der Tagung Evangelische Pflege Akademie Hofgeismar Mittwoch, 28. Februar 2007, 15.45 18.00 Uhr 1. Vorstellung: Wolfgang Schopp,
Ehrenamtlichkeit in Palliativnetzen - Die Hospizbewegung - Workshop im Rahmen der Tagung Evangelische Pflege Akademie Hofgeismar Mittwoch, 28. Februar 2007, 15.45 18.00 Uhr 1. Vorstellung: Wolfgang Schopp,
ARD-Themenwoche Leben mit dem Tod (4)
 Südwestrundfunk Impuls Aufnahme: 15.11.2012 Sendung: 22.11.2012 Dauer: 05 31 Autor: Mirko Smiljanic Redaktion: Rainer Hannes ARD-Themenwoche Leben mit dem Tod (4) Wie möchten wir sterben? 2 Wie möchten
Südwestrundfunk Impuls Aufnahme: 15.11.2012 Sendung: 22.11.2012 Dauer: 05 31 Autor: Mirko Smiljanic Redaktion: Rainer Hannes ARD-Themenwoche Leben mit dem Tod (4) Wie möchten wir sterben? 2 Wie möchten
Insitutionalisierung - Eine Kulturtheorie am Beispiel des jagdlichen Brauchtums
 Geisteswissenschaft Deborah Falk Insitutionalisierung - Eine Kulturtheorie am Beispiel des jagdlichen Brauchtums Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung..3 2. Begriffsklärungen....4 2.1. Institution..4
Geisteswissenschaft Deborah Falk Insitutionalisierung - Eine Kulturtheorie am Beispiel des jagdlichen Brauchtums Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung..3 2. Begriffsklärungen....4 2.1. Institution..4
Malteser Hospizdienste St. Christophorus Dortmund
 Malteser Hospizdienste St. Christophorus Dortmund 15. November 2014 Aufbau des Hospizdienstes Ambulanter Hospiz und Palliativ- Beratungsdienst Kinder- und Jugendhospizdienst Trauerbegleitung Besuchsdienst
Malteser Hospizdienste St. Christophorus Dortmund 15. November 2014 Aufbau des Hospizdienstes Ambulanter Hospiz und Palliativ- Beratungsdienst Kinder- und Jugendhospizdienst Trauerbegleitung Besuchsdienst
Sterben Menschen mit geistiger Behinderung anders?
 Sterben Menschen mit geistiger Behinderung anders? Vortrag am 19.08.2011 im Rahmen der Tagung Hospizarbeit mit behinderten Menschen im Alter Dr. Katrin Grüber IMEW Die Gesellschafter 9 Gesellschafter aus
Sterben Menschen mit geistiger Behinderung anders? Vortrag am 19.08.2011 im Rahmen der Tagung Hospizarbeit mit behinderten Menschen im Alter Dr. Katrin Grüber IMEW Die Gesellschafter 9 Gesellschafter aus
Schöne neuen Welt? - Umgang mit Sterben
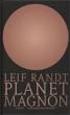 auf das Lebensende - Konturen einer Debatte Dr. Stefanie Becker Institut Alter Berner Fachhochschule Careum Tagung Das Ende planen?, 25. Juni 2015, Aarau Institut Dr. Stefanie Alter Berner Becker Fachhochschule
auf das Lebensende - Konturen einer Debatte Dr. Stefanie Becker Institut Alter Berner Fachhochschule Careum Tagung Das Ende planen?, 25. Juni 2015, Aarau Institut Dr. Stefanie Alter Berner Becker Fachhochschule
Leben dürfen sterben müssen. Oder manchmal eher umgekehrt? Dr. med. Roland Kunz Chefarzt Geriatrie und Palliative Care
 Leben dürfen - sterben müssen. Oder manchmal eher umgekehrt? Dr. med. Roland Kunz Chefarzt Geriatrie und Palliative Care Wir! Wir dürfen leben, im Hier und Jetzt! Wir müssen einmal sterben! Aber daran
Leben dürfen - sterben müssen. Oder manchmal eher umgekehrt? Dr. med. Roland Kunz Chefarzt Geriatrie und Palliative Care Wir! Wir dürfen leben, im Hier und Jetzt! Wir müssen einmal sterben! Aber daran
i n Inhaltsverzeichnis
 in 1. Einführung in den Untersuchungsgegenstand 1 2. Definitionen von Sterben und Tod 13 3. Der Tod als gesellschaftliches Phänomen 17 4. Der Umgang abendländischer Gesellschaften mit dem Tod von der Antike
in 1. Einführung in den Untersuchungsgegenstand 1 2. Definitionen von Sterben und Tod 13 3. Der Tod als gesellschaftliches Phänomen 17 4. Der Umgang abendländischer Gesellschaften mit dem Tod von der Antike
Theoretische Rahmenkonzepte
 Soziale Ungleichheit und Gesundheit: Die Relevanz von individuellem Verhalten und gesellschaftlichen Verhältnissen Theoretische Rahmenkonzepte Medizinische Versorgung Biologische und genetische Gegebenheiten
Soziale Ungleichheit und Gesundheit: Die Relevanz von individuellem Verhalten und gesellschaftlichen Verhältnissen Theoretische Rahmenkonzepte Medizinische Versorgung Biologische und genetische Gegebenheiten
Das neue Hospiz- und Palliativgesetz, ein Beitrag zur würdevollen Versorgung am Ende des Lebens. Till Hiddemann Bundesministerium für Gesundheit
 Das neue Hospiz- und Palliativgesetz, ein Beitrag zur würdevollen Versorgung am Ende des Lebens Till Hiddemann Bundesministerium für Gesundheit Sterbende Menschen gehören in die Mitte der Gesellschaft
Das neue Hospiz- und Palliativgesetz, ein Beitrag zur würdevollen Versorgung am Ende des Lebens Till Hiddemann Bundesministerium für Gesundheit Sterbende Menschen gehören in die Mitte der Gesellschaft
Palliative Basisversorgung
 Konzept Palliative Basisversorgung Altenpflegeheim St. Franziskus Achern Vernetzte palliative Basisversorgung in den Einrichtungen: Pflegeheim Erlenbad, Sasbach Altenpflegeheim St. Franziskus Sozialstation
Konzept Palliative Basisversorgung Altenpflegeheim St. Franziskus Achern Vernetzte palliative Basisversorgung in den Einrichtungen: Pflegeheim Erlenbad, Sasbach Altenpflegeheim St. Franziskus Sozialstation
Q D ie M e n s c h e n s te r b e n, w ie s ie g e le b t h a b e n... 13
 Inhalt Vorwort...11 Q D ie M e n s c h e n s te r b e n, w ie s ie g e le b t h a b e n... 13 Wer sich mit dem Tod befasst, ist zufriedener und hum orvoller...14 Der Tod ist des modernen Menschen grösster
Inhalt Vorwort...11 Q D ie M e n s c h e n s te r b e n, w ie s ie g e le b t h a b e n... 13 Wer sich mit dem Tod befasst, ist zufriedener und hum orvoller...14 Der Tod ist des modernen Menschen grösster
25. Dresdner Pflegestammtisch
 25. Dresdner Pflegestammtisch Würdevolle Begleitung am Lebensende Hospizarbeit, Palliativversorgung und Trauerarbeit Den Vortrag hält: Claudia Schöne Fachbereichsleiterin Pflegeleistungen Geschichte der
25. Dresdner Pflegestammtisch Würdevolle Begleitung am Lebensende Hospizarbeit, Palliativversorgung und Trauerarbeit Den Vortrag hält: Claudia Schöne Fachbereichsleiterin Pflegeleistungen Geschichte der
046 Bedürfnisse in der letzten Lebensphase: Wenn nichts mehr zu machen ist...
 046 Bedürfnisse in der letzten Lebensphase: Wenn nichts mehr zu machen ist... Menschen in ihren letzten Lebenstagen und -stunden und deren Angehörige zu begleiten, ist eine ehrenvolle und ganz besondere
046 Bedürfnisse in der letzten Lebensphase: Wenn nichts mehr zu machen ist... Menschen in ihren letzten Lebenstagen und -stunden und deren Angehörige zu begleiten, ist eine ehrenvolle und ganz besondere
Palliativmedizin. Eine Herausforderung für unser Gesundheitssystem. Stephanie Rapp Allgemeinmedizin Palliativmedizin
 Palliativmedizin Eine Herausforderung für unser Gesundheitssystem Stephanie Rapp Allgemeinmedizin Palliativmedizin Definition WHO 2002 Palliativmedizin ist die aktive, ganzheitliche Behandlung von Patienten
Palliativmedizin Eine Herausforderung für unser Gesundheitssystem Stephanie Rapp Allgemeinmedizin Palliativmedizin Definition WHO 2002 Palliativmedizin ist die aktive, ganzheitliche Behandlung von Patienten
Julia Klöckner, MdL. Vorsitzende der CDU-Fraktion im Landtag von Rheinland-Pfalz. Orientierungsdebatte zur Sterbebegleitung
 Julia Klöckner, MdL Vorsitzende der CDU-Fraktion im Landtag von Rheinland-Pfalz Redebeitrag zur Plenarsitzung zu Tagesordnungspunkt 14 93. Plenarsitzung, Donnerstag, 19. März 2015 Orientierungsdebatte
Julia Klöckner, MdL Vorsitzende der CDU-Fraktion im Landtag von Rheinland-Pfalz Redebeitrag zur Plenarsitzung zu Tagesordnungspunkt 14 93. Plenarsitzung, Donnerstag, 19. März 2015 Orientierungsdebatte
Was bleibt? Nachhaltige Palliative Kultur im Alten- und Pflegeheim
 Was bleibt? Nachhaltige Palliative Kultur im Alten- und Pflegeheim 6. Fachtagung Palliative Geriatrie Berlin Katharina Heimerl, 7.10.2011 katharina.heimerl@uni-klu.ac.at Palliative Care im Pflegeheim In
Was bleibt? Nachhaltige Palliative Kultur im Alten- und Pflegeheim 6. Fachtagung Palliative Geriatrie Berlin Katharina Heimerl, 7.10.2011 katharina.heimerl@uni-klu.ac.at Palliative Care im Pflegeheim In
Palliative Care. In der Begleitung von Menschen mit geistiger Behinderung
 Palliative Care In der Begleitung von Menschen mit geistiger Behinderung DGKS Patrizia Pichler Trainerin für Palliative Care und Hospizarbeit Lebens - und Trauerbegleiterin www.patrizia-pichler.com info@patrizia-pichler.com
Palliative Care In der Begleitung von Menschen mit geistiger Behinderung DGKS Patrizia Pichler Trainerin für Palliative Care und Hospizarbeit Lebens - und Trauerbegleiterin www.patrizia-pichler.com info@patrizia-pichler.com
Beihilfe zur Selbsttötung, Tötung aus Mitleid, Tötung auf Verlangen?
 Beihilfe zur Selbsttötung, Tötung aus Mitleid, Tötung auf Verlangen? Eine theologisch-ethische und seelsorgerische Beurteilung Prof. Dr. theol. Ulrich Eibach, Ev. Theol. Fakultät Uni Bonn und Klinikseelsorge
Beihilfe zur Selbsttötung, Tötung aus Mitleid, Tötung auf Verlangen? Eine theologisch-ethische und seelsorgerische Beurteilung Prof. Dr. theol. Ulrich Eibach, Ev. Theol. Fakultät Uni Bonn und Klinikseelsorge
Die Würde des Menschen ist unantastbar
 Die Würde des Menschen ist unantastbar In gesundheitlichen Extremsituationen und am Ende des Lebens Dr. Susanne Roller Palliativstation St. Johannes von Gott Krankenhaus Barmherzige Brüder München Gibt
Die Würde des Menschen ist unantastbar In gesundheitlichen Extremsituationen und am Ende des Lebens Dr. Susanne Roller Palliativstation St. Johannes von Gott Krankenhaus Barmherzige Brüder München Gibt
Referentin: Elisabeth Nüßlein, Dipl. Sozialpädagogin, ausgebildete Trauerbegleiterin, Referentin für Hospizarbeit, Gruppentherapeutin
 Referentin: Elisabeth Nüßlein, Dipl. Sozialpädagogin, ausgebildete Trauerbegleiterin, Referentin für Hospizarbeit, Gruppentherapeutin Gesellschaftliche Rahmenbedingungen Definition von Trauer Psychische
Referentin: Elisabeth Nüßlein, Dipl. Sozialpädagogin, ausgebildete Trauerbegleiterin, Referentin für Hospizarbeit, Gruppentherapeutin Gesellschaftliche Rahmenbedingungen Definition von Trauer Psychische
Wie möchten die Menschen sterben. Welche Probleme ergeben sich daraus? Dr.med. Regula Schmitt Tila Stiftung, Bern
 Wie möchten die Menschen sterben Welche Probleme ergeben sich daraus? Dr.med. Regula Schmitt Tila Stiftung, Bern Wie möchten wir sterben? Hinüberschlafen aus voller Gesundheit heraus Ohne Schmerzen und
Wie möchten die Menschen sterben Welche Probleme ergeben sich daraus? Dr.med. Regula Schmitt Tila Stiftung, Bern Wie möchten wir sterben? Hinüberschlafen aus voller Gesundheit heraus Ohne Schmerzen und
1. Mit dem Thema Sterben habe ich mich durch folgende Ereignisse auseinander gesetzt:
 Patientenverfügung Familienname: Vorname: geb. am: Anschrift: 1. Mit dem Thema Sterben habe ich mich durch folgende Ereignisse auseinander gesetzt: Pflege und Sterbebegleitung eines nahen Angehörigen Erfahrungen
Patientenverfügung Familienname: Vorname: geb. am: Anschrift: 1. Mit dem Thema Sterben habe ich mich durch folgende Ereignisse auseinander gesetzt: Pflege und Sterbebegleitung eines nahen Angehörigen Erfahrungen
Erfahrungen beim Aufbau eines Palliative Care Teams. Fridtjof Biging Pflegeberatung Palliative Care Hochtaunuskliniken Bad Homburg ggmbh
 Erfahrungen beim Aufbau eines Palliative Care Teams Fridtjof Biging Pflegeberatung Palliative Care Hochtaunuskliniken Bad Homburg ggmbh Überblick Überblick über die Hochtaunuskliniken Definition Palliative
Erfahrungen beim Aufbau eines Palliative Care Teams Fridtjof Biging Pflegeberatung Palliative Care Hochtaunuskliniken Bad Homburg ggmbh Überblick Überblick über die Hochtaunuskliniken Definition Palliative
Modelle vernetzter Palliativversorgung. Standortbestimmung Möglichkeiten Gefahren
 Modelle vernetzter Palliativversorgung Standortbestimmung Möglichkeiten Gefahren Begriffsverwirrung Palliative Care Hospizarbeit Palliativmedizin Seelsorge Palliativpflege Psychosoziale Begleitung Palliative
Modelle vernetzter Palliativversorgung Standortbestimmung Möglichkeiten Gefahren Begriffsverwirrung Palliative Care Hospizarbeit Palliativmedizin Seelsorge Palliativpflege Psychosoziale Begleitung Palliative
Informationen für Anfragende 1. Bescheinigung der Hospiznotwendigkeit 2. Erläuterungen zur Hospiznotwendigkeit 3. Antrag auf Hospizaufnahme 4
 Leitfaden zur Hospizaufnahme Hospiz Naila Inhalt Seite Informationen für Anfragende 1 Bescheinigung der Hospiznotwendigkeit 2 Erläuterungen zur Hospiznotwendigkeit 3 Antrag auf Hospizaufnahme 4 Ärztlicher
Leitfaden zur Hospizaufnahme Hospiz Naila Inhalt Seite Informationen für Anfragende 1 Bescheinigung der Hospiznotwendigkeit 2 Erläuterungen zur Hospiznotwendigkeit 3 Antrag auf Hospizaufnahme 4 Ärztlicher
Wünsche in Worte kleiden den letzten Lebensabschnitt besprechen.
 Wünsche in Worte kleiden den letzten Lebensabschnitt besprechen. www.pallnetz.ch Ideen für den Einstieg ins Gespräch mit Angehörigen und Bezugspersonen 1 Wie sterben? Inhalt Wünsche in Worte kleiden. Den
Wünsche in Worte kleiden den letzten Lebensabschnitt besprechen. www.pallnetz.ch Ideen für den Einstieg ins Gespräch mit Angehörigen und Bezugspersonen 1 Wie sterben? Inhalt Wünsche in Worte kleiden. Den
Faktenbox zur palliativen Versorgung nach Lungenkrebsdiagnose
 Faktenbox zur palliativen Versorgung nach Lungenkrebsdiagnose Was ist das Ziel einer palliativen Versorgung? Palliative Versorgung hilft Patienten, die aufgrund einer weit fortgeschrittenen Krankheit eine
Faktenbox zur palliativen Versorgung nach Lungenkrebsdiagnose Was ist das Ziel einer palliativen Versorgung? Palliative Versorgung hilft Patienten, die aufgrund einer weit fortgeschrittenen Krankheit eine
Patientenverfügung. Ich,. geb. am. wohnhaft in...
 Patientenverfügung Ich,. (Name) (Vorname) geb. am. wohnhaft in... verfasse hiermit für den Fall, dass ich meinen Willen nicht mehr bilden oder verständlich äußern kann, folgende Patientenverfügung: Ich
Patientenverfügung Ich,. (Name) (Vorname) geb. am. wohnhaft in... verfasse hiermit für den Fall, dass ich meinen Willen nicht mehr bilden oder verständlich äußern kann, folgende Patientenverfügung: Ich
Möglichkeiten der palliativmedizinischen und hospizlichen Versorgung
 Möglichkeiten der palliativmedizinischen und hospizlichen Versorgung 28. Juni 2014 Ars moriendi nova - Die neue Kunst zu sterben Vom bewussten Umgang mit dem Ende des Lebens Evangelische Akademie Lutherstadt
Möglichkeiten der palliativmedizinischen und hospizlichen Versorgung 28. Juni 2014 Ars moriendi nova - Die neue Kunst zu sterben Vom bewussten Umgang mit dem Ende des Lebens Evangelische Akademie Lutherstadt
Rede zum Thema. Patientenverfügung. gehalten vor dem XVI. Deutschen Bundestag Berlin, den 29. März Sperrfrist: Beginn der Rede!
 Thomas Rachel MdB Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung Bundesvorsitzender des Evangelischen Arbeitskreises der CDU / CSU (EAK) Rede zum Thema Patientenverfügung
Thomas Rachel MdB Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung Bundesvorsitzender des Evangelischen Arbeitskreises der CDU / CSU (EAK) Rede zum Thema Patientenverfügung
Checkliste Palliative Care in der Gemeinde
 Checkliste Palliative Care in der Gemeinde Schritt 1: Personen/ Organisationen Alle Personen und Organisationen die in der Gemeinde in einer palliativen Situation zum Einsatz kommen könnten, sind deklariert.
Checkliste Palliative Care in der Gemeinde Schritt 1: Personen/ Organisationen Alle Personen und Organisationen die in der Gemeinde in einer palliativen Situation zum Einsatz kommen könnten, sind deklariert.
Sterbebegleitung Sterbehilfe gegen die Begriffsverwirrung und für christliche Zuwendung auf einem entscheidenden Weg Sterbebegleitung aktiv indirekt a
 Sterbebegleitung Sterbehilfe gegen die Begriffsverwirrung und für christliche Zuwendung auf einem entscheidenden Weg Hauptabteilung II -Seelsorge, Abteilung Altenseelsorge, 86140 Augsburg, Tel. 0821/3166-2222,
Sterbebegleitung Sterbehilfe gegen die Begriffsverwirrung und für christliche Zuwendung auf einem entscheidenden Weg Hauptabteilung II -Seelsorge, Abteilung Altenseelsorge, 86140 Augsburg, Tel. 0821/3166-2222,
Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit nach Peter L. Berger und Thomas Luckmann
 Geisteswissenschaft Andrea Müller Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit nach Peter L. Berger und Thomas Luckmann Studienarbeit DIE SOZIALE KONSTRUKTION DER WIRKLICHKEIT NACH PETER L. BERGER UND THOMAS
Geisteswissenschaft Andrea Müller Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit nach Peter L. Berger und Thomas Luckmann Studienarbeit DIE SOZIALE KONSTRUKTION DER WIRKLICHKEIT NACH PETER L. BERGER UND THOMAS
Pflege und Versorgung von Menschen in der letzten Lebensphase Der Palliativ-Geriatrische Dienst
 Pflege und Versorgung von Menschen in der letzten Lebensphase Der Palliativ-Geriatrische Dienst Hans Steil Gregor Sattelberger Christophorus Hospiz Verein e.v. München Palliativ-Geriatrischer Dienst (PGD)
Pflege und Versorgung von Menschen in der letzten Lebensphase Der Palliativ-Geriatrische Dienst Hans Steil Gregor Sattelberger Christophorus Hospiz Verein e.v. München Palliativ-Geriatrischer Dienst (PGD)
eßlich ihrer Koordination insbesondere zur Schmerztherapie und Symptomkontrolle
 37b Ambulante Palliativversorgung (1) Versicherte mit einer nicht heilbaren, fortschreitenden und weit fortgeschrittenen Erkrankung bei einer zugleich begrenzten Lebenserwartung, die eine besonders aufwändige
37b Ambulante Palliativversorgung (1) Versicherte mit einer nicht heilbaren, fortschreitenden und weit fortgeschrittenen Erkrankung bei einer zugleich begrenzten Lebenserwartung, die eine besonders aufwändige
Sterben in Luxemburg
 Sterben in Luxemburg Ein gezielter Blick auf die Situation in CIPAs und Pflegeheimen Marie-France Liefgen Omega 90 0 Untersuchte Stichprobe: Bewohner von Pflegeheimen In der Erhebung wurden bewusst undifferenziert
Sterben in Luxemburg Ein gezielter Blick auf die Situation in CIPAs und Pflegeheimen Marie-France Liefgen Omega 90 0 Untersuchte Stichprobe: Bewohner von Pflegeheimen In der Erhebung wurden bewusst undifferenziert
Das Geheimnis des Lebens berühren - Spiritualität bei Krankheit, Sterben, Tod
 Das Geheimnis des Lebens berühren - Spiritualität bei Krankheit, Sterben, Tod Eine Grammatik für Helfende Bearbeitet von Erhard Weiher 2., durchgesehene und ergänzte Auflage 2009. Taschenbuch. 358 S. Paperback
Das Geheimnis des Lebens berühren - Spiritualität bei Krankheit, Sterben, Tod Eine Grammatik für Helfende Bearbeitet von Erhard Weiher 2., durchgesehene und ergänzte Auflage 2009. Taschenbuch. 358 S. Paperback
So möchte ich leben. So möchte ich sterben.
 So möchte ich leben. So möchte ich sterben. Medizinische Vorsorge am Lebensende Möglichkeiten der Vorsorge Patientenverfügung Willenserklärung zu Art und Umfang der gewünschten Behandlung im Falle der
So möchte ich leben. So möchte ich sterben. Medizinische Vorsorge am Lebensende Möglichkeiten der Vorsorge Patientenverfügung Willenserklärung zu Art und Umfang der gewünschten Behandlung im Falle der
Palliativversorgung im Pflegeheim
 Palliativversorgung im Pflegeheim Arbeitsgruppe Palliative Care in stationären Pflegeeinrichtungen des Schleswig Holsteinischen Hospiz- und Palliativverbandes (HPVSH) Lebenserwartung und Todesfälle Deutschland
Palliativversorgung im Pflegeheim Arbeitsgruppe Palliative Care in stationären Pflegeeinrichtungen des Schleswig Holsteinischen Hospiz- und Palliativverbandes (HPVSH) Lebenserwartung und Todesfälle Deutschland
Sterben für Anfänger
 Susanne Conrad Sterben für Anfänger Wie wir den Umgang mit dem Tod neu lernen können Ullstein ISBN 978-3-550-08052-4 2013 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Alle Rechte vorbehalten Lektorat: Heike Gronemeier
Susanne Conrad Sterben für Anfänger Wie wir den Umgang mit dem Tod neu lernen können Ullstein ISBN 978-3-550-08052-4 2013 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Alle Rechte vorbehalten Lektorat: Heike Gronemeier
Charta der Rechte der hilfeund pflegebedürftigen Menschen Qualitätsmaßstab für Pflege/Betreuung
 Charta der Rechte der hilfeund pflegebedürftigen Menschen Qualitätsmaßstab für Pflege/Betreuung Auswirkungen bei der Umsetzung in der Pflege Der Deutsche Verband der Leitungskräfte von Alten- und Behinderteneinrichtungen
Charta der Rechte der hilfeund pflegebedürftigen Menschen Qualitätsmaßstab für Pflege/Betreuung Auswirkungen bei der Umsetzung in der Pflege Der Deutsche Verband der Leitungskräfte von Alten- und Behinderteneinrichtungen
Die palliative Versorgung im stationären Hospiz
 Die palliative Versorgung im stationären Hospiz Wolfgang George TransMIT-Projektbereich für Versorgungsforschung, Gießen Vortrag anlässlich BIVA-Fachtagung 2016 Vorarbeiten zum Thema Sterben in Institutionen
Die palliative Versorgung im stationären Hospiz Wolfgang George TransMIT-Projektbereich für Versorgungsforschung, Gießen Vortrag anlässlich BIVA-Fachtagung 2016 Vorarbeiten zum Thema Sterben in Institutionen
Sozialdienst. Unsere Leistungen. Höchstgelegene Lungenfachklinik Deutschlands
 Sozialdienst Unsere Leistungen Höchstgelegene Lungenfachklinik Deutschlands Der Sozialdienst der Klinik St. Blasien GmbH Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, sehr geehrte Damen und Herren, im
Sozialdienst Unsere Leistungen Höchstgelegene Lungenfachklinik Deutschlands Der Sozialdienst der Klinik St. Blasien GmbH Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, sehr geehrte Damen und Herren, im
Soziale Arbeit in Hospizarbeit und Palliative Care Perspektiven aus Grossbritannien und Europa
 Soziale Arbeit in Hospizarbeit und Palliative Care Perspektiven aus Grossbritannien und Europa Andrea Dechamps St Christopher s Hospice, London / St Wilfrid s Hospice, Eastbourne In der Praxis - wie schaut
Soziale Arbeit in Hospizarbeit und Palliative Care Perspektiven aus Grossbritannien und Europa Andrea Dechamps St Christopher s Hospice, London / St Wilfrid s Hospice, Eastbourne In der Praxis - wie schaut
Begrüßungsrede. von. Maria Krautzberger, Präsidentin des Umweltbundesamtes, anlässlich der Podiumsdiskussion. Selbstverbrennung oder Transformation.
 Begrüßungsrede von Maria Krautzberger, Präsidentin des Umweltbundesamtes, anlässlich der Podiumsdiskussion Selbstverbrennung oder Transformation. Mit Kunst und Kultur aus der Klimakrise? am 15. Juli, in
Begrüßungsrede von Maria Krautzberger, Präsidentin des Umweltbundesamtes, anlässlich der Podiumsdiskussion Selbstverbrennung oder Transformation. Mit Kunst und Kultur aus der Klimakrise? am 15. Juli, in
Referat: TRANSKULTURELLER PFLEGEDIENST
 Fachtagung Interkulturelle Öffnung Bremen 16.10,.2007 Referat: TRANSKULTURELLER PFLEGEDIENST Interkulturelle Kompetenz gewinnt in der ambulanten und stationären Pflege zunehmend an Bedeutung, weil immer
Fachtagung Interkulturelle Öffnung Bremen 16.10,.2007 Referat: TRANSKULTURELLER PFLEGEDIENST Interkulturelle Kompetenz gewinnt in der ambulanten und stationären Pflege zunehmend an Bedeutung, weil immer
Unterstützung für Einzelne und Familien bei schwerer Krankheit und Trauer
 Unterstützung für Einzelne und Familien bei schwerer Krankheit und Trauer Hospiz- und Palliativ beratungsdienst Potsdam »Man stirbt wie wie man man lebt; lebt; das Sterben gehört zum Leben, das Sterben
Unterstützung für Einzelne und Familien bei schwerer Krankheit und Trauer Hospiz- und Palliativ beratungsdienst Potsdam »Man stirbt wie wie man man lebt; lebt; das Sterben gehört zum Leben, das Sterben
Soziale Arbeit in Hospizarbeit und Palliative Care in Deutschland eine Bestandsaufnahme. Prof. Dr. Maria Wasner
 Soziale Arbeit in Hospizarbeit und Palliative Care in Deutschland eine Bestandsaufnahme Prof. Dr. Maria Wasner Sterben und Tod ist doch ein Exotenthema in der Sozialen Arbeit Fakten I??? Sozialarbeiter
Soziale Arbeit in Hospizarbeit und Palliative Care in Deutschland eine Bestandsaufnahme Prof. Dr. Maria Wasner Sterben und Tod ist doch ein Exotenthema in der Sozialen Arbeit Fakten I??? Sozialarbeiter
Das erste Mal Erkenntnistheorie
 Das erste Mal... Das erste Mal...... Erkenntnistheorie Systemische Therapie hat nicht nur theoretische Grundlagen, sie hat sich in der letzten Dekade auch in verschiedene Richtungen und Ansätze aufgesplittert
Das erste Mal... Das erste Mal...... Erkenntnistheorie Systemische Therapie hat nicht nur theoretische Grundlagen, sie hat sich in der letzten Dekade auch in verschiedene Richtungen und Ansätze aufgesplittert
Thema kompakt Hospizarbeit und Palliativversorgung
 Thema kompakt Hospizarbeit und Palliativversorgung Zentrum Kommunikation Pressestelle Caroline-Michaelis-Straße 1 10115 Berlin Telefon: +49 30 65211-1780 Telefax: +49 30 65211-3780 pressestelle@diakonie.de
Thema kompakt Hospizarbeit und Palliativversorgung Zentrum Kommunikation Pressestelle Caroline-Michaelis-Straße 1 10115 Berlin Telefon: +49 30 65211-1780 Telefax: +49 30 65211-3780 pressestelle@diakonie.de
Interdisziplinäres Zentrum für Palliativmedizin. Sterbeorte in Deutschland
 1 Interdisziplinäres Zentrum für Palliativmedizin www.izp-muenchen.de Sterbeorte in Deutschland Krankenhaus 42-43% Zuhause 25-30% Heim 15-25% (steigend) Hospiz 1-2% Palliativstation 1-2% andere Orte 2-5%
1 Interdisziplinäres Zentrum für Palliativmedizin www.izp-muenchen.de Sterbeorte in Deutschland Krankenhaus 42-43% Zuhause 25-30% Heim 15-25% (steigend) Hospiz 1-2% Palliativstation 1-2% andere Orte 2-5%
Soziale Arbeit in Hospiz und Palliative Care
 Johann-Christoph Student Albert Mühlum Ute Student Soziale Arbeit in Hospiz und Palliative Care Mit 6 Abbildungen und 3 Tabellen 3., vollständig überarbeitete Auflage Unter Mitarbeit von Swantje Goebel
Johann-Christoph Student Albert Mühlum Ute Student Soziale Arbeit in Hospiz und Palliative Care Mit 6 Abbildungen und 3 Tabellen 3., vollständig überarbeitete Auflage Unter Mitarbeit von Swantje Goebel
Aktuelle Angebote und Strukturen für die hospizliche-und palliative Versorgung schwerstkranker und sterbender Menschen
 Aktuelle Angebote und Strukturen für die hospizliche-und palliative Versorgung schwerstkranker und sterbender Menschen Ilka Jope, Krankenschwester, MAS Palliative Care - freiberufliche Dozentin Thüringer
Aktuelle Angebote und Strukturen für die hospizliche-und palliative Versorgung schwerstkranker und sterbender Menschen Ilka Jope, Krankenschwester, MAS Palliative Care - freiberufliche Dozentin Thüringer
Palliative Care in der Schweiz. Christina Affentranger Weber Dipl. Gerontologin MAS/FH
 Palliative Care in der Schweiz Christina Affentranger Weber Dipl. Gerontologin MAS/FH 1 Die Bedeutung von Palliative Care in der Schweiz Heutzutage sterben in der Schweiz ca. 60 000 Menschen jedes Alters
Palliative Care in der Schweiz Christina Affentranger Weber Dipl. Gerontologin MAS/FH 1 Die Bedeutung von Palliative Care in der Schweiz Heutzutage sterben in der Schweiz ca. 60 000 Menschen jedes Alters
Wünsche für das Lebensende Über die Möglichkeiten und Grenzen vorausschauender Planung in Anbetracht von Situationen am Lebensende
 Wünsche für das Lebensende Über die Möglichkeiten und Grenzen vorausschauender Planung in Anbetracht von Situationen am Lebensende Michael Rogner Haus Gutenberg, 2014 1 Projektionsfläche ureigener Ängste.
Wünsche für das Lebensende Über die Möglichkeiten und Grenzen vorausschauender Planung in Anbetracht von Situationen am Lebensende Michael Rogner Haus Gutenberg, 2014 1 Projektionsfläche ureigener Ängste.
PATIENTENVERFÜGUNG. Name: Vorname: Geburtsort: Ausweis: Adresse: Errichtungsdatum:
 PATIENTENVERFÜGUNG Name: Vorname: Geburtsort: SVNr.: Geburtsdatum: Ausweis: Adresse: Telefon: Mobil: E-Mail: Errichtungsdatum: Internationale Gesellschaft für Sterbebegleitung und Lebensbeistand e.v. Hospizbewegung
PATIENTENVERFÜGUNG Name: Vorname: Geburtsort: SVNr.: Geburtsdatum: Ausweis: Adresse: Telefon: Mobil: E-Mail: Errichtungsdatum: Internationale Gesellschaft für Sterbebegleitung und Lebensbeistand e.v. Hospizbewegung
Foucaults "Was ist ein Autor" und "Subjekt und Macht"
 Geisteswissenschaft Nicole Friedrich Foucaults "Was ist ein Autor" und "Subjekt und Macht" Eine Annäherung Essay Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg Lektürekurs Foucault Sommersemester 2011
Geisteswissenschaft Nicole Friedrich Foucaults "Was ist ein Autor" und "Subjekt und Macht" Eine Annäherung Essay Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg Lektürekurs Foucault Sommersemester 2011
Ehrenamtliche Mitarbeit bei der Hospiz Initiative Wilhelmshaven Friesland e.v.
 HOSPIZ-INITIATIVE Wilhelmshaven-Friesland e.v. - Ambulanter Hospizdienst - Ehrenamtliche Mitarbeit bei der Hospiz Initiative Wilhelmshaven Friesland e.v. Schafft Euch ein Nebenamt, ein unscheinbares, womöglich
HOSPIZ-INITIATIVE Wilhelmshaven-Friesland e.v. - Ambulanter Hospizdienst - Ehrenamtliche Mitarbeit bei der Hospiz Initiative Wilhelmshaven Friesland e.v. Schafft Euch ein Nebenamt, ein unscheinbares, womöglich
Alter, Armut und Gesundheit
 Alter, Armut und Gesundheit Das Problem ist der graue Alltag Dr. Antje Richter-Kornweitz Hannover, 25. Oktober 2010 Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e.v.(lvg&afs
Alter, Armut und Gesundheit Das Problem ist der graue Alltag Dr. Antje Richter-Kornweitz Hannover, 25. Oktober 2010 Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e.v.(lvg&afs
Kinderhospiz Löwenherz Informationen für Eltern
 Kinderhospiz Löwenherz Informationen für Eltern 1 Am Tag der Diagnose wird plötzlich alles anders Wenn Eltern erfahren, dass ihr Kind an einer unheilbaren Krankheit leidet, erschüttert das die ganze Familie.
Kinderhospiz Löwenherz Informationen für Eltern 1 Am Tag der Diagnose wird plötzlich alles anders Wenn Eltern erfahren, dass ihr Kind an einer unheilbaren Krankheit leidet, erschüttert das die ganze Familie.
Wegschauen nicht erlaubt Hinsehen erwünscht. Ethikberatung in der Altenhilfe Ethisch entscheiden Bayerische Stiftung Hospiz
 Wegschauen nicht erlaubt Hinsehen erwünscht Ethikberatung in der Altenhilfe Ethisch entscheiden Bayerische Stiftung Hospiz 22.04.15 Pfarrerin Dorothea Bergmann Fachstelle Spiritualität Palliative Care
Wegschauen nicht erlaubt Hinsehen erwünscht Ethikberatung in der Altenhilfe Ethisch entscheiden Bayerische Stiftung Hospiz 22.04.15 Pfarrerin Dorothea Bergmann Fachstelle Spiritualität Palliative Care
Christliches Hospiz Haus Geborgenheit Neustadt / Südharz
 Christliches Hospiz Haus Geborgenheit Neustadt / Südharz Ein Hospiz für den Norden Thüringens und den Harz. Der Hospizgedanke Hospize bejahen das Leben, Hospize machen es sich zur Aufgabe, Menschen in
Christliches Hospiz Haus Geborgenheit Neustadt / Südharz Ein Hospiz für den Norden Thüringens und den Harz. Der Hospizgedanke Hospize bejahen das Leben, Hospize machen es sich zur Aufgabe, Menschen in
Spezialisierte Ambulante PalliativVersorgung (SAPV)
 Spezialisierte Ambulante PalliativVersorgung (SAPV)...zuhause leben bis zuletzt Lasst keinen zu Euch kommen, ohne dass er glücklicher wieder geht. (Mutter Teresa) SAPV Allgemeines Die Bundesregierung hat
Spezialisierte Ambulante PalliativVersorgung (SAPV)...zuhause leben bis zuletzt Lasst keinen zu Euch kommen, ohne dass er glücklicher wieder geht. (Mutter Teresa) SAPV Allgemeines Die Bundesregierung hat
BEREITS ERSCHIENEN. The Fall. - Prophezeiung eines Untergangs * * * Umstieg auf. Microsoft Word leicht gemacht * * * DIE VORSORGEVOLLMACHT
 1 BEREITS ERSCHIENEN The Fall - Prophezeiung eines Untergangs * * * Umstieg auf Microsoft Word 2007 leicht gemacht * * * DIE VORSORGEVOLLMACHT 2 DIE VORSORGEVOLLMACHT Marcel Niggemann 3 2008 Marcel Niggemann.
1 BEREITS ERSCHIENEN The Fall - Prophezeiung eines Untergangs * * * Umstieg auf Microsoft Word 2007 leicht gemacht * * * DIE VORSORGEVOLLMACHT 2 DIE VORSORGEVOLLMACHT Marcel Niggemann 3 2008 Marcel Niggemann.
Für mehr Lebensqualität
 Für mehr Lebensqualität Ambulante Krankenpflege und Hauspflege Gatz und Zippel GmbH Selbstbestimmt leben Pflegebedürftigkeit ist nicht immer eine Frage des Alters. Jeder Mensch kann ohne sein Zutun in
Für mehr Lebensqualität Ambulante Krankenpflege und Hauspflege Gatz und Zippel GmbH Selbstbestimmt leben Pflegebedürftigkeit ist nicht immer eine Frage des Alters. Jeder Mensch kann ohne sein Zutun in
Palliativversorgung im Pflegeheim. Arbeitsgruppe Palliative Care im Pflegeheim des Schleswig Holsteinischen Hospiz- und Palliativverbandes (HPVSH)
 Palliativversorgung im Pflegeheim Arbeitsgruppe Palliative Care im Pflegeheim des Schleswig Holsteinischen Hospiz- und Palliativverbandes (HPVSH) Lebenserwartung und Todesfälle Deutschland 2013 Lebenserwartung:
Palliativversorgung im Pflegeheim Arbeitsgruppe Palliative Care im Pflegeheim des Schleswig Holsteinischen Hospiz- und Palliativverbandes (HPVSH) Lebenserwartung und Todesfälle Deutschland 2013 Lebenserwartung:
Professur für Spiritual Care Michael Petery PRAXIS DER BETREUUNG SCHWERSTKRANKER UND STERBENDER IN BAYERISCHEN JÜDISCHEN GEMEINDEN
 Professur für Spiritual Care Michael Petery DIE GEGENWÄRTIGE PRAXIS DER BETREUUNG SCHWERSTKRANKER UND STERBENDER IN BAYERISCHEN JÜDISCHEN GEMEINDEN Jüdische Betreuung Schwerstkranker- eine vergessene Tradition
Professur für Spiritual Care Michael Petery DIE GEGENWÄRTIGE PRAXIS DER BETREUUNG SCHWERSTKRANKER UND STERBENDER IN BAYERISCHEN JÜDISCHEN GEMEINDEN Jüdische Betreuung Schwerstkranker- eine vergessene Tradition
Definitionen Konflikte Probleme
 Definitionen Konflikte Probleme Definitionen haben die Aufgabe, festzulegen/abzugrenzen, was mit einem Sachverhalt gemeint ist Definitionen führen Begriffe auf bekannte Begriffe zurück Z.B. Schimmel =
Definitionen Konflikte Probleme Definitionen haben die Aufgabe, festzulegen/abzugrenzen, was mit einem Sachverhalt gemeint ist Definitionen führen Begriffe auf bekannte Begriffe zurück Z.B. Schimmel =
Spirituelle Evaluation im Patientengespräch anhand des Modells STIW
 Spirituelle Evaluation im Patientengespräch anhand des Modells STIW Definitionsversuch von Spiritualität Spiritualität ist die Erfahrung mit dem ewig Anderen. ( DDr. Monika Renz) Spiritualität ist die
Spirituelle Evaluation im Patientengespräch anhand des Modells STIW Definitionsversuch von Spiritualität Spiritualität ist die Erfahrung mit dem ewig Anderen. ( DDr. Monika Renz) Spiritualität ist die
Haus CERES 1. Wachkomawohngemeinschaft in BaWÜ
 Haus CERES 1. Wachkomawohngemeinschaft in BaWÜ Selbstbestimmung trotz Hilfe- und Pflegebedarf Fachtagung, Plochingen am 25.November 2013 Annette Saur 1. Vorsitzende/Geschäftsführerin des CERES e.v. N E
Haus CERES 1. Wachkomawohngemeinschaft in BaWÜ Selbstbestimmung trotz Hilfe- und Pflegebedarf Fachtagung, Plochingen am 25.November 2013 Annette Saur 1. Vorsitzende/Geschäftsführerin des CERES e.v. N E
Wir über uns. Informationen zur Station 0.2// Mutter-Kind-Behandlung // Kompetent für Menschen.
 Wir über uns Informationen zur Station 0.2// Mutter-Kind-Behandlung // Kompetent für Menschen. 02 BEGRÜSSUNG Gesundheit ist das höchste Gut. Sie zu erhalten, haben wir uns zur Aufgabe gemacht. Wir heißen
Wir über uns Informationen zur Station 0.2// Mutter-Kind-Behandlung // Kompetent für Menschen. 02 BEGRÜSSUNG Gesundheit ist das höchste Gut. Sie zu erhalten, haben wir uns zur Aufgabe gemacht. Wir heißen
ECVET-konformes Curriculum der Altenpflege
 ECVET-konformes Curriculum der Altenpflege Entstanden im Projekt 2get1care Lebenslanges Lernen und Interprofessionalität in den Gesundheitsfachberufen (2011-2013) Dieses Projekt wurde mit Unterstützung
ECVET-konformes Curriculum der Altenpflege Entstanden im Projekt 2get1care Lebenslanges Lernen und Interprofessionalität in den Gesundheitsfachberufen (2011-2013) Dieses Projekt wurde mit Unterstützung
Haltungen in der Bevölkerung zur Palliativversorgung und zur ärztlich assistierten Selbsttötung eine repräsentative Umfrage
 Haltungen in der Bevölkerung zur Palliativversorgung und zur ärztlich assistierten Selbsttötung eine repräsentative Umfrage Saskia Jünger¹, Nils Schneider¹, Birgitt Wiese¹, Jochen Vollmann², Jan Schildmann²
Haltungen in der Bevölkerung zur Palliativversorgung und zur ärztlich assistierten Selbsttötung eine repräsentative Umfrage Saskia Jünger¹, Nils Schneider¹, Birgitt Wiese¹, Jochen Vollmann², Jan Schildmann²
Leben und Sterben in Würde
 Leben und Sterben in Würde Was ist Palliativmedizin? Palliativmedizin (von lat. palliare mit einem Mantel bedecken) kümmert sich um Menschen mit schweren, fortschreitenden oder unheilbaren Krankheiten.
Leben und Sterben in Würde Was ist Palliativmedizin? Palliativmedizin (von lat. palliare mit einem Mantel bedecken) kümmert sich um Menschen mit schweren, fortschreitenden oder unheilbaren Krankheiten.
2. Auflage. Patientenverfügung. Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung. Code im Buch für. kostenlosen Download
 2. Auflage Patientenverfügung Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung Code im Buch für kostenlosen Download Die Betreuungsverfügung 19 Die Verfügung/Vollmacht sollte so aufbewahrt werden, dass sie bei
2. Auflage Patientenverfügung Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung Code im Buch für kostenlosen Download Die Betreuungsverfügung 19 Die Verfügung/Vollmacht sollte so aufbewahrt werden, dass sie bei
ARD-Themenwoche Leben mit dem Tod (2)
 1 Südwestrundfunk Impuls Aufnahme: 15.11.2012 Sendung: 20.11.2012 Dauer: 05 41 Autor: Mirko Smiljanic Redaktion: Rainer Hannes ARD-Themenwoche Leben mit dem Tod (2) Was wissen wir über die Phase unmittelbar
1 Südwestrundfunk Impuls Aufnahme: 15.11.2012 Sendung: 20.11.2012 Dauer: 05 41 Autor: Mirko Smiljanic Redaktion: Rainer Hannes ARD-Themenwoche Leben mit dem Tod (2) Was wissen wir über die Phase unmittelbar
CME Grundlagen der Kommunikation zwischen Arzt und Patient. Teil 1
 CME Grundlagen der Kommunikation zwischen Arzt und Patient Teil 1 Inhaltsverzeichnis Teil 1 Einführung: Der Arzt als Kommunikations-Manager Was ist Kommunikation? Eine Erklärung Vom Arzt zum Patienten
CME Grundlagen der Kommunikation zwischen Arzt und Patient Teil 1 Inhaltsverzeichnis Teil 1 Einführung: Der Arzt als Kommunikations-Manager Was ist Kommunikation? Eine Erklärung Vom Arzt zum Patienten
Leben Abschied Tod Trost Trauer Leben
 Leben Abschied Tod Trost Trauer Leben Wir sind da, wenn es schwer wird. Hospiz Ulm e. V. Lichtensteinstraße 14/2, 89075 Ulm Telefon: 0731 509 733-0, Telefax: 0731 509 733-22 kontakt@hospiz-ulm.de, www.hospiz-ulm.de
Leben Abschied Tod Trost Trauer Leben Wir sind da, wenn es schwer wird. Hospiz Ulm e. V. Lichtensteinstraße 14/2, 89075 Ulm Telefon: 0731 509 733-0, Telefax: 0731 509 733-22 kontakt@hospiz-ulm.de, www.hospiz-ulm.de
Anrede, (es gilt das gesprochene Wort)
 Zwischenbilanz Initiative Hospizarbeit und Palliative Care 12. Juni 2007, Kreuzkirche, München Beitrag von Dr. Ludwig Markert, Präsident des Diakonischen Werks Bayern (es gilt das gesprochene Wort) Anrede,
Zwischenbilanz Initiative Hospizarbeit und Palliative Care 12. Juni 2007, Kreuzkirche, München Beitrag von Dr. Ludwig Markert, Präsident des Diakonischen Werks Bayern (es gilt das gesprochene Wort) Anrede,
HPCV-Studie: Hospizliche Begleitung
 Februar 2008 Sonder-Info Sonder-Info Sonder-Info Sonder-Info HPCV-Studie: Hospizliche Begleitung und Palliative-Care-Versorgung in Deutschland 2007 (Stand: 26.02.2008) Sonder Hospiz Info Brief 1 / 08 Seite
Februar 2008 Sonder-Info Sonder-Info Sonder-Info Sonder-Info HPCV-Studie: Hospizliche Begleitung und Palliative-Care-Versorgung in Deutschland 2007 (Stand: 26.02.2008) Sonder Hospiz Info Brief 1 / 08 Seite
Die Werbung für mehr Organspende bedeutet deshalb überaus große Sensibilität frühzeitige, behutsame, beständige Aufklärung.
 Sehr geehrter Herr Präsident/ Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Transplantationsgesetz hat zu einem hohen Maß an Rechtssicherheit geführt und ist eine unverzichtbare Grundlage für Vertrauensbildung
Sehr geehrter Herr Präsident/ Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Transplantationsgesetz hat zu einem hohen Maß an Rechtssicherheit geführt und ist eine unverzichtbare Grundlage für Vertrauensbildung
Begriffsdefinitionen
 Begriffsdefinitionen Sozialisation: Unter Sozialisation versteht man die Entstehung und Bildung der Persönlichkeit aufgrund ihrer Interaktion mit einer spezifischen materiellen, kulturellen und sozialen
Begriffsdefinitionen Sozialisation: Unter Sozialisation versteht man die Entstehung und Bildung der Persönlichkeit aufgrund ihrer Interaktion mit einer spezifischen materiellen, kulturellen und sozialen
verbessern Uni-Leipzig: Forschungsprojekt will deutschlandweit psychosoziale Versorgung junger Krebspatienten ve
 Uni-Leipzig Forschungsprojekt will deutschlandweit psychosoziale Versorgung junger Krebspatienten verbessern Leipzig (22. Januar 2014) - Die Deutsche Krebshilfe fördert ab Januar 2014 über einen Zeitraum
Uni-Leipzig Forschungsprojekt will deutschlandweit psychosoziale Versorgung junger Krebspatienten verbessern Leipzig (22. Januar 2014) - Die Deutsche Krebshilfe fördert ab Januar 2014 über einen Zeitraum
Die Karriere pflegender Angehöriger von Menschen im Wachkoma
 Die Karriere pflegender Angehöriger von Menschen im Wachkoma Dr. Annett Horn Universität Bielefeld, AG 6 Versorgungsforschung und Pflegewissenschaft Erkenntnisstand Folgen Wachkoma Häufig und oft gleichzeitig
Die Karriere pflegender Angehöriger von Menschen im Wachkoma Dr. Annett Horn Universität Bielefeld, AG 6 Versorgungsforschung und Pflegewissenschaft Erkenntnisstand Folgen Wachkoma Häufig und oft gleichzeitig
Patientenverfügung. Ich: geb. am: wohnhaft in:
 Patientenverfügung Eine Patientenverfügung macht es Ihnen möglich, Ihr Selbstbestimmungsrecht auch dann wahrzunehmen, wenn Ihre Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, eingeschränkt oder erloschen ist. Mit
Patientenverfügung Eine Patientenverfügung macht es Ihnen möglich, Ihr Selbstbestimmungsrecht auch dann wahrzunehmen, wenn Ihre Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, eingeschränkt oder erloschen ist. Mit
GRUNDBEGRIFFE DER SOZIOLOGIE. Markus Paulus. Radboud University Nijmegen DIPL.-PSYCH. (UNIV.), M.A.
 GRUNDBEGRIFFE DER SOZIOLOGIE Markus Paulus DIPL.-PSYCH. (UNIV.), M.A. Radboud University Nijmegen XIII, GRUNDZÜGE DER MODERNEN GESELLSCHAFT: SOZIALSTRUKTUR UND SOZIALER WANDEL II Begriffe: soziale Ungleichheit
GRUNDBEGRIFFE DER SOZIOLOGIE Markus Paulus DIPL.-PSYCH. (UNIV.), M.A. Radboud University Nijmegen XIII, GRUNDZÜGE DER MODERNEN GESELLSCHAFT: SOZIALSTRUKTUR UND SOZIALER WANDEL II Begriffe: soziale Ungleichheit
Zwischen Theorie und Praxis
 SAPV Zwischen Theorie und Praxis Die Möglichkeiten der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung Ein Vortrag von Barbara Spandau Palliativkompetenz: beraten-schulen-netzwerken Ziele für den heutigen
SAPV Zwischen Theorie und Praxis Die Möglichkeiten der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung Ein Vortrag von Barbara Spandau Palliativkompetenz: beraten-schulen-netzwerken Ziele für den heutigen
Weinfelder. Predigt. Auferstehung? Dezember 2013 Nr Markus 12,18-25
 Weinfelder Dezember 2013 Nr. 749 Predigt Auferstehung? Markus 12,18-25 von Pfr. Johannes Bodmer gehalten am 24.11.2013 Markus 12,18-25 18 Die Sadduzäer kamen zu Jesus. Sie bestreiten, daß die Toten auferstehen
Weinfelder Dezember 2013 Nr. 749 Predigt Auferstehung? Markus 12,18-25 von Pfr. Johannes Bodmer gehalten am 24.11.2013 Markus 12,18-25 18 Die Sadduzäer kamen zu Jesus. Sie bestreiten, daß die Toten auferstehen
