Deutscher Rat für Landespflege
|
|
|
- Tristan Kranz
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Deutscher Rat für Landespflege Biosphärenreservate sind mehr als Schutzgebiete Wege in eine nachhaltige Zukunft Nr ISSN Schriftenreihe des Deutschen Rates für Landespflege, Heft 83, 2010, Biosphärenreservate sind mehr als Schutzgebiete Wege in eine nachhaltige Zukunft Farbprofil: Deaktiviert Komposit Standardbildschirm Q:\Satz\DRL%0\CorelTitel\Titel_83.cdr Montag, 27. Dezember :36:10
2 Deutscher Rat für Landespflege Biosphärenreservate sind mehr als Schutzgebiete Wege in eine nachhaltige Zukunft Ergebnisse des F+E-Vorhabens Konzepte für neue Landschaften Nachhaltigkeit in Biosphärenreservaten (FKZ ) vom 1. Oktober 2009 bis 30. September 2010 Das Projekt wurde gefördert durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und durch die Lennart-Bernadotte-Stiftung. LENNART-BERNADOTTE-STIFTUNG Heft 83 - November 2010 SCHRIFTENREIHE DES DEUTSCHEN RATES FÜR LANDESPFLEGE
3 ISSN Herausgegeben vom Deutschen Rat für Landespflege e. V. (DRL) Redaktion: Dipl.-Ing. Angelika Wurzel Dipl.-Biol. Ute Borchers Dipl.-Biol. Melanie Drews Fachbetreuung im BfN: Gabriele Niclas, Fachgebiet II 2.3 Ein Nachdruck mit Quellenangabe kann kostenlos vorgenommen werden, jedoch wird um Zusendung eines Belegexemplars gebeten. Beiträge, die nicht ausdrücklich als Stellungnahme des Deutschen Rates für Landespflege gekennzeichnet sind, stellen die persönliche Meinung der Verfasser/innen dar. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, die Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben sowie für die Beachtung privater Rechte Dritter. Herstellung und Auslieferung: Druck Center Meckenheim (DCM) Werner-von-Siemens-Str. 13, Meckenheim Papier dieser Ausgabe aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff.
4 Inhalt Seite Deutscher Rat für Landespflege Nicole Schrader Werner Konold Biosphärenreservate sind mehr als Schutzgebiete Wege in eine nachhaltige Zukunft 1 Anlass und Ziel des Vorhabens Rahmenbedingungen der Biosphärenreservate in Deutschland Rückblick auf die Geschichte der Biosphärenreservate Biosphärenreservate als Modellgebiete Rechtlicher und planerischer Hintergrund Biosphärenreservate in Deutschland Steckbriefe der Biosphärenreservate Zusammenfassende Ergebnisse der Datenauswertung Modellhafte Entwicklungen und aktuelle Herausforderungen für Biosphärenreservate Beispiele für modellhafte Entwicklungen Governance und Biosphärenreservate Aktuelle Herausforderungen Empfehlungen Summary Literatur Beiträge: Biosphärenreservate auf dem Prüfstand - Ergebnisse einer ersten unabhängigen Evaluierung Kulturlandschaftsentwicklung und neue Landschaften - eine Herausforderung Günther Bachmann Nachhaltigkeit und Biosphärenreservate...96 Ulrich Gehrlein Kathrin Ammermann Rainer Mönke Nachhaltiges Wirtschaften in Biosphärenreservaten - von der Strategie zur Umsetzung - Ergebnisse und Schlussfolgerungen des F+E-Vorhabens Strategien zur Förderung des nachhaltigen Wirtschaftens in Biosphärenreservaten Nachhaltige Landnutzung in Biosphärenreservaten - Beispiel nachwachsender Rohstoffe Anpassung an den Klimawandel - Erfahrungen aus dem UNESCO-Biosphärenreservat Schaalsee Johann Schreiner Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in Biosphärenreservaten Susanne Stoll-.Kleemann Faktoren für die Beeinflussung gesellschaftlicher Prozesse in Biosphärenreservaten Eick von Ruschkowski Nachhaltigkeit in Biosphärenreservaten - welche Rolle spielt die Planung? Timothy Moss und Ludger Gailing Doris Pokorny Institutionelle Herausforderungen und Governance-Formen für die nachhaltige Entwicklung von Biosphärenreservaten Erfahrungen und Perspektiven zur Regionalen Selbststeuerung (Regional Governance) aus dem Biosphärenreservat Rhön Verzeichnis der bisher erschienen Hefte Verzeichnis der Ratsmitglieder
5 *) *) noch nicht anerkannt
6 123 Timothy Moss und Ludger Gailing Institutionelle Herausforderungen und Governance-Formen für die nachhaltige Entwicklung von Biosphärenreservaten 1 Einleitung Die hohen und teilweise divergierenden Ansprüche an Biosphärenreservate stellen besondere Anforderungen an deren organisatorisch-institutionelle Steuerung. Gefragt sind Governance-Formen, die die besten Voraussetzungen zur Erreichung der biosphärenreservatsspezifischen Ziele bieten, und zugleich den besonderen institutionellen Rahmenbedingungen der jeweiligen Regionen Rechnung tragen. Der folgende Beitrag untersucht Biosphärenreservate als kulturlandschaftliche Handlungsräume mit spezifischen Ansprüchen an die institutionelle Steuerung. Diese werden anhand von drei analytischen Kategorien problems of interplay, problems of fit und problems of scale erläutert. Daraus werden Schlussfolgerungen für geeignete Governance-Formen gezogen und offene Fragen für Praxis und Forschung formuliert. 2 Das Biosphärenreservat als Handlungsraum Mit der Schaffung eines Biosphärenreservats wird aus einem diffus abgegrenzten Natur-, Kultur- und Identitätsraum ein kulturlandschaftlicher Handlungsraum. Unter kulturlandschaftlichen Handlungsräumen können solche Kulturlandschaften verstanden werden, in denen es gelungen ist, Netzwerke, Steuerungsansätze oder regional wirksame Projekte zu entwickeln, die nach innen regionale Handlungsfähigkeit und Selbstorganisation gewährleisten und nach außen eine Marketingwirkung bzw. die Artikulation regionaler Interessen ermög- Abb. 1: Überlappende Raumbezüge des Biosphärenreservats Spreewald lichen (FÜRST et al. 2008: 94). Beispiele für kulturlandschaftliche Handlungsräume sind Regionen der integrierten ländlichen Entwicklung, Regionalparks, Tourismusregionen und eben traditionellerweise auch und gerade Großschutzgebiete. Im Falle von Biosphärenreservaten wird der kulturlandschaftliche Handlungsraum vor allem durch die internationalen Leitlinien der UNESCO für das Weltnetz der Biosphärenreservate sowie durch imagebildende und identitätsstiftende Qualitäten der jeweiligen Kulturlandschaft beeinflusst. 3 Institutionelle Herausforderungen: ein analytischer Rahmen Um den besonderen Anforderungen von Biosphärenreservaten gerecht zu werden, sind
7 124 die institutionellen Rahmenbedingungen dieses Typus eines kulturlandschaftlichen Handlungsraums genauer zu analysieren. Zur Erfassung der institutionellen Herausforderungen bietet sich ein analytischer Rahmen an, der vom internationalen Forschungsprogramm Institutional Dimensions of Global Environmental Change (IDGEC) entwickelt wurde (YOUNG 2002). Dieser Rahmen identifiziert drei generische Probleme des institutionellen Umgangs mit Umweltgütern, die für die Erforschung von kulturlandschaftlichen Handlungsräumen besonders aufschlussreich sind: problems of interplay, problems of fit und problems of scale (vgl. GAILING & RÖHRING 2008). Problems of (sectoral) interplay bezeichnen Probleme in der Interaktion zwischen verschiedenen sektorspezifischen Institutionen, wie Landwirtschaft, Wasserwirtschaft oder Naturschutz. Demzufolge hängt die Effektivität spezifischer Institutionen nicht nur von ihren eigenen Eigenschaften, sondern auch von der Interaktion mit anderen Institutionen ab. Integriertes Wasserressourcenmanagement, das Land- und Wassernutzungen integriert behandelt, steht zum Beispiel für einen Versuch, problems of sectoral interplay in den Griff zu bekommen. Bei problems of (spatial) fit geht es um Probleme der räumlichen Inkompatibilität zwischen institutionellen Arrangements und biophysischen Systemen. Hier hängt institutionelle Effektivität von der Passfähigkeit zwischen Institutionenraum und Naturraum ab. Ein Beispiel für einen entsprechenden Lösungsansatz ist das Flusseinzugsgebietsmanagement (MOSS 2003). Problems of scale beziehen sich auf Skalenprobleme bei der institutionellen Regelung von Umweltgütern. Diese können Probleme der Übertragbarkeit von institutionellen Regelungen von einer Maßstabsebene (z. B. global) auf eine andere (z. B. lokal) betreffen, aber auch das Spannungsverhältnis zwischen topdown - und bottom-up -Ansätzen sowie machtpolitische Verschiebungen zwischen verschiedenen Maßstabsebenen. 4 Anwendung auf Biosphärenreservate 4.1 Problems of (sectoral) interplay Probleme institutioneller Interaktionen sind in Biosphärenreservaten immanent. Der gesellschaftliche Umgang mit Kulturlandschaft ist zwangsläufig stets Interdependenzmanagement, wobei die einzelnen Flächennutzungen über unterschiedlich machtvolle institutionelle Arrangements verfügen. Dabei ergeben sich Probleme sektoraler Interaktionen nicht nur aufgrund unterschiedlicher Ansprüche und Interessen an Biosphärenreservate, etwa des Naturschutzes, der Landwirtschaft, der Wasserwirtschaft oder der Raumplanung. Es bestehen auch gravierende Unterschiede in den Eigenschaften dieser sektoralen Institutionen, die die Zusammenarbeit in einer Region erschweren. So verfügen sie über sehr unterschiedliche Akteurskonstellationen, Zielorientierungen, Steuerungsansätze, Instrumente, Ressourcen und Raumbezüge, um nur die wesentlichen Merkmale zu nennen (VON HAAREN & MOSS, im Erscheinen). Die Neuausrichtung der Biosphärenreservate seit der Sevilla-Strategie (vgl. UNESCO 1996), derzufolge Biosphärenreservate als Modellregionen für eine nachhaltige Entwicklung unter Integration von Schutz- und Nutzungszielen zu entwickeln sind, verstärkt den Bedarf nach sektorübergreifenden Lösungen. Biosphärenreservate stellen Versuche dar, Synergien zwischen Landschaftsnutzungen (z. B. Landwirtschaft, Tourismus, Naturschutz) aktiv herzustellen. Die Nutzung von Synergien kann als Strategie zur Herstellung eines taktischen interplays verstanden werden. In diesem Sinne erfordert die Umsetzung der Biosphärenreservatsziele zur Förderung naturverträglicher Landnutzungs- und Erholungsformen den Aufbau vertrauensvoller Kooperationsbeziehungen mit Landnutzern, Tourismusanbietern und Gemeinden. Dabei darf nicht übersehen werden, dass Biosphärenreservate nicht nur Synergien ermöglichen, sondern auch zugleich interplay -Probleme verstärken, indem sie jeweils eigene Raumansprüche geltend machen, die sich in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung auch ökonomisch bewähren müssen. 4.2 Problems of (spatial) fit Da die Handlungsräume eines Biosphärenreservats häufig von Verwaltungsgrenzen der Landkreise (selten sogar der Bundesländer) durchzogen werden, sind Probleme räumlicher Passfähigkeit zwischen territorial-administrativen Räumen und dem kulturlandschaftlichen Handlungsraum des jeweiligen Biosphärenreservats zu konstatieren. Verwaltungspraxis und Fördermittelvergabe z. B. im Rahmen der integrierten ländlichen Entwicklung oder der europäischen Strukturfonds orientieren sich an staatlichen und kommunalen Raumabgrenzungen, so dass grenzübergreifende Aktivitäten erschwert werden. Biosphärenreservate überlagern und überlappen sich zudem in vielfältiger Weise mit anderen Handlungsräumen (z. B. Tourismusregionen, LEADER-Regionen, Kulturlandschaften des UNESCO-Welterbes, Nationalparke), was ebenfalls problems of spatial fit impliziert, aber auch Synergien auslösen kann. Diesbezüglich bietet das Biosphärenreservat Spreewald ein positives Beispiel. Der Wirtschaftsraum Spreewald als LEADER- Region umfasst das Biosphärenreservat und gewährleistet damit eine Arbeitsteilung zwischen eher schutz- und eher nutzungsorientierten Landnutzungen bei gemeinsamer Stärkung der regionalen Wertschöpfung (s. Abb. 1) unter Nutzung einer gemeinsamen regionalen Dachmarke. Hier stellt sich zudem die Frage, inwieweit das gängige Zonierungsmodell für Biosphärenreservate zur Lösung von Problemen der räumlichen Passfähigkeit beitragen kann. Die Unterscheidung zwischen Kern-, Pflege- und Entwicklungszonen entspricht dem Grundsatz, institutionelle Arrangements (hier insbesondere Nutzungsvorgaben) anhand der naturräumlichen Bedingungen räumlich zu differenzieren. Allerdings widerspricht das Modell durchaus der Perspektive, Biosphärenreservate als Modellregionen für eine nachhaltige Entwicklung zu sehen. Nicht umsonst haben viele deutsche Biosphärenreservate damit Probleme, eine ausreichend große Kernzone einzurichten. Der Madrid Action Plan von 2008 relativiert nun konsequenterweise das Zonierungsmodell dahingehend, dass die Kernzone als Totalreservat auch ökonomisch quantifizierbare Ökosystemdienstleistungen erbringen kann und in der Entwicklungszone auch engere Naturschutzziele handlungsleitend sein können (UNESCO 2008). In der Sprache unseres analytischen Rahmens wird damit eine Aufweichung des Grundsatzes der räumlichen Passfähigkeit zugunsten besserer Lösungsbedingungen für problems of sectoral interplay in Kauf genommen. 4.3 Problems of scale Skalenübergreifendes Handeln ist für jeden kulturlandschaftlichen Handlungsraum charakteristisch. Es geht stets um die vertikale Koordination und Kooperation über Handlungsebenen hinweg (Akteure vor Ort, Kommune, Region, Land, Bund, EU, ). Spezifisch für Biosphärenreservate ist allerdings die deutlich höherrangige formelle Anbindung an internationale Institutionen als etwa bei Naturparken: Das zwischenstaatliche Programm Der Mensch und die Biosphäre (kurz: MAB-Programm) der UNESCO bildet die Basis für das weltweite Netz aller Biosphärenreservate.
8 Biosphärenreservate sind ein prägnantes Beispiel für machtpolitische Verschiebungen zwischen verschiedenen Maßstabebenen (sog. politics of scale ) in einer Mehrebenenkonstellation. Auf der Basis bundes- und landesgesetzlicher Regelungen, die aufgrund des zwischenstaatlichen MAB-Programms der UNESCO erlassen wurden, werden sie durch die Bundesländer eingerichtet, aber von der UNESCO (Internationaler Koordinationsrat des MAB-Programms) auf Antrag des nationalen MAB-Komitees als Teil des Weltnetzes anerkannt. Sie müssen sich zudem einer Überprüfung anhand von Bewertungskriterien stellen, die durch das nationale MAB-Komitee entwickelt wurden, und können in diesem Rahmen auch ihren Status einbüßen. Die Sevilla-Strategie und der Madrid Action Plan richten ihre Empfehlungen adressatengenau an die jeweils zuständige Handlungsebene (international, national, einzelnes Biosphärenreservat). 5 Schlussfolgerungen für geeignete Governance-Formen Welche Governance-Strukturen sind erforderlich und realisierbar, um Biosphärenreservate als Modellregionen für eine nachhaltige Entwicklung voranzubringen? Unter Governance wird hier das Steuern und Koordinieren mit dem Ziel des Managements von Interdependenzen zwischen (in der Regel kollektiven) Akteuren verstanden. Kulturlandschaftliche Handlungsräume bedürfen besonderer Formen von Governance. Die Governance in Biosphärenreservaten weicht deutlich von klassisch hierarchischem Verwaltungshandeln im Naturschutz ab. Oft sind öffentliche Gebietskörperschaften zwar wichtige Akteure, aber auf ihre formellen Regelwerke und ihre administrativen Raumabgrenzungen kommt es nicht ausschließlich an. Vielmehr entsteht eine neue politische Realität, die durch Formen der Selbststeuerung komplexer Netzwerke (zwischen Staat Zivilgesellschaft Wirtschaft) und die Erfüllung kooperationsorientierter Entwicklungsaufgaben geprägt wird (vgl. MAYNTZ 2005). Kennzeichnend für Landscape Governance sind deshalb das Handeln jenseits gängiger Grenzen zwischen Staat und Gesellschaft sowie das Management von Interdependenzen und Inkongruenzen zwischen Akteuren der Landnutzung. Angesichts der großen Unterschiede allein zwischen den deutschen Biosphärenreservaten ist ein Universalmodell für deren Governance weder realistisch noch wünschenswert. Die best practices aus einzelnen Biosphärenreservaten sind nur bedingt auf andere übertragbar und dann nur nach genauer Prüfung ihrer Eignung und einer regionsspezifischen Anpassung. Die wohl umfassendste Studie der Governance- Dimensionen von Biosphärenreservaten in Deutschland wurde bisher von der Arbeitsgruppe von Dietrich Fürst erarbeitet (FÜRST et al. 2008). Dort wurde ein analytisches Konzept zur Untersuchung von Regional Governance entwickelt und zur Auswertung von zwei deutschen und zwei britischen Biosphärenreservaten angewendet. Für diese Analyse wurde zwischen vier übergeordneten Kategorien unterschieden: dem extern-formalen Institutionenrahmen für Regional Governance, deren Funktionsweise, der Rolle von Raumbezug für Regional Governance sowie deren Leistungsfähigkeit. An dieser Stelle kann lediglich auf einzelne, ausgewählte Gesamtergebnisse hingewiesen werden (siehe FÜRST, LAHNER & POL- LERMANN 2008). So werden unter der Kategorie externformaler Institutionenrahmen problems of spatial fit beim Regionszuschnitt von Biosphärenreservate konstatiert. Diese können jedoch minimiert werden, wenn eine relativ unabhängige Organisation als Mittler wirkt oder die politische Führung hinter der grenzübergreifenden Kooperation steht. Bei der Funktionsweise von Regional Governance verweist die Studie auf charakteristische Prozessverläufe in Biosphärenreservaten. In der Initiierungsphase herrschen oft Widerstände gegen das gemeinsame Handeln für die Ziele des Biosphärenreservats. In der Konzeptphase kann es schwierig sein, die Kooperationsbereitschaft für ein regionales Entwicklungskonzept zu mobilisieren. In der Realisierungsphase wandelt sich oft der Kreis der Akteure mit dem Beginn konkreter Umsetzungsprojekte. In der Konsolidierungsphase besteht die Gefahr von Ermüdungserscheinungen bei den Schlüsselakteuren. Hinsichtlich des räumlichen Bezugs (dritte analytische Kategorie) konstatiert die Studie eine relativ hohe Identifikation mit dem Handlungsraum Biosphärenreservat in allen vier untersuchten Fällen, jedoch in geringerem Maße dort, wo neue Raumabgrenzungen vorgenommen wurden, wie z. B. im Biosphärenreservat Südost-Rügen. Schließlich wurde unter der Kategorie Leistungsfähigkeit von Regional Governance festgestellt, dass Kooperationsprozesse entstanden sind, die sich nicht nur auf einzelne Projekte, sondern auf die Regionalentwicklung insgesamt beziehen, und dass diese besonders stark sind, wenn ökologische und wirtschaftliche Vorteile 125 gesehen werden. Solche Prozesse erweisen sich ohne staatliche Unterstützung jedoch als fragil. 6 Offene Fragen für Praxis und Forschung Im Rahmen dieses Beitrags konnte das Thema Governance in Biosphärenreservaten mit der Erläuterung eines geeigneten analytischen Rahmens und Beispielen seiner Anwendung nur angerissen werden. Er schließt mit folgenden offenen Fragen, die zur Orientierung der weiteren Auseinandersetzung mit der Thematik in Praxis und Forschung gedacht sind: 1. Welche typischen Formen der Überlagerung eines Biosphärenreservats mit anderen regionalen Handlungsräumen (LEADER, Tourismusentwicklung, andere Großschutzgebiete) zeigen sich in der Praxis und welche sind erfolgversprechend oder kritisch zu beurteilen? 2. Welche Auswirkungen sollte die neue Anforderung integrated zoning, multiple functions des Madrid Action Plans von 2008 auf die Governance der Biosphärenreservate haben? 3. Wie kann die neue Anforderung an Biosphärenreservate, Lernorte für Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel zu sein, im Einklang mit den traditionellen Anforderungen an Natur- und Landschaftsschutz in diesen Gebieten gebracht werden? Welche institutionellen Arrangements wären dafür förderlich? 4. Wie kann bzw. muss sich das Institutionensystem Naturschutz an die besonderen Anforderungen von Biosphärenreservaten anpassen? 5. Wie können sektorale Förderinstrumente (z. B. LEADER, Naturschutzgroßprojekte) zur Verfolgung der Entwicklungsziele von Biosphärenreservaten effektiver eingesetzt werden? 6. Welche institutionellen Anpassungen wären hilfreich, um lokale und regionale Akteure bei der Bewältigung der hohen Ansprüche an nachhaltige Landnutzungen in Biosphärenreservaten zu unterstützen? Literatur FÜRST, D.; GAILING, L.; LAHNER, M.; POLLERMANN, K.; RÖHRING, A. (2008): Konstituierung von Kulturlandschaften als Handlungsräume. In: FÜRST, D.; GAILING, L.; POLLERMANN, K.; RÖHRING, A. (Hrsg.): Kulturlandschaft als Handlungsraum. Institu-
9 126 tionen und Governance im Umgang mit dem regionalen Gemeinschaftsgut Kulturlandschaft. Rohn-Verlag. Dortmund, S FÜRST, D.; LAHNER, M. & POLLERMANN, K. (2008): Vergleich der Fallstudien zu Biosphärenreservaten. In: FÜRST, D.; GAILING, L.; POLLERMANN, K. & RÖHRING, A. (Hrsg.): Kulturlandschaft als Handlungsraum. Rohn- Verlag. Dortmund, S GAILING, L. & RÖHRING, A. (2008): Institutionelle Aspekte der Kulturlandschaftsentwicklung. In: FÜRST, D.; GAILING, L.; POLLERMANN, K. & RÖHRING, A. (Hrsg.): Kulturlandschaft als Handlungsraum. Institutionen und Governance im Umgang mit dem regionalen Gemeinschaftsgut Kulturlandschaft. Rohn-Verlag. Dortmund, S von HAAREN, Ch. & MOSS, T.: Voraussetzungen für ein integriertes Management: Koordination und Kooperation der wasserrelevanten Akteure und Organisationen in Deutschland. In: von HAAREN, Ch.; GALLER, C. (Hrsg.): Wasser und Raum. Forschungs- und Sitzungsberichte der ARL. Im Erscheinen. MAYNTZ, R. (2005): Governance-Theorie als fortentwickelte Steuerungstheorie? In: SCHUP- PERT, G.F. (Hrsg.): Governance-Forschung: Vergewisserung über Stadt und Entwicklungslinien. Nomos. Baden-Baden, S MOSS, T. (Hrsg.) (2003): Das Flussgebiet als Handlungsraum. Institutionenwandel durch die EU-Wasserrahmenrichtlinie aus raumwissenschaftlichen Perspektiven. LIT-Verlag. Münster. UNESCO (1996): Biosphere Reserves: The Seville Strategy and the Statutory Framework of the World Network. Paris. UNESCO (2008), MAB-Programme: Madrid Action Plan for Biosphere Reserves ( ). Madrid. YOUNG, O. (2002): The Institutional Dimensions of Environmental Change. Fit, Interplay, and Scale. MIT Press. Cambridge (MA). Anschrift des Verfassers: Dr. Timothy Moss und Ludger Gailing Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung (IRS) Flakenstraße Erkner
Zwischenlandschaft Barnim
 Zwischenlandschaft Barnim Institutionelle Dimensionen einer Kulturlandschaft zwischen Stadt und Land Ludger Gailing Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung (IRS), Erkner ANL / BfN
Zwischenlandschaft Barnim Institutionelle Dimensionen einer Kulturlandschaft zwischen Stadt und Land Ludger Gailing Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung (IRS), Erkner ANL / BfN
Grundsatzpapier. Bekenntnis der Halligbevölkerung zur Nachhaltigkeitsstrategie der Biosphäre Halligen
 Grundsatzpapier Bekenntnis der Halligbevölkerung zur Nachhaltigkeitsstrategie der Biosphäre Halligen Tönning, 29. Januar 2010 Inhaltsverzeichnis Einleitung 3 1 Die Biosphäre Halligen 3 2 Nachhaltigkeit
Grundsatzpapier Bekenntnis der Halligbevölkerung zur Nachhaltigkeitsstrategie der Biosphäre Halligen Tönning, 29. Januar 2010 Inhaltsverzeichnis Einleitung 3 1 Die Biosphäre Halligen 3 2 Nachhaltigkeit
Governance von Trade- offs zwischen Ökosystemleistungen im deutschen Küstenraum
 Governance von Trade- offs im deutschen Küstenraum Klara J. Winkler, M.Sc. Lehrstuhl für Ökologische Ökonomie Universität Oldenburg @kj_winkler, klara.johanna.winkler@uni- oldenburg.de Das IBR ist ein
Governance von Trade- offs im deutschen Küstenraum Klara J. Winkler, M.Sc. Lehrstuhl für Ökologische Ökonomie Universität Oldenburg @kj_winkler, klara.johanna.winkler@uni- oldenburg.de Das IBR ist ein
Kick-off ÖREK 2011. Grundzüge der Raumordnung 1996
 Kick-off ÖREK 2011 RAUMKONZEPT SCHWEIZ Dr. Fritz Wegelin, Bern 1 Grundzüge der Raumordnung 1996 Vom Bund erarbeitet Nach Anhörung der Kantone und weiterer interessierter Kreise (Vernehmlassung) stark überarbeitet
Kick-off ÖREK 2011 RAUMKONZEPT SCHWEIZ Dr. Fritz Wegelin, Bern 1 Grundzüge der Raumordnung 1996 Vom Bund erarbeitet Nach Anhörung der Kantone und weiterer interessierter Kreise (Vernehmlassung) stark überarbeitet
VILMER RESOLUTION ZU GENTECHNIK UND ÖKOLOGISCH SENSIBLEN GEBIETEN
 VILMER RESOLUTION ZU GENTECHNIK UND ÖKOLOGISCH SENSIBLEN GEBIETEN Die unten aufgeführten Organisationen haben bei einer Tagung zu Gentechnik und ökologisch sensiblen Gebieten auf der Insel Vilm folgende
VILMER RESOLUTION ZU GENTECHNIK UND ÖKOLOGISCH SENSIBLEN GEBIETEN Die unten aufgeführten Organisationen haben bei einer Tagung zu Gentechnik und ökologisch sensiblen Gebieten auf der Insel Vilm folgende
Hintergrundinformationen zur Gründung des. Bündnisses. August 2011
 Hintergrundinformationen zur Gründung des Bündnisses August 2011 erarbeitet von der Expertengruppe zur Gründung eines kommunalen Bündnisses für biologische Vielfalt, Mitglieder der Expertengruppe: Arnt
Hintergrundinformationen zur Gründung des Bündnisses August 2011 erarbeitet von der Expertengruppe zur Gründung eines kommunalen Bündnisses für biologische Vielfalt, Mitglieder der Expertengruppe: Arnt
MODUL EUROPÄISCHE UNION: POLITISCHES SYSTEM UND AUßENBEZIEHUNGEN
 MODUL EUROPÄISCHE UNION: POLITISCHES SYSTEM UND AUßENBEZIEHUNGEN Fakultät für Staats- und Sozialwissenschaften Institut für Politikwissenschaft FT2011 - BA Staats- und Sozialwissenschaften SEMINAR GOVERNANCE
MODUL EUROPÄISCHE UNION: POLITISCHES SYSTEM UND AUßENBEZIEHUNGEN Fakultät für Staats- und Sozialwissenschaften Institut für Politikwissenschaft FT2011 - BA Staats- und Sozialwissenschaften SEMINAR GOVERNANCE
Integriertes Klimaschutzkonzept Regionalforum Bremerhaven Workshop Leitbild Klimakonzept
 Integriertes Klimaschutzkonzept Regionalforum Bremerhaven Workshop Leitbild Klimakonzept Ulrich Scheele ARSU GmbH Bremerhaven 20. November 2013 Integriertes Klimaschutzkonzept (IKS) des Regionalforum Bremerhaven
Integriertes Klimaschutzkonzept Regionalforum Bremerhaven Workshop Leitbild Klimakonzept Ulrich Scheele ARSU GmbH Bremerhaven 20. November 2013 Integriertes Klimaschutzkonzept (IKS) des Regionalforum Bremerhaven
Entwicklung der LEADER- Entwicklungsstrategie der LAG Vogtland
 Entwicklung der LEADER- Entwicklungsstrategie der LAG Vogtland Das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) setzte am 9. Oktober 2013 den ersten Schritt in Richtung neuer Förderperiode.
Entwicklung der LEADER- Entwicklungsstrategie der LAG Vogtland Das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) setzte am 9. Oktober 2013 den ersten Schritt in Richtung neuer Förderperiode.
Erfolgsfaktoren und Hemmnisse am Beispiel von Modellregionen
 Erfolgsfaktoren und Hemmnisse am Beispiel von Modellregionen Karin Ellermann-Kügler Verband der Landwirtschaftskammern Geschäftsstelle Brüssel Beispiele Modell- und Demonstrationsvorhaben Regionen Aktiv
Erfolgsfaktoren und Hemmnisse am Beispiel von Modellregionen Karin Ellermann-Kügler Verband der Landwirtschaftskammern Geschäftsstelle Brüssel Beispiele Modell- und Demonstrationsvorhaben Regionen Aktiv
LEADER 2014-2020 IGNAZ KNÖBL BMLFUW. Thalerhof, am 13. November 2014
 LEADER 2014-2020 IGNAZ KNÖBL BMLFUW Thalerhof, am 13. November 2014 Leader Dotierung in Österreich seit 1995 Programm Periode EU-Mittel Bundes- u. Landesmittel Öffentliche Mittel gesamt LEADER II 1995
LEADER 2014-2020 IGNAZ KNÖBL BMLFUW Thalerhof, am 13. November 2014 Leader Dotierung in Österreich seit 1995 Programm Periode EU-Mittel Bundes- u. Landesmittel Öffentliche Mittel gesamt LEADER II 1995
Partizipation und Klimawandel
 A. Knierim, S. Baasch, M. Gottschick (Hrsg.) Partizipation und Klimawandel Ansprüche, Konzepte und Umsetzung Klimawandel in Regionen zukunftsfähig gestalten / Band 1 18 Partizipation und Klimawandel Zur
A. Knierim, S. Baasch, M. Gottschick (Hrsg.) Partizipation und Klimawandel Ansprüche, Konzepte und Umsetzung Klimawandel in Regionen zukunftsfähig gestalten / Band 1 18 Partizipation und Klimawandel Zur
Gemeinsame Agrarpolitik der EU
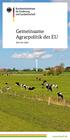 Gemeinsame Agrarpolitik der EU 2014 bis 2020 www.bmel.de Liebe Leserinnen und Leser, die Landwirtschaft ist eine starke Branche, die unser täglich Brot sichert und den ländlichen Raum attraktiv gestaltet.
Gemeinsame Agrarpolitik der EU 2014 bis 2020 www.bmel.de Liebe Leserinnen und Leser, die Landwirtschaft ist eine starke Branche, die unser täglich Brot sichert und den ländlichen Raum attraktiv gestaltet.
PartizipativeAnsätze und Methoden in der Gesundheitsförderung
 PartizipativeAnsätze und Methoden in der Gesundheitsförderung Dr. PH Petra Wihofszky Institut für Gesundheits-, Ernährungs- und Sportwissenschaften, Universität Flensburg 1 2 Aufbau des Vortrags Theoretische
PartizipativeAnsätze und Methoden in der Gesundheitsförderung Dr. PH Petra Wihofszky Institut für Gesundheits-, Ernährungs- und Sportwissenschaften, Universität Flensburg 1 2 Aufbau des Vortrags Theoretische
Erfolgsfaktoren zur regionalen Energiewende Ergebnisse für dem Forschungsprojekt 100%-EE- Regionen
 Erfolgsfaktoren zur regionalen Energiewende Ergebnisse für dem Forschungsprojekt 100%-EE- Regionen Dr. Peter Moser Klimabündniskonferenz, Nürnberg, 21. November 2008 Gefördert durch: gien e.v. deenet Gründung
Erfolgsfaktoren zur regionalen Energiewende Ergebnisse für dem Forschungsprojekt 100%-EE- Regionen Dr. Peter Moser Klimabündniskonferenz, Nürnberg, 21. November 2008 Gefördert durch: gien e.v. deenet Gründung
Ergebnisse der Begleitforschung Regionen Aktiv in der Diskussion
 Ergebnisse der Begleitforschung Regionen Aktiv in der Diskussion Erfolgsfaktoren und Rahmenbedingungen Integrierter ländlicher Entwicklung Sebastian Tränkner Im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung,
Ergebnisse der Begleitforschung Regionen Aktiv in der Diskussion Erfolgsfaktoren und Rahmenbedingungen Integrierter ländlicher Entwicklung Sebastian Tränkner Im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung,
Konzepte und Herausforderungen
 Eine Zukunftsaufgabe in guten Händen Wildnis im Dialog 2015 Konzepte und Herausforderungen Dr. Heiko Schumacher*, Dr. Manfred Klein** & Dr. Uwe Riecken* * Abteilung II 2 Biotopschutz und Landschaftsökologie
Eine Zukunftsaufgabe in guten Händen Wildnis im Dialog 2015 Konzepte und Herausforderungen Dr. Heiko Schumacher*, Dr. Manfred Klein** & Dr. Uwe Riecken* * Abteilung II 2 Biotopschutz und Landschaftsökologie
Wasserpolitik und Institutionen des Wassermanagement in der Türkei - Status quo und Anpassungsbedarf -
 Wasserpolitik und Institutionen des Wassermanagement in der Türkei - Status quo und Anpassungsbedarf - Waltina Scheumann Institut für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung, TU Berlin Kritische Regionen
Wasserpolitik und Institutionen des Wassermanagement in der Türkei - Status quo und Anpassungsbedarf - Waltina Scheumann Institut für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung, TU Berlin Kritische Regionen
Visualisierung künftiger Landschaften
 Konzepte für neue Landschaften - Nachhaltigkeit in Biosphärenreservaten 9./10- März 2010 Visualisierung künftiger Landschaften Welche Bilder helfen Akteuren gemeinsam Zukunftsperspektiven für ihre Kulturlandschaften
Konzepte für neue Landschaften - Nachhaltigkeit in Biosphärenreservaten 9./10- März 2010 Visualisierung künftiger Landschaften Welche Bilder helfen Akteuren gemeinsam Zukunftsperspektiven für ihre Kulturlandschaften
Bayerische Staatskanzlei
 Bayerische Staatskanzlei Pressemitteilung «Empfängerhinweis» Nr: 31 München, 3. Februar 2015 Bericht aus der Kabinettssitzung: 1. Korrekturen beim Mindestlohn / Arbeitsministerin Müller: Bayern steht zum
Bayerische Staatskanzlei Pressemitteilung «Empfängerhinweis» Nr: 31 München, 3. Februar 2015 Bericht aus der Kabinettssitzung: 1. Korrekturen beim Mindestlohn / Arbeitsministerin Müller: Bayern steht zum
Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen in Oberfranken unter dem Aspekt des Landschaftsschutzes
 Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen in Oberfranken unter dem Aspekt des Landschaftsschutzes Bereich (Behörde) Arial Regular 16pt Christiane Odewald Regionsbeauftragte Oberfranken-West Bad Blankenburg,
Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen in Oberfranken unter dem Aspekt des Landschaftsschutzes Bereich (Behörde) Arial Regular 16pt Christiane Odewald Regionsbeauftragte Oberfranken-West Bad Blankenburg,
Dynamische Arrangements städtischer Sicherheit
 Dynamische Arrangements städtischer Sicherheit Jan Abt Leon Hempel Dietrich Henckel Ricarda Pätzold Gabriele Wendorf (Hrsg.) Dynamische Arrangements städtischer Sicherheit Akteure, Kulturen, Bilder Herausgeber
Dynamische Arrangements städtischer Sicherheit Jan Abt Leon Hempel Dietrich Henckel Ricarda Pätzold Gabriele Wendorf (Hrsg.) Dynamische Arrangements städtischer Sicherheit Akteure, Kulturen, Bilder Herausgeber
Einführung Business & Society Stakeholder View, Corporate Social Performance, Issue Management & Business Ethics
 Einführung Business & Society Stakeholder View, Corporate Social Performance, Issue Management & Business Ethics Prof. Dr. Prof. Dr. Jean-Paul Thommen Universität Zürich Course Outline Business & Society
Einführung Business & Society Stakeholder View, Corporate Social Performance, Issue Management & Business Ethics Prof. Dr. Prof. Dr. Jean-Paul Thommen Universität Zürich Course Outline Business & Society
Netzwerke wer, wo, wie? Prof. Dr. Herbert Schubert, Fachhochschule Köln Frieder Wolf, Stadt Köln
 Netzwerke wer, wo, wie? Prof. Dr. Herbert Schubert, Fachhochschule Köln Frieder Wolf, Stadt Köln Netzwerktagung Europaaktive Kommune in NRW Fortbildungsakademie Mont-Cenis, Herne, 21.11.2013 1 Übersicht
Netzwerke wer, wo, wie? Prof. Dr. Herbert Schubert, Fachhochschule Köln Frieder Wolf, Stadt Köln Netzwerktagung Europaaktive Kommune in NRW Fortbildungsakademie Mont-Cenis, Herne, 21.11.2013 1 Übersicht
Border Futures grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gebiet der LAG Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland
 IPS Fachgebiet internationale Planungssysteme Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Karina M. Pallagst Border Futures grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gebiet der LAG Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland ARL Kongress
IPS Fachgebiet internationale Planungssysteme Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Karina M. Pallagst Border Futures grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gebiet der LAG Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland ARL Kongress
Bürgerhaushalt im Kräftedreieck Politik-Verwaltung-Bürgerschaft
 Elias Pflaumbaum Bürgerhaushalt im Kräftedreieck Politik-Verwaltung-Bürgerschaft Diplomica Verlag Elias Pflaumbaum Bürgerhaushalt im Kräftedreieck Politik-Verwaltung-Bürgerschaft ISBN: 978-3-8428-1302-1
Elias Pflaumbaum Bürgerhaushalt im Kräftedreieck Politik-Verwaltung-Bürgerschaft Diplomica Verlag Elias Pflaumbaum Bürgerhaushalt im Kräftedreieck Politik-Verwaltung-Bürgerschaft ISBN: 978-3-8428-1302-1
Masterstudiengang Regionalmanagement und Wirtschaftsförderung: Karriereprofile
 Masterstudiengang Regionalmanagement und Wirtschaftsförderung: Karriereprofile HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Fakultät Ressourcenmanagement Göttingen Stand: 05/2011 Berufliche Einstiegschancen
Masterstudiengang Regionalmanagement und Wirtschaftsförderung: Karriereprofile HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Fakultät Ressourcenmanagement Göttingen Stand: 05/2011 Berufliche Einstiegschancen
Koproduktion in Deutschland über die Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger in kommunale Leistungen
 Koproduktion in Deutschland über die Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger in kommunale Leistungen Alexander Koop Elisabeth Pfaff In Deutschland verfügen wir neben vielfältigen sozialstaatlichen Leistungen
Koproduktion in Deutschland über die Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger in kommunale Leistungen Alexander Koop Elisabeth Pfaff In Deutschland verfügen wir neben vielfältigen sozialstaatlichen Leistungen
IST. Ute Reuter. IST Volume 5, Issue 5 (2013) Innovationsorientierung und Organisation bei der Salzgitter AG ISSN 2193-231X.
 Fallstudienreihe IST Innovation, Servicedienstleistungen und Technologie Case Studies on Innovation, Services and Technology Innovationsorientierung und Organisation bei der Salzgitter AG Ute Reuter IST
Fallstudienreihe IST Innovation, Servicedienstleistungen und Technologie Case Studies on Innovation, Services and Technology Innovationsorientierung und Organisation bei der Salzgitter AG Ute Reuter IST
Europafähigkeit der Kommunen
 Ulrich von Alemann Claudia Münch (Hrsg.) Europafähigkeit der Kommunen Die lokale Ebene in der Europäischen Union VS VERLAG FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN Vorwort des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten
Ulrich von Alemann Claudia Münch (Hrsg.) Europafähigkeit der Kommunen Die lokale Ebene in der Europäischen Union VS VERLAG FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN Vorwort des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten
Arbeitskreis Faire und Nachhaltige
 faire & nachhaltige beschaffung 1 Arbeitskreis Thüringen Arbeitskreis Faire und Nachhaltige Beschaffung in Thüringen www.nachhaltige-beschaffung-thueringen.de 2 3 Hintergrund der Broschüre Umsetzung in
faire & nachhaltige beschaffung 1 Arbeitskreis Thüringen Arbeitskreis Faire und Nachhaltige Beschaffung in Thüringen www.nachhaltige-beschaffung-thueringen.de 2 3 Hintergrund der Broschüre Umsetzung in
Die Akzeptanz von Kosten Nutzen Analysen und umweltökonomischen Bewertungen im Verwaltungshandeln
 Der Nutzen von Ökonomie und Ökosystemdienstleistungen für die Naturschutzpraxis 25. 28. April 2012, Bundesamt für Naturschutz, Vilm Die Akzeptanz von Kosten Nutzen Analysen und umweltökonomischen Bewertungen
Der Nutzen von Ökonomie und Ökosystemdienstleistungen für die Naturschutzpraxis 25. 28. April 2012, Bundesamt für Naturschutz, Vilm Die Akzeptanz von Kosten Nutzen Analysen und umweltökonomischen Bewertungen
Bildung für nachhaltige Entwicklung
 Bildung für nachhaltige Entwicklung Fortschreibung des Aktionsplans "Zukunft gestalten - Bildung für nachhaltige Entwicklung in Baden-Württemberg" Projektabschlussbericht Name des Projekts: Fortschreibung
Bildung für nachhaltige Entwicklung Fortschreibung des Aktionsplans "Zukunft gestalten - Bildung für nachhaltige Entwicklung in Baden-Württemberg" Projektabschlussbericht Name des Projekts: Fortschreibung
Schriftliche Anfrage Heinrich Ueberwasser betreffend Basel, Zürich, St. Gallen oder bald die ganze Schweiz zollfrei?
 An den Grossen Rat 15.5392.02 WSU/P155392 Basel, 25. November 2015 Regierungsratsbeschluss vom 24. November 2015 Schriftliche Anfrage Heinrich Ueberwasser betreffend Basel, Zürich, St. Gallen oder bald
An den Grossen Rat 15.5392.02 WSU/P155392 Basel, 25. November 2015 Regierungsratsbeschluss vom 24. November 2015 Schriftliche Anfrage Heinrich Ueberwasser betreffend Basel, Zürich, St. Gallen oder bald
Governance räumlicher Wettbewerbseinheiten
 Frieda Raich 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Governance räumlicher Wettbewerbseinheiten Ein Ansatz
Frieda Raich 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Governance räumlicher Wettbewerbseinheiten Ein Ansatz
Zunehmende Bedeutung von inter-kommunaler Kooperation
 Einführung Zunehmende Bedeutung von inter-kommunaler Kooperation International COP 16: Anerkennung der Bedeutung von Kommunen als staatliche Akteure im Klimaschutz und Umgang mit den Folgen des Klimawandels
Einführung Zunehmende Bedeutung von inter-kommunaler Kooperation International COP 16: Anerkennung der Bedeutung von Kommunen als staatliche Akteure im Klimaschutz und Umgang mit den Folgen des Klimawandels
Inhalt. Jörn Timm Die Reform der europäischen Strukturpolitik aus kommunaler Sicht 119
 Vorwort des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Nordrhein-Westfalen Michael Breuer 9 Vorwort des Leiters der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland Dr. Gerhard Sabathil
Vorwort des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Nordrhein-Westfalen Michael Breuer 9 Vorwort des Leiters der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland Dr. Gerhard Sabathil
AWI-Seminar über Evaluierungsprozesse: Ansprüche und Umsetzung Wien, 20. Juni 2007
 AWI-Seminar über Evaluierungsprozesse: Ansprüche und Umsetzung Wien, 20. Juni 2007 Stichworte und Quellenangaben zum Referat: Monitoring Nachhaltiger Entwicklung: Grundlagen, Bedürfnisfeldansatz und gute
AWI-Seminar über Evaluierungsprozesse: Ansprüche und Umsetzung Wien, 20. Juni 2007 Stichworte und Quellenangaben zum Referat: Monitoring Nachhaltiger Entwicklung: Grundlagen, Bedürfnisfeldansatz und gute
Umsetzung in Deutschland
 UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung Umsetzung in Deutschland Hintergrund Struktur Strategie Projekte Weltkonferenz UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung (2005-2014) Folgeprojekt aus dem
UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung Umsetzung in Deutschland Hintergrund Struktur Strategie Projekte Weltkonferenz UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung (2005-2014) Folgeprojekt aus dem
Integriert handeln, finanzieren und fördern
 Integriert handeln, finanzieren und fördern Mittelbündelung in kleineren Städten und Gemeinden Transferwerkstatt Kleinere Städte und Gemeinden 11. und 12. Juni 2014 Magdeburg, Gröningen und Seeland Ziel
Integriert handeln, finanzieren und fördern Mittelbündelung in kleineren Städten und Gemeinden Transferwerkstatt Kleinere Städte und Gemeinden 11. und 12. Juni 2014 Magdeburg, Gröningen und Seeland Ziel
Weiterbildung. Prof. Dr. Karlheinz Schwuchow. 28. Oktober 2014. Der Stellenwert der Mitarbeiterqualifizierung und ihre betriebliche Umsetzung
 Weiterbildung Der Stellenwert der Mitarbeiterqualifizierung und ihre betriebliche Umsetzung 28. Oktober 2014 0 AGENDA: WEITERBILDUNG 2020 Megatrends: Demographischer Wandel und Wissensgesellschaft Methodik:
Weiterbildung Der Stellenwert der Mitarbeiterqualifizierung und ihre betriebliche Umsetzung 28. Oktober 2014 0 AGENDA: WEITERBILDUNG 2020 Megatrends: Demographischer Wandel und Wissensgesellschaft Methodik:
Dr. Angelika Engelbert (IQZ)
 Zeit für Familie Dr. Angelika Engelbert (IQZ) Vortrag beim Frauen-Neujahrstreffen am 19.1.2014 in Arnsberg Worum geht es? Zeit Örtliche Ebene Familie Inhalt Zeitstrukturen und Zeit als knappes Gut von
Zeit für Familie Dr. Angelika Engelbert (IQZ) Vortrag beim Frauen-Neujahrstreffen am 19.1.2014 in Arnsberg Worum geht es? Zeit Örtliche Ebene Familie Inhalt Zeitstrukturen und Zeit als knappes Gut von
100 Naturparke in Deutschland, 96 Mitglied im Verband Deutscher Naturparke (VDN)
 30. Mai 2008 Management und Finanzierung von Naturparken Beispiele aus Deutschland Ulrich Köster, Geschäftsführer Verband Dt. Naturparke 100 Naturparke in Deutschland, 96 Mitglied im Verband Deutscher
30. Mai 2008 Management und Finanzierung von Naturparken Beispiele aus Deutschland Ulrich Köster, Geschäftsführer Verband Dt. Naturparke 100 Naturparke in Deutschland, 96 Mitglied im Verband Deutscher
Chancen eines neuen Konzepts für die Schweiz
 PPP für Kläranlagen Chancen eines neuen Konzepts für die Schweiz Lorenz Bösch, Präsident Verein PPP-Schweiz 9. März 2012, Symposium PPP im Bereich Abwasser, ETH Zürich-Hönggerberg 22.02.2012 Überblicke
PPP für Kläranlagen Chancen eines neuen Konzepts für die Schweiz Lorenz Bösch, Präsident Verein PPP-Schweiz 9. März 2012, Symposium PPP im Bereich Abwasser, ETH Zürich-Hönggerberg 22.02.2012 Überblicke
Naturverträglicher Ausbau der Windenergie an Land
 Eine Zukunftsaufgabe in guten Händen Naturverträglicher Ausbau der Windenergie an Land Kathrin Ammermann Leiterin des FG Naturschutz und erneuerbare Energien Bundesamt für Naturschutz, AS Leipzig Über
Eine Zukunftsaufgabe in guten Händen Naturverträglicher Ausbau der Windenergie an Land Kathrin Ammermann Leiterin des FG Naturschutz und erneuerbare Energien Bundesamt für Naturschutz, AS Leipzig Über
Hessisches Ministerium der Finanzen Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleiches
 Hessisches Ministerium der Finanzen Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleiches 24. Sitzung der Arbeitsgruppe KFA 2016 am 19. März 2015 Agenda 1. Begrüßung 2. Abnahme des Protokolls der 23. Sitzung am
Hessisches Ministerium der Finanzen Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleiches 24. Sitzung der Arbeitsgruppe KFA 2016 am 19. März 2015 Agenda 1. Begrüßung 2. Abnahme des Protokolls der 23. Sitzung am
Indikatorenbasierte Bewertung der Freiraumentwicklung
 Indikatorenbasierte Bewertung der Freiraumentwicklung 1. Zielstellung Gliederung 2. Bestehende Ansätze zu Freiraumindikatoren 3. Gedanke und Vorschläge zur Weiterentwicklung Landschaft; Schutzgebiete Unzerschnittene
Indikatorenbasierte Bewertung der Freiraumentwicklung 1. Zielstellung Gliederung 2. Bestehende Ansätze zu Freiraumindikatoren 3. Gedanke und Vorschläge zur Weiterentwicklung Landschaft; Schutzgebiete Unzerschnittene
Nationalpark Hunsrück-Hochwald: Mehr als nur ein Schutzgebiet. UCB 26. März 2015 Claus-Andreas Lessander
 Nationalpark Hunsrück-Hochwald: Mehr als nur ein Schutzgebiet UCB 26. März 2015 Claus-Andreas Lessander Nationalpark Hunsrück-Hochwald: Mehr als nur ein Schutzgebiet. Ein Modellvorhaben für fachübergreifende
Nationalpark Hunsrück-Hochwald: Mehr als nur ein Schutzgebiet UCB 26. März 2015 Claus-Andreas Lessander Nationalpark Hunsrück-Hochwald: Mehr als nur ein Schutzgebiet. Ein Modellvorhaben für fachübergreifende
EU Förderung 2014-2020
 EU Förderung 2014-2020 Jutta Schiecke Landesbeauftragte für regionale Landesentwicklung Fachtagung EU-Förderung 2014 2020 des Landkreises Stade am Montag den 10.03.2014, 16.00 Uhr, in Stade, Am Sande 2,
EU Förderung 2014-2020 Jutta Schiecke Landesbeauftragte für regionale Landesentwicklung Fachtagung EU-Förderung 2014 2020 des Landkreises Stade am Montag den 10.03.2014, 16.00 Uhr, in Stade, Am Sande 2,
Territoriale Kohäsion und Donaustrategie eine ökonomische Analyse neuer Konzepte der EU-Integration
 Territoriale Kohäsion und Donaustrategie eine ökonomische Analyse neuer Konzepte der EU-Integration Budapester Gespräche 2011 Budapest, 12.-14. Oktober Konrad Lammers Europa-Kolleg Hamburg Institute for
Territoriale Kohäsion und Donaustrategie eine ökonomische Analyse neuer Konzepte der EU-Integration Budapester Gespräche 2011 Budapest, 12.-14. Oktober Konrad Lammers Europa-Kolleg Hamburg Institute for
Wissen, Netzwerke und interkommunaler Zusammenarbeit
 Institut für Öffentliche Dienstleistungen und Tourismus Wissen, Netzwerke und interkommunaler Zusammenarbeit Dr. Roland Scherer Hannover, den 29. Oktober 2008 Die Ausgangssituation Kleinräumige Strukturen
Institut für Öffentliche Dienstleistungen und Tourismus Wissen, Netzwerke und interkommunaler Zusammenarbeit Dr. Roland Scherer Hannover, den 29. Oktober 2008 Die Ausgangssituation Kleinräumige Strukturen
VERZEICHNIS AUSGEWÄHLTER BESCHLÜSSE ZUR BERUFLICHEN BILDUNG
 141 VERZEICHNIS AUSGEWÄHLTER BESCHLÜSSE ZUR BERUFLICHEN BILDUNG Titel: Stellungnahme des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) zu ESCO European Taxonomy of Skills, Competencies
141 VERZEICHNIS AUSGEWÄHLTER BESCHLÜSSE ZUR BERUFLICHEN BILDUNG Titel: Stellungnahme des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) zu ESCO European Taxonomy of Skills, Competencies
Folgen des Klimawandels für den Wintertourismus in deutschen Alpen- und Mittelgebirgsregionen
 Deutscher Bundestag Drucksache 18/7315 18. Wahlperiode 13.01.2016 Kleine Anfrage der Abgeordneten Markus Tressel, Annalena Baerbock, Bärbel Höhn, Christian Kühn (Tübingen), Steffi Lemke, Matthias Gastel
Deutscher Bundestag Drucksache 18/7315 18. Wahlperiode 13.01.2016 Kleine Anfrage der Abgeordneten Markus Tressel, Annalena Baerbock, Bärbel Höhn, Christian Kühn (Tübingen), Steffi Lemke, Matthias Gastel
Partnerschaftliches themenübergreifendes Netzwerken auf regionaler Ebene: Die Rolle der TEPs
 Partnerschaftliches themenübergreifendes Netzwerken auf regionaler Ebene: Die Rolle der TEPs Pakte Treffen 2011 "Innovation und nachhaltige Entwicklung in den TEPs ein Spannungsfeld? Klagenfurt, 04. -
Partnerschaftliches themenübergreifendes Netzwerken auf regionaler Ebene: Die Rolle der TEPs Pakte Treffen 2011 "Innovation und nachhaltige Entwicklung in den TEPs ein Spannungsfeld? Klagenfurt, 04. -
Fragebogen zu Corporate Social Responsibility (CSR) im Unternehmen
 Die onlinebasierte Mitarbeiterbefragung Fragebogen Corporate Social Responsibility (CSR) im Unternehmen Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen r Unternehmenskultur
Die onlinebasierte Mitarbeiterbefragung Fragebogen Corporate Social Responsibility (CSR) im Unternehmen Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen r Unternehmenskultur
Aggregierte Präferenzen: Liberalismus (Rasmus Beckmann)
 Liberalismus Folie 1 Aggregierte Präferenzen: Liberalismus (Rasmus Beckmann) Gliederung 1. Einordnung der liberalen Außenpolitiktheorie in den Kontext der Vorlesung 2. Abgrenzung vom traditionellen Liberalismus
Liberalismus Folie 1 Aggregierte Präferenzen: Liberalismus (Rasmus Beckmann) Gliederung 1. Einordnung der liberalen Außenpolitiktheorie in den Kontext der Vorlesung 2. Abgrenzung vom traditionellen Liberalismus
Ländliche Entwicklung EK-Vorschläge, aktueller Stand und Bezug zu Tourismus
 Ländliche Entwicklung EK-Vorschläge, aktueller Stand und Bezug zu Tourismus BMWFJ-Fachveranstaltutung Tourismus 2014+ Wien, 11. Oktober 2012 Markus Hopfner Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,
Ländliche Entwicklung EK-Vorschläge, aktueller Stand und Bezug zu Tourismus BMWFJ-Fachveranstaltutung Tourismus 2014+ Wien, 11. Oktober 2012 Markus Hopfner Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,
Methoden der Bewertung und Messung der Nachhaltigkeit von ethischen, sozialen und ökologischen Kapitalanlagen
 Oliver Foltin Methoden der Bewertung und Messung der Nachhaltigkeit von ethischen, sozialen und ökologischen Kapitalanlagen Am Beispiel des Anlageverhaltens der Kirchen in Deutschland Metropolis-Verlag
Oliver Foltin Methoden der Bewertung und Messung der Nachhaltigkeit von ethischen, sozialen und ökologischen Kapitalanlagen Am Beispiel des Anlageverhaltens der Kirchen in Deutschland Metropolis-Verlag
Vernetzung und Entwicklung von gesundheitsorientierter Arbeitsförderung in Brandenburg
 Vernetzung und Entwicklung von gesundheitsorientierter Arbeitsförderung in Brandenburg Ein Projekt von Gesundheit Berlin-Brandenburg e.v. Regionalbudget 21./22. November 2012 Gesundheit Berlin-Brandenburg
Vernetzung und Entwicklung von gesundheitsorientierter Arbeitsförderung in Brandenburg Ein Projekt von Gesundheit Berlin-Brandenburg e.v. Regionalbudget 21./22. November 2012 Gesundheit Berlin-Brandenburg
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie
 174 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie 25. Land sucht neue Wege bei der Förderung der Weiterbildung Das Land fördert seit Jahren regionale Weiterbildungsverbünde mit 2 Mio. jährlich.
174 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie 25. Land sucht neue Wege bei der Förderung der Weiterbildung Das Land fördert seit Jahren regionale Weiterbildungsverbünde mit 2 Mio. jährlich.
EUROPEAN ENERGY AWARD
 EUROPEAN ENERGY AWARD Kommunale Energie- und Klimaschutzpolitik nachhaltig planen, optimieren und umsetzen Rathaus Jena Erstellung des Arbeitsprogramms Politischer Beschluss Gründung des Energieteams Durchführung
EUROPEAN ENERGY AWARD Kommunale Energie- und Klimaschutzpolitik nachhaltig planen, optimieren und umsetzen Rathaus Jena Erstellung des Arbeitsprogramms Politischer Beschluss Gründung des Energieteams Durchführung
Transformationspotenzial durch Vernetzung bei E-Government und andere IT-Funktionen
 IfG.CC The Potsdam egovernment Competence Center E-Government ist mehr als IT: Kooperationsfähigkeit bei E-Government-Netzwerken Prof. Dr. Tino Schuppan, IfG.CC Worms, 14. November 2013 Netzwerkfähigkeit
IfG.CC The Potsdam egovernment Competence Center E-Government ist mehr als IT: Kooperationsfähigkeit bei E-Government-Netzwerken Prof. Dr. Tino Schuppan, IfG.CC Worms, 14. November 2013 Netzwerkfähigkeit
Formblatt der LEADER-Region Zwickauer Land zur Einreichung von Vorhaben. Handlungsfeld B Infrastruktur, Mobilität und Bildung
 Formblatt der LEADER-Region Zwickauer Land zur Einreichung von Vorhaben Handlungsfeld B Infrastruktur, Mobilität und Bildung Die gesamten Beratungen sowie das Auswahlverfahren sind für den Begünstigten
Formblatt der LEADER-Region Zwickauer Land zur Einreichung von Vorhaben Handlungsfeld B Infrastruktur, Mobilität und Bildung Die gesamten Beratungen sowie das Auswahlverfahren sind für den Begünstigten
Weltnaturerbe Wattenmeer
 Weltnaturerbe Wattenmeer Nachhaltiger Tourismus in der Weltnaturerbe Wattenmeer Destination eine gemeinsame Strategie Regionale Konsultation Juni 2013 UNESCO Welterbekomitee 2009 Vorbereitung und Umsetzung
Weltnaturerbe Wattenmeer Nachhaltiger Tourismus in der Weltnaturerbe Wattenmeer Destination eine gemeinsame Strategie Regionale Konsultation Juni 2013 UNESCO Welterbekomitee 2009 Vorbereitung und Umsetzung
Evaluation der Leader Maßnahme in Österreich
 Seminar: Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus der Halbzeitevaluierung Akademie der Wissenschaften, Sonnenfelsgasse 19, A 1010 Wien 20. Mai 2011 Evaluation der Leader Maßnahme in Österreich Thomas Dax
Seminar: Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus der Halbzeitevaluierung Akademie der Wissenschaften, Sonnenfelsgasse 19, A 1010 Wien 20. Mai 2011 Evaluation der Leader Maßnahme in Österreich Thomas Dax
Transformationsaspekte und Models of Change: Wie kann gesellschaftlicher Wandel angestoßen werden?
 Transformationsaspekte und Models of Change: Wie kann gesellschaftlicher Wandel angestoßen werden? Überlegungen aus dem UFOPLAN-Vorhaben Transformationsstrategien und Models of Change für nachhaltigen
Transformationsaspekte und Models of Change: Wie kann gesellschaftlicher Wandel angestoßen werden? Überlegungen aus dem UFOPLAN-Vorhaben Transformationsstrategien und Models of Change für nachhaltigen
Wie kann Wissenschaftsmanagement inter- und transdisziplinäre Forschungsprojekte erfolgreich unterstützen?
 Wie kann Wissenschaftsmanagement inter- und transdisziplinäre Forschungsprojekte erfolgreich unterstützen? Beispiele aus CC-LandStraD Dr. Johanna Fick Thünen-Institut für Ländliche Räume Gefördert durch
Wie kann Wissenschaftsmanagement inter- und transdisziplinäre Forschungsprojekte erfolgreich unterstützen? Beispiele aus CC-LandStraD Dr. Johanna Fick Thünen-Institut für Ländliche Räume Gefördert durch
Kriterien für die Anerkennung und Überprüfung von Biosphärenreservaten der UNESCO in Deutschland
 Kriterien für die Anerkennung und Überprüfung von Biosphärenreservaten der UNESCO in Deutschland Inhaltsverzeichnis Seite 4 1. Einführung Seite 32 5. Literaturverzeichnis 5 2. Verfahren zur Anerkennung
Kriterien für die Anerkennung und Überprüfung von Biosphärenreservaten der UNESCO in Deutschland Inhaltsverzeichnis Seite 4 1. Einführung Seite 32 5. Literaturverzeichnis 5 2. Verfahren zur Anerkennung
Wolfgang Merkel Hans-Jürgen Puhle Aurel Croissant Claudia Eicher Peter Thiery. Defekte Demokratie. Band 1 : Theorie
 Defekte Demokratie Wolfgang Merkel Hans-Jürgen Puhle Aurel Croissant Claudia Eicher Peter Thiery Defekte Demokratie Band 1 : Theorie Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2003 Gedruckt auf säurefreiem und
Defekte Demokratie Wolfgang Merkel Hans-Jürgen Puhle Aurel Croissant Claudia Eicher Peter Thiery Defekte Demokratie Band 1 : Theorie Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2003 Gedruckt auf säurefreiem und
Newsletter - März 2015 1. Ausgabe Das INTERREG V B Donauprogramm - eine neue Zielgruppen Möglichkeit, die transnationale Zusammenarbeit zu stärken
 Das INTERREG V B Donauprogramm - eine neue Möglichkeit, die transnationale Zusammenarbeit zu stärken Liebe Leserinnen und Leser, In Kürze startet das neue Interreg Donauprogramm, ein transnationales Förderprogramm,
Das INTERREG V B Donauprogramm - eine neue Möglichkeit, die transnationale Zusammenarbeit zu stärken Liebe Leserinnen und Leser, In Kürze startet das neue Interreg Donauprogramm, ein transnationales Förderprogramm,
Einführung zum Naturpark Obst-Hügel-Land Rainer Silber, 6. Februar 2009 DORFER
 I t ti O td F i it A b t t i k l Integrative Outdoor-Freizeit-Angebote entwickeln Einführung zum Naturpark Obst-Hügel-Land Rainer Silber, 6. Februar 2009 DORFER oto: MICHAEL DERND Fo Inhalt Organisation
I t ti O td F i it A b t t i k l Integrative Outdoor-Freizeit-Angebote entwickeln Einführung zum Naturpark Obst-Hügel-Land Rainer Silber, 6. Februar 2009 DORFER oto: MICHAEL DERND Fo Inhalt Organisation
Das Internet als Herausforderung politischer Bildung
 A im S t u d i e n z u P o l i t i k u n d W i s s e n s c h a f t Thilo Harth Das Internet als Herausforderung politischer Bildung WOCHEN SCHAU VERLAG Inhalt Votwort 1 1 Einleitung 3 Das Internet ist
A im S t u d i e n z u P o l i t i k u n d W i s s e n s c h a f t Thilo Harth Das Internet als Herausforderung politischer Bildung WOCHEN SCHAU VERLAG Inhalt Votwort 1 1 Einleitung 3 Das Internet ist
Integrierte ländliche Entwicklung und Leader: Durch Verknüpfung zu Synergien und Mehrwert für die ländlichen Räume
 Integrierte ländliche Entwicklung und Leader: Durch Verknüpfung zu Synergien und Mehrwert für die ländlichen Räume Maximilian Geierhos, Wolfgang-Günther Ewald, Joseph Köpfer, Angelika Schaller Einleitung
Integrierte ländliche Entwicklung und Leader: Durch Verknüpfung zu Synergien und Mehrwert für die ländlichen Räume Maximilian Geierhos, Wolfgang-Günther Ewald, Joseph Köpfer, Angelika Schaller Einleitung
Ein Modellvorhaben der Landesregierung Nordrhein-Westfalen und der Bertelsmann Stiftung
 Ein Modellvorhaben der Landesregierung Nordrhein-Westfalen und der Bertelsmann Stiftung Die Modellkommunen 18 Kommunen nehmen am Vorhaben Kein Kind zurücklassen! teil. Jede Kommune arbeitet an ihren eigenen
Ein Modellvorhaben der Landesregierung Nordrhein-Westfalen und der Bertelsmann Stiftung Die Modellkommunen 18 Kommunen nehmen am Vorhaben Kein Kind zurücklassen! teil. Jede Kommune arbeitet an ihren eigenen
Rede von Simone Strecker Referentin im Bundesministerium für Gesundheit
 Es gilt das gesprochene Wort! Rede von Simone Strecker Referentin im Bundesministerium für Gesundheit Prävention und Gesundheitsförderung in Deutschland Anknüpfungspunkte für gemeinsames Handeln mit dem
Es gilt das gesprochene Wort! Rede von Simone Strecker Referentin im Bundesministerium für Gesundheit Prävention und Gesundheitsförderung in Deutschland Anknüpfungspunkte für gemeinsames Handeln mit dem
Qualitätsentwicklung in der Blackbox der Setting- Förderung? Eine Querschau auf kommunaler Ebene
 Qualitätsentwicklung in der Blackbox der Setting- Förderung? Eine Querschau auf kommunaler Ebene Dr. des. Gesine Bär Qualität macht den Unterschied Berlin 13.01.2015 Gliederung 1. Black Box der Setting-Entwicklung
Qualitätsentwicklung in der Blackbox der Setting- Förderung? Eine Querschau auf kommunaler Ebene Dr. des. Gesine Bär Qualität macht den Unterschied Berlin 13.01.2015 Gliederung 1. Black Box der Setting-Entwicklung
Hessisches Ministerium der Finanzen EPSAS aus dem Blickwinkel des Landes Hessen
 Hessisches Ministerium der Finanzen EPSAS aus dem Blickwinkel des Landes Hessen Brüssel, den 20. August 2014 1 EPSAS Entwicklung auf Europäischer Ebene Richtlinie 2011/85/EU v. 8.11.2011 über Anforderungen
Hessisches Ministerium der Finanzen EPSAS aus dem Blickwinkel des Landes Hessen Brüssel, den 20. August 2014 1 EPSAS Entwicklung auf Europäischer Ebene Richtlinie 2011/85/EU v. 8.11.2011 über Anforderungen
Erfolgsfaktoren integrativer Ansätze in Deutschland
 Erfolgsfaktoren integrativer Ansätze in Deutschland Was gibt`s? Wann klappt`s? Dirk Schubert nova-institut 1 Kennzeichen / Verständnis integrativer Regionalentwicklung Sektorübergreifender Ansatz >> der
Erfolgsfaktoren integrativer Ansätze in Deutschland Was gibt`s? Wann klappt`s? Dirk Schubert nova-institut 1 Kennzeichen / Verständnis integrativer Regionalentwicklung Sektorübergreifender Ansatz >> der
SYNAKLI - Instrumente zur Stärkung von Synergien zwischen Natur- und Klimaschutz im Bereich Landbewirtschaftung
 SYNAKLI - Instrumente zur Stärkung von Synergien zwischen Natur- und Klimaschutz im Bereich Landbewirtschaftung Johannes Schuler, G. Uckert, A. Bues, C. Krämer, B. Osterburg, N. Röder BfN-Tagung Biodiversität
SYNAKLI - Instrumente zur Stärkung von Synergien zwischen Natur- und Klimaschutz im Bereich Landbewirtschaftung Johannes Schuler, G. Uckert, A. Bues, C. Krämer, B. Osterburg, N. Röder BfN-Tagung Biodiversität
Arbeiten für. Mittelfranken. Selbstbewusst. Erfolgreich. Heimatverbunden. BayernSPD Landtagsfraktion
 Arbeiten für Mittelfranken. Selbstbewusst. Erfolgreich. Heimatverbunden. BayernSPD Landtagsfraktion Arbeiten für Mittelfranken. Als eine der zehn größten Wirtschaftsregionen Deutschlands ist Mittelfranken
Arbeiten für Mittelfranken. Selbstbewusst. Erfolgreich. Heimatverbunden. BayernSPD Landtagsfraktion Arbeiten für Mittelfranken. Als eine der zehn größten Wirtschaftsregionen Deutschlands ist Mittelfranken
Koproduktion bei Demenz
 KoAlFa Koproduktion im Welfare Mix der Altenarbeit und Familienhilfe Koproduktion bei Demenz Theresa Hilse Dipl. Soz. Arb./ Soz. Päd.(FH) Gerontologie- und Geriatriekongress, Bonn 2012 1 Der Rahmen Projektleitung:
KoAlFa Koproduktion im Welfare Mix der Altenarbeit und Familienhilfe Koproduktion bei Demenz Theresa Hilse Dipl. Soz. Arb./ Soz. Päd.(FH) Gerontologie- und Geriatriekongress, Bonn 2012 1 Der Rahmen Projektleitung:
Psychologie in der Naturschutzkommunikation
 Psychologie in der Naturschutzkommunikation Naturschutz, Umweltkrise und die Rolle des Individuums 03. bis 06. November 2014 am Bundesamt für Naturschutz - Internationale Naturschutzakademie Insel Vilm
Psychologie in der Naturschutzkommunikation Naturschutz, Umweltkrise und die Rolle des Individuums 03. bis 06. November 2014 am Bundesamt für Naturschutz - Internationale Naturschutzakademie Insel Vilm
Leitbild Gemeinde Felben-Wellhausen 2003 Überarbeitet 2015. Grundlage für Konkretisierung der Massnahmen. Unsere Leitidee.
 2003 Überarbeitet 2015 Grundlage für Konkretisierung der Massnahmen Unsere Leitidee Felben-Wellhausen Ein wohnliches Dorf zum Leben und Arbeiten in einer aufstrebenden Region 1 Gemeindeentwicklung Bewahrung
2003 Überarbeitet 2015 Grundlage für Konkretisierung der Massnahmen Unsere Leitidee Felben-Wellhausen Ein wohnliches Dorf zum Leben und Arbeiten in einer aufstrebenden Region 1 Gemeindeentwicklung Bewahrung
Wasserwirtschaft in Deutschland. Wasserversorgung Abwasserbeseitigung
 Wasserwirtschaft in Deutschland Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Öffentliche Abwasserbeseitigung in Zahlen (211) Abwasserbehandlungsanlagen: knapp 1. Behandelte Abwassermenge: 1,1 Mrd. m 3 (5,2 Mrd.
Wasserwirtschaft in Deutschland Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Öffentliche Abwasserbeseitigung in Zahlen (211) Abwasserbehandlungsanlagen: knapp 1. Behandelte Abwassermenge: 1,1 Mrd. m 3 (5,2 Mrd.
Der Biosphärenpark Wienerwald Geologie und Kulturgeschichte
 Der Biosphärenpark Wienerwald Geologie und Kulturgeschichte Michael Götzinger (Institut für Mineralogie und Kristallographie, Univ. Wien; Wienerwaldmuseum Eichgraben) Einleitung: Anerkennung im Sommer
Der Biosphärenpark Wienerwald Geologie und Kulturgeschichte Michael Götzinger (Institut für Mineralogie und Kristallographie, Univ. Wien; Wienerwaldmuseum Eichgraben) Einleitung: Anerkennung im Sommer
Erfahrungen mit der Umsetzung der WRRL und der HWRM-RL in Deutschland
 11. Sächsische Gewässertage 2014 Dresden, 4. Dezember 2014 Erfahrungen mit der Umsetzung der WRRL und der HWRM-RL in Deutschland Thomas Borchers Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit,
11. Sächsische Gewässertage 2014 Dresden, 4. Dezember 2014 Erfahrungen mit der Umsetzung der WRRL und der HWRM-RL in Deutschland Thomas Borchers Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit,
SCHRIFTEN DES VEREINS FÜR UMWELTRECHT BREMEN. Schriftleitung: Dr. Sabine Schlacke RHOMBOS VERLAG RHOMBOS-VERLAG BERLIN
 SCHRIFTEN DES VEREINS FÜR UMWELTRECHT BREMEN Schriftleitung: Dr. Sabine Schlacke Forschung Politik RHOMBOS VERLAG RHOMBOS-VERLAG BERLIN 1 Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche
SCHRIFTEN DES VEREINS FÜR UMWELTRECHT BREMEN Schriftleitung: Dr. Sabine Schlacke Forschung Politik RHOMBOS VERLAG RHOMBOS-VERLAG BERLIN 1 Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche
Forum Natürliche Ressourcen: Themen und Maßnahmen
 Managementplänen und ähnlichem Biotopverbund im Schwäbischen Wald durch die Ausarbeitung von Natura 2000- Landschaft- erhaltungs- verbände Natur- und Artenschutzaspekte werden bei allen Planungen selbstverständliche
Managementplänen und ähnlichem Biotopverbund im Schwäbischen Wald durch die Ausarbeitung von Natura 2000- Landschaft- erhaltungs- verbände Natur- und Artenschutzaspekte werden bei allen Planungen selbstverständliche
Investitions- und Steuerstandort Schweiz
 Investitions- und Steuerstandort Schweiz Wirtschaftliche und steuerliche Rahmenbedingungen von Dr. Jürgen Brand, Hermann Bechtold, Christine Boldi-Goetschy, Lorella Callea, Dominique Facincani-Kunz, Dr.
Investitions- und Steuerstandort Schweiz Wirtschaftliche und steuerliche Rahmenbedingungen von Dr. Jürgen Brand, Hermann Bechtold, Christine Boldi-Goetschy, Lorella Callea, Dominique Facincani-Kunz, Dr.
Principles in Human Resource Management HS 2014
 Institut für Betriebswirtschaftslehre / Lehrstuhl Human Resource Management Principles in Human Resource Management HS 2014 Prof. Dr. Bruno Staffelbach Andreas Schmid, MA UZH Susanne Mehr, BA UZH Gastreferentinnen
Institut für Betriebswirtschaftslehre / Lehrstuhl Human Resource Management Principles in Human Resource Management HS 2014 Prof. Dr. Bruno Staffelbach Andreas Schmid, MA UZH Susanne Mehr, BA UZH Gastreferentinnen
Kommunale Gesundheitskonferenz. für den Landkreis Karlsruhe
 Gesundheitskonferenz Kommunale Gesundheitskonferenz für den Landkreis Karlsruhe UAG Betriebliches Gesundheitsmanagement Handlungsempfehlungen 2013 Inhalt Einleitung...2 Unterarbeitsgruppe Betriebliches
Gesundheitskonferenz Kommunale Gesundheitskonferenz für den Landkreis Karlsruhe UAG Betriebliches Gesundheitsmanagement Handlungsempfehlungen 2013 Inhalt Einleitung...2 Unterarbeitsgruppe Betriebliches
Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung in Stuttgart und in anderen Großstädten mit 500 000 und mehr Einwohnern 1995 bis 2001
 Kurzberichte Statistik und Informationsmanagement, Monatsheft 12/2003 Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung in Stuttgart und in anderen Großstädten mit 500 000 und mehr Einwohnern 1995 bis 2001
Kurzberichte Statistik und Informationsmanagement, Monatsheft 12/2003 Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung in Stuttgart und in anderen Großstädten mit 500 000 und mehr Einwohnern 1995 bis 2001
6 Zusammenfassende Bewertung und Ausblick
 437 6 Zusammenfassende Bewertung und Ausblick Immer wieder scheitern Projekte zur Software-Gestaltung im Öffentlichen Dienst bzw. sie laufen nicht wie geplant ab. Dies ist für sich genommen nicht weiter
437 6 Zusammenfassende Bewertung und Ausblick Immer wieder scheitern Projekte zur Software-Gestaltung im Öffentlichen Dienst bzw. sie laufen nicht wie geplant ab. Dies ist für sich genommen nicht weiter
Fördermöglichkeiten für Jungunternehmer
 Fördermöglichkeiten für Jungunternehmer Mag. Alexander Stockinger Förder-Service WKO Oberösterreich 04. Mai 2010 Schwierigkeiten bei der Unternehmensgründung Abwicklung rechtlicher oder administrativer
Fördermöglichkeiten für Jungunternehmer Mag. Alexander Stockinger Förder-Service WKO Oberösterreich 04. Mai 2010 Schwierigkeiten bei der Unternehmensgründung Abwicklung rechtlicher oder administrativer
Ökosystemleistungen und Biodiversität im EU-Fokus
 Eine Zukunftsaufgabe in guten Händen Ökosystemleistungen und Biodiversität im EU-Fokus Karin Robinet Fachgebiet I 2. 1; Recht & Ökonomie Gliederung 1. Einführung: Von 2010 zu 2020 und 2050 2. Der europäische
Eine Zukunftsaufgabe in guten Händen Ökosystemleistungen und Biodiversität im EU-Fokus Karin Robinet Fachgebiet I 2. 1; Recht & Ökonomie Gliederung 1. Einführung: Von 2010 zu 2020 und 2050 2. Der europäische
Die Stakeholderanalyse als Werkzeug zur Identifizierung von Kooperationspartnern
 Monika Weber, Charis L. Braun und Judith Specht Die Stakeholderanalyse als Werkzeug zur Identifizierung von Kooperationspartnern Arbeitspapier Fachgebiet Politik und Märkte in der Agrar- und Ernährungswirtschaft
Monika Weber, Charis L. Braun und Judith Specht Die Stakeholderanalyse als Werkzeug zur Identifizierung von Kooperationspartnern Arbeitspapier Fachgebiet Politik und Märkte in der Agrar- und Ernährungswirtschaft
Die Aufgaben des Zweckverbandes Knüllgebiet
 Die Aufgaben des Zweckverbandes Knüllgebiet Entwicklung des Handlungsprogramms zur ökonomischen, ökologischen, sozialen und kulturellen Entwicklung des Knüllgebietes nach Maßgabe der Ziele und Erfordernisse
Die Aufgaben des Zweckverbandes Knüllgebiet Entwicklung des Handlungsprogramms zur ökonomischen, ökologischen, sozialen und kulturellen Entwicklung des Knüllgebietes nach Maßgabe der Ziele und Erfordernisse
Leitbild Malans. Wohnen und leben in den Bündner Reben
 Leitbild Malans Wohnen und leben in den Bündner Reben Gemeinde Malans: Zukunftsperspektiven Richtziele Malans mit seinen natürlichen Schönheiten, Wein und Kultur ist eine liebens- und lebenswerte Gemeinde.
Leitbild Malans Wohnen und leben in den Bündner Reben Gemeinde Malans: Zukunftsperspektiven Richtziele Malans mit seinen natürlichen Schönheiten, Wein und Kultur ist eine liebens- und lebenswerte Gemeinde.
COMINN KOMpetenzen für INNovation im Metallsektor DEFINITIONEN DER LERNERGEBNISSE
 COMINN KOMpetenzen für INNovation im Metallsektor Land: Institution: Qualifikation: Portugal Inovafor Innovationsentwicklung und Verantwortliche für Innovation in Arbeitsteams in Klein- und Mittelbetrieben,
COMINN KOMpetenzen für INNovation im Metallsektor Land: Institution: Qualifikation: Portugal Inovafor Innovationsentwicklung und Verantwortliche für Innovation in Arbeitsteams in Klein- und Mittelbetrieben,
Forschen mit GrafStat Partizipation 2.0
 Partizipation 2.0 Projektteam der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster FB Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften Leitung: Prof. Dr. W. Sander in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für
Partizipation 2.0 Projektteam der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster FB Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften Leitung: Prof. Dr. W. Sander in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für
