Gerald Koller, Steyr: RISIKOKOMPETENTE PRÄVENTION Voraussetzung und Wegbegleiter für Jugendliche, Rausch- und Risikobalance zu entwickeln
|
|
|
- Theodor Kurzmann
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Gerald Koller, Steyr: RISIKOKOMPETENTE PRÄVENTION Voraussetzung und Wegbegleiter für Jugendliche, Rausch- und Risikobalance zu entwickeln Zur Ausgangslage Die stetig steigende Anzahl jugendlicher KomsumentInnen illegalisierter Substanzen, wie sie Studien wie jene von Wittchen und Lieb aufzeigen, verweist auf ein sich diesbezüglich verdünnendes Unrechtsempfinden immer größerer Personengruppen. Noch bedeutsamer ist jedoch der Umstand, dass durch die hier beschriebene Dynamik zunehmende Alltagsnähe von Drogenkonsum und Rauscherfahrungen eine lange Zeit unhinterfragte, aber populäre Grundannahme der Suchthilfe obsolet geworden ist: Menschen greifen nicht nur zu Drogen, weil sie damit psychischen und sozialen Problemen kurzzeitig entfliehen wollen oder Selbstheilung anstreben, sondern weil die Rauscherfahrung Genuss, Selbstentgrenzung, community und fun verspricht! Diesen Umstand muss Prävention ebenso wahrnehmen wie die Notwendigkeit des Gesprächs über all das, was Menschen im Rausch so tun: Er-lösung, Abenteuer, Geborgenheit, andere Wirklichkeiten, die über den gesellschaftlich definierten Rahmen hinausführen, schließlich Initiation. Das hier vorgestellte risflecting-konzept versteht sich als Beitrag zu einer risikokompetenten Prävention, die nicht nur Risiken definiert, sondern das Risiko an sich als wesentliche Entwicklungssehnsucht des Menschen begreift. Unter Rausch wird hier eine prozesshafte Veränderung sinnlicher und sozialer Wahrnehmung hinsichtlich Eindrücken, Emotionen, Grenzen und Konventionen verstanden. Risiko meint die Verbindung von Ungewissheit und Bedeutsamkeit, die mit einem Ereignis einhergeht und zur Auseinandersetzung mit ihm und seinen Folgen auffordert. Gesellschaftliche Polaritäten... Rausch und Risiko sind in unserer Gesellschaft höchst ambivalent gebrauchte Begriffe: auf der einen Seite werden sie als mögliche Gefährdung für die menschliche Stabilität und Gesundheit problematisiert bzw. moralisch verworfen auf der anderen Seite von politischen, wirtschaftlichen und sozialen Kräften als wichtige Faktoren in p.r. und der Inszenierung von sozialen events erkannt und eingesetzt. So ist insbesondere der Freizeitbereich junger Menschen als rauschhaftes no risk-no fun - Patchwork komponiert. Philosophen und Lernpsychologen fordern überdies vermehrt Risikobereitschaft, die erst Lernen und Wertentwicklungen ermöglicht. Und die globale Wirtschaft erwartet sie als Grundtugend des gegenwärtigen und zukünftigen Arbeitsalltags.
2 ...und pädagogische Konsequenzen Wie auch immer: Das Bedürfnis nach Risikosituationen und rauschhaften Erfahrungen ist im Menschen verankert, ihm wird täglich millionenfach auf verschiedenste Weise nachgegangen. Dies ruft nach Auseinandersetzung und Kultivierung. Hier steht die präventive Jugendarbeit, die die Negativ-Wirkungen all dieser Sehnsüchte einzuschränken hat, im Dilemma einer Tradition, die seit etwa 200 Jahren das Kind mit dem Bade ausschüttet :Im Kampf gegen problematische Auswirkungen, die keineswegs zwingend sind, werden auch die ihnen zugrundeliegenden Bedürfnisse problematisiert und oftmals bekämpft. Mit diesem Versuch der Minimierung von Risiko- und Rauschsituationen wird aber Prävention zunehmend als weltfremd erlebt. Pädagogik, die Rausch und Risiko ausschließlich mit Gefahren und Tod assoziiert, hilft Menschen nicht, Kommunikation zwischen ihrem Lebensalltag und ihren außeralltäglichen Sehnsüchten und Erfahrungen aufzubauen. Sie spaltet vielmehr in zwei Bewusstseinsbereiche: ein von Kontrollmoral besetztes Über-Ich und ein triebhaftes Es ; für das mit Schuldgefühlen erlebte Es wird fortan keine Verantwortung übernommen ( Ich weiß nicht, was ich gestern gesagt habe ich war ja betrunken ). Da Maßnahmen insbesondere im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit nur dann erfolgversprechend sind, wenn sie lebenswelt-orientiert geplant und durchgeführt werden, folgern ExpertInnen in diesem Arbeitsgebiet vermehrt, dass die hier beschriebenen Phänomene aus dem Problemzirkel herausgelöst und als grundlegende menschliche Verhaltens- und Erfahrungsräume betrachtet werden müssen. So ist es für eine effiziente Gesundheitsförderung nicht zuträglich, wenn das Phänomen Rausch mit dem zwangs- und abhängigkeits-orientierten Phänomen Sucht assoziiert wird: Die Verknüpfung zweier unterschiedlicher Phänomene ist weder einem fachlichen Diskurs noch einer differenzierten Umsetzung im Arbeitsalltag von Nutzen. Ein neues pädagogisches Kommunikationsmodell: Im internationalen Diskurs zeigt sich daher die Tendenz, statt der Minimierung von Rausch- und Risikosituationen eine Optimierung des Verhaltens zu erreichen. Dazu bedarf es der Entwicklung * persönlicher Kompetenzen * offener Kommunikationsformen über Erfahrungen und Erlebnisse * und gesellschaftlicher Integrationsformen sowie der Kultivierung des Diskurses Der diesbezügliche Forschungs- und Handlungsansatz findet in Europa vermehrt praktische Anwendung und wird mit dem Begriff RISFLECTING beschrieben. Risflecting greift die aktuellen Ergebnisse der Gehirnforschung auf, die besagen, dass das menschliche Gehirn in drei evolutionären Phasen entstanden ist: Das sogenannte Reptiliengehirn mit Hirnstamm und Kleinhirn, das für die Sicherung der existenziellen Funktionen und Emotionen zuständig ist.
3 Das ältere Säugetiergehirn (sogenanntes Pferdegehirn ) mit Hippocampus und Amygdala, das Erinnerungen an Gefühle und Orte und somit die soziale Dimension unseres Lebens steuert. Und das jüngere Säugetiergehirn, die Großhirnrinde: Die hier angelegten Funktionen ermöglichen Sprache, Planung und komplexe Gefühle wie Selbstreflexion. Gefühl Da das lernende Gehirn neue Synapsen zwischen den Neuronen nur in freudvoller Gestimmtheit, also bei Ausschüttung von Dopamin oder Serotonin, bildet, lassen neuropharmakologische Forschungsergebnisse darauf schließen, dass ein optimaler Umgang mit Rausch und Risiko nicht durch die Warnung vor den Gefahren, sondern durch den Aufbau einer kommunikativen Brücke zwischen alltäglicher Vernunft und dem Risikobereich in den gefühlssteuernden Zentren unseres Gehirns gewährleistet wird (vgl. Hepp, Duman, 2000). Damit werden kulturgeschichtliche Erkenntnisse bestätigt, die besagen, dass Gesellschaften, die Risiko- und Rausch-Erfahrungen integrieren, diese Erfahrungen für das Individuum und die Gesellschaft nutzbar machen können und damit auch Problementwicklungen vorbeugen: Das Wagnis, ein RISiko einzugehen / Rausch zu erleben, wird durch Vor- und Nachbereitung, also durch ReFLEKTion, einschätzbar und in den Alltag integriert.
4 EXISTENTIELLE BEDROHUNG Gefahren- WAGNIS: Außeralltägliches VERNUNFT: Alltagsbewusstsein Erfahrungsbewusstsein und Todeszone Die Pfeile deuten die Brückenfunktion von RISFLECTING an. Die hier dargestellten drei Erfahrungsbereiche menschlichen Lebens entsprechen den o.g. Entwicklungsstufen und Aufgabenbereichen des menschlichen Gehirns: Überleben in der Gefahren- und Todeszone Entwickeln von Gefühlen Strukturieren durch Vernunft. Die gesellschaftlich/pädagogische Reaktion auf Risiko- und Rauschbedürfnisse, dass diese nur durch Vernunftmaßnahmen kontrollierbar seien ansonsten ausnahmslos der Weg in die Gefahren- und Todeszone führe, lässt Lern- und Kommunikationsmöglichkeiten im sozialen Gefühlsbereich unberücksichtigt. Erst die Interaktion zwischen vernunftgeleitetem Alltag und selbstgewähltem Wagnis macht die Optimierung und Kultivierung von Rausch- und Risikoverhalten möglich. Diese Brücke will risflecting bauen: Denn nur die Kommunikation zwischen beiden Bewusstseinsbereichen sichert die VerANTWORTung des Individuums und der Gesellschaft für Rausch- und Risikosituationen -statt der eher problemfördernden Bekämpfung derselben.
5 Auch in der pädagogischen Arbeit gilt: Erst das Hereinholen des Rausch- und Risikohaften in die Nähe des Alltäglichen sichert a) die mögliche Auseinandersetzung mit ihm, b) den Kontakt mit den Zielgruppen (die präventive Maßnahmen nur allzu oft als moralische Verwerfung ihrer Rausch- und Risikosehnsüchte erlebt). Risflecting verfolgt folgende Ziele: Integration von Rausch- und Risikoerfahrungen auf persönlicher, sozialer und gesellschaftlicher Ebene Nutzbarmachung dieser Erfahrungen für die Alltags- und Lebensgestaltung Übernahme von Verantwortung für außeralltägliches Verhalten durch Rauschkultur und Risikokompetenz. Dies meint insbesondere die Vor- und Nachbereitung solcher Erfahrungen durch die bewusste Wahrnehmung und Gestaltung von Set (innerer Bereitschaft) und Setting (äußerem Umfeld). Grundlagen des risflecting-ansatzes ist der empowerment-ansatz der WHO, die flow- Forschung, Erkenntnisse der Psychoanalyse, der Gehirnforschung sowie sozialethnologischer Studien. Zielgruppen von risflecting sind nicht Problemkonsumenten von Substanzen und Missbraucher, nicht Personen und Gruppen mit exzessivem Risikoverhalten. Solche Personengruppen bedürfen sekundärpräventiver Hilfestellung und Maßnahmen der harm reduction. Risflecting zielt vielmehr darauf ab, jener großen Gruppe von Personen, die Risikosituationen unbewusst eingehen und Rauscherfahrungen konsumieren, bewusste Kultivierungsmöglichkeiten durch Diskurs, Projekte und Beziehungsarbeit anzubieten. Da Risikoverhalten je nach persönlicher Vorliebe und sozialem Setting variiert, sind Risikotypen als durchgängige Handlungsstrategie nicht eindeutig diagnostizierbar wir haben es in unserem pädagogischen Handeln also immer mit einer Melange verschiedener Handlungsdynamiken und Einflussfaktoren zu tun. Hier strebt risflecting Balance an: So brauchen in mancher Situation die einen mehr Risikobereitschaft, die anderen wiederum Hilfestellung durch Begrenzung derselben. In der präventiven Jugendarbeit setzt also RISFLECTING gemäß den oben dargestellten Graphiken wie folgt an:
6 Sehnsucht / Wunsch / Triebimpuls Integration in den Alltag V o r b e r e i t u n g Analyse der Rahmenbedingungen/Dosierung Vernunft Selbstreflexion Mit-Gestaltung Reflexion in des sozialen Settings der Gruppe / Gefühl Kommunizieren Selbstwahrnehmung + Entwicklung einer positiven Aufarbeitung persönlichen Befindlichkeit Existentielle Befindlichkeit des Erlebten / Stabilisieren BREAK: Entscheidung N a c h b e r e i t u n g Verzicht Durchführung Ziel von risflecting ist also die Optimierung folgender Handlungsressourcen: soziale Kompetenzen Auf individueller wie sozialer Ebene sind damit folgende 3 Kultivierungsinstrumente gemeint: die offene Diskussion über Rausch- und Risikoerfahrungen, -sehnsüchte und -strategien soziale Wahrnehmung, wie sie das dänische Präventionsprogramm look at your friends auf zweifache Weise fokussiert: Schau, wer deine Freunde sind und schaut aufeinander, wenn ihr gemeinsam unterwegs seid. Entwicklung stabiler nachhaltiger sozialer Netze und Strukturen in allen gesellschaftlichen Settings, die Begleitung und Lernraum anbieten können. break Die Kompetenz, vor dem Eingehen auf eine Risikosituation kurz inne zu halten und innere Bereitschaft, psychische und physische Verfassung sowie soziale und Umweltfaktoren miteinander in Abstimmung zu bringen, bevor die Entscheidung zur Handlung getroffen wird wird BREAK genannt. Dieser mitunter durchaus kurze Wahrnehmungs- und Entscheidungsprozess ist weniger kognitiver als emotionaler Natur zumal auch die Wahrnehmung des eigenen Körpers wichtige Voraussetzung für diese Kompetenz ist. Reflexion Außeralltägliche Erfahrungen bedürfen der Reflexion auf individueller und sozialer Ebene, um nachhaltig wirken zu können und für den Alltag nutzbar zu sein. Erst die Integration in das alltägliche Leben auch im Sinne einer gesund-
7 heitsfördernden Kultur der Balance beugt Fluchttendenzen und moralische Bewusstseinsspaltungen (wie sie beispielsweise den gesellschaftlichen Umgang mit Alkohol bestimmen) vor. Der deutsche Gehirnforscher Wolf Singer hat herausgefunden, dass hormonell gesteuerte vereinheitlichende neuromale Oszillationen im Schwingungsbereich von 40 Hz die größtmögliche Zusammenbindung von Erfahrungen ermöglichen. Reflexionsfördernde Settings wie eine angenehme Gesprächsatmosphäre führen zur Entwicklung dieser Oszillationen (Singer bei Klein, 2002). Somit muss also auch Reflexion nicht als rein kognitiver, sondern vielmehr als sozialer Akt verstanden werden, der einen Prozess positiver Gefühle auslöst und nachhaltiges Lernen ermöglicht. Lebenskompetenzen als Voraussetzung für die Entwicklung von risflecting: Um Rausch- und Risikokompetenz zu entwickeln, bedarf es grundsätzlicher intellektueller, sozialer und emotionaler Fähigkeiten. Diese zu bilden ist Ziel allgemeiner Pädagogik der Gesundheitsförderung und Primärprävention. Hier bietet sich die Kooperation mit Fachkräften aus diesen Handlungsfeldern an. Der Eisberg grundlegender Kompetenzen zeigt, dass die Fähigkeit, mit Rausch- und Risikosituationen umzugehen, als special skill die Spitze eines Eisbergs von generellen life skills ist, deren unspezifische Ausrichtung risflecting auf den Umgang mit Rausch und Risiko fokussieren möchte: So ist eine allgemeine Konsumkompetenz wichtige Voraussetzung für die speziellen Kompetenzen, die risflecting anstrebt damit ist sowohl gemeint, altersgemäß Substanzen und entsprechende Quantitäten zu konsumieren (ein zu früher Konsum psychoaktiver Substanzen gilt nach allen Untersuchungen als schädigend) als auch einen Rhythmus zwischen Genuss- und Verzichtsituationen zu entwickeln: Der vom Dopamin-Erwartungssystem gesteuerte Lustimpuls, als angenehm empfundene Zustände zu wiederholen, führt, wenn er nur auf immer die selbe Weise befriedigt wird, zu immer niedrigeren Endorphin-Ausschüttungen im linken Scheitellappen des Stirnhirns. Dosissteigerungen sind in der Regel die Folge. Der Rhythmus zwischen Genießen und Verzichten ist daher ein ebenso wesentliches präventives Ziel wie auch die Entwicklung verschiedener Rausch- und Risikostrategien nach der alten Weisheit Variatio delectat (vgl. auch das Klaviermodell nach Koller, 1994). Die Kommunikation über Rausch- und Risikosituationen und -erfahrungen gelingt nur dann, wenn in allen Bereichen des Alltags Kommunikation trainiert und angewandt wird. Übung in Selbstwahrnehmung ist eine wichtige Voraussetzung dafür, die eigene Befindlichkeit situativ und aktuell wahrzunehmen: Beginnend bei der sensiblen Wahrnehmung der körperlichen Befindlichkeit in Stress- und Entspannungssituationen über die Entwicklung einer adäquaten Sinnlichkeit auf allen Ebenen bis zur Integration von persönlichen und sozialen Ritualen, die das Alltägliche wie das Außeralltägliche strukturieren.
8 Der Eisberg der Kompetenzen: Rausch + Risiko-Kompetenz Konsumkompetenz (Alter/Rhythmus) Begleitung + Kommunikation Trainings- Selbstwahrnehmung: Körper, Sinnlichkeit, Rituale angebote Strukturelle Grundlagen als Voraussetzung für den Einsatz von risflecting: Insbesondere die Risikotypen von Guzei zeigen, dass risflecting nur gelingen kann, wenn der Alltag jener Menschen, die Rausch- und Risikoerfahrungen suchen, strukturell abgesichert ist. Wer keine Arbeit hat, obdachlos ist, wem es an Lebenssinn fehlt oder wer allgemein in gesundheitsschädigenden strukturellen Rahmenbedingungen lebt, läuft wesentlich häufiger Gefahr, Risikosituationen nicht aus dem Motiv der Erfahrungssuche oder des Genusses aufzusuchen, sondern als Kompensation, Flucht aus unerträglichen Lebensbedingungen oder im Sinne eines Selbstheilungsversuchs. Strukturelle Prävention und Gesundheitsförderung sind also eine wichtige Voraussetzung dafür, dass risflecting greifen kann. Die Praxis: Um die wissenschaftlichen Grundlagen für die Diskussion und Weiterführung der bisherigen Präventionsmaßnahmen im Jugendbereich durch RISFLECTING gewährleisten, wurde ein Pool für RISFLECTING-Strategien entwickelt, in dem Entscheidungsträgern und PraktikerInnen Forschungsergebnisse, Bildungsmaßnahmen und Praxisprojekte austauschen und weiterentwickeln.
9 Die Projekte sollen den Begriff Wagnis positiv einführen und den Begriff Sicherheit kritisch hinterfragen: es geht um bewusste Auseinandersetzung, Kultivierung und Balance zwischen Risiko und Reflexion; einen Prozess von der Bewahrungs- zur Bewährungspädagogik einleiten; einen gesellschaftspolitischen Diskurs einleiten: von der Entprivatisierung und Delegation des Risikos zur Eigenverantwortung. den Missbrauch von Rausch- und Risikoerfahrungen für wirtschaftliche oder politische Zwecke kritisch beleuchten; Rausch- und Risikoerfahrungen als Mittel für persönliches Wachstum und gesellschaftliche Veränderung integrieren und weiterentwickeln. An konkreten Praxisprojekten wurden bislang umgesetzt (beispielhafte Nennungen detaillierte und weitere Beschreibungen unter Jugendcafé SERVAS: Ein Jugendzentrum bietet qualitativ hochwertige alkoholische Getränke an. Die JugendleiterInnen haben auch gastronomische Ausbildung und begleiten Jugendliche als Barkeeper bei ihren Alkoholerfahrungen. OBERTRUM RAUSCH FREI: Eine Landgemeinde setzt sich mit der Funktion von Rauscherfahrungen im Gemeindeleben auseinander. SHAKE YOUR BRAKE: Jugendliche können bei Großveranstaltungen ihre alkoholischen Longdrinks unter Anleitung selbst zubereiten. Rauschrituale in Jugendzentren. WAGNIS LEBEN: Initiationsrituale für 14-jährige, die nach der Absolvierung seitens der Öffentlichkeit (Gemeinde, Stadtteil, Schule) neue Rechte zuerkannt bekommen. Peer leader als Vermittler von Rausch- und Risikokompetenz: In den Großprojekten RISK+FUN (Training von peer leaders in Snowboardszenen, und B RAUSCHEND (Qualifizierung der Festkultur im ländlichen Raum) werden peers und MultiplikatorInnen nicht dazu ausgerüstet, als Rollenmodelle Risikoabstinenz, sondern Risikokompetenz in rauschhaften Erfahrungen zu vermitteln. Ein weiterer zukünftiger Schwerpunkt von risflecting ist die Auseinandersetzung mit Festen als Rausch- und Risikoräume (Koller, 2002) und die Entwicklung entsprechender Festkultur, die Vor- und Nachbereitung dieser Erfahrungen vorsieht.
10 4 Folgerungen für die präventive Arbeit Der Diskurs über Rausch und Risiko kann nicht allein vernunftgeleitet geführt werden. Erst ein interaktives emotionales Geschehen sichert nachhaltige präventive Wirkungen. Diese tiefgreifende Nachhaltigkeit von Lernschritten über gewünschtes Verhalten hinaus wird neuesten Erkenntnissen der Gehirnforschung zufolge nur auf zweierlei Wegen gewährleistet: durch massive Krisen (wie z.b. die Erfahrung einer heißen Herdplatte in der Kindheit) oder durch ein wohlwollendes und wohltuendes Setting: das Gehirn lernt bei Ausschüttung von Dopamin und Serotonin im linken Scheitellappen, nicht aber in cortisolgesteuerten Stresssituationen, die (wer erinnert sich nicht an so manche Unterrichtsstunde) zu Lernblockaden führen. Im Rahmen aktuell durchgeführter qualitativer und quantitativer Erhebungen wurde deutlich, dass Jugendliche und MitarbeiterInnen der Jugendhilfe Anliegen, Ansätze und Sprache der Prävention oftmals nicht verstehen und als von ihrer Realität abgehoben empfinden. Alltagsnähe ist also angesagt. Neben dem komplexen Geschehen struktureller Maßnahmen sollten wir in der Kommunikation mit Jugendlichen nicht vergessen, zwei jahrtausendelang bewährte Hilfen zur Rausch- und Risikobalance anzubieten: Nimm nichts oder nicht viel, wenn Du schlecht drauf bist. Guter Rausch braucht gute Stimmung und Zeit und: Halt Ausschau nach Leuten, mit denen du deine Erfahrungen teilen kannst. Auch danach. Die Vorbildrolle erwachsener BegleiterInnen ist nicht zu unterschätzen, wenn es um Rausch und Risiko geht. Hier ist Offenheit angesagt. Über Grenzziehungen, Informationen, pädagogische Appelle und Maßnahmen bzw. -regelungen hinaus schulden wir Kindern und Jugendlichen vor allem eine ernsthafte und aufmerksame Einführung in die Bereiche des Außeralltäglichen. Literatur, auf die in diesem Artikel Bezug genommen wird: Duman, R. et al: Neuronal plasticidy and survival in mood disorders, in: Biol. Psychiatry 48, Klein, S.: Die Glücksformel, Reinbek bei Hamburg, Koller, G.: ZuMutungen ein Leitfaden zur Suchtvorbeugung für Theorie und Praxis, BMUJF, 3. Auflage, 1999 Koller, G.: Das Fest als Rausch- und Risikoraum, in: Feste feiern. Ausstellungsband zur OÖ. Landesausstellung Waldhausen 2002 Rolls, E.: The brain and emotion, Oxford.
Ein Bildungsmodell zur Rausch- und Risikobalance
 Treatment: «risflecting» Ein Bildungsmodell zur Rausch- und Risikobalance Rausch = Prozesshafte Veränderung sinnlicher und sozialer Wahrnehmung hinsichtlich Eindrücken, Emotionen, Grenzen und Konventionen
Treatment: «risflecting» Ein Bildungsmodell zur Rausch- und Risikobalance Rausch = Prozesshafte Veränderung sinnlicher und sozialer Wahrnehmung hinsichtlich Eindrücken, Emotionen, Grenzen und Konventionen
4. Vortrag und Workshop Risikopädagogik
 4. Vortrag und Workshop Risikopädagogik Gerald Koller (Büro Vital) In den zweiten Tag starteten die TeilnehmerInnen in Begleitung von Gerald Koller, der mit seinem mitreißenden Vortrag einen als theoretischen
4. Vortrag und Workshop Risikopädagogik Gerald Koller (Büro Vital) In den zweiten Tag starteten die TeilnehmerInnen in Begleitung von Gerald Koller, der mit seinem mitreißenden Vortrag einen als theoretischen
Wer niemals vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke! risflecting Entwicklungsweg zur Rausch- und Risikokompetenz durch Reflektion
 Wer niemals vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke! risflecting Entwicklungsweg zur Rausch- und Risikokompetenz durch Reflektion Was bedeutet Rausch? Und welche Formen des Rausches kenne ich überhaupt?
Wer niemals vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke! risflecting Entwicklungsweg zur Rausch- und Risikokompetenz durch Reflektion Was bedeutet Rausch? Und welche Formen des Rausches kenne ich überhaupt?
Risflecting will optimieren nicht minimieren und zwar die Fähigkeit der Menschen, sich dem Risiko Leben mit einem Optimum zu stellen.
 www.risflecting.at Risflecting will optimieren nicht minimieren und zwar die Fähigkeit der Menschen, sich dem Risiko Leben mit einem Optimum zu stellen. Rausch prozesshafte Veränderung der sinnlichen und
www.risflecting.at Risflecting will optimieren nicht minimieren und zwar die Fähigkeit der Menschen, sich dem Risiko Leben mit einem Optimum zu stellen. Rausch prozesshafte Veränderung der sinnlichen und
Internationaler Studienweg zur Risikopädagogischen Begleitung Inhaltliche Leitung: Gerald Koller
 Wie Lebenswasser ist der Wein dem Menschen, der ihn trinkt mit Maß. Was hat der für ein Leben, der den Wein entbehrt? Dieser ist ja von Anfang an zur Freude der Menschen geschaffen. Sir 31, 27-28 Internationaler
Wie Lebenswasser ist der Wein dem Menschen, der ihn trinkt mit Maß. Was hat der für ein Leben, der den Wein entbehrt? Dieser ist ja von Anfang an zur Freude der Menschen geschaffen. Sir 31, 27-28 Internationaler
Warum ist Beteiligung wichtig?
 Fachtagung Jugendbeteiligung im Kreis Siegen-Wittgenstein Warum ist Beteiligung wichtig? Prof. Dr. Thomas Coelen / Dipl. Soz. Pia Rother Siegener Zentrum für Sozialisations-, Biographie- und Lebenslaufforschung
Fachtagung Jugendbeteiligung im Kreis Siegen-Wittgenstein Warum ist Beteiligung wichtig? Prof. Dr. Thomas Coelen / Dipl. Soz. Pia Rother Siegener Zentrum für Sozialisations-, Biographie- und Lebenslaufforschung
S o S Sozialraumorientierte Suchthilfe
 S o S Sozialraumorientierte Suchthilfe Findet der Mensch nicht das System, so muss das System die Menschen finden! Modellprojekt mit Unterstützung des Landes Hessen Sucht/Abhängigkeit Die Weltgesundheitsorganisation
S o S Sozialraumorientierte Suchthilfe Findet der Mensch nicht das System, so muss das System die Menschen finden! Modellprojekt mit Unterstützung des Landes Hessen Sucht/Abhängigkeit Die Weltgesundheitsorganisation
BILDUNG GENIESSEN. 14/März 2011. das Informationsmenü des risflecting-pools. Der Genuss im Überblick: Entwicklungspool für Rausch- und Risikokompetenz
 BILDUNG GENIESSEN das Informationsmenü des risflecting-pools 14/März 2011 Entwicklungspool für Rausch- und Risikokompetenz Der Genuss im Überblick: Jugend, Sport & Alkohol (L) Risikokompetenz als Familienthema
BILDUNG GENIESSEN das Informationsmenü des risflecting-pools 14/März 2011 Entwicklungspool für Rausch- und Risikokompetenz Der Genuss im Überblick: Jugend, Sport & Alkohol (L) Risikokompetenz als Familienthema
Kindertageseinrichtungen auf dem Weg
 Vielfalt begegnen ein Haus für alle Kinder Kindertageseinrichtungen auf dem Weg von der Integration zur Inklusion Von der Integration zur Inklusion den Blickwinkel verändern 2 Von der Integration zur Inklusion
Vielfalt begegnen ein Haus für alle Kinder Kindertageseinrichtungen auf dem Weg von der Integration zur Inklusion Von der Integration zur Inklusion den Blickwinkel verändern 2 Von der Integration zur Inklusion
Erklärung unseres Ansatzes in der Arbeit mit dementen Menschen Aus unserer Sicht ist die Würde eines Menschen dann erhalten, wenn er seine
 1 2 3 Erklärung unseres Ansatzes in der Arbeit mit dementen Menschen Aus unserer Sicht ist die Würde eines Menschen dann erhalten, wenn er seine Grundbedürfnisse weitgehend selbst erfüllen kann. Ist er
1 2 3 Erklärung unseres Ansatzes in der Arbeit mit dementen Menschen Aus unserer Sicht ist die Würde eines Menschen dann erhalten, wenn er seine Grundbedürfnisse weitgehend selbst erfüllen kann. Ist er
Pädagogisches Leitbild der Kita Kinderwerkstatt
 Pädagogisches Leitbild der Kita Kinderwerkstatt Inhaltsverzeichnis 1. Allgemeine Grundsätze Grundsätze der Kita Zusammenarbeit mit den Kindern Zusammenarbeit mit den Eltern 2. Schwerpunkte unsere Arbeit
Pädagogisches Leitbild der Kita Kinderwerkstatt Inhaltsverzeichnis 1. Allgemeine Grundsätze Grundsätze der Kita Zusammenarbeit mit den Kindern Zusammenarbeit mit den Eltern 2. Schwerpunkte unsere Arbeit
Leitbild der Jugendarbeit Bödeli
 Leitbild der Jugendarbeit Bödeli Inhaltsverzeichnis Leitbild der Jugendarbeit Bödeli... 3 Gesundheitsförderung... 3 Integration... 3 Jugendkultur... 3 Partizipation... 3 Sozialisation... 4 Jugendgerechte
Leitbild der Jugendarbeit Bödeli Inhaltsverzeichnis Leitbild der Jugendarbeit Bödeli... 3 Gesundheitsförderung... 3 Integration... 3 Jugendkultur... 3 Partizipation... 3 Sozialisation... 4 Jugendgerechte
Vorwort. Wir verfolgen das Ziel die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen zu fördern.
 Vorwort Wir verfolgen das Ziel die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen zu fördern. Mit dieser Zielsetzung vor Augen haben wir Führungskräfte der gpe uns Führungsleitlinien gegeben. Sie basieren
Vorwort Wir verfolgen das Ziel die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen zu fördern. Mit dieser Zielsetzung vor Augen haben wir Führungskräfte der gpe uns Führungsleitlinien gegeben. Sie basieren
Alkoholmissbrauch im Jugendalter - Strategien zur Prävention und Intervention in Städten und Gemeinden -
 Strategien kommunaler Alkoholprävention in Niedersachsen Alkoholmissbrauch im Jugendalter - Strategien zur Prävention und Intervention in Städten und Gemeinden - Hans-Jürgen Hallmann g!nko - Landeskoordinierungsstelle
Strategien kommunaler Alkoholprävention in Niedersachsen Alkoholmissbrauch im Jugendalter - Strategien zur Prävention und Intervention in Städten und Gemeinden - Hans-Jürgen Hallmann g!nko - Landeskoordinierungsstelle
Inhalt des Vortrages:
 Inhalt des Vortrages: Ziele der Prävention Prävention durch Gebote und Verbote Welche Kenntnisse die Mädchen gewinnen Grundbotschaften a. Höre auf Deine Gefühle! b. Du darfst NEIN sagen! c. Dein Körper
Inhalt des Vortrages: Ziele der Prävention Prävention durch Gebote und Verbote Welche Kenntnisse die Mädchen gewinnen Grundbotschaften a. Höre auf Deine Gefühle! b. Du darfst NEIN sagen! c. Dein Körper
20 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN zur Förderung eines verantwortungsvollen Umgangs mit Alkohol in Österreich. ARGE Tagung Stainz
 ARGE Tagung Stainz 19.10.2016 Christoph Lagemann / Lisa Brunner Suchtpra ventives Ziel ist es, einen verantwortungsvollen und kompetenten Umgang mit Alkohol zu erlernen und beizubehalten. Die O sterreichische
ARGE Tagung Stainz 19.10.2016 Christoph Lagemann / Lisa Brunner Suchtpra ventives Ziel ist es, einen verantwortungsvollen und kompetenten Umgang mit Alkohol zu erlernen und beizubehalten. Die O sterreichische
Gesundheitsbildung und Prävention im Lehrplan 21
 Gesundheitsbildung und Prävention im Lehrplan 21 Luzern, 12. September 2015 Dominique Högger, Pädagogische Hochschule FHNW Analyse des Lehrplans 21: Welche Kompetenzformulierungen aus den Fachbereichen
Gesundheitsbildung und Prävention im Lehrplan 21 Luzern, 12. September 2015 Dominique Högger, Pädagogische Hochschule FHNW Analyse des Lehrplans 21: Welche Kompetenzformulierungen aus den Fachbereichen
Die Wirksamkeit von Verhaltens- und Verhältnisprävention in verschiedenen Settings
 Die Wirksamkeit von Verhaltens- und Verhältnisprävention in verschiedenen Settings Dipl.-Psych. Daniela Piontek 4. Nordrhein-Westfälischer Kooperationstag Sucht und Drogen Dortmund, 12. 09. 2007 Gliederung
Die Wirksamkeit von Verhaltens- und Verhältnisprävention in verschiedenen Settings Dipl.-Psych. Daniela Piontek 4. Nordrhein-Westfälischer Kooperationstag Sucht und Drogen Dortmund, 12. 09. 2007 Gliederung
Bärenstark zu stark für Sucht! Primäre Suchtprävention vom Kindergarten bis in die Ausbildung
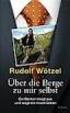 Bärenstark zu stark für Sucht! Primäre Suchtprävention vom Kindergarten bis in die Ausbildung Dagmar Wieland Fachstelle für Suchtprävention der AWO Suchthilfeeinrichtungen Suchtprävention als langfristige
Bärenstark zu stark für Sucht! Primäre Suchtprävention vom Kindergarten bis in die Ausbildung Dagmar Wieland Fachstelle für Suchtprävention der AWO Suchthilfeeinrichtungen Suchtprävention als langfristige
Förderung der SOZIALEN KOMPETENZ
 Förderung der SOZIALEN KOMPETENZ Impulse & Training mit der LEBENSWERK-Methode Konzept & Angebot für Unternehmen Linz, im Jänner 2016 Seite 1 Übergeordnete Ziele: 1 Persönliche Standortbestimmung und Erkennen
Förderung der SOZIALEN KOMPETENZ Impulse & Training mit der LEBENSWERK-Methode Konzept & Angebot für Unternehmen Linz, im Jänner 2016 Seite 1 Übergeordnete Ziele: 1 Persönliche Standortbestimmung und Erkennen
KOMMUNIKATION IN DER SCHULE
 KOMMUNIKATION IN DER SCHULE KOMMUNIZIEREN REFLEKTIEREN ENTWICKELN 1 Kommunikation in der Schule der Zukunft Vier Säulen der Bildung (Jacques Delors, UNESCO, 4, 96) 2 Lernen zu lernen Eine Allgemeinbildung
KOMMUNIKATION IN DER SCHULE KOMMUNIZIEREN REFLEKTIEREN ENTWICKELN 1 Kommunikation in der Schule der Zukunft Vier Säulen der Bildung (Jacques Delors, UNESCO, 4, 96) 2 Lernen zu lernen Eine Allgemeinbildung
Soziale Arbeit im Gesundheitswesen
 Qualifizierungsbereich im Gesundheitswesen Intention der ist es, (1) die Potentiale der Sozialen Arbeit wie auch das damit verbundene soziale Mandat für das Gesundheitssystem nutzbar zu machen; (2) für
Qualifizierungsbereich im Gesundheitswesen Intention der ist es, (1) die Potentiale der Sozialen Arbeit wie auch das damit verbundene soziale Mandat für das Gesundheitssystem nutzbar zu machen; (2) für
Stratégie nationale Addictions
 Département fédéral de l intérieur DFI Office fédéral de la santé publique OFSP Unité de direction Santé publique Stratégie nationale Addictions 2017 2024 Schadensminderung mögliche Entwicklungsschritte
Département fédéral de l intérieur DFI Office fédéral de la santé publique OFSP Unité de direction Santé publique Stratégie nationale Addictions 2017 2024 Schadensminderung mögliche Entwicklungsschritte
im Freiwilligen Sozialen Jahr ( FSJ )
 Mindeststandards im Freiwilligen Sozialen Jahr ( FSJ ) der Landesarbeitsgemeinschaft der FSJ-Träger in Hessen November 2011 Grundverständnis Mindeststandards sollen über die gesetzlichen Rahmenbedingungen
Mindeststandards im Freiwilligen Sozialen Jahr ( FSJ ) der Landesarbeitsgemeinschaft der FSJ-Träger in Hessen November 2011 Grundverständnis Mindeststandards sollen über die gesetzlichen Rahmenbedingungen
Die Bildungsziele des Sächsischen Curriculums der Ernährungs- und Verbraucherbildung
 Die Bildungsziele des Sächsischen Curriculums der Ernährungs- und Verbraucherbildung Anja Schindhelm, Sabine Zubrägel (2012, überarbeitet 2016) nach REVIS (2005) und Ministerium für Bildung und Frauen
Die Bildungsziele des Sächsischen Curriculums der Ernährungs- und Verbraucherbildung Anja Schindhelm, Sabine Zubrägel (2012, überarbeitet 2016) nach REVIS (2005) und Ministerium für Bildung und Frauen
Was ist Sucht/Abhängigkeit?
 Was ist Sucht/Abhängigkeit? 1 Suchtkranke sind in der Regel nicht - unter der Brücke zu finden - ständig betrunken - offensichtlich suchtkrank - leistungsunfähig - aggressiv - labil und willensschwach
Was ist Sucht/Abhängigkeit? 1 Suchtkranke sind in der Regel nicht - unter der Brücke zu finden - ständig betrunken - offensichtlich suchtkrank - leistungsunfähig - aggressiv - labil und willensschwach
Pädagogische Perspektive ( A ) Wahrnehmungsfähigkeit verbessern, Bewegungserfahrungen erweitern... Pädagogische Perspektive ( A )
 Pädagogische Perspektive ( A ) Wahrnehmungsfähigkeit verbessern, Bewegungserfahrungen erweitern... Pädagogische Perspektive ( A ) Wahrnehmungsfähigkeit verbessern, Bewegungserfahrungen erweitern... Pädagogische
Pädagogische Perspektive ( A ) Wahrnehmungsfähigkeit verbessern, Bewegungserfahrungen erweitern... Pädagogische Perspektive ( A ) Wahrnehmungsfähigkeit verbessern, Bewegungserfahrungen erweitern... Pädagogische
Mensch - Natur. Leitbild
 Mensch - Natur Leitbild Unser Auftrag Die berufliche und soziale Integration verstehen wir als gesellschaftspolitischen Auftrag. Wir fördern versicherte Personen in ihrem individuellen Lern- und Entwicklungsprozess.
Mensch - Natur Leitbild Unser Auftrag Die berufliche und soziale Integration verstehen wir als gesellschaftspolitischen Auftrag. Wir fördern versicherte Personen in ihrem individuellen Lern- und Entwicklungsprozess.
Lernen und Motivation
 Lernen und Motivation Worauf es ankommt, wenn Sie Ihr Kind wirklich unterstützen wollen Gedanken, Ideen und Erfahrungen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen März 2014, zusammengetragen von Hansueli Weber
Lernen und Motivation Worauf es ankommt, wenn Sie Ihr Kind wirklich unterstützen wollen Gedanken, Ideen und Erfahrungen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen März 2014, zusammengetragen von Hansueli Weber
Die Arbeit in Mutter-Kind-Einrichtungen: Eine fachliche und persönliche Herausforderung
 Die Arbeit in Mutter-Kind-Einrichtungen: Eine fachliche und persönliche Herausforderung In Mutter-Kind-Einrichtungen leben heute Frauen, die vielfach belastet sind. Es gibt keinen typischen Personenkreis,
Die Arbeit in Mutter-Kind-Einrichtungen: Eine fachliche und persönliche Herausforderung In Mutter-Kind-Einrichtungen leben heute Frauen, die vielfach belastet sind. Es gibt keinen typischen Personenkreis,
Jugendliche zwischen Alkoholrausch, Langeweile, Spass und Risiko
 Voll ins Wochenende Jugendliche zwischen Alkoholrausch, Langeweile, Spass und Risiko Perspektiven geben Suchtprävention Aargau Prävention stärkt Mediothek -Wissen ist wichtig Projekte - damit Sucht nicht
Voll ins Wochenende Jugendliche zwischen Alkoholrausch, Langeweile, Spass und Risiko Perspektiven geben Suchtprävention Aargau Prävention stärkt Mediothek -Wissen ist wichtig Projekte - damit Sucht nicht
Die Rituale des Karate. als Grundlage von Erziehung
 Die Rituale des Karate als Grundlage von Erziehung http://bushido-din.beepworld.de/files/neu2013/sv1.gif von Julian Perzl Ausarbeitung zum 1. Dan Karate-Do September 2014 Gliederung: 1 Vorwort 2 Rituale
Die Rituale des Karate als Grundlage von Erziehung http://bushido-din.beepworld.de/files/neu2013/sv1.gif von Julian Perzl Ausarbeitung zum 1. Dan Karate-Do September 2014 Gliederung: 1 Vorwort 2 Rituale
Seminar Emotionale Intelligenz *
 Seminar Emotionale Intelligenz * S. Scully, Cut Ground Orange and Pink, 2011 (Detail) Dieses zweiteilige Persönlichkeitstraining spricht Menschen an, die ihre Selbstführung verbessern wollen, mehr Unabhängigkeit
Seminar Emotionale Intelligenz * S. Scully, Cut Ground Orange and Pink, 2011 (Detail) Dieses zweiteilige Persönlichkeitstraining spricht Menschen an, die ihre Selbstführung verbessern wollen, mehr Unabhängigkeit
Ein suchtmittelübergreifendes Programm für den verantwortungsvollen Umgang bei riskantem Konsumverhalten für Jugendliche und Erwachsene
 Ein suchtmittelübergreifendes Programm für den verantwortungsvollen Umgang bei riskantem Konsumverhalten für Jugendliche und Erwachsene Drogenhilfe Schwaben Standort: Augsburg Einzugsgebiet: 600.000 Einwohner
Ein suchtmittelübergreifendes Programm für den verantwortungsvollen Umgang bei riskantem Konsumverhalten für Jugendliche und Erwachsene Drogenhilfe Schwaben Standort: Augsburg Einzugsgebiet: 600.000 Einwohner
Elternprogramm zur Förderung des seelischen Wohlbefindens von Kindern in Kindertageseinrichtungen
 Gesundheit Berlin Brandenburg Landeskoordination Schatzsuche Dr. Iris Schiek Tel. 0331-88762017 schiek@gesundheitbb.de Elternprogramm zur Förderung des seelischen Wohlbefindens von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Gesundheit Berlin Brandenburg Landeskoordination Schatzsuche Dr. Iris Schiek Tel. 0331-88762017 schiek@gesundheitbb.de Elternprogramm zur Förderung des seelischen Wohlbefindens von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Junge Menschen für das Thema Alter interessieren und begeistern Lebenssituation von älteren, hochaltrigen und pflegebedürftigen Menschen verbessern
 Stefanie Becker Vorgeschichte Die Geschichte der Gerontologie ist eine lange und von verschiedenen Bewegungen gekennzeichnet Das Leben im (hohen) Alter wird mit steigender Lebenserwartung komplexer und
Stefanie Becker Vorgeschichte Die Geschichte der Gerontologie ist eine lange und von verschiedenen Bewegungen gekennzeichnet Das Leben im (hohen) Alter wird mit steigender Lebenserwartung komplexer und
Handwerkszeug für Kinder
 Landesarbeitsgemeinschaft Evangelischer Familienbildungsstätten in Niedersachsen Handwerkszeug für Kinder Sozialtraining für Kinder im Alter von 5 8 Jahren Konzept für einen Kinderkurs in Zusammenarbeit
Landesarbeitsgemeinschaft Evangelischer Familienbildungsstätten in Niedersachsen Handwerkszeug für Kinder Sozialtraining für Kinder im Alter von 5 8 Jahren Konzept für einen Kinderkurs in Zusammenarbeit
Gerd Hansen (Autor) Konstruktivistische Didaktik für den Unterricht mit körperlich und motorisch beeinträchtigten Schülern
 Gerd Hansen (Autor) Konstruktivistische Didaktik für den Unterricht mit körperlich und motorisch beeinträchtigten Schülern https://cuvillier.de/de/shop/publications/1841 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin
Gerd Hansen (Autor) Konstruktivistische Didaktik für den Unterricht mit körperlich und motorisch beeinträchtigten Schülern https://cuvillier.de/de/shop/publications/1841 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin
Belastung und Selbststärkung im Lehrberuf. Bedingungen und Auswege
 Belastung und Selbststärkung im Lehrberuf Bedingungen und Auswege 1. Selbststärkung wozu? Belastungsfaktoren im Lehrberuf Die Potsdamer Lehrerstudie (beendet 2006) Untersucht Arbeitbezogenes Verhalten
Belastung und Selbststärkung im Lehrberuf Bedingungen und Auswege 1. Selbststärkung wozu? Belastungsfaktoren im Lehrberuf Die Potsdamer Lehrerstudie (beendet 2006) Untersucht Arbeitbezogenes Verhalten
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) Mag.a Samira Bouslama
 Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) Mag.a Samira Bouslama Die Nachhaltigkeitsdimensionen Ökologische Dimension Gesellschaftliche Dimension Schutz von Natur und Umwelt Erhalt der natürlichen Ressourcen
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) Mag.a Samira Bouslama Die Nachhaltigkeitsdimensionen Ökologische Dimension Gesellschaftliche Dimension Schutz von Natur und Umwelt Erhalt der natürlichen Ressourcen
I. Vorschulischer Bereich und Übergang in die Schule
 I. Vorschulischer Bereich und Übergang in die Schule I.1 Gemeinsame pädagogische Grundlagen von Kindertageseinrichtungen und Schulen (Grundschulen, Sonderschulen) Tageseinrichtungen und Schulen tragen
I. Vorschulischer Bereich und Übergang in die Schule I.1 Gemeinsame pädagogische Grundlagen von Kindertageseinrichtungen und Schulen (Grundschulen, Sonderschulen) Tageseinrichtungen und Schulen tragen
Herzlich Willkommen an der DKSS Reinheim Thema: SOZIALES LERNEN
 Herzlich Willkommen an der DKSS Reinheim Thema: SOZIALES LERNEN SEB-Sitzung 11.09.2012 Ralf Loschek DKSS Reinheim Soziales Lernen ist die Vermittlung von Lebenskompetenzen Lebenskompetenzen sind diejenigen
Herzlich Willkommen an der DKSS Reinheim Thema: SOZIALES LERNEN SEB-Sitzung 11.09.2012 Ralf Loschek DKSS Reinheim Soziales Lernen ist die Vermittlung von Lebenskompetenzen Lebenskompetenzen sind diejenigen
Helfen Sie einem. anderen Kind, obenauf zu sein bewerben Sie sich für eine. Erziehungsstelle!
 Helfen Sie einem anderen Kind, obenauf zu sein bewerben Sie sich für eine Erziehungsstelle! Warum manche Kinder NEUE PERSPEKTIVEN brauchen Es gibt Kinder und Jugendliche, die aus den unterschiedlichsten
Helfen Sie einem anderen Kind, obenauf zu sein bewerben Sie sich für eine Erziehungsstelle! Warum manche Kinder NEUE PERSPEKTIVEN brauchen Es gibt Kinder und Jugendliche, die aus den unterschiedlichsten
Diskussionsrunden über Ethik und Demokratie im Jugendtreff und in Jugendgruppen zur Förderung der Integration
 Diskussionsrunden über Ethik und Demokratie im Jugendtreff und in Jugendgruppen zur Förderung der Integration Kurzbeschreibung: Durch Diskussionsrunden zu verschiedenen Themenblöcken (Religion, Heimat,
Diskussionsrunden über Ethik und Demokratie im Jugendtreff und in Jugendgruppen zur Förderung der Integration Kurzbeschreibung: Durch Diskussionsrunden zu verschiedenen Themenblöcken (Religion, Heimat,
Einführung in die Sedona Methode
 Einführung in die Sedona Methode Mit der Sedona Methode gelingt es, unangenehme und belastende Gefühle auf einfache und sanfte Weise loszulassen. Geschichte: Der Erfinder der Sedona Methode ist der amerikanische
Einführung in die Sedona Methode Mit der Sedona Methode gelingt es, unangenehme und belastende Gefühle auf einfache und sanfte Weise loszulassen. Geschichte: Der Erfinder der Sedona Methode ist der amerikanische
ACHTSAMKEIT UND DER INNERE BEOBACHTER. Dr. Monika Veith
 ACHTSAMKEIT UND DER INNERE BEOBACHTER 2 SELBST-DIAGNOSE MIT DEM INNEREN BEOBACHTER Das Konzept der Achtsamkeit im Alltag und in der Arbeit Wozu Achtsamkeit? Das wichtigste Ziel der Achtsamkeitspraxis,
ACHTSAMKEIT UND DER INNERE BEOBACHTER 2 SELBST-DIAGNOSE MIT DEM INNEREN BEOBACHTER Das Konzept der Achtsamkeit im Alltag und in der Arbeit Wozu Achtsamkeit? Das wichtigste Ziel der Achtsamkeitspraxis,
Thomas Ködelpeter ANU FG Schule + Nachhaltigkeit
 Einführung in das Thema: Bauernhof als außerschulischer Lernort der Ernährungsbildung Thomas Ködelpeter ANU FG Schule + Nachhaltigkeit O Bildung für nachhaltige Entwicklung O Ernährungsbildung O Bauernhof
Einführung in das Thema: Bauernhof als außerschulischer Lernort der Ernährungsbildung Thomas Ködelpeter ANU FG Schule + Nachhaltigkeit O Bildung für nachhaltige Entwicklung O Ernährungsbildung O Bauernhof
Der Ausstieg aus dem Autopilotenleben Im Alltag Ruhe und Balance finden
 MBSR - Achtsamkeitstraining Der Ausstieg aus dem Autopilotenleben Im Alltag Ruhe und Balance finden Was ist MBSR? Wir haben Gedanken, aber die Gedanken haben nicht uns Vom unbewussten Reagieren zum bewussten
MBSR - Achtsamkeitstraining Der Ausstieg aus dem Autopilotenleben Im Alltag Ruhe und Balance finden Was ist MBSR? Wir haben Gedanken, aber die Gedanken haben nicht uns Vom unbewussten Reagieren zum bewussten
PRÄVENTIONS- KATALOG
 PRÄVENTIONS- KATALOG Jugendberatung Saalfeld, Brudergasse 18, Saalfeld Tel. 0367145589-125, Mail: jugendberatung.slf-ru@diakonie-wl.de Psychosoziale Suchtberatungsstelle Saalfeld / Rudolstadt Brudergasse
PRÄVENTIONS- KATALOG Jugendberatung Saalfeld, Brudergasse 18, Saalfeld Tel. 0367145589-125, Mail: jugendberatung.slf-ru@diakonie-wl.de Psychosoziale Suchtberatungsstelle Saalfeld / Rudolstadt Brudergasse
Zukunft gestalten! Leitbild für die RHEIN-ERFT AKADEMIE
 Zukunft gestalten! Leitbild für die RHEIN-ERFT AKADEMIE V2- März 2012 Inhalt 1. RHEIN-ERFT AKADEMIE 2020 - Unsere Vision...3 2. Zukunft gestalten!...4 3. Zukunftsmodell RHEIN-ERFT AKADEMIE...5 4. Zukunftsfähigkeit...6
Zukunft gestalten! Leitbild für die RHEIN-ERFT AKADEMIE V2- März 2012 Inhalt 1. RHEIN-ERFT AKADEMIE 2020 - Unsere Vision...3 2. Zukunft gestalten!...4 3. Zukunftsmodell RHEIN-ERFT AKADEMIE...5 4. Zukunftsfähigkeit...6
Stadt Luzern. Leitsätze. Kinder-, Jugend- und Familienpolitik. Stadtrat
 Stadt Luzern Stadtrat Leitsätze Kinder-, Jugend- und Familienpolitik Juni 2014 Leitsätze der Kinder-, Jugend- und Familienpolitik Die Stadt Luzern setzt sich mit ihrer Kinder-, Jugend- und Familienpolitik
Stadt Luzern Stadtrat Leitsätze Kinder-, Jugend- und Familienpolitik Juni 2014 Leitsätze der Kinder-, Jugend- und Familienpolitik Die Stadt Luzern setzt sich mit ihrer Kinder-, Jugend- und Familienpolitik
Selbstkompetenz /// Persönliche Handlungsfähigkeit
 Einleitung // 5 Grundlagen // 5 Selbstkompetenz /// Persönliche Handlungsfähigkeit Autonomie // Die eigene Entwicklung innerhalb eines kulturellen Kontextes gestalten können. // Lebenspläne oder persönliche
Einleitung // 5 Grundlagen // 5 Selbstkompetenz /// Persönliche Handlungsfähigkeit Autonomie // Die eigene Entwicklung innerhalb eines kulturellen Kontextes gestalten können. // Lebenspläne oder persönliche
Offener Unterricht Das Kind soll als Subjekt erkannt und respektiert werden.
 Offener Unterricht ist ein Dachbegriff für unterschiedliche Formen von Unterricht, der sowohl ältere als auch neu-reformpädagogische Konzepte aufnimmt. Die Eigenverantwortlichkeit und Mitwirkung der Schüler
Offener Unterricht ist ein Dachbegriff für unterschiedliche Formen von Unterricht, der sowohl ältere als auch neu-reformpädagogische Konzepte aufnimmt. Die Eigenverantwortlichkeit und Mitwirkung der Schüler
Gesundheitsförderung. Organisationsentwicklung. Weiterentwicklung der Kita zu einer gesundheitsförderlichen Einrichtung
 Gesundheitsförderung als Organisationsentwicklung Weiterentwicklung der Kita zu einer gesundheitsförderlichen Einrichtung 1 Liebe Leiterinnen und Leiter von Kindertageseinrichtungen, liebe pädagogische
Gesundheitsförderung als Organisationsentwicklung Weiterentwicklung der Kita zu einer gesundheitsförderlichen Einrichtung 1 Liebe Leiterinnen und Leiter von Kindertageseinrichtungen, liebe pädagogische
Gender Mainstreaming in der Kinder- und Jugendarbeit...
 Gender Mainstreaming in der Kinder- und Jugendarbeit... Zur Erinnerung: GM bedeutet in der Kinder- und Jugendhilfe bedeutet...... grundsätzlich danach zu fragen, wie sich Maßnahmen und Gesetzesvorhaben
Gender Mainstreaming in der Kinder- und Jugendarbeit... Zur Erinnerung: GM bedeutet in der Kinder- und Jugendhilfe bedeutet...... grundsätzlich danach zu fragen, wie sich Maßnahmen und Gesetzesvorhaben
Denken, Lernen, Vergessen? Was Pädagogik von Hirnforschung lernen kann. Dipl.-Päd. Kajsa Johansson Systemische Therapeutin
 Denken, Lernen, Vergessen? Was Pädagogik von Hirnforschung lernen kann Dipl.-Päd. Kajsa Johansson Systemische Therapeutin Objektive Wahrnehmung? Bildquellen: Schachl, H. (2006): Was haben wir im Kopf?
Denken, Lernen, Vergessen? Was Pädagogik von Hirnforschung lernen kann Dipl.-Päd. Kajsa Johansson Systemische Therapeutin Objektive Wahrnehmung? Bildquellen: Schachl, H. (2006): Was haben wir im Kopf?
Manual. der Weiterbildung und Beratung
 Manual der Weiterbildung und Beratung Im Mittelpunkt des Begleitmaterials für die Weiterbildung steht eine Kartensammlung im DIN-A6-Format. Auf den über 400 Karten finden sich Impulse (praktische Übungen),
Manual der Weiterbildung und Beratung Im Mittelpunkt des Begleitmaterials für die Weiterbildung steht eine Kartensammlung im DIN-A6-Format. Auf den über 400 Karten finden sich Impulse (praktische Übungen),
PÄDAGOGIK / PSYCHOLOGIE
 PÄDAGOGIK / PSYCHOLOGIE 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse 1 Jahreslektion à 70 Minuten 1 Jahreslektion à 70 Minuten Bildungsziele Der Unterricht in Pädagogik und Psychologie trägt bei zum besseren Selbst-
PÄDAGOGIK / PSYCHOLOGIE 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse 1 Jahreslektion à 70 Minuten 1 Jahreslektion à 70 Minuten Bildungsziele Der Unterricht in Pädagogik und Psychologie trägt bei zum besseren Selbst-
LBISucht seit 1972 und AKIS seit 2000 beide am Anton-Proksch-Institut in Wien Kalksburg Zielsetzungen: Forschung in allen Bereichen der Sucht Wissensc
 Pubertät und Suchtprävention Ulrike Kobrna Gym. Wieden Suchtprävention 1 Kobrna 18.05.2009 LBISucht seit 1972 und AKIS seit 2000 beide am Anton-Proksch-Institut in Wien Kalksburg Zielsetzungen: Forschung
Pubertät und Suchtprävention Ulrike Kobrna Gym. Wieden Suchtprävention 1 Kobrna 18.05.2009 LBISucht seit 1972 und AKIS seit 2000 beide am Anton-Proksch-Institut in Wien Kalksburg Zielsetzungen: Forschung
Qualifizierung zum/r behördlichen Gesundheitsmanager/in in der Bundesverwaltung
 Qualifizierung zum/r behördlichen Gesundheitsmanager/in in der Bundesverwaltung Ein Qualifizierungsangebot für Mitgliedsbetriebe der Unfallkasse des Bundes Stand April 2014 Seite 1 Erfolgsfaktor Gesundheitsmanagement
Qualifizierung zum/r behördlichen Gesundheitsmanager/in in der Bundesverwaltung Ein Qualifizierungsangebot für Mitgliedsbetriebe der Unfallkasse des Bundes Stand April 2014 Seite 1 Erfolgsfaktor Gesundheitsmanagement
Resümee und pädagogische Konsequenzen
 Resümee und pädagogische Konsequenzen (Jürgen Fritz, Tanja Witting, Shahieda Ibrahim, Heike Esser) Welche Spiele vom Spieler gewählt werden und welche inhaltlichen Aspekte von ihm wahrgenommen werden und
Resümee und pädagogische Konsequenzen (Jürgen Fritz, Tanja Witting, Shahieda Ibrahim, Heike Esser) Welche Spiele vom Spieler gewählt werden und welche inhaltlichen Aspekte von ihm wahrgenommen werden und
Psychische Belastungen am Arbeitsplatz
 Psychische Belastungen am Arbeitsplatz Personalversammlung Universität Hildesheim 24. November 2010 1 Psyche (grch.) Hauch, Leben, Seele das seelisch-geistige Leben des Menschen unbewusste und bewusste
Psychische Belastungen am Arbeitsplatz Personalversammlung Universität Hildesheim 24. November 2010 1 Psyche (grch.) Hauch, Leben, Seele das seelisch-geistige Leben des Menschen unbewusste und bewusste
Pflegeheim Am Nollen Gengenbach
 Pflegeheim Am Nollen Gengenbach Geplante Revision: 01.06.2018 beachten!!! Seite 1 von 7 Unsere Gedanken zur Pflege sind... Jeder Mensch ist einzigartig und individuell. In seiner Ganzheit strebt er nach
Pflegeheim Am Nollen Gengenbach Geplante Revision: 01.06.2018 beachten!!! Seite 1 von 7 Unsere Gedanken zur Pflege sind... Jeder Mensch ist einzigartig und individuell. In seiner Ganzheit strebt er nach
Fachstelle für Suchtprävention
 Fachstelle für Suchtprävention Dokumentation Gut Drauf?! ein Seminar um Freundschaft, Glück und Abenteuer im Zeitraum 2006 bis 2010 Konzeption von Gut Drauf?! Jugendliche und junge Erwachsene sind heute
Fachstelle für Suchtprävention Dokumentation Gut Drauf?! ein Seminar um Freundschaft, Glück und Abenteuer im Zeitraum 2006 bis 2010 Konzeption von Gut Drauf?! Jugendliche und junge Erwachsene sind heute
"Können Sie mir helfen?"
 Suchtprävention und Suchthilfe für f r jeden Arbeitsplatz "Können Sie mir helfen?" Prävention und Hilfe für kleinere Betriebseinheiten Suchtprävention und Suchthilfe für f r jeden Arbeitsplatz Hilfe bei
Suchtprävention und Suchthilfe für f r jeden Arbeitsplatz "Können Sie mir helfen?" Prävention und Hilfe für kleinere Betriebseinheiten Suchtprävention und Suchthilfe für f r jeden Arbeitsplatz Hilfe bei
Von den Erfahrungen anderer lernen -Gesund aufwachsen- ein Baustein im Gesundheitszieleprozess in Sachsen. Stephan Koesling Hamburg, 21.
 Von den Erfahrungen anderer lernen -Gesund aufwachsen- ein Baustein im Gesundheitszieleprozess in Sachsen Stephan Koesling Hamburg, 21.Oktober 2010 Gliederung: Grundlagen und Struktur Gesundheitsziele
Von den Erfahrungen anderer lernen -Gesund aufwachsen- ein Baustein im Gesundheitszieleprozess in Sachsen Stephan Koesling Hamburg, 21.Oktober 2010 Gliederung: Grundlagen und Struktur Gesundheitsziele
Positive Peer Culture (PPC) Lernen in der Peergroup. am Beispiel von. Projekt Chance im CJD Creglingen
 Positive Peer Culture (PPC) Lernen in der Peergroup am Beispiel von Projekt Chance im CJD Creglingen 1. Kurzpräsentation der Konzeption von Projekt Chance (Kontextklärung ausgewählte konzeptionelle Module)
Positive Peer Culture (PPC) Lernen in der Peergroup am Beispiel von Projekt Chance im CJD Creglingen 1. Kurzpräsentation der Konzeption von Projekt Chance (Kontextklärung ausgewählte konzeptionelle Module)
AWO pro:mensch. Kinder betreuen. Familien beraten.
 AWO pro:mensch. Kinder betreuen. Familien beraten. Unsere Kindertagesstätten. Profil l Konzept l Leitbild Spielen. Lernen. Leben. Was ein Kind in seinen ersten Lebensjahren lernt, ist von großer Bedeutung
AWO pro:mensch. Kinder betreuen. Familien beraten. Unsere Kindertagesstätten. Profil l Konzept l Leitbild Spielen. Lernen. Leben. Was ein Kind in seinen ersten Lebensjahren lernt, ist von großer Bedeutung
Entwicklungspsychologie
 Entwicklungspsychologie 1. Begriffsbestimmung Kindheit 2. Kindheit und geistige Entwicklung 3. Kindheit und Konzentration 4. Kindheit und Motivation 5. Spiel und kindliche Entwicklung Begriffsbestimmung
Entwicklungspsychologie 1. Begriffsbestimmung Kindheit 2. Kindheit und geistige Entwicklung 3. Kindheit und Konzentration 4. Kindheit und Motivation 5. Spiel und kindliche Entwicklung Begriffsbestimmung
Programm München sucht Genuss. Fachtag: Prävention vernetzt München Genuss oder Sucht 25. November 2013 Viktoria Racic, Georg Hopp, Barbara Roth
 Programm München sucht Genuss Fachtag: Prävention vernetzt München Genuss oder Sucht 25. November 2013 Viktoria Racic, Georg Hopp, Barbara Roth Voller als voll? Expertenempfehlungen und Bausteine Ausgangslage
Programm München sucht Genuss Fachtag: Prävention vernetzt München Genuss oder Sucht 25. November 2013 Viktoria Racic, Georg Hopp, Barbara Roth Voller als voll? Expertenempfehlungen und Bausteine Ausgangslage
Basiskompetenzen eines Kindes bis zur Einschulung
 Basiskompetenzen eines Kindes bis zur Einschulung Personale Kompetenzen 1. Selbstwahrnehmung Selbstwertgefühl (Bewertung eigener Eigenschaften und Fähigkeiten) Positive Selbstkonzepte (Wissen über eigene
Basiskompetenzen eines Kindes bis zur Einschulung Personale Kompetenzen 1. Selbstwahrnehmung Selbstwertgefühl (Bewertung eigener Eigenschaften und Fähigkeiten) Positive Selbstkonzepte (Wissen über eigene
Klasse 7. Bildungsstandards: Anthropologie (allgemein menschliche Lebensbedingungen und die Erfahrungswelt der Schüler)
 Curriculum für das Fach Ethik, Klasse 7-10; Vorbemerkung: Gemäß unserem Schulprofil legen wir im Fach Ethik besonderen Wert auf die Erziehung - zu Toleranz, Gewaltlosigkeit und Antirassismus, worunter
Curriculum für das Fach Ethik, Klasse 7-10; Vorbemerkung: Gemäß unserem Schulprofil legen wir im Fach Ethik besonderen Wert auf die Erziehung - zu Toleranz, Gewaltlosigkeit und Antirassismus, worunter
Unter Druck arbeiten
 Unter Druck arbeiten Tagung der Evangelischen Akademie Tutzing am 24./25. Juni 2013 Mignon von Scanzoni Was ist Achtsamkeit? Artikel zum Workshop Achtsamkeit im Unternehmen Selbstverantwortung und Führungsaufgabe
Unter Druck arbeiten Tagung der Evangelischen Akademie Tutzing am 24./25. Juni 2013 Mignon von Scanzoni Was ist Achtsamkeit? Artikel zum Workshop Achtsamkeit im Unternehmen Selbstverantwortung und Führungsaufgabe
Systematisches Training für Eltern und Pädagogen. STEP in der Jugendhilfe
 Systematisches Training für Eltern und Pädagogen STEP in der Jugendhilfe Ein Erfolgsmodell am Beispiel der Kinder- und Jugendpädagogischen Einrichtung der Stadt Köln (KidS) Statistische Übersicht über
Systematisches Training für Eltern und Pädagogen STEP in der Jugendhilfe Ein Erfolgsmodell am Beispiel der Kinder- und Jugendpädagogischen Einrichtung der Stadt Köln (KidS) Statistische Übersicht über
Kinderrechte sind das Fundament
 Kinderrechte sind das Fundament Fachtagung MMI 29. Mai 2016 Dr. phil. Heidi Simoni Marie Meierhofer Institut für das Kind Unter Verwendung von Unterlagen von Jörg Maywald und Regula Gerber Jenni 6 Dimensionen
Kinderrechte sind das Fundament Fachtagung MMI 29. Mai 2016 Dr. phil. Heidi Simoni Marie Meierhofer Institut für das Kind Unter Verwendung von Unterlagen von Jörg Maywald und Regula Gerber Jenni 6 Dimensionen
Unternehmenszweck, Vision, Mission, Werte
 Unternehmenszweck, Vision, Mission, Werte UNSER STRATEGISCHER RAHMEN Unternehmenszweck, Vision, Mission, Werte Wir haben einen klaren und langfristig ausgerichteten strategischen Rahmen definiert. Er hilft
Unternehmenszweck, Vision, Mission, Werte UNSER STRATEGISCHER RAHMEN Unternehmenszweck, Vision, Mission, Werte Wir haben einen klaren und langfristig ausgerichteten strategischen Rahmen definiert. Er hilft
Hurrelmann: Entwicklungsaufgaben in drei Lebensphasen
 Hurrelmann: Entwicklungsaufgaben in drei Lebensphasen Hurrelmann: Entwicklungsaufgaben im Jugendalter Entwicklung einer intellektuellen und sozialen Kompetenz Selbstverantwortlicher Erwerb schulischer
Hurrelmann: Entwicklungsaufgaben in drei Lebensphasen Hurrelmann: Entwicklungsaufgaben im Jugendalter Entwicklung einer intellektuellen und sozialen Kompetenz Selbstverantwortlicher Erwerb schulischer
Qualifizierung als TrainerIn im Wissenschaftsbereich. Weiterbildungsprogramm
 1 ZWM 2016 Weiterbildungsprogramm 2 Hintergrund und Thematik Zielgruppe Konzept /Methodik Die interne Weiterbildung an Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen umfasst vielfältige Aktivitäten
1 ZWM 2016 Weiterbildungsprogramm 2 Hintergrund und Thematik Zielgruppe Konzept /Methodik Die interne Weiterbildung an Hochschulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen umfasst vielfältige Aktivitäten
Behindertenarbeit. Leitsätze und Agogisches Konzept.
 Behindertenarbeit Leitsätze und Agogisches Konzept www.diakoniewerk.at Geltungsbereich Das vorliegende Agogische 1 Konzept ist die Basis der Arbeit mit Menschen mit Behinderung im Diakoniewerk. Unabhängig
Behindertenarbeit Leitsätze und Agogisches Konzept www.diakoniewerk.at Geltungsbereich Das vorliegende Agogische 1 Konzept ist die Basis der Arbeit mit Menschen mit Behinderung im Diakoniewerk. Unabhängig
Stress als Risiko und Chance
 Heidi Eppel Stress als Risiko und Chance Grundlagen von Belastung, Bewältigung und Ressourcen Verlag W. Kohlhammer Vorwort 9 Teil I Grundlagen: Die Elemente des transaktionalen Stress-Bewältigungs-Modells
Heidi Eppel Stress als Risiko und Chance Grundlagen von Belastung, Bewältigung und Ressourcen Verlag W. Kohlhammer Vorwort 9 Teil I Grundlagen: Die Elemente des transaktionalen Stress-Bewältigungs-Modells
Vorlage für eine individuelle Lernzielvereinbarung im Modul zur Erlangung der staatlichen Anerkennung
 Vorlage für eine individuelle Lernzielvereinbarung im Modul zur Erlangung der staatlichen Anerkennung Name der Einrichtung Träger Name der Praxisanleitung Name des / der Studierenden Der vorliegende Entwurf
Vorlage für eine individuelle Lernzielvereinbarung im Modul zur Erlangung der staatlichen Anerkennung Name der Einrichtung Träger Name der Praxisanleitung Name des / der Studierenden Der vorliegende Entwurf
Die tun nix! Die wollen nur spielen Entwicklungspsychologie, Hirnforschung und jugendliches Verhalten
 !"#$%"&&&'(%!()#*$*+" #",%(*-.)*#) Die tun nix! Die wollen nur spielen Entwicklungspsychologie, Hirnforschung und jugendliches Verhalten Peter J. Uhlhaas Jahrestagung Offene Kinder- und Jugendarbeit Arbeitsgemeinschaft
!"#$%"&&&'(%!()#*$*+" #",%(*-.)*#) Die tun nix! Die wollen nur spielen Entwicklungspsychologie, Hirnforschung und jugendliches Verhalten Peter J. Uhlhaas Jahrestagung Offene Kinder- und Jugendarbeit Arbeitsgemeinschaft
Hauswirtschaft im Quartier
 Hauswirtschaft im Quartier Jahrestagung Berufsverband Hauswirtschaft 15. - 16. April 2013 Stuttgart-Hohenheim Johanna Ewig-Spur Diakonisches Werk Württemberg Jahrestagung Berufsverband Hauswirtschaft April
Hauswirtschaft im Quartier Jahrestagung Berufsverband Hauswirtschaft 15. - 16. April 2013 Stuttgart-Hohenheim Johanna Ewig-Spur Diakonisches Werk Württemberg Jahrestagung Berufsverband Hauswirtschaft April
Wie gehe ich mit Suizidalität um? Dr. med. Barbara Hochstrasser, M.P.H. Chefärztin Privatklinik Meiringen
 Wie gehe ich mit Suizidalität um? Dr. med. Barbara Hochstrasser, M.P.H. Chefärztin Privatklinik Meiringen Suizidalität : Begriffbestimmung Suizidalität meint die Summe aller Denk- und Verhaltensweisen,
Wie gehe ich mit Suizidalität um? Dr. med. Barbara Hochstrasser, M.P.H. Chefärztin Privatklinik Meiringen Suizidalität : Begriffbestimmung Suizidalität meint die Summe aller Denk- und Verhaltensweisen,
Lehren und Lernen 1. Informationsabend. Jugendliche und Computerspiele Risiken und Chancen
 Lehren und Lernen 1. Informationsabend Jugendliche und Computerspiele Risiken und Chancen Sek Liestal 21.09.2011 Computerspielnutzung durch Kinder und Jugendliche Jugendliche in der Schweiz nutzen zur
Lehren und Lernen 1. Informationsabend Jugendliche und Computerspiele Risiken und Chancen Sek Liestal 21.09.2011 Computerspielnutzung durch Kinder und Jugendliche Jugendliche in der Schweiz nutzen zur
Sozialwissenschaftliches Institut Tübingen
 Sozialwissenschaftliches Institut Tübingen Forschung Beratung Konzepte Qualifizierung Köln 22.11.07 Reinhard Winter More Risk mehr Mann!? Jungen und ihr Risikoverhalten zwischen männlichen Bedürfnissen,
Sozialwissenschaftliches Institut Tübingen Forschung Beratung Konzepte Qualifizierung Köln 22.11.07 Reinhard Winter More Risk mehr Mann!? Jungen und ihr Risikoverhalten zwischen männlichen Bedürfnissen,
2.2 Wichtige Ursachen im Überblick
 2.2 Wichtige Ursachen im Überblick Süchtiges Verhalten lässt sich nicht auf eine Ursache zurückführen. Vielmehr liegt ihm ein komplexes Bedingungsgefüge individuell verschiedener Faktoren zugrunde. Generell
2.2 Wichtige Ursachen im Überblick Süchtiges Verhalten lässt sich nicht auf eine Ursache zurückführen. Vielmehr liegt ihm ein komplexes Bedingungsgefüge individuell verschiedener Faktoren zugrunde. Generell
Kapitel 2, Führungskräftetraining, Kompetenzentwicklung und Coaching:
 Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? von Tanja Hollinger 1. Auflage Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? Hollinger schnell und portofrei
Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? von Tanja Hollinger 1. Auflage Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? Hollinger schnell und portofrei
Prinzip Nachhaltigkeit PädagogischeÜberlegungen zum professionellen Selbstverständnis von Jugendsozialarbeit an Schulen
 Ev. Hochschule NürnbergN Institut für f r Praxisforschung und Evaluation Prinzip Nachhaltigkeit PädagogischeÜberlegungen zum professionellen Selbstverständnis von Jugendsozialarbeit an Schulen Fachtagung
Ev. Hochschule NürnbergN Institut für f r Praxisforschung und Evaluation Prinzip Nachhaltigkeit PädagogischeÜberlegungen zum professionellen Selbstverständnis von Jugendsozialarbeit an Schulen Fachtagung
Wie findet Sprachförderung in der Kindertageseinrichtung statt?
 Wie findet Sprachförderung in der Kindertageseinrichtung statt? Zitat: Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt Der Sprachbaum Sprachkompetenz ist eine Schlüsselkompetenz Kommunikation durchzieht
Wie findet Sprachförderung in der Kindertageseinrichtung statt? Zitat: Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt Der Sprachbaum Sprachkompetenz ist eine Schlüsselkompetenz Kommunikation durchzieht
Mindeststandards im Freiwilligen Sozialen Jahr (Inland) der Landesarbeitsgemeinschaft der FSJ-Träger in Rheinland-Pfalz
 FSJ Mindeststandards im Freiwilligen Sozialen Jahr (Inland) der Landesarbeitsgemeinschaft der FSJ-Träger in Rheinland-Pfalz Stand: März 2009 Seite 1 von 7 Grundverständnis Mindeststandards sollen über
FSJ Mindeststandards im Freiwilligen Sozialen Jahr (Inland) der Landesarbeitsgemeinschaft der FSJ-Träger in Rheinland-Pfalz Stand: März 2009 Seite 1 von 7 Grundverständnis Mindeststandards sollen über
um leben zu können? Leben und Sterben im alltäglichen Zusammenhang betrachtet ein Plädoyer für das Leben
 MAJA SCHWEIZER LEBEN. um sterben zu können? STERBEN um leben zu können? Leben und Sterben im alltäglichen Zusammenhang betrachtet ein Plädoyer für das Leben Maja Schweizer Leben, um sterben zu können?
MAJA SCHWEIZER LEBEN. um sterben zu können? STERBEN um leben zu können? Leben und Sterben im alltäglichen Zusammenhang betrachtet ein Plädoyer für das Leben Maja Schweizer Leben, um sterben zu können?
Diagnose psychoaktiver Beeinflussung
 Diagnose psychoaktiver Beeinflussung Aline Hollenbach Hans-Jürgen Maurer Prof. Dr. Peter Schmidt* Dr. Andreas Ewald* Prof. Dr. Thomas Krämer** ReMed Homburg Landesinstitut für Präventives Handeln Saar
Diagnose psychoaktiver Beeinflussung Aline Hollenbach Hans-Jürgen Maurer Prof. Dr. Peter Schmidt* Dr. Andreas Ewald* Prof. Dr. Thomas Krämer** ReMed Homburg Landesinstitut für Präventives Handeln Saar
Reflexion zum kollegialen Coaching
 Dieses Werkzeug ist in Zusammenhang mit unserem Konzept zum kollegialen Coaching zu sehen (vgl. Schaubild unten). (1) Grundsätzliches Aspekte Blick auf das Verhalten von im Zeitraum Geführte Coaching-Gespräche
Dieses Werkzeug ist in Zusammenhang mit unserem Konzept zum kollegialen Coaching zu sehen (vgl. Schaubild unten). (1) Grundsätzliches Aspekte Blick auf das Verhalten von im Zeitraum Geführte Coaching-Gespräche
Gesundes Führen - Führungskräfteentwicklung & Potentialnutzung
 Gesundes Führen - Führungskräfteentwicklung & Potentialnutzung Beugen Sie vor, denn vorbeugen ist sinnvoller als heilen. Das Trainingskonzept vermittelt Lebens- und Leitlinien für ausgeglichene und gesunde
Gesundes Führen - Führungskräfteentwicklung & Potentialnutzung Beugen Sie vor, denn vorbeugen ist sinnvoller als heilen. Das Trainingskonzept vermittelt Lebens- und Leitlinien für ausgeglichene und gesunde
Leadership Essentials
 Leadership 4.0 - Essentials Kommunikationskompetenz für Führungskräfte Teil 1: Wie Sie wirkungsvoll für Klarheit sorgen Inhalte 1. Warum klare Kommunikation in der Führung wichtiger ist denn je 2. Die
Leadership 4.0 - Essentials Kommunikationskompetenz für Führungskräfte Teil 1: Wie Sie wirkungsvoll für Klarheit sorgen Inhalte 1. Warum klare Kommunikation in der Führung wichtiger ist denn je 2. Die
