Literarisches Lernen in kulturwissenschaftlicher Sicht
|
|
|
- Meta Hertz
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 ULF ABRAHAM Literarisches Lernen in kulturwissenschaftlicher Sicht Abstract Dass die elf Aspekte eine offene, also ergänzungsfähige und auch -bedürftige Liste darstellen, ist vielleicht im Prozess ihrer Diskussion nicht immer genügend beachtet worden. Dasselbe gilt für den Ort ihrer Veröffentlichung (Praxis Deutsch) und damit für ihren Zweck: Lehrer/-innen Orientierung zu bieten in der seinerzeit gerade angelaufenen Debatte über die Modellierbarkeit und Überprüfbarkeit literarischer Kompetenz(en). So versteht sich der Verzicht darauf, einen literaturdidaktischen Diskurs grundsätzlicher (d.h. mit Blick auf ungeklärte kontroverse Fragen des literarischen Lernens) zu führen. Dies soll hier geschehen; der Beitrag will Spinners Konzept literarischen Lernens erstens ergänzen und präzisieren, zweitens anthropologisch reflektieren und drittens in einen größeren Zusammenhang einordnen, in dem es um den Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule im Ganzen geht. 0 Einleitung Mit dem von Kaspar H. Spinner vor allem in seinem Praxis-Deutsch-Artikel von 2006 in Anspruch genommenen Begriff Literarisches Lernen hat die Literaturdidaktik der vergangenen zwanzig Jahre einen neuen Diskurs über Literatur im Unterricht eröffnet (vgl. zuletzt z. B. Bräuer 2014), der deutlicher als derjenige über literarische Bildung alle Zielgruppen des Deutschunterrichts einbezieht auch die Primarstufe (vgl. Kruse 2013, Becker 2014) und die Förderschule (vgl. Wiprächtiger-Geppert 2009). Zugleich ist er besser als der vorherrschende Kompetenzdiskurs in der Literaturdidaktik (vgl. Schilcher/Pissarek 2013 sowie kritischer Kepser 2012) anschließbar an aktuelle Überlegungen zur kulturwissenschaftlichen Grundierung unseres Faches (vgl. Kepser 2013). Kepser schlägt vor, die Fachdidaktik Deutsch mit all ihren Teildisziplinen als eingreifende Kulturwissenschaft zu denken (ebd., 54) und nicht nur die Schule als Feld zu verstehen, in dem Lehren und Lernen als kulturelle Praxen untersucht und verändert werden können, sondern auch den Kulturraum einzubeziehen, der als Lebensraum der Kinder und Jugendlichen und späteren Erwachsenen diese sozial und medial präge. Der Methodenpluralismus, der die Deutschdidaktik kennzeichne, legitimiere sich von daher, weil sich Kulturräume nicht mit einer einzelnen Methode erschließen lassen (ebd., 60). Die Besinnung auf kulturelle Kontexte literarischer Werke, wie Klaus-Michael Bogdal (2001, 3) sie im Sinn einer solchen kulturwissenschaftlichen Wende für den Deutschunterricht gefordert hat, greift also, wenn es um literarisches Lernen geht, noch zu kurz. Der Be-
2 griff des literarischen Lernens, in der fachdidaktischen Literatur mit zunehmender Häufigkeit gebraucht (vgl. besonders einflussreich Rosebrock/Nix 2014, 142), schließt zwar auch die Anbahnung literarästhetischer Bildung ein, ist aber im Kern ein Sammelbegriff für alle Beiträge literarischen Lesens und Textverstehens zur Persönlichkeitsbildung, für die Katalysatorfunktion von Literatur im Rahmen der Selbstverständigung von Gemeinschaften über ihre Interessen, Erfahrungen und Werte und schließlich für die kulturstiftende und -bewahrende Funktion literarischer Kommunikation in allen Medien, derer sie sich bedient. Diesen Eindruck gewinnt, wer die erwähnte und weitere Fachliteratur zu diesem Begriff sichtet: Es geht nicht nur um Lernen auf einer personalen Ebene, sondern auch um soziale und kulturelle Formen des Lernens über, an und durch Literatur. Wie verhalten sich diese aber zu einer kulturwissenschaftlich denkenden Lese- und Literaturdidaktik? Spinners elf Aspekte können als Ausgangspunkt für weitere Überlegungen dazu dienen, ohne indessen eine vollständige Beschreibung der Problemlage darzustellen. Dass es sich dabei um eine offene, also ergänzungsfähige und auch -bedürftige Liste handelt, ist vielleicht im Prozess ihrer Diskussion nicht immer genügend beachtet worden. Dasselbe gilt für den Ort ihrer Veröffentlichung (Praxis Deutsch) und damit für ihren Zweck: Lehrer/-innen Orientierung zu bieten in der seinerzeit (2006) gerade angelaufenen Debatte über die Modellierbarkeit und Überprüfbarkeit literarischer Kompetenz(en). So verstehen sich Spinners Bemerkungen über Lesetests und seine Betonung auch des impliziten literarischen Lernens, das den Schüler/innen weder durchgängig bewusst noch für Testverfahren zugänglich sei (vgl. Spinner 2006, 16). So versteht sich aber auch sein Verzicht darauf, an dieser Stelle einen literaturdidaktischen Diskurs grundsätzlicher (d.h. mit Blick auf ungeklärte, möglicherweise kontroverse Fragen des literarischen Lernens) zu führen. Um dies hier tun zu können, geht der vorliegende Beitrag von drei Beobachtungen zu den elf Aspekten aus: 1 Ein kulturwissenschaftlich reflektiertes Verständnis literarischer Kommunikation innerund außerhalb der Schule muss Antworten auf die Frage entwickeln, welche Funktionen literarisches Lesen erfüllt und was Literatur überhaupt für Menschen, und zwar auch in großen Gemeinschaften (früher Nationen, aktuell besser Gesellschaften, Kulturen und Subkulturen), eigentlich leistet. Hierfür sind eine individuelle, eine soziale und eine kulturelle Ebene zu unterscheiden 1 und sowohl die Rezeptions- als auch die Produktionsperspektive zu bedenken: Wofür werden literarische bzw. poetische Texte von Einzelnen, sozialen Gruppen und ganzen Kulturen (ge-)braucht, und warum werden sie überhaupt geschrieben? Insofern dies in Spinners Artikel zwar impliziert, aber nicht wirklich diskutiert wird, bleibt die normative Kraft einiger seiner Aspekte literarischen Lernens (z. B. prototypische Vorstellungen von Gattungen und Genres gewinnen ) unhinterfragt. Kulturwissenschaftlich reflektiert werden sollten auch die schärfere Konturierung einer Wertungskompetenz, die Frage nach einer poetischen Produktionskompetenz sowie die Neubewertung der Rolle der Medien beim literarischen Lernen. 2 Die von Spinner aufgeführten und kommentierten, allesamt zentralen Aspekte literarischen Lernens sind in Bezug auf ihr Verhältnis zur kulturellen Praxis Literatur uneinheitlich: Sie changieren zwischen individueller, sozialer und kultureller Bedeutsamkeit von Literatur. Hier kann ein Versuch ansetzen, die jeweils weniger oder gar nicht ausgeleuchteten Bereiche besser zu erfassen (vgl. Tabelle im Anhang). Hierher gehört aber auch die Auseinandersetzung mit den Bedingungen und Zielen literaturgeschichtlichen Unterrichts, der eine spezifische, eigens begründungsbedürftige Form literarischen Lernens intendiert (vgl. hierzu unten auch Ausführungen zu 1.). 3 Die Bezeichnung literarisches Lernen ist insofern unterbestimmt, als sie eigentlich zwei Aspekte enthält: Lernen über Literatur und Lernen an/durch Literatur. Das Letztere verweist auf allgemein- und persönlichkeitsbildende Effekte literarischen Lesens und damit auf Aspekte von Literaturunterricht, die Spinner (2006, 7) ausdrücklich aus seiner Definition literarischen Lernens ausgrenzt: soziales und ethisches Lernen sowie Erwerb von Weltwissen. Über ihren Stellenwert in einem entsprechend erweiterten Verständnis litera- 1 Vgl. zu einem entsprechenden literaturdidaktischen Modell Abraham/Kepser (2009, 13 19). 7
3 rischen Lernens ist nachzudenken, wenn Literaturunterricht nicht als unverbunden bzw. unverbindbar mit anderen schulischen Fächern und deren Zielen erscheinen soll. Insofern will der vorliegende Beitrag Spinners Konzept literarischen Lernens erstens anthropologisch reflektieren und legitimieren, zweitens ergänzen und präzisieren sowie drittens in einen größeren Zusammenhang einordnen, in dem es um den Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule im Ganzen geht. 1 Kulturelle Funktionen literarisches Lesens und Schreibens näher bestimmen Literatur sammelt, verarbeitet und perspektiviert das kollektive Wissen einer Kultur über sich selbst; sie ist so betrachtet zum einen ein Wissensspeicher, zum andern eine Art Vergrößerungsglas für die scheinbaren Kleinigkeiten, aus denen sich der Alltag der Menschen einschließlich ihrer gedanklichen Welt zusammensetzt. Zwischen Homers Odyssee und James Joyces Ulysses hat sich zwar vieles verändert, beginnend mit den Textmedien und immer neuen Werkmedien 2, aber das nicht. Was es bedeutet, ist zwar für die Geschichte der Medienentwicklung beschrieben worden (vgl. Schütz/Wegmann 1996), aber noch nicht befriedigend für die Literaturwissenschaft (vgl. aber Koŝenina 2008, Schlaeger 2008). Auch die Literaturdidaktik hat hier nach wie vor Reflexionsbedarf: In der dreibändigen Zusammenfassung des literaturdidaktischen Wissensbestandes aus der Reihe Deutschunterricht in Theorie und Praxis (Kämper-van den Boogaart/Spinner 2010) sucht man das Stichwort Anthropologie vergeblich. Wolfgang Isers Literarische Anthropologie von 1991 beschreibt zwar die Fähigkeit des Menschen zum literarischen Fantasieren und zur Besetzung eines fiktionalen Übergangs- Raums zwischen Innen- und Außenwelt; Arbeiten Spinners zur Imagination bzw. Vorstellungsbildung im Literaturunterricht nehmen u.a. darauf Bezug. 3 Die Rolle, die Literatur phylogenetisch (in der Menschheitsgeschichte zunächst als orales, später als Schrift-/Bildmedium) und ontogenetisch (für die Entwicklung und Sozialisation eines Menschen) spielt, ist damit aber erst im Ansatz umrissen. Es geht, wie Jürgen Schlaeger (2008, 427) in Auseinandersetzung mit Iser formuliert, um die Fiktionsfähigkeit und Fiktionsbedürftigkeit des Menschen. Durch Vorstellungsbildung das Hier und Jetzt zu überschreiten und die Fantasie nicht nur zur Entwicklung neuer Werkzeuge oder zum Aufspüren von Beute zu nutzen, sondern zu entpragmatisieren, dürfte schon den frühen Menschen ausgezeichnet und seine kulturelle Entwicklung ermöglicht haben. Kunst, und hier besonders Literatur, kann man in diesem größeren Zusammenhang begreifen als eine Anthropologie des Einzelmenschlichen (ebd., 428); sie vermittelt Wissen auf eine besonders gelungene Art (vgl. Greiner/Abraham 2002; Fauser 2011, 65) und erlaubt Einsichten in die Ausstattung des Menschen, wie sie philosophische, soziologische oder psychologische Theorien nicht bieten können (vgl. Schlaeger 2008, 428). Literatur übernimmt diese Aufgabe ganz grundsätzlich und relativ unabhängig von Intentionen ihrer Autoren, Herausgeber oder Verbreiter; nicht nur für pädagogisch motivierte und didaktisch verfasste Zielgruppenliteratur (die beispielsweise der inter- bzw. transkulturellen Erziehung dient) gilt demnach, dass von ihr zu lernen ist, was Menschsein bedeutet. Das in literarischen Texten verarbeitete Wissen ist freilich nicht systematisch durch Forschung (wie das Wissen der Wissenschaften) gewonnen, sondern weitgehend introspektiv. Manche Schriftsteller/innen recherchieren sehr gründlich, alle aber verarbeiten eigene Erfahrung. Diese bezieht sich auf die Außen-, aber eben auch auf die Innenwelt. Man hat deshalb Schriftsteller/-innen als subjektive Anthropologen (Daniels 1989) bezeichnet bzw. als Ethnologen ihrer eigenen Kultur (Abraham/Kepser 2009, 23). Als solche haben sie beispielsweise die beginnende Emanzipation des Bürgertums seit dem 18. Jahrhundert, diejenige der Frau seit dem 19. und die des Kindes seit dem 20. Jahrhundert jeweils seismografisch wahrge- 2 Zu den Medien der Literatur vgl. Binczek/Dembeck/Schäfer (2013). 3 Z. B. durch den Grundsatz Vor aller abstrahierenden Reduktion soll der Text imaginiert werden (Spinner 1993, zitiert nach Spinner 2001, 103). 8
4 nommen, beschrieben und diskurszugänglich gemacht. Darin und nicht in einer Unterhaltungs- oder Lebensverschönerungsfunktion besteht die eigentliche kulturelle Leistung von Literatur, die Wirklichkeit nicht nur darstellt, sondern langfristig auch beeinflusst. So begann beispielsweise die Entdeckung der Tiefenpsychologie lange vor Freud, nämlich in Texten der romantischen und postromantischen Fantastik (vgl. Abraham 2012, 19). Fiktionsfähigkeit und Fiktionsbedürftigkeit des Menschen äußern sich nun aber nicht nur im (literarischen) Lesen, sondern auch in Praxen des Schreibens und Inszenierens sowie in medialen Adaptionen von Literatur: Die Frage nach einer literarischen bzw. poetischen Produktionskompetenz, in der Literaturdidaktik trotz aller Handlungs- und Produktionsorientierung lange randständig, gewinnt gegenwärtig an Interesse (vgl. im Überblick Abraham/Brendel-Perpina 2015) und kann in ein erweitertes Konzept literarischen Lernens eingegliedert werden: Wer eine Erzählung schreibt, ein Gedicht verfasst oder durch Spielen und Schreiben ein Minidrama entwickelt, befolgt nicht nur Konventionen einer Gattung oder eines Genres (obwohl es die natürlich gibt), sondern nutzt Verfahren der Literatur, um Einsichten über sich selbst und/oder die umgebende Gesellschaft zu generieren. Auch eine Neubewertung der Rolle anderer Medien beim literarischen Lernen steht damit an: Wenn kulturelles Wissen sich in einem Medium objektivieren und kristallisieren muss, um kulturell überliefert zu werden (Nünning 2008, 239), so sind Medien nicht eine irgendwie kurzweiligere und leichter konsumierbare Alternative zur Schriftliteratur, sondern die einzige Möglichkeit, wie kulturelles Wissen die Form narrativer und szenischer Fiktion 4 annehmen konnte und kann. Es ist zwar richtig, dass viele v.a. junge Menschen ihre Fiktionsbedürfnisse heute weit mehr aus bewegten Bildern als aus beschriebenen stillen (Maiwald 2013, 163), aber man sollte das nicht als Medienschelte und Plädoyer für das gute alte Buch verstehen, sondern auch eine gleichsam gegenläufige Tendenz mitbedenken: Je länger es narrative Fiktion in den bilddominierten Medien gibt, desto schwerer zu `lesen wird auch sie; so stellen Spielfilme oder adventure games am PC heute bereits beachtliche semiotische und intertextuelle Anforderungen an ihre Rezipienten. 2 Zwischen individueller, sozialer und kultureller Bedeutsamkeit beim literarischen Lernen unterscheiden Wie die Tabelle im Anhang synoptisch zeigt, kann die Unterscheidung der drei Ebenen helfen, einen Überblick über den laufenden Diskurs zum literarischen Lernen zu gewinnen. Insbesondere ist damit sichergestellt, dass die noch wenig ausgeleuchteten Teilbereiche nicht übersehen werden. Individuell bedeutsam werden literarische Texte in mehreren Modi der Rezeption (nach Werner Graf): als leichte Unterhaltung (zur situativen Ablenkung, aus Langeweile, zur Entspannung), als Stoffe eines wunscherfüllenden intimen Lesens (nach dem identifikatorischen Muster der Kinderlektüre), als selbstgewählte Lesestoffe, mit denen ( oft in Opposition zur Schule) selbstkonzeptionelle Leseinteressen verfolgt werden, als Vorlagen für Teilhabe am Gespräch in der Peer Group ( Partizipation ), als Gelegenheiten zu involviertem Lesen und ästhetischem Genuss (Aufmerksamkeit für Form und Gestalt vorausgesetzt) und nicht zuletzt als Erkenntnisquelle ( Lesen im Modus diskursiver Erkenntnis ). Diese basalen Lesemodi, die Graf (2004) auf der Basis von Lektüreautobiografien Erwachsener unterschieden und beschrieben hat, sind zunächst strikt deskriptiv gemeint, d.h. nicht normativ im Sinn des didaktisch oder pädagogisch Wünschenswerten (vgl. dazu unten, 3.): Alle diese Modi gibt es. Literatur als kulturelle Praxis hat offenbar grundsätzlich das Potenzial, derart unterschiedliche Gratifikationen zu bieten, wobei die Machart oder Genre den Modus nicht völlig festle- 4 Für Lyrik, die in der Regel kaum als fiktional zu kennzeichnen ist, wären eigene Überlegungen nötig. 9
5 gen. Auch Sachliteratur kann zur Unterhaltung gelesen und auch sogenannte Trivial- oder Unterhaltungsliteratur zur Erkenntnisquelle werden; es kommt wesentlich darauf an, in welchem Modus die Rezeption erfolgt. Normativ ist demgegenüber gedacht, was vor allem in Bezug auf Kinder und Jugendliche über Bedeutung von Literatur für Ich-Entwicklung und Identitätsbildung geschrieben worden ist. Es muss hier nicht wiederholt werden; es genügt der Hinweis, dass in Kindheit und Adoleszenz alle Eindrücke, denen das Individuum ausgesetzt ist, vergleichsweise stark wirken können: Sozialisation ist ein Lernprozess, aber auch ein Prozess der Prägung im Sinn der Herausbildung von Verhaltensmustern und Handlungsdispositionen. Hierher gehört das unten (unter 3.) noch Auszuführende, vor allem aber die Herausbildung eines lesebezogenen Selbstkonzepts (vgl. Rieckmann 2012) und einer stabilen Lesehaltung. Einige von Spinners elf Aspekten, darüber hinaus aber einige mehr, liegen auf dieser Ebene: Es geht nicht nur darum beim Lesen und Hören Vorstellungen zu entwickeln, subjektive Involviertheit und genaue Wahrnehmung miteinander ins Spiel zu bringen, Perspektiven literarischer Figuren nachzuvollziehen oder den vom literarischen Text angebotenen Weltentwurf imaginativ auszugestalten. Es geht auch um den aktive Beitrag zum Sinnbildungsprozess durch Herstellen innertextlicher Bezüge, um die Entwicklung von Präferenzen für Arten, Stile, Gattungen und Genres der Literatur, um das wachsende Verständnis für metaphorische und symbolische Ausdrucksweise und grundsätzlich um die Bereitschaft, sich auf die Unabschließbarkeit eines jeden Sinnbildungsprozesses einzulassen. Außerdem wird der literarische Text einerseits assimiliert, d.h. mit der eigenen Lebenserfahrung in Beziehung gesetzt, andererseits in seiner Alterität erkannt, indem Vorstellungen von Epochen und Strömungen der Literatur in Vergangenheit und Gegenwart ausgebildet werden. Sozial bedeutsam wird Literatur einschließlich ihrer Medien, insofern sie zum Gegenstand eines Dialogs zwischen Familienmitgliedern, Freunden, Arbeitskollegen, Theater- und Kinobesuchern (usw.) werden kann. Auch Lernende und Lehrende an Schulen und Hochschulen sind an diesem Dialog beteiligt. Um ihn führen zu können, sollte man, wie Spinner sagt, mit dem literarischen Gespräch vertraut werden. Aber über die (schulische) Form solcher Kommunikation hinaus gilt es aus kulturwissenschaftlicher Sicht diese Forderung inhaltlich zu füllen und um manches zu ergänzen, was ebenfalls hierher gehört: sich über textbezogene Vorstellungen sowie über die vom Text angestoßene Selbstreflexion mit anderen austauschen und deren Perspektiven als Angebot zur Erweiterung der eigenen begrenzten Weltsicht verstehen, sich über einen literarische Weltentwurf und die Kohärenz seiner literarischen Darstellung verständigen sowie deren Bezug zur Realität ausloten (ohne dabei Literatur als Wirklichkeitsabbildung misszuverstehen). Weil aber Literatur als Kommunikationsanlass gemeinsame Rezeption nahe legt, ist es hier auch wichtig literarische Texte präsentieren, (akustisch, visuell, szenisch) vortragen und Textpräsentationen beurteilen zu können. Auch Metaphern und Symbole in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens wahrzunehmen und sich darüber zu verständigen, liegt als literaturaffine Fähigkeit auf dieser sozialen Ebene, ebenso andere Sichtweisen auf einen literarischen Text zu diskutieren und als gleichberechtigt zuzulassen sowie bevorzugte Gegenstände und Modi literarischer Rezeption zum Thema in einer Gruppe zu machen. Dazu kann auch gehören, sich zu bestimmten Epochen wie Mittelalter oder Romantik kommunikativ verhalten und Interesse, Ablehnung (usw.) bekunden zu können. Wenn Literatur auf sozialer Ebene thematisiert wird, hat das gelegentlich mit bildungsbürgerlichem Dünkel zu tun (sachlicher gesagt: mit dem Ausspielen sozialen Kapitals nach Bourdieu), immer aber mit dem, was die Kulturanthropologie geteilte Intentionalität nennt (vgl. Tomasello/Carpenter 2007): Das Teilenwollen ist ein uraltes anthropologisches Fundament der Kulturfähigkeit des Menschen 5 und stellt die Brücke dar zwischen der sozialen und der kulturellen Bedeutsamkeit von Literatur. Diese liegt in ihrem Beitrag zu einem komplexen Symbolsystem, mit dessen Hilfe große Gemeinschaften Identität herstellen (vgl. Fauser 2011, 27 ff.). Musik, Tanz, Sport, bildendende Kunst, Architektur und eben Literatur sind 5 An anderer Stelle (Abraham 2013) habe ich in diesem Sinn die kulturelle Praxis Literatur als ein Handlungsfeld des Teilens und Mit-Teilens beschrieben. 10
6 ästhetische Kommunikationsformen, mit deren Hilfe eine Kultur einerseits den Anschluss an die Vergangenheit sucht (Tradition) und andererseits gegenwärtige Bedürfnisse davon abgrenzt (Innovation) sowie Zukunftsperspektiven entwickelt. Als Teil des kulturellen Gedächtnisses einer Großgruppe (vgl. Assmann/Assmann 1994, 120) wird Literatur zu einem Handlungsfeld, in dem immer wieder neu zu bestimmen ist, was erinnert werden soll und in welcher Perspektive es wert ist, bewahrt zu werden. Das Speichergedächtnis, das der Umgang einer Kultur mit ihrer Literatur in Form von Bibliotheken, Archiven und zunehmend elektronischen Textkorpora darstellt (vgl. Assmann 1999, 140 f.), hält Literatur prinzipiell unbegrenzt verfügbar, um Werke, insofern sie für die individuelle und/oder soziale Bedeutsamkeitsebene noch oder wieder wichtig sind, in ein damit nicht identisches Funktionsgedächtnis (ebd., 133) zu übernehmen. Für das Einspielen von Werken der Literatur (einschließlich ihrer Medien) in das Funktionsgedächtnis der jeweils nächsten Generation übernimmt der Deutschunterricht eine Schlüsselrolle. Hier lernen die Schüler/-innen, die Rezeptionsgeschichte älterer Werke zu reflektieren und mit dem eigenen Textverständnis zu vergleichen oder eine literarische Figur als Ausdruck eines Lebensgefühls einer Generation bzw. einer Epoche zu begreifen. Sie lernen narrative und dramaturgische Handlungslogik fiktionaler Texte zu verstehen und überhaupt mit Fiktionalität bewusst umzugehen, daneben auch sprachliche Gestaltung (im kulturellen Kontext) aufmerksam wahrzunehmen und uneigentliche Rede als ästhetischen Weltzugang zu begreifen und zu schätzen. Die eigene Lesebiografie ist als Form kultureller Partizipation zu verstehen, und in diesem Zusammenhang sind divergierende Kritiken und Interpretationen desselben Textes als Beiträge zum Diskurs über Literatur zu würdigen: Auch literarische Wertung ist ein wichtiger, in der Literaturdidaktik heute wieder stark beachteter Aspekt der kulturellen Praxis: 6 Literatur ist nicht einfach da, sondern Ergebnis eines kulturellen Aushandlungsprozesses, und das gilt auch für prototypische Vorstellungen von Gattungen und Genres, die entwickelt und kritisch diskutiert, nicht aber einfach als deklaratives Begriffswissen aufgenommen werden sollen. Und schließlich liegt auch literaturgeschichtlicher Unterricht als eine spezifische Form literarischen Lernens, in der Bewusstsein für historische Alterität entsteht (vgl. z. B. Brüggemann 2009), auf der Ebene kultureller Bedeutsamkeit. 3 Allgemein- und persönlichkeitsbildende Effekte des Literaturunterrichts einbeziehen Dass Literatur, insbesondere solche für Heranwachsende, vielfach beiläufigen Erwerb von Allgemeinbildung oder Weltwissen ermöglicht, ist in der lese- und literaturdidaktischen Diskussion der vergangenen vier Jahrzehnte immer wieder einmal erwähnt, selten aber fokussiert worden (vgl. aber Abraham/Launer 2002). Auch, dass Literatur zum ethischen Lernen beitragen kann, ist eher ein Gemeinplatz als eine gut beschriebene Tatsache. Wenn von der Literatur zu lernen ist, was Menschsein bedeutet (vgl. oben, 1.), so gilt das im Guten wie im Schlechten. Nicht nur die sogenannte didaktische Literatur (Fabel, Parabel) vermittelt moralische Maßstäbe, sondern an Hand vieler literarischer Texte v.a. fiktionaler Art erfahren Leser/-innen, wozu der Mensch besten- und schlechtestenfalls im Stande ist. Es ist deshalb zumindest nicht auszuschließen, dass literarisches Lesen auch ethisch bildet. Theoretisch reflektiert wurde diese vorwissenschaftliche Vermutung im Rahmen der Kompetenzdiskussion indessen bislang kaum. Der Philosoph Oliver R. Scholz (2014) beklagt nicht nur ein entsprechendes Versäumnis der (literaturwissenschaftlichen und -didaktischen) Forschung, Wissenserwerb in Bezug auf fiktionale Texte aufzuklären, sondern er legt ausgehend von einem sehr weiten Wissensbegriff die Skizze einer Theorie beiläufigen Lernens vor: Es geht um Belebung der Erkenntniskräfte (z. B. Nachdenken über Wahrheit ), moralisches, ethisches Lernen und emotionales Lernen (vgl. ebd., ). Obwohl empirische Belege für einen so weitreichenden und gleichsam ganzheitlichen Einfluss literarischer Lektüre auf die Persönlichkeit des Lesers nicht leicht zu erbringen sind, referieren Groeben/Christmann (2014) in 6 Vgl. neuere fachdidaktische Arbeiten zur literarischen Wertung: Dannecker (2012), Zabka (2013), Pisall (2013). 11
7 einem Forschungsbericht zur empirischen Rezeptionspsychologie Hinweise darauf, dass lebenslange Lektüre literarischer Texte mit Empathie-Fähigkeit und sozialer Kompetenz einhergeht (ebd., 350) und sprechen ausdrücklich von einer potenziell persönlichkeitsverändernde[n] Kraft literarischer Lektüren (ebd., 349). Empathie spielt auch in Spinners Aspekten literarischen Lernens eine Rolle allerdings, nach Ansicht von Olsen (2011, 2) eine problematische als eine bestimmte und zwar emotionale Stufe der Perspektivenübernahme, während es seiner Ansicht nach darauf ankäme, zwischen Emotionswahrnehmung und Emotionseinnahme zu unterscheiden und damit sowohl eine affektive als auch eine kognitive Komponente von Empathie zu erfassen (vgl. ebd., 10 f.). Ohne Olsens schwierige Einteilung von Niveaustufen einer Empathiefähigkeit (vgl. ebd., 11 f.) hier diskutieren zu können, will ich doch auf seinen Forschungsbericht zur tragenden, aber unklaren Rolle der Empathie in der Literaturdidaktik verweisen und als wesentlich für einen erweiterten Begriff literarischen Lernens festhalten, dass literarische Figuren und deren Perspektiven und Lebensansichten nicht weniger als diejenigen realer Menschen eine sowohl affektive als auch kognitive Herausforderung darstellen können. Der Unterschied zwischen ihnen und realen Menschen besteht allerdings darin, dass wir uns zu Letzteren verhalten müssen (auch Nichtbeachtung wäre Verhalten), wogegen wir als Leser/- innen literarischer Texte immer die Wahl haben, uns (im Sinn des Involviertseins bei Spinner) mit einer Figur auseinanderzusetzen oder nicht. Literarisches Lernen als Lernen an/durch Literatur findet nur statt, wenn und solange wir als Leser involviert sind und aus dieser Erfahrung heraus zum Erwerb von Weltwissen, zu Fremdverstehen und schließlich auch zu literarästhetischen Urteilen über den Text kommen, der uns dies alles ermöglicht hat (vgl. Steinhauer 2010). Dass die Kunst frei ist, gilt ja nicht nur für deren Urheber, also z. B. Dichter/-innen, sondern auch für deren Rezipienten. Literarisches Lernen in kulturwissenschaftlicher Sicht zu deuten, heißt sich gerade darauf zu besinnen und damit anzuerkennen, dass Literatur auch in der Schule Freiheit der Aneignung verlangt und nicht irgendein Lernstoff ist. Auch das aber hat Kaspar H. Spinner (1988, 35) schon festgestellt. 12
8 Individuation Sozialisation Enkulturation 1. beim Lesen und Hören Vorstellungen entwickeln sich über textbezogene Vorstellungen austauschen die Rezeptionsgeschichte reflektieren und mit dem eigenen Textverständnis vergleichen 2. subjektive Involviertheit und genaue Wahrnehmung miteinander ins Sich über die vom Text angestoßene Selbstreflexion mit anderen austauschen die eigene Lesebiografie als Form kultureller Partizipation verstehen Spiel bringen 3. Präferenzen für Arten und Stile poetischer Rede entwickeln literarische Texte präsentieren (akustisch, visuell, szenisch) vortragen und sprachliche Gestaltung (im kulturellen Kontext) aufmerksam wahrnehmen Textpräsentationen beurteilen 4. Perspektiven literarischer Figuren nachvollziehen Perspektivübernahmen anderer bei der Lektüre als Angebot zur Erweiterung der eigenen begrenzten Weltsicht verstehen eine literarische Figur als Ausdruck eines Lebensgefühls, einer Generation, einer Epoche (usw.) verstehen 5. zum Sinnbildungsprozess durch Herstellen innertextlicher Bezüge aktiv beitragen sich über Textkohärenzen mit anderen Rezipienten verständigen narrative und dramaturgische Handlungslogik verstehen 6. den vom literarischen Text angebotenen Weltentwurf über literarische Weltentwürfe mit anderen sprechen mit Fiktionalität bewusst umgehen verstehen und imaginativ ausgestalten und ihren Bezug zur Realität ausloten, ohne Literatur als Wirklichtsabbildung misszuverstehen 7. metaphorische und symbolische Ausdrucksweise verstehen Metaphern und Symbole in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens wahrnehmen uneigentliche Rede als ästhetischen Weltzugang begreifen und schätzen und sich darüber verständigen 8. sich auf die Unabschließbarkeit des Sinnbildungsprozesses einlassen andere Sichtweisen auf einen literarischen Text diskutieren und als gleichberechtigt zulassen Werten: divergierende Kritiken und Interpretationen desselben Textes als Beiträge zum Diskurs über Literatur verstehen 9. einen literarischen Text mit der eigener Lebenserfahrung in Beziehung setzen mit dem literarischen Gespräch vertraut werden Literatur als Ergebnis eines kulturellen Aushandlungsprozesses verstehen 10. Präferenzen für Gattungen und Genres entwickeln bevorzugte Gegenstände und Modi literarischer Rezeption zum Thema in einer prototypische Vorstellungen von Gattungen und Genres gewinnen Gruppe machen 11. eigene Vorstellungen von Epochen und Strömungen der Literatur in Vergangenheit und Gegenwart bilden sich zu bestimmten Epochen kommunikativ verhalten (Interesse, Ablehnung usw. bekunden) können literarhistorisches Bewusstsein entwickeln Tabelle 1: Aspekte literarischen Lernens nach Spinner (2006, fett): Ergänzte Übersicht 13
9 Literatur Abraham, Ulf / Launer, Christoph (Hg.) (2002): Weltwissen erlesen. Literarisches Lernen im fächerverbindenden Unterricht. Baltmannsweiler: Schneider. Abraham, Ulf / Kepser, Matthis (2009): Literaturdidaktik Deutsch. Eine Einführung. 3., aktualisierte Aufl. Berlin: Erich Schmidt. 1. Auflage 2005 Abraham, Ulf (2012): Fantastik in Literatur und Film. Eine Einführung für Schule und Hochschule. Berlin: Erich Schmidt. Abraham, Ulf (2013): Geteilte Aufmerksamkeit für Literatur? Literarische Kompetenz als Fähigkeit kulturelle Praxis zu teilen. In: Wolfgang Hallet (Hg.): Literatur- und kulturwissenschaftliche Hochschuldidaktik. Konzepte, Methoden, Lehrbeispiele. Trier: WVT. S Abraham, Ulf / Brendel-Perpina, Ina (2015): Literarisches Schreiben im Deutschunterricht. Ein Weiterbildungsmodell in produktionsorientierter Literaturpädagogik. Seelze: Klett/Kallmeyer (im Druck). Assmann, Aleida / Assmann, Jan (1994): Das Gestern im Heute. Medien und soziales Gedächtnis. In: Klaus Merten / Siegfried J. Schmid / Siegfried Weischenberg (Hg.): Die Wirklichkeit der Medien. Eine Einführung in die Kommunikationswissenschaft. Opladen: Westdeutscher Verlag. S Assmann, Aleida (1999): Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. München: C.H. Beck. Becker, Tabea (2014): Sprachliches und literarisches Lernen an Bilderbüchern. In: Ulf Abraham / Juli Knopf (Hg.): BilderBücher. Bd. 1: Theorie. Baltmannsweiler: Schneider. S Binczek, Natalie / Dembeck, Till / Schäfer, Jörgen (Hg.) (2013): Handbuch Medien der Literatur. Berlin: de Gruyter. Bogdal, Klaus-Michael (2001): Kulturwissenschaftliche Wende im Deutschunterricht? In: Der Deutschunterricht 53, H. 3, S Bräuer, Christoph (2014): Literarisches Lernen im Sprechen und Schreiben: Schriftliche Vor- und Nachbereitungen literarischer Gespräche. In: Marcus Steinbrenner / Johannes Mayer / Bernhard Rank / Felix Heizmann (Hg.): Seit ein Gespräch wir sind und hören voneinander. Das Heidelberger Modell des Literarischen Unterrichtsgesprächs in Theorie und Praxis. 2., korrigierte und erweiterte Auflage. Baltmannsweiler: Schneider. S Auflage 2011 Brüggemann, Jörn (2009): Literarisches Lesen Historisches Verstehen. Zur Explikation einer unterbewerteten Komponente literarischer Rezeptionskompetenz. In: Didaktik Deutsch H. 26, S Daniels, Celia A. (1989): The Poet as Anthropologist. In: Philip A. Dennis / Aycock Wendell (Hg.): Literature and Anthropology. Lubbock: Texas Tech University Press. S Dannecker, Wiebke (2012): Literarische Texte reflektieren und bewerten zwischen theoretischer Modellierung und empirischer Rekonstruktion am Beispiel einer empirischen Untersuchung mit Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe II. Trier: WVT. Fauser, Markus (2011): Einführung in die Kulturwissenschaft. 5., durchgesehene Auflage. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 1. Auflage 2003 Frickel, Daniela / Kammler, Clemens / Rupp, Gerhard (Hg.) (2012): Literaturdidaktik im Zeichen von Kompetenzorientierung und Empirie. Perspektiven und Probleme. Freiburg im Breisgau: Fillibach. Graf, Werner (2004): Der Sinn des Lesens. Modi literarischer Rezeptionskompetenz. Münster: LIT. Greiner, Thorsten / Abraham, Ulf (2002): Die Lehre der Literatur oder Was Literaturlehrende von ihrem Gegenstand lernen können. In: Sprache und Literatur 33, H. 1, S Groeben, Norbert / Christmann, Ursula (2014): Empirische Rezeptionspsychologie der Fiktionalität. In: Tobias Klauk / Tilmann Köppe (Hg.): Fiktionalität. Ein interdisziplinäres Handbuch. Berlin: de Gruyter, Iser, Wolfgang (1991): Das Fiktive und das Imaginäre. Perspektiven literarischer Anthropologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Kämper-van den Boogaart, Michael / Spinner, Kaspar H. (Hg.) (2010): Deutschunterricht in Theorie und Praxis. Bd. 11: Lese- und Literaturunterricht. 3 Bde. Baltmannsweiler: Schneider. Kepser, Matthis (2012): Anmerkungen zur Kompetenzorientierung in der Literaturdidaktik. In: Frickel et al. (Hg.). S Kepser, Matthis (2013): Deutschdidaktik als eingreifende Kulturwissenschaft. Ein Positionierungsversuch im wissenschaftlichen Feld. In: Didaktik Deutsch 19, H. 34,
10 Koŝenina, Alexander (2008): Literarische Anthropologie. Die Neuentdeckung des Menschen. Berlin: Akademie- Verlag. Kruse, Iris (2013): Literarisches Lernen in der Primarstufe. Das Lesetagebuch als Lern- und Beobachtungsinstrument zur Förderung von literarischen Kompetenzen. In: Steffen Gailberger / Frauke Wietzke (Hg.): Handbuch kompetenzorientierter Deutschunterricht. Weinheim: Beltz. S Maiwald, Klaus (2013): Film und/als Literatur. Zum Stellenwert des Films im Literaturunterricht. In: Literatur im Unterricht: Texte der Gegenwartsliteratur für die Schule 14 (3), S Nünning, Ansgar (Hg.) (2008): Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Stuttgart: Metzler. Nünning, Ansgar (2008): Gedächtnis, kulturelles. In: derselbe (Hg.). S. 239 f. Olsen, Ralph: Das Phänomen Empathie beim Lesen literarischer Texte. Eine didaktisch-kompetenzorientierte Annäherung. In: zeitschrift ästhetische bildung 3 (2011), Nr. 1. Online unter < (letzter Zugriff am 11. März 2015) Pisall, Verena (2013): Ich konnte mich einfach nicht identifizieren Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II bewerten literarische Texte Eine qualitative Studie. Online unter < (letzter Zugriff am 11. März 2015) Rieckmann, Carola (2012): Chancen eines erweiterten Selbstkonzeptbegriffs für die Lese- und Literaturdidaktik. In: Frickel et al. (Hg.). S Rosebrock, Cornelia / Nix, Daniel (2014): Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung. 7., überarbeitete und erweiterte Auflage. Baltmannsweiler: Schneider. 1. Auflage 2008 Schilcher, Anita / Pissarek, Markus (Hg.) (2013): Auf dem Weg zur literarischen Kompetenz. Ein Modell literarischen Lernens auf semiotischer Grundlage. Baltmannsweiler: Schneider. Schilcher, Anita / Pissarek, Markus (2013): Zum Begriff der Kompetenzorientierung und seiner Anwendung im Bereich des literarischen Lernens. In: dieselben. (Hg.). S Schlaeger, Jürgen (2008): Literarische Anthropologie. In: Nünning (Hg.). S Scholz, Oliver R. (2014): Fiktionen, Wissen und andere kognitive Güter. In: Tobias Klauk / Tilmann Köppe (Hg.): Fiktionalität. Ein interdisziplinäres Handbuch. Berlin: de Gruyter. S Schütz, Erhard / Wegmann, Thomas (1996): Literatur und Medien. In: Heinz Ludwig Arnold / Heinrich Detering (Hg.): Grundzüge des Literaturwissenschaft. München: dtv. S Spinner, Kaspar H. (1988): Der Kern literarischer Bildung. In: Bildung. Die Menschen stärken, die Sachen klären. Friedrich Jahresheft IV, S Spinner, Kaspar H. (2001): Kreativer Deutschunterricht. Identität Imagination Kognition. Seelze: Kallmeyer. Spinner, Kaspar H. (2006): Literarisches Lernen. In: Praxis Deutsch 33, H. 200, S Steinhauer, Lydia (2010): Involviertes Lesen. Eine empirische Studie zum Begriff und seiner Wechselwirkung mit literarästhetischer Urteilskompetenz. Freiburg im Breisgau: Fillibach. Tomasello, Michael / Carpenter, Melissa (2007): Shared intentionality. In: Developmental Science 10, 1, S Wiprächtiger-Geppert, Maja (2009): Literarisches Lernen in der Förderschule. Eine qualitativ-empirische Studie zur literarischen Rezeptionskompetenz von Förderschülerinnen und -schülern in literarischen Unterrichtsgesprächen. Baltmannsweiler: Schneider. Zabka, Thomas (2013): Literarische Texte werten. In: Praxis Deutsch, H. 241, S Prof. Dr. Ulf Abraham Institut für Germanistik Lehrstuhl für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur Otto-Friedrich-Universität Bamberg ulf.abraham@uni-bamberg.de 15
GRUNDLAGEN DER GERMANISTIK. Herausgegeben von Christine Lubkoll, Ulrich Schmitz, Martina Wagner-Egelhaaf und Klaus-Peter Wegera 42
 GRUNDLAGEN DER GERMANISTIK Herausgegeben von Christine Lubkoll, Ulrich Schmitz, Martina Wagner-Egelhaaf und Klaus-Peter Wegera 42 Literaturdidaktik Deutsch Eine Einführung von Matthis Kepser und Ulf Abraham
GRUNDLAGEN DER GERMANISTIK Herausgegeben von Christine Lubkoll, Ulrich Schmitz, Martina Wagner-Egelhaaf und Klaus-Peter Wegera 42 Literaturdidaktik Deutsch Eine Einführung von Matthis Kepser und Ulf Abraham
Universität zu Köln Attraktive Lesestoffe für Jungen (und Mädchen): Sachbücher, ein vernachlässigtes Genre der KJL
 Universität zu Köln Attraktive Lesestoffe für Jungen (und Mädchen): Sachbücher, ein vernachlässigtes Genre der KJL Prof. Dr. Christine Garbe, Uni Köln Workshop auf der Tagung (für) alle? Salzburg Puch,
Universität zu Köln Attraktive Lesestoffe für Jungen (und Mädchen): Sachbücher, ein vernachlässigtes Genre der KJL Prof. Dr. Christine Garbe, Uni Köln Workshop auf der Tagung (für) alle? Salzburg Puch,
ZWISCHEN SELBST-ENTWICKLUNG UND WELT- ERSCHLIEßUNG SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER MIT SCHWERER BEHINDERUNG IM UNTERRICHT
 Dr. Oliver Musenberg Dr. Judith Riegert Humboldt-Universität zu Berlin Institut für Rehabilitationswissenschaften ZWISCHEN SELBST-ENTWICKLUNG UND WELT- ERSCHLIEßUNG SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER MIT SCHWERER
Dr. Oliver Musenberg Dr. Judith Riegert Humboldt-Universität zu Berlin Institut für Rehabilitationswissenschaften ZWISCHEN SELBST-ENTWICKLUNG UND WELT- ERSCHLIEßUNG SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER MIT SCHWERER
Literaturdidaktik Deutsch
 Grundlagen der Germanistik (GrG) 42 Literaturdidaktik Deutsch Eine Einführung Bearbeitet von Prof. Dr. Matthis Kepser, Prof. Dr. Ulf Abraham völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage 2016. Taschenbuch.
Grundlagen der Germanistik (GrG) 42 Literaturdidaktik Deutsch Eine Einführung Bearbeitet von Prof. Dr. Matthis Kepser, Prof. Dr. Ulf Abraham völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage 2016. Taschenbuch.
GRUNDLAGEN DER GERMANISTIK. Herausgegeben von Detlef Kremer, Ulrich Schmitz, Martina Wagner-Egelhaaf und Klaus-Peter Wegera
 GRUNDLAGEN DER GERMANISTIK Herausgegeben von Detlef Kremer, Ulrich Schmitz, Martina Wagner-Egelhaaf und Klaus-Peter Wegera 42 Literaturdidaktik Deutsch Eine Einführung von Ulf Abraham und Matthis Kepser
GRUNDLAGEN DER GERMANISTIK Herausgegeben von Detlef Kremer, Ulrich Schmitz, Martina Wagner-Egelhaaf und Klaus-Peter Wegera 42 Literaturdidaktik Deutsch Eine Einführung von Ulf Abraham und Matthis Kepser
LITERATUR-UNTERRICHT VORTRAG ZUR AUFTAKTVERANSTALTUNG DES IMST-TP
 LITERATUR-UNTERRICHT VORTRAG ZUR AUFTAKTVERANSTALTUNG DES IMST-TP 2 5. S E P T E M B E R 2 0 1 5 E D I T H E R L A C H E R - Z E I T L I N G E R / P H K Ä R N T E N WELCHEN THEMEN/FRAGEN NACHGEGANGEN WERDEN
LITERATUR-UNTERRICHT VORTRAG ZUR AUFTAKTVERANSTALTUNG DES IMST-TP 2 5. S E P T E M B E R 2 0 1 5 E D I T H E R L A C H E R - Z E I T L I N G E R / P H K Ä R N T E N WELCHEN THEMEN/FRAGEN NACHGEGANGEN WERDEN
Die klassischen Kurzgeschichten "Das Brot" von Wolfgang Borchert und "Saisonbeginn" von Elisabeth Langgässer
 Germanistik Christiane Streubel Die klassischen Kurzgeschichten "Das Brot" von Wolfgang Borchert und "Saisonbeginn" von Elisabeth Langgässer Kompetenzorientierter Unterricht,Analyse des Schwierigkeitsgrads
Germanistik Christiane Streubel Die klassischen Kurzgeschichten "Das Brot" von Wolfgang Borchert und "Saisonbeginn" von Elisabeth Langgässer Kompetenzorientierter Unterricht,Analyse des Schwierigkeitsgrads
Narrative Computerspiele als Gegenstände literarischen Lernens
 Narrative Computerspiele als Gegenstände literarischen Lernens Jun.-Prof. Dr. Jan M. Boelmann boelmann@ph-ludwigsburg.de PH Ludwigsburg Zum Einstieg Zunehmend lesen Schüler Texte, die sie nicht ausgewählt
Narrative Computerspiele als Gegenstände literarischen Lernens Jun.-Prof. Dr. Jan M. Boelmann boelmann@ph-ludwigsburg.de PH Ludwigsburg Zum Einstieg Zunehmend lesen Schüler Texte, die sie nicht ausgewählt
Johannes Kirschenmann / Christoph Richter / Kaspar H. Spinner (Hg.) Reden über Kunst
 Johannes Kirschenmann / Christoph Richter / Kaspar H. Spinner (Hg.) Reden über Kunst Fachdidaktisches Forschungssymposium in Literatur, Kunst und Musik kopaed (muenchen) www.kopaed.de Inhalt ---~._---~--~-~
Johannes Kirschenmann / Christoph Richter / Kaspar H. Spinner (Hg.) Reden über Kunst Fachdidaktisches Forschungssymposium in Literatur, Kunst und Musik kopaed (muenchen) www.kopaed.de Inhalt ---~._---~--~-~
Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule
 Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule Kompetenzbereiche: Sach-, Methoden-, Urteils-, Handlungskompetenz Synopse aller Kompetenzerwartungen Sachkompetenz
Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule Kompetenzbereiche: Sach-, Methoden-, Urteils-, Handlungskompetenz Synopse aller Kompetenzerwartungen Sachkompetenz
Die Bösen sind irgendwie immer schwarz. Literarisches und medienästhetisches Lernen mit intermedialen Lektüren
 Die Bösen sind irgendwie immer schwarz. Literarisches und medienästhetisches Lernen mit intermedialen Lektüren Lesen- und Schreibenlernen mit neuen Medien Herbsttagung der DGLS, 25. 27. November 2011 Jun.-Prof.
Die Bösen sind irgendwie immer schwarz. Literarisches und medienästhetisches Lernen mit intermedialen Lektüren Lesen- und Schreibenlernen mit neuen Medien Herbsttagung der DGLS, 25. 27. November 2011 Jun.-Prof.
Medienberatung Niedersachsen. Timo Ihrke Medienpädagogischer Berater im Medienzentrum Hameln-Pyrmont
 Medienberatung Niedersachsen Timo Ihrke Medienpädagogischer Berater im Medienzentrum Hameln-Pyrmont ihrke@nibis.de Medienberatung Niedersachsen Schulen informieren NLQ qualifiziert koordiniert Medienpädagogische
Medienberatung Niedersachsen Timo Ihrke Medienpädagogischer Berater im Medienzentrum Hameln-Pyrmont ihrke@nibis.de Medienberatung Niedersachsen Schulen informieren NLQ qualifiziert koordiniert Medienpädagogische
Professionalität von Lehrkräften aus Sicht der Deutschdidaktik
 Holger Zimmermann Professionalität von Lehrkräften aus Sicht der Deutschdidaktik Vortrag im Rahmen der Tagung Professionalität von Lehrkräften: fachdidaktische Perspektiven Augsburg, 24.1.14 Aspekte von
Holger Zimmermann Professionalität von Lehrkräften aus Sicht der Deutschdidaktik Vortrag im Rahmen der Tagung Professionalität von Lehrkräften: fachdidaktische Perspektiven Augsburg, 24.1.14 Aspekte von
2. Sitzung Literatur: Richter, Karin, Hurrelmann Bettina: Kinderliteratur im Unterricht. Theorie und Modelle zur Kinder- und Jugendliteratur im
 2. Sitzung Literatur: Richter, Karin, Hurrelmann Bettina: Kinderliteratur im Unterricht. Theorie und Modelle zur Kinder- und Jugendliteratur im pädagogisch-didaktischen Kontext. München 1998. Lange, G.:
2. Sitzung Literatur: Richter, Karin, Hurrelmann Bettina: Kinderliteratur im Unterricht. Theorie und Modelle zur Kinder- und Jugendliteratur im pädagogisch-didaktischen Kontext. München 1998. Lange, G.:
1. Zur Didaktik des Lernbereichs Lesen mit Texten und Medien umgehen
 1. Zur Didaktik des Lernbereichs Lesen mit Texten und Medien umgehen 1.1 Verlaufsmodell der literarischen und Lesesozialisation 1.2 Plateaus der literalen und literarischen Entwicklung 1.3 Aufgaben des
1. Zur Didaktik des Lernbereichs Lesen mit Texten und Medien umgehen 1.1 Verlaufsmodell der literarischen und Lesesozialisation 1.2 Plateaus der literalen und literarischen Entwicklung 1.3 Aufgaben des
Leseliste Literaturdidaktik
 Leseliste Literaturdidaktik Die vergleichsweise junge, interdisziplinär orientierte wissenschaftliche Disziplin Literaturdidaktik ist ein unverzichtbarer Bestandteil der fachlichen Qualifizierung zukünftiger
Leseliste Literaturdidaktik Die vergleichsweise junge, interdisziplinär orientierte wissenschaftliche Disziplin Literaturdidaktik ist ein unverzichtbarer Bestandteil der fachlichen Qualifizierung zukünftiger
Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht
 Germanistik Katja Schiemann Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht Studienarbeit Name: Katja Schiemann Studiengang: LA Sonderpädagogik/Germanistik 8. Semester Universität Rostock Institut
Germanistik Katja Schiemann Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht Studienarbeit Name: Katja Schiemann Studiengang: LA Sonderpädagogik/Germanistik 8. Semester Universität Rostock Institut
"Der blonde Eckbert": Die Wiederverzauberung der Welt in der Literatur der Romantik
 Germanistik Jasmin Ludolf "Der blonde Eckbert": Die Wiederverzauberung der Welt in der Literatur der Romantik Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung...2 2. Das Kunstmärchen...3 2.1 Charakteristika
Germanistik Jasmin Ludolf "Der blonde Eckbert": Die Wiederverzauberung der Welt in der Literatur der Romantik Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung...2 2. Das Kunstmärchen...3 2.1 Charakteristika
Literaturdidaktik Deutsch. Eine Einführung CHRISTIAN DAWIDOWKSI
 CHRISTIAN DAWIDOWKSI Deutsch Eine Einführung unter Mitarbeit von Angelika Stolle, Anna R. Hoffmann, Matthias jakubanis und Nadine J. Schmidt FERDINAND SCHÖNINCH Inhalt Seite 5 VORWORT 11 O ZUM GELEIT -
CHRISTIAN DAWIDOWKSI Deutsch Eine Einführung unter Mitarbeit von Angelika Stolle, Anna R. Hoffmann, Matthias jakubanis und Nadine J. Schmidt FERDINAND SCHÖNINCH Inhalt Seite 5 VORWORT 11 O ZUM GELEIT -
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch Teil Literaturdidaktik
 Einführung in die Fachdidaktik Deutsch Teil Literaturdidaktik E I N F Ü H R U N G A R B E I T S B E R E I C H E D E S D E U T S C H U N T E R R I C H T E S U N D B I L D U N G S S T A N D A R D S Tutorium
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch Teil Literaturdidaktik E I N F Ü H R U N G A R B E I T S B E R E I C H E D E S D E U T S C H U N T E R R I C H T E S U N D B I L D U N G S S T A N D A R D S Tutorium
0. Einleitung Kapitel: Forschungsüberblick: Literarische Kompetenz im Spiegel der literaturdidaktischen Diskussion 18
 Inhalt 0. Einleitung 13 1. Kapitel: Forschungsüberblick: Literarische Kompetenz im Spiegel der literaturdidaktischen Diskussion 18 1.1. Ausgewählte Definitionsansätze aus der Literaturdidaktik zur Bestimmung
Inhalt 0. Einleitung 13 1. Kapitel: Forschungsüberblick: Literarische Kompetenz im Spiegel der literaturdidaktischen Diskussion 18 1.1. Ausgewählte Definitionsansätze aus der Literaturdidaktik zur Bestimmung
Das Phasenmodell literarischen Verstehens von G.Waldmann
 Germanistik Britta Wehen Das Phasenmodell literarischen Verstehens von G.Waldmann Überlegungen zur theoretischen Herleitung und Begründung sowie zur Umsetzung am Beispiel des Gedichts Inventur von Günter
Germanistik Britta Wehen Das Phasenmodell literarischen Verstehens von G.Waldmann Überlegungen zur theoretischen Herleitung und Begründung sowie zur Umsetzung am Beispiel des Gedichts Inventur von Günter
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch - Teil Literaturdidaktik G E S P R Ä C H E I M L I T E R A T U R U N T E R R I C H T
 Einführung in die Fachdidaktik Deutsch - Teil Literaturdidaktik G E S P R Ä C H E I M L I T E R A T U R U N T E R R I C H T Unterrichtskonzepte Handlungs- und Produktionsorientierung Textanalyse Hermeneutik
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch - Teil Literaturdidaktik G E S P R Ä C H E I M L I T E R A T U R U N T E R R I C H T Unterrichtskonzepte Handlungs- und Produktionsorientierung Textanalyse Hermeneutik
Module des Studienganges
 Module des Studienganges Deutsch im Bachelor of Education Sonderpädagogik (2016) zur Prüfungsordnung vom 13.10.2016 (Amtl. Mittlg. Nr. 94/2016) Beschlussdatum des Modulhandbuches: 15.06.2016 Redaktionsstand
Module des Studienganges Deutsch im Bachelor of Education Sonderpädagogik (2016) zur Prüfungsordnung vom 13.10.2016 (Amtl. Mittlg. Nr. 94/2016) Beschlussdatum des Modulhandbuches: 15.06.2016 Redaktionsstand
Auf die Haltung kommt es an!
 Auf die Haltung kommt es an! ANREGUNGEN ZUR ENTWICKLUNG EINER PROFESSIONELLEN PÄDAGOGISCHEN HALTUNG IM KINDERGARTEN SONJA SCHMID, BA Ein Beispiel aus dem Berufsalltag https://www.youtube.com/watch?v=m7e
Auf die Haltung kommt es an! ANREGUNGEN ZUR ENTWICKLUNG EINER PROFESSIONELLEN PÄDAGOGISCHEN HALTUNG IM KINDERGARTEN SONJA SCHMID, BA Ein Beispiel aus dem Berufsalltag https://www.youtube.com/watch?v=m7e
Rezeptionsästhetische Literaturdidaktik
 Lothar Bredella/Eva Burwitz-Melzer Rezeptionsästhetische Literaturdidaktik mit Beispielen aus dem Fremdsprachenunterricht Englisch R7 Gunter Narr Verlag Tübingen Inhaltsverzeklhimils Danksagung : XI Einleitung
Lothar Bredella/Eva Burwitz-Melzer Rezeptionsästhetische Literaturdidaktik mit Beispielen aus dem Fremdsprachenunterricht Englisch R7 Gunter Narr Verlag Tübingen Inhaltsverzeklhimils Danksagung : XI Einleitung
GRUNDLAGEN DER GERMANISTIK. Herausgegeben von Christine Lubkoll, Ulrich Schmitz, Martina Wagner-Egelhaaf und Klaus-Peter Wegera 61
 GRUNDLAGEN DER GERMANISTIK Herausgegeben von Christine Lubkoll, Ulrich Schmitz, Martina Wagner-Egelhaaf und Klaus-Peter Wegera 61 Deutschdidaktik Grundschule Eine Einführung von Anja Pompe, Kaspar H. Spinner
GRUNDLAGEN DER GERMANISTIK Herausgegeben von Christine Lubkoll, Ulrich Schmitz, Martina Wagner-Egelhaaf und Klaus-Peter Wegera 61 Deutschdidaktik Grundschule Eine Einführung von Anja Pompe, Kaspar H. Spinner
Leitperspektiven: Wir fordern die Leitperspektive Kulturelle Bildung
 Stellungnahme des Landesverbandes Theater in Schulen Baden-Württemberg e.v. (LVTS B-W) zur Reform der Bildungspläne - Veränderungsvorschläge Leitperspektiven: Wir fordern die Leitperspektive Kulturelle
Stellungnahme des Landesverbandes Theater in Schulen Baden-Württemberg e.v. (LVTS B-W) zur Reform der Bildungspläne - Veränderungsvorschläge Leitperspektiven: Wir fordern die Leitperspektive Kulturelle
GRUNDLAGEN DER GERMANISTIK. Herausgegeben von Christine Lubkoll, Ulrich Schmitz, Martina Wagner-Egelhaaf und Klaus-Peter Wegera 61
 GRUNDLAGEN DER GERMANISTIK Herausgegeben von Christine Lubkoll, Ulrich Schmitz, Martina Wagner-Egelhaaf und Klaus-Peter Wegera 61 Deutschdidaktik Grundschule Eine Einführung von Anja Pompe, Kaspar H. Spinner
GRUNDLAGEN DER GERMANISTIK Herausgegeben von Christine Lubkoll, Ulrich Schmitz, Martina Wagner-Egelhaaf und Klaus-Peter Wegera 61 Deutschdidaktik Grundschule Eine Einführung von Anja Pompe, Kaspar H. Spinner
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch - Teil Literaturdidaktik L E S E K O M P E T E N Z
 Einführung in die Fachdidaktik Deutsch - Teil Literaturdidaktik L E S E K O M P E T E N Z Gespräche im Unterricht Wie kann angemessen über Literatur im Unterricht gesprochen werden? Sie können: Leistungen
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch - Teil Literaturdidaktik L E S E K O M P E T E N Z Gespräche im Unterricht Wie kann angemessen über Literatur im Unterricht gesprochen werden? Sie können: Leistungen
Die Inhaltsangabe im Deutschunterricht der gymnasialen Mittelstufe in Theorie und Unterrichtspraxis
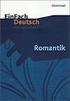 Germanistik Rebecca Mahnkopf Die Inhaltsangabe im Deutschunterricht der gymnasialen Mittelstufe in Theorie und Unterrichtspraxis Formen modernen Aufsatzunterrichts (Sprachdidaktik) Studienarbeit Hauptseminar:
Germanistik Rebecca Mahnkopf Die Inhaltsangabe im Deutschunterricht der gymnasialen Mittelstufe in Theorie und Unterrichtspraxis Formen modernen Aufsatzunterrichts (Sprachdidaktik) Studienarbeit Hauptseminar:
Deutschunterricht Grundwissen Literatur. Lesegenese in Kindheit und Jugend
 Deutschunterricht Grundwissen Literatur Band 2 Lesegenese in Kindheit und Jugend Einführung in die literarische Sozialisation von Werner Graf Schneider Verlag Hohengehren GmbH Inhaltsverzeichnis V Inhaltsverzeichnis
Deutschunterricht Grundwissen Literatur Band 2 Lesegenese in Kindheit und Jugend Einführung in die literarische Sozialisation von Werner Graf Schneider Verlag Hohengehren GmbH Inhaltsverzeichnis V Inhaltsverzeichnis
Gerd Hansen (Autor) Konstruktivistische Didaktik für den Unterricht mit körperlich und motorisch beeinträchtigten Schülern
 Gerd Hansen (Autor) Konstruktivistische Didaktik für den Unterricht mit körperlich und motorisch beeinträchtigten Schülern https://cuvillier.de/de/shop/publications/1841 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin
Gerd Hansen (Autor) Konstruktivistische Didaktik für den Unterricht mit körperlich und motorisch beeinträchtigten Schülern https://cuvillier.de/de/shop/publications/1841 Copyright: Cuvillier Verlag, Inhaberin
Evangelische Religion, Religionspädagogik
 Lehrplaninhalt Vorbemerkung Im Fach Evangelische Religion an der Fachschule für Sozialpädagogik geht es sowohl um 1. eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben, 2. die Reflexion des eigenen religiösen
Lehrplaninhalt Vorbemerkung Im Fach Evangelische Religion an der Fachschule für Sozialpädagogik geht es sowohl um 1. eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben, 2. die Reflexion des eigenen religiösen
F) Germanistik. Folgende Module sind bei Germanistik als 1. Fach zu absolvieren:
 Besonderer Teil der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Erziehungswissenschaft Seite 32 von 112 F) Germanistik Folgende Module sind bei Germanistik als 1. Fach zu absolvieren: Studienprofil Gymnasium/
Besonderer Teil der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Erziehungswissenschaft Seite 32 von 112 F) Germanistik Folgende Module sind bei Germanistik als 1. Fach zu absolvieren: Studienprofil Gymnasium/
ARBEITEN MIT LITERATUR. Warum Literaturarbeit?
 ARBEITEN MIT LITERATUR Warum Literaturarbeit? Wozu arbeiten wir mir Literatur? Die Literaturarbeit ist eine wichtige Komponente im Prozess Ihres wissenschaftlichen Arbeitens und hilft Ihnen von Anfang
ARBEITEN MIT LITERATUR Warum Literaturarbeit? Wozu arbeiten wir mir Literatur? Die Literaturarbeit ist eine wichtige Komponente im Prozess Ihres wissenschaftlichen Arbeitens und hilft Ihnen von Anfang
Schreiben in Unterrichtswerken
 Europäische Hochschulschriften 1014 Schreiben in Unterrichtswerken Eine qualitative Studie über die Modellierung der Textsorte Bericht in ausgewählten Unterrichtswerken sowie den Einsatz im Unterricht
Europäische Hochschulschriften 1014 Schreiben in Unterrichtswerken Eine qualitative Studie über die Modellierung der Textsorte Bericht in ausgewählten Unterrichtswerken sowie den Einsatz im Unterricht
Semester: Kürzel Titel CP SWS Form P/WP Turnus Sem. A Einführung in die Sprachwissenschaft 3 2 VL P WS u. SoSe 1.-2.
 Fachwissenschaftliche Grundlagen Dr. Nicole Bachor-Pfeff BAS-1Deu-FW1 CP: 10 Arbeitsaufwand: 300 Std. 1.-2. sind in der Lage, die Entwicklung der deutschsprachigen Literatur in ihren wesentlichen Zusammenhängen
Fachwissenschaftliche Grundlagen Dr. Nicole Bachor-Pfeff BAS-1Deu-FW1 CP: 10 Arbeitsaufwand: 300 Std. 1.-2. sind in der Lage, die Entwicklung der deutschsprachigen Literatur in ihren wesentlichen Zusammenhängen
Thesen zum Lesen und Einführung des LeseNavigators. Initiative zur Lesekompetenzförderung in der Sekundarstufe I
 Thesen zum Lesen und Einführung des LeseNavigators Initiative zur Lesekompetenzförderung in der Sekundarstufe I Werkstatt-Tage am 5.1. und 11.1.2010 Lesen bedeutet Verstehen Lesekompetenz heißt mehr als
Thesen zum Lesen und Einführung des LeseNavigators Initiative zur Lesekompetenzförderung in der Sekundarstufe I Werkstatt-Tage am 5.1. und 11.1.2010 Lesen bedeutet Verstehen Lesekompetenz heißt mehr als
Übersicht über die Unterrichtsvorhaben in der Qualifikationsphase I und II für das Fach Deutsch
 Übersicht über die Unterrichtsvorhaben in der Qualifikationsphase I und II für das Fach Deutsch Grundkurs Unterrichtsvorhaben I und II: Thema: Unterschiedliche Dramenkonzeptionen erarbeiten anhand von
Übersicht über die Unterrichtsvorhaben in der Qualifikationsphase I und II für das Fach Deutsch Grundkurs Unterrichtsvorhaben I und II: Thema: Unterschiedliche Dramenkonzeptionen erarbeiten anhand von
Schulinterner Lehrplan für das Fach Pädagogik
 Anhang: 2.2 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben Einführungsphase (EF)/ 1. Halbjahr: Inhaltsfeld 1: Bildungs- und Erziehungsprozesse UV Thema Übergeordnete Kompetenzen* Konkretisierte Kompetenzen** I Der
Anhang: 2.2 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben Einführungsphase (EF)/ 1. Halbjahr: Inhaltsfeld 1: Bildungs- und Erziehungsprozesse UV Thema Übergeordnete Kompetenzen* Konkretisierte Kompetenzen** I Der
Gedächtniskonzepte der Kulturwissenschaft
 Gedächtniskonzepte der Kulturwissenschaft Desiree Hebenstreit Universität Wien Erasmus-Intensiv-Programm EIP Die Transformation von 'Mitteleuropa'. Identitätspolitiken und Erinnerungskonstruktionen vor
Gedächtniskonzepte der Kulturwissenschaft Desiree Hebenstreit Universität Wien Erasmus-Intensiv-Programm EIP Die Transformation von 'Mitteleuropa'. Identitätspolitiken und Erinnerungskonstruktionen vor
Konzepte und Methoden. im Umgang mit narrativen Texten
 Konzepte und Methoden im Umgang mit narrativen Texten Narrative Kurzformen narrative Langformen Aufgabe: Diskutieren Sie mit Ihrem Partner oder Ihren Partnern, inwiefern die von Spinner aufgeführten methodischen
Konzepte und Methoden im Umgang mit narrativen Texten Narrative Kurzformen narrative Langformen Aufgabe: Diskutieren Sie mit Ihrem Partner oder Ihren Partnern, inwiefern die von Spinner aufgeführten methodischen
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Ich muss wissen, was ich machen will... - Ethik lernen und lehren in der Schule Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Ich muss wissen, was ich machen will... - Ethik lernen und lehren in der Schule Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Didaktisierung zu Thomas Bernhard: Alte Meister
 SE: Verdichtete Erfahrung. Literatur als Laboratorium des Sprachunterrichts, SoSe 2017 LV-Leitung: Dr. Tobias Heinrich Mathias Henning 09607513, Constanze Guczogi 01201633 Didaktisierung zu Thomas Bernhard:
SE: Verdichtete Erfahrung. Literatur als Laboratorium des Sprachunterrichts, SoSe 2017 LV-Leitung: Dr. Tobias Heinrich Mathias Henning 09607513, Constanze Guczogi 01201633 Didaktisierung zu Thomas Bernhard:
Religionsunterricht wozu?
 Religionsunterricht wozu? Mensch Fragen Leben Gott Beziehungen Gestalten Arbeit Glaube Zukunft Moral Werte Sinn Kirche Ziele Dialog Erfolg Geld Wissen Hoffnung Kritik??? Kompetenz Liebe Verantwortung Wirtschaft
Religionsunterricht wozu? Mensch Fragen Leben Gott Beziehungen Gestalten Arbeit Glaube Zukunft Moral Werte Sinn Kirche Ziele Dialog Erfolg Geld Wissen Hoffnung Kritik??? Kompetenz Liebe Verantwortung Wirtschaft
Das Bildungskonzept der Cusanus Hochschule
 Das Bildungskonzept der Cusanus Hochschule am Beispiel des Masters Ökonomie Münster, 7. September 2015 Ausgangspunkt: Die Vision des Netzwerks von Ökonomie als pluraler Wissenschaft Bildungsanliegen der
Das Bildungskonzept der Cusanus Hochschule am Beispiel des Masters Ökonomie Münster, 7. September 2015 Ausgangspunkt: Die Vision des Netzwerks von Ökonomie als pluraler Wissenschaft Bildungsanliegen der
Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht. Schrey 09/01
 Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht Schrey 09/01 Vier Kriterien eines handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterrichts T H E S E Der Deutschunterricht stellt den Schülerinnen
Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht Schrey 09/01 Vier Kriterien eines handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterrichts T H E S E Der Deutschunterricht stellt den Schülerinnen
Wann ist ein Mann ein Mann? Förderung der Reflexionsfähigkeit von Jungen über nonverbale und emotionale Prozesse in lyrischen Texten
 Germanistik Christoph Heimbucher Wann ist ein Mann ein Mann? Förderung der Reflexionsfähigkeit von Jungen über nonverbale und emotionale Prozesse in lyrischen Texten Studienarbeit Zentrum für schulpraktische
Germanistik Christoph Heimbucher Wann ist ein Mann ein Mann? Förderung der Reflexionsfähigkeit von Jungen über nonverbale und emotionale Prozesse in lyrischen Texten Studienarbeit Zentrum für schulpraktische
Wie kommen wir von den Kompetenzerwartungen und Inhaltsfeldern des KLP zu Unterrichtsvorhaben?
 Wie kommen wir von den Kompetenzerwartungen und Inhaltsfeldern des KLP zu Unterrichtsvorhaben? 1. Entwickeln Sie ausgehend von a. den übergeordneten und konkretisierten Kompetenzerwartungen b. den inhaltlichen
Wie kommen wir von den Kompetenzerwartungen und Inhaltsfeldern des KLP zu Unterrichtsvorhaben? 1. Entwickeln Sie ausgehend von a. den übergeordneten und konkretisierten Kompetenzerwartungen b. den inhaltlichen
Bilderbuchlesarten von Kindern
 Bilderbuchlesarten von Kindern Neue Erzählformen im Spannungsfeld von kindlicher Rezeption und Produktion Bearbeitet von Alexandra Ritter 1. Auflage 2017. Taschenbuch. 304 S. Paperback ISBN 978 3 8340
Bilderbuchlesarten von Kindern Neue Erzählformen im Spannungsfeld von kindlicher Rezeption und Produktion Bearbeitet von Alexandra Ritter 1. Auflage 2017. Taschenbuch. 304 S. Paperback ISBN 978 3 8340
Wissen als Quelle zukünftiger Wettbewerbsvorteile
 Wissen als Quelle zukünftiger Wettbewerbsvorteile Handlungen und Führung an einer zukünftigen Möglichkeit orientieren, aus Mustern der Vergangenheit ausbrechen. Den inneren Ort, d.h. die Struktur der Aufmerksamkeit,
Wissen als Quelle zukünftiger Wettbewerbsvorteile Handlungen und Führung an einer zukünftigen Möglichkeit orientieren, aus Mustern der Vergangenheit ausbrechen. Den inneren Ort, d.h. die Struktur der Aufmerksamkeit,
Fantastik in Literatur und Film
 Grundlagen der Germanistik (GrG) 50 Fantastik in Literatur und Film Eine Einführung für Schule und Hochschule Bearbeitet von Prof. Dr. Ulf Abraham 1. Auflage 2012. Taschenbuch. 256 S. Paperback ISBN 978
Grundlagen der Germanistik (GrG) 50 Fantastik in Literatur und Film Eine Einführung für Schule und Hochschule Bearbeitet von Prof. Dr. Ulf Abraham 1. Auflage 2012. Taschenbuch. 256 S. Paperback ISBN 978
Das Fach Praktische Philosophie wird im Umfang von zwei Unterrichtsstunden in der 8./9. Klasse unterrichtet. 1
 Werrestraße 10 32049 Herford Tel.: 05221-1893690 Fax: 05221-1893694 Schulinternes Curriculum für das Fach Praktische Philosophie in der Sekundarstufe I (G8) (in Anlehnung an den Kernlehrplan Praktische
Werrestraße 10 32049 Herford Tel.: 05221-1893690 Fax: 05221-1893694 Schulinternes Curriculum für das Fach Praktische Philosophie in der Sekundarstufe I (G8) (in Anlehnung an den Kernlehrplan Praktische
Fachseminar_Ev. Religion_Lisa Faber. EKD Texte 109. Kerncurriculum für das Fach Evangelische Religionslehre in der gymnasialen Oberstufe
 Fachseminar_Ev. Religion_Lisa Faber EKD Texte 109 Kerncurriculum für das Fach Evangelische Religionslehre in der gymnasialen Oberstufe Allgemeines Der Unterricht in der Oberstufe vermittelt nach den gegenwärtig
Fachseminar_Ev. Religion_Lisa Faber EKD Texte 109 Kerncurriculum für das Fach Evangelische Religionslehre in der gymnasialen Oberstufe Allgemeines Der Unterricht in der Oberstufe vermittelt nach den gegenwärtig
Erzählungen in Literatur und Medien und ihre Didaktik
 Erzählungen in Literatur und Medien und ihre Didaktik von Martin Leubner, Anja Saupe bearbeitet Erzählungen in Literatur und Medien und ihre Didaktik Leubner / Saupe schnell und portofrei erhältlich bei
Erzählungen in Literatur und Medien und ihre Didaktik von Martin Leubner, Anja Saupe bearbeitet Erzählungen in Literatur und Medien und ihre Didaktik Leubner / Saupe schnell und portofrei erhältlich bei
Einführung in die Erziehungs- und Bildungswissenschaft
 Cathleen Grunert Einführung in die Erziehungs- und Bildungswissenschaft Vorwort zum Modul Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten
Cathleen Grunert Einführung in die Erziehungs- und Bildungswissenschaft Vorwort zum Modul Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten
Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre am Städtischen Gymnasium Gütersloh
 Unterrichtsvorhaben 1 : Thema: Was ist Religion? Inhaltsfelder: IF 1: Der Mensch in christlicher Perspektive Übergeordnete Kompetenzerwartungen: Konkretisierte Kompetenzerwartungen: Inhaltliche Schwerpunkte:
Unterrichtsvorhaben 1 : Thema: Was ist Religion? Inhaltsfelder: IF 1: Der Mensch in christlicher Perspektive Übergeordnete Kompetenzerwartungen: Konkretisierte Kompetenzerwartungen: Inhaltliche Schwerpunkte:
Literaturwissenschaft
 Literaturwissenschaft Theorie & Beispiele Herausgegeben von Herbert Kraft ASCHENDORFF Historisch-kritische Literaturwissenschaft. Von Herbert Kraft 1999, 120 Seiten, Paperback 9,10 d. ISBN 978-3-402-04170-3
Literaturwissenschaft Theorie & Beispiele Herausgegeben von Herbert Kraft ASCHENDORFF Historisch-kritische Literaturwissenschaft. Von Herbert Kraft 1999, 120 Seiten, Paperback 9,10 d. ISBN 978-3-402-04170-3
Kenntnis der technischen Grundlagen für die Nutzung medienkonvergenter Bezüge
 narrationstheoretisch Technischinstrumentell Bedienung von Videorekorder, DVD-Player, Video- und Fotokamera, Computer, Handy, Fernseher und Beamer (evtl. Bedienung von Filmprojektoren) formalästhetisc
narrationstheoretisch Technischinstrumentell Bedienung von Videorekorder, DVD-Player, Video- und Fotokamera, Computer, Handy, Fernseher und Beamer (evtl. Bedienung von Filmprojektoren) formalästhetisc
Staatsexamensthemen DiDaZ - Didaktikfach (Herbst 2013 bis Fru hjahr 2017)
 Staatsexamensthemen DiDaZ - Didaktikfach (Herbst 2013 bis Fru hjahr 2017) Übersicht - Themen der letzten Jahre Themenbereiche Prüfung (H : Herbst, F : Frühjahr) Interkultureller Sprachunterricht / Interkulturelle
Staatsexamensthemen DiDaZ - Didaktikfach (Herbst 2013 bis Fru hjahr 2017) Übersicht - Themen der letzten Jahre Themenbereiche Prüfung (H : Herbst, F : Frühjahr) Interkultureller Sprachunterricht / Interkulturelle
Fachrichtung 4.1 Germanistik
 Fachrichtung 4.1 Germanistik Bereich Fachdidaktik Merkblatt zum fachdidaktischen Prüfungsteil der modularisierten 1. Staatsprüfung im Fach Deutsch (Schwerpunkt: Literaturdidaktik) für Studierende der Lehrämter
Fachrichtung 4.1 Germanistik Bereich Fachdidaktik Merkblatt zum fachdidaktischen Prüfungsteil der modularisierten 1. Staatsprüfung im Fach Deutsch (Schwerpunkt: Literaturdidaktik) für Studierende der Lehrämter
Elf Aspekte auf dem Prüfstand Verbirgt sich in den elf Aspekten literarischen Lernens eine Systematik?
 KASPAR H. SPINNER Elf Aspekte auf dem Prüfstand Verbirgt sich in den elf Aspekten literarischen Lernens eine Systematik? Abstract Der folgende Beitrag geht der Frage nach, wie die elf Aspekte des literarischen
KASPAR H. SPINNER Elf Aspekte auf dem Prüfstand Verbirgt sich in den elf Aspekten literarischen Lernens eine Systematik? Abstract Der folgende Beitrag geht der Frage nach, wie die elf Aspekte des literarischen
Literarisches Lernen in der Grundschule
 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Deutschdidaktik aktuell Hrsg. von Günter Lange Werner Ziesenis Band
2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. Deutschdidaktik aktuell Hrsg. von Günter Lange Werner Ziesenis Band
Analyse der Tagebücher der Anne Frank
 Germanistik Amely Braunger Analyse der Tagebücher der Anne Frank Unter Einbeziehung der Theorie 'Autobiografie als literarischer Akt' von Elisabeth W. Bruss Studienarbeit 2 INHALTSVERZEICHNIS 2 1. EINLEITUNG
Germanistik Amely Braunger Analyse der Tagebücher der Anne Frank Unter Einbeziehung der Theorie 'Autobiografie als literarischer Akt' von Elisabeth W. Bruss Studienarbeit 2 INHALTSVERZEICHNIS 2 1. EINLEITUNG
Kritische Theorie und Pädagogik der Gegenwart
 Kritische Theorie und Pädagogik der Gegenwart Aspekte und Perspektiven der Auseinandersetzung Herausgegeben von F. Hartmut Paffrath Mit Beiträgen von Stefan Blankertz, Bernhard Claußen, Hans-Hermann Groothoff,
Kritische Theorie und Pädagogik der Gegenwart Aspekte und Perspektiven der Auseinandersetzung Herausgegeben von F. Hartmut Paffrath Mit Beiträgen von Stefan Blankertz, Bernhard Claußen, Hans-Hermann Groothoff,
Berufsmatura / Deutsch Seite 1/18. Deutsch BM 1 SLP 2005
 Berufsmatura / Deutsch Seite 1/18 Deutsch BM 1 SLP 2005 Allgemeine Bildungsziele Der Unterricht in der ersten Landessprache fördert bei Lernenden die Fähigkeit, sich als Individuum in der beruflichen und
Berufsmatura / Deutsch Seite 1/18 Deutsch BM 1 SLP 2005 Allgemeine Bildungsziele Der Unterricht in der ersten Landessprache fördert bei Lernenden die Fähigkeit, sich als Individuum in der beruflichen und
Jan Boelmann Ruhr-Universität Bochum Kooperation.Kult 23. November 2011
 Jan Boelmann Ruhr-Universität Bochum Kooperation.Kult 23. November 2011 Printnutzung geht zurück, ohne ganz zu verschwinden These Koexistenz der Medien Dabei Trägerverschiebung ursprünglich printgebundener
Jan Boelmann Ruhr-Universität Bochum Kooperation.Kult 23. November 2011 Printnutzung geht zurück, ohne ganz zu verschwinden These Koexistenz der Medien Dabei Trägerverschiebung ursprünglich printgebundener
Christoph Bräuer Dorothee Wieser (Hrsg.) Lehrende im Blick. Empirische Lehrerforschung in der Deutschdidaktik
 Lehrende im Blick Christoph Bräuer Dorothee Wieser (Hrsg.) Lehrende im Blick Empirische Lehrerforschung in der Deutschdidaktik Herausgeber Christoph Bräuer Universität Göttingen Deutschland Dorothee Wieser
Lehrende im Blick Christoph Bräuer Dorothee Wieser (Hrsg.) Lehrende im Blick Empirische Lehrerforschung in der Deutschdidaktik Herausgeber Christoph Bräuer Universität Göttingen Deutschland Dorothee Wieser
Übersicht Lehrveranstaltungen Dr. Tobias Heinz
 Übersicht Lehrveranstaltungen Dr. Tobias Heinz TECHNISC HE UNIVE RSITÄT BRAUNSCH WEIG WiSe 03/04 SoSe 04 WiSe 04/05 SoSe 05 Literarische Semantik Sprache und Kulturgeschichte. Historische Entwicklungslinien
Übersicht Lehrveranstaltungen Dr. Tobias Heinz TECHNISC HE UNIVE RSITÄT BRAUNSCH WEIG WiSe 03/04 SoSe 04 WiSe 04/05 SoSe 05 Literarische Semantik Sprache und Kulturgeschichte. Historische Entwicklungslinien
Brückenmodule Unterrichtsfach Deutsch
 Brückenmodule Unterrichtsfach 1. Semester 2. Semester Pflichtmodul (): MGerm 1: Grundlagen der Literatur- und Kulturwissenschaft Wahlpflichtmodul (10 oder 10 oder 6 CP 6 CP) MGerm 2: Literatur im historischen
Brückenmodule Unterrichtsfach 1. Semester 2. Semester Pflichtmodul (): MGerm 1: Grundlagen der Literatur- und Kulturwissenschaft Wahlpflichtmodul (10 oder 10 oder 6 CP 6 CP) MGerm 2: Literatur im historischen
Erste Staatsprüfung für ein Lehramt an öffentlichen Schulen. Prüfungsaufgaben Frühjahr 2013
 Fachdidaktik Grundschulen (42317) Fachdidaktik Hauptschulen (42318) Richtig schreiben In einem Schülertext steht: Es war ein Groser feler. Ich hofe das du ihm fergipst. Nehmen Sie eine auf zentrale Prinzipien
Fachdidaktik Grundschulen (42317) Fachdidaktik Hauptschulen (42318) Richtig schreiben In einem Schülertext steht: Es war ein Groser feler. Ich hofe das du ihm fergipst. Nehmen Sie eine auf zentrale Prinzipien
Schulinternes Curriculum Deutsch Sekundarstufe II. (Stand: ) Ansprechpartner: M. Valk
 Schulinternes Curriculum Deutsch Sekundarstufe II (Stand: 16.10.2017) Ansprechpartner: M. Valk 1 Fach: Deutsch Stufe: EF Das Ich in der Welt - Lyrik Aufeinandertreffen verschiedener Lebensideale und Weltbilder
Schulinternes Curriculum Deutsch Sekundarstufe II (Stand: 16.10.2017) Ansprechpartner: M. Valk 1 Fach: Deutsch Stufe: EF Das Ich in der Welt - Lyrik Aufeinandertreffen verschiedener Lebensideale und Weltbilder
Die Schauspielklasse an der HBS Kommt, lasst uns spielen! Daniel Winning
 Die Schauspielklasse an der HBS Kommt, lasst uns spielen! Daniel Winning Grundgedanke n Denn, um es endlich auf einmal n herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch
Die Schauspielklasse an der HBS Kommt, lasst uns spielen! Daniel Winning Grundgedanke n Denn, um es endlich auf einmal n herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch
Sprache als Herausforderung Literatur als Ziel: Sprachsensible Zugänge zur Kinder- und Jugendliteratur
 Interdisziplinäres Symposium der Forschungsstelle Kinder- und Jugendliteratur der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Sprache als Herausforderung Literatur als Ziel: Sprachsensible Zugänge zur Kinder-
Interdisziplinäres Symposium der Forschungsstelle Kinder- und Jugendliteratur der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Sprache als Herausforderung Literatur als Ziel: Sprachsensible Zugänge zur Kinder-
Semester: Kürzel Titel CP SWS Form P/WP Turnus Sem. A Einführung in die Sprachwissenschaft 3 2 VL P WS u. SoSe 1.-2.
 Fachwissenschaftliche Grundlagen Dr. Nicole Bachor-Pfeff BAS-2Deu-FW1 CP: 10 Arbeitsaufwand: 300 Std. 1.-2. sind in der Lage, die Entwicklung der deutschsprachigen Literatur in ihren wesentlichen Zusammenhängen
Fachwissenschaftliche Grundlagen Dr. Nicole Bachor-Pfeff BAS-2Deu-FW1 CP: 10 Arbeitsaufwand: 300 Std. 1.-2. sind in der Lage, die Entwicklung der deutschsprachigen Literatur in ihren wesentlichen Zusammenhängen
Allgemeine Erziehungswissenschaft. Edgar Forster HS 2017
 Allgemeine Erziehungswissenschaft Edgar Forster HS 2017 Das Recht auf eine menschenwürdige Existenz, ist bedingungslos. Dafür zu kämpfen, ist eine Pflicht, die wir nicht abtreten können. Wir tragen Verantwortung
Allgemeine Erziehungswissenschaft Edgar Forster HS 2017 Das Recht auf eine menschenwürdige Existenz, ist bedingungslos. Dafür zu kämpfen, ist eine Pflicht, die wir nicht abtreten können. Wir tragen Verantwortung
Kompetenzorientierung im RU
 Kompetenzorientierung im RU Nicht Paradigmenwechsel, sondern Perspektivewechsel Paradigmenwechsel suggeriert, dass etwas grundsätzlich Neues passiert und das bisher Praktizierte überholt ist. LehrerInnen
Kompetenzorientierung im RU Nicht Paradigmenwechsel, sondern Perspektivewechsel Paradigmenwechsel suggeriert, dass etwas grundsätzlich Neues passiert und das bisher Praktizierte überholt ist. LehrerInnen
Semester: Semester
 Dr. Nicole BachorPfeff Fachwissenschaftliche Grundlagen BAPDeu1 CP: 10 Arbeitsaufwand: 300 Std. 1.2. Semester können mit Theorien der Sprach und Medienwissenschaft Sprache und andere Medien analysieren
Dr. Nicole BachorPfeff Fachwissenschaftliche Grundlagen BAPDeu1 CP: 10 Arbeitsaufwand: 300 Std. 1.2. Semester können mit Theorien der Sprach und Medienwissenschaft Sprache und andere Medien analysieren
Die Hofmeister sozialhistorische Hintergründe und ihre Darstellung in Lenz Drama "Der Hofmeister"
 Germanistik Stefanie Reichhart Die Hofmeister sozialhistorische Hintergründe und ihre Darstellung in Lenz Drama "Der Hofmeister" Studienarbeit Die Hofmeister sozialhistorische Hintergründe und ihre Darstellung
Germanistik Stefanie Reichhart Die Hofmeister sozialhistorische Hintergründe und ihre Darstellung in Lenz Drama "Der Hofmeister" Studienarbeit Die Hofmeister sozialhistorische Hintergründe und ihre Darstellung
Einführung in die Kulturwissenschaften. Einführung. Aufbau der Veranstaltung
 Prof. Dr. H. Schröder Einführung in die Kulturwissenschaften Einführung Aufbau der Veranstaltung Arbeitsweise Literatur und Quellen Kulturwissenschaft an der Viadrina Wissenschaft Verteilung der Themen
Prof. Dr. H. Schröder Einführung in die Kulturwissenschaften Einführung Aufbau der Veranstaltung Arbeitsweise Literatur und Quellen Kulturwissenschaft an der Viadrina Wissenschaft Verteilung der Themen
Interkulturelle Literaturvermittlung
 Karl Esselborn Interkulturelle Literaturvermittlung zwischen didaktischer Theorie und Praxis 3 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese
Karl Esselborn Interkulturelle Literaturvermittlung zwischen didaktischer Theorie und Praxis 3 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese
Masterstudiengang Philosophie Modulbeschreibungen nach den verabschiedeten Fassungen der Studien- und Prüfungsordnung
 Masterstudiengang Philosophie Modulbeschreibungen nach den verabschiedeten Fassungen der Studien- und Prüfungsordnung 1. Modul Theoretische Philosophie 2. Modul Praktische Philosophie 3. Modul Spezielle
Masterstudiengang Philosophie Modulbeschreibungen nach den verabschiedeten Fassungen der Studien- und Prüfungsordnung 1. Modul Theoretische Philosophie 2. Modul Praktische Philosophie 3. Modul Spezielle
Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Jahrgangsstufe EF
 Unterrichtsvorhaben A: Woran glaubst du? religiöse Orientierung in unserer pluralen Gesellschaft Inhaltsfeld 1: Der Mensch in christlicher Perspektive Inhaltliche Schwerpunkte: Religiosität in der pluralen
Unterrichtsvorhaben A: Woran glaubst du? religiöse Orientierung in unserer pluralen Gesellschaft Inhaltsfeld 1: Der Mensch in christlicher Perspektive Inhaltliche Schwerpunkte: Religiosität in der pluralen
kultur- und sozialwissenschaften
 Christiane Hof Kurseinheit 1: Lebenslanges Lernen Modul 3D: Betriebliches Lernen und berufliche Kompetenzentwicklung kultur- und sozialwissenschaften Redaktionelle Überarbeitung und Mitarbeit Renate Schramek
Christiane Hof Kurseinheit 1: Lebenslanges Lernen Modul 3D: Betriebliches Lernen und berufliche Kompetenzentwicklung kultur- und sozialwissenschaften Redaktionelle Überarbeitung und Mitarbeit Renate Schramek
Staatsexamensaufgaben DiDaZ: Didaktikfach
 Staatsexamensaufgaben DiDaZ: Didaktikfach Frühjahr 2014 bis Herbst 2017 Sortiert nach Schwerpunkten Themenübersicht: 1. Interkultureller Sprachunterricht / Interkulturelle Kompetenz 2. Literarische Texte
Staatsexamensaufgaben DiDaZ: Didaktikfach Frühjahr 2014 bis Herbst 2017 Sortiert nach Schwerpunkten Themenübersicht: 1. Interkultureller Sprachunterricht / Interkulturelle Kompetenz 2. Literarische Texte
Modulhandbuch. zu der Prüfungsordnung. Teilstudiengang Deutsch im Studiengang Master of Education Lehramt für Sonderpädagogische Förderung
 Modulhandbuch zu der Prüfungsordnung Teilstudiengang Deutsch im Studiengang Master of Education Lehramt für Sonderpädagogische Förderung Inhaltsverzeichnis Fachliche Kernkompetenz Literatur 3 Fachliche
Modulhandbuch zu der Prüfungsordnung Teilstudiengang Deutsch im Studiengang Master of Education Lehramt für Sonderpädagogische Förderung Inhaltsverzeichnis Fachliche Kernkompetenz Literatur 3 Fachliche
Der pragmatische Blick
 Der pragmatische Blick Was bedeutet das bisher gesagte für die Methoden in der Bildnerischen Erziehung Der Blick geht von der Kunstpädagogik aus. Blick der Kunst(pädagogik) K. erschließt die Welt wahr
Der pragmatische Blick Was bedeutet das bisher gesagte für die Methoden in der Bildnerischen Erziehung Der Blick geht von der Kunstpädagogik aus. Blick der Kunst(pädagogik) K. erschließt die Welt wahr
Modulhandbuch für das Fach Englisch im Masterstudium für das Lehramt an Haupt-, Real- und Gesamtschulen. Studiensemester. Leistungs -punkte 8 LP
 Modulhandbuch für das Fach Englisch im Masterstudium für das Lehramt an Haupt, Real und Gesamtschulen Titel des Moduls Linguistik Kennnummer MEd EHRGeM 1 Workload 240 h 1.1 Vertiefung Ling 1: Sprachstruktur
Modulhandbuch für das Fach Englisch im Masterstudium für das Lehramt an Haupt, Real und Gesamtschulen Titel des Moduls Linguistik Kennnummer MEd EHRGeM 1 Workload 240 h 1.1 Vertiefung Ling 1: Sprachstruktur
Kinder erzählen ihre Geschichten Medienbildung und Sprachförderung am Schulanfang
 Kinder erzählen ihre Geschichten Medienbildung und Sprachförderung am Schulanfang Franz Gerlach Multiplikator für den HEBP Neue Horizonte - Netzwerk Medien- und Kulturarbeit mit Kindern e.v. Das medienkompetente
Kinder erzählen ihre Geschichten Medienbildung und Sprachförderung am Schulanfang Franz Gerlach Multiplikator für den HEBP Neue Horizonte - Netzwerk Medien- und Kulturarbeit mit Kindern e.v. Das medienkompetente
Neuer kompetenzorientierter und semestrierter Lehrplan. Kompetenzorientierung bedeutet eine Verknüpfung von Wissenserwerb und Anwendung von Wissen.
 Neuer kompetenzorientierter und semestrierter Lehrplan Kompetenzorientierung bedeutet eine Verknüpfung von Wissenserwerb und Anwendung von Wissen. Orientierung am Exemplarischenberücksichtigt auch die
Neuer kompetenzorientierter und semestrierter Lehrplan Kompetenzorientierung bedeutet eine Verknüpfung von Wissenserwerb und Anwendung von Wissen. Orientierung am Exemplarischenberücksichtigt auch die
Auswahlkriterien für Gegenwartsliteratur im Deutschunterricht
 Auswahlkriterien für Gegenwartsliteratur im Deutschunterricht von Sabine Pfäfflin überarbeitet Auswahlkriterien für Gegenwartsliteratur im Deutschunterricht Pfäfflin schnell und portofrei erhältlich bei
Auswahlkriterien für Gegenwartsliteratur im Deutschunterricht von Sabine Pfäfflin überarbeitet Auswahlkriterien für Gegenwartsliteratur im Deutschunterricht Pfäfflin schnell und portofrei erhältlich bei
( Picasso ) LuPe Lebenskunst
 ( Picasso ) LuPe Lebenskunst Nutzt die Schule nur 10% der Hirnen der Schüler? Paolo Freire Körper Wissen Körper Inspiration Intuition Imagination Improvisation Impulse Assoziieren Automatische Aktionen
( Picasso ) LuPe Lebenskunst Nutzt die Schule nur 10% der Hirnen der Schüler? Paolo Freire Körper Wissen Körper Inspiration Intuition Imagination Improvisation Impulse Assoziieren Automatische Aktionen
Modularisierte Lehrveranstaltungen im Bachelor-Studiengang Erziehungswissenschaften WS 2005/2006
 TU Braunschweig Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften Modularisierte Lehrveranstaltungen im Bachelor-Studiengang Erziehungswissenschaften WS 2005/2006 Angaben zum Modul: Art und Bezeichnung
TU Braunschweig Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften Modularisierte Lehrveranstaltungen im Bachelor-Studiengang Erziehungswissenschaften WS 2005/2006 Angaben zum Modul: Art und Bezeichnung
Schulinternes Curriculum für das Fach Deutsch in der SI auf der Grundlage des Kernlehrplans G8
 Schulinternes Curriculum für das Fach Deutsch in der SI auf der Grundlage des Kernlehrplans G8 Übersicht über die Unterrichtsinhalte - Erzähltexte (kürzerer Roman, Novelle, Kriminalgeschichten) - lyrische
Schulinternes Curriculum für das Fach Deutsch in der SI auf der Grundlage des Kernlehrplans G8 Übersicht über die Unterrichtsinhalte - Erzähltexte (kürzerer Roman, Novelle, Kriminalgeschichten) - lyrische
Gliederung. 2 Methoden und einige unabdingbare methodologische und wissenschaftstheoretische Voraussetzungen humanontogenetischer
 Gliederung Vorwort Gliederung Einleitung 1 Der Gegenstand der Humanontogenetik und ihre Ziele 1.1 Einführung in die Humanontogenetik 1.2 Der Gegenstand der Humanontogenetik ein Moment des endlosen Streites
Gliederung Vorwort Gliederung Einleitung 1 Der Gegenstand der Humanontogenetik und ihre Ziele 1.1 Einführung in die Humanontogenetik 1.2 Der Gegenstand der Humanontogenetik ein Moment des endlosen Streites
Kompetenzorientierte Lehr- und Lernprozesse initiieren
 Kompetenzorientierte Lehr- und Lernprozesse initiieren Was ändert sich in Ihrem Religionsunterricht mit Einführung des LehrplanPlus?» vieles?» etwas?» nichts? Kompetenz Vermittlungsdidaktik Input wissen
Kompetenzorientierte Lehr- und Lernprozesse initiieren Was ändert sich in Ihrem Religionsunterricht mit Einführung des LehrplanPlus?» vieles?» etwas?» nichts? Kompetenz Vermittlungsdidaktik Input wissen
Faltungen Fiktion, Erzählen, Medien
 Faltungen Fiktion, Erzählen, Medien von Remigius Bunia ERICH SCHMIDT VERLAG Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
Faltungen Fiktion, Erzählen, Medien von Remigius Bunia ERICH SCHMIDT VERLAG Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
Didaktik / Methodik Sozialer Arbeit
 Johannes Schilling Didaktik / Methodik Sozialer Arbeit Grundlagen und Konzepte 7., vollständig überarbeitete Auflage Mit 40 Abbildungen, 5 Tabellen und 177 Lernfragen Mit Online-Material Ernst Reinhardt
Johannes Schilling Didaktik / Methodik Sozialer Arbeit Grundlagen und Konzepte 7., vollständig überarbeitete Auflage Mit 40 Abbildungen, 5 Tabellen und 177 Lernfragen Mit Online-Material Ernst Reinhardt
