Kongressbericht von Hans Joachim Schliep...
|
|
|
- Hartmut Bruhn
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 PROTESTANTISCHE ETHIK UND MODERNER SOZIALSTAAT (4./ BERLIN) KONGRESSBERICHT 1 / 9»PROTESTANTISCHE ETHIK UND MODERNER SOZIALSTAAT - Fernwirkungen der Reformation«Veranstalter: Ev. Akademie zu Berlin, Sozialwissenschaftliches Institut der Ev. Kirche in Deutschland und Stiftung Sozialer Protestantismus, Diakoniewissenschaftliches Insti tut der Theologischen Fakultät der Ruprecht-Karls- Universität Heidelberg Berlin (Franz. Friedrichstadtkirche) 4. und 5. April 2014 Kongressbericht von Hans Joachim Schliep Der Kongress»PROTESTANTISCHE ETHIK UND MODERNER SOZIALSTAAT - Fernwirkungen der Reformation«war eine Station auf dem Weg zum Reformationsjubiläum Dessen Absicht und Ausrichtung legte in ihrer Begrüßung Professorin Dr. Margot Käßmann, Botschafterin des Rates der EKD für das Reformationsjubiläum, in zehn Punkten knapp und einleuchtend dar. Dabei betonte sie die Absicht einer anders als 1817 und 1917 kritischen Aneignung des reformatorischen Erbes, die ökumenische Dimension im Horizont der Weltgesellschaft, die B e- deutung der Reformation für Freiheit und Demokratie sowie der reformatorischen Erkenntnis von der Rechtfertigung allein aus Gnaden in einer Erfolgsgesellschaft. Diese Gedanken vertiefte Prof. Dr. Gerhard Wegner in seiner thematischen Einführung. Im Rückgriff auf Werner Elerts Morphologie des Luthertums und vor allem auf die neueren Arbeiten von Elmar Rieger/Stephan Leibfried 1 stellte er den Kongress hinein in die derzeitige Diskussion um die prägenden Einflüsse religiöser Bewegungen, Einstellungen und Haltungen auf das g e- sellschaftliche und politische Leben. Demnach wirk ten die religiösen Formatierungen als unsichtbare Sozialpolitik, gerade weil sie ökonomischen Interessen vor ausliegen und über sie hinausgehen. So ergebe sich aus der recht verstandenen Reformation die Vision gege nseitiger Verantwortung als Grundnorm eines Rechts der Freiheit (Axel Honneth) und damit zukunftsweisendes Modell für den Sozialstaat. Damit fokussierte er den Blick auf das zentrale Anliegen des Kongresses: die Zukunft des Sozialstaats. Aus Sicht des Berichterstatters 2 begann der Kongress sogleich mit einem Höhepunkt, dem Vortrag des Bremer Politikwissenschaftlers Prof. Dr. Frank Nullmeier: Die Legitimation des Sozialstaates. Für Nullmeier war es keine Frage, dass die Soziale Marktwirtschaft als wirtschaftliche Grundordnung für den (deutschen) Sozial- bzw. Wohlfahrtsstaat ihre Wurzeln nicht nur, aber vor allem auch im Protestantismus hat. Daraus leitete er zunächst drei Fragestellungen ab: 1) Wie lassen sich die in der Sozialen Marktwirtschaft bzw. im Sozialstaat wirksam g e- wordenen Motivhintergründe eines genuin protestantischen Et hikansatzes identifizieren und aktualisieren? 2) Wie sind religiös fundierte sozialethische Aussagen, wenn sie gehört und beachtet werden wollen, in säkularen Diskursen überhaupt möglich? 3) Vorausgesetzt, eine ausschließlich in der Vernunft begründete S ozialethik vermag die Zukunft des Sozialstaats nicht hinreichend zu gewährleisten, aus welchen religiösen Annahmen und Aussagen ergibt sich mit Notwendigkeit dessen Begründung und Gestaltung? In der Diskussion mit den Positionen von Heinrich Bedford-Strohm, der eine Zweisprachigkeit kirchlicher Stellungnahmen im Sinne von sowohl Kenntlichkeit als auch Übersetzbarkeit einer religiös grundierten sozialethischen Orientierung fordert, und Jürgen Habermas, der für eine grundsätzliche Beachtung der in den vernunftethischen Diskursen unabgeltbaren übe r- schießenden Potenziale der Religionen mit ihren spezifischen Äußerungsweisen plädiert, trat Nullmeier für eine gegenseitige Verstehens- und Übersetzungsverpflichtung ein, die Recht und Pflicht zur öffentlichen Artikulation der jeweils eigenen Gründe auch der Kirchen bzw. Religionsgemeinschaften einschließen. Nicht zuletzt weil bestimmte wirkmächtige ökonomische und sozialethische Theorien ebenfalls Partikularlehren darstellen. Allerdings seien die protestantischen Kirchen weiterhin noch auf der Suche nach einer systematischen Sozialethik. Diese habe sich insbesondere der Spannung zwischen einer am personalen Handeln orientierten Tugend- und einer auf Organisationen bezogenen Institutionen-Ethik zu stellen. Zugleich wies Nullmeier darauf hin, dass in der weltweiten Ökumene die Zustimmung zur 1 Elmar Rieger/Stephan Leibfried: Kultur versus Globalisierung. Sozialpolitische Theologie in Konfuzianismus und Christentum, Frankfurt a. M. 2004; Werner Elert: Morphologie des Luthertums, 2. Bd.: Soziallehren und Sozialordnungen des Luthertums, München Siehe dazu Gerhard Wegner: Moralische Ökonomie. Perspektiven lebensweltlich basierter Kooperation, Stuttgart 2014, S Der Berichterstatter ist bemüht, die Vortrags- und Diskussionsinhalte möglichst in eigenen Worten wiederzugeben, und ist sich des subjektiven Charakters seiner Darstellung bewusst.
2 PROTESTANTISCHE ETHIK UND MODERNER SOZIALSTAAT (4./ BERLIN) KONGRESSBERICHT 2 / 9 Sozialen Marktwirtschaft und zum Sozialstaat, wie sie heute für die christlichen Kirchen in Deutschland evident sei, keineswegs überall geteilt werde. Besonders bemerkenswert ist, wie der Politikwissenschaftler Nullmeier fordert, die Theologie in der Sozialethik zu stärken, und wie er selbst den Sozialstaat aus dem Kern der reformatorischen Theologie, der Rechtfertigung allein aus Gnaden, legitimiert wissen will: Wie auch immer»gerechtigkeit«als Grundgedanke und Zielbestimmung von Sozialstaatlichkeit im Detail zu verwirklichen ist, bedeutet sie die ungeschmälerte Achtung und Anerkennung der Person in ihren Lebenschancen und Lebensrechten. Diese Symmetrie setzt aber eine bestimmte Form von Asymmetrie voraus, nämlich sich selbst und alle anderen Menschen vor allem Handeln grundsätzlich, ebenso wenig herstellbar wie verlierbar, angenommen zu wissen. Eben dieses Umsonst bedeutet Glauben im reformatorischen Verständnis. So ergibt sich aus der Partikularität einer bestimmten religiösen Auffassung und Haltung eine Universalität in Fragen sozial-ökonomischer Gestaltung. Mit anderen Worten: Das in der Rech tfertigung allein aus Gnaden mitgegebene Umsonst begründet Reziprozität in Nicht-Reziprozität. In der Gottesbeziehung wird erfahrbar und erkennbar, dass auch in den Gesellschaft sbeziehungen die Gabe dem Tausch prim-ordial vorausgeht. In der lebhaften Diskussion ging es unter anderem um die Unterscheidung von Sozialer Marktwirtschaft, die als sozial-ökonomische Grundordnung eine Gesamtverbesserung der wirtschaftlichen Lage zur Aufgabe hat und damit deutlich über wohlfahrtsstaatliche Armutsbekämpfung hinausgeht, sowie um Fragen der (Rück - )Übersetzbarkeit religiöser Grundannahmen in sozialpolitische Gestaltungsaufgaben, des b e- dingungslosen Grundeinkommens als möglicher sozialethischer Konsequenz aus dem Umsonst, um die Bedeutung der Goldenen Regel (Matthäus 7,12) und die, theologisch gesprochen, paradoxe Situation des Menschen als Gerechter und Sünder zugleich. Frank Nullmeier ging es um eine grundlegende Betrachtungsweise, auch deshalb wollte er für konkrete sozialpolitische Folgerungen und Forderungen ( Grundei nkommen ) hic et nunc nicht in Anspruch genommen werden. Sehr klar benannte er einen Hiatus zwischen der religiösen Fundierung und der sozialethischen Konkretion auch in systematischer Hinsicht. Dem the o- logischen Topos des Sünderseins gewann er den produktiven Sinn ab, dass Sozialpolitik immer unvollkommen bleibe und ständig real-utopisch überschritten werden müsse. Bedauerlicherweise konnte Prof. Dr. Elmar Rieger nicht anwesend sein. Sein nun nicht gehaltener Vortrag Sozialpolitische Theologie wäre vermutlich ein erkenntnisfördernder Hinte r- grund für die Ausführungen von Prof. Dr. Philip Manow, zum Thema Parteien, Sozialstaaten und Religion in Europa gewesen. Ausgehend von der These ihrer religiösen Grundierung wies Manow, die Forschungen von Gøsta Esping-Andersen aufnehmend, in einem Überblick über die europäischen Sozialstaaten auf weitere kennzeichnende und unte rscheidende Faktoren hin: das unterschiedliche Wahl- und Parteiensystem. So habe der Sozialstaat eine andere G e- stalt bei einem Mehrheitswahlrecht mit einem in der Regel Zweiparteiensystem, wobei die häufiger regierenden Konservativen die Staatsleistungsquote durch Umverteilung s- minimierung niedriger halten (residualer W ohlfahrtsstaat) als die seltener regierenden Sozialdemokraten, als bei einem Verhältniswahlrecht mit einem in der Regel Vi elparteiensystem und Regierungskoalitionen. Als signifikantes Beispiel führte Philip Manow das skandinavische Modell des W ohlfahrtsstaates an. Jahrzehntelang habe es eine Koalition aus Sozialdemokratie und Agrarpartei gegeben, wodurch der Sozialstaatsged anke immer auch Teil konservativer politischer Au f- fassungen gewesen und geworden sei. Dagegen sei in Ländern wie Frankreich und Italien das Verhältnis von Arbeiterbewegung und konservativ-agrarisch-religiösen politischen Richtungen nicht selten äußerst kontrovers und konflikthaft gewesen. Die Schweiz und Österreich seien Beispiele für einen politisch dezenten Katholizismus und dieser wiederum ein Beispiel dafür, dass der Sozialstaat seine Wurzeln auch in der römisch-katholischen Soziallehre habe. Es gebe also eine Art gegenreformatorisches Wohlfahrtsstaatsmodell. Die hier nur angedeuteten Überlegungen wurden in der Diskussion durch Fragen nach der Bedeutung der Rechtssysteme und -traditionen (z. B. germanisches oder römisches Recht), namentlich der Verfassungsrechtssprechung angereichert. Prof. Dr. Dr. Karl Gabriel referierte zum Thema Sozialstaat und Konfessionen in Deutschland. In nachvollziehbarer Weise wählte er die historische Darstellungsweise, wodurch allerdings die Zukunftsperspektive zu kurz kam. Er begann sein Referat mit einer Feststellung von Franz- Xaver Kaufmann, Deutschland sei zwar die europäische Nation mit der geringsten staat s- politischen, aber der höchsten sozialpolitischen Kontinuität. Dabei sei die sozio-ökonomische Entwicklung als solche nur ein Bestimmungsfaktor gewesen, denn Deutschland sei unabhängig davon spätestens seit Hegel und Lorenz vom Stein von einer Denktradition geprägt, die den
3 PROTESTANTISCHE ETHIK UND MODERNER SOZIALSTAAT (4./ BERLIN) KONGRESSBERICHT 3 / 9 engen Zusammenhang von Staat und Gesellschaft zu ihrer Leitnorm gemacht habe. Daran habe Bismarck angeknüpft mit seiner Sozialpolitik im Dienste einer staatspolitischen Integration möglichst aller Schichten. So sei für ihn Sozialpolitik zugleich Macht- (sicherungs)politik gewesen, freilich auf dem Hintergrund seiner religiösen Einstellung. Das heißt in der Zeit nach 1890 aber auch: Sozialpolitik wird zur Selbstbehauptungspolitik des Staates. Die Ziele der konfessionsgebundenen Akteure im Aufbau des deutschen Sozialstaates waren freilich andere bzw. gingen sie darüber hinaus. Das werde auf Seiten des Protestantismus deutlich an den Diskussionen und Positionen des Ev.-Soz. Kongresses (ab 1890), dem viele Kathedersozialisten angehört haben, und des Hauptverfassers der Renten -, Krankenversicherungs- und Arbeiterschutzgesetze, des lutherisch-konservativen Theodor Lohmann. Wegen seines Eintretens für Sozialpartnerschaft und Teilhaberechte der Arbei t- nehmer geriet Lohmann mehrfach in Konflikt mit Bismarck, der freilich nicht auf dessen Fac h- kompetenz verzichten konnte. 3 Karl Gabriel unterließ es nicht, den Anteil des Katholizismus an der Entwicklung zum Sozialstaat darzustellen. Immerhin war im Jahr 1881 das kath. Zentrum die stärkste Partei im Reichstag. Die röm.-kath. Position sei anti-etatistisch, anti-sozialistisch und anti-individualistisch gewesen und insofern ein eigenes korporatistisches Modell. Im Blick auf die Weimarer Republik betonte der Referent, dass nach 1918 die ehemaligen Reich s- feinde (Sozialdemokraten und Katholiken) mehrfach in Regierung skoalitionen die politische Verantwortung innegehabt haben. In der Tat, seit der katholische Zentrumspolitiker Heinrich Brauns von 1920 bis 1928 das Ministerium für Arbeit geleitet hat, war dieses bis heute überwiegend in Händen von Katholiken. So sei zumal nach 1945 die Sozialpolitik mehr von der röm.-kath. Soziallehre, die Wirtschaftspolitik stärker von der protestantischen Sozia lethik geprägt gewesen. Das habe nicht zuletzt seinen Grund im Ordoliberalismus nach Walter Eucken, dem auch durch den Freiburger Bonhoeffer-Kreis (1942/43) einflussreich gewordenen Konzept, demzufolge Sozialpolitik als Teil von W irtschaftspolitik gesehen werden könne und eine gute W irtschaft s- politik immer auch gute Sozialpolitik sei. Schlussendlich sei das Modell Soziale Marktwir t- schaft, so Karl Gabriel, als konfessioneller Kompromiss zu betrachten. An dieser These wurden in der Diskussion und werden vom Berichterstatter Zweifel a n- gemeldet, weil die Initialzündung doch von protestantisch orientierten Persönlichkeiten au s- gegangen ist ( Freiburger Bonhoeffer-Kreis ) und der spannungsvolle Ausgleich der Elemente Freiheit und Gemeinschaft noch etwas anderes ist als der Personalismus in der röm.-kath. Soziallehre. Auch hier dürfte sich trotz vieler vorhandener Untersuchungen noch ein weites Forschungsfeld auftun, das ein hoch differenziertes Beziehungsgeflecht zwischen religiösen Motiven, sozio-ökonomischen Faktoren und pragmatisch-politischen Optionen zutage fördern würde. Im Zuge der rechts- und sozialstaatlichen Entwicklung nach 1945 haben sich die großen christlichen Kirchen als intermediäre Institutionen weiter ausgebildet, auch indem sie ein wesentlicher Bestandteil im System freier Wohlfahrtsverbände geworden sind. Karl Gabriel erinnerte an zahlreiche wegweisende Stellungnahmen ( Denkschriften ) zu den sozialen Sicherungssystemen in der modernen Industrie-, Dienstleistungs-, Wissens- und Informationsgesellschaft überwiegend von protestantischer Seite, denen sich Gemeinsame Worte in ökumenischer Kooperation hinzugesellt haben. Die konfessionellen Einflussnahmen auf die Sozial- und Wirtschaftspolitik gehörten, so der Referent, zum Kontinuum der deutschen Geschichte, zur Erinnerung des Staates an seine Verantwortung für das Ganze im Sinne sozialen Ausgleichs und inneren Friedens, und so hätten die ch ristlichen Konfessionen den Sozial- bzw. Wohlfahrtsstaat bis heute wirksam geprägt. In der Diskussion ging es vor allem um die Frage nach Bedeutung und Neubegründung des Subsidiaritätsprinzips und seiner A n- erkennung inzwischen auch auf protestantischer Seite sowie um die neuen Herausforderungen für die Wohlfahrtsverbände durch den Finanzmark tkapitalismus. An diesen Themenkomplex die globale und generelle Ökonomisierung des Lebens schloss sich in gewisser W eise der Beitrag von Prof. Dr. Nils Goldschmidt an: Der deutsche Sozialstaat im Wandel. Leider stellte der historische Zugang eine Verdoppelung dar. Ein unmittel- 3 Aus Sicht des Berichterstatters lässt sich insbesondere an Theodor Lohmann der lutherische Hintergrund und Einfluss auf die deutsche Sozialgesetzgebung aufweisen. Vgl. u. a. Günter Brakelmann: Theodor Lohmann ein protestantischer Sozialpolitiker aus der Inneren Mission, in: ders.: Zwischen Widerstand und Mitverantwortung. Vier Studien zum Protestantismus in sozialen Konflikten, Bochum 1994, S ; Renate Zitt: Zwischen Innerer Mission und staatlicher Sozialpolitik. Der protestantische Sozialreformer Theodor Lohmann ( ). Eine Studie zum sozialen Protestantismus im 19. Jahrhundert, Heidelberg 1997.
4 PROTESTANTISCHE ETHIK UND MODERNER SOZIALSTAAT (4./ BERLIN) KONGRESSBERICHT 4 / 9 barerer Zugriff auf das, was derzeit im deutlichen W andel begriffen oder ihm geradezu unte r- worfen ist, hätte besser verstehen lassen, welche Herausforderung die Ausbreitung und Ausformung des Finanzmarktkapitalismus namentlich in den 1990er Jahren bedeutet, nicht zuletzt für die Zukunft des sozialen Lebens und der Sozialpolitik. Nils Goldschmidt wollte Mut machen, die große Herausforderung anzunehmen und den Wandel mitzugestalten, indem er die Chancen für den modernen Sozialstaat dahin gehend beschrieb, dass eine plurale Gesellschaft auch einen pluralen Sozialstaat benötige und ermögliche. Er vertritt damit einen dynamisierten Ordoliberalismus, den er vom Begriff des Marktes als einer flexibel zu handhabbaren Mark t- ordnung her versteht. Wenn aber, wie Goldschmidt betonte, Markt Marktordnung bedeutet, ist auch der gegenwärtige Wandel in einer normativen Perspektive zu sehen. In Rückbindung (re - ligio) an ein Normativ ist Sozialpolitik Gesellschafts- und diese Ordnungspolitik, die zwar keine guten Menschen braucht, aber an dem Grundsatz festhält: Sozialpoliti k bedeutet, lebensdienlich für die Menschen Politik zu betreiben. In der Diskussion ging es unter andrem um folgende Aspekte: Märkte müssen geordnet werden, sie sind kein Zweck, sondern ein Mittel. Weil wir den Markt brauchen, brauchen wir auch eine Marktethik. Individualethik muss in Ordnungsstrukturen transformiert werden (Institutionenethik). Zurzeit mangelt es an einem gesellschaftspolitischen Gesamtentwurf. Wir brauchen eine Lebensgemeinschaftspolitik, die religiösen und kulturellen Pluralismus als Mö g- lichkeitsform für Sozialpolitik begreift. Hier hätte sich, bei grundsätzlicher Zustimmung, nicht nur der Berichterstatter mehr Konkretion und Problemzuspitzung gewünscht. Einen Einblick in die britischen Verhältnisse bot Prof. Dr. Peter Taylo r-gooby. Sein Thema: Die doppelte Krise des Sozialstaats: Das britische Beispiel. Zwar kann das United Kingdom als zentraler (nicht-föderaler) und starker Staat bezeichnet werden, dieses aber vor allem hi n- sichtlich der Erhaltung freier Märkte, also einer liberalen mark tzentrierten Wirtschaft. Durch relativ niedrige staatliche Transferleistungen wird die Staatsquote gering gehalten. Bei gut ausgebautem Public-Health-System sind Sozialdienste mit steigender Tendenz stark privatisiert. Steuererhöhungen zur Finanzierung von Sozialleistungen sind u npopulär, wobei die tatsächlichen Kosten zum Beispiel für die Arbeitslosenversicherung überschätzt würden. Die doppelte Krise besteht zum einen in der Alterung der Gesellschaft mit steigenden Kosten in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Langzeitpflege und zum anderen in der wirtschaf t- lichen Stagnation seit etwa 2007, von der nur der Bankplatz City of London ausgenommen ist. So würden Gesellschaften immer ungleicher, das Wissen über andere soziale Gruppen nehme ab. Reformer müssten drei Probleme angehen (Trilemma): stigma cost, moral curbs und labourism. Ausgehend von der Kantschen Idee des Respekts vor der Würde jedes einzelnen Menschen müssten solche Reformen entwickelt werden, die auch die Armen als Mitbürger a n- erkennt und alle befähigt, zum gesellschaftlichen Leben beizutragen. Für den Berichterstatter blieb unklar, welche Rolle die Religion aus Sicht Peter Taylor-Goobys in Großbritannien spielt: Eingangs schien er diese für wenig bedeutsam und wirksam zu halten, in der Diskussion gab er einem Teilnehmer recht, der auf die Rolle religiös bestimmter Sozialreformen im Zeitalter der Industrialisierung hinwies (John Wesley; Heilsarmee), und bestätigte sozialkritische Stellungnahmen der anglikanischen und der röm.-kath. Kirche sowie des Rabbinats. Insgesamt hielt er es für möglich, ein neues Solidaritätsbewusstse in auf der Grundlage der Marktwir t- schaft aufzubauen. In der Diskussion zwischen und mit allen Referenten des Nachmittags schälten sich drei Schwerpunkte heraus: Die Frage nach den Sozialstandards, die These, Deutschland sei nicht trotz, sondern wegen seiner Sozialstandards besser als andere Staaten durch die Krise gekommen, und die Notwendigkeit beziehungsweise das Ziel, Menschen zu einem selbstständigen Leben zu ermutigen und zu befähigen. Der Abend des ersten Kongresstages war einem Thema gewidmet, das m orgens bereits Frank Nullmeier intoniert hatte: das Verhältnis von Gabe und Tausch. Um seine Au sführungen wirklich verstehen und in aller Tiefe ausloten zu können, hätte man Marcel Hénaffs Buch Der Preis der Wahrheit vorher gelesen haben müssen. 4 So hatte nicht nur der Berichterstatter einige Mühe, die Aussagen zu erfassen, die Prof. Dr. Hénaff in seinem Vortrag: Die Reformation Paradoxien der Gnade zur Diskussion stellte, zu der es mit Au snahme einer Rückfrage an diesem Abend nicht mehr kam. Auch an dieser Stelle sind nur einige wenige Hinweise im Blick auf seine Conclusion möglich, zumal die Verbindung von ethnologischen, kulturanthropologischen, religionswissenschaftlichen und philosophischen Perspektiven im wissenschaftlichen Diskurs in Deutschland immer noch die Ausnahme ist. 4 Marcel Hénaff: Der Preis der Wahrheit. Gabe, Geld und Philosophie, Frankfurt/M
5 PROTESTANTISCHE ETHIK UND MODERNER SOZIALSTAAT (4./ BERLIN) KONGRESSBERICHT 5 / 9 In komplexen philosophischen (z. B. Sokrates, Aristoteles, Seneca) und soziolo gischökonomischen (z. B. Mauss, Weber, Troeltsch, Simmel) Analysen geht Hénaff der Frage nach, ob und wie diejenigen Werte und Wahrheiten, die keinen Preis haben, für die es also keinen in Geld messbaren Gegenwert gibt, unsere Lebens- und Gesellschaftsbeziehungen prägen, auch unsere Vorstellungen von Gerechtigkeit. Ausgehend sowohl von Aristoteles, demzufolge Wissen und Geld sich nicht mit einem Maß messen lassen, als auch von der Hebräischen Bibel, der jesuanischen Botschaft und der paulinischen Theologie sieht Hénaff in der Reformation die Grundeinsicht radikalisiert, alles Leben sei vor allen Tauschbeziehungen eine durch den Gabe-Charakter des Seins konstituierte Beziehung. Denn die Rede von der Rechtfertigung allein aus Gnaden situiere eine durch nichts und niemanden a ustauschbare, ausgleichbare und überholbare Großzügigkeit Gottes (charis, gratia). Diese finde ihren Raum im Menschlichen in dem von ihr selbst hervorgerufenen Glauben. Einem Glauben, der selbst der Hoffnung auf Erlösung entsage, weil Erlösung immer noch an Schuld als einem Äquivalenzbegriff gebunden sei, die Gnade als Glaubensgrund stehe unübertreffbar über b eziehungsweise jenseits von Schuld. Gottes Großzügigkeit ist eben ohne irgendein Äquivalent. Darum sei die göttliche Gnade auch nicht der Kausalität des Rituals unterworfen. Hénaff hält Rituale und Symbole als Ausdrucksmittel des Menschlichen und Gesellschaf tlichen für völlig legitim, bezweifelt aber, dass aus ihnen wirklich Freiheit konstituiert und konfiguriert werden kann. Denn Rituale bleiben ein Artefakt eines Dogmas, sie entsprechen einer religiös -sozialen Konstruktion. Das wirkliche Symbol für Freiheit und zugleich Beziehung sei Gnade. Mithin ist der Empfang der göttlichen Gnade keineswegs mit kausalem (äquivalentem) Handeln vorz ustellen. Gnade als voraussetzungslose und unbegrenzte Großzügigkeit müsse, so Hénaff, gnädig gedacht werden ( Grace must be envisioned above all as God s infinite generosity: it must be envisioned graciously. ) Gnade sei die Unendlichkeit des Geschenks, das Vorrang hat vor allen Erwartungen beziehungsweise Anwartschaften. ( Grace is the infinity of the gift that precedes all expectations. ) Sie kann nicht erwidert werden. Sie kennt nur eine Entsprechung: die Dankbarkeit ( gratitude ). Eine Dankbarkeit, die weder eine Geste der Wechselseitigkeit ( a gesture of reciprocity ) ist noch in einem Ritual ausgedrückt werden kann, nicht einmal im Lobgesang. Denn unendliche Großzügigkeit kann weder erwidert noch ergänzt werden. Gnade ist unbegründet, bedingungslos, unbedingt, nicht enthalten in dem, dem sie gilt. Diese Dankbarkeit ist eine Antwort, die nur durch eine bedingungslose Großzügigkeit anderen gegenüber möglich wird. Ein Theologe könnte kaum besser sagen, was Rechtfertigung allein aus Gnaden bedeutet und warum im Evangelium die Liebe Gottes als Quelle der Nächstenliebe zugrunde liegt. 5 Der Berichterstatter, der inzwischen Der Preis der Wahrheit gelesen hat, vermisst im Rückblick in Hénaffs Vortrag, was dieser als Paradoxie der Gnade markiert hat: Die Aufhebung von Wechselseitigkeit in der Gottesbeziehung sei gleichsam das Einfallstor für die u ngehemmte kapitalistische Geldwirtschaft gewesen, wo Gerechtigkeit derart transzendent g edacht werde und Wechsel- und Gegenseitigkeit aufgehoben seien, verlören sich auch die Grundregeln und Maßstäbe für das soziale Leben, das ohne Äquivalenzbeziehungen nicht auskomme. Hier muss und kann weitergedacht werden! Hier geht es um eine Tiefendimension in Grundlegung und Gestaltung des modernen Sozialstaats. Der Vormittag des 2. Kongresstages war dem skandinavische n Modell des Sozial- / Wohlfahrtsstaats gewidmet. Aus dem detailliert historischen Vortrag Die kulturelle Konstruktion des Nordens von Prof. Dr. Bo Sträth erscheinen folgende Aussagen bemerkenswert: 1) Wo in Deutschland der Begriff des Volkes utopische Züge hat, bezeichnet folk im Schwedischen die empirische Perspektive aller sozialen Klassen. 2) Die Folkehjem -Bewegung ist, durchsetzt mit pietistischer Grundierung, eine Bewegung der Selbstbildung als Mixtur aus theoretischer und praktischer Bildung im Sinne der Aufklärung (vgl. N. F. S. Grundtvig in Dänemark) in der ganzen Gesellschaft jenseits scharfer Klassengegensätze gewesen, wobei eine Trennungslinie vor allem zwischen Groß- und Kleinbauern lag. 3) Durch die Verbindung von Arbeiterbewegung und Bauernschaft wurden Konflikte nicht polarisiert, sondern integr iert, dadurch entstand eine grundsätzliche Kompromissbereitschaft anstelle öffentliche Konfrontation. 4) Auf staatskirchlicher Seite haben gerade konservative Mitglieder eine Bewegung der Jungen Kirche mit liberaler Kulturalität und sozialen Reformzielen gebildet; 5 Unverkennbar sind auch die Anklänge an die Philosophie vom Anderen her bei Emmanuel Lévinas, die zwar nicht von Gnade ausgeht, aber Freiheit, Gerechtigkeit, Verantwortung radikal relati onal denkt: Das Ich wird in prim-ordialer Rezeptivität ( passiver als passiv ) konstituiert vom Antlitz des Anderen her, das mich unbedingt angeht und ve rpflichtet.
6 PROTESTANTISCHE ETHIK UND MODERNER SOZIALSTAAT (4./ BERLIN) KONGRESSBERICHT 6 / 9 Nathan Söderblom wollte die lutherische Staatskirche als Volkskirche ( Schwedens Volk ist Gottes Volk. ) 5) Die Sozialdemokraten waren nicht anti-kirchlich, wollten die Kirche aber unter staatlicher Aufsicht halten. 6) Aufgrund des staatskirchlichen Systems seit dem 16. Jh. war nicht die Kirche, sondern der Staat Hauptakteur im sozialen Handeln und der Wohlfahrt spflege. 7) Bis zum Ende der lutherischen Staatskirche, vorbereitet ab Mitte der 1990er Jahre, gab es zur christlichen Religion keine echte Alternative, der Katholizismus hat im lutherischen Skandinavien nie eine Rolle gespielt. In der Diskussion wurde auf Unterschiede zwischen den skandinavischen Ländern eingegangen, die aber in der Auße nbetrachtung aufgrund langer staatlicher Zusammengehörigkeit von nicht besonders großem Gewicht zu sein scheinen. Aufgrund der historischen Entwicklung vermutet der Berich terstatter, dass in Skandinavien Traditionen und Legitimationsmuster aus der Zeit weit vor der Christianisierung und der Reformation eine Rolle spielen. Solche langen Entwicklungslinien geben auch spezifisch christlichen Begründungsstrukturen ihre charakteristischen Ausprägungen. An den Beitrag von Bo Sträth schloß sich das Referat von Prof. Dr. Henrik Stenius an: Der lutherische Einfluss auf den nordischen Sozialstaat. Ausgehend von der Feststellung, die protestantische Ethik habe Einfluss auf die Organisation (nicht nur) der skandinavischen G e- sellschaft, lautete seine Kernfrage: Was bedeutet es, eine Normengesel lschaft zu sein? Aus Stenius Ausführungen seien einige Punkte markiert: 1) Für Skandinavien gilt, dass die Kirche als Institution stets der Organisation des Staates inkorporiert und damit subordiniert war (Kirche und Staat als Ganzheit). 2) Ebenso wichtig sind die Rechtstraditionen: In Skandinavien war das Römische Recht nie stark. Die südliche Grenze Dänemarks war die nördliche Grenze für das Römische Recht, das erst ab 1479 an der Kopenhagener Universität unterrichtet wurde und erst Ende des 19. Jahrhunderts verpflichtendes Prüfungsfach war; wichtiger blieb die lokale Rechtstradition. 3) Ein entscheidender Faktor war im 18. Jh. eine reformorientierte Verbindung von Pietismus und Aufklärung, die Sittlichkeit und Bildung miteinander verband, wozu die Grun dlagen schon in der Reform des Glaubens und der Bildung in der Reformation szeit gelegt waren. 4) In einer Ein-Normen-Gesellschaft, die auf großer religiöser Homogenität aufbaut und wenig religiöse Differenzierung kennt, kann es zu einer fruchtbaren und respektvollen Arbeitsteilung zwischen verschiedenen Akteuren kommen (Staat, intermediäre Institutionen, Einzelpersonen, NGOs). Der Berichterstatter hat nicht den Eindruck, dass der Referent dem lutherischen Einfluss auf den nordischen Sozialstaat wirklich nachgegangen ist. Es fehlten Informationen darüber, auch kamen charakteristische Motive des Luthertums zum Beispiel der Berufsgedanke im skandinavischen Sozialstaat nicht zur Sprache. Prof. Dr. Per Pettersson schilderte unter dem Thema Die Deregulierung des schwedischen Sozialstaats und die Religion Herausforderungen für die Lutherische Mehrheitskirche die neue Lage nach dem Abschied von der Staatskirche zur Jahrtausendwende. Seine Ausführungen waren ein engagiertes Plädoyer für einen Eigenbeitrag der schwedischen Lutherischen Kirche zum Sozialstaat. Nach der Trennung von Staat und Kirche müsse und könne sich die Kirche, die nach wie vor Mehrheitskirche sei, auf ihre eigenen sozialkreativen Kräfte und Möglichkeiten besinnen. Dieses umso mehr, als der Deregulierungsprozess im schwedischen Sozialsystem in allen Sparten seit den 1980er Jahren ständig an Fahrt g e- wonnen habe. Da die allgemeine Erwartung sich nach wie vor auf staatliches soziales Handeln richte, habe im Jahr 2008 die schwedische Regierung Rahmenabkommen mit ma rktorientierten Sozialdiensten und Ehrenamtlichen-Organisationen geschlossen: eine Verbindung zwischen frei-wettbewerblichen Sozialunternehmen und staatlicher sozialpolitischer Verantwortung. Der Referent schien das Marktmodell auch für kirchliche Sozialdi enste geeignet zu halten. Er betonte aber, die Kirche müsse eine selbstständige kritische Rolle spielen, besonders die Ehrenamtlichendienste müssten für Humanität und Solidarität eintreten, eine Vorreiterrolle im Blick auf besondere soziale Probleme wahrnehmen und als service provider auftreten. In Anbetracht von 68 Prozent Zugehörigkeit der Bevölkerung zur Kirche sei davon auszugehen, dass eine Mehrheit von Kirchenmitgliedern in den freien sozialen Diensten tätig seien. Diese gelte es von den Grundgedanken christlicher Humanität her zu stärken und zu fördern. Nicht zuletzt sei, wie Pettersson in der Diskussion betonte, dem Neoliberalismus als neuer Religion entgegenzutreten. Die lebhafte Diskussion kann hier nicht angemessen wiedergegeben
7 PROTESTANTISCHE ETHIK UND MODERNER SOZIALSTAAT (4./ BERLIN) KONGRESSBERICHT 7 / 9 werden. Vermerkt sei die (berechtigte) Kritik, das Operieren mit Mitgliedschaftszahlen unterstelle bloß quantitative, in qualitativer Hinsicht (christliche Motivation) möglicherweise schon lange irreale Verhältnisse. Als Vorteil bei diesem Neuaufbau kirchlicher Sozialdienste könnte sich herausstellen, dass von vornherein auf Marktorientierung gesetzt werden muss, sodass keine schwierigen Anpassungsprozesse wie in der Diakonie in Deutschland mehr no twendig sind. Die Entwicklung wird abzuwarten sein, gegenseitige Konsultat ionen sollten stattfinden. Die vierte und letzte Kongressrunde läutete Prof. em. Dr. Franz-Xaver Kaufmann mit seinem auf grundsätzliche Aussagen angelegten Vortrag Christentum und Sozia lstaat ein. Zunächst leitete er das Sozialstaatsgebot aus der Charta der Menschenrechte ab (1948/1966/1976). Dann beschrieb er das Christentum von seinen Anfängen vor den Konfessionsspaltungen her und erinnerte daran, keine der drei christlichen Konfessionen sei mit der Alten Kirche identisch. Die lateinische Kirche (Katholizismus, Reformationskirchen) sei nur der westliche Rest der Alten Kirche, die in ihrer Ausdehnung bis nach Samarkand bis ins 6. Jh. hinein stark monophysitisch geprägt gewesen sei. Das Luthertum habe versucht, sich wieder der Wurzeln in der Alten Kirche zu erinnern und von daher die Kirche zu erneuern. Dass die religiöse Entwicklung die Grundlage aller Kultur sei, werde am Umgang mit der Armut in der Hebräischen Bibel und im Neuen Testament deutlich, nach dem die Armen und Bedürftigen nicht nur Adressaten der Hilfe, sondern ihnen die allen Menschen ausnahmslos geltende Wertschätzung zukomme (Universalismus). Aus den Ursprüngen des Universalismus in den egalitären Tendenzen in der Bibel, der prophetischen Gerechtigkeitsforderung, verbunden mit dem Gedanken der Gottebenbildlichkeit entwickelte Kaufmann historisch und inhaltlich die Gleichheits-Dimension. Die Idee fundamentaler Gleichheit sei die Voraussetzung der Diskussion über Ungleichheit; es gebe sie so nur im Okzident. Aus ihr erwachse auch die staatliche Verantwortung für die Wohlfahrt aller (Bismarck: Wenn keiner helfen kann, der Staat kann helfen. ). Diese, so Kaufmann in der Diskussion, müsse den Sozialraum Europa überschreiten und die ganze Menschheit im Blick haben. Diese Verantwortung müsse aber nicht zwangsläufig vom Staat selbst, sondern könne im staatlichen Rahmen gemäß dem Subsidiaritätsprinzip von kirchlicher Diakonie und Caritas wahrgenommen werden. Das setze eine sittliche Staatsverfassung voraus. In der Diskussion blieb eher offen, ob zur Aufgabe des Sozialstaats auch gehöre, die Ursachen der Armut zu bekämpfen. Volle Übereinstimmung bestand hinsichtlich des kurzen Diktums von Franz -Xaver Kaufmann: Ohne Rechtsstaat kein Sozialstaat. Für die feministische Perspektive sorgte Professorin Dr. Ann Shola Orloff: Gender und die Transformation des Sozialstaats. Sie brachte die spezifisch US-amerikanische Situation ein, von der hier aber nur soviel wiedergegeben werden kann, dass Ann Shola Orloff bemängelte, die US-Politik beschäftige sich mehr mit Rassen als mit Frauen. Doch spätestens seit die Industrialisierung Frauenbeschäftigung erforderlich gemacht habe, dafür trat die Referentin vehement ein, sei Sozialpolitik Arbeitsmarktpolitik, die eine (nicht nur) für Frauen lebbare Work-Life-Balance und Care-Freundlichkeit beinhalten müsse. Kindererziehung und Pflegeau f- gaben müssten in frauenfreundlichen Familienstrukturen einschränkungslose Anerkennu ng erfahren. Das Familienmodell, nach dem der Mann breadwinner und die Frau caregiver sei, lehnte sie ab. Umso mehr hielt sie an der Familie als Grundform sozialen Lebens fest. Dabei plädierte sie für eine Diversität der Lebensgestaltung, die von der Sozialpolitik berücksichtigt werden müsse, einschließlich der Gesundheits- und Ernährungsfragen. Orloff betrachtete auch die Care-Dienste als marktfähig, aber es sei von Glaubenshaltungen her notwendig, für Qualität im Sinne von Humanität zu sorgen. So sei die Gender-Perspektive integraler Bestandteil von Sozial- und Arbeitsmarktpolitik in jeder Detailfrage. In der Tat muss Sozialpolitik jenseits der Gender-Perspektive scheitern, ohne sie wäre das Kongressprogramm unvollständig geblieben. Das gilt allerdings auch für die ökologische Perspektive. Denn ohne ökologisch nachhaltiges und zukunftsfähiges Wirtschaften gibt es auch keine lebensdienliche Sozialpolitik, eine möglichst intakte Umwelt muss als Wohlfahrtsindikator gelten. Den Abschluss des Kongresses bildete das Referat von Dr. Tuomas Martikainen: Religion, Sozialstaat und Neoliberalismus. 6 Aus seinem mehr einen Überblick über einige Forschungsansätze als eine tiefere Analyse gebenden Beitrag seien seine wichtigsten Fragestellungen 6 Mit Neo-Liberalismus müsste korrekterweise der Ordo-Liberalismus der Freiburger Schule bezeichnet werden, der Ausdruck hat sich aber für das Konzept der Chicagoer Schule (Milton Friedman) bzw. die Reag anomics bzw. den Thatcherismus etabliert. Er kann hier nur als Kürzel verwendet werden für das, was T. Martikainen so umschreibt: Neoliberalism can be defined as an ideology that prefers market-based solutions to almost all social phenomena (Redemanuskript, S.1). Es ist hier nicht der Ort genauerer Begriffsbestimmungen, die an sich dringend nötig wären.
8 PROTESTANTISCHE ETHIK UND MODERNER SOZIALSTAAT (4./ BERLIN) KONGRESSBERICHT 8 / 9 herausgegriffen: 1) W ie haben Religionen auf den Neoliberalismus reagiert? 2) Hat der Ne o- liberalismus das Verhältnis zwischen Religionen und Sozial- bzw. Wohlfahrtsstaat verändert? 3) Welche Langzeitfolgen bzw. -folgerungen impliziert ein solcher Wandel? 7 Zu 1: Die Reaktion der Religionen bzw. ihrer Institutionen hat ein doppeltes Gesicht: Kritik und Adaption. Während zum Beispiel die Bischöfe der Luth. Kirche Finnlands 1999 der neoliberalen Wirtschaftspolitik, weil sie Verlierer produziert, eine Abkehr von den moralischen Grundlagen der Gesellschaft attestiert haben, haben eine Vielzahl auch christlicher Kirchen längst der marktförmigen Konsumgesellschaft ihren Segen erteilt. Immer mehr (christliche) religiöse Gemeinschaften erheben die W erte Entscheidungsfreiheit, Wahl, Individualismus und wirtschaf t- lichen Erfolg zu ihrer Signatur und beteiligen sic h am Marketing im Sinne liberaler W ettbewerbsmodelle (z. B. Pfingstler). Am Beispiel der Türkei lässt sich ablesen, dass es einen new capitalist Islam gibt. Zu 2: Bereits in dem Wohlfahrtsstaat-Modell nach Gøsta Esping- Anderson und in den sozialdemokratischen Regimes spielten Religionen mit Ausnahme des politischen römischen Katholizismus keine ausschlaggebende Rolle. Im liberalen System fungieren Religionen als Dienstleister ( service provider ). In korporatistischen Systemen hat zumal die röm.-kath. Kirche die Rolle eines halb-staatlichen Sozialdienstleisters. In allen Regimen bzw. Systemen aber wirken Kirchen und ihre caritativen Dienste als eine Art letzte Auffangstation in Sozialangelegenheiten (im Finanzwesen spricht man von lender of last resort ) Zwar gibt es noch zu wenige validierte Untersuchungen zum Einfluss des Neoliberalismus auf Kirchen und religiöse Gemeinschaften und deren caritatives Wirken, aber beobachtbar ist eine neue Wertschätzung religiöser Sozialdienste. Die allerdings unterlägen in Schlagworten ausgedrückt dem Zwang zu ökonomischer Effizienz, zum Outsourcing, zur Privatisierung, zum Sozialmarketing und -management, zur Diversität und zum Networking. Wie sich dieser Wandel ausgestalte, hänge wiederum davon ab, in welcher unterschied lichen Weise sich die Staaten im Blick auf die Wohlfahrt ihrer Bürger positionierten (z. B. der Bürger als Kunde ). Zu verzeichnen sei einerseits eine neue zivilgesellschaftliche Bedeutung der caritativen Institutionen von Kirchen und Religionsgemeinschaf ten, andererseits ein Erodieren der kirchlichen Finanzbasis, dessen Ursachen freilich nicht nur in der neoliberalen Ökonomie liegen. Zu 3: Wie alle Referenten und die Referentin war auch Martikainen mit Prognosen sehr vorsichtig, wagte aber zumindest einige Andeutungen: Der Wandel werde sich auch in Zukunft in unterschiedlichen kulturellen (religiösen, sozialen, politischen) Ko ntexten vollziehen, insofern sei er schwer generalisierbar. Doch da die neoliberale Wirtschaftsweise viele soziale Probleme mit sich bringe, würden die unmittelbaren caritativen Aufgaben zunehmen ( charity s return ). Infolgedessen müssten sich die Kirchen und religiösen Gemeinschaften b eziehungsweise deren Sozialdienste ein erkennbares Profil geben, das auf bestimmte Marktsegmente ausgerichtet sei. Wer sich klar definiere, finde auch einen Markt. Mit dieser Devise seien die religiös bestimmten caritativen Akteure bereits heute konfrontiert. Der Berichterstatter hat schon im Zusammenhang mit den Referaten auf kritische Punkte hingewiesen. Deshalb beschränkt er sich zum Schluss auf wenige Anmerkungen: Der Kongress war als Zwischenbilanz und im Sinne internationalen Vergleiches und Austausches notwendig und wertvoll. Da aber die historische Perspektive, die stets mit dabei sein sollte, ü berwog, kam die Zukunft des Sozialstaats insgesamt zu kurz. Sehr viel genauer und den Neoliberalismus beziehungsweise beherrschenden Finanzmarktkapitalismus kritischer ausleuchtend hätte eine ökonomische Analyse und Diagnose des Sozialstaats einschließlich von Diakonie und Caritas sein müssen. Oder liegt die Zurückhaltung sowohl in scharfer Analyse und Diagnose als auch in der Entwicklung von Perspektiven daran, dass die derzeitige Lage in all ihren Dimensionen noch keineswegs erfasst und erkannt ist und wir im Blick auf die Zukunft im Grunde ratlos sind? Die Konturen einer spezifisch protestantischen Ethik hätten ebenfalls schärfer und in einem ganz eigenen Beitrag nachgezeichnet werden sollen. Das hätte zu einer differenzierten Sicht auch der ökonomischen Bedingungen, Zwänge und Möglichkeiten geführt, die von Anfang an dem Sozialstaat und der öffentlichen Wohlfahrtspflege Grenzen gesetzt hat und denen auch die kirchliche Diakonie stets unterworfen war. Knapp waren die Ressourcen schon immer. Das allemal prekäre Verhältnis von Gemeinwohl und Eigennutz musste immer schon, bevor es den modernen Finanzmarktkapitalismus, den Neoliberalismus und die Globalisierung gab, mühsam ausbalanciert werden: eine Wanderung auf äußerst schmalem Grat. Auch muss immer wieder neu reflektiert werden, was es bedeutet und wie damit umzugehen ist, dass es im Protestantismus seit seinen Anfängen zwei gege n- sätzliche Ansätze und Ansichten gab und gibt, die hier plakativ so charakterisiert seien: Der 7 Der Berichterstatter bezieht in seine Darstellung das ihm in englischer Sprache vorliegende Manuskript von T. M. ein.
9 PROTESTANTISCHE ETHIK UND MODERNER SOZIALSTAAT (4./ BERLIN) KONGRESSBERICHT 9 / 9 Markt braucht Moral, weil er sie verbraucht. Der Markt ist Moral, weil es per se moralisch ist, den Marktgesetzen zu folgen und damit zum Beispiel die Knappheit der Ressourcen zu beachten, angemessene Preise durch Angebots- und Nachfrageregulierung zu haben und das Wohlstandsniveau insgesamt zu heben. Die Steilvorlagen von Frank Nullmeier und Marcel Hénaff wurden nur sporadisch aufgenommen, obwohl gerade sie über die Gestaltungsfragen hinaus die theologische, ja spirituelle Dimension der Frage nach Gerechtigkeit, Wohlfahrt und Sozialstaat zu einem ganz eigenen Thema gemacht haben. Bei einer intensiveren Diskussion wäre sicher auch in den Blick gekommen, was für die protestantische Spiritualität von größter Bedeutung ist: Es gibt keine Gerechtigkeit ohne Liebe, das heißt auch Lebenshingabe. Der US-amerikanische Sozialphilosoph Cornel West hat das im März 2014 beim 4. Festival der Philosophie in Hannover Wie, bitte, geht Gerechtigkeit? so ausgedrückt: You can t lead the people if you don t love the people. You can t save the people if you don t serve the people. Tenderness is what love looks like in private. Justice is what love looks like in public. 8 Gerechtigkeit ist immer strukturell und individuell! Auf dem Berliner Kongress wurde klar, dass es über Verteilungsg e- rechtigkeit hinaus um Befähigungsgerechtigkeit und damit auch um Bildung gehen muss. Abschließend seien das ausgezeichnete Diskussionsklima und die vielfältigen Mögli chkeiten zum Dialog bei zugleich streng durchgeführtem Programmablauf hervorgehoben. Soviel auf diesem Gebiet noch präziser zu erforschen wäre, ist eines klar und wäre im Blick auf das Reformationsjubiläum 2017 öffentlich zu kommunizieren: Der Protestantismus gehört zu den Fundamenten des Sozialstaats. In welcher Form er sich in Zukunft auch präsentieren wird, er wird gerade um der Erhaltung der Freiheit willen die soziale Verantwortlichkeit der ganzen G e- sellschaft und damit auch des Staates einfordern und dafür seine eigenen Ressourcen zur Verfügung stellen. Fassung vom Hans Joachim Schliep, Pastor i. R., Hans-Joachim-Schliep@t-online.de 8 Der Berichterstatter hat am 4. Festival der Philosophie teilgenommen, hier zitiert er nach Dominik Hammer / Jürgen Manemann: Liebe und Gerechtigkeit Zur Herausforderung der Philosophie von Cornel West, in: fiph-journal Nr. 23 / April 2014, S. 15..
Inhaltsverzeichnis. Vorwort 11
 Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 1. Einleitung 13 1.1 Vorblick 13 1.2 Aufgaben der Ethik als eines Prozesses der Reflexion 13 1.2.1 Ohne Fragestellung kein Zugang zur ethischen Reflexion 13 1.2.2 Was bedeutet
Inhaltsverzeichnis Vorwort 11 1. Einleitung 13 1.1 Vorblick 13 1.2 Aufgaben der Ethik als eines Prozesses der Reflexion 13 1.2.1 Ohne Fragestellung kein Zugang zur ethischen Reflexion 13 1.2.2 Was bedeutet
Qualifikationsphase (Q1) Auf der Suche nach Orientierung im Glauben und im Zweifel
 Unterrichtsvorhaben 1 Thema: Woran kann ich glauben? Christliche Antworten auf die Gottesfrage als Angebote Inhaltsfelder: IF 2: Christliche Antworten auf die Gottesfrage IF 1: Der Mensch in christlicher
Unterrichtsvorhaben 1 Thema: Woran kann ich glauben? Christliche Antworten auf die Gottesfrage als Angebote Inhaltsfelder: IF 2: Christliche Antworten auf die Gottesfrage IF 1: Der Mensch in christlicher
Herzlich willkommen zum Vortrag von. Prof. Dr. Friedrich Schweitzer Universität Tübingen
 Herzlich willkommen zum Vortrag von Prof. Dr. Friedrich Schweitzer Universität Tübingen Verfassungsauftrag christliche Gemeinschaftsschule Oder: Von der alten zur neuen Gemeinschaftsschule LV Baden-Württemberg
Herzlich willkommen zum Vortrag von Prof. Dr. Friedrich Schweitzer Universität Tübingen Verfassungsauftrag christliche Gemeinschaftsschule Oder: Von der alten zur neuen Gemeinschaftsschule LV Baden-Württemberg
Kompetenzorientiertes Schulcurriculum für das Fach Evangelische Religionslehre für die Jahrgangsstufen 7 bis 9
 Kompetenzorientiertes Schulcurriculum für das Fach Evangelische Religionslehre für die Jahrgangsstufen 7 bis 9 Inhaltsfelds 1: Entwicklung einer eigenen religiösen Identität Inhaltlicher Schwerpunkt: Luther
Kompetenzorientiertes Schulcurriculum für das Fach Evangelische Religionslehre für die Jahrgangsstufen 7 bis 9 Inhaltsfelds 1: Entwicklung einer eigenen religiösen Identität Inhaltlicher Schwerpunkt: Luther
Schulinternes Curriculum Evangelische Religionslehre
 Schulinternes Curriculum Evangelische Religionslehre Jahrgang 7.2 1. Unterrichtsvorhaben Inhaltsfeld 1: Inhaltlicher Schwerpunkt 2: Entwicklung einer eigenen religiösen Identität Reformatorische Grundeinsichten
Schulinternes Curriculum Evangelische Religionslehre Jahrgang 7.2 1. Unterrichtsvorhaben Inhaltsfeld 1: Inhaltlicher Schwerpunkt 2: Entwicklung einer eigenen religiösen Identität Reformatorische Grundeinsichten
Jürgen Eiben Von Luther zu Kant- Der deutsche Sonderweg in die Moderne
 Jürgen Eiben Von Luther zu Kant- Der deutsche Sonderweg in die Moderne Jürgen Eiben von Luther zu Kant-- Der deutsche Sonderweg in die Moderne Eine soziologische Bebachtung ~ Springer Fachmedien Wiesbaden
Jürgen Eiben Von Luther zu Kant- Der deutsche Sonderweg in die Moderne Jürgen Eiben von Luther zu Kant-- Der deutsche Sonderweg in die Moderne Eine soziologische Bebachtung ~ Springer Fachmedien Wiesbaden
Grundinformation Theologische Ethik
 Grundinformation Theologische Ethik Bearbeitet von Wolfgang Lienemann 1. Auflage 2008. Taschenbuch. 319 S. Paperback ISBN 978 3 8252 3138 5 Format (B x L): 15 x 21,5 cm Gewicht: 425 g Weitere Fachgebiete
Grundinformation Theologische Ethik Bearbeitet von Wolfgang Lienemann 1. Auflage 2008. Taschenbuch. 319 S. Paperback ISBN 978 3 8252 3138 5 Format (B x L): 15 x 21,5 cm Gewicht: 425 g Weitere Fachgebiete
Nah. am Menschen. Unser Leitbild. Caritasverband für den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald e. V.
 Nah am Menschen Unser Leitbild Caritasverband für den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald e. V. Herzlich willkommen! Sie halten unser Leitbild in den Händen. Das sind die zehn zentralen Aussagen zu unserem
Nah am Menschen Unser Leitbild Caritasverband für den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald e. V. Herzlich willkommen! Sie halten unser Leitbild in den Händen. Das sind die zehn zentralen Aussagen zu unserem
Religionsunterricht wozu?
 Religionsunterricht wozu? Mensch Fragen Leben Gott Beziehungen Gestalten Arbeit Glaube Zukunft Moral Werte Sinn Kirche Ziele Dialog Erfolg Geld Wissen Hoffnung Kritik??? Kompetenz Liebe Verantwortung Wirtschaft
Religionsunterricht wozu? Mensch Fragen Leben Gott Beziehungen Gestalten Arbeit Glaube Zukunft Moral Werte Sinn Kirche Ziele Dialog Erfolg Geld Wissen Hoffnung Kritik??? Kompetenz Liebe Verantwortung Wirtschaft
Heinz Eduard Tödt Menschenrechte - Grundrechte
 Heinz Eduard Tödt Menschenrechte - Grundrechte TÃ dt, Heinz Eduard Menschenrechte, Grundrechte 1982 digitalisiert durch: IDS Luzern Menschenrechte - Grundrechte 7. Menschen- und Grundrechte im Rechtsbewußtsein
Heinz Eduard Tödt Menschenrechte - Grundrechte TÃ dt, Heinz Eduard Menschenrechte, Grundrechte 1982 digitalisiert durch: IDS Luzern Menschenrechte - Grundrechte 7. Menschen- und Grundrechte im Rechtsbewußtsein
Unser Leitbild. Caritasverband Rhein-Wied-Sieg e.v. Geschäftsstelle Neuwied
 Geschäftsstelle Neuwied Vorwort ist in einem intensiven Prozess erarbeitet worden, an dem alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitwirken konnten. bestimmt unser Handeln im Heute und im Morgen. Es will
Geschäftsstelle Neuwied Vorwort ist in einem intensiven Prozess erarbeitet worden, an dem alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitwirken konnten. bestimmt unser Handeln im Heute und im Morgen. Es will
Zukunftsperspektiven des Christentums
 Karl Gabriel Wie kann der Glaube überleben? Die Zukunftsperspektiven des Christentums (Vortrag gehalten am 08. 02. 2017 im Sozialseminar der evang. Kirchengemeinde Jöllenbeck) 1. Einleitung 500 Jahre Reformation,
Karl Gabriel Wie kann der Glaube überleben? Die Zukunftsperspektiven des Christentums (Vortrag gehalten am 08. 02. 2017 im Sozialseminar der evang. Kirchengemeinde Jöllenbeck) 1. Einleitung 500 Jahre Reformation,
Ist Ethik wichtiger als Religion? Di, , Schlatterhaus, Gespräch mit den Humanisten Tübingen Michael Seibt
 Ist Ethik wichtiger als Religion? Di, 22.03.2016, Schlatterhaus, Gespräch mit den Humanisten Tübingen Michael Seibt 1. Frage: Was ist Religion und warum ist sie wichtig? Was ist Ethik und warum ist sie
Ist Ethik wichtiger als Religion? Di, 22.03.2016, Schlatterhaus, Gespräch mit den Humanisten Tübingen Michael Seibt 1. Frage: Was ist Religion und warum ist sie wichtig? Was ist Ethik und warum ist sie
I. WAHRNEHMUNGEN DES HELFENS
 INHALT Geleitwort von GerdTheißen 11 Vorwort 13 Einführung 15 I. WAHRNEHMUNGEN DES HELFENS KAPITEL 1: AMBIVALENZEN DES HELFENS - WERTSCHÄTZUNG UND KRITIK HELFENDEN HANDELNS 28 1. Helfen als Erwartung an
INHALT Geleitwort von GerdTheißen 11 Vorwort 13 Einführung 15 I. WAHRNEHMUNGEN DES HELFENS KAPITEL 1: AMBIVALENZEN DES HELFENS - WERTSCHÄTZUNG UND KRITIK HELFENDEN HANDELNS 28 1. Helfen als Erwartung an
Zum Wohle aller? Religionen, Wohlfahrtsstaat und Integration in Europa
 Theologische Fakultät Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät VORTRAG UND BUCHVERNISSAGE Prof. em. Dr. Dr. h.c. Karl Gabriel (Universität Münster) Zum Wohle aller? Religionen, Wohlfahrtsstaat und
Theologische Fakultät Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät VORTRAG UND BUCHVERNISSAGE Prof. em. Dr. Dr. h.c. Karl Gabriel (Universität Münster) Zum Wohle aller? Religionen, Wohlfahrtsstaat und
Jesus erzählt vom Reich Gottes die Evangelien als frohe Botschaft
 Unterrichtsvorhaben A: Jesus erzählt vom Reich Gottes die Evangelien als frohe Botschaft Bibel als Ur-kunde des Glaubens an Gott (IF 3), Jesus der Christus (IF 4) deuten biblisches Sprechen von Gott als
Unterrichtsvorhaben A: Jesus erzählt vom Reich Gottes die Evangelien als frohe Botschaft Bibel als Ur-kunde des Glaubens an Gott (IF 3), Jesus der Christus (IF 4) deuten biblisches Sprechen von Gott als
Diakonie. Leitbild. Schleswig-Holstein. Diakonisches Werk. Schleswig-Holstein. Landesverband der Inneren Mission e.v.
 Diakonie Schleswig-Holstein Diakonisches Werk Schleswig-Holstein Landesverband der Inneren Mission e.v. Leitbild Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Dieses Leitbild des Diakonischen
Diakonie Schleswig-Holstein Diakonisches Werk Schleswig-Holstein Landesverband der Inneren Mission e.v. Leitbild Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Dieses Leitbild des Diakonischen
3) Evangelischer Religionsunterricht in der Sek.II
 3) Evangelischer Religionsunterricht in der Sek.II Evangelischer Religionsunterricht erschließt die religiöse Dimension der Wirklichkeit und des Lebens und trägt damit zur religiösen Bildung der Schüler/innen
3) Evangelischer Religionsunterricht in der Sek.II Evangelischer Religionsunterricht erschließt die religiöse Dimension der Wirklichkeit und des Lebens und trägt damit zur religiösen Bildung der Schüler/innen
Ökumenische Rundschau
 Einheit und Vielfalt Ökumenische Rundschau 4/2015 Oktober Dezember 4/2015 64. Jahrgang Ökumenische Rundschau Miteinander Nebeneinander Gegeneinander Einheit und Vielfalt innerhalb der Religionen mit Beiträgen
Einheit und Vielfalt Ökumenische Rundschau 4/2015 Oktober Dezember 4/2015 64. Jahrgang Ökumenische Rundschau Miteinander Nebeneinander Gegeneinander Einheit und Vielfalt innerhalb der Religionen mit Beiträgen
Fach: Evangelische Religion Jahrgangsstufe: 9 Inhalt: Die Frage nach Gott
 Fach: Evangelische Religion Jahrgangsstufe: 9 Inhalt: Die Frage nach Gott Leitperspektive Inhaltsfeld Kompetenzen/ Abstufungen Inhaltsbezogene Kompetenzen* Zeit Fächerübergreifend/ - verbindend Christliche
Fach: Evangelische Religion Jahrgangsstufe: 9 Inhalt: Die Frage nach Gott Leitperspektive Inhaltsfeld Kompetenzen/ Abstufungen Inhaltsbezogene Kompetenzen* Zeit Fächerübergreifend/ - verbindend Christliche
Curriculum Evangelische Religionslehre Qualifikationsphase März 2015
 Qualifikationsphase (Q1) GRUNDKURS Halbjahresthema 1. Hj.: Auf der Suche nach Orientierung im Glauben Unterrichtsvorhaben I: Thema: Gott, Götter, Götzen: Wie Christen im Glauben Orientierung finden und
Qualifikationsphase (Q1) GRUNDKURS Halbjahresthema 1. Hj.: Auf der Suche nach Orientierung im Glauben Unterrichtsvorhaben I: Thema: Gott, Götter, Götzen: Wie Christen im Glauben Orientierung finden und
Gerechtigkeit für Menschen mit Behinderung
 Campus Forschung 940 Gerechtigkeit für Menschen mit Behinderung Ethische Reflexionen und sozialpolitische Perspektiven von Johannes Eurich 1. Auflage Gerechtigkeit für Menschen mit Behinderung Eurich schnell
Campus Forschung 940 Gerechtigkeit für Menschen mit Behinderung Ethische Reflexionen und sozialpolitische Perspektiven von Johannes Eurich 1. Auflage Gerechtigkeit für Menschen mit Behinderung Eurich schnell
Wahrnehmungskompetenz. Die Schülerinnen und Schüler
 Inhaltsfeld 1: Entwicklung einer eigenen religiösen Identität : Bilder von Männern und Frauen als Identifikationsangebote -Reformatorische Grundeinsichten als Grundlagen der Lebensgestaltung identifizieren
Inhaltsfeld 1: Entwicklung einer eigenen religiösen Identität : Bilder von Männern und Frauen als Identifikationsangebote -Reformatorische Grundeinsichten als Grundlagen der Lebensgestaltung identifizieren
Schulinterner Arbeitsplan ev./ kath. Religion (Große Schule Wolfenbüttel)
 Schulinterner Arbeitsplan ev./ kath. Religion (Große Schule Wolfenbüttel) Kompetenzbereich Mensch Klage- und Trostpsalmen - beschreiben Situationen der Angst und der Trauer. - gestalten religiöse Sprachformen
Schulinterner Arbeitsplan ev./ kath. Religion (Große Schule Wolfenbüttel) Kompetenzbereich Mensch Klage- und Trostpsalmen - beschreiben Situationen der Angst und der Trauer. - gestalten religiöse Sprachformen
Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft
 Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft Teilband 29 Karl Lehmann Gemeinde Franz-Xaver Kaufmann / Heinrich Fries / Wolfhart Pannenberg / Axel Frhr. von Campenhausen / Peter Krämer Kirche Heinrich Fries
Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft Teilband 29 Karl Lehmann Gemeinde Franz-Xaver Kaufmann / Heinrich Fries / Wolfhart Pannenberg / Axel Frhr. von Campenhausen / Peter Krämer Kirche Heinrich Fries
Wirtschaftsordnung und Eigentum in der christlichen Sozialethik
 Wirtschaftsordnung und Eigentum in der christlichen Sozialethik [D]er Mensch [muss] der Träger, Schöpfer und das Ziel aller gesellschaftlichen Einrichtungen sein (Johannes XXIII. 1961: Mater Et Magistra
Wirtschaftsordnung und Eigentum in der christlichen Sozialethik [D]er Mensch [muss] der Träger, Schöpfer und das Ziel aller gesellschaftlichen Einrichtungen sein (Johannes XXIII. 1961: Mater Et Magistra
Das Bildungskonzept der Cusanus Hochschule
 Das Bildungskonzept der Cusanus Hochschule am Beispiel des Masters Ökonomie Münster, 7. September 2015 Ausgangspunkt: Die Vision des Netzwerks von Ökonomie als pluraler Wissenschaft Bildungsanliegen der
Das Bildungskonzept der Cusanus Hochschule am Beispiel des Masters Ökonomie Münster, 7. September 2015 Ausgangspunkt: Die Vision des Netzwerks von Ökonomie als pluraler Wissenschaft Bildungsanliegen der
I. Einführung in den Wohlfahrtsstaats vergleich: Methoden, Theorien und Kontroversen
 Inhaltsverzeichnis Verzeichnis der Schaubilder 12 Vorwort zur 1. Auflage 19 Vorwort zur 2. Auflage 21 I. Einführung in den Wohlfahrtsstaats vergleich: Methoden, Theorien und Kontroversen 1 Methodisch-theoretische
Inhaltsverzeichnis Verzeichnis der Schaubilder 12 Vorwort zur 1. Auflage 19 Vorwort zur 2. Auflage 21 I. Einführung in den Wohlfahrtsstaats vergleich: Methoden, Theorien und Kontroversen 1 Methodisch-theoretische
I. Die Weltkirchenkonferenz für praktisches Christentum 1925 in Stockholm
 Inhaltsverzeichnis 0. Einleitung 1. Zur Fragestellung der Arbeit 2. Inhalt 3. Zielsetzung 1 1 7 12 I. Die Weltkirchenkonferenz für praktisches Christentum 1925 in Stockholm 14 I.1. Auf dem Weg nach Stockholm
Inhaltsverzeichnis 0. Einleitung 1. Zur Fragestellung der Arbeit 2. Inhalt 3. Zielsetzung 1 1 7 12 I. Die Weltkirchenkonferenz für praktisches Christentum 1925 in Stockholm 14 I.1. Auf dem Weg nach Stockholm
Zu diesem Band: Ein kurzer Überblick... 1 Rauf Ceylan und Michael Kiefer. I. Geschichte der konfessionellen Wohlfahrt in Deutschland...
 Inhaltsverzeichnis Zu diesem Band: Ein kurzer Überblick............................ 1 Rauf Ceylan und Michael Kiefer I. Geschichte der konfessionellen Wohlfahrt in Deutschland......... 5 Wohlfahrtspflege
Inhaltsverzeichnis Zu diesem Band: Ein kurzer Überblick............................ 1 Rauf Ceylan und Michael Kiefer I. Geschichte der konfessionellen Wohlfahrt in Deutschland......... 5 Wohlfahrtspflege
Klasse 7 Leitthema Jona 1. Halbjahr, 1. Quartal. Didaktisch-methodische Zugriffe
 Klasse 7 Leitthema Jona 1. Halbjahr, 1. Quartal W3: Situationen beschreiben, in denen existenzielle Fragen des Lebens auftreten De1: Grundformen religiöser und biblischer Sprache sowie individueller und
Klasse 7 Leitthema Jona 1. Halbjahr, 1. Quartal W3: Situationen beschreiben, in denen existenzielle Fragen des Lebens auftreten De1: Grundformen religiöser und biblischer Sprache sowie individueller und
Rauf Ceylan Michael Kiefer. (Hrsg.) Ökonomisierung. und Säkularisierung. Neue Herausforderungen der. konfessionellen Wohlfahrtspflege.
 Rauf Ceylan Michael Kiefer (Hrsg.) Ökonomisierung und Säkularisierung Neue Herausforderungen der konfessionellen Wohlfahrtspflege in Deutschland ^ Springer VS Zu diesem Band: Ein kurzer Überblick 1 RaufCeylan
Rauf Ceylan Michael Kiefer (Hrsg.) Ökonomisierung und Säkularisierung Neue Herausforderungen der konfessionellen Wohlfahrtspflege in Deutschland ^ Springer VS Zu diesem Band: Ein kurzer Überblick 1 RaufCeylan
Didaktischer Aufriss zum Oberstufenlehrplan Katholische Religionslehre: Jgst. 12 im Überblick Stand:
 K 12.1 Ethische Kompetenz aus christlicher Sicht: Orientierung im Wertepluralismus / K 12.2 Ethische Kompetenz aus christlicher Sicht: aktuelle Herausforderungen Kurzkommentierung: An relevanten ethischen
K 12.1 Ethische Kompetenz aus christlicher Sicht: Orientierung im Wertepluralismus / K 12.2 Ethische Kompetenz aus christlicher Sicht: aktuelle Herausforderungen Kurzkommentierung: An relevanten ethischen
Krise des Neoliberalismus? Thesen zur Dynamik und Wirkung eines Jahrhundertprojekts
 Krise des Neoliberalismus? Thesen zur Dynamik und Wirkung eines Jahrhundertprojekts Symposium des Renner-Instituts am in Wien Vortrag von Institut II Wirtschaftswissenschaft, Bildungsökonomie und Ökonomische
Krise des Neoliberalismus? Thesen zur Dynamik und Wirkung eines Jahrhundertprojekts Symposium des Renner-Instituts am in Wien Vortrag von Institut II Wirtschaftswissenschaft, Bildungsökonomie und Ökonomische
Städtisches Gymnasium Olpe. Schulinternes Curriculum Evangelische Religionslehre
 Städtisches Gymnasium Olpe Schulinternes Curriculum Evangelische Religionslehre Qualifikationsphase 1-1. Halbjahr Halbjahresthema: Gotteslehre / Theologie Unterrichtsvorhaben I: Thema: Wie kann ich mit
Städtisches Gymnasium Olpe Schulinternes Curriculum Evangelische Religionslehre Qualifikationsphase 1-1. Halbjahr Halbjahresthema: Gotteslehre / Theologie Unterrichtsvorhaben I: Thema: Wie kann ich mit
Christliche Religionen (Teil 1)
 Christliche Religionen (Teil 1) Nach Konfessionen, Anteil der Christen an der Bevölkerung in Prozent, Staaten der EU, 2001* Malta Italien 1 Katholiken 1 Bevölkerung ohne Angaben: > 10 Prozent 94,5 94,5
Christliche Religionen (Teil 1) Nach Konfessionen, Anteil der Christen an der Bevölkerung in Prozent, Staaten der EU, 2001* Malta Italien 1 Katholiken 1 Bevölkerung ohne Angaben: > 10 Prozent 94,5 94,5
Inhalt. Vorwort u Postskriptum 113. I. C hristliche Religiosität und kulturelles Erbe
 Inhalt Vorwort u Postskriptum 113 I. C hristliche Religiosität und kulturelles Erbe 1. Religiöse versus kulturelle Christlichkeit 117 Wie christlich ist die deutsche Gesellschaft? 117 Persönliche Religiosität
Inhalt Vorwort u Postskriptum 113 I. C hristliche Religiosität und kulturelles Erbe 1. Religiöse versus kulturelle Christlichkeit 117 Wie christlich ist die deutsche Gesellschaft? 117 Persönliche Religiosität
Ihr Empfang bietet eine gute Gelegenheit zum Gedankenaustausch zwischen Vertretern von Kirche und Politik.
 Sperrfrist: 9. Juli 2015, 19.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Jahresempfang des Erzbischofs
Sperrfrist: 9. Juli 2015, 19.00 Uhr Es gilt das gesprochene Wort. Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Jahresempfang des Erzbischofs
Inhalt. Vorwort 15. I. Theorien und Methoden
 Vorwort 15 I. Theorien und Methoden 1 Einführung 21 1.1 Einleitung 21 1.2 Theorien der vergleichenden Staatstätigkeitsforschung im Überblick 22 Literatur 26 2 Die Sozioökonomische Schule 29 2.1 Einleitung
Vorwort 15 I. Theorien und Methoden 1 Einführung 21 1.1 Einleitung 21 1.2 Theorien der vergleichenden Staatstätigkeitsforschung im Überblick 22 Literatur 26 2 Die Sozioökonomische Schule 29 2.1 Einleitung
I. Einleitung 1. I.1 Zur Themenstellung 1. I.2 Zum Stand der Forschung und der Fragestellung der Arbeit 2. I.3 Der Aufbau der Untersuchung 7
 I. Einleitung 1 I.1 Zur Themenstellung 1 I.2 Zum Stand der Forschung und der Fragestellung der Arbeit 2 I.3 Der Aufbau der Untersuchung 7 II Die Bedeutung der Menschenwürde als Basis der Menschenrechte
I. Einleitung 1 I.1 Zur Themenstellung 1 I.2 Zum Stand der Forschung und der Fragestellung der Arbeit 2 I.3 Der Aufbau der Untersuchung 7 II Die Bedeutung der Menschenwürde als Basis der Menschenrechte
Curriculum Evangelische Religionslehre am Marianne-Weber-Gymnasium Jahrgangsstufe 7
 Unterrichtsvorhaben Inhaltsfeld Umfang Martin Luther und die Reformation Wahrnehmungskompetenz Inhaltsfeld 1: Entwicklung einer eigenen religiösen Identität Inhaltsfeld 4: Kirche und andere Formen religiöser
Unterrichtsvorhaben Inhaltsfeld Umfang Martin Luther und die Reformation Wahrnehmungskompetenz Inhaltsfeld 1: Entwicklung einer eigenen religiösen Identität Inhaltsfeld 4: Kirche und andere Formen religiöser
IV. Globalisierung Globalización aus Sicht der Fächer Gemeinschaftskunde, Spanisch und Religion
 IV. Globalisierung Globalización aus Sicht der Fächer Gemeinschaftskunde, Spanisch und Religion Vermittlung orientierender und gestaltender Teilhabe in Studium, Beruf und Gesellschaft auf der Basis heterogener
IV. Globalisierung Globalización aus Sicht der Fächer Gemeinschaftskunde, Spanisch und Religion Vermittlung orientierender und gestaltender Teilhabe in Studium, Beruf und Gesellschaft auf der Basis heterogener
UNSERE WERTE UND GRUNDÜBER- ZEUGUNGEN
 UNSERE WERTE UND GRUNDÜBER- ZEUGUNGEN Wir sind das Hilfswerk der evangelischen Kirchen der Schweiz. Unsere Verankerung in den Kirchen prägt die Grundüberzeugungen, welche für unser Handeln von zentraler
UNSERE WERTE UND GRUNDÜBER- ZEUGUNGEN Wir sind das Hilfswerk der evangelischen Kirchen der Schweiz. Unsere Verankerung in den Kirchen prägt die Grundüberzeugungen, welche für unser Handeln von zentraler
Was verdanken wir der Reformation? Gründe zum Feiern nicht nur für Evangelische!
 Was verdanken wir der Reformation? 10 Gründe zum Feiern nicht nur für Evangelische! Zugang zur Bibel 1 Martin Luther war überzeugt, dass ich den Gott, dem ich vertrauen und den ich lieben kann, nur in
Was verdanken wir der Reformation? 10 Gründe zum Feiern nicht nur für Evangelische! Zugang zur Bibel 1 Martin Luther war überzeugt, dass ich den Gott, dem ich vertrauen und den ich lieben kann, nur in
Übergabe der BSG-Denkschrift an den Bundespräsidenten
 Ulrich Becker & Stephan Leibfried Übergabe der BSG-Denkschrift an den Bundespräsidenten Do. 11.9., BSG Kassel: 5 Minuten Sehr verehrter Herr Bundespräsident, wir freuen uns sehr, Ihnen zugleich in Vertretung
Ulrich Becker & Stephan Leibfried Übergabe der BSG-Denkschrift an den Bundespräsidenten Do. 11.9., BSG Kassel: 5 Minuten Sehr verehrter Herr Bundespräsident, wir freuen uns sehr, Ihnen zugleich in Vertretung
Konzepte und Erfahrungen Verbandliche Konkretisierung Dr. Dorothee Steiof
 Konzepte und Erfahrungen Verbandliche Konkretisierung Dr. Dorothee Steiof ein Beitrag zur Tagung: Interreligiöse Öffnung und Zusammenarbeit? 11. 12.05.2015 in Stuttgart-Hohenheim http://downloads.akademie-rs.de/interreligioeser-dialog/150511_steiof_caritas.pdf
Konzepte und Erfahrungen Verbandliche Konkretisierung Dr. Dorothee Steiof ein Beitrag zur Tagung: Interreligiöse Öffnung und Zusammenarbeit? 11. 12.05.2015 in Stuttgart-Hohenheim http://downloads.akademie-rs.de/interreligioeser-dialog/150511_steiof_caritas.pdf
Sook-Young Ahn Soziale Grenzen der Globalisierung
 Sook-Young Ahn Soziale Grenzen der Globalisierung Zur Entwicklung der sozialwissenschaftlichen Diskussion um das Verhältnis zwischen Globalisierung und Sozialstaat Traktor Verlag Inhaltsverzeichnis Einleitung:
Sook-Young Ahn Soziale Grenzen der Globalisierung Zur Entwicklung der sozialwissenschaftlichen Diskussion um das Verhältnis zwischen Globalisierung und Sozialstaat Traktor Verlag Inhaltsverzeichnis Einleitung:
sportlich. christlich. bewegt.
 DJK-Sportverband Diözesanverband Münster e. V. sportlich. christlich. bewegt. Unser Leitbild Unsere Mission. Sport als Dienst am Menschen. Unsere Mission. Sport als Dienst am Menschen. Bewegung, Spiel
DJK-Sportverband Diözesanverband Münster e. V. sportlich. christlich. bewegt. Unser Leitbild Unsere Mission. Sport als Dienst am Menschen. Unsere Mission. Sport als Dienst am Menschen. Bewegung, Spiel
Aufbaumodul Prakt. Philos. Philosophiegeschichte. S: Rawls: Gerechtigkeit als
 Aufbaumodul Prakt. Philos. Philosophiegeschichte S: Rawls: Gerechtigkeit als Fairness 11.10.2011 Programm heute 1. Organisatorisches - Seminarlektüre/ Semesterapparat 2. Einführung zum Seminar 3. Termine/
Aufbaumodul Prakt. Philos. Philosophiegeschichte S: Rawls: Gerechtigkeit als Fairness 11.10.2011 Programm heute 1. Organisatorisches - Seminarlektüre/ Semesterapparat 2. Einführung zum Seminar 3. Termine/
Ethik der Entwicklungspolitik
 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. T h om as Kessel ri n g Ethik der Entwicklungspolitik Gerechtigkeit
2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated to dandelon.com network. T h om as Kessel ri n g Ethik der Entwicklungspolitik Gerechtigkeit
Übersicht: schulinterner Lehrplan Evangelische Religionslehre
 Übersicht: schulinterner Lehrplan Evangelische Religionslehre Jahrgang Inhaltsfelder Kompetenzen 5 / 6 1 Ankommen hier sein Ich sein - Gemeinschaft erleben - Einzigartigkeit erfahren -Orientierung finden
Übersicht: schulinterner Lehrplan Evangelische Religionslehre Jahrgang Inhaltsfelder Kompetenzen 5 / 6 1 Ankommen hier sein Ich sein - Gemeinschaft erleben - Einzigartigkeit erfahren -Orientierung finden
Schulinternes Curriculum Sek I der Fachschaft evangelisch Religionslehre. Kompetenzbereich Übergeordnete Kompetenzerwartungen
 Jahrgangsstufen Inhaltsfeld Inhaltlicher Kompetenzbereich Übergeordnete Kompetenzerwartungen Schwerpunkt 5 Gottesvorstellungen im Lebenslauf (1) Abschied vom Kinderglauben ; Gottesbilder im AT Sachkompetenz
Jahrgangsstufen Inhaltsfeld Inhaltlicher Kompetenzbereich Übergeordnete Kompetenzerwartungen Schwerpunkt 5 Gottesvorstellungen im Lebenslauf (1) Abschied vom Kinderglauben ; Gottesbilder im AT Sachkompetenz
Katholische Religionslehre Q2
 Unterrichtsvorhaben V : Thema: Die (christliche) Herausforderung sinnvoll zu leben und ethisch zu handeln Inhaltsfelder: IF 1: Der Mensch in christlicher Perspektive IF 5: Verantwortliches Handeln aus
Unterrichtsvorhaben V : Thema: Die (christliche) Herausforderung sinnvoll zu leben und ethisch zu handeln Inhaltsfelder: IF 1: Der Mensch in christlicher Perspektive IF 5: Verantwortliches Handeln aus
Für Menschenrechte und Säkularisierung stehen
 EU WAHLEN 2014 Für Menschenrechte und Säkularisierung stehen EHF Memorandum November 2013 ie europäischen Wahlen im Mai 2014 werden für Humanisten in D Europa entscheidend sein. Der Aufstieg von radikalen
EU WAHLEN 2014 Für Menschenrechte und Säkularisierung stehen EHF Memorandum November 2013 ie europäischen Wahlen im Mai 2014 werden für Humanisten in D Europa entscheidend sein. Der Aufstieg von radikalen
Schulinterner Lehrplan Evangelische Religionslehre am Clara-Schumann-Gymnasium Holzwickede Qualifikationsphase (Q 1)
 Schulinterner Lehrplan Evangelische Religionslehre am Clara-Schumann-Gymnasium Holzwickede Qualifikationsphase (Q 1) Qualifikationsphase (Q1) GRUNDKURS Halbjahresthema 1.Hj.: Als Mensch Orientierung suchen
Schulinterner Lehrplan Evangelische Religionslehre am Clara-Schumann-Gymnasium Holzwickede Qualifikationsphase (Q 1) Qualifikationsphase (Q1) GRUNDKURS Halbjahresthema 1.Hj.: Als Mensch Orientierung suchen
Stefan Müller-Teusler
 und wozu brauchen wir sie? meint das Nachdenken über Handlungen und Sitten beschäftigt sich mit der Reflexion sittlicher Phänomene und damit mit Fragen nach dem SOLLEN im Blickpunkt: die rechte Normierung
und wozu brauchen wir sie? meint das Nachdenken über Handlungen und Sitten beschäftigt sich mit der Reflexion sittlicher Phänomene und damit mit Fragen nach dem SOLLEN im Blickpunkt: die rechte Normierung
1 - Es gilt das gesprochene Wort! - - Sperrfrist: , Uhr -
 1 - Es gilt das gesprochene Wort! - - Sperrfrist: 24.11.2013, 20.00 Uhr - Rede des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Empfang anlässlich
1 - Es gilt das gesprochene Wort! - - Sperrfrist: 24.11.2013, 20.00 Uhr - Rede des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Empfang anlässlich
Helene-Lange-Schule Hannover Schulcurriculum Katholische Religion Klasse Sek II
 Helene-Lange-Schule Hannover Schulcurriculum Katholische Religion Klasse 5-10 + Sek II Legende: prozessbezogene Kompetenzbereiche inhaltsbezogene Kompetenzbereiche Hinweise: Zur nachhaltigen Förderung
Helene-Lange-Schule Hannover Schulcurriculum Katholische Religion Klasse 5-10 + Sek II Legende: prozessbezogene Kompetenzbereiche inhaltsbezogene Kompetenzbereiche Hinweise: Zur nachhaltigen Förderung
Graf-Engelbert-Schule Bochum Ev. Religionslehre Schulinterner Lehrplan Sek II (Kurzfassung)
 Graf-Engelbert-Schule Bochum Ev. Religionslehre Schulinterner Lehrplan Sek II (Kurzfassung) Themen und Inhaltsfelder 10/1 Wer bin ich? Was ist der Mensch vor Gott? Inhaltliche Schwerpunkte Exemplarische
Graf-Engelbert-Schule Bochum Ev. Religionslehre Schulinterner Lehrplan Sek II (Kurzfassung) Themen und Inhaltsfelder 10/1 Wer bin ich? Was ist der Mensch vor Gott? Inhaltliche Schwerpunkte Exemplarische
Religionsunterricht. Ein besonderes Fach an den katholischen Grundschulen in Bremen
 Religionsunterricht Ein besonderes Fach an den katholischen Grundschulen in Bremen Bischöfliches Generalvikariat Osnabrück Abteilung Schulen und Hochschulen Domhof 2 49074 Osnabrück Tel. 0541 318351 schulabteilung@bistum-os.de
Religionsunterricht Ein besonderes Fach an den katholischen Grundschulen in Bremen Bischöfliches Generalvikariat Osnabrück Abteilung Schulen und Hochschulen Domhof 2 49074 Osnabrück Tel. 0541 318351 schulabteilung@bistum-os.de
Werner Schüßler/Erdmann Sturm. Paul Tillich. Leben - Werk - Wirkung
 Werner Schüßler/Erdmann Sturm Paul Tillich Leben - Werk - Wirkung Inhalt Vorwort Hinweis zur Zitation IX X I.Teil: Leben 1 Zwischen Schwermut und Lebensfreude 3 2 Die Entdeckung der Spätphilosophie F.
Werner Schüßler/Erdmann Sturm Paul Tillich Leben - Werk - Wirkung Inhalt Vorwort Hinweis zur Zitation IX X I.Teil: Leben 1 Zwischen Schwermut und Lebensfreude 3 2 Die Entdeckung der Spätphilosophie F.
Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaft. Begründet von Joseph Höpfner Herausgegeben von Karl Gabriel
 Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaft Begründet von Joseph Höpfner Herausgegeben von Karl Gabriel ASCHENDORFF VERLAG Europäische Wohlfahrtsstaatlichkeit Soziokulturelle Grundlagen und religiöse Wurzeln
Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaft Begründet von Joseph Höpfner Herausgegeben von Karl Gabriel ASCHENDORFF VERLAG Europäische Wohlfahrtsstaatlichkeit Soziokulturelle Grundlagen und religiöse Wurzeln
Fach: Katholische Religionslehre Klasse 5
 Fach: Katholische Religionslehre Klasse 5 Ich und die Gruppe Menschen leben in Beziehungen und übernehmen verschiedene Rollen Orientierung für den Umgang miteinander die Goldene Regel Einübung in eine
Fach: Katholische Religionslehre Klasse 5 Ich und die Gruppe Menschen leben in Beziehungen und übernehmen verschiedene Rollen Orientierung für den Umgang miteinander die Goldene Regel Einübung in eine
Werner Müller Bürgertum und Christentum
 Werner Müller Bürgertum und Christentum MÃ?ller, Werner BÃ?rgertum und Christentum 1982 digitalisiert durch: IDS Luzern Bürgertum und Christentum 7. Das Problem einer theologischen Fundamentalhermeneutik
Werner Müller Bürgertum und Christentum MÃ?ller, Werner BÃ?rgertum und Christentum 1982 digitalisiert durch: IDS Luzern Bürgertum und Christentum 7. Das Problem einer theologischen Fundamentalhermeneutik
HIPHOP PARTEI KICK OFF
 KICK OFF Dezember 2016 WIR! In Zeiten der Globalisierung ist unsere Gesellschaft einem stetigen Wandel von kultureller Identität unterworfen. Die HipHop Kultur hat seit den 70er Jahren eine Vielzahl von
KICK OFF Dezember 2016 WIR! In Zeiten der Globalisierung ist unsere Gesellschaft einem stetigen Wandel von kultureller Identität unterworfen. Die HipHop Kultur hat seit den 70er Jahren eine Vielzahl von
Zur Kirche, die geprägt ist durch die frohe Botschaft des Evangeliums. Wie wird es sein, wenn Du stirbst und Du mußt vor Gottes Gericht erscheinen?
 Keine Kirche der Angst. Predigt am Reformationsfest, 6. November 2016, in der Petruskirche zu Gerlingen Das ist es, was Martin Luther aufgegangen ist. Ja, wenn man versucht, es ganz schlicht auf den Punkt
Keine Kirche der Angst. Predigt am Reformationsfest, 6. November 2016, in der Petruskirche zu Gerlingen Das ist es, was Martin Luther aufgegangen ist. Ja, wenn man versucht, es ganz schlicht auf den Punkt
ERKLÄRUNG DER DEUTSCHEN BISCHÖFE ZUR PARTEIPOLITISCHEN TÄTIGKEIT DER PRIESTER
 ERKLÄRUNG DER DEUTSCHEN BISCHÖFE ZUR PARTEIPOLITISCHEN TÄTIGKEIT DER PRIESTER Vorwort Aus Sorge um die Schäden, die der Kirche aus der parteipolitischen Betätigung der Priester erwachsen, haben die deutschen
ERKLÄRUNG DER DEUTSCHEN BISCHÖFE ZUR PARTEIPOLITISCHEN TÄTIGKEIT DER PRIESTER Vorwort Aus Sorge um die Schäden, die der Kirche aus der parteipolitischen Betätigung der Priester erwachsen, haben die deutschen
Thomas Kessel ring. Ethik der Entwicklungspolitik. Gerechtigkeit im Zeitalter der Globalisierung
 Thomas Kessel ring Ethik der Entwicklungspolitik Gerechtigkeit im Zeitalter der Globalisierung j C.H.Beck Inhalt Vorwort 9 Einleitung 11 Erster Teil Gerechtigkeit und Entwicklung Philosophische Debatten
Thomas Kessel ring Ethik der Entwicklungspolitik Gerechtigkeit im Zeitalter der Globalisierung j C.H.Beck Inhalt Vorwort 9 Einleitung 11 Erster Teil Gerechtigkeit und Entwicklung Philosophische Debatten
Zur Reihe 13. Vorwort 15. (Eberhard Schockenhoff) Begriffserklärung: Moral - Ethos - Ethik 19
 Inhalt Zur Reihe 13 Vorwort 15 I. Philosophische Ethik (Eberhard Schockenhoff) 17 1. Begriffserklärung: Moral - Ethos - Ethik 19 2. Reflexionsebenen: Narrative Ethik - normative Ethik - Metaethik 21 2.1
Inhalt Zur Reihe 13 Vorwort 15 I. Philosophische Ethik (Eberhard Schockenhoff) 17 1. Begriffserklärung: Moral - Ethos - Ethik 19 2. Reflexionsebenen: Narrative Ethik - normative Ethik - Metaethik 21 2.1
VI. Moderne wertorientierte Volkspartei
 VI. Moderne wertorientierte Volkspartei 177 VI. Moderne wertorientierte Volkspartei 179 Die CSU ist die moderne wertorientierte Volkspartei Die CSU sieht sich in der Verantwortung für alle Menschen und
VI. Moderne wertorientierte Volkspartei 177 VI. Moderne wertorientierte Volkspartei 179 Die CSU ist die moderne wertorientierte Volkspartei Die CSU sieht sich in der Verantwortung für alle Menschen und
Kraft der Barmherzigkeit
 George Augustin Kraft der Barmherzigkeit Mensch sein aus den Quellen des Glaubens Matthias Grünewald Verlag Für die Schwabenverlag AG ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Maßstab ihres Handelns. Wir achten
George Augustin Kraft der Barmherzigkeit Mensch sein aus den Quellen des Glaubens Matthias Grünewald Verlag Für die Schwabenverlag AG ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Maßstab ihres Handelns. Wir achten
Wie könnte ein schulinternes Curriculum aussehen? Beispiel eines ausgeführten Schulcurriculums Beispiel für eine alternative
 Wie könnte ein schulinternes Curriculum aussehen?... 2 1. Beispiel eines ausgeführten Schulcurriculums... 2 2. Beispiel für eine alternative Strukturierung... 4 Wie könnte ein schulinternes Curriculum
Wie könnte ein schulinternes Curriculum aussehen?... 2 1. Beispiel eines ausgeführten Schulcurriculums... 2 2. Beispiel für eine alternative Strukturierung... 4 Wie könnte ein schulinternes Curriculum
Thomas Kesselring. Ethik der Entwicklungspolitik. Gerechtigkeit im Zeitalter der Globalisierung. C.H.Beck
 Thomas Kesselring Ethik der Entwicklungspolitik Gerechtigkeit im Zeitalter der Globalisierung C.H.Beck Inhalt Vorwort 9 Einleitung 11 Erster Teil Gerechtigkeit und Entwicklung Philosophische Debatten aus
Thomas Kesselring Ethik der Entwicklungspolitik Gerechtigkeit im Zeitalter der Globalisierung C.H.Beck Inhalt Vorwort 9 Einleitung 11 Erster Teil Gerechtigkeit und Entwicklung Philosophische Debatten aus
Schulinternes Curriculum Evangelische und Katholische Religionslehre
 Schulinternes Curriculum Evangelische und Katholische Religionslehre Jahrgang 6.1 1. Unterrichtsvorhaben Inhaltsfeld 3: Inhaltlicher Schwerpunkt: Einsatz für Gerechtigkeit und Menschenwürde Zukunftsgewissheit
Schulinternes Curriculum Evangelische und Katholische Religionslehre Jahrgang 6.1 1. Unterrichtsvorhaben Inhaltsfeld 3: Inhaltlicher Schwerpunkt: Einsatz für Gerechtigkeit und Menschenwürde Zukunftsgewissheit
GESCHICHTE DER SOZIALEN IDEEN 1M DEUTSCHEN KATHOLIZISMUS
 GESCHICHTE DER SOZIALEN IDEEN 1M DEUTSCHEN KATHOLIZISMUS VON FRANZ JOSEF STEGMANN UND PETER LANGHORST Gewidmet Oswald von Nell-Breuning (1890-1991), dem Nestor der katholischen Soziallehre, dessen Lebenswerk
GESCHICHTE DER SOZIALEN IDEEN 1M DEUTSCHEN KATHOLIZISMUS VON FRANZ JOSEF STEGMANN UND PETER LANGHORST Gewidmet Oswald von Nell-Breuning (1890-1991), dem Nestor der katholischen Soziallehre, dessen Lebenswerk
Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Jahrgangsstufe 6
 Unterrichtsvorhaben: Bilder des Glaubens Inhaltliche Schwerpunkte ( Inhaltsfelder) Sprechen von und mit Gott (IF2), Bibel als Ur-Kunde des Glaubens (IF3), Jesus der Christus (IF4) Lebensweltliche Relevanz:
Unterrichtsvorhaben: Bilder des Glaubens Inhaltliche Schwerpunkte ( Inhaltsfelder) Sprechen von und mit Gott (IF2), Bibel als Ur-Kunde des Glaubens (IF3), Jesus der Christus (IF4) Lebensweltliche Relevanz:
Wahrnehmungskompetenz. Die Schülerinnen und Schüler
 Inhaltsfeld 1: Entwicklung einer eigenen religiösen Identität : Gottesvorstellungen im Lebenslauf legen mit eigenen Worten subjektive Gottesvorstellung en dar, lebensgeschichtlic he Veränderungen von Gottesvorstellung
Inhaltsfeld 1: Entwicklung einer eigenen religiösen Identität : Gottesvorstellungen im Lebenslauf legen mit eigenen Worten subjektive Gottesvorstellung en dar, lebensgeschichtlic he Veränderungen von Gottesvorstellung
Arbeitsbeziehungen im Rheinischen Kapitalismus. Zwischen Modernisierung und Globalisierung
 Jürgen Hoffmann Arbeitsbeziehungen im Rheinischen Kapitalismus Zwischen Modernisierung und Globalisierung WESTFÄLISCHES DAMPFBOOT Inhalt Gewerkschaften in Deutschland: Jenseits gesellschaftlicher Hegemonie
Jürgen Hoffmann Arbeitsbeziehungen im Rheinischen Kapitalismus Zwischen Modernisierung und Globalisierung WESTFÄLISCHES DAMPFBOOT Inhalt Gewerkschaften in Deutschland: Jenseits gesellschaftlicher Hegemonie
Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaft
 Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaft Begründet von Joseph Höffner Herausgegeben von Marianne Heimbach-Steins Redaktion: Institut für Christliche Sozialwissenschaften NEU ASCHENDORFF VERLAG Ethische
Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaft Begründet von Joseph Höffner Herausgegeben von Marianne Heimbach-Steins Redaktion: Institut für Christliche Sozialwissenschaften NEU ASCHENDORFF VERLAG Ethische
Katholische Religion
 Fachcurriculum Katholische Religion Klassen 7 und 8 Ab Schuljahr 2006/07 Religion 7/8 Seite 1 1. Meine Stärken und Schwächen Leben lernen in Freiheit und Verantwortung Jeder hat Stärken und Schwächen können
Fachcurriculum Katholische Religion Klassen 7 und 8 Ab Schuljahr 2006/07 Religion 7/8 Seite 1 1. Meine Stärken und Schwächen Leben lernen in Freiheit und Verantwortung Jeder hat Stärken und Schwächen können
Anhang: Modulbeschreibung
 Anhang: Modulbeschreibung Modul 1: Religionsphilosophie und Theoretische Philosophie (Pflichtmodul, 10 CP) - Ansätze aus Geschichte und Gegenwart im Bereich der Epistemologie und Wissenschaftstheorie sowie
Anhang: Modulbeschreibung Modul 1: Religionsphilosophie und Theoretische Philosophie (Pflichtmodul, 10 CP) - Ansätze aus Geschichte und Gegenwart im Bereich der Epistemologie und Wissenschaftstheorie sowie
Islam Politische Bildung und interreligiöses Lernen
 Das Konzept Didaktisch aufbereitete Unterrichts- und Informationsmaterialien zum Thema : Loseblattsammlung mit ca. 1.000 Seiten in zehn Module gegliedert, fertige Unterrichtseinheiten zu politischen und
Das Konzept Didaktisch aufbereitete Unterrichts- und Informationsmaterialien zum Thema : Loseblattsammlung mit ca. 1.000 Seiten in zehn Module gegliedert, fertige Unterrichtseinheiten zu politischen und
Katholische Religionslehre, Schuleigener Lehrplan
 Clemens-Brentano-Gymnasium An der Kreuzkirche 7 48249 Dülmen Telefon 02594 4893 Telefax 02594 949908 sekretariat@cbg.duelmen.org schulleitung@cbg.duelmen.org cbg.duelmen.org Katholische Religionslehre,
Clemens-Brentano-Gymnasium An der Kreuzkirche 7 48249 Dülmen Telefon 02594 4893 Telefax 02594 949908 sekretariat@cbg.duelmen.org schulleitung@cbg.duelmen.org cbg.duelmen.org Katholische Religionslehre,
Freude und Hoffnung der Menschen teilen
 Freude und Hoffnung der Menschen teilen Katholische Moral und Ethik vor und nach dem Vatikanum II 1962-65 Paulus Akademie Zürich 3. Dezember 2012 Hans Halter, Luzern 1. Katholische Kirche vor Vatikanum
Freude und Hoffnung der Menschen teilen Katholische Moral und Ethik vor und nach dem Vatikanum II 1962-65 Paulus Akademie Zürich 3. Dezember 2012 Hans Halter, Luzern 1. Katholische Kirche vor Vatikanum
Liberalismus & Staatsverständnis
 Liberalismus & Staatsverständnis Christian Hoffmann 27.10.14 Absolutismus Der Naturzustand ist einer der Gesetzlosigkeit ("Krieg aller gegen alle", "der Mensch ist dem Menschen ein Wolf"). Menschen sind
Liberalismus & Staatsverständnis Christian Hoffmann 27.10.14 Absolutismus Der Naturzustand ist einer der Gesetzlosigkeit ("Krieg aller gegen alle", "der Mensch ist dem Menschen ein Wolf"). Menschen sind
Christliche Sozialethik und Moraltheologie
 CLEMENS BREUER Christliche Sozialethik und Moraltheologie Eine Auseinandersetzung mit den Grundlagen zweier Disziplinen und die Frage ihrer Eigenständigkeit 2003 Ferdinand Schöningh Paderborn München Wien
CLEMENS BREUER Christliche Sozialethik und Moraltheologie Eine Auseinandersetzung mit den Grundlagen zweier Disziplinen und die Frage ihrer Eigenständigkeit 2003 Ferdinand Schöningh Paderborn München Wien
Der religiöse Pluralismus Deutschlands und seine Auswirkungen auf den Religionsunterricht
 Pädagogik Klaudia Kock, geb. Buczek Der religiöse Pluralismus Deutschlands und seine Auswirkungen auf den Religionsunterricht Essay 1 Ruhr-Universität Bochum Bochum, den 14.02.2013 Katholisch-Theologische
Pädagogik Klaudia Kock, geb. Buczek Der religiöse Pluralismus Deutschlands und seine Auswirkungen auf den Religionsunterricht Essay 1 Ruhr-Universität Bochum Bochum, den 14.02.2013 Katholisch-Theologische
Diese Wirtschaft tötet (Papst Franziskus) und verletzt die Menschenrechte. Für eine Ökonomie des Lebens
 Diese Wirtschaft tötet (Papst Franziskus) und verletzt die Menschenrechte. Für eine Ökonomie des Lebens Wuppertal, 24.2.2016 Prof. Dr. Franz Segbers Universität Marburg 2 1. These: Es gibt auf der Ebene
Diese Wirtschaft tötet (Papst Franziskus) und verletzt die Menschenrechte. Für eine Ökonomie des Lebens Wuppertal, 24.2.2016 Prof. Dr. Franz Segbers Universität Marburg 2 1. These: Es gibt auf der Ebene
Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie in der Einführungsphase der Gesamtschule Aachen-Brand
 Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie in der Einführungsphase der Gesamtschule Aachen-Brand Stand: August 2014 Unterrichtsvorhaben I Eigenart philosophischen Fragens und Denkens - Was heißt es
Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie in der Einführungsphase der Gesamtschule Aachen-Brand Stand: August 2014 Unterrichtsvorhaben I Eigenart philosophischen Fragens und Denkens - Was heißt es
Schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan für das Fach. Katholische Religionslehre Klasse 8
 Schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan für das Fach Katholische Religionslehre Klasse 8 Stand: September 2017 Unterrichtsvorhaben: Wunder IF3: Bibel als Ur-Kunde des Glaubens an Gott, IF4: Jesus der Christus
Schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan für das Fach Katholische Religionslehre Klasse 8 Stand: September 2017 Unterrichtsvorhaben: Wunder IF3: Bibel als Ur-Kunde des Glaubens an Gott, IF4: Jesus der Christus
Unterrichtsinhalte Religion
 Unterrichtsinhalte Religion Jahrgangsstufe 5 Ankommen im Religionsunterricht/Freundschaft Schöpfung Abraham Mose Jesus Entdecken Verstehen Gestalten Ankommen im Religionsunterricht Schöpfung: Staunen Erkennen
Unterrichtsinhalte Religion Jahrgangsstufe 5 Ankommen im Religionsunterricht/Freundschaft Schöpfung Abraham Mose Jesus Entdecken Verstehen Gestalten Ankommen im Religionsunterricht Schöpfung: Staunen Erkennen
Walter Kardinal Kasper. Martin Luther. Eine ökumenische Perspektive. Patmos Verlag
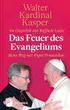 Walter Kardinal Kasper Martin Luther Eine ökumenische Perspektive Patmos Verlag Meiner Schwester Ingeborg von Gott am 28. Januar 2016 heimgerufen Inhalt Die vielen Lutherbilder und der fremde Luther 7
Walter Kardinal Kasper Martin Luther Eine ökumenische Perspektive Patmos Verlag Meiner Schwester Ingeborg von Gott am 28. Januar 2016 heimgerufen Inhalt Die vielen Lutherbilder und der fremde Luther 7
Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie
 Philosophie schulinternes Curriculum für die EF Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie - unterscheiden philosophische Fragen
Philosophie schulinternes Curriculum für die EF Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie - unterscheiden philosophische Fragen
Deutlicher. Wenn man sie mit anderen Techniken und Traditionen vergleicht
 Ole Gjems-Onstad Deutlicher Wenn man sie mit anderen Techniken und Traditionen vergleicht Die Beziehung zu Christus oder Gott Are Holen in Rishikesh, Indien: ACEM Meditation bringt einen nicht näher auf
Ole Gjems-Onstad Deutlicher Wenn man sie mit anderen Techniken und Traditionen vergleicht Die Beziehung zu Christus oder Gott Are Holen in Rishikesh, Indien: ACEM Meditation bringt einen nicht näher auf
Wohlfahrtsstaaten im Vergleich
 Wohlfahrtsstaaten im Vergleich Soziale SicherungsSysteme in Europa: Organisation, Finanzierung, Leistungen und Probleme Unter Mitarbeit von Martin Bräutigam, Viola Desideria Burau, Heike Henze, Heinz Ölke,
Wohlfahrtsstaaten im Vergleich Soziale SicherungsSysteme in Europa: Organisation, Finanzierung, Leistungen und Probleme Unter Mitarbeit von Martin Bräutigam, Viola Desideria Burau, Heike Henze, Heinz Ölke,
Pestalozzi-Gymnasium Unna im Januar Schulinternes Curriculum Praktische Philosophie für die Jahrgangsstufen 9 und 10 bzw.
 Pestalozzi-Gymnasium Unna im Januar 2010 Schulinternes Curriculum Praktische Philosophie für die Jahrgangsstufen 9 und 10 bzw. 8 und 9: Fragenkreis 1. Die dem Selbst Körper Leib Seele Freiheit ( obligatorisch)
Pestalozzi-Gymnasium Unna im Januar 2010 Schulinternes Curriculum Praktische Philosophie für die Jahrgangsstufen 9 und 10 bzw. 8 und 9: Fragenkreis 1. Die dem Selbst Körper Leib Seele Freiheit ( obligatorisch)
THEOLOGIE UND MENSCHENRECHTE
 THEOLOGIE UND MENSCHENRECHTE Theologische Berichte XXXI Herausgegeben im Auftrag der Theologischen Hochschule Chur von Michael Durst und der Theologischen Fakultät der Universität Luzern von Hans J. Münk
THEOLOGIE UND MENSCHENRECHTE Theologische Berichte XXXI Herausgegeben im Auftrag der Theologischen Hochschule Chur von Michael Durst und der Theologischen Fakultät der Universität Luzern von Hans J. Münk
Rede von Bundeskanzler Gerhard Schröder anlässlich der Verleihung des Heinrich-
 Rede von Bundeskanzler Gerhard Schröder anlässlich der Verleihung des Heinrich- Albertz-Friedenspreises durch die Arbeiterwohlfahrt am 2. August 2005 in Berlin Lieber Klaus, verehrter Herr Vorsitzender,
Rede von Bundeskanzler Gerhard Schröder anlässlich der Verleihung des Heinrich- Albertz-Friedenspreises durch die Arbeiterwohlfahrt am 2. August 2005 in Berlin Lieber Klaus, verehrter Herr Vorsitzender,
