Ernst Apeltauer: Anbahnen von Biliteralität im Rahmen von vorschulischen Sprachfördermaßnahmen
|
|
|
- Emil Pohl
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Ernst Apeltauer: Anbahnen von Biliteralität im Rahmen von vorschulischen Sprachfördermaßnahmen Wenn Kinder ohne oder mit geringen Deutschkenntnissen in eine KITA kommen und sie plötzlich mit der fremden Sprache (Deutsch) konfrontiert werden, müssen sie mit Nichtverstehen, mit vielen Irritationen und Frustrationen fertig werden. Solche Erfahrungen werden leichter verkraftet, wenn die Kinder über ausreichendes Selbstvertrauen und ein gutes Selbstwertgefühl verfügen. Selbstvertrauen und Selbstwertgefühle können gerade in der Anfangsphase durch Anerkennung und Wohlwollen vermittelt werden. Mit anderen Worten: Wir können diesen Kindern helfen, indem wir ihre Einfälle oder Ideen bewundern und ihnen so über ihre Anfangsschwierigkeiten hinweghelfen. Viele dieser Kinder sind gerade in der Anfangsphase darauf angewiesen. Damit die sprachliche Förderung solcher Kinder gelingen kann, sollten vor allem folgende Bedingungen erfüllt sein: Sprachförderkinder brauchen vertrauensvolle, gute Beziehungen und sie brauchen Erfolgserlebnisse und Anregungen zum Sprechen. 1 Erfolgserlebnisse lassen sich durch angemessene Lernaufgaben vermitteln, Anregungen zum Sprechen durch Zuwendung und die Bereitschaft zuzuhören. Doch was sind angemessene Lernaufgaben und wie kann man Zuhörbereitschaft signalisieren? Angemessene Lernaufgaben sind Lernaufgaben, die die Kinder bewältigen können, mit denen sie weder unter- noch überfordert werden. Es muss also überlegt werden, welche Aufgaben ein Kind aufgrund seines Entwicklungsstandes, seiner Fähigkeiten und Interessen schon bewältigen kann. Im sprachlichen Bereich bedeutet das, dass man wissen sollte, auf welcher sprachlichen Entwicklungsstufe ein Kind sich gerade befindet. Denn nur dann kann man auch angemessene sprachliche Aufgaben stellen. Kinder, die mit keinen oder nur geringen Deutschkenntnissen in eine Fördermaßnahme eintreten, benötigen zunächst eine Einhörphase, die, wenn keine deutschsprachigen Kinder in der Gruppe sind, ca. drei bis vier Monate, bei manchen Kindern auch neun und mehr Monate dauern kann (vgl. Apeltauer 2004). Während der Einhörphase sollten die Kinder ein einfaches und korrektes Deutsch hören, am besten von einer Fach- bzw. Lehrkraft oder auch von älteren deutschen Kindern. 2 Es können aber auch Medien (Hörbücher oder Kinderfilme zum Beispiel über Tiere) eingesetzt werden. Durch einen Medieneinsatz kann eine Fach- / Lehrkraft vorübergehend entlastet werden und Zeit zum Beobachten gewinnen. Anfangs geht es dabei weniger um Sprachbeobachtung. Denn die Zweitsprache muss sich ja erst entwickeln. Beobachtungen in frühen Phasen können uns aber helfen, Interessen und Präferenzen (lernt lieber mit anderen oder lieber alleine, will dominieren ) sowie bevorzugte Lernstrategien der einzelnen Kinder herauszufinden. Während der Einhörphase versuchen viele Kinder immer wieder sich mit Hilfe ihrer Erstsprache zu verständigen. Auch bei Wortschatzlücken wechseln sie noch häufig in ihre 1 2 Mit Sprechen ist dabei nicht Nachsprechen gemeint. Nachsprechen kann man etwas ohne innere Beteiligung. Man spricht dann auch vom Nachplappern (im Englischen: parroting ). Nachsprechen ist nur dann lernwirksam, wenn man etwas mitteilen will und eine angebotene Hilfe nutzt. Wird man dagegen zum korrekten Nachsprechen (ohne Mitteilungsabsicht!) gezwungen, ist das zumeist lernunwirksam. Dort, wo Fördermaßnahmen vor Schulbeginn in der Schule durchgeführt werden, könnten ältere deutsche Kinder (z. B. aus dem vierten Schuljahr) auch eine Patenschaft für einzelne Kinder übernehmen.
2 Erstsprache. Man hat herausgefunden, dass sich ein solcher Sprachwechsel nicht negativ auf den Zweitspracherwerbsprozess auswirkt. Im Gegenteil: Kinder, denen das gestattet wird, scheinen schneller zu lernen als Kinder, die einen Sprachwechsel zu vermeiden versuchen. 3 Je besser die Zweitsprache beherrscht wird, desto weniger wird auch zwischen den Sprachen gewechselt. M. a. W.: Mit zunehmendem Sprachstand nimmt die Tendenz zum Sprachwechsel ab. Erforderlichenfalls kann man Kinder auch daran erinnern, dass sie die richtigen Wörter in der Zweitsprache schon kennen. Kinder sollten während der Einhörphase nicht nur zuhören, sondern auch schon zum Mitsprechen oder Mitsingen angeregt werden. Sie sollten jedoch nicht dazu gezwungen werden, weil manche Kinder etwas mehr Eingewöhnungszeit brauchen, ehe sie sich zu entfalten beginnen. Wichtig ist, dass sie zuhören lernen und in Geschichten einbezogen werden. 4 Und natürlich sollten sie auch bei anderen Aktivitäten, zum Beispiel in Anweisungsspielen 5 oder bei Spaziergängen zum Mitmachen angeregt werden. Eine besondere Bedeutung haben in der Anfangszeit Rituale. Sie ermöglichen es, einen vertrauten Rahmen für erste Interaktionen herzustellen. In einem solchen Rahmen kann dann auch ein Basiswortschatz mit Hilfe von Anweisungs- und Benennungsspielen erarbeitet werden 6. Wichtig sind in der Anfangsphase sprachliche Formeln (z.. Guten Morgen, Tschüs, Wie heißt du? Wie heißt das? Was ist das? sag noch mal gib (mir), ich mag X, ). Solche Wörter und Wendungen (bzw. Formeln) sollten zyklisch wiederholt werden, damit sie sich einprägen und ihre Artikulation automatisiert wird. Es geht insbesondere am Anfang also nicht darum, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele neue Wörter zu vermitteln. Vielmehr geht es darum, durch viele variierende Wiederholungen das Einhören in die fremde Sprache zu erleichtern und erste Wörter und Formeln so zu automatisieren, dass sie ohne großes Nachdenken (d. h. automatisch) abgerufen werden können. Nur wenn Kinder sicher und schnell auf Anweisungen reagieren können, werden sie auch Lust haben, selbst Anweisungen zu erteilen und weitere zu lernen. Kurz: Am Anfang sollte durch eine geringe Progression 7 eine solide Grundlage für weitere Erwerbsprozesse geschaffen werden. Während der Einhörphase werden in der Regel nur wenige Wörter gelernt, weil die Kinder in dieser Zeit noch mit der Entwicklung des Hörverstehens und mit der Aussprache (Artikulation) beschäftigt sind. In dieser Zeit können auch neu eingeführte Wörter rasch wieder vergessen werden. Erst wenn die Einhörphase vorüber ist, beschleunigt sich die Wortschatzentwicklung allmählich Vgl. dazu Jeuk 2003 Man spricht von interaktivem Erzählen. Dazu wird ein Erzählvorgang durch lerneraktivierende Fragen unterbrochen, zum Beispiel: Und wie geht es weiter? oder Was würdest du an seiner Stelle machen? Erinnerst du dich an die Schwäne, die wir gestern gesehen haben? Also solche Schwäne gibt es in unserer Geschichte... vgl. dazu auch Apeltauer 2003 Darunter verstehen wir einfache Anweisungen wie komm, halt, setz dich, steh auf, dreh dich, geh, halt, setz dich. Am Anfang sollten nur vier bis fünf solcher Äußerungen vermittelt werden, z. B. steh auf, komm, halt, setzt dich. Wenn diese Anweisungen sicher verstanden werden, kann die Sequenz erweitert werden. Vgl. dazu auch Asher 1977 Es gibt inzwischen viele Spielesammlungen, in denen Benennungsspiele oder Spiele zur Wortschatzerweiterung zu finden sind. Solche Angebote sollte man sichten und überlegen, für welche Entwicklungsstufe sie geeignet sind und welche Erwerbsprinzipien dabei zum Einsatz kommen. Ausführlicher dazu Apeltauer 2007b Unter einer Progression versteht man Anforderungen, die an Lerner gestellt werden. Eine steile Progression im Wortschatzbereich bedeutet z. B. viele neue Wörter pro Tag, eine geringe Progression, wenige.
3 Welche Wörter und welche Formeln und Strukturen sollten am Anfang ausgewählt und vermittelt werden? Wer nichts mitzuteilen hat oder nichts mitteilen möchte, muss auch seine Lernersprache nicht weiterentwickeln. Nur die Kinder, die etwas mitteilen wollen, stoßen auch an ihre Ausdrucksgrenzen und werden versuchen, diese zu überwinden. Darum sind in der Anfangsphase Gespräche zwischen einer Fach- bzw. Lehrkraft und einem Kind so wichtig. Denn solche dialogischen Kooperationen können die Funktion einer Sprechlernhilfe 8 übernehmen. Gemeinsames, interaktives Erzählen oder Vorlesen kann in diesem Sinne zum Motor der Lernersprachentwicklung werden. Anders formuliert: Die Weiterentwicklung und Differenzierung von Äußerungen ist immer an Kommunikationsbedürfnisse gebunden. Sie gilt es zu provozieren, damit die Kinder eigenständig weiterlernen wollen und ihre Gesprächspartner (bzw. deren Ausdruckshilfen) zur Entfaltung ihrer Ausdrucksmittel nutzen. Dagegen kann das Üben formaler Strukturen demotivierend wirken, insbesondere dann, wenn funktionale Zusammenhänge (und damit die Relevanz für eigene Mitteilungsbedürfnisse) für die Lerner nicht unmittelbar erkennbar sind. Außerdem haben grammatische Übungen das hat man in verschiedenen Untersuchungen nachgewiesen keine Langzeitwirkung. Allenfalls können damit Strukturen, die von den Lernern bereits entdeckt, aber noch fehlerhaft gebraucht werden, korrigiert und stabilisiert werden. Dies gelingt vor allem dann, wenn solche Übungen in kommunikative Spiele eingebettet werden (vgl. dazu z. B. Spier 2002). Letztlich bestimmen die Lerner selbst, was und wie rasch sie etwas lernen. Darum sollten Kinder in Sprachfördermaßnahmen nicht zu etwas genötigt werden, was nicht in Reichweite ihrer Entwicklung liegt. Förderkräfte können das vermeiden, wenn sie etwas über die Lernersprachentwicklung wissen, d. h. wissen, in welcher Reihenfolge sprachliche Elemente erworben werden und auf welche Erwerbsprinzipien sich Kinder dabei stützen. 9 Damit Kinder ihre Zweitsprache entwickeln, benötigen sie aber nicht nur sprachlich anregende Situationen. Fachkräfte sollten auch wissen, was die einzelnen Kinder interessiert und welche Alltagserfahrungen sie gerade machen oder gemacht haben. Darüber können z. B. Eltern Auskunft geben. Man sollte darum versuchen, mit den Eltern /Müttern ins Gespräch zu kommen und sie nach Vorlieben, Eigenarten, Lerngewohnheiten, nach Interessen und Spielgefährten/-innen ihrer Kinder fragen. Wenn es gelingt, auf Erlebnisse oder Erfahrungen der Kinder Bezug zu nehmen oder Geschichten zu präsentieren, in denen diese Erfahrungen eine Rolle spielen oder Interessen der Kinder aufgegriffen werden, können die Lerner leichter Beziehungen zu ihrer eigenen Erfahrungswelt herstellen und neues Wissen in ihr bereits vorhandenes Weltwissen integrieren. Sie werden dadurch angeregt und motiviert und sie werden später auch bereit sein, über ihre Erfahrungen und Interessen zu sprechen. Zusätzlich sollte man mit Eltern auch über Geschichten sprechen, die im Rahmen der Fördermaßnahme behandelt werden sollen. Denn Eltern könnten solche Geschichten zuvor schon zu Hause in der Erstsprache erzählen oder vorlesen. Da die Kinder ihre Erstsprache meist besser beherrschen als ihre Zweit- oder Drittsprache Deutsch, können sie auch schneller und differenzierter verstehen. Darum sollten Geschichten zuerst in der starken Erstsprache erzählt oder vorgelesen werden. 8 9 In der angelsächsischen Literatur wird von scaffolding gesprochen. Ein scaffold ist ein Gerüst. Mit einem Dialog, der die Funktion einer Sprechlernhilfe hat, werden also stützende Aufgaben vom älteren (kompetenteren) Gesprächspartner übernommen, durch Einsagen oder Vorsagen aber auch durch Vervollständigen oder Wiederholen von Aussagen des Kindes in korrekter Form. Vgl. dazu auch Apeltauer 2007b
4 Wenn eine Geschichte in der Erstsprache erzählt wurde und die Kinder den Ablauf der Geschichte kennen und die Geschichte danach im Kindergarten wieder aufgegriffen wird, so fällt ihnen das Verstehen (auch in der Zweitsprache Deutsch) im Allgemeinen leichter als wenn eine Geschichte zum ersten Mal in der Zweitsprache Deutsch gehört wird. 10 Allerdings sollten Geschichten, die zuerst in der Erstsprache erzählt werden, später nicht nur als wörtliche Übersetzungen in der Zweitsprache vorgelesen werden, weil das für die Kinder auf Dauer langweilig wäre. Es empfiehlt sich hier, kleine Abweichungen oder Varianten in eine Geschichte einzubauen, damit die Kinder unterschiedliche Versionen einer Geschichte kennen lernen, eine in der Erstsprache und eine andere (leicht modifizierte) in der Zweitsprache. Dadurch bleiben solche Geschichten auch beim Wiedererzählen in der Zweitsprache interessant. Und die Kinder lernen zugleich, dass man Geschichten variieren kann, dass es erlaubt ist, neue Szenen zu erfinden oder weitere Personen einzuführen. Kurz: Sie lernen, dass man fabulieren kann und dass das Fabulieren Spaß machen kann, was auch für spätere Textproduktion von Bedeutung ist. Themen, die bearbeitet werden sollen, sollten die Kinder interessieren oder sie sollten sie mit Erfahrungen verbinden können. Das können z. B. Vögel sein oder Blumen, Schnecken oder Käfer, Baumrinde oder Moos. Ein Bezug zu ihrem unmittelbaren Erfahrungsbereich sollte immer explizit hergestellt werden. Wir haben oben darauf hingewiesen, dass in der Anfangsphase Formeln eine wichtige Rolle spielen. Lerner suchen in dieser Zeit nach Formeln, die sie funktional einsetzen können. Später bauen sie ihre Formeln in Äußerungen ein, so dass sie plötzlich von der Zwei- oder Dreiwortphase 11 in die Fünf- bzw. Sechswortphase zu wechseln scheinen. Wenn man genau hinhört, wird man aber schnell erkennen, dass die Äußerungen nur mit Hilfe von Formeln erweitert wurden. Beispiel: guck mal was ist das? oder ich weiß nicht das. 12 Wenn Formeln automatisiert und in das Lernersprachsystem integriert wurden und der Wortschatz weiter gewachsen ist, beginnen die Lerner in ihren Formeln einzelne Wörter zu identifizieren. Damit beginnt der Prozess des Aufbrechens und Variierens solcher Formeln. An Stellen, an denen ein bekanntes Wort auftaucht, kann nun versucht werden, ein anderes (ähnliches) Wort einzusetzen. Man hat beobachtet, dass Wortarten mit Hilfe solcher Formelabwandlungen bestimmt werden. Kinder experimentieren also regelrecht mit Wortmaterial und stellen fest, was sich an einer bestimmten Stelle einsetzen lässt. (1) Das ist (ein) Stift / Buch / schön 13 Mit anderen Worten: Die Lerner beginnen einzelne Formeln aufzubrechen und zu verändern. Dadurch bedingt erweitern sie ihre Ausdrucksmöglichkeiten rasch. Und sie beginnen nun auch ihr sprachliches Wissen zu erweitern, stellen z. B. fest, welcher Wortart ein Wort angehört und können so auch die dazugehörige Bedeutung leichter erschließen. Und sie sind im weiteren Verlauf dieser Phase auch in der Lage, Satzstrukturen zu erarbeiten. Fach- und Lehrkräfte, die solche Abwandlungen von Formeln beobachten, können dann beim Aufschreiben 14 nach anderen Formulierungen oder Wörtern fragen. 15 Und sie können 10 Das hat Rehbein in einem eindrucksvollen Versuch nachweisen können. Vgl. Rehbein Beim Spracherwerb unterscheidet man Äußerungslängen nach Wörtern: 1-2 Wortphase, drei- bis vier Wörter, mehr als vier Wörter. Gemeint ist damit, dass zu einem Zeitpunkt die Mehrzahl der Äußerungen dann z. B. drei oder vier Wörter aufweisen. 12 Formeln wie ich weiß nicht oder ich hab oder das ist X werden auf diese Weise in Äußerungen eingebaut. 13 Das eingeklammerte Wort wird anfangs oft ausgelassen. In einer Übergangsphase kommt es aber auch vor, dass Äußerungen wie das ist ein schön produziert werden.
5 Kinder auch zu spielerischer Manipulation von Ausdrücken anregen, zu Spielen mit Wörtern und Wortfolgen. Wer Kinder genau beobachtet und herausfindet, was sie bewegt und was sie in bestimmten Situationen sagen wollen, kann ihnen einfache und angemessene Wörter und Formeln anbieten, die von ihnen schneller aufgegriffen und dauerhafter gespeichert werden als sprachliches Material, das von Verlagsautorinnen und -autoren am grünen Tisch ausgewählt wurde. Dies gilt auch dann, wenn Verlage ihr Material erprobt haben. Denn diese Erprobungen haben i. d. R. mit anderen Kindern (womöglich mit anderen Erstsprachen) stattgefunden. In Fördermaßnahmen eingesetzte Fach- und Lehrkräfte müssen also erst ausprobieren, ob vorgefertigte Materialien das halten, was Verlagsprospekte versprechen. Im Übrigen sind selbst erstellte Materialien, die auf bestimmte Kinder zugeschnitten sind, immer besser als Fremdmaterialien. Bei der Herstellung solcher Materialien können Eltern helfen, wenn es gelingt, sie auf die Fördermaßnahmen neugierig zu machen und sie in diese Maßnahmen einzubeziehen. Dann können sogar Materialien erstellt werden, in denen auch die Erstsprache angemessene Berücksichtigung findet. 16 Nun kann man beobachten, dass Kinder Wörter oder Formeln, die ihnen vorgesagt werden, vereinfachen oder verkürzen. Da sagt eine Erzieherin z. B. sag das gehört mir und das Kind wiederholt: das mir. Solche reduzierten Formen sollten zunächst toleriert werden. Ursachen dafür können vielfältig sein. Dazu beitragen können u. a. Müdigkeit oder Stress. In der Regel werden solche Vereinfachungen oder Verkürzungen nach einiger Zeit den korrekten Formen angepasst, sofern die Fach- / Lehrkräfte - geduldig und freundlich - weiterhin die vollständigen Formen in Gegenwart der Kinder gebrauchen. Lerner vergleichen nämlich ihre Äußerungen mit den im Umfeld gehörten und passen sie an, sobald sie dazu in der Lage sind. Zwingt man sie hingegen zu früh zur Anpassung ihrer Äußerungen, so kann das Lerner demotivieren und Vermeidungsverhalten begünstigen. Wichtig ist, dass Kinder Interaktionssprache vor Beschreibungssprache lernen. Das bedeutet, dass der Basiswortschatz nicht nur aus Bezeichnungen für Gegenstände bestehen sollte (wie das durch Fördermaterialien oft suggeriert wird), sondern auch aus Formeln, die Aufforderungen ermöglichen wie komm her, setz dich, gib mir und aus Verbformen wie komm, halt, geh Kurz: Am Anfang sollte eine Sprache vermittelt werden, mit der Kinder handlungsfähig werden. Daneben sind für die Kinder vor allem Bezeichnungen für Utensilien wichtig, die für sie besondere Bedeutungen haben, z. B. Kleidungsstücke, Nahrungsmittel, Bücher, Stifte, Farben, Autos, Puppen, kurz: alles, was sie interessiert. Bezeichnungen für Dinge vermitteln zu wollen, die sie nicht interessieren, ist schwierig und begünstigt das Entstehen von Langeweile. Überall dort, wo sich Langeweile breit macht, geht Lernbereitschaft verloren. Sprachentwicklung fördern durch das Anbahnen von Literalität? Was bedeutet Literalität? Unter Literalität verstehen wir die Fähigkeit, schriftliche Texte aber auch Tabellen, Stadt- oder Fahrpläne, Gedichte oder Formeln sowie animierte Texte im Internet lesen und verstehen zu können. Und es gehört dazu auch die Fähigkeit zum Gemeint sind damit kollektive Diktate. Kinder erzählen über Erlebnisse oder Erfahrungen und die betreuende Fach- / Lehrkraft schreibt vor ihren Augen auf ein Plakat, so dass alle es sehen können. Anschließend liest sie vor und die Kinder prüfen, ob alles stimmt. So wird auf das Edieren schriftlicher Texte vorbereitet. Z. B.: Wie könnte man noch sagen? Wie könnte man anders sagen? Gibt es ein anderes / besseres Wort? Vgl. dazu Apeltauer 2006
6 Verfassen anspruchsvollerer Texte 17. Es wird vermutet, dass ca. 70 % der Unterrichtssprache auf schriftlichen Texten basiert, weshalb Schüler über eine gute schriftsprachliche Kompetenz verfügen sollten. Alltagssprache dient überwiegend der Regulation und Kontrolle zwischenmenschlichen Verhaltens. Sie ist einerseits flexibel einsetzbar, andererseits aber auch ungenau. Wenn Kinder mit ihrem Erstspracherwerb beginnen, orientieren sie sich zunächst an den interaktiven Funktionen und an emotionalen Aspekten ihrer ersten Sprache. Genauere begriffliche Bedeutungen oder logische Zusammenhänge werden i. d. R. erst später beachtet. Im Unterschied zur Alltagssprache ist Schriftsprache weniger kontextabhängig als Alltagssprache und sie weist gewöhnlich eine höhere Informationsdichte auf. Wir verwenden sie u. a. zum Explizieren und zum Analysieren, weshalb sie sich auch besser als Alltagssprache zum modellierenden Verarbeiten von Erfahrungen eignet. Man hat nachgewiesen, dass der Gebrauch einer differenzierten Sprache (und Schriftsprache ist in diesem Sinne eine differenzierte Sprache) Rückwirkungen auf das Vorstellungsvermögen von Lernern und auf deren Fähigkeiten zum schlussfolgernden Denken hat (vgl. Singer 2001, 7; vgl. auch Senghas/ Kita/ Özyürek 2004). Das bedeutet, dass ein früher Gebrauch von Schriftsprache (z. B. beim interaktiven Vorlesen oder beim kollektiven Diktat 18 ) auch Anregungen zur Entwicklung von Textkompetenz enthält und zudem eine gute Vorbereitung auf späteren Unterricht ist. Kinder entwickeln schon in einem sehr frühen Alter Interesse an Geschriebenem. Sie scheinen sogar in der Lage, sich Schreibfertigkeiten spontan anzueignen, wenn sie entsprechende Vorbilder haben. 19 Die schwedische Kindersprachforscherin Söderbergh hat schon vor vielen Jahren beobachtet, dass Kinder bereits im Alter von zwei bis drei Jahren Freude und Lust beim Lesen und Schreiben erfahren. Mit vier oder fünf Jahren verfügen Kinder über Grundkenntnisse in ihrer Erstsprache und es werden nun von ihnen zunehmend auch begriffliche und logische Zusammenhänge wahrgenommen und rekonstruiert. Die Frage, die sich nun stellt, lautet: Könnte man dieses erwachende Interesse an Schriftsprache und an begrifflichen und logischen Zusammenhängen für den Zweitspracherwerb und die Vermittlung von allgemeinem Weltwissen nutzen? Für das Anbahnen von Literalität im Rahmen von Fördermaßnahmen lassen sich aber auch lernpraktische Gründe anführen. So können schriftliche Texte durch Vorlesen beliebig oft reproduziert werden, wodurch die Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung des dargebotenen Sprachmaterials erleichtert wird. Außerdem dienen die Handlungsstränge von Geschichten als Merkhilfen, weil man sich Wörter in solchen Kontexten leichter merken kann als isoliertes Wortmaterial. Und wenn Lerner zu einem kollektiven Diktat angeregt werden, entsteht bei ihnen ein erstes Bewusstsein für unterschiedliche sprachliche Formen. In solchen Kontexten können Lerner auch zum Abwägen von Wörtern (bzw. Wortbedeutungen) angeregt werden, wenn z. B. ein Erlebnis genau beschrieben (bzw. diktiert) werden soll, aber 17 In Deutschland findet man in der Fachliteratur sowohl die Bezeichnungen Literacy als auch die Bezeichnung Literalität. Mit Literacy wird gewöhnlich auf Kulturtechniken wie Lesen und Schreiben verwiesen (vgl. z. B. Uhlich 2003, Wieler 2003 ). Literalität wird von uns hier in einem weiteren Sinne gebraucht. Wir verstehen darunter auch den Umgang mit kognitiv anspruchsvollen, dekontextualisierten Texten sowie das damit verbundene Generieren und Transformieren von Wissen (vgl. dazu auch Kern 2000, 29 ff.). 18 Damit ist gemeint, dass ein Kollektiv (d. h. Kinder einer Gruppe aber auch einzelne Kinder) einer Erzieherin sagen, was sie schreiben soll. So kann z. B. ein Brief an ein krankes Kind gemeinsam verfasst werden. 19 Vgl. dazu Scollon / Scollon 1981
7 auch zum Reflektieren formalsprachlicher Aspekte. Kurz: Das Anbahnen von Literalität scheint bei Vorschulkindern eine sinnvolle Möglichkeit zu bieten, um sprachliche Fertigkeiten zu vermitteln sowie ein Bewusstsein für sprachliche Korrektheit und für Unterschiede zwischen gesprochener und geschriebener Sprache zu entwickeln. Gleichzeitig werden in diesem Rahmen auch (Vorläufer-)Fertigkeiten für den Schriftspracherwerb vermittelt, die später ein erfolgreiches Durchlaufen der Schule erleichtern. Das Anbahnen von Literalität, d. h. die Entwicklung von Vorläuferfertigkeiten für diesen Bereich, wurde in Deutschland erst in den letzten Jahren im Zusammenhang mit Fördermaßnahmen diskutiert und teilweise auch schon in solche einbezogen (vgl. Apeltauer 2003, 2004; Ulich/Mayr 2003). Die Tradition der Frühförderung gibt es in einzelnen ethnischen Gruppen aber schon sehr viel länger: Jüdische Knaben werden oft schon im Alter von drei Jahren zur Schule geschickt, und es kam selten vor, dass sie mit sechs nicht schon lesen und schreiben konnten. (Rosten 2002, 134 f.) Der Presse konnte man in den letzten Jahren entnehmen, dass chinesische Zuwanderer in Vancouver 20 (Kanda) ihre Kinder schon mit drei Jahren chinesische Schriftzeichen lernen lassen, so dass sie also in ihrer Erstsprache weitgehend alphabetisiert sind, wenn sie in die Schule kommen. Und die bekannte schwedische Kindersprachforscherin Söderbergh hat schon vor Jahren darauf hingewiesen, dass es einfacher für ein Kind ist, lesen zu lernen, wenn es zwei Jahre alt ist, als wenn es sieben Jahre alt ist. Lesenlernen, so Söderbergh, macht Kindern in diesem Alter Spaß, ist ein Spiel und ein Abenteuer und sonst nichts (vgl. Söderbergh 1988). Es gibt noch ein weiteres Argument, weshalb eine frühe Anbahnung von Literatlität sinnvoll erscheint. Eine Wissensgesellschaft braucht Mitglieder mit einer hohen schriftsprachlichen Kompetenz. Zur Entwicklung von Literalität in einer fremden (bzw. zweiten) Sprache braucht man aber viel Zeit und Übungsmöglichkeiten. Neuere Untersuchungsergebnisse belegen, dass dafür fünf bis sechs Jahre zu veranschlagen sind (vgl. Verhoeven 2003, 168). Nun könnte man einwenden, dass es sinnvoller wäre, wenn Kinder zuerst in ihrer starken Sprache 21 alphabetisiert würden. Denn Interesse für Zeichen und Schrift (z. B. auf Etiketten) entsteht lange vor dem sechsten Lebensjahr. Und natürlich werden solche Interessen eher in der starken Sprache (gewöhnlich der Erstsprache) als in der kaum oder nur rudimentär beherrschten Zweitsprache geäußert. Wäre es also besser, wenn eine Alphabetisierung zuerst in der Erstsprache stattfinden würde? Dagegen spricht, dass viele Zuwandererfamilien zur Gruppe der sog. low SES-Familien 22 gehören. In diesen Familien spielen Lesen und Schreiben gewöhnlich keine oder nur eine untergeordnete Rolle. Man kann von solchen Eltern nicht automatisch eine Unterstützung beim Anbahnen von Literalität erwarten. Vielmehr sollten solche Eltern zunächst einmal über die Funktionen von Literalität in unserer Gesellschaft informiert und evtl. auch angeleitet werden, wie sie Vorläuferfähigkeiten für Literalität in der Muttersprache anbahnen können. Dadurch, dass sie ihr Wissen über Zweitspracherwerbsprozesse erweitern und lernen, wie 20 Das sind i. d. R. gut situierte Geschäftsleute, die aus Hongkong zugewandert sind. Sie wollen, dass ihre Kinder die wichtigsten chin. Schriftzeichen beherrschen und sind bereit, dafür viel Geld zu zahlen. 21 Die starke Sprache ist die Sprache, in der man schneller verstehen und sich besser ausdrücken kann. Im Gegensatz dazu erfordert die schwache Sprache mehr Konzentration (d. h. sie ist weniger automatisiert). Sie ist durch Zusatzgeräusche leichter störbar und es fällt meist schwerer, sich darin so differenziert auszudrücken wie in der starken Sprache. 22 SES bedeutet sozio-ökonomischer Status, d. h. also Bildungsvoraussetzungen der Eltern und das Einkommen, das bei low SES meist niedrig ist, wenn eine angelernte Tätigkeit ausgeübt wird.
8 sie die sprachliche Entwicklung ihrer Kinder (z. B. durch interaktives Vorlesen von Gutenachtgeschichten) anregen können, werden sie zu Kooperationspartnern und Helfern für Erzieherinnen und Lehrkräfte. Was für die Eltern gilt, gilt natürlich auch für Fach- und Lehrkräfte. Auch ihnen müssen Weiterbildungsangebote gemacht werden, damit sie besser verstehen können, warum im Rahmen von Sprachfördermaßnahmen das Anbahnen von Literalität sinnvoll ist. Ein paar Aspekte sollen hier herausgegriffen werden. 23 Die Vermittlung der Zweitsprache genügt nicht, um diese Kinder schulfähig zu machen. Denn Kindern benötigen vor Schuleintritt zusätzliches Weltwissen, weil fehlendes Wissen später nur schwer kompensierbar ist (vgl. Kretschmann / Rose 2002; Stern 2003, 11). Weil Weltwissen über die Erstsprache schneller und differenzierter aufgenommen und verarbeitet werden kann als über eine erst im Aufbau befindliche Zweitsprache, sollte die Erstsprache gezielt zur Vermittlung von Weltwissen genutzt werden. Das bedeutete: Eltern sollten von Anfang an in die Fördermaßnahmen einbezogen werden (vgl. Apeltauer 2006a). Im Sinne einer Stärkung des Selbstbewusstseins der Zuwanderer sollte die Erstsprache und -kultur auch im Kindergarten einen Platz haben. Eltern sollten durch Aufklärungs- und Bildungsarbeit dazu angeregt werden, ihren Kindern Literalitätserfahrungen in der Erstsprache zu ermöglichen. Dadurch kann auch die Entwicklung der Erstsprache weiter angeregt werden. Bei der Vermittlung eines Wortschatzes in der Zweitsprache sollte darauf geachtet werden, dass nicht isolierte Wörter mit Einzelbedeutungen vermittelt werden, sondern Wörter mit ihren Interaktions- oder Erzählkontexten. Und die Kinder sollten auch lernen, dass sich Bedeutungen mit wechselnden Kontexten ändern können (vgl. Apeltauer 2006c). Untersuchungen haben gezeigt, dass zur Kommunikation in der Zweitsprache Formeln verwendet werden. Mit ihrer Hilfe können Wortartzugehörigkeiten, syntaktische Strukturen und morphologische Besonderheiten der Zielsprache erschlossen werden (vgl. Peters 1983, Aguado 2001). Darum sollten lernerspezifische Formeln 24 vorübergehend toleriert und konventionalisierte sprachliche Formeln vermittelt werden. Als Vorbereitung auf die Schule, aber auch aus lernpraktischen Gründen sollte ein Schwerpunkt der sprachlichen Förderung im Bereich Literalität liegen. Denn Literalitätserfahrungen haben Rückwirkungen auf die Sprachverarbeitung und den Sprachgebrauch, weil zum Verstehen von geschriebener Sprache stärker als zum Verstehen gesprochener Sprache Strukturieren, Verweisen und Verknüpfen von Informationen gehört. Vorschulkinder verfügen i. d. R. über eine kürzere Konzentrationsspanne als ältere Kinder. Sie sind aber in der Lage, sich längere Zeit zu konzentrieren, wenn 23 Die folgenden Überlegungen liegen der Sprachförderung im Kieler Modell zugrunde, dessen wiss. Konzeption von mir initiiert wurde und das ich von wissenschaftlich begleitet habe. 24 Solche Formeln sind oftmals Vereinfachungen, die aber vorübergehend ihren Zweck erfüllen, z. B. Was das? statt Was ist das? Formeln, die vermittelt wurden waren z. B. sag noch mal, sag langsam, kannst du mir helfen? du bist dran...
9 sie eine Sache interessiert. Darum sollten Interessen der Kinder ermittelt und im Rahmen der Fördermaßnahmen entsprechende Themen aufgegriffen und Angebote (z. B. für Kleingruppenarbeit 25 ) gemacht werden. Ergänzend dazu sollten Lernstationen eingerichtet werden, die von den Kindern der Gruppe interessengeleitet aufgesucht und genutzt werden können. So sollten die Kinder - parallel zu den thematischen Angeboten in der Großgruppe 26 und den Fördermaßnahmen in den Kleingruppen - Themen auch eigenständig bearbeiten und vertiefen können. Ein Grundprinzip bei Fördermaßnahmen sollte darin bestehen, dass neben den traditionellen Rahmenthemen und Situationen, die in KITAs bearbeitet werden, besonders darauf geachtet wird, ob Kinder spontan Interessen bekunden, ob sie eigene Spiele entwickeln oder auf Entdeckungsreisen gehen. Denn daran kann in den Fördermaßnahmen angeknüpft werden. Spiele sollte man sorgfältig beobachten, aber möglichst nicht stören. Denn Erwachsene verstehen die Spiele von Kindern oft falsch. Ihr Eingreifen kann ein Spiel zerstören. Erwachsene können Spiele aber bewundern und Kindern dadurch Freude und Selbstvertrauen vermitteln. Und schließlich ist die Freude am Entdecken groß und die Freude über selbst entdeckte Fähigkeiten sogar noch größer. Gerade darüber kann man anschließend wunderbar sprechen. Darum sollten spontane Äußerungen oder Einfälle der Kinder sorgfältig beobachtet und gesammelt (u. U. auch auf einem bereitliegenden Blatt notiert) werden. Wenn es gelingt, Ideen oder Wünsche der Kinder im Rahmen von Fördermaßnahmen aufzugreifen, werden sie leichter und ausdauernder lernen. Denn Tätigkeiten, die von den Kindern selbst initiiert werden, vermögen sie stärker zu motivieren als von Erwachsenen vorgegebene Aktionen. Und das Entdecken eigener Fähigkeiten stärkt ihr Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. Ein solches Eingehen auf Interessen und Präferenzen der Kinder ist natürlich nur dort möglich, wo Fördermaßnahmen nicht in Form von Einzelstunden gegeben werden müssen. Wenn Fördermaßnahmen in den Kita-Alltag integriert werden können, kann auf Interessen der Kinder besser eingegangen werden und es können Kleingruppen interessengeleitet betreut werden. Dadurch wird eine intensivere Interaktion und Betreuung möglich, als in durchgeplanten und am traditionellen Fremdsprachenunterricht orientierten Förderstunden. Wie sollte beim Anbahnen von Literalität verfahren werden? Es gibt dazu zwei unterschiedliche Ansätze: 27 Einen fertigkeitsorientierten Ansatz und einen Ansatz, der ein ganzheitliches Vorgehen bevorzugt. Vertreter des fertigkeitsorientierten Ansatzes gehen davon aus, dass zuerst Dekodierungsfähigkeiten fokussiert werden müssen. 28 Es sollte also die Zuordnung von Lauten zu Buchstaben vermittelt werden und diese dann zu Morphemen, Lexemen und Bedeutungen zusammengesetzt werden. Kurz: 25 Ein Thema einer solchen Interessengruppe lautete z. B. Schnecken. Sechs Kinder aus der Kieler Modellgruppe haben dazu drei Wochen lang Schnecken gesammelt, beobachtet und sich über Schnecken informiert. Es wurden während dieser Zeit auch Fotos gemacht. Zum Abschluss diktierten die Kinder der Fachkraft kurze Texte zu einzelnen Fotos. Daraus entstand ein Schnecken-Buch. 26 Dazu gehören die üblichen Aktivitäten: Kennenlernspiele (mit Luftballons), Handabdrücke machen, Lieder singen, mit Fingerfarbe malen und Bilder ans Fenster hängen, Körperspiele, Zungenspiele, Geburtstag feiern, Jahreszeiten, Zahnpflege, Besuch in der Stadtteilbücherei (mit Müttern) etc. 27 vgl. dazu Kucer 2005, 291 ff. 28 Zu diesem Ansatz gehört auch das Training der phonologischen Bewusstheit.
10 Literalitätsentwicklung wird als deduktiver Prozess organisiert von kleinsten zu immer größer werdenden Einheiten. Ein solches Vorgehen ist möglich, wenn alle Wörter, die zerlegt oder aus Einzellauten (bzw. Buchstaben) zusammengesetzt werden sollen, bereits bekannt und automatisch abrufbar sind. Mit anderen Worten: Sie eignen sich für monolinguale Kinder mit einem größeren Wortschatz. Für Kinder mit Migrationshintergrund, die mehrheitlich in ihrer Zweitsprache über einen kleineren Wortschatz verfügen, ist dieser Ansatz eher ungeeignet. Im Unterschied dazu wird beim ganzheitlichen Ansatz (den i. d. R. Erzieherinnen bevorzugen) davon ausgegangen, dass Sprachenlernen ein kollaborativer Prozess der Bedeutungskonstruktion und des Bedeutungsaushandelns ist, in dessen Verlauf von einem Ganzen (z. B. einer Erzählung) auf induktivem Wege zu immer kleineren Teilen übergegangen wird. Durch interaktives Erzählen oder Vorlesen werden Bedeutungen mit Hilfe von Gestik und Mimik verständlich gemacht, werden Wörter erforderlichenfalls auch wiederholt oder paraphrasiert, werden zusätzlich Fragen zur Erzählung gestellt und so zum Mitdenken und zum Mitmachen angeregt. 29 Dadurch soll eine Erzählung mit möglichst vielen Sinnen erfassbar werden. Merkmale eines solchen Vorgehens sind: - langsames, betontes Erzählen oder Vorlesen unter Einsatz von Mimik und Gestik - Fragen zum Mitdenken und Mitmachen (z. B. Wie könnte es weiter gehen? Was könnte er/sie jetzt tun? ) - das Visualisieren von Inhalten mit Hilfe von Gegenständen oder Bildern - ein gestalterisches Reproduzieren (z. B. Malen von Helden oder Szenen, Verkleiden und spontanes Nachspielen von einzelnen Szenen) - kollektive Diktate (Kinder erzählen gemeinsam eine ihnen bekannte Geschichte oder berichten über Erlebnisse z. B. auf einem Spaziergang. Das Diktat wird in Form eines Plakats im Raum aufgehängt, so dass es immer wieder in den Morgenkreis einbezogen werden kann) - das Inszenieren einer Geschichte, die oft gehört oder vorgelesen wurde, z. B. für Eltern (evtl. dokumentiert durch Fotos oder Videoaufnahmen) Dieser Ansatz wird inzwischen erfolgreich zur Vermittlung fremd- und zweitsprachlicher Kenntnisse genutzt. 30 Zur Anbahnung von Literalität im Kieler Modell Eines unserer Ziele war es, den Kindern positive Erfahrungen mit Lesen und Schreiben zu vermitteln. Die Kinder sollten merken, dass Lesen Spaß machen kann und dass beim Lesen und Schreiben andere sprachliche Formen gebraucht werden als beim Sprechen. Und weil es in der Gruppe keine deutschen Spielkameradinnen und -kameraden gab, sollten zusätzlich Lern- bzw. Medienstationen eingerichtet werden, die die Kinder je nach Interessen aufsuchen und nutzen können sollten. Dazu wurden eingerichtet eine Bücher- und Leseecke mit einem Bücherregal und bequemen Sitzgelegenheiten; im Bücherregal waren sowohl türkische als auch deutsche Kinderbücher zu finden; alle Bücher waren ausleihbar Ausführlicher dazu Apeltauer 2003 sowie Vgl. dazu z. B. das Förderprogramm Hocus & Lotus von Taeschner u. a., dessen Effektivität wissenschaftlich evaluiert wurde oder das Kieler Modell (vgl. Apeltauer 2004). 31 In die deutschen Bücher wurde auf jeder Textseite ein türkischer Text eingeklebt, damit Eltern, die in den Kindergarten kamen und Zeit und Lust hatten, auf Türkisch vorlesen konnten. Zusätzlich wurde für Eltern
11 eine CD-Station mit zwei Funkkopfhörern zum Abhören von Kinderliedern, Reimen, Zungenbrechern und Hörbüchern 32 eine Schreib- und Malecke mit entsprechenden Utensilien eine Magnettafel mit Buchstaben, wo die jüngeren Kinder mit Hilfe der Buchstaben Muster legten und die älteren Kinder damit begannen, ihre Namen zu schreiben 33 eine Wandzeitung, auf der kollektive Diktate (z. B. vom Waldspaziergang oder ein Brief an ein krankes Kind) festgehalten und besondere Erlebnisse mit Fotos und Zeichnungen dokumentiert wurden Computer mit dem Lernprogramm Schlaumäuse auf Wunsch der Kinder wurden Briefkästen für die Kinder hergestellt 34 in einem Kleingruppenraum wurden zudem zwei bis drei Kinder an drei Vormittagen pro Woche von jeweils einer der beiden teilnehmenden Beobachterinnen (TB, Doktorandinnen) und von einer Lesepatin betreut Neben der Bücher- und Leseecke gab es also einen Kleingruppenraum, in den die TB sich mit ein bis zwei, zuweilen auch mit drei Kindern zurückziehen konnten, um dort interaktiv vorzulesen oder auch zu spielen und Tonaufnahmen zu machen. An einem Vormittag pro Woche übernahm diese Arbeit die bilinguale (türkisch-deutsche) TB, die sich mit den Kindern (vor allem während der ersten Monate) in der Erstsprache Türkisch unterhielt und auch zunächst in dieser Sprache erzählte und vorlas. Mit zunehmendem Sprachstand in der Zweitsprache Deutsch wurde jedoch auch von ihr mehr und mehr auf Deutsch vorgelesen und kommentiert. An einem zweiten Vormittag wurden die Kinder von einer deutschen TB betreut, die über keine Türkischkenntnisse verfügt, so dass die Kinder mit ihr von Anfang an nur Deutsch sprechen konnten. Das Deutschsprechen wurde allerdings dadurch erleichtert, dass die von den Kindern gewählten Geschichten oder Bücher 35 meist schon in der Erstsprache behandelt worden waren. Gewöhnlich kam an einem weiteren Vormittag in der Woche eine Lesepatin und gingen ebenfalls auf die Vorlesewünsche (bzw. Bücherwünsche) türkische Unterhaltungsliteratur beschafft, so dass auch Eltern Bücher ausleihen konnten. Eltern sollten zu Hause eine Vorbildfunktion übernehmen können. 32 Von den Lieblingsbüchern der Kinder wurden Hörbücher hergestellt. Die meisten deutschen Hörbücher wurden von den Erzieherinnen der Gruppe und deren Bekannten besprochen, die türkischen Versionen der Hörbücher von türkischen Eltern, teilweise auch von älteren Geschwistern der Kinder. Die Verweildauer an dieser Station war anfangs nur kurz (ca. 5 Minuten pro Tag). Später stieg die Verweildauer auf 15 bis 20 Minuten pro Tag. Manche Kinder hörten ein Hörbuch mehrmals am Tag konzentriert an und sprachen dabei halblaut mit, ohne dass sie je dazu aufgefordert worden wären. 33 Es dauerte nicht lange, bis die Kinder entdeckt hatten, dass es keine türkischen Buchstaben gibt, sie ihre Namen also nicht immer korrekt schreiben konnten. Die Eltern haben schnell Abhilfe geschaffen. Nach kurzer Zeit hatten wir neben den deutschen Buchstaben auch (von den Eltern gefertigte) türkische Buchstaben. 34 Kinder hatten gesehen, dass die Eltern einen Briefkasten vor dem Gruppenraum hatten. Sie wollten auch Briefkästen. Nachdem diese nach ihrer Anweisung hergestellt worden waren, malten oder zeichneten sie Postkarten und versahen sie mit ihrer Unterschrift, einem (oder mehreren) Buchstaben, teilweise auch schon mit ihrem Namen oder einem Krakel und steckten diese Karte dann in den Briefkasten einer Erzieherin. Diese musste darauf antworten. Wenn sie es vergaß, wurde sie von den Kindern daran erinnert. 35 Die Kinder durften in die Kleingruppe Bücher mitbringen, die gemeinsam betrachtet und aus denen vorgelesen werden sollte.
12 der Kinder ein. Und natürlich hatten auch die beiden Erzieherinnen die Möglichkeit, sich bei Bedarf mit einer Kleingruppe in diesen Raum zurückzuziehen. 36 Fazit Was haben die Kinder der Modellgruppe gelernt? Was fiel den Lehrkräften, was uns als teilnehmenden Beobachtern auf, als die Kinder eingeschult wurden? Die Kinder waren beim Schuleintritt in der Lage, ihre Zweitsprache (Deutsch) flüssig zu sprechen. Sie konnten komplexe syntaktische Strukturen gebrauchen (z. B. dass-sätze, Konditionalsätze, Relativsätze). Sie haben einzelne Verben verwendet, deren Gebrauch bei deutschen Kindern erst im zweiten Schuljahr belegt ist. Sie haben zuzuhören gelernt und sie lassen andere ausreden, halten sich also an Gesprächsregeln. Sie haben gelernt, Fragen zu stellen und sie sind in der Lage, selbstständig zu arbeiten. Sie helfen sich gegenseitig, verfügen über eine höhere Leistungsbereitschaft als die meisten ihre Klassenkameradinnen und -kameraden und sie verfügen auch über eine größere Konzentrationsspanne als die anderen Kinder. 37 Sie sprechen deutlich. Die meisten von ihnen konnten schon nach wenigen Wochen lesen. Sie leihen häufiger Bücher aus als die anderen Kinder. Und sie verbinden Bücher mit etwas Positivem, mit lernen, sich unterhalten und gemütlich machen. 38 Im Unterricht selber stoßen sie dennoch an Grenzen. Es gibt Objekte, die ihnen unbekannt sind und für die sie daher auch keine Bezeichnungen kennen, z. B. Fuchs, Schlips oder Raspel. 39 Der Fuchs wurde von einem der Kinder als Katze bezeichnet, von einem anderen als Hund und von einem dritten als Wolf. Das Wort Fuchs hatten die Kinder etwa ein Jahr zuvor im Kindergarten zwar kennen gelernt. Es war aber offenbar bei keinem der Kinder dauerhaft gespeichert worden. Mit der Raspel hatten auch Lehrkräfte Probleme. Einige der von uns befragten Lehrkräfte bezeichneten das abgebildete Objekt als Feile. Und ein Schlips ist ein Kleidungsstück, das die Kinder aus ihrem häuslichen Umfeld nicht kennen. 40 Hinzu kommen sprachliche Formen und Konstruktionen, die ihnen noch nicht vertraut sind, z. B. Präteritumformen (.. wog so viel wie...), Steigerungsformen (Einer der größten...), komplexe Wortbildungen (z. B. Peitschenschwanz) und für die Kinder weniger gebräuchliche Wörter (z. B. verteidigen). Auch Funktionswörter (Präpositionen und Konjunktionen) sowie Genusformen (bzw. Artikel) werden selbst nach zweieinhalb Jahren Sprachfördermaßnahmen noch nicht sicher beherrscht. Kurz: Die Kinder der Modellgruppe müssen noch mit sprachlichen Problemen kämpfen, die für monolinguale Kinder nicht existieren. Diese sprachlichen Probleme werden zweifellos anwachsen, wenn sie im Laufe ihrer Schulzeit keine sprachliche Förderung mehr erhalten. 36 Eine dieser Erzieherinnen war ebenfalls bilingual (Türkisch und Deutsch), die zweite Erzieherin hatte Grundkenntnisse im Türkischen, konnte also etwas von dem, was die Kinder auf Türkisch sagten, verstehen. Genauere Informationen dazu findet man in Apeltauer 2004 und Die Kinder der Gruppe wurden an zwei unterschiedlichen Schulen eingeschult. 38 So die Kommentare der Kinder bei einer Befragung im März Ein Arbeitsblatt, auf dem die Kinder bestimmen sollten, wie ein abgebildetes Objekt heißt, ob ein S-Laut am Anfang, in der Mitte oder am Ende des Wortes steht. 40 Keiner der Väter besitzt einen Schlips.
13 Literatur Aguado, Karin 2002: Formelhafte Sequenzen und ihre Funktion für den L2-Erwerb. In: Zeitschrift für angewandte Linguistik 37, Apeltauer, E. 2003: Literalität und Spracherwerb. In: Flensburger Papiere zur Mehrsprachigkeit und Kulturenvielfalt im Unterricht, H. 32 [33 Seiten] Apeltauer E. 2004: Sprachliche Frühförderung von zweisprachig aufwachsenden türkischen Kindern im Vorschulbereich; Flensburg [Sonderheft 1 der Flensburger Papiere zur Mehrsprachigkeit und Kulturenvielfalt im Unterricht, 180 S.] Apeltauer, E. 2005: Sprachlerndispositionen - eine Alternative zu Sprachtests im Vorschulalter? In: Frühes Deutsch, 2004, H 2, Apeltauer, E. 2006a: Kooperation mit zugewanderten Eltern. Flensburger Papiere zur Mehrsprachigkeit und Kulturenvielfalt im Unterricht, H 40/41 [55 S.] Apeltauer, E. 2006b: Förderprogramme, Modellvorstellungen und empirische Befunde. Zur Wortschatz- und Bedeutungsentwicklung bei türkischen Vorschulkindern. In: Ahrenholz, Bernt Hg.: Kinder mit Migrationshintergrund, Spracherwerb und Fördermöglichkeiten; Freiburg (Fillibach), Apeltauer, Ernst 2006c: Bedeutungsentwicklung bei zweisprachig aufwachsenden türkischen Vorschulkindern. In: Ahrenholz, B./ Apeltauer, E. Hrsg.: Zweitspracherwerb und curriculare Dimensionen, Empirische Untersuchungen zum Deutschlernen in Kindergarten und Grundschule; Tübingen (Stauffenburg) Apeltauer, E. 2007a: Sprachliche Frühförderung von Kindern mit Migrationshintergrund. In: Info DaF 1/2007, Apeltauer, E. 2007b: Grundlagen frühkindlicher Sprachförderung [im Druck] Apple, M 1999: Power, Meaning and Identity: Essays in Critical Educational Studies; New York. Frankfurt/M (Lang) Asher, J. J. 1977: Learning another Language through Actions; Los Gatos (sky oak) Baur, R. S. / Meder, G. 1989: Die Rolle der Muttersprache bei der schulischen Sozialisation ausländischer Kinder. In: Diskussion Deutsch 1989, 106, Jeuk, Stefan 2003: Erste Schritte in der Zweitsprache Deutsch (Diss.); Freiburg (Fillibach) Kern, R. 2000: Literacy and Language Teaching; Oxford (Uni Press) Kretschmann, R., / Rose, A. M. 2002: Starthilfen zum Schulanfang. Überlegungen zu einer verstärkten Zusammenarbeit von Schule und Kidnergarten. In: Schulleitung und Schulentwicklung, Oktober 2002, wieder unter Kucer, Stephen, B. 2005: Dimensions of Literacy, A Conceptual Base for Teaching Reading and Writing in School Settings; Mahwah/NJ (Erlbaum) Peters, Ann, M. 1983: The units of language acquisition; Cambridge (CUP) Rehbein, J. 1987: Diskurs und Verstehen. Zur Rolle der Muttersprache bei der Textverarbeitung in der Zweitsprache. In: Apeltauer, E. Hg.: Gesteuerter Zweitspracherwerb. Voraussetzungen und Konsequenzen für den Unterricht; Ismaning bei München (Hueber), Rodari, Gianni 1974: Grammatik der Phantasie, Die Kunst Geschichten zu erfinden; Leipzig (Reclam)
14 Rosten, L. 2002: Jiddisch, Eine kleine Enzyklopädie; München (dtv) Scollon, R. / Scollon, S.B.K. 1981: Narrative, Literacy and Face in Interethnic Communication; Norwood/N.J. (Ablex) Senghas, Ann / Kita, Sotaro / Özyürek, Aslı 2004: Children Creating Core Properties of Language: Evidence from an Emerging Sign Language in Nicaragua. In: Science 305, September 2004, Singer, W. 2001: Was kann ein Mensch wann lernen? [ ] Söderbergh, Ragnhild (1988). Barnets tidiga språkutveckling. Gleerups förlag. Malmö Spier, Anne 2002: Mit Spielen Deutsch lernen; Berlin (Cornelsen) Stern, E. 2003: Wissen ist der Schlüssel zum Können. In: Psychologie Heute 7 / 2003, zitiert nach dem Text im Internet [ ] Taeschner, T. 1993: Insegnare la lingua straniera con il format un modello psicolinguistico per la scuola materna ed elementare; Roma (Anicia) Uhlich, M. 2003: Literacy und sprachliche Bildung im Elementarbereich. In: Kindergarten heute, 33. Jg., Heft 3, Verhoeven, L. 2003: Literacy Development in Immigrant Groups. In: IMIS-Beiträge 2003, H 21,
HÖRSTATION. Sprache & Literalität Integrative Kindertagesstätte Roonstraße
 HÖRSTATION Sprache & Literalität Integrative Kindertagesstätte Roonstraße Sprache als Grundlage Sprache ist die Grundlage für den späteren Erfolg in der Schule, im beruflichen Leben und in der Gesellschaft.
HÖRSTATION Sprache & Literalität Integrative Kindertagesstätte Roonstraße Sprache als Grundlage Sprache ist die Grundlage für den späteren Erfolg in der Schule, im beruflichen Leben und in der Gesellschaft.
Konzept für Deutsch als Zweitsprache
 Grundschule Aufenau Schule des Main-Kinzig-Kreises Konzept für Deutsch als Zweitsprache 1. Fassung: August 2015 1 Inhaltsverzeichnis 1. Allgemeines.3 2. Leitgedanken für den Unterricht.. 3 3. Förderkurse.
Grundschule Aufenau Schule des Main-Kinzig-Kreises Konzept für Deutsch als Zweitsprache 1. Fassung: August 2015 1 Inhaltsverzeichnis 1. Allgemeines.3 2. Leitgedanken für den Unterricht.. 3 3. Förderkurse.
Kernkompetenzen. im Fach Englisch, die in jeder Unterrichtsstunde erreicht werden können
 Kernkompetenzen im Fach Englisch, die in jeder Unterrichtsstunde erreicht werden können Bereich: Kommunikation sprachliches Handeln Schwerpunkt: Hörverstehen/Hör- Sehverstehen verstehen Äußerungen und
Kernkompetenzen im Fach Englisch, die in jeder Unterrichtsstunde erreicht werden können Bereich: Kommunikation sprachliches Handeln Schwerpunkt: Hörverstehen/Hör- Sehverstehen verstehen Äußerungen und
Vorhaben heute. Einstieg kurze Vorstellungsrunde
 Vorhaben heute Einstieg kurze Vorstellungsrunde Umgang mit Mehrsprachigkeit Mythen und Fakten über Mehrsprachigkeit Umsetzungsmethoden der Mehrsprachigkeit/Wege zur Mehrsprachigkeit Die Funktion der Kita
Vorhaben heute Einstieg kurze Vorstellungsrunde Umgang mit Mehrsprachigkeit Mythen und Fakten über Mehrsprachigkeit Umsetzungsmethoden der Mehrsprachigkeit/Wege zur Mehrsprachigkeit Die Funktion der Kita
V wenn das Kind seine Muttersprache gut beherrscht. V wenn das Kind früh in eine Spielgruppe geht, wo die
 Frage 21 Antwort 21 Was hilft Ihnen beim Sprachenlernen? Was hilft Ihnen am meisten? Bitte entscheiden Sie: Ich lerne eine Sprache am besten, wenn ich in jemanden verliebt bin, der/die diese Sprache spricht.
Frage 21 Antwort 21 Was hilft Ihnen beim Sprachenlernen? Was hilft Ihnen am meisten? Bitte entscheiden Sie: Ich lerne eine Sprache am besten, wenn ich in jemanden verliebt bin, der/die diese Sprache spricht.
Workshops im März 2018:
 Workshops im März 2018: Workshop Nr. 1: Wortschatzarbeit im DaF/DaZ-Unterricht Zeit und Ort: 20. März 2018, 16-20 Uhr an der EUF (Raum: OSL 231) In dem Workshop wird zunächst der Begriff Wortschatz definiert.
Workshops im März 2018: Workshop Nr. 1: Wortschatzarbeit im DaF/DaZ-Unterricht Zeit und Ort: 20. März 2018, 16-20 Uhr an der EUF (Raum: OSL 231) In dem Workshop wird zunächst der Begriff Wortschatz definiert.
Miteinander reden, miteinander leben. Sprachförderung. Gut für Bielefeld.
 Miteinander reden, miteinander leben. Wie wird der Sprachförderbedarf der Kinder ermittelt? Fachkompetenz der Erzieherinnen und Erzieher durch gezielte Beobachtung mit den Beobachtungsbögen: - Sprachverhalten
Miteinander reden, miteinander leben. Wie wird der Sprachförderbedarf der Kinder ermittelt? Fachkompetenz der Erzieherinnen und Erzieher durch gezielte Beobachtung mit den Beobachtungsbögen: - Sprachverhalten
hförderung von Kindergartenkindern mit Migrationshintergrund
 Sprachliche Frühf hförderung von Kindergartenkindern mit Migrationshintergrund Anastasia Senyildiz Universität Flensburg, 2009 1. Spracherwerb einsprachiger und zweibzw. mehrsprachiger Kinder Gemeinsamkeiten:
Sprachliche Frühf hförderung von Kindergartenkindern mit Migrationshintergrund Anastasia Senyildiz Universität Flensburg, 2009 1. Spracherwerb einsprachiger und zweibzw. mehrsprachiger Kinder Gemeinsamkeiten:
Sprachförderung an der Evangelischen J.-H.-Wichern- Kindertagesstätte in Heppenheim
 Sprachförderung an der Evangelischen J.-H.-Wichern- Kindertagesstätte in Heppenheim 1. Allgemeine Grundlagen 1.1. Was bedeutet Sprache? Sprache ist die wichtigste Form des wechselseitigen Verständnisses
Sprachförderung an der Evangelischen J.-H.-Wichern- Kindertagesstätte in Heppenheim 1. Allgemeine Grundlagen 1.1. Was bedeutet Sprache? Sprache ist die wichtigste Form des wechselseitigen Verständnisses
Zielsetzung der Materialien
 Zielsetzung der Materialien Die sprachliche Entwicklung von Kindern am Schulanfang führt zu vielen Besorgnissen bei Eltern und Pädagogen. Jedes vierte Kind hat im letzten Kindergartenjahr und in der ersten
Zielsetzung der Materialien Die sprachliche Entwicklung von Kindern am Schulanfang führt zu vielen Besorgnissen bei Eltern und Pädagogen. Jedes vierte Kind hat im letzten Kindergartenjahr und in der ersten
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Genial! Deutsch DAZ/DAF - Schritt für Schritt zukunftsfit - Schulbuch Deutsch - Serviceteil Das komplette Material finden Sie hier:
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Genial! Deutsch DAZ/DAF - Schritt für Schritt zukunftsfit - Schulbuch Deutsch - Serviceteil Das komplette Material finden Sie hier:
Flüchtlinge lernen Deutsch Geschichten bauen Phase 2 - Ideen für fortgeschrittene Anfänger
 Flüchtlinge lernen Deutsch Geschichten bauen Phase 2 - Ideen für fortgeschrittene Anfänger In den ersten ca. 100 Stunden haben die Lernenden mit Hilfe von Gegenständen und Handlungen aus ihrem direkten
Flüchtlinge lernen Deutsch Geschichten bauen Phase 2 - Ideen für fortgeschrittene Anfänger In den ersten ca. 100 Stunden haben die Lernenden mit Hilfe von Gegenständen und Handlungen aus ihrem direkten
. Kinder brauchen Aufgaben, an denen sie wachsen können, Vorbilder, an denen sie sich orientieren können, Gemeinschaften, in denen sie sich
 . Kinder brauchen Aufgaben, an denen sie wachsen können, Vorbilder, an denen sie sich orientieren können, Gemeinschaften, in denen sie sich aufgehoben fühlen. Prof. Dr. Gerald Hüther Liebe Eltern Ihr Kind
. Kinder brauchen Aufgaben, an denen sie wachsen können, Vorbilder, an denen sie sich orientieren können, Gemeinschaften, in denen sie sich aufgehoben fühlen. Prof. Dr. Gerald Hüther Liebe Eltern Ihr Kind
Erwartete Kompetenzen am Ende des 4. Schuljahrganges. Die Schüler erwerben Kompetenzen in folgenden Bereichen :
 Ebene 1 erwerben Kompetenzen in folgenden Bereichen : 1. Funktionale kommunikative Kompetenzen 1.2 Verfügung über sprachliche Mittel 2. Methodenkompetenzen 3. Interkulturelle Kompetenzen Ebene 2 1. Funktionale
Ebene 1 erwerben Kompetenzen in folgenden Bereichen : 1. Funktionale kommunikative Kompetenzen 1.2 Verfügung über sprachliche Mittel 2. Methodenkompetenzen 3. Interkulturelle Kompetenzen Ebene 2 1. Funktionale
zu gefährlich. Gib ihn mir bitte. Du bekommst ihn später wieder. Handlungen werden mit einfachen Worten begleitet: Komm, wir gehen auf den Teppich.
 Sprachentwicklung 11 Kinder entwickeln ihre sprachlichen Fähigkeiten, indem sie Erwachsenen beim Sprechen zuhören und zuschauen. Wichtig ist das Sprachvorbild der Lehrkraft (Artikulation, Begriffe, Satzbau,
Sprachentwicklung 11 Kinder entwickeln ihre sprachlichen Fähigkeiten, indem sie Erwachsenen beim Sprechen zuhören und zuschauen. Wichtig ist das Sprachvorbild der Lehrkraft (Artikulation, Begriffe, Satzbau,
Ergänzende Informationen zum LehrplanPLUS
 Ich im Umgang mit anderen (für Lerner mit Grundkenntnissen) Wir gehen aufeinander zu Was ich mir von dir wünsche Ich im Umgang mit anderen Ich und meine Freunde Mein Schultag in der Klasse Stand der Sprachkenntnisse
Ich im Umgang mit anderen (für Lerner mit Grundkenntnissen) Wir gehen aufeinander zu Was ich mir von dir wünsche Ich im Umgang mit anderen Ich und meine Freunde Mein Schultag in der Klasse Stand der Sprachkenntnisse
Kinder entdecken die Sprache. Die Sprachentwicklung in den ersten Lebensjahren
 Kinder entdecken die Sprache Die Sprachentwicklung in den ersten Lebensjahren Was erwartet Sie? Die Sprachentwicklung als Entdeckungsreise Wichtige Voraussetzungen für diese Reise Wann ist die Sprachentwicklung
Kinder entdecken die Sprache Die Sprachentwicklung in den ersten Lebensjahren Was erwartet Sie? Die Sprachentwicklung als Entdeckungsreise Wichtige Voraussetzungen für diese Reise Wann ist die Sprachentwicklung
Erinnern Sie sich, wie Ihr Kind seine erste Sprache gelernt hat?
 Erinnern Sie sich, wie Ihr Kind seine erste Sprache gelernt hat? Sie haben mit Ihrem Kind viel gesprochen Geschichten vorgelesen, Bilderbücher erzählt, Verse vorgesagt, Lieder gesungen... sich nicht dem
Erinnern Sie sich, wie Ihr Kind seine erste Sprache gelernt hat? Sie haben mit Ihrem Kind viel gesprochen Geschichten vorgelesen, Bilderbücher erzählt, Verse vorgesagt, Lieder gesungen... sich nicht dem
Kernkompetenzen im Fach Englisch, die in jeder Unterrichtsstunde erreicht werden können
 Kernkompetenzen im Fach Englisch, die in jeder Unterrichtsstunde erreicht werden können Bereich: Kommunikation sprachliches Handeln Schwerpunkt : Hörverstehen/Hör- Sehverstehen 1 / 2 entnehmen Äußerungen
Kernkompetenzen im Fach Englisch, die in jeder Unterrichtsstunde erreicht werden können Bereich: Kommunikation sprachliches Handeln Schwerpunkt : Hörverstehen/Hör- Sehverstehen 1 / 2 entnehmen Äußerungen
Marktstraße Bonn Telefon 0228/ Zeugnis. 3.Schuljahr, 2. Halbjahr 2016/2017 für. Vorname Name. geboren am..
 Marktstraße 47 53229 Bonn Telefon 0228/ 948620 Zeugnis 3.Schuljahr, 2. Halbjahr 2016/2017 für Vorname Name geboren am.. Klasse 3 Schuljahr 2016/2017 versäumte Stunden?, davon unentschuldigt? Stunden Arbeitsverhalten
Marktstraße 47 53229 Bonn Telefon 0228/ 948620 Zeugnis 3.Schuljahr, 2. Halbjahr 2016/2017 für Vorname Name geboren am.. Klasse 3 Schuljahr 2016/2017 versäumte Stunden?, davon unentschuldigt? Stunden Arbeitsverhalten
Lesen. macht schlauer. Eine Aktion von. Mit Unterstützung von
 Lesen macht schlauer T i p p s f ü r k l u g e E lt e r n Eine Aktion von Mit Unterstützung von Lesen beginnt lange vor dem Lesen Und zwar in der Familie. Lange bevor Ihr Kind in die Schule kommt, können
Lesen macht schlauer T i p p s f ü r k l u g e E lt e r n Eine Aktion von Mit Unterstützung von Lesen beginnt lange vor dem Lesen Und zwar in der Familie. Lange bevor Ihr Kind in die Schule kommt, können
Mille feuilles Information für Eltern
 Mille feuilles Information für Eltern Inhalte Spracherwerb Materialien von Mille feuilles Grundlage von Mille feuilles Aufbau eines parcours (Lerneinheit) 3 Kompetenzbereiche Umgang mit Fehlern Als Eltern
Mille feuilles Information für Eltern Inhalte Spracherwerb Materialien von Mille feuilles Grundlage von Mille feuilles Aufbau eines parcours (Lerneinheit) 3 Kompetenzbereiche Umgang mit Fehlern Als Eltern
Cito-Sprachtest Version 3
 Cito Deutschland Cito-Sprachtest Version 3 Digitale Sprachstandfeststellung im Elementarbereich Digital Testen Effizient und kindgerecht zu objektiven Messergebnissen Zu Hause gehören Computer und Smartphones
Cito Deutschland Cito-Sprachtest Version 3 Digitale Sprachstandfeststellung im Elementarbereich Digital Testen Effizient und kindgerecht zu objektiven Messergebnissen Zu Hause gehören Computer und Smartphones
Pädagogisches Konzept. zur. Sprachförderung
 Pädagogisches Konzept zur Sprachförderung Berufsbildende Schulen des Landkreises Peine Pelikanstraße 12 31228 Peine Stand: Schuljahr 2014/15 U.Peterhansel / U. Kuhlmann-Feske Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung/Auftrag
Pädagogisches Konzept zur Sprachförderung Berufsbildende Schulen des Landkreises Peine Pelikanstraße 12 31228 Peine Stand: Schuljahr 2014/15 U.Peterhansel / U. Kuhlmann-Feske Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung/Auftrag
Duits in de beroepscontext Deutsch für den Beruf Niederlande Modellsatz A2-B1
 Duits in de beroepscontext Deutsch für den Beruf Niederlande Modellsatz A2-B1 KANDIDATENBLÄTTER SPRECHEN Zeit: 20 Minuten Das Modul Sprechen hat vier Teile. Sie kommunizieren mit einem/r Teilnehmenden
Duits in de beroepscontext Deutsch für den Beruf Niederlande Modellsatz A2-B1 KANDIDATENBLÄTTER SPRECHEN Zeit: 20 Minuten Das Modul Sprechen hat vier Teile. Sie kommunizieren mit einem/r Teilnehmenden
Sprachförderung als Querschnittsaufgabe
 Mehr Sprache für Kinder Fachtagung am Placidahaus Xanten, 19.05.10 Sprachförderung als Querschnittsaufgabe ganzheitlich systematisch Integriert Klara Gardemann BK Xanten Gliederung des Vortrags Vorüberlegungen
Mehr Sprache für Kinder Fachtagung am Placidahaus Xanten, 19.05.10 Sprachförderung als Querschnittsaufgabe ganzheitlich systematisch Integriert Klara Gardemann BK Xanten Gliederung des Vortrags Vorüberlegungen
Die pädagogische Wirksamkeit vorschulischer Förderung des Schriftspracherwerbs
 Pädagogik Dirk Kranz Die pädagogische Wirksamkeit vorschulischer Förderung des Schriftspracherwerbs Bachelorarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 3 2. Spracherwerb und Schriftspracherwerb... 3 2.1.
Pädagogik Dirk Kranz Die pädagogische Wirksamkeit vorschulischer Förderung des Schriftspracherwerbs Bachelorarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 3 2. Spracherwerb und Schriftspracherwerb... 3 2.1.
Schrifterwerb und Mehrsprachigkeit
 Schrifterwerb und Mehrsprachigkeit Referentin: Lisa Aul 28. Juni 2011 Vgl. Schrifterwerb und Mehrsprachigkeit von Gerlind Belke Fakten Mehrsprachigkeit ist in Deutschland der Regelfall Im Grundschulalter
Schrifterwerb und Mehrsprachigkeit Referentin: Lisa Aul 28. Juni 2011 Vgl. Schrifterwerb und Mehrsprachigkeit von Gerlind Belke Fakten Mehrsprachigkeit ist in Deutschland der Regelfall Im Grundschulalter
Ergänzende Informationen zum LehrplanPLUS
 Ich Du Wir Hallo, das bin ich! Ich - Du - Wir Wer bist du? Das sind wir! Stand der Sprachkenntnisse Fach Zeitrahmen Schülerinnen und Schüler mit geringen Sprachkenntnissen mit Grundkenntnissen in der Alltagssprache
Ich Du Wir Hallo, das bin ich! Ich - Du - Wir Wer bist du? Das sind wir! Stand der Sprachkenntnisse Fach Zeitrahmen Schülerinnen und Schüler mit geringen Sprachkenntnissen mit Grundkenntnissen in der Alltagssprache
merkwürdig oder SKURRIL finden? Damit zeigt es Ihnen, dass es langsam beginnt, LOGISCH zu denken. Es ahnt eine Beziehung zwischen zwei verschiedenen
 Selbstständig werden Wenn Ihr Kind in die Schule kommt, muss es im Alltag viele Dinge eigenständig bewältigen. Es lernt jetzt nach und nach, sich auch ohne die Eltern in seiner kleinen Welt zurechtzufinden.
Selbstständig werden Wenn Ihr Kind in die Schule kommt, muss es im Alltag viele Dinge eigenständig bewältigen. Es lernt jetzt nach und nach, sich auch ohne die Eltern in seiner kleinen Welt zurechtzufinden.
Indikatoren für Sprachauffälligkeiten im Übergang Kindergarten Schule. Einschulung 20 /
 Indikatoren für Sprachauffälligkeiten im Übergang Kindergarten Schule Einschulung 20 / Vor- und Zuname des Kindes zuständige Grundschule geboren am Ansprechpartner Migrationshintergrund? Falls ja: Erstsprache
Indikatoren für Sprachauffälligkeiten im Übergang Kindergarten Schule Einschulung 20 / Vor- und Zuname des Kindes zuständige Grundschule geboren am Ansprechpartner Migrationshintergrund? Falls ja: Erstsprache
Arbeitskreis Prima sprechen. Beobachtungsbogen für die gezielte Sprachbildung in der Schuleingangsphase
 STADT BIELEFELD Amt für Integration und interkulturelle Angelegenheiten Niederwall 23 33602 Bielefeld Arbeitskreis Prima sprechen Arbeiterwohlfahrt (AWO) Bezirksverband Ostwestfalen-Lippe e. V. Detmolder
STADT BIELEFELD Amt für Integration und interkulturelle Angelegenheiten Niederwall 23 33602 Bielefeld Arbeitskreis Prima sprechen Arbeiterwohlfahrt (AWO) Bezirksverband Ostwestfalen-Lippe e. V. Detmolder
Ergänzende Informationen zum LehrplanPLUS
 Ich habe Wünsche Wir begrüßen uns Ich im Umgang mit anderen Bedürfnisse äußern Ich bedanke mich Stand der Sprachkenntnisse Fach Zeitrahmen Schülerinnen und Schüler mit geringen Sprachkenntnissen mit Grundkenntnissen
Ich habe Wünsche Wir begrüßen uns Ich im Umgang mit anderen Bedürfnisse äußern Ich bedanke mich Stand der Sprachkenntnisse Fach Zeitrahmen Schülerinnen und Schüler mit geringen Sprachkenntnissen mit Grundkenntnissen
Hoffnungsthaler Elternverein - Hauptstraße Rösrath Tel
 Sprache / Kommunikation ist immer und überall. Man kann nicht nicht kommunizieren! (Paul Watzlawick). 1. Sprache im Kita-Alltag Kinder kommen zu uns in die Kindertagesstätte und erleben und erfahren die
Sprache / Kommunikation ist immer und überall. Man kann nicht nicht kommunizieren! (Paul Watzlawick). 1. Sprache im Kita-Alltag Kinder kommen zu uns in die Kindertagesstätte und erleben und erfahren die
Ergänzende Informationen zum LehrplanPLUS
 Essen und Trinken Feste und Feiern Stand der Sprachkenntnisse Fach Zeitrahmen Schülerinnen und Schüler mit geringen Sprachkenntnissen mit Grundkenntnissen in der Alltagssprache mit Unterstützungsbedarf
Essen und Trinken Feste und Feiern Stand der Sprachkenntnisse Fach Zeitrahmen Schülerinnen und Schüler mit geringen Sprachkenntnissen mit Grundkenntnissen in der Alltagssprache mit Unterstützungsbedarf
Unser Bild vom Menschen
 Das pädagogische Konzept t des ELKI Naturns: Unser Bild vom Menschen Wir sehen den Menschen als ein einzigartiges, freies und eigenständiges Wesen mit besonderen physischen, emotionalen, psychischen und
Das pädagogische Konzept t des ELKI Naturns: Unser Bild vom Menschen Wir sehen den Menschen als ein einzigartiges, freies und eigenständiges Wesen mit besonderen physischen, emotionalen, psychischen und
Sprachförderung im kath. Kiga Christ König
 Sprachförderung im kath. Kiga Christ König I. Aufgaben und Ziele der Sprachförderung 1. Sprachförderung von einzelnen Kindern und in Kleingruppen Verbesserung der sprachlichen Kompetenzen von Kindern mit
Sprachförderung im kath. Kiga Christ König I. Aufgaben und Ziele der Sprachförderung 1. Sprachförderung von einzelnen Kindern und in Kleingruppen Verbesserung der sprachlichen Kompetenzen von Kindern mit
Nataša Ćorić Gymnasium Mostar Bosnien und Herzegowina
 Nataša Ćorić Gymnasium Mostar Bosnien und Herzegowina n Inhalt Der passive und der aktive Wortschatz Das vernetzte Lernen Die Einführung von neuem Wortschatz Phasen der Wortschatzvermittlung Techniken
Nataša Ćorić Gymnasium Mostar Bosnien und Herzegowina n Inhalt Der passive und der aktive Wortschatz Das vernetzte Lernen Die Einführung von neuem Wortschatz Phasen der Wortschatzvermittlung Techniken
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Sprachförderung: 102 Gespensterchen. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Sprachförderung: 102 Gespensterchen Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 102 Gespensterchen edidact.de - Arbeitsmaterialien
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Sprachförderung: 102 Gespensterchen Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 102 Gespensterchen edidact.de - Arbeitsmaterialien
Kinder erzählen ihre Geschichten Medienbildung und Sprachförderung am Schulanfang
 Kinder erzählen ihre Geschichten Medienbildung und Sprachförderung am Schulanfang Franz Gerlach Multiplikator für den HEBP Neue Horizonte - Netzwerk Medien- und Kulturarbeit mit Kindern e.v. Das medienkompetente
Kinder erzählen ihre Geschichten Medienbildung und Sprachförderung am Schulanfang Franz Gerlach Multiplikator für den HEBP Neue Horizonte - Netzwerk Medien- und Kulturarbeit mit Kindern e.v. Das medienkompetente
Sprachförderkonzept der EKT Sonnenblümchen
 Sprachförderkonzept der EKT Sonnenblümchen 1. Was ist Sprache 2. Was bedeutet Sprachförderung a. Allgemein b. Speziell für unsere Einrichtung 3. Methoden a. Ganzheitlich b. Additiv 4. Material 5. Rolle
Sprachförderkonzept der EKT Sonnenblümchen 1. Was ist Sprache 2. Was bedeutet Sprachförderung a. Allgemein b. Speziell für unsere Einrichtung 3. Methoden a. Ganzheitlich b. Additiv 4. Material 5. Rolle
Die im Französischunterricht vermittelten Grundlagen sollen als Fundament für die Verständigung mit der frankophonen Bevölkerung der Schweiz dienen.
 Anzahl der Lektionen Bildungsziel Französisch hat weltweit und als zweite Landessprache eine wichtige Bedeutung. Im Kanton Solothurn als Brückenkanton zwischen der deutschen Schweiz und der Romandie nimmt
Anzahl der Lektionen Bildungsziel Französisch hat weltweit und als zweite Landessprache eine wichtige Bedeutung. Im Kanton Solothurn als Brückenkanton zwischen der deutschen Schweiz und der Romandie nimmt
Ergänzende Informationen zum LehrplanPLUS
 In der Schule Meine neue Schule Was mache ich nach der Schule? In der Schule In meiner Klasse Ich lerne Stand der Sprachkenntnisse Fach Zeitrahmen Schülerinnen und Schüler mit geringen Sprachkenntnissen
In der Schule Meine neue Schule Was mache ich nach der Schule? In der Schule In meiner Klasse Ich lerne Stand der Sprachkenntnisse Fach Zeitrahmen Schülerinnen und Schüler mit geringen Sprachkenntnissen
Ergänzende Informationen zum LehrplanPLUS
 Meine Ferien Mein Wetterbericht Meine Hobbys Meine Ferien Raus ins Grüne... Endlich Ferien! Stand der Sprachkenntnisse Fach Zeitrahmen Schülerinnen und Schüler mit geringen Sprachkenntnissen mit Grundkenntnissen
Meine Ferien Mein Wetterbericht Meine Hobbys Meine Ferien Raus ins Grüne... Endlich Ferien! Stand der Sprachkenntnisse Fach Zeitrahmen Schülerinnen und Schüler mit geringen Sprachkenntnissen mit Grundkenntnissen
Librileo gug, Kantstraße 75, Berlin Ansprechpartnerin: Janine Klumper Tel.: Mail:
 MIT JANINE KLUMPER Janine Klumper ist Pädagogin, Erziehungsund Bildungswissenschaftlerin und studiert nebenberuflich Bildung und Medien im Master. Ihr Schwerpunkt liegt in der frühkindlichen Entwicklung
MIT JANINE KLUMPER Janine Klumper ist Pädagogin, Erziehungsund Bildungswissenschaftlerin und studiert nebenberuflich Bildung und Medien im Master. Ihr Schwerpunkt liegt in der frühkindlichen Entwicklung
Förderliches Verhalten
 Ich lerne sprechen! Liebe Eltern, der Erwerb der Sprache ist wohl die komplexeste Aufgabe, die ein Kind im Laufe seiner frühen Entwicklung zu bewältigen hat. Es scheint, als würden unsere Kleinen das Sprechen
Ich lerne sprechen! Liebe Eltern, der Erwerb der Sprache ist wohl die komplexeste Aufgabe, die ein Kind im Laufe seiner frühen Entwicklung zu bewältigen hat. Es scheint, als würden unsere Kleinen das Sprechen
Konzept zur Leistungsbewertung im Fach Englisch
 Konzept zur Leistungsbewertung im Fach Englisch Gültig ab 10.03.2014 auf Beschluss der Fachkonferenz Englisch vom 06.03.2014 Klasse 1/2 Vorrangige Kriterien für die Einschätzung der Leistungen sind die
Konzept zur Leistungsbewertung im Fach Englisch Gültig ab 10.03.2014 auf Beschluss der Fachkonferenz Englisch vom 06.03.2014 Klasse 1/2 Vorrangige Kriterien für die Einschätzung der Leistungen sind die
VORSCHAU. zur Vollversion. Inhalt. Erläuterungen... 4 Beobachtungsbogen... 6 Übungen Lösungen Anhang... 45
 Inhalt Erläuterungen... 4 Beobachtungsbogen... 6 Übungen... 8 Lehrerseite: Handpuppe und einfache Sätze... 8 Lehrerseite: Unser Klassenzimmerlied... 9 Doppelgänger-Karten... 10 Wortgitter... 12 Kartenspiel
Inhalt Erläuterungen... 4 Beobachtungsbogen... 6 Übungen... 8 Lehrerseite: Handpuppe und einfache Sätze... 8 Lehrerseite: Unser Klassenzimmerlied... 9 Doppelgänger-Karten... 10 Wortgitter... 12 Kartenspiel
Wie findet Sprachförderung in der Kindertageseinrichtung statt?
 Wie findet Sprachförderung in der Kindertageseinrichtung statt? Zitat: Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt Der Sprachbaum Sprachkompetenz ist eine Schlüsselkompetenz Kommunikation durchzieht
Wie findet Sprachförderung in der Kindertageseinrichtung statt? Zitat: Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt Der Sprachbaum Sprachkompetenz ist eine Schlüsselkompetenz Kommunikation durchzieht
Unterstützte Kommunikation im Alltag
 Sprachtherapie aktuell Unterstützte Kommunikation = Sprachtherapie?! Unterstützte Kommunikation im Alltag Oskar Streit, Lisa Streit Zitation: Streit. O. & Streit, L. (2014) Unterstützte Kommunikation im
Sprachtherapie aktuell Unterstützte Kommunikation = Sprachtherapie?! Unterstützte Kommunikation im Alltag Oskar Streit, Lisa Streit Zitation: Streit. O. & Streit, L. (2014) Unterstützte Kommunikation im
Kinder eine komplexe Lernaufgabe meistern und wo manche von ihnen Hilfe brauchen
 Fachtagung Sprache hat System Sprachförderung braucht System. Lernersprache Deutsch. Wie Formatvorlage des Untertitelmasters durch Klicken bearbeiten Kinder eine komplexe Lernaufgabe meistern und wo manche
Fachtagung Sprache hat System Sprachförderung braucht System. Lernersprache Deutsch. Wie Formatvorlage des Untertitelmasters durch Klicken bearbeiten Kinder eine komplexe Lernaufgabe meistern und wo manche
Mille feuilles 5/6 Information für Eltern
 Mille feuilles 5/6 Information für Eltern Informationen für Eltern Inhalte Eine gemeinsame Aufgabe Die verbindliche Grundlage Materialien von Mille feuilles 5/6 Aufbau von Kompetenzen Umgang mit Fehlern
Mille feuilles 5/6 Information für Eltern Informationen für Eltern Inhalte Eine gemeinsame Aufgabe Die verbindliche Grundlage Materialien von Mille feuilles 5/6 Aufbau von Kompetenzen Umgang mit Fehlern
m e i n s p r ac h e n p o r t f o l i o Name: Schule:
 m e i n s p r ac h e n p o rtf o li o Name: Schule: Mein Sprachenportfolio: Entstanden aus einem Pilotprojekt des Landes Hessen, gefördert mit Mitteln des Hessischen Kultusministeriums Herausgegeben von
m e i n s p r ac h e n p o rtf o li o Name: Schule: Mein Sprachenportfolio: Entstanden aus einem Pilotprojekt des Landes Hessen, gefördert mit Mitteln des Hessischen Kultusministeriums Herausgegeben von
Das Kind weist ausreichende Fertigkeiten in der Addition und Subtraktion auf, kann also in der Regel Aufgaben wie und 70-7 richtig lösen.
 Einführung Das Einmaleins wird häufig in der dritten Klasse eingeführt und entsprechend gute Kenntnisse in diesem Bereich erleichtern das Lösen vieler Aufgaben. Weiterhin wird ab der vierten Klasse das
Einführung Das Einmaleins wird häufig in der dritten Klasse eingeführt und entsprechend gute Kenntnisse in diesem Bereich erleichtern das Lösen vieler Aufgaben. Weiterhin wird ab der vierten Klasse das
Schlüsselsituation Sprache
 Karin Jampert Schlüsselsituation Sprache Spracherwerb im Kindergarten unter besonderer Berücksichtigung des Spracherwerbs bei mehrsprachigen Kindern Leske + Budrich, Opladen 2002 Inhalt 1. Einleitung 9
Karin Jampert Schlüsselsituation Sprache Spracherwerb im Kindergarten unter besonderer Berücksichtigung des Spracherwerbs bei mehrsprachigen Kindern Leske + Budrich, Opladen 2002 Inhalt 1. Einleitung 9
3. In welchen Sprachen spricht das Kind mit der Mutter, dem Vater, Geschwistern und anderen Bezugspersonen?
 A. Erfassung biografischer Daten 1. Was ist die Erst- und ggf. Zweit- und Familiensprache des Kindes? Deutsch als Erstsprache: weiter mit Frage 5: 2. Seit wann hat das Kind Kontakt mit Deutsch als Zweitsprache?
A. Erfassung biografischer Daten 1. Was ist die Erst- und ggf. Zweit- und Familiensprache des Kindes? Deutsch als Erstsprache: weiter mit Frage 5: 2. Seit wann hat das Kind Kontakt mit Deutsch als Zweitsprache?
Französisch (2. FS): Kompetenzraster zum gemeinsamen Bildungsplan 2016 Sek I
 LSF 1 LSF 2 LSF 3 LSF 4 LSF 5 LSF 6 VERSTEHEN SPRECHEN SCHREIBEN SPRAC H MITTE LN SPRA CHLI CHE MITT EL 1 Ich kann verstehen, was ich höre 2 Methoden und 3 Ich kann Texte lesen und verstehen. 4 Ich kann
LSF 1 LSF 2 LSF 3 LSF 4 LSF 5 LSF 6 VERSTEHEN SPRECHEN SCHREIBEN SPRAC H MITTE LN SPRA CHLI CHE MITT EL 1 Ich kann verstehen, was ich höre 2 Methoden und 3 Ich kann Texte lesen und verstehen. 4 Ich kann
Karin J ampert Schlüsselsituation Sprache
 Karin J ampert Schlüsselsituation Sprache DJI-Reihe Kinder Band 10 Karin J ampert Schlüsselsituation Sprache Spracherwerb im Kindergarten unter besonderer Berücksichtigung des Spracherwerbs bei mehrsprachigen
Karin J ampert Schlüsselsituation Sprache DJI-Reihe Kinder Band 10 Karin J ampert Schlüsselsituation Sprache Spracherwerb im Kindergarten unter besonderer Berücksichtigung des Spracherwerbs bei mehrsprachigen
Sprachförderkonzept der Grundschule Mühlenweg
 Grundschule Mühlenweg Schellingstraße 17 26384 Wilhelmshaven 04421-16 43 20 04421-16 41 43 20 gs-muehlenweg@wilhelmshaven.de Sprachförderkonzept der Grundschule Mühlenweg Inhaltsverzeichnis 1. Vorwort
Grundschule Mühlenweg Schellingstraße 17 26384 Wilhelmshaven 04421-16 43 20 04421-16 41 43 20 gs-muehlenweg@wilhelmshaven.de Sprachförderkonzept der Grundschule Mühlenweg Inhaltsverzeichnis 1. Vorwort
ENTDECKEN SIE IHRE LERNSTRATEGIEN!
 ENTDECKEN SIE IHRE LERNSTRATEGIEN! Beantworten Sie folgenden Fragen ausgehend vom dem, was Sie zur Zeit wirklich machen, und nicht vom dem, was Sie machen würden, wenn Sie mehr Zeit hätten oder wenn Sie
ENTDECKEN SIE IHRE LERNSTRATEGIEN! Beantworten Sie folgenden Fragen ausgehend vom dem, was Sie zur Zeit wirklich machen, und nicht vom dem, was Sie machen würden, wenn Sie mehr Zeit hätten oder wenn Sie
Name: Klasse: 4. Überfachliche Kompetenzen
 Arbeitsverhalten Überfachliche Kompetenzen Du hast die benötigten Unterrichts- und Arbeitsmaterialien dabei. Du beteiligst dich mit sinnvollen Beiträgen am Unterrichtsgespräch. Du hältst dich an die Gesprächsregeln.
Arbeitsverhalten Überfachliche Kompetenzen Du hast die benötigten Unterrichts- und Arbeitsmaterialien dabei. Du beteiligst dich mit sinnvollen Beiträgen am Unterrichtsgespräch. Du hältst dich an die Gesprächsregeln.
Arbeitskreis Prima sprechen. Beobachtungsbogen für die gezielte Sprachbildung in der Schuleingangsphase
 STADT BIELEFELD Amt für Integration und interkulturelle Angelegenheiten Niederwall 23 33602 Bielefeld Arbeitskreis Prima sprechen Arbeiterwohlfahrt (AWO) Bezirksverband Ostwestfalen-Lippe e. V. Detmolder
STADT BIELEFELD Amt für Integration und interkulturelle Angelegenheiten Niederwall 23 33602 Bielefeld Arbeitskreis Prima sprechen Arbeiterwohlfahrt (AWO) Bezirksverband Ostwestfalen-Lippe e. V. Detmolder
PROTOKOLLBOGEN ZUM EINSATZ IM KINDERGARTEN
 Einschätng des Sprachförderbedarfs im Jahr vor der Einschulung (Protokollbogen-Kindergarten) PROTOKOLLBOGEN ZUM EINSATZ IM KINDERGARTEN Beachten Sie bitte unbedingt die Hinweise m Ausfüllen des Protokollbogens!
Einschätng des Sprachförderbedarfs im Jahr vor der Einschulung (Protokollbogen-Kindergarten) PROTOKOLLBOGEN ZUM EINSATZ IM KINDERGARTEN Beachten Sie bitte unbedingt die Hinweise m Ausfüllen des Protokollbogens!
Deutsche Privatschule Feldstedt
 Deutsche Privatschule Feldstedt Zeugnis für Klasse 2 Schuljahr Arbeitsverhalten 1. ist neugierig auf Unbekannte Inhalte und Aufgaben 2. folgt dem Unterricht aufmerksam 3. leistet unterrichtsfördernde Beiträge
Deutsche Privatschule Feldstedt Zeugnis für Klasse 2 Schuljahr Arbeitsverhalten 1. ist neugierig auf Unbekannte Inhalte und Aufgaben 2. folgt dem Unterricht aufmerksam 3. leistet unterrichtsfördernde Beiträge
Plaudertasche - Lesetiger Sprach- und Leseförderung von Anfang an Katholisches Bildungswerk Vorarlberg, Elternbildung
 Plaudertasche - Lesetiger Sprach- und Leseförderung von Anfang an Katholisches Bildungswerk Vorarlberg, Elternbildung Lesen ist eine komplexe Fertigkeit, die aus mehreren Teilkompetenzen besteht. Teilkompetenzen
Plaudertasche - Lesetiger Sprach- und Leseförderung von Anfang an Katholisches Bildungswerk Vorarlberg, Elternbildung Lesen ist eine komplexe Fertigkeit, die aus mehreren Teilkompetenzen besteht. Teilkompetenzen
prachfö rderung in lltag nd piel Studie zur Förderung von Sprache und Kommunikation in der Familie und in der Kita*
 prachfö rderung in lltag nd piel Studie zur Förderung von Sprache und Kommunikation in der Familie und in der Kita* *gefördert von der Univ. Gießen und dem Gesundheitsamt Region Kassel Gesellschaft, Forschung
prachfö rderung in lltag nd piel Studie zur Förderung von Sprache und Kommunikation in der Familie und in der Kita* *gefördert von der Univ. Gießen und dem Gesundheitsamt Region Kassel Gesellschaft, Forschung
Fach: Deutsch als Zweitsprache Klasse: 1. Klasse
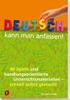 Klasse: 1. Klasse kann in verschiedenen Sprechsituationen aufmerksam zuhören kann im Alltag häufig gebrauchte Formeln (Standardausdrücke, Begrüßungen, Verabschiedungen, Entschuldigungen) und einfache Fragen
Klasse: 1. Klasse kann in verschiedenen Sprechsituationen aufmerksam zuhören kann im Alltag häufig gebrauchte Formeln (Standardausdrücke, Begrüßungen, Verabschiedungen, Entschuldigungen) und einfache Fragen
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Action-Hausaufgaben Deutsch 1+2. Das komplette Material finden Sie hier:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Action-Hausaufgaben Deutsch 1+2 Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Inhalt Vorwort...................................................................
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Action-Hausaufgaben Deutsch 1+2 Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Inhalt Vorwort...................................................................
2.6 Sprachförderkonzept. Deutsch als Zweitsprache (DaZ)
 2.6 Sprachförderkonzept Deutsch als Zweitsprache (DaZ) 1. Einleitung 2. Grundsätze der Förderung in DaZ 3. Zielsetzung 4. Maßnahmen 5. Leistungsbewertung 5. Evaluation 6. Anhang 1 1. Einleitung Es gehört
2.6 Sprachförderkonzept Deutsch als Zweitsprache (DaZ) 1. Einleitung 2. Grundsätze der Förderung in DaZ 3. Zielsetzung 4. Maßnahmen 5. Leistungsbewertung 5. Evaluation 6. Anhang 1 1. Einleitung Es gehört
Hinweise für den Lehrer
 Hinweise für den Lehrer Leseverstehen trainieren enthält Geschichten und Arbeitsblätter, die in vielfältiger Weise verwendet werden können. Der Hauptzweck besteht darin, das Leseverstehen (vor allem leseschwacher
Hinweise für den Lehrer Leseverstehen trainieren enthält Geschichten und Arbeitsblätter, die in vielfältiger Weise verwendet werden können. Der Hauptzweck besteht darin, das Leseverstehen (vor allem leseschwacher
Seminarunterlagen. Auditives Feedback - System. Erwachsene sind Sprachvorbild: Monat: Erstes Sprachverständnis
 Vorlagen zur Nutzung für PowerPoint - Präsentationen Spracherwerb Wie erlernen/erwerben Kinder Sprache? Erwachsene sind Sprachvorbild: Empfehlungen: Blickkontakt Zuhören, Sprache anregen, aussprechen lassen,
Vorlagen zur Nutzung für PowerPoint - Präsentationen Spracherwerb Wie erlernen/erwerben Kinder Sprache? Erwachsene sind Sprachvorbild: Empfehlungen: Blickkontakt Zuhören, Sprache anregen, aussprechen lassen,
Unit 1. New World 3 Lernziele aus dem Lehrplan Passepartout
 Unit 1 Hören Niveau A 1.2 bis A 2.1 Wo? Kurze mündliche Informationen über bekannte Themen verstehen, wenn einfach und deutlich gesprochen wird. CB, S. 15 17 In kurzen Texten, in denen es um Erlebnisse
Unit 1 Hören Niveau A 1.2 bis A 2.1 Wo? Kurze mündliche Informationen über bekannte Themen verstehen, wenn einfach und deutlich gesprochen wird. CB, S. 15 17 In kurzen Texten, in denen es um Erlebnisse
Deutsch Dexway Kommunizieren - Niveau 13. Descripción
 Deutsch Dexway Kommunizieren - Niveau 13 Descripción ŀ Lernziele: In diesem Block lernt der/die Schüler/-in, Szenen und Gemälde zu beschreiben und seine/ihre eigenen Eindrücke über das Gesehene wiederzugeben.
Deutsch Dexway Kommunizieren - Niveau 13 Descripción ŀ Lernziele: In diesem Block lernt der/die Schüler/-in, Szenen und Gemälde zu beschreiben und seine/ihre eigenen Eindrücke über das Gesehene wiederzugeben.
Klasse Schulbesuchsjahr
 Indikatoren für Sprachauffälligkeiten in der Grundschule Klasse Schulbesuchsjahr Vor- und Zuname des Kindes zuständige Grundschule geboren am Ansprechpartner (Klassenlehrer/in) Migrationshintergrund? Falls
Indikatoren für Sprachauffälligkeiten in der Grundschule Klasse Schulbesuchsjahr Vor- und Zuname des Kindes zuständige Grundschule geboren am Ansprechpartner (Klassenlehrer/in) Migrationshintergrund? Falls
dbl Deutscher Bundesverband für Logopädie e.v.
 Sprachförderkonzept "Haus für Kinder" Vallendar: Alltagsintegrierte Sprachbildung = inklusive Sprachbildung "Alltagsintegrierte Sprachförderung bedeutet, dass die frühpädagogischen Fachkräfte sich in allen
Sprachförderkonzept "Haus für Kinder" Vallendar: Alltagsintegrierte Sprachbildung = inklusive Sprachbildung "Alltagsintegrierte Sprachförderung bedeutet, dass die frühpädagogischen Fachkräfte sich in allen
Literalität bei zweisprachig aufwachsenden Kindern
 Reyhan Kuyumcu, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Stadt Kiel, Projektleitung des Projekts Literalität und Spracherwerb Literalität bei zweisprachig aufwachsenden Kindern In vielen Großstädten gehört
Reyhan Kuyumcu, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Stadt Kiel, Projektleitung des Projekts Literalität und Spracherwerb Literalität bei zweisprachig aufwachsenden Kindern In vielen Großstädten gehört
Zeugnis Klasse 3-1. Halbjahr -
 GGS Ardeyschule Stadt Essen Zeugnis Klasse 3-1. Halbjahr - für: Max Musterschüler geboren am: 01.01.2007 Klasse: 3 Schuljahr: 2016/2017 versäumte Stunden: 0 davon unentschuldigt: 0 Stunden Deutsch zeigt
GGS Ardeyschule Stadt Essen Zeugnis Klasse 3-1. Halbjahr - für: Max Musterschüler geboren am: 01.01.2007 Klasse: 3 Schuljahr: 2016/2017 versäumte Stunden: 0 davon unentschuldigt: 0 Stunden Deutsch zeigt
Kindertageseinrichtung & Grundschule
 Kurzkonzept der Übergangsgestaltung Kindertageseinrichtung & Grundschule Seite 1 von 6 Liebe Familien, für Ihr Kind beginnt in Kürze Das letzte Kindergartenjahr. Der Übergang von der Kindertagesstätte
Kurzkonzept der Übergangsgestaltung Kindertageseinrichtung & Grundschule Seite 1 von 6 Liebe Familien, für Ihr Kind beginnt in Kürze Das letzte Kindergartenjahr. Der Übergang von der Kindertagesstätte
Deutsche Sprache richtig lernen
 Maike Wendt, Dipl.-Sprachheilpädagogin Deutsche Sprache richtig lernen Informationsveranstaltung für ehrenamtliche Helfer von Geflüchteten Was ist wichtig beim Spracherwerb? Wortschatz: Wörter als Ausdruck
Maike Wendt, Dipl.-Sprachheilpädagogin Deutsche Sprache richtig lernen Informationsveranstaltung für ehrenamtliche Helfer von Geflüchteten Was ist wichtig beim Spracherwerb? Wortschatz: Wörter als Ausdruck
Abenteuer Kommunikation Teil 1. Abenteuer Sprache 2002 Jugendamt der Stadt Dortmund, Abteilung Tageseinrichtungen für Kinder
 Abenteuer Kommunikation Teil 1 1 1 Man kann nicht nicht kommunizieren. 1 2 Man kann sich nicht nicht verhalten. 1 3 Jedes Verhalten hat einen Mitteilungscharakter. 1 4 Material der Kommunikation Sprache
Abenteuer Kommunikation Teil 1 1 1 Man kann nicht nicht kommunizieren. 1 2 Man kann sich nicht nicht verhalten. 1 3 Jedes Verhalten hat einen Mitteilungscharakter. 1 4 Material der Kommunikation Sprache
Deutsche Privatschule Feldstedt
 Deutsche Privatschule Feldstedt Zeugnis für Klasse 4 Schuljahr Arbeitsverhalten 1. ist neugierig auf Unbekannte Inhalte und Aufgaben 2. folgt dem Unterricht aufmerksam 3. leistet unterrichtsfördernde Beiträge
Deutsche Privatschule Feldstedt Zeugnis für Klasse 4 Schuljahr Arbeitsverhalten 1. ist neugierig auf Unbekannte Inhalte und Aufgaben 2. folgt dem Unterricht aufmerksam 3. leistet unterrichtsfördernde Beiträge
Cito Deutschland. Digital Testen. Sprachstandfeststellung für 4- bis 7-jährige Kinder. Deutsch Türkisch
 Cito Deutschland Digital Testen Sprachstandfeststellung für 4- bis 7-jährige Kinder Deutsch Türkisch Digital Testen Werden Sie digital Zu Hause gehören Computer und Smartphones für viele Kinder, Lehr-
Cito Deutschland Digital Testen Sprachstandfeststellung für 4- bis 7-jährige Kinder Deutsch Türkisch Digital Testen Werden Sie digital Zu Hause gehören Computer und Smartphones für viele Kinder, Lehr-
Curriculum Deutsch - Förderschule - Grundstufe
 Curriculum Deutsch - Förderschule - Grundstufe Klasse Kompetenz felder 3 Sprechen Seite 1 von 6 Kompetenzen nutzen Gestik und Mimik, um sich verständlich zu machen sprechen verständlich hören zu und verstehen
Curriculum Deutsch - Förderschule - Grundstufe Klasse Kompetenz felder 3 Sprechen Seite 1 von 6 Kompetenzen nutzen Gestik und Mimik, um sich verständlich zu machen sprechen verständlich hören zu und verstehen
Grundlage u.a.: M. Ulich,P. Oberhuemer, M. Soltendieck: Die Welt trifft sich im Kindergarten, 2001
 Exzerpt: Landeskoordinatorin V 2002 Grundlage u.a.: M. Ulich,P. Oberhuemer, M. Soltendieck: Die Welt trifft sich im Kindergarten, 2001 Informationen zum Thema Kinder nichtdeutscher Muttersprache 1. Begriffe
Exzerpt: Landeskoordinatorin V 2002 Grundlage u.a.: M. Ulich,P. Oberhuemer, M. Soltendieck: Die Welt trifft sich im Kindergarten, 2001 Informationen zum Thema Kinder nichtdeutscher Muttersprache 1. Begriffe
Foto-Materialien für den Einsatz im Deutsch-Unterricht
 Foto-Materialien für den Einsatz im Deutsch-Unterricht Katja Schneider PH Freiburg und Adolf-Reichwein Schule Worum geht es? Fotomaterialien mit Lebensweltbezug Fotomaterialien enthalten Fotos von Kindern
Foto-Materialien für den Einsatz im Deutsch-Unterricht Katja Schneider PH Freiburg und Adolf-Reichwein Schule Worum geht es? Fotomaterialien mit Lebensweltbezug Fotomaterialien enthalten Fotos von Kindern
Deutsch Dexway - Niveau 13
 Deutsch Dexway - Niveau 13 Contenido Lernziele: In diesem Block lernt der/die Schüler/-in, Szenen und Gemälde zu beschreiben und seine/ihre eigenen Eindrücke über das Gesehene wiederzugeben. Er/sie wird
Deutsch Dexway - Niveau 13 Contenido Lernziele: In diesem Block lernt der/die Schüler/-in, Szenen und Gemälde zu beschreiben und seine/ihre eigenen Eindrücke über das Gesehene wiederzugeben. Er/sie wird
Deutsche Privatschule Feldstedt
 Deutsche Privatschule Feldstedt Zeugnis für Klasse 3 Schuljahr Arbeitsverhalten 1. ist neugierig auf Unbekannte Inhalte und Aufgaben 2. folgt dem Unterricht aufmerksam 3. leistet unterrichtsfördernde Beiträge
Deutsche Privatschule Feldstedt Zeugnis für Klasse 3 Schuljahr Arbeitsverhalten 1. ist neugierig auf Unbekannte Inhalte und Aufgaben 2. folgt dem Unterricht aufmerksam 3. leistet unterrichtsfördernde Beiträge
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Deutsch mit Vater und Sohn (DaF / DaZ)
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Deutsch mit Vater und Sohn (DaF / DaZ) Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Vorwort Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen!
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Deutsch mit Vater und Sohn (DaF / DaZ) Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Vorwort Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen!
Vorlaufkurs an der LWS. Konzept
 !! 1 Vorlaufkurs an der LWS Konzept 1. Vorüberlegungen Vorschulkinder sind in Deutschland vielfach für den Schulstart nicht ausreichend gerüstet. Schulanfänger haben zum Teil nicht gelernt, Sprache als
!! 1 Vorlaufkurs an der LWS Konzept 1. Vorüberlegungen Vorschulkinder sind in Deutschland vielfach für den Schulstart nicht ausreichend gerüstet. Schulanfänger haben zum Teil nicht gelernt, Sprache als
Bildungsstandards Deutsch
 Bildungsstandards Deutsch Hören, Sprechen und Miteinander-Reden H1: Verständlich erzählen und anderen verstehend zuhören 1 Erlebnisse erzählen 2 Über Begebenheiten und Erfahrungen zusammenhängend sprechen
Bildungsstandards Deutsch Hören, Sprechen und Miteinander-Reden H1: Verständlich erzählen und anderen verstehend zuhören 1 Erlebnisse erzählen 2 Über Begebenheiten und Erfahrungen zusammenhängend sprechen
Ergänzende Informationen zum LehrplanPLUS
 So leben wir miteinander Meine Familie So leben wir miteinander Nachbarn Bei mir zu Hause Stand der Sprachkenntnisse Fach Zeitrahmen Schülerinnen und Schüler mit geringen Sprachkenntnissen mit Grundkenntnissen
So leben wir miteinander Meine Familie So leben wir miteinander Nachbarn Bei mir zu Hause Stand der Sprachkenntnisse Fach Zeitrahmen Schülerinnen und Schüler mit geringen Sprachkenntnissen mit Grundkenntnissen
Corso in metodologia e didattica CLIL TEDESCO Scuola primaria Planung einer Unterrichtseinheit
 Corso in metodologia e didattica CLIL TEDESCO Scuola primaria 2017 Planung einer Unterrichtseinheit Adressaten: 3.Grundschulklasse Sachfach: Erdkunde Thema: Himmelsrichtungen Thema der Unterrichtsreihe
Corso in metodologia e didattica CLIL TEDESCO Scuola primaria 2017 Planung einer Unterrichtseinheit Adressaten: 3.Grundschulklasse Sachfach: Erdkunde Thema: Himmelsrichtungen Thema der Unterrichtsreihe
Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS
 Sich begrüßen und verabschieden Guten Tag/Auf Wiedersehen Stand: 7.08.2017 Stand der Sprachkenntnisse Fächer Zeitrahmen Benötigtes Material Schülerinnen und Schüler mit geringen Sprachkenntnissen mit Grundkenntnissen
Sich begrüßen und verabschieden Guten Tag/Auf Wiedersehen Stand: 7.08.2017 Stand der Sprachkenntnisse Fächer Zeitrahmen Benötigtes Material Schülerinnen und Schüler mit geringen Sprachkenntnissen mit Grundkenntnissen
Tabelle 2 - Gemeinsame Referenzniveaus: Raster zur Selbstbeurteilung. Verstehen Sprechen Schreiben C2 bis A1 Hören Lesen. An Gesprächen teilnehmen
 Tabelle 2 - Gemeinsame Referenzniveaus: Raster zur Selbstbeurteilung Verstehen Sprechen Schreiben C2 bis Hören Lesen An Gesprächen teilnehmen Zusammenhängendes sprechen Schreiben C2 Hören Ich habe keinerlei
Tabelle 2 - Gemeinsame Referenzniveaus: Raster zur Selbstbeurteilung Verstehen Sprechen Schreiben C2 bis Hören Lesen An Gesprächen teilnehmen Zusammenhängendes sprechen Schreiben C2 Hören Ich habe keinerlei
Vorwort Einleitung... 13
 Inhaltsverzeichnis Vorwort... 11 1 Einleitung... 13 A Theorien und Befunde der Spracherwerbsforschung 2 Zweitspracherwerbstypen... 23 2.1 Der simultane Erwerb zweier Sprachen... 24 2.2 Der sukzessive kindliche
Inhaltsverzeichnis Vorwort... 11 1 Einleitung... 13 A Theorien und Befunde der Spracherwerbsforschung 2 Zweitspracherwerbstypen... 23 2.1 Der simultane Erwerb zweier Sprachen... 24 2.2 Der sukzessive kindliche
