Nachhaltigkeit lernen in Hessen
|
|
|
- Philipp Frank
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Nachhaltigkeit lernen in Hessen Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) als Antwort auf globale Herausforderungen Dokumentation der Fachtagung Nachhaltigkeit lernen in Hessen am an der Hochschule Fulda
2 2 Nachhaltigkeit lernen in Hessen Impressum Herausgeber: Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) Referat I 3 B Aus- und Fortbildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung Mainzer Straße 80, Wiesbaden Telefon: Telefax: Silvia.Fengler@umwelt.hessen.de Erstellt durch: ANU Hessen e.v. Frankfurter Str Flörsheim Telefon 06145/ Textgestaltung und Vorlayout: Riccarda Wolter ANU Hessen e.v. Frankfurter Str Flörsheim Abbildungen: Isabelle Zellmer Libelle Designwerkstatt weiterer Fotonachweis: Seite 6: S. Feige/HMUKLV Gestaltung: design.idee, Büro für Gestaltung, Erfurt Wiesbaden 2017 Download (pdf) unter: Anmerkung zur Verwendung: Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Hessischen Landesregierung herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags- und Kommunalwahlen. Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Die genannten Beschränkungen gelten unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Druckschrift dem Empfänger zugegangen ist. Den Parteien ist es jedoch gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden.
3 Fachtagung Nachhaltigkeit lernen in Hessen Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) als Antwort auf globale Herausforderungen
4 4 Nachhaltigkeit lernen in Hessen Inhaltsverzeichnis GRUSSWORTE Bildung ist der Schlüssel: Nachhaltigkeit lernen in Hessen 6 Priska Hinz Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Nachhaltigkeit an der Hochschule Fulda 8 Prof. Dr. Kathrin Becker-Schwarze Vizepräsidentin der Hochschule Fulda Nachhaltigkeit heißt miteinander und voneinander lernen 10 Martina Teipel Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung (ANU), Landesverband Hessen e.v. VORTRÄGE & TALKRUNDE Die Agenda 2030 Große Transformation zur Nachhaltigkeit 12 Prof. Dr. Dirk Messner Direktor des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik (DIE), Bonn & Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen BNE als Antwort auf globale Herausforderungen 16 Renate Labonté Geschäftsstelle Nachhaltigkeitsstrategie Hessen Ulrich Striegel Hessisches Kultusministerium Prof. Dr. Dirk Messner Direktor des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik (DIE), Bonn & Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen Heike Blaum Landesverband Hessen im Verband der Chemischen Industrie e.v. Moderation: Dr. Tanja Busse Wege zur Bildung für Nachhaltigkeit im Grundschulalter 20 Prof. Dr. Astrid Kaiser Institut für Pädagogik, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Bildung für nachhaltige Entwicklung und MINT Unterricht: Modelle und Perspektiven 22 Prof. Dr. Ingo Eilks Institut für Didaktik der Naturwissenschaften, Fachbereich Biologie und Chemie, Universität Bremen Nachhaltige Entwicklung: Strukturelle Ansatzpunkte in der Berufsbildung 24 Andrea Mohoric Forschungsinstitut Betriebliche Bildung, Berlin
5 Nachhaltigkeit lernen in Hessen 5 WORKSHOPBERICHTE Workshop 1: Energie schlau nutzen 26 Workshop 2: Kleidung und Konsum 27 Workshop 3: Gemeinsam aktiv! Die Methode Handprint 28 Workshop 4: Naturwissenschaften in Kita und Grundschule Experimentieren leicht gemacht mit der Chemiekiste! 30 Workshop 5: Kunos coole Kunststoffkiste 31 Workshop 6: Organisation einer Weltladen AG 32 Workshop 7: Solarrennen Rhein Main 33 Workshop 8: Kunststoff 34 Workshop 9: Wert der Biodiversität 35 Workshop 10: Virtuelles Wasser 36 Workshop 11: Lernwerkstatt Klimawandel 38 Workshop 12: Bildung für nachhaltige Entwicklung und Globales Lernen: Leitperspektive in beruflichen Bildungsgängen 39 Workshop 13: Energierallye im Technikhaus EnergiePLUS 40 Workshop 14: Nachhaltigkeit in der beruflichen Bildung Beispiele für die didaktische Umsetzung im Berufsfeld Ernährung und Hauswirtschaft 41 Workshop 15: Verankerung von BNE in der Ausbildung von Sozialpädagogen 42 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 44 WEITERE INFORMATIONSMÖGLICHKEITEN ZU DEN WORKSHOPS 45 MARKT DER MÖGLICHKEITEN 47 VERZEICHNIS DER AUSSTELLER 47 IMPRESSIONEN 49
6 6 Nachhaltigkeit lernen in Hessen Grußwort Bildung ist der Schlüssel: Nachhaltigkeit lernen in Hessen Priska Hinz Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Nachhaltigkeit zielt auf Generationengerechtigkeit, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, sozialen Zusammenhalt, Lebensqualität, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und internationale Verantwortung. Seit dem Jahr 2008 nimmt die Nachhaltigkeitsstrategie Hessen für die Politik der Landesregierung eine bedeutende Rolle ein. Dabei ist es wichtig, dass alle, sprich Gesellschaft, Kommunen, Unternehmen, Politik und Verwaltung, gemeinsam an Lösungen und neuen Ideen arbeiten. Der Bogen der Tagung wurde weit gespannt: Von den globalen Herausforderungen über die aktuellen Entwicklungen in den Bildungsbereichen bis hin zur Etablierung einer gemeinsamen Dachmarke Nachhaltigkeit lernen in Hessen!. Ich freue mich, dass so viele Akteure aus verschiedenen Bereichen ob Umwelt-, politische oder technisch-naturwissenschaftliche Bildung und der Bildung für nachhaltige Entwicklung miteinander diskutiert und sich intensiv ausgetauscht haben. Nachhaltig zu leben, zu denken und zu wirtschaften ist kein Luxus, sondern eine gesamtgesellschaftliche Pflicht. Denn die globale Erwärmung und knapper werdende Ressourcen haben Auswirkungen auf alle. Ich bin mir sicher: Je früher ein Bewusstsein für ein nachhaltiges Handeln entwickelt wird, umso selbstverständlicher wird es Teil des Alltags. Das Konzept der Bildung für Nachhaltige Entwicklung, kurz BNE, begleitet junge Menschen auf diesem Weg und ist seit 2014 eine der Kernaufgaben unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Um nachhaltiges Lernen in allen Bildungsbereichen voranzutreiben, wurde der Runde Tisch BNE gegründet. Er arbeitet ressortübergreifend und bindet, dank des vielfältigen Engagements seiner Teilnehmer, die wichtigen und einflussreichen hessischen Akteure ein. Der Runde Tisch BNE gab auch den
7 Nachhaltigkeit lernen in Hessen 7 Impuls zur Durchführung einer Fachtagung. Die große Zahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Hochschulen und Allgemeinbildenden Schulen, aus Umweltbildungszentren und aus der Industrie, aus Politik und Verwaltung bei der Tagung im März 2017 haben uns darin bestätigt. In Hessen ist schon viel passiert: Dies zeigen nicht nur die landesweit mehr als 170 Umweltschulen, sondern auch das Zertifizierungsverfahren Bildungsträger für nachhaltige Entwicklung. Damit setzt sich das Land für eine Bildung ein, die nicht nur vorausschauendes Denken fördert, sondern auch zu einem Handeln befähigt, das nachhaltig und zukunftsfähig ist. Dazu gehört zum einen, Herausforderungen wie die Globalisierung und den Klimawandel zu verstehen. Zum anderen geht es aber auch darum, mit technischen Möglichkeiten sowie sozialen oder wirtschaftlichen Entwicklungen umgehen zu können. Im Bildungsbereich liegt hier ein Schwerpunkt auf den sogenannten MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Wir wissen, dass sich viele andere Schulen im Bereich der BNE engagieren und dafür Auszeichnungen erhalten. Um diese vielfältigen Ansätze zu bündeln und so das Thema insgesamt zu stärken, möchten wir die Dachmarke Nachhaltigkeit lernen in Hessen etablieren. Hier sollen alle hessischen Schulen mit unterschiedlichen Zugängen zur BNE ein Netzwerk bilden. Sie alle werden als Vorreiter in ihrem Engagement vorgestellt und auf der Internetseite sowie im Newsletter der Nachhaltigkeitsstrategie präsentiert und dürfen das Logo der Dachmarke verwenden. Sie sehen, dass auch nach knapp zehn Jahren noch viel zu tun bleibt und wir alle in unserem Bestreben nicht nachlassen dürfen und auch nicht wollen! In diesem Sinne wünsche ich allen Akteuren, die die Idee der BNE mittragen und umsetzen, in ihrer Arbeit weiterhin viel Erfolg. Die vorliegende Dokumentation kann dabei sicher viele neue Impulse geben. Ich bin überzeugt davon: Bildung ist der Schlüssel für den Wandel hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft.
8 8 Nachhaltigkeit lernen in Hessen Grußwort Nachhaltigkeit an der Hochschule Fulda Prof. Dr. Kathrin Becker-Schwarze Vizepräsidentin der Hochschule Fulda sehr heterogenen Gruppe von Studierenden zu tun. Studierende kommen direkt nach ihrem Schulabschluss an die Hochschule, andere haben bereits eine Ausbildung absolviert, studieren berufsbegleitend, sind Rückkehrer*innen an die Hochschule oder orientieren sich nach längerer Berufstätigkeit fachlich völlig neu. Die Hochschulen haben den Auftrag, diesen Studierenden mit sehr unterschiedlichen Lernbiographien, Hochschul zugängen und Bildungsvoraussetzungen im Laufe des Studiums mit den verfügbaren Ressourcen einer Hochschule die bestmögliche Bildung, Qualifikation und Berufsbefähigung zu vermitteln. Thema der Fachtagung Nachhaltigkeit lernen in Hessen Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ist natürlich nicht nur ein Thema für Schulen, sondern im Fokus dieses Programms BNE sind auch die Hochschulen. Ich möchte hier einen Aspekt grundsätzlicher Natur herausgreifen, den ich mit sozialer Nachhaltigkeit und noch konkreter mit Bildungsgerechtigkeit beschreiben möchte. Die Hochschulen sind nicht erst seit gestern mit dem Problem des starken Aufwuchses konfrontiert, dass derzeit ca. 55% eines Schüler-und Schülerinnen-Jahrgangs den Weg an die Hochschule suchen. Damit korrespondiert die Tatsache, dass die Hochschulzugangsberechtigung ausgeweitet wurde. Wir haben es also mit einer Die Hochschule Fulda hat sich in den letzten Jahren sehr gut auf die unterschiedlichen Studierendenbiographien eingestellt und fühlt sich dem Prinzip des lebenslangen Lernens verpflichtet. Wir haben an der Hochschule Fulda insofern nicht nur reine Präsenzstudiengänge, sondern seit über 15 Jahre bilden wir duale und berufsbegleitend Studierende in Blended-Learning-Studiengängen aus. Und natürlich haben wir mit dem Problem zu kämpfen, dass die Kenntnisstände der Studierenden sehr unterschiedlich sind. Hier versuchen wir individuelle Lernunterstützungsangebote für die Studierenden anzubieten. Die Probleme liegen nicht nur im MINT-Bereich, sondern betreffen eigentlich alle Fachdisziplinen. Wir haben darüber zwar keine harten Daten, aber nehmen vermehrt war, dass Defizite im Textverständnis und mangelnder Konzentration wahrzunehmen sind. Gerade im MINT-Bereich gibt es unzählige Programme in den Hochschulen zu Maßnahmen in der Studieneingangsphase, weil wir
9 Nachhaltigkeit lernen in Hessen 9 es in den MINT-Bereichen mit besonderen Problemen zu tun haben. Studierende haben hier die Möglichkeit, ihr Studium um zwei weitere Semester zu strecken. Wir versprechen uns damit eine höhere Abschluss quote. Und wir bieten einen internationalen ingenieurwissenschaftlichen Studiengang an, der ja auch auf der Tagung präsentiert ist. Der Studiengang ist im Basisstudium englischsprachig und richtet sich sowohl an internationale wie deutsche Studieninteressierte, insbesondere an Studieninteressierte mit Migrationshintergrund. Zudem legt die Hochschule ein besonderes Augenmerk auf Schulkooperationen, die in vielfältigen Formen stattfinden. Die Hochschule geht nicht nur in die regionalen Schulen, stellt Studiengänge vor, hält Vorträge, es werden in einigen Schulen auch Veranstaltungen zum Programmieren und wissenschaftlichen Arbeiten angeboten. Viele Schüler*innen kommen zu Veranstaltungen in die Hochschule. Diesen Bereich der Schulkooperation gilt es noch weiter auszubauen. Einen zweiten wichtigen Baustein nimmt MINT Mach- Club ein. Das ist ein Projekt, das durch das Land Hessen gefördert wird und Menschen jeden Alters für das Thema MINT begeistern will. Sie sehen also, dass die Hochschule Fulda sich mit vielfältigen Ansätzen den neuen und wachsenden gesellschaftlichen Anforderungen stellt, um jungen Menschen in den unterschiedlichsten Lebensphasen ein erfolgreiches Studium zu ermöglichen.
10 10 Nachhaltigkeit lernen in Hessen Grußwort Nachhaltigkeit heißt miteinander und voneinander lernen Martina Teipel, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umwelt bildung (ANU), Landesverband Hessen e.v. vernetztes Denken und Handeln, um kompetenzorientiertes Lernen. Das ist der Anspruch einer Bildung für nachhaltige Entwicklung, für die sich die ANU Hessen einsetzt. Wie können wir Kinder und Jugendliche für den richtigen Umgang z.b. mit Natur, Klimawandel, Konsum und für einen gerechten Zugang aller Menschen zu einem guten Leben sensibilisieren? Wie können wir Menschen motivieren? Die ANU Hessen freut sich, die Tagung zusammen mit dem HMUKLV und den vielen Aktiven aus Arbeitsgruppen, Initiativen, Schulen und Verbänden auszurichten. Nachhaltigkeit lernen heißt miteinander und voneinander lernen. Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit sind die heutigen Herausforderungen. Natur und biologische Vielfalt sind die Voraussetzungen für unsere Lebensgrundlagen, die es zu erhalten gilt. Dazu braucht es das naturwissenschaftliche Lernen, das globale Lernen und die Umweltbildung. Es geht um Hier fängt die Arbeit der hessischen Umweltzentren, Verbände, Organisationen und Multiplikatoren, Lehrkräfte, Erzieher*innen der Pädagogen an. Mit innovativen Konzepten und Projekten stehen wir für ein lebendiges handlungsorientiertes Lernen in Schulen, Kindergärten, der Jugendarbeit und auch in der Erwachsenenbildung. Wir bringen Unterstützung von außen. Hessen unterstützt diese Arbeit. Das zeigt sich in zahlreichen Projekten, die von der hessischen Nachhaltigkeitsstrategie, dem Kultusministerium und dem Runden Tisch Bildung für nachhaltige Entwicklung initiiert wurden: wie z.b. das Schuljahr der Nachhaltigkeit, die Auszeichnung Umweltschulen, die regionalen Netzwerke BNE, die heutige Tagung, die Klimaschutzstrategie und die neue Dachmarke Nachhaltigkeit lernen in Hessen.
11 Nachhaltigkeit lernen in Hessen 11 Ein großes erfolgversprechendes Netzwerk ist inzwischen entstanden und es wird wachsen. Davon können Sie sich heute schon einen Eindruck verschaffen. Holen Sie sich Anregungen von knapp 20 Ausstellern und in 15 Workshops, in denen sie erleben können wie Bildungsarbeit für unterschiedliche Zielgruppen zu den Schlüsselthemen einer nachhaltigen Entwicklung aussehen kann. Seien Sie gespannt, so wie ich, auf die Vorträge von Herrn Prof. Dr. Messner, der uns Nachhaltigkeit als Antwort auf globale Herausforderungen aufzeigt, auf die Talkrunde BNE, auf die Impulsvorträge zum Grundschulbereich mit Prof. Astrid Kaiser, vom Institut der Pädagogik der Universität Oldenburg zur BNE und MINT Unterricht mit Prof. Dr. Ingo Eilks vom Institut für Didaktik der Naturwissenschaften der Universität Bremen zur Berufsbildung mit Andrea Mohoric vom Forschungsinstitut Betriebliche Bildung, Berlin. Wir freuen uns, dass das Umweltministerium diese Tagung ermöglicht und in Hessen die Nachhaltigkeit und die Bildung für nachhaltige Entwicklung zu Schwerpunktthemen ernennt. Das ist vorsorgende Umweltpolitik und die beste Investition in die Zukunft. Wir wünschen Ihnen und uns anregende Vorträge, Workshops und Gespräche und neue Impulse für Ihre Arbeit. Werden wir zusammen aktiv für Nachhaltigkeit lernen in Hessen.
12 12 Nachhaltigkeit lernen in Hessen Vortrag Die Agenda 2030 Große Transformation zur Nachhaltigkeit Prof. Dr. Dirk Messner, Direktor des Deutschen Instituts für Entwicklungs politik (DIE), Bonn & Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen Die Verwandlung der Welt im 21. Jahrhundert Die große Transformation zur Nachhaltigkeit kann nur basierend auf Wissen und Bildung bewerkstelligt werden. Die Welt im 21. Jahrhundert hat sich verwandelt. Wir Menschen sind die größte geologische Kraft im Erdsystem geworden. Die Menschen können das Erdsystem und dessen Dynamik grundlegend verändern. Erdsystemwandel ist möglich von Menschen voran getrieben und historisch gesehen ist das eine neue Herausforderung, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Wenn wir die Nachhaltigkeitsfragen auflösen wollen, dann geht es darum, zu verstehen, wie das Erdsystem mit seinen unterschiedlichen Bestandteilen (dem Ozean, dem Klimasystem, den Wäldern, der Biodiversität) interagiert mit sozialen Systemen (Gesellschaft, Wirtschaft, Menschheit) und mit technischen Systemen (Mobilitätssysteme, Energiesysteme, Infrastruktur). Am Ende des Tages geht es darum, zu verstehen, welche Auswirkungen unsere technischen Entscheidungen und die Weiterentwicklung der Gesellschaften und Wirtschaft auf das Erdsystem haben. Das ist eine große Herausforderung für die Bildung, die Forschung und die Universitäten. Bezüglich der Weltgesellschaft und der globalen Interdependenzen müssen Lösungen im lokalen Bereich gefunden und entwickelt und national verändert werden. Doch die Lösung der Probleme einer erdsystemkompatiblen Weltwirtschaft kann nur erreicht werden, wenn im globalen Kontext ähnliche Prozesse entstehen. Hier ist eine globale Kooperation entscheidend. Wenn es nicht gelänge, eine globale Kooperationskultur zu entwickeln, im Laufe des 21. Jahrhunderts, dann werden viele Probleme nicht lösbar sein. Mit der globalen Interdependenz verbunden ist, dass wir als Menschheit, als Individuum und Gesellschaften, lernen müssen, dass die Entscheidungen, wie wir heute treffen, nicht nur für die nächste und übernächste Generation von Bedeutung sind, sondern sie alle Generationen. Dies ist eine neue, eine kulturelle Herausforderung. Aus meiner Perspektive ist die
13 Nachhaltigkeit lernen in Hessen 13 größte Herausforderung nicht, die entsprechenden finanziellen Mittel oder die entsprechenden Technologien zur Lösung der Probleme zu haben, beides ist vorhanden. Die Kernproblematik ist, dass wir es mit kulturellen und zivilisatorischen Veränderungen zu tun haben, auf die wir uns in der Bildung und an den Hochschulen und Universitäten vorbereiten müssen. Das was heute zur Nachhaltigkeit diskutiert wird, hat die Qualität einer Aufklärung, die uns eine neue Welt beschert hat. Sie hat durch die Art und Weise, was wir als Rechte und Pflichten von Menschen gegenüber einer Gemeinschaft sowie die Rolle Staaten in unserer Gesellschaft sehen, ein neues Zeitalter eingeläutet. Die Nachhaltigkeitstransformation müsste auch ein neues Zeitalter einläuten. Bereits Immanuel Kant hat gesagt: Es geht in der Aufklärung um die Veränderung der Denkungsart des Menschen. Globaler Gesellschaftsvertrag für Nachhaltigkeit und Inklusion Wenn man die Agenda 2030 und die 17 Ziele der SDGs optimistisch interpretiert, könnte man sagen, dass dies ein globaler Gesellschaftsvertrag für Nachhaltigkeit und inklusive Entwicklung ( leave no one behind ) darstellt. Die 17 Ziele können in 4 Messages zusammengefasst werden: 1. Armutsbekämpfung und Reduzierung von Ungleichheit 2. Grenzen des Erdsystems 3. Wohlstand, der universalisierbar ist ( Wachstum) 4. Gute Regierungsführung und internationale Kooperationen Die Umsetzung dieser Agenda stellt eine sehr komplexe, aber durchaus lösbare Herausforderung dar. Die meisten Elemente die man braucht, um Probleme zu lösen, haben wir bereits und diese müssen nur noch umgesetzt werden. Hierzu gibt es zunächst eine Langfristperspektive. Viele Generationensind wichtig, denn die Nachhaltigkeitsdiskussion denkt in neuen Zeiträumen. Mit Beginn der industriellen Evolution in den letzten 200 Jahren gab es immer markantere Auswirkungen auf das Erdsystem, z.b. dadurch wie Menschen wirtschaften. Dieser Einfluss der Menschen auf das Erdsystem, die Planeten und das Ökosystem ist ein neues Phänomen in der Menschheitsgeschichte. Auswirkungen von Menschen auf das Erdsystemwaren zuvor nur marginal gewesen. Dies ist eine neue Entwicklung und daraus müssen wir in neue Phase der Zivilisation umsteigen. Der Mensch als Triebkraft zur Veränderung des Erdsystems Betrachtet man die Treibhausgasemission im Laufe der letzten Jahre der Entwicklung des Erdsystems, so schwankten diese innerhalb eines bestimmten Korridors. Diese Schwankungen im Erdsystem haben natürliche Ursachen. Doch wie man sieht katapultieren wir uns seit Begin der industriellen Revolution aus diesen natürlichen Schwankungen heraus. So würde bis Ende des Jahrhunderts die globale Erwärmung um 6 Grad Celsius ansteigen. Der Mensch kann den Planeten mit seinen Grundstrukturen verändern. Das muss man sich durch den Kopf gehen lassen. Früher musste man Erdsystemforschung studieren, um die Entwicklung des Planten zu verstehen, nun muss neben den physischen und biochemischen Prozessen auch der wichtigste Treiber zur Veränderung des Erdsystems verstanden werden, nämlich der Mensch. Menschen sind die entscheidende Triebkraft zur Veränderung des Erdsystems. Daher sind die neuen Herausforderungen, vor denen wir stehen, von kultureller Art. Wollen wir diesen Pfad weiter gehen oder die Stabilität des Erdsystems für die kommenden Generationen bewahren? Für einen beachtlichen Teil der Weltbevölkerung hat die Globalisierung entscheidende wirtschaftliche Vorteile gebracht, vor allem im globalen Süden. Die Anzahl der Menschen, die dort in der Mittelschicht leben, ist enorm angestiegen lebten international 1,3 Milliarden Menschen in der Mittelschicht. Davon lebte 1 Milliarde in den Industrieländern, den Rest in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Aktuell sind 2 Milliarden, davon weiterhin 1 Milliarde in den Industrieländern und 1 Milliarde im globalen Süden. Somit wachsen die Mittelschichten im globalen Süden werden es 5 etwa Milliarden Menschen sein, die zu der globalen Mittelschicht gehören. 20 % bei uns,
14 14 Nachhaltigkeit lernen in Hessen 80 % in Entwicklungs- und Schwellenländern. Das ist prinzipiell eine gute Nachricht, aber wenn der Anstieg sich auch in der Form auf die Emissionen auswirkt, wie es bei uns üblich ist, würde dies alle Grenzen des Erdsystems sprengen. Daher muss der Wohlstandsschub in den Ländern des Südens auf einem neuen Wachstumsmuster basieren. Zwei wichtige Messages aus den Naturwissenschaften Aus den Naturwissenschaften heraus gibt es zwei wichtige Kern-Messages, wenn es um die große Nachhaltigkeitsproblematik geht, die in den letzten 10 Jahren erarbeitet worden sind. Die Naturwissenschaften sind inzwischen gut in der Lage, uns die zentralen 9 Dimensionen des Erdsystems vor Augen zu führen und deren Grenzen zu markieren, die man nicht überschreiten darf, weil es sonst zu einer Inbalance des Erdsystems kommt. Wir haben in den letzten 10 bis 15 Jahren in der Forschung viel über Tipping Points gelernt (Kipppunkte im Erdsystem). Das sind Kipppunkte im Erdsystem, die darstellen, was passiert, wenn bestimmte Grenzen und Schwellenwerte überschritten werden. Dann werden Dynamiken in Gang gesetzt, die zu einer Transformation von Teilelementen des Erdsystems führen. Bei einigen Kippunkten weiß man, was danach kommt, bei anderen nicht. Es handelt sich dabei um Hochrisikostrategien. Wir kennen inzwischen knapp 20 Tipping Points des Erdsystems. Hope Speech Ich möchte Sie heute nicht ohne eine Hope Speech gehen lassen, denn alle die genannten komplexen Probleme können schnell paralysieren. Hierzu eine kleine Geschichte: Vor den Klimaverhandlungen in Paris 2015 hat mich die Generalsekretärin des Klimasekretariats mich darum gebeten eine Hope Speech zu halten. Dies habe ich getan, nicht nur um Mut zu machen, sondern auch weil ich wirklich glaube, dass die Aussagen im Kern richtig sind und dass wir die Möglichkeiten haben, die Problemlagen zu lösen. Hierzu möchte ich mich auf den Klimawandel konzentrieren. Mein Konzept der damaligen Hope Speech stammte von Osterhammel: Sein Buch heißt die Verwandlung der Welt im 19 Jahrhundert. Er hat darin ein geniales Konzept entwickelt, dass er als Häufigkeitsverdichtung bezeichnet. Er beschreibt darin den Übergang von Agrargesellschaften zu Industriegesellschaften. Häufigkeitsverdichtung meint das Folgende: 1785 wird die Dampfmaschine erfunden. Zunächst ist der Effekt auf die
15 Nachhaltigkeit lernen in Hessen 15 Wirtschaften gleich Null. Dann wird die Maschine in den ersten Sektoren angewandt. Es wird Wasser damit gepumpt, sie wird genutzt, um neue Formen der Mobilität zu erzeugen, Eisenbahnen und neue Industriezweige entstehen. Es findet eine Verdichtung von neuen Trends in Richtung einer Gesellschaftsformation statt. Es gibt inzwischen viele Beispiele für Häufigkeitsverdichtungen in Richtung Nachhaltigkeit, die alle in den letzten wenigen Jahren stattgefunden haben. Meine Interpretation daraus ist, wir haben die Elemente die man braucht, um die Nachhaltigkeitstransformation durchzuführen, alle auf dem Tisch. Das ist der große Unterschied zwischen 2017 im Vergleich zu 1970, als begonnen wurde über die Grenzen des Wachstums nachzudenken. Damals hatte man eine Problemanalyse, aber keine Technologien, um die Probleme zu lösen. Ein Beispiel ist das Energiesystem. 75 % der CO 2 Emission sind mit dem Energiesystem verkoppelt. Seit 2013/14 gibt es erstmals seit beginnen der industriellen Revolution bei den Neuinvestitionen im Energiebereich höhere Investitionen in erneuerbaren, nicht fossilen Bereich als im fossilen Bereich. Das fossile Modell ist auslaufendes Geschäftsmodell. Und das ist ein Trend in die richtige Richtung. Ein weiteres Beispiel: 2015 im Juni gab es ein G7 Meeting in Deutschland. Hier kamen die wichtigsten Industrieländer zusammen. Für mich war es sehr erfreulich, im Abschlussdokument zu lesen, dass sich die G7-Staaten dazu ausgesprochen haben, dass wir das fossile Zeitalter im 21. Jahrhundert beenden müssen. Eine Decarbonisierung der Weltwirtschaft im 21. Jahrhundert ist gefordert. Es findet eine Veränderungsart der Denkungsart des Menschen statt. Zusammenfassung Die größte Herausforderung ist nicht technologischer Art, denn wir haben viele Technologien die wir brauchen. Auch können wir die Transformationen finanzieren. Die Finanzierung der Transformation ist billiger als die Schäden, die durch die Weiterverfolgung des etablierten Wirtschafts-und Wachstumsmusters entstehen. Für mich ist das größte Problem ist die Perspektivveränderung hinzubekommen. Dass wir es hinzubekommen, zu schauen, wie unter den Bedingungen von globaler Interdependenz und den Grenzen des Erdsystems, wir international Wirtschafts- und Gesellschaftsmodelle voranbringen müssen, die diesen Anforderungen genügen. Das ist eine kulturelle und zivilisatorische Aufgabe. Und dafür sind Bildung und Forschung wichtig.
16 16 Nachhaltigkeit lernen in Hessen Talkrunde BNE als Antwort auf globale Herausforderungen Renate Labonté, Geschäftsstelle Nachhaltigkeitsstrategie Hessen Ulrich Striegel, Hessisches Kultusministerium Prof. Dr. Dirk Messner, Direktor des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik (DIE), Bonn & Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen Heike Blaum, Landesverband Hessen im Verband der Chemischen Industrie e.v. Moderation: Dr. Tanja Busse ó Wie wir gehört haben, gibt es große globale Anforderungen, aber Hessen ist einer der Länder, das schon relativ viel macht. Es gibt schon eine Dachmarke, unter der sich Schulen im Bereich der BnE bündeln können, aber die Nachhaltigkeitsstrategie Hessen umfasst noch deutlich mehr. Was macht Hessen schon alles um sich diesen gewaltigen Aufgaben zu widmen? Frau Labonté: Die Landesregierung hat die SDGs in der Nachhaltigkeitsstrategie in der Task force verankert, das bedeutet dass die Ziele und Indikatoren resortübergreifend mit allen gesellschaftlichen Akteuren gemeinsam aufgestellt werden und sich dabei nicht mehr an dem 3-Säulen-Modell orientiert wird, sondern an den 17 SDGs. ó Die Nachhaltigkeitsstrategie gibt es noch nicht in allen Bundesländern, ist es wichtig dass es eine Nachhaltigkeitsstrategie gibt und dass diese ganz oben aufgehängt ist? Frau Labonté: Ja, da sind wir in Hessen wirklich gut aufgestellt, weil die Nachhaltigkeit nicht nur im Umweltministerium angesiedelt ist, sondern wir resortübergreifend arbeiten und eng mit der Staatskanzlei kooperieren, die hinter uns steht.
17 Nachhaltigkeit lernen in Hessen 17 ó Der Begriff resortübergreifend ist ja nun schon mehrfach gefallen. In vielen Bundesländern sind die Umweltministerien sehr aktiv und dann kommt immer die Frage nach den Lehrplänen. Wie läuft es denn in Hessen ab mit der Zusammenarbeit mit dem Kultusministerium und in wie weit ist es involviert? Herr Striegel: Das Kultusministerium arbeitet eng mit der Staatskanzlei und dem Umweltministerium zusammen. Wir sind in bundesweite Prozesse eingebunden, es gibt einen nationalen Aktionsplan, der sich aktuell in einer online Beratungsphase befindet und im Sommer das Licht der Welt erblicken wird. Und wir sind auf hessischer Ebene mit dem Klimaschutzplan, der Biodiversitätsstrategie und der Nachhaltigkeitsstrategie eng vernetzt. Es besteht eine gute und enge Zusammenarbeit ohne Resortegosimen. ó Noch kurz zu den Lehrplänen, da hat Hessen auch schon einiges verankert. Wie weit finden sich Themen der Nachhaltigkeit in den Lehrplänen wieder, so dass diese nicht nur in Schulen aufgegriffen werden, die unter die Dachmarke fallen, sondern so dass alle Schülerinnen und Schüler mit diesen Themen konfrontiert werden? Herr Striegel: Der Gedanke, dass die Nachhaltigkeitsthemen in den hessischen Lehrplänen auftauchen muss, ist absolut der Richtige. Wir haben in Hessen weitgehend umgesteuert von Lehrplänen hin zu Bildungsstandards und in den Bildungsstandards kommt das Thema Nachhaltigkeit in verschiedenen Aspekten vor. Wir hatten auch schon eine Abiturprüfung zum Thema Nachhaltigkeit. Wir haben in dem Bildungsplan 0-10 das Thema Nachhaltigkeit weiter ausgebaut und wir arbeiten momentan daran die Kerncurricula zu konkretisieren, auch unter dem besonderen Aspekt der Nachhaltigkeit, so dass sich in diesem Punkt in Hessen eine ganze Menge auf unterschiedlichen Ebenen tut. Zum Sommer wird das Thema Bildung für Nachhaltige Entwicklung auch im Schulgesetzt aufgenommen. ó Frau Blaum, die Frage nach der Wirtschaft kam heute bereits und sie als Vertreterin vom Verband der chemischen Industrie in Hessen sind am Prozess Bildung für Nachhaltige Entwicklung beteiligt. Was genau machen Sie denn da? Frau Blaum: Der CVI engagiert sich zu diesem Thema direkt im Ministerium, Frau Labonté hat die AG, die sich mit der Verzahnung von MINT-Bildung und BNE beschäftigt, bereits erwähnt, wir sind aber auch in anderen Arbeitskreisen aktiv, z.b. in den Feldern Biodiversität, Energie oder Klimawandel. Das sind alles unsere Felder in denen die chemische Industrie den Fortschritt durch Schlüsseltechnologien mit bestreiten kann. Zum einen muss sich die Industrie selbst wandeln, zum anderen bieten wir auch die Lösungen, damit Veränderung überhaupt funktionieren kann. Im speziellen Falle der MINT-Bildung sind wir seit vielen Jahren aktiv, weil wir junge Menschen motivieren möchten, neugieriger zu sein auf das Leben und die Umwelt, damit sie Dinge hinterfragen, um ihr Verhalten und ihre Denkmuster ändern zu können. Wir sind davon überzeugt, dass dies nur mit einem Wissenserwerb gelingen kann. Wir brauchen Bildung, wir müssen das Wissen vermitteln, wie Dinge miteinander zusammenhängen und das versuchen wir, indem wir Lehrerfortbildungen anbieten, die sich mit naturwissenschaftlichen Experimenten beschäftigen, um Lehrkräften Unterstützung zu bieten. Große Nachfrage gibt es hierzu gerade im Grundschulbereich und das Interesse dort stärker mit den Kindern zu arbeiten ist sehr groß. Die Kinder sollen experimentieren können, um ihre Umwelt besser kennenlernen zu können, um so auch ihre Sichtweise verändern zu können. ó Herr Messner, wenn sie hören, was in Hessen alles passiert und dies mit ihrem globalen Blick betrachten, haben sie das Gefühl, dass Hessen auf einem guten Weg ist? Herr Messner: Soweit ich das beurteilen kann, gehen die Dinge in die richtige Richtung. In NRW gibt es ähnliche Anstrengungen, während andere Bundesländer noch nicht so weit sind. Zwei Punkte möchte ich noch unterstreichen und zwar zum einen in Bezug auf die Curricula und der Bedeutung von Nachhaltigkeit. Meine Analogie hierzu wäre die Diskussion die ich gerade mit den G20-Entscheidungsträgern führe. Wir versuchen im Augenblick mit einem Netzwerk aus Forschungseinrichtungen der G20 Länder die G20-Entscheidungsträger zu beraten und unsere Kernmessage ist, dass die Nachhaltigkeitsagenda kein Add-On ist, das man noch zusätzlich berücksichtigen muss, sondern es sollte der Rahmen sein, indem wir dann nach Lösungen suchen. Wir müssen also die planetaren Grenzen berücksichtigen. Das ist der Rahmen, in dem man schauen muss, was dies für die Weltpolitik, Wachstumspolitik und Industriepolitik bedeutet. In den Curricula stelle ich es mir auch so vor, dass dies integriert
18 18 Nachhaltigkeit lernen in Hessen werden muss. Der zweite Punkt ist die Bedeutung von Wissen. Ich finde das ist ein sehr wichtiger Punkt. Gesellschaftliche Veränderungsprozesse haben oft durch radikale Krisenprozesse stattgefunden. Z.B. haben die Menschenrechtserklärungen der Vereinten Nationen nach zwei Weltkriegen stattgefunden. Der einzige Mechanismus um Krise nicht zum Veränderungsmotor werden zu lassen, ist wissensbasiert zu handeln, indem man Probleme erkennen und dann nach Lösungen suchen kann, bevor man in die Krise hineinstürzt. Deswegen sind Bildung und Erziehung so relevant. Herr Striegel: Ich bin dankbar für den Hinweis zum übergreifenden Kooperieren. Für das Kultusministerium ist Nachhaltigkeit kein Biologiethema, sondern ein fächerübergreifendes Thema, was es im schulischen Alltag manchmal schwierig macht, die Nachhaltigkeit im Unterricht oder in das Bildungssystem zu implementieren. Man muss sich im Schulalltag mit den Kollegen aus anderen Fachrichtungen absprechen, wer das Thema Nachhaltigkeit wann in welcher Form im Unterricht behandelt, damit es nicht passiert, dass das Wort den Schülern zu den Ohren raushängt. Es muss gut abgestimmt werden und diese fächerübergreifende Zusammenarbeit ist eine Herausforderung auf der schulischen Ebene. ó Für mich hört sich das nach einer Überforderung für die Lehrer an, wie kann man diese große Fragen runter brechen, damit es zu händeln ist? Frau Labonté: Die Herausforderung ist es, bürgernah zu sein. Die einen sprechen so selbstverständlich von den SGDs, dass sich andere gar nicht trauen nachzufragen, was das ist. Die Aufgabe der Nachhaltigkeitsstrategie ist es, den Begriff so zu übersetzen, dass man viele Menschen erreicht und ihn in den Lebensalltag bringt. Man muss es konkret machen und auch in der Sprache darauf achten, es so zu kommunizieren, dass man viele Leute erreicht. ó Ist das ein Apell an die einzelnen Lehrer und wie kann man als Ministerium noch mehr die Kollegen und Trägereinrichtungen erreichen? Frau Labonté: Das Ministerium bietet an, wenn jmd. Ideen hat, wie wir unterstützen können, können diese ans Ministerium weitergegeben werden. Es ist wichtig, dass die Schulleitung das Thema mitträgt, damit es nicht an einzelnen Lehren hängt. Frau Blaum: Man erwartet oftmals zu viel. Z.B. in der Ausbildlung, hier werden junge Menschen bereits damit konfrontiert, was es heißt, nachhaltig zu wirtschaften und wie die Auswirkungen auf Soziales und Umwelt sind. Das ist ein komplexes Thema, das schnell überfordern kann und hier braucht es Unterstützungssysteme von außen die spezielle Themen in Schulen und Kindergärten hineintragen. Hier sollte man sich nicht davor scheuen, sich Unterstützung zu holen, um selbst daraus zu lernen und dann Dinge mit eigenen Ideen fortführen zu können. Man muss die komplexen Aufgaben, die zu bewältigen sind, auf die eigene kleine, lokale Einheit herunter brechen können. Hier ist die Wertschätzung von kleinen Schritten wichtig, die auch zur Veränderung führen. ó Wie ist an dieser Stelle die Rolle des Verbandes der Chemischen Industrie? Die chemische Industrie befindet sich ja selbst gerade in einem Wandel und es gibt auch Unterstellungen, dass das was die chemische Industrie im Bereich der Nachhaltigkeit macht, als Green Washing gemacht wird. Frau Blaum: Green Washing kann man uns sicherlich nicht unterstellen. Die Industrie an sich ist darauf bedacht, Geld zu verdienen und das geht mit herkömmlichen Methoden inzwischen nicht mehr, daher wird nach alternativen Methoden gesucht. Wir nehmen aus Schulen mit, dass Lehrer Unterstützung brauchen, dass Lehrpläne das Thema Zukunftstechnologien nicht ausreichend beinhalten, daher bieten wir Fortbildungen für Lehrer an, die sich mit Biotechnologien, Elektromobilität, Brennstoffzellen mit oder neuen Lichtmöglichkeiten beschäftigen wollen. Wir versuchen Bezüge zu unserem Lebensalltag herzustellen und die Sinnhaftigkeit zu vermitteln. ó Es gibt ja in Hessen einige die Biodiversitätsstrategie und den Klimaschutzplan, die nur dann mit Leben gefüllt werden könne, wenn die Schüler auch verstehen, warum sie das machen, wie kann man das verbinden, oder ist das dann noch eine weitere Aufgabe für die Lehrer? Herr Striegel: Vor allem ist das eine Herausforderung für uns. Wir müssen versuchen die verschiedenen politischen Stränge miteinander zu verbinden, auf nationaler Ebene und auf hessischer Ebene. Dabei laufen wir immer Gefahr, dass Externe ganz viele Forderungen in Richtung Bildung stellen. Wir müssen das so weit
19 Nachhaltigkeit lernen in Hessen 19 kanalisieren, dass es realistisch vor Ort durchführbar ist und da versuchen wir die einzelnen Pläne möglichst gut miteinander zu verbinden, so dass wir für die Schulen vor Ort die Dinge handhabbar machen. Daher müssen Themen wie die Klimabildung und die Biodiversitätsstrategie in die Lehrerbildung und Lehrerfortfortbildung implementiert werden in die Bidungsplanarbeit einfließen und wir versuchen Netzwerke zu stärken. Wir haben in Hessen zehn Umweltzentren und sind bemüht mit dem Umweltministerium diese Anzahl auszubauen, so dass am Ende für die Schulen vor Ort ein möglichst machbares Paket ankommt. Vernetzung ist daher ein zentraler Aspekt auf regionaler, nationaler und landesweiter Ebene, um die Lehrkräfte mit der Herausforderung nicht alleine dastehen lassen. ó Gibt es von Ihnen noch Ideen und Vorschläge für die Ebene der Macher an den Schulen, in den Kinder gärten und an den Universitäten? Herrn Messner: Ich denke es ist wichtig, ein neues Leitbild für eine gesellschaftliche Entwicklung zu haben. Wir reden über ein erweitertes Leitbild das notwendig ist, um Wohlstand auf Dauer zu erhalten. Damit man Menschen motivieren kann, sich zu engagieren, ist es wichtig, dass man zeigt, dass Dinge auf eine andere Art funktionieren können. Daher war z.b. die Industriewende in Deutschland ungemein wichtig. Man muss mit Beispielen arbeiten, die zeigen, dass es anders funktioniert und damit muss man auch im Unterricht arbeiten. Außerdem ist die individuelle Ebene wichtig, das können Schüler sein, Studenten, Stadtabgeordnete etc. sein. Man muss für sich selbst übersetzen, was man selbst individuell tun kann. Und das alles sind keine Alternativen zueinander, sondern es muss miteinander verbunden werden, um erfolgreich zu sein. ó Jeder der sich mit Themen Nachhaltigkeit auseinandersetzt, wird verstehen, warum wir ein neues Leitbild brauchen. Gleichzeitig erleben wir in der Gesellschaft ein erodieren des Glaubens an die Wissenschaft. Macht Ihnen das Sorge für die BNE? Wie schätzen Sie diese Entwicklung ein? Frau Blaum: In Sorge bin ich nicht, aber man muss natürlich wachsam sein und noch aktiver sein. Es geht darum, mit positiven Beispielen zu überzeugen, dass es kein Hexenwerk ist, sonders etwas, das möglich ist und man muss stärker den Nutzen und die Machbarkeit herausstellen und die Verantwortung, die jeder als wichtiges Mitglied einer Gesellschaft übernehmen kann, betonen. Herr Striegel: Ich denke, die Menschheit braucht eine Phase um sich der Bedeutung von Demokratie, wirtschaftlicher Unabhängigkeit etc. gerecht zu werden. Für den Bildungsprozess heißt dies, dass wir uns verstärkt bemühen müssen. Wir haben ein sehr gutes Faktenwissen, auf dessen Basis wir auf der sicheren Seite sind. Im Bildungsbereich können wir diese Fakten gut entwickeln, aber wir brauchen ein Ziel, welches wir als Gesellschaft erreichen wollen. Das ist eine große Herausforderung für uns, für die wir ein neues Leitbild brauchen. ó Wie könnte so ein neues Leitbild aussehen? Frau Labonté: Es gibt keine Alternative zur Bildung, man kann Postfaktischem nur begegnen, wenn wir weitermachen. Man darf nicht hoffnungslos sein. Die Pflanzen in den Schulen sind am wachsen, es gibt gute Trends in den Schulen. Man muss die Schüler nur dazu bringen, aufzustehen und zeigen, dass es andere Wege gibt und in den Schulen motivieren. Noch kurz etwas zum Klimaschutzplan. Dieser ist gestern in Hessen durch das Kabinett gegangen und verabschiedet worden. Er ist im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie mit vielen Akteuren aufgestellt worden und sehr maßnahmenorientiert. Er ist auch anspruchsvoll in der Umsetzung. Wir sind nun in Hessen auch beim Thema Klimabildung noch stärker gefordert, insgesamt passiert aber schon sehr viel.
20 20 Nachhaltigkeit lernen in Hessen Impulsvortrag Wege zur Bildung für Nachhaltigkeit im Grundschulalter Prof. Dr. Astrid Kaiser Institut für Pädagogik, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Dimensionen aus. Bildung ist nach der Definition des Didaktikers Wolfgang Klafki, der Zusammenhang von Selbstbestimmungs-, Mitbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit. Tendenzen in der Risikogesellschaft und Gesellschaftliche Entwicklungen Die heutige Risikogesellschaft mit der Globalisierung, Konsumexpansion, zunehmenden Individualisierung und Zunahme der Ungleichheit bedingt einen Wandel von Lehren und Lernen. Für die Didaktik einer Risikogesellschaft sind drei Punkte von entscheidender Bedeutung: Der kommunikative Austausch, die aktive Mitarbeit an den Versuchen sowie ein gemeinsamer Rahmen und differenzierte Erfahrungen. Verantwortung und Gemeinsamkeit muss in der Gruppenarbeit in den Schulen beginnen, um gesellschaftlich wachsen zu können. Nachhaltigkeit im Bildungskontext Bildung für Nachhaltigkeit ist die Entwicklung von Handlungsfähigkeit jetzt und zukünftig sowie die Verortung des Menschen in seiner Verantwortung für die Welt. Sie macht die Verknüpfung von ökologischen, ökonomischen und soziokulturellen Nachhaltigkeit als Unterrichtsprinzip in der Grundschule Ein kommunikativer Sachunterricht ist ein angemessenes Konzept, um menschliche aktive Seiten voranzubringen, die Eigenaktivität und die Recherchefähigkeit für neues Wissen zu fördern. Geeignete Organisationsformen des Unterrichts sind Stationenlernen mit Handlungsmaterialien, differenzierte Freie Arbeit und Gesprächskreis sowie Projekte um gemeinsame Fragen. Positiv zu werten sind hierbei
21 Nachhaltigkeit lernen in Hessen 21 Aspekte wie Mitbestimmung, Selbstbestimmung, Eigenaktivität, Solidarität, soziale Verantwortung und Achtung vor der Schöpfung. Pädagogisches Denkmodell Wissen soll nicht von oben nach unten weiter vermitteln, sondern Kinder sollen von Kindern lernen. Es geht um eine eigenaktive Wissenskonstruktion durch die Kinder. So sollten Lernwerkstattstrukturen idealerweise Phasen von kommunikativem Austausch über verschiedene Lösungsmöglichkeiten im Wechsel mit differenzierten Arbeitsphasen enthalten. Als Basis gelten themenzentrierte differenzierte Handlungsaufgaben für Kinder und als Organisationsform ein Wechsel differenzierten Arbeitens und gemeinsamer Sitzkreise. Kinder lernen durch Handeln: aus Handeln kommt Erkenntnis, Kinder sind verschieden: differenziertes Lernen ist erforderlich, Kinder lernen von Kindern: Lernen muss sozial strukturiert werden. Kinder eigenen sich die Welt gemeinsam an. Konsequenzen für BNE bedeuten aus der Anthropologie des Kindes heraus, dass Kinder emotional angenommen werden anregende Objekte und Erfahrungen benötigen, Bewegung benötigen zum Entdecken angeregt werden eine sozial-emotionale Auseinandersetzung zur Ich-Findung brauchen anderen Kindern Freundschaft und Zuwendung geben Das Staunen der Kinder bringt Achtung vor der Umwelt hervor und damit die Grundhaltung nachhaltigen Denkens.
22 22 Nachhaltigkeit lernen in Hessen Impulsvortrag Bildung für nachhaltige Entwicklung und MINT Unterricht: Modelle und Perspektiven Prof. Dr. Ingo Eilks Institut für Didaktik der Naturwissenschaften, Fachbereich Biologie und Chemie, Universität Bremen Aktionspläne der Bundesregierung zur Umsetzung der Dekade-Ziele, die KMK-Empfehlung zur BNE in der Schule 2007 und viele Weitere. Leider kommt vieles davon in den Schulen nicht an, wie eine Umfrage gezeigt hat. BNE spielt in der Schule oftmals noch keine große Rolle, vor allem nicht in den MINT-Fächern. Aber gerade die MINT-Fächer sind zentral für eine nachhaltige Entwicklung, weil sie zentral für die Erhaltung des Wohlstandes und für die Arbeitsplätze sind. Die Naturwissenschaften sind in vielen Bereichen der Schlüssel, um eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen, z.b. bei für Energiewände, für die nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung, Ernährung, Gesundheit und Versorgung, sowie auch für moderne Materialien. Nach wie vor findet vor allem im Chemie- und Physikunterricht relativ wenig im Bereich der Nachhaltigkeit statt, obwohl es inzwischen einige gute Modelle hierzu gibt. MINT-Bildung, MINT-Unterricht und BNE / Umweltbildung werden häufig gegensätzlich betrachtet, obwohl es gute Möglichkeiten gibt, beide Aspekte miteinander zu verbinden. Bildung wird als einer der Schlüssel für Nachhaltigkeit angesehen. Daher muss sich neben den außerschulischen Lernorten vor allem auch die schulische Bildung dieser Thematik annehmen, weil durch Schule alle Schülerinnen und Schüler erreicht werden. Hierzu gibt es zahlreichen Initiativen für Schulen, z.b. die UNESCO-Weltdekade zur Bildung für nachhaltige Entwicklung, die Basismodelle für BNE im naturwissenschaftlichen Unterricht Es gibt recht einfache bis zu sehr komplexen Modellen. Das einfachste Modell ist, dass man die Idee einer nachhaltigen Naturwissenschaft und Technik auf die Praxis im Unterricht überträgt. Man wendet einfach das an, was in Chemie und Physik aktuell passiert und nutzt dies in der Schule, z.b. benutzt man energiesparende Geräte, versucht, den Verbrauch an Ressourcen, Chemikalien und Gerätschaften zu reduzieren, versucht Abfälle zu vermeiden und Dinge zu recyceln.
23 Nachhaltigkeit lernen in Hessen 23 Das zweite Modell ist das am häufigsten praktizierte und heißt Context-Based learning. Hier bindet man Themen aus der Nachhaltigkeitsdebatte in die Naturwissenschaften ein. Z.B. lernt man etwas über Photovoltaik im Rahmen des Themas Energie im Physikunterricht, oder man lernt etwas über nachwachsende Rohstoffe, indem man sich damit auseinandersetzt, wie Biodiesel hergestellt wird. Das dritte Modell beschäftigt sich mit der Betrachtung von kontroversen Themen in der Gesellschaft ( Socio-Scientific Issues-Based Science Education ), bei denen Handlungsoptionen zur Entscheidung anstehen. So z.b. beim Thema Klimawandel: Hier muss entschieden werden, ob und wie man darauf reagiert. Oder beim Bioethanol, will man dass dies gefördert wird oder sollen stattdessen lieber Nahrungsmittel angebaut werden? Das vierte Modell beinhaltet die Fokussierung auf Nachhaltigkeitsstrategien als systematisches Element der Schulentwicklung. Damit können z.b. Aktionen verbunden sein, die an den Schulen durchgeführt werden, wie die Verbindung des Lernens über Müll und Abwasserbehandlung mit konkreten Aktivitäten der Müll- und Abwasservermeidung an der Schule, oftmals auch durch die Vernetzung mit außerschulischen Partnern oder mit Hilfe eines Schülerlabors. Die vier Modelle haben ganz unterschiedliche Potenziale für ein Lernen über nachhaltige Entwicklung, für eine nachhaltige Entwicklung oder um direkt einen Beitrag für nachhaltige Entwicklung zu leisten. Chemie, Umwelt, Nachhaltigkeit Schülerlabore als Innovationsmotor für Nachhaltigkeit und MINT-Bildung Zudem gibt es diverse Modellprojekte, wie z.b. das Projekt Chemie, Umwelt, Nachhaltigkeit, das im Schülerlabor die verschiedenen Modelle miteinander verbinden soll. Das Schülerlabor kann helfen innovative und nachhaltige Experimentiertechniken zu entwickeln und an Lehrkräfte heranzutragen (Modell 1), über die Nähe zur Wissenschaft neue Nachhaltigkeitsthemen und kontexte für den Unterricht aufarbeiten (Modell 2), über die Auseinandersetzung mit authentischen Fragestellungen aus Wissenschaft und Technik zur Thematisierung gesellschaftlicher Herausforderungen zu führen (Modell 3) und kann durch systematische Vernetzung von Schulen mit dem Schülerlabor innovative Strukturen schaffen und zur Schulentwicklung beitragen (Modell 4). Zusammenfassung / Ausblick Die MINT Fächer haben eine zentrale Verantwortung für Nachhaltigkeitsbildung, insbesondere die Naturwissenschaften. Due Nachhaltigkeitsbildung bietet enorme Chancen die MINT-Bildung interessanter, authentischer und relevanter zu machen. Man sollte sich über die verschiedenen Rollen im Klaren sein, die Nachhaltigkeitsbildung in den MINT-Fächers spielen kann und man sollte den Mut haben, auch unkonventionelle Ansätze zu verfolgen, um Nachhaltigkeitsbildung in den MINT-Fächern und darüber hinaus zu stärken.
24 24 Nachhaltigkeit lernen in Hessen Impulsvortrag Nachhaltige Entwicklung: Strukturelle Ansatzpunkte in der Berufsbildung Andrea Mohoric Forschungsinstitut Betriebliche Bildung, Berlin und Handeln in der Berufsarbeit. Ein Beispiel ist der Lebenszyklus eines Produktes. Hier müssen Tansportwege, Verbrauch, Rohstoffe, Produktionsbedingen und Entsorgung müssen gemeinsam bedacht werden, um zu prüfen, wie man betriebswirtschaftliche, aber auch gesellschaftliche Kosten sparen kann. Kompetenzentwicklung für nachhaltiges Wirtschaften und Arbeiten Nachhaltigkeitsorientiere Gestaltungskompetenz ist ein Teil der beruflichen Handlungskompetenz. Darunter versteht man Globales Denken, Interdisziplinarität und interkulturelle Kompetenzen. In der Berufsbildung spielen zudem Schnittstellenkompetenzen, Kundenberatung und Kommunikationskompetenzen sowie systematisches, übergreifendes Denken eine entscheidende Rolle. Ordnungsmittel und BBNE Die Berufsbildung hat eine zentrale Rolle für die Veränderung von nachhaltigem Arbeiten und Wirtschaften. Sie ist der Motor, da die Berufsbildung Kompetenzen und Qualifikationen vermittelt, die eine Wirkung auf das Arbeiten und Wirtschaften erzielen. Wenn man nachhaltige Aspekte umsetzen will, müssen Produkte und Dienstleistungen anders erarbeitet werde als bisher, dazu braucht es ein neues Denken In der Ausbildungsordnung gibt es allmählich einen Wandel und inzwischen gibt es einige neue Ansatzpunkte. Ein Ansatzpunkt ist die Standardberufsbildposition. Hierfür gibt es eine eigene zum Thema Umweltschutz, Arbeitsschutz und Gesundheit. In jeder Ausbildungsordnung ist diese Standardberufsbildposition benannt. Nun gibt es zum Einen den Ansatzpunkt, den Umweltschutz an die Kriterien einer nachhaltigen Entwicklung anzupassen, oder alternativ hierfür eine eigene Standardberufsbildposition zu benennen. Ein weiterer Ansatzpunkt ist die Ausbildungsordnung, die Rahmenlehrpläne
25 Nachhaltigkeit lernen in Hessen 25 und die Zusatzqualifikationen stärker in den Blick zu nehmen und dabei die nachhaltige Entwicklung in die Facharbeit und die Ausbildungsordnung aufzunehmen. Weiterhin kann man das Thema Nachhaltigkeit vermehrt in die Fort- und Weiterbildungen integriert werden und auch in die Prüfungsordnung mit aufnehmen. Kompetenzorientierte Ausbildungsordnungen Derzeit findet eine Neudefinition der Ausbildungsordnungen statt. Hier gibt es auch zahlreiche Ansatzpunkte für eine nachhaltige Entwicklung. Z.B. beschreibt Niveau 4 Kompetenzen, die zur selbstständigen Planung und Bearbeitung fachlichen Aufgabenstellungen in einem umfassenden, verändernden Lernbereich oder beruflichen Tätigkeitsfeld benötigt werden. Ähnliche Ziele gibt es für personale und soziale Kompetenzen. Die Gestaltung von Lernsituationen zur nachhaltigen Entwicklung Berufsbildungspersonal als Multiplikator Ein weiterer Punkt ist, dass das Berufsbildungspersonal als Multiplikator ein wichtiger Schlüssel ist, um nachhaltige Entwicklung in der Fachdidaktik umgesetzt werden. Fort- und Weiterbildungen spielen hierbei eine große Rolle, z.b. durch schulinterne Lehrerfortbildungen, betriebliche Schulungen oder Arbeitskreise. Im Rahmen der Diskussion in diesem Forum wurden noch die Rahmenbedingungen der Neuordnung von Ausbildungen erörtert. Diese erfolgt, organisiert und inhaltlich gestaltet durch das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) in enger Abstimmung mit den Sozialpartnern (Betriebe, Verbände und Gewerkschaften). Das BIBB hat in den vergangenen Jahren umfangreiche Projekte und Praxisbeispiele zur Integration von Nachhaltigkeit in die Berufliche Bildung gestartet und dokumentiert. Diese verstehen sich als Begleitung der Entwicklung hin zu mehr Themen und Inhalten der nachhaltigen Entwicklung in der Berufs- und Arbeitswelt. In der beruflichen Bildung geht es auch darum, Lernsituationen zu gestalten und nachhaltige Entwicklung in die Arbeitswelt zu integrieren. Es geht darum, Arbeitsprozesse neu zu überdenken und neue Fragen zu Arbeitsweisen, Verfahren, Abläufen, etc zu stellen. Die nachhaltige Entwicklung kann so im beruflichen Handlungsfeld entwickelt werden.
26 26 Nachhaltigkeit lernen in Hessen Workshop 1 Energie schlau nutzen Heike Wefing-Lude Wassererlebnishaus Fuldatal Im Workshop ging es neben erneuerbaren Energien und Experimenten zu physikalischen Zusammenhängen rund um Energienutzung auch darum, wie Schüler*innen unterstützt werden können, die neu gewonnen Erkenntnisse zu prüfen, zu bewerten und Konsequenzen für das eigene Handeln abzuleiten. Die Teilnehmer*innen des Workshops kamen aus ganz verschiedenen Bildungsbereichen: Kita, Grundschule, Umweltzentren, Freiberufler*innen. In Flüstergruppen wurde zu Beginn nach einer Definition von Nachhaltiger Entwicklung, die Grundschüler verstehen, gesucht. Gerechtigkeit und Zukunftsfähigkeit waren dabei die Bergriffe die in unterschiedlicher Art immer wieder auftauchten. Als Versuch einer Übersetzung nutzt Frau Wefing- Lude im Schuljahr der Nachhaltigkeit mit den Kindern folgende: Genug für alle für immer. Im Anschluss daran fasste sie noch einmal die Kennzeichen von BNE zusammen und stellte Praxisbeispiele für die verschiedenen Kennzeichen vor. Danach probierten die Teilnehmer*innen in Gruppen die Stationen der Lernwerkstatt Energie schlau nutzen aus dem Schuljahr der Nachhaltigkeit aus. Dabei setzen sie Punkte an denen aus ihrer Sicht am stärksten vorhandenen Kennzeichen der BNE an den jeweiligen Stationen. Die Ergebnisse wurden mit der Gruppe diskutiert. Es wurden weitere Ideen für Aktionen gesammelt, besonders für die Kennzeichen von BNE die bisher in der Lernwerkstatt weniger stark vorkommen. Ein wichtiger Punkt war dabei die Kooperation mit Partnern und Lernorten außerhalb der Klasse, wie z.b. Hausmeister, Eltern, Geschäften vor Ort.
27 Nachhaltigkeit lernen in Hessen 27 Workshop 2 Kleidung und Konsum Bettina Dören AZN-Naturerlebnishaus Heideberg In diesem Workshop stellte Bettina Dören eine für die Klassenstufen 3-5 konzipierte Unterrichtseinheit zum Thema Kleidung und Konsum vor. Am Beispiel der Weltreise einer Jeans wurde zunächst anschaulich auf einer großen Weltkarte dargestellt, in welchen Ländern welche Arbeitsschritte vom Baumwollanbau bis zum Verkauf stattfinden können: Baumwollanbau in Indien Spinnerei in der Türkei Färberei in Taiwan Weberei in Polen Näherei auf den Philippinen Endfertigung/Behandlung in Griechenland Verkauf in Deutschland. Dabei legt die Jeans eine Entfernung von gut km zurück! Im Anschluss erarbeiteten die Teilnehmer*innen Handlungsoptionen: weniger Kleidung kaufen, ökologische Kennzeichen beachten, Kleidung flicken, Tauschbörsen, Flohmarkt, Altkleider. Bettina Dören stellte eine einfache Möglichkeit vor, mit Bügelpapier Flicken auf Kleidung aufzutragen. So sieht die kaputte Jeans wieder schick aus und wird länger getragen. Zum Abschluss wurde nach Zusammenhängen zwischen den vorgestellten Inhalten und MINT-Themen gesucht und vielfältige gefunden: Arbeitslöhne berechnen, Transportkosten, CO 2 -Ausstoß, Recycling, Wasserverbrauch, Bodenverschmutzung, Pestizide, Technisierung, Baumwolle pflanzen. Der Workshop machte am Beispiel Kleidung Aspekte von Konsum, seinen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt sowie die globale Dimension begreifbar. Mit Hilfe von Bildern, Requisiten und km-angaben wurden Themen wie Transportwege und -kosten, Arbeitsbedingungen, Kinderarbeit, Schadstoffe, nachvollziehbar besprochen. Im zweiten Teil des Workshops wurden 5 Stationen vorgestellt, die die Schüler*innen anhand eines Laufzettels selbständig bearbeiten: Station 1: Vergleich des jährlichen Kleidungsverbrauchs in Deutschland und Indien. Station 2: Thematisierung von Kinderrechten anhand des Alltags einer 14-jährigen Näherin. Station 3: Vorstellung alternativer Kleidungs- Firmen und Kataloge. Station 4: Einen Knopf annähen. Station 5: Vorstellung / Vergleich der verschiedenen Kennzeichen und Siegel für Kleidung.
28 28 Nachhaltigkeit lernen in Hessen Workshop 3 Gemeinsam aktiv! Die Methode Handprint Lena Heilmann Umweltbildungszentrum Licherode Zum Einstieg stellten die Teilnehmer*innen in der Vorstellungsrunde ihre persönlichen Assoziationen zu Fußabdruck und Handabdruck vor. Fast alle Assoziationen zum Handabdruck einte der Gedanke, dass dieser eine aktive Tat beschreibt, schließlich sind unsere Hände die Werkzeuge zum täglichen Handeln, so die einhellige Meinung der Teilnehmer*innen. Weiterhin steht der Handabdruck fürs Anpacken, Gestalten, Verändern und Einflussnehmen. Lena Heilmann knüpfte im Workshop an diese Vorstellung an und fasste zusammen: Es ist auf dem Tisch, vor welchen Herausforderungen wir stehen und was zu tun ist, aber genau das aktiv werden ist das, was so schwerfällt und was begleitet werden muss. Nachhaltige Entwicklung hat das Ziel, heute nicht auf Kosten von Morgen und hier nicht auf Kosten von anderswo zu leben. Der 1992 ins Leben gerufene ökologische Fußabdruck möchte Auswirkungen unseres Lebensstiles sichtbar und vergleichbar machen. Er möchte zum Handeln anregen. Hierfür zeigt er auf, welche Entscheidungen und Taten unseres Lebens, welchen Einfluss auf die Erde haben. Doch motiviert der Fußabdruck auch zum Handeln? Ist dafür vielleicht ein anderes Konzept von Nöten? Der Handprint wurde 2007 in Indien von einem 10-Jährigen Mädchen erfunden. In einer Unterrichtseinheit zum ökologischen Fußabdruck wollte sie statt ihres Fußabdruckes lieber eine Hand präsentieren, um zu zeigen, was man positiv verändern kann. Aus der Idee wurde eine weltweit eingesetzte Methode. Sie ergänzt die Vorstellungen zum Prinzip des ökologischen Fußabdruckes und zeigt auf, wie Schüler*innen in ihrem Umfeld im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung aktiv werden können. Damit betont sie die Selbstwirksamkeit und stellt den Wert heraus, im Alltag auch mit kleinen Aktionen aktiv zu werden. Das Prinzip ist klar, je mehr Leute ich motiviere ebenfalls aktiv zu werden und sich zu
29 Nachhaltigkeit lernen in Hessen 29 engagieren, desto größer ist der positive Effekt, der entsteht. Auch ist klar, dass vor allem der Anstoß struktureller Veränderungen dauerhaft positive Effekte erzeugt. So kann auch politisches Engagement zu wichtigen Veränderungen hin zu einer nachhaltigeren Entwicklung führen. Der Handprint wurde bewusst als Offenes Konzept verbreitet, damit das Konzept überall in der Welt genutzt werden kann, so Lena Heilmann. Während der UN-Dekade wurde das Projekt als eines der 25 weltweit wirkungsvollste BNE-Projekt (Nagoya 2014) ausgezeichnet. In Deutschland wurde die Idee vor allem von der Organisation Germanwatch aufgegriffen, die das Handprint-Konzept stark auf politisches Engagement ausgerichtet haben. Dauerhafte Veränderungen durch Strukturänderungen sollen angestoßen werden. Aus Einzelaktionen soll der Anstoß zur Veränderung von Rahmenbedingungen erwachsen. Sowohl das Konzept des ökologischen Fußabdruckes als auch das des Handabdruckes verfolgt das Ziel, Zukunft durch verändertes Handeln neu zu gestalten. Während der ökologische Fußabdruck dabei die negativen Einflüsse der Menschen auf die Erde in den Vordergrund stellt, dreht es das Konzept des Handprints um. Mittlerweile gäbe es analog zu den existierenden Footprint-Rechnern auch einen Handprint-Rechner, mit dessen Hilfe positive Handlungen in Zahlen ausgedrückt werden. Dieser werde jedoch zum Teil kritisch gesehen, da sich schließlich viele Handlungen, nicht so einfach in Zahlen fassen ließen. Im Anschluss an die Einführung der Methode stellte Lena Heilmann im Workshop Einsatzmöglichkeiten zur Verbindung von Nachhaltigkeitsthemen im Unterricht mit Beispielen aus dem Schuljahr der Nachhaltigkeit vor. In diesem landesweiten Programm, das seit 2013 von der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen gefördert und von der ANU Hessen e.v. umgesetzt wird, wird der Handprint am Ende jeder Lernwerkstatt rund um die Themen Ernährung, Biodiversität, Konsum oder Klimawandel als verbindendes Element eingesetzt. Der Handprint wird genutzt, um je Thema Handlungsmöglichkeiten aus dem Alltag der Schüler*innen zu entwickeln. So kann es gelingen, altersgerecht einen roten Faden zwischen den verschiedenen Themen nachhaltiger Entwicklung herzustellen und so das systemische Denken und Handeln zu fördern. Das Fazit war durchweg positiv: Es gibt viel, was wir dem Planeten Gutes tun können und der Handprint setzt daran an. Schließlich ist es ein positives Konzept, dass motiviert, statt zu frustrieren. Der Mensch wird nicht nur als Verbraucher angesehen, sondern als Gestalter seines unmittelbaren Umfeldes und darüber hinaus. Du kannst gestalten, du kannst was bewirken, wenn du dich einmischst und dich engagierst, so die Botschaft. Die Symbolkraft der Hand ist eingängig und faszinierend. Plakate mit den Handprint-Ideen der Schüler*innen könnten z.b. nach einiger Zeit ausgewertet werden mit den Fragen Was konntet ihr umsetzen? Was nicht, was hättet ihr gebraucht, um es umzusetzen?
30 30 Nachhaltigkeit lernen in Hessen Workshop 4 Naturwissenschaften in Kita und Grundschule Experimentieren leicht gemacht mit der Chemiekiste! Carina Hesse 3-up Wie kann man Kindergarten- und Grundschulkinder fürs Forschen und Experimentieren begeistern? Indem man sie möglichst viel selbst ausprobieren lässt! Das vermittelte Carina Hesse vom Unternehmen 3up, das sich auf die naturwissenschaftliche Förderung von Kindern spezialisiert hat. Sie stellte die Chemiekiste vor, in der Zutaten für 40 Experimente rund um die Elemente Feuer, Wasser und Luft enthalten sind. Auch im Workshop wurden zur Veranschaulichung des Konzepts Chemiekiste kleine Experimente durchgeführt. Während die Teilnehmenden in Kleingruppen zwei in kleine Flaschen abgefüllte Flüssigkeiten untersuchten, um herauszufinden, welche der beiden giftig ist, konnten die verschiedenen Elemente des Konzepts selbst erlebt werden. Denn um als Gruppe nur mithilfe von 2 Gläsern, einem Verbrennungslöffel, einer Kerze, einem rohen Ei, einer Pipette und einem Feuerzeug die giftige Flüssigkeit bestimmen zu können, braucht es neben dem Einhalten von grundlegenden Regeln viel Kommunikation, Entscheidungsfindung und kreatives Denken. Zuvor hatte die Referentin das hinter der Chemiekiste liegende pädagogische Konzept erläutert. Dabei ging sie auf fachdidaktische Fragen, den hessischen Bildungs- und Erziehungsplan und die entwicklungspsychologischen Grundlagen des Lernens ein. In der Arbeit mit der Chemiekiste werden einfache Experimente didaktisch auf die kindlichen Möglichkeiten zugeschnitten. Dabei ist die Reduktion der oftmals komplexen chemischen Prozesse eine Herausforderung für die Pädagoginnen und Pädagogen. Ziel ist es, dass die Kinder Lust am Experimentieren und Nachfragen entwickeln und kompetenzorientiert selbst forschen können. Zu diesem Zweck enthält die Chemiekiste einen Großteil der benötigten Gegenstände im Klassensatz, damit alle aktiv werden und so Spaß an Naturwissenschaften entwickeln. Doch nicht nur naturwissenschaftliches Wissen wird mit dem Konzept gefördert. Bei der Beschreibung der Experimente und des Beobachteten findet beispielsweise gleichzeitig auch Sprachförderung statt, denn in den Naturwissenschaften ist die korrekte Benennung von Phänomenen und Ergebnissen wichtig. Lehrerinnen und Lehrer können die Chemiekiste und ihre Einsatzmöglichkeiten im Unterricht im Rahmen einer kostenlosen Fortbildung kennen lernen und erhalten im Anschluss eine eigene Chemiekiste für ihre Schule bzw. Einrichtung.
31 Nachhaltigkeit lernen in Hessen 31 Workshop 5 Kunos coole Kunststoffkiste Tanja Rühl PlasticsEurope Das Primarstufenprogramm von PlasticsEurope "Kunos coole Kunststoff-Kiste" ist ein wichtiger Baustein zur naturwissenschaftlichen Bildung im Grundschulalter. Mit fünf Experimenten werden Grundschulkinder an das Thema herangeführt. Wie die Experimente ablaufen, wurde im Rahmen des Workshops erläutert. "Kunos coole Kunststoff-Kiste ist für Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren geeignet. Im Workshop wurden die fünf Versuche aus der Kiste in Kleingruppen ausprobiert. Die Versuche lassen sich unabhängig voneinander durchführen. Vier der Versuche können die Kinder selbstständig durchführen. Experiment 1: Ganz normale Plastikfolien Drei Folien aus PE, PVA und Kartoffelstärke werden darauf getestet ob sie sich in Wasser und Erdboden auflösen (Anwendung: Folien um Spülmaschinentabs Wasserlösliche, Bioabfallbeutel nicht Wasserlöslich aber Kompostierbar) Experiment 3: Wir stellen einen Kunststoff her Aus Bastelkleber der mit Borax gemischt wird entsteht ein Kunststoff aus dem man einen Flummi rollen kann. Experiment 4: Eine Kläranlage im Taschenformat Verschmutztes Wasser wird durch drei unterschiedlich feine Filter gereinigt. Filet 1 Teesieb, Filter 2 Kaffeefilter, Filter 3 Kunststoffmembran Ein Versuch muss wegen des kochenden Wassers von der Lehrerin durchgeführt werden. Experiment 5: Schaumstoff-Herstellung In einem Teeei wird Polystyrol zu einem Styroporball aufgeschäumt. Im Anschluss an die Fortbildung erhielt jede*r Teilnehmer*in ein Exemplar von Kunos cooler Kunststoff Kiste für seine / ihre Grundschule. Experiment 2: Wo bleibt das Wasser? Die Wasseraufnahmefähigkeit von einem Stein, Watte und einem Kunststoff (Superabsorber) werden getestet. (Anwendung z.b. in Windeln und bei der Feuerwehr Ölaufnahme von der Straße)
32 32 Nachhaltigkeit lernen in Hessen Workshop 6 Organisation einer Weltladen AG Christian Quanz Eduard-Stieler-Schule, Fulda Gleich zu Beginn des Workshops stellte sich in der Vorstellungsrunde der Teilnehmer*innen heraus: Das Interesse am Thema Weltladen AG ist groß! Fragen der Teilnehmer waren vor allem solche zur Sicherstellung der Kontinuität einer Weltladen AG und Fragen nach Anreiz- und Zertifizierungssystemen für Schulen. Herr Quanz gab den Teilnehmern zunächst einen Einblick in die Planung, die Durchführung und die Zertifizierung seiner Weltladen AG. Er berichtete, mit welchen Tipps und Tricks er die Schüler*innen zur kontinuierlichen Mitarbeit motiviert. Dies sei gar nicht so leicht, denn schließlich sei die Mitarbeit in der Weltladen AG kein MUSS, so Quanz. Wie bekommt man also Schüler*innen dazu, dass sie trotz Prüfungsstress und Freizeitmangel engagiert dabeibleiben? Quanz Geheimrezept setzt sich aus drei Komponenten zusammen: Der Inhalt ist das A und O. In seiner Weltladen AG werden Produkte angeboten, die man nicht an jeder Ecke kaufen kann. Mit dem Verkauf werden Menschen in armen Regionen unterstützt, die für ihre Arbeit korrekt entlohnt werden. Der Einsatz für eine gute Sache motiviert die Schüler*innen. Dennoch steht fest, die Herausforderungen der Organisation einer Weltladen AG sind vielseitig und umfangreich. Organisiert werden muss der wöchentliche Verkauf, die Teilnahme an externen Veranstaltungen zur Vorstellung der AG, das Planen von Aktionen an der Schule sowie die Kommunikation mit Eltern und Schulgemeinde, wie z.b. am Tag der offenen Tür. Über den Verkauf hinaus können außerdem weitere Aktionen entstehen, wie die Ausarbeitung eines konsumkritischen Stadtrundgangs. Organisiert werde dies mit Hilfe von drei Abteilungen, dem Marketing (Flyer, Plakate, Bewerbung in der Schule), dem Controlling, sowie dem Einkauf/Verkauf. mit Mitschüler*innen auch über Jahrgangsstufen hinweg fördere das soziale Miteinander und motiviere am Ball zu bleiben. Damit die Kommunikation gelingt, müsse man sich den aktuellen Trends anpassen. So sei an seiner Schule eine WhatsApp Gruppe zur Koordination der Treffen eingerichtet worden. Über dieses Medium erreiche man alle. Getroffen werde sich jeden Monat jeweils 1/2h in der großen Pause. Zu guter Letzt sei auch die Wertschätzung der Mitarbeit über ein Ehrenamtszeugnis hilfreich, um die Schüler*innen zu einer kontinuierlichen Mitarbeit zu motivieren. Hier gäbe es spezielle Vorlagen, die sich beim Schulamt erfragen lassen. Sein Tipp für die konkrete Umsetzung des Verkaufes eine enge Kooperation mit Weltläden. Sei Vertrauen vorhanden, könne Ware vom örtlichen Weltladen bezogen werden, und zwar auf Kommission. Damit verringere man das Risiko und es könnte gleichzeitig der Start einer längerfristigen Kooperation sein. So könne ein Weltladen auch bei der Erarbeitung eines konsumkritischen Stadtrundganges ein wichtiger Partner sein. Am Ende des Workshops gab er Einblicke und Anregungen, wie eine Weltladen-AG ihren Teil zu den Zertifizierungen UNESCO-Schule, Umweltschule und FairTradeSchool leisten kann Das alles funktioniert natürlich nur im Team, so Quanz. Und genau dieser Gedanke, ist ein weiterer Teil seines Geheimrezeptes. Schließlich schweiße die Arbeit im Weltladen-Team zusammen, der Austausch
33 Nachhaltigkeit lernen in Hessen 33 Workshop 7 Solarrennen Rhein Main Monika Krocke Umweltlernen in Frankfurt e.v. Eine nachhaltige Entwicklung erfordert technische sowie soziale Innovation. Beides ist ohne Bildung nicht denkbar. Das Solarrennen RheinMain ist ein Beispiel, wie MINT und BNE erfolgreich in Verbindung gebracht werden. Der Bildungswettbewerb bringt Kindern und Jugendlichen die Zukunftstechnik Eletromobilität nahe. Anhand von zwei Thesen wurden die Unterschiede von BNE und MINT diskutiert und wie die beiden Zugangsweisen verbunden werden könnten. Die Leiterin des Workshops repräsentierte die beiden Bereiche (BNE: Umweltlernen in Frankfurt e.v., MINT: Solarinitiative Fulda) BNE orientiert sich am Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung. Fragen der gesellschaftlichen Entwicklung werden in den Mittelpunkt gerückt. MINT wird als Werkzeug begriffen. MINT orientiert sich an technischer Machbarkeit und letztendlich am wirtschaftlichen Erfolg. Die Möglichkeiten von Naturwissenschaften und Technik und ihre Machbarkeit sind Selbstzweck, die gesellschaftliche Dimension wird als nachrangig angesehen. Nach dem lebendigen Austausch wurden Folgerungen für das etablierte Solarrennen gezogen. Damit das Solarrennen und damit der Bau von Solarfahrzeugen ein Bildungsprojekt im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung wird, wurden Themen gesammelt, die mit den Schüler*innen im Rahmen des Projekts bearbeitet werden sollten. nachhaltige Mobilität postfossile Energieversorgung nachwachsende Rohstoffe Das Solarrennen RheinMain findet in diesem Jahr am 12. Juni statt. Teilnehmen können Schüler*innen der Jahrgangsstufen Zu Beginn des Workshops wurden die Rahmenbedingungen, der Ablauf und die verschiedenen Rennklassen vorgestellt. Zum Abschuss hatten die Teilnehmer*innen noch die Möglichkeit ein eigenes Solarauto zu bauen.
34 34 Nachhaltigkeit lernen in Hessen Workshop 8 Kunststoff Petra Carbon C-edu Kunststoff gehört zu unserem Leben. Aber wie wird er hergestellt? Wie bekommt er seine Form? Was passiert mit ihm nach der Benutzung? Spannende Fragen für den Unterricht. In diesem Workshop stellte Petra Carbon eine mehrfach erprobte Unterrichtseinheit zum Thema Kunststoff vor. Die Unterrichtseinheit ist so konzipiert, dass sie sowohl in der Grundschule als auch in der Sek. I eingesetzt werden kann. Es werden alle Aspekte rund um das Thema Kunststoff beleuchtet. Aber es können auch nur einzelne Unterthemen ausgewählt und im eigenen Unterricht eingesetzt werden. Es geht dabei nicht nur um Themen aus MINT, sondern auch um BNE. Vor der Vorstellung der Unterrichtseinheit konnten die Teilnehmer des Workshops aber zuerst selbst experimentieren. Dabei ging es um den Produktionskreislauf, physikalische Eigenschaften wie, Dichte, Wärme, Brenn- und Schwimmfähigkeit, Wasserbindekraft und Formgebung. Die Teilnehmer konnten dadurch selbst erfahren, mit wieviel Spaß das Thema vermittelt werden kann. Ganz besonders die Experimente rund um Superabsorber, dem Wundermittel in Windeln, zeigten, wie viele Fragen bei Schülern beim Beschäftigen mit Alltagsproblemen aufkommen können. Um die Experimente mit relativ geringem Aufwand im eigenen Unterricht durchführen zu können erhielten die Teilnehmer alle Bezugsquellen dafür. Danach bot Frau Carbon im ersten Teil Möglichkeiten, sich mit folgenden Punkten zu beschäftigen: Was sind Kunststoffe? Wofür nutzen wir sie? Geschichte des Kunststoffes. Wie wird aus Erdöl Kunststoff? Erdöl als eigenes Thema. Welche unterschiedlichen Sorten Kunststoffe gibt es? Und natürlich die dazugehörenden Experimente. Im zweiten Teil wurden Vor- und Nachteile von Kunststoffeinsatz im Alltag diskutiert. Es folgte die Darstellung der Nutzung von alternativen Stoffen und die Reflexion von Konsum- und Verhaltensmustern mit Handlungsoptionen. Schüler*innen müssen alle Seiten von Kunststoff und seinen sogenannten Alternativen kennen, um sich eine eigene, auf Fakten basierte Meinung bilden zu können und entsprechend zu handeln.
35 Nachhaltigkeit lernen in Hessen 35 Workshop 9 Wert der Biodiversität Jan Kirchhein Naturschutzzentrum Bergstraße Die Ausgangsfragen des Workshops waren: Welchen Wert hat Biodiversität? Wie gelingt die Kommunikation des Wertes von Biodiversität? Zum Einstieg erfolgte eine Kurzpräsentation und ein Video ( WissensWerte: Biodiversität auf zur Darstellung der verschiedenen Bereiche der Biologischen Vielfalt (Artenvielfalt, genetische Vielfalt, Lebensraumvielfalt), ihren Vorteilen (hohe Anpassungsfähigkeit, wirtschaftliche Vorteile, Erholung und Heimatgefühl) und ihren Bedrohungen (Zerstörung von Lebensräumen, Vereinheitlichung von Nutztier- und Pflanzenarten, Übernutzung, Zersiedelung, Klimawandel, Einwanderung fremder Arten). Anschließend wurde vorgestellt, welche Werte der Biodiversität zugesprochen werden: Ethische Werte - Wert des Lebens an sich Evolutionärer Wert - Wert der Vielfalt Ökologischer Wert - höhere Produktivität und Stabilität von Ökosystemen Utilitaristischer Wert - Leistungen, die uns zur Verfügung stehen, diese werden unterschieden in Basisleistungen, Versorgungsleistungen, Regulationsleistungen Somit wurde klar, dass der Verlust an Vielfalt z.b. ein unmittelbares Problem für die Landwirtschaft und somit für unsere Ernährung darstellt. Danach wurde eine Umfrage unter Oberstufenschüler*innen zum Thema Biodiversität und ihre Werte dargestellt. Das Ergebnis zeigte, dass die Mehrzahl (60 %) unter Biodiversität Artenvielfalt versteht, dass aber die Lebensraumvielfalt mit 35 % und die genetische Vielfalt (mit nur 5 %) nur wenigen bewusst sind. Bei der Einschätzung der Wertkategorien auf einer Skala von 0 bis 4 ergab sich, dass die Basisleistung (mit 3,5) vor der Regulierung und Versorgung (mit jeweils 3,2) und vor der Kulturleistung (mit 2,7) rangierte. An Gründen für die Bedeutung von Biodiversität wurden genannt, dass sie unser Überleben und die Grundlage unserer Natur sichert.
36 36 Nachhaltigkeit lernen in Hessen Wesentliche Schutzmaßnahmen für Biodiversität wurden im Naturschutz sowie im Konsum gesehen. Insgesamt zeigte sich also ein unzureichendes Wissen über die Biodiversität, Ihren Wert und ihre Erhaltung. Als nächstes wurde als ein Beispiel für Kommunikation das hessische Programm Wilde Ecken vorgestellt. Dieses wurde vom Herbst 2015 bis 2016 als Wettbewerb ausgeschrieben. Insgesamt wurden 240 Wilde Ecken angelegt, die auf einer Onlineplattform dokumentiert wurden. Als Fazit kann gezogen werden: Das Projekt war öffentlich wirksam und vermittelte Naturerfahrung und Artenkenntnis. Es konnte Wildnis in vielen Ecken entstehen und es war pädagogisch eingebunden. Nachteilig war, dass es sehr naturromantisch angelegt war, der Fokus stark auf einzelnen Arten lag und die Projektdauer nur ein Jahr betrug. Im Anschluss daran sollten die Workshopteilnehmer*innen in Kleingruppen eigene Projekte entwickeln, um Schülern die Bedeutung von Biodiversität für Gesundheit, Kultur, Ökologie und Ökonomie nahe zu bringen. Dabei sollten die Kernkompetenzen von BNE berücksichtigt und das Hand Print -Prinzip angewendet werden, dessen zentrale Frage ist Was kann ich Gutes tun? Im Laufe der Gruppenarbeit konnte eine Vielzahl an Projektideen zu den verschiedenen Werten der Biodiversität entwickelt werden. Insbesondere Projekte um die Themen Streuobstwiese und Wald tauchten in allen 4 Kategorien auf. So entwickelten sich für die beiden Themen folgende Projektideen: Exemplarisches Thema Streuobstwiese: Bestimmungsübungen von Kräutern und Insekten (Ökologie), Berechnung des Wertes der Bestäuberleistung auf der untersuchten Fläche (Ökonomie), Inhaltsstoffe von Äpfeln und Verzehr (Gesundheit), Ernte und Verarbeitung sowie Lieblingsorte suchen und Traumfänger gestalten (Kultur), Vergleich Apfelsortenvielfalt in Deutschland mit Mangosortenvielfalt in Indien (Globales Lernen). Exemplarisches Thema Wald: Bestimmung von Bäumen und Zersetzerorganismen, Nahrungsnetze (Ökologie), Berechnung des Wertes der nicht notwendigen künstlichen Düngung der Fläche (Ökonomie), Verbesserung der Luftqualität durch Wälder, Bewegungsspiele (Gesundheit), Geschichte des Waldes in Deutschland, Waldwanderungen, Märchen, LandArt-Kunstwerke gestalten (Kultur), Vergleich Mischwald in Mitteleuropa mit tropischem Regenwald (Zerstörung für Weideflächen, Palmöl) (Globales Lernen). Workshop 10 Virtuelles Wasser Volker Strauch Umweltzentrum Fulda e.v. Volker Strauch vom Umweltzentrum Fulda präsentierte in diesem Workshop eine Wanderausstellung zum Thema Virtuelles Wasser, die über das Umweltzentrum Fulda ausgeliehen werden kann. Die Ausstellung wurde vor etwa vier Jahren entwickelt, Schulen, regionale Wasserversorger und Umweltämter sind bisher die Hauptinteressenten. Folgende Definition von virtuellem Wasser wird in der Ausstellung gegeben: Für die Produktion jeder Ware ist Wasser nötig. Dieses Wasser ist in der Ware nicht mehr direkt enthalten. Das Produktionswasser ist mit dem Begriff Virtuelles Wasser gemeint. Virtuelles Wasser wird in drei verschiedene Bereiche gegliedert: Grünes virtuelles Wasser für die Produktion von Gütern genutztes Regenwasser
37 Nachhaltigkeit lernen in Hessen 37 Blaues virtuelles Wasser für die Produktion von Gütern genutztes Wasser zur künstliches Bewässerung Graues virtuelles Wasser durch die Produktion von Gütern verschmutztes Wasser Zum grauen virtuellen Wasser zählt die Menge Wasser, die aufgewendet werden muss, um das verschmutzte Wasser soweit zu verdünnen, dass es nicht mehr schädlich ist. Während in Deutschland pro Kopf durchschnittlich Liter Wasser auf direktem Wege (Geschirrspülen, duschen, Toilettenspülung, etc.) gebraucht werden, liegt der tägliche Verbrauchswert des virtuellen Wassers bei etwa Litern pro Person. Deutschland gehört wegen des Imports von beispielsweise Textilien, Kaffee und Futtermitteln für die Fleischproduktion zu den Netto-Wasser-Importeuren. Die Ausstellung ist anschaulich und vielseitig einsetzbar konzipiert worden. Sie ist in mehrere Bereiche gegliedert, die je nach Bedarf aufgebaut oder auch weggelassen werden können. Ein großer Hingucker ist ein großer blauer Würfel, der einen Kubikmeter Wasser repräsentiert und auf allen Seiten Aufdrucke besitzt, wie viel von verschiedenen Produkten mit diesen 1000 Litern Wasser hergestellt werden kann. Zudem beinhaltet die Ausstellung Aufsteller mit Informationen zu folgenden Themen: Was ist Virtuelles Wasser?; Blaues, grünes, graues virtuelles Wasser; Erdbeeren im Winter; Fleisch; Äpfel; Kaffee; Papier; Was kann der Einzelne tun?; Europa und sein Wasserfußabdruck; T-Shirts. Für die Arbeit mit Gruppen bietet sich ein Einstieg über das Abschätzen von in verschiedenen Produkten enthaltenem virtuellen Wasser an. Verschiedene Stationen machen ein Stationenlernen in Kleingruppen möglich. Hierzu gehört beispielsweise ein virtueller Supermarkt, der mit Computer, Produktscanner und etlichen mit Barcodes ausgestatteten Produkten zum Einkauf einlädt. Statt eines Gesamtpreises wird am Ende des Einkaufs ein Kassenzettel mit aufsummiertem virtuellen Wasser der ausgewählten Produkte ausgedruckt. Einige weitere Stationen behandeln die Themen Tagesablauf: Verbrauch von virtuellem Wasser, Unterschiedliche Anbaumethoden, Saisonalität und Regionalität. Während des Workshops wurde durchaus kontrovers über bestimmte Inhalte diskutiert. Es wurde darauf eingegangen, dass die in der Ausstellung genannten Zahlen lediglich Durchschnittswerte darstellen. Eine konkrete Bewertung einzelner Produkte gestaltet sich als äußerst kompliziert und muss beispielsweise Anbaubedingungen, Anbaualternativen, klimatische Bedingungen u.v.m. miteinbeziehen. Nichtsdestotrotz bietet die Ausstellung einen anschaulichen Einstieg in das Thema. Das Umweltzentrum Fulda liefert mit der Ausstellung auch eine kommentierte Bibliographie zum Thema virtuelles Wasser, damit Aussteller gezielt und gut strukturiert an Hintergrundinformationen gelangen können.
38 38 Nachhaltigkeit lernen in Hessen Workshop 11 Lernwerkstatt Klimawandel Dr. Martin Jatho AZN-Naturerlebnishaus Heideberg Wodurch wird der Klimawandel verursacht und wie wirkt er sich aus? Diesen Fragen geht die Lernwerkstatt Klimawandel, konzipiert für die Sekundarstufe I, mit verschiedenen Methoden und Medien auf den Grund. Als Einstieg in das Thema wurde der Kurzfilm Die Rechnung von Germanwatch gezeigt. Anhand der drei verschiedenen Charaktere, die in dem Film spielen, kommt man gut und alltagsnah zum Thema Klimawandel ins Gespräch. Nawi-Grundlagen wurden abgefragt und ergänzt, um dann an zwölf verschiedenen Stationen in Kleingruppen zu verschiedenen Aspekten des Klimawandels ins eigenständige Tun zu kommen. Es gab Versuche zu folgenden Themen: Die Entstehung von Wind, Sturmschäden und Trockenheit durch Wind Die Entstehung von Regen und Schäden die durch Starkregen entstehen können Der Treibhauseffekt und der CO 2 -Kreislauf Weiterhin beschäftigen sich Schüler*innen mit unterschiedlichen Menschenschicksalen, die durch den Klimawandel verursacht werden und sie machen sich anhand von zwei unterschiedlichen Weltkarten Gedanken über globale Ungerechtigkeiten. Auch ein Blick in die Zukunft soll klar machen, wo der Klimawandel hinführen wird, wenn wir ihn nicht aufhalten. Nach dieser praktischen Arbeit werden alle Stationen und deren Ergebnisse an der Tafel sehr prägnant in Zusammenhang gebracht, nämlich welche Klima- und Wetter-Änderungen der Anstieg von CO 2 bewirkt und welche Auswirkungen das auf Erde und Mensch hat. Der Frage nach Was kann ich tun gehen Schüler*innen dann mit Karten, die Handlungsoptionen aufzeigen, auf den Grund. Diese geben viele Anregungen selber im schulischen und privaten Kontext aktiv zu werden. In dem Workshop wurden alle Stationen vom Einstieg mit dem Film, über alle Versuche, Grafiken, Fotos mit Klima-Schicksalen, bis hin zur Endrunde mit den Handlungsoptions-Karten vorgestellt und erläutert. Die Lernwerkstatt wurde vom Wassererlebnishaus Fuldatal und dem AZN entwickelt, wird gefördert durch das Hessische Umweltministerium (HMUKLV) und ist gegen Gebühren ausleihbar oder an Schulen buchbar.
39 Nachhaltigkeit lernen in Hessen 39 Workshop 12 Bildung für nachhaltige Entwicklung und Globales Lernen: Leitperspektive in beruflichen Bildungsgängen Ingo Noack Ministerium für Kultur, Jugend und Sport Baden-Württemberg und Lydia Koblofsky Weltladen Marburg / EPN Hessen Nach einer kurzen Vorstellungsrunde der Workshop-Teilnehmer*innen erläuterte die Promotorin des Marburger Weltladens, Lydia Koblofsky, warum Globales Lernen in der beruflichen Bildung wichtig sei. Dies wurde insbesondere am Beispiel einer kaufmännischen Ausbildung gezeigt. Lehrer und Lehrerinnen haben die Möglichkeit, auf drei Ebenen zu wirken: Mikroebene: diese umfasst konkrete Maßnahmen, z.b. das Aufgreifen von Nachhaltigkeitsthemen im Unterricht, Projekttage, externe Referenten Institutionelle Ebene: beinhaltet Schulentwicklungsprozesse wie beispielsweise die Etablierung von AGs oder Projekten wie der Umweltschule Strukturelle Ebene: GL soll in Rahmenlehrpläne eingebracht werden Anschließend wurde eine Methode für den Unterricht in einer Berufsschule vorgestellt: in einem gefilmten Interview erzählt die Besitzerin eines Fischgeschäfts, wie sie nachhaltiger wirtschaftet. Die Schüler*innen positionieren sich danach im Raum auf einem Meinungsbarometer und diskutieren über den Film. Dies soll sie dazu ermutigen, beim eigenen Ausbildungsbetrieb nachzufragen, ob Nachhaltigkeit eine Rolle spielt. Anschließend stellte Ingo Noack dar, wie BNE in verschiedenen Modulen und in Prüfungen stärker im Schulalltag und den Lehrplänen verankert werden solle mit dem Ziel, dass die Schüler*innen später im Berufsleben nachhaltiger handeln. Allgemein gab es große Zustimmung zu den Bildungsplänen und Materialien. Die Workshop-Teilnehmer*innen diskutierten über die Ausbildung bzw. Weiterbildung von Lehrkräften, da die Hochschulen autonom sind und somit in der Lehrerausbildung die Themen BNE und Globales Lernen nicht immer hinreichend behandelt werden. Auch das Angebot von Lydia Koblofsky, persönliche Zweiergespräche zu führen und individuellen Input zu bekommen, wurde von den Teilnehmer*innen begrüßt.
40 40 Nachhaltigkeit lernen in Hessen Workshop 13 Energierallye im Technikhaus EnergiePLUS Kai Burchart, Werner Böddiger, Armin Frankenfeld Radko-Stöckl-Schule, Melsungen Wie schwer ist es, Strom zu erzeugen? Dies demonstrierten im Workshop Energierallye im Technikhaus EnergiePLUS an der ersten Station erst ein, dann zwei Mitarbeiter des Technikhauses EnergiePLUS an den beiden mitgebrachten Strommakern. Sie geraten allmählich doch ins Schwitzen und in Atemnot, und wenn der Verbraucher mehr als 112 Watt einfordert, wird es bald kritisch für die Muskelgeneratoren. Aber was sind schon 112 Watt, gemessen an dem, was wir alle im Alltagverbrauchen, ohne viel nachzudenken Und damit ist schon ein wichtiges Lernziel erreicht, nämlich am eigenen Körper zu spüren, welcher Energieeinsatz für die Bereitstellung von Alltagsenergie erforderliche ist. Unschwer kommt dabei die Rede auf Ernährung, gesunde und umweltverträglich produzierte Nahrung. Da ist es naheliegend, in einer anderen Station den Mixer zur Zubereitung eines leckeren Smoothie mit selbsterzeugten Strom anzutreiben. Aber warum eigentlich nicht -wie früher- gleich von Hand? Das ergibt, wie auch bei anderen Stationen Gesprächsanlass über Lebensstilfragen und Nachhaltigkeit. Stromerzeugung, insbesondere durch Solarenergie, ist Thema an weiteren Stationen, und als Anwendung dürfen mutige Teilnehmer*innen dann auch mit beachtlicher Geschwindigkeit auf einem Elektro scooter den langen Flur im E-Gebäude der Hochschule entlang sausen! Die Stationen sind sehr kindgerecht aufbereitet, so geht es z.b. bei Fragen der Wärmedämmung um den Pullover für das Haus und um praxisnahe Erfahrungen mit Dämmstoffen. Die Anwendung von Originalwerkzeugen, z.b. einer Abisolierzange macht Neugier auf die elektrotechnischen Berufe. Das Technikhaus der Radko-Stöckl-Schule in Melsungen versteht sich als Generationen übergreifendes Bildungshaus für Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. In der Energierallye für Kids setzen sich Kindergarten-und Grundschulkinder spielerisch und experi mentierend mit nachhaltiger Technik auseinander. Das Besondere dabei ist: der große Bruder, die große Schwester, d.h. Auszubildende der technischen Berufe, unterstützt von Fachschüler*innen der Sozialberufe, sind ihre Anleiter*innen. Das bringt doppelten Gewinn: die Azubis sichern und festigen ihr Expertenwissen, indem sie es in die kindgerechte Sprache übersetzen und trainieren nebenbei ihre Sozialkompetenz. Und wenn man die Kinder fragt, was das Beste am Tag war: dass die Großen mit uns gespielt haben. Was will man mehr? Die Energierallye für Kids selbst ist ein Baustein des Lernortes TechnikhausPLUS. Ursprünglich Hausmeisterhaus, wurde es mit innovativen Baustoffen und der Installation einer energieeffizienten Haustechnik durch die Schule und Auszubildende verschiedener Gewerke und mit einer Vielzahl von Firmenspendenmodellhaft energetisch saniert. Entstanden ist ein sich weiterentwickelndes Bildungshaus als regionales Zentrum für viele und ganz unterschiedliche Lerngruppen im Lernorteverbund der Radko-Stöckl- Schule.
41 Nachhaltigkeit lernen in Hessen 41 Workshop 14 Nachhaltigkeit in der beruflichen Bildung Beispiele für die didaktische Umsetzung im Berufsfeld Ernährung und Hauswirtschaft Prof. Dr. Christine Küster Hochschule Fulda Die beruflichen Schulen eignen sich im besonderen Maße, das Thema Nachhaltigkeit als berufliche Handlungskompetenz zu vermitteln. In diesem Workshop wurde nach einer kurzen Einstiegsrunde zum Kennenlernen am Beispiel des Berufsfeldes Ernährung und Hauswirtschaft in einem ersten Schritt gezeigt, wie die Lernfelder und Lernsituationen in der Berufsschule mit den Handlungsfeldern und Handlungssituationen im Betrieb verbunden sind. Letztere werden an den Berufsschulen strukturiert, didaktisch gegliedert und aufbereitet. Dort leitet die Bildungsgangkonferenz aus den Lernfeldern Lernsituationen ab. Evaluiert fließen die Ergebnisse dieser Arbeit den Betrieben zu und werden wiederum dort aufgegriffen. Damit können Nachhaltigkeitsaspekte gleichzeitig an zwei Lernorten eingebunden, durch die Handlungskompetenz geübt und ggf. in den Alltag übertragen werden. Dabei bietet sich ebenfalls die Möglichkeit, außerschulische Lernorte und Lernangebote, z.b. von Umweltzentren, einzubinden, wenn die schulischen Lehrkräfte oder die Ausbilder im Betrieb diese Angebote kennen. Nach dieser kurzen Einstiegs- und Informationsrunde wurde das nachhaltigkeitsorientierte Rahmencurriculum in der Gemeinschaftsverpflegung diskutiert und Handlungsfelder vorgestellt (Speiseplanung, LM-Beschaffung, LM-Lagerung, Vorund Zubereitung, Bereitstellung/Ausgabe, Verzehr, Abfallmanagement, Reinigung und Pflege). Mit einem vorbereiteten Arbeitsblatt folgte eine Arbeitsphase, bei der die Teilnehmer*innen folgende Punkte in Partnerarbeit diskutiert haben: 1. Beispiele und Methoden zum Kompetenzerwerb der Schüler*innen 2. Außerschulische Kooperationen (Partner und deren mögliche Angebote für die Lernsituation) Fachliche Kompetenz Methodische Kompetenz Soziale Kompetenz Personale Kompetenz Handlungsfeld 5 Bereitstellung/ Ausgabe Verringerung von Lebensmittelabfällen Informationspflichten bei der Speisenausgabe Marketing für nachhaltigkeitsor. Speiseangebot Neue Zubereitungsverfahren sicher beherrschen (Bsp. Front-cooking) Attraktive Ausgabealternativen kreieren und umsetzen Vielfalt möglicher Kundenbedürfnisse bei der Speisenausgabe kennen Eine wertschätzende Haltung gegenüber LM entwickeln und auf LM-Verluste reagieren
42 42 Nachhaltigkeit lernen in Hessen Workshop 15 Verankerung von BNE in der Ausbildung von Sozialpädagogen Klaus Adamaschek Umweltzentrum Licherode / Berufliche Schulen Bad Hersfeld Klaus Adamaschek vertrat in dem Workshop die These, dass Menschen, die noch nicht mit Nachhaltiger Entwicklung und BNE in Kontakt gekommen sind, für dieses Thema sensibilisiert werden müssen, indem man sie emotional erreicht, sie eine persönliche Bindung zu BNE aufbauen lässt, um diese dann zu vertiefen. Dabei sollte klar werden, dass das Thema sie betrifft und dass sie mit ihm bereits in Kontakt stehen, möge es auch nur in einem noch so kleinen Umfang sein. So stellte Klaus Adamaschek ganz unterschiedliche Methoden vor, mit denen er Studierende der Sozialpädagogik dazu ermutigt, sich dem Themas BNE anzunehmen und in ihrem späteren Berufsleben zu integrieren. Diesen Prozess durchläuft er mit den Studierenden in 12 x 2 Stunden. Nach einer Kennenlernen-Runde lernte man im Workshop das BNE-Bingo, als einen guten Einstieg, kennen. Alle bekamen einen Zettel mit 16 Fragen wie z.b.: Wer fährt regelmäßig mit dem Fahrrad? Wer hat schon mal einen Baum gepflanzt? Wer bezieht Ökostrom? Man befragte dazu die anderen Teilnehmer*innen und wenn eine*r eine Frage mit ja beantwortete, bekam man eine Unterschrift in das jeweilige Fragenfeld. Wer als erster eine Vierer-Reihe voll bekommen hatte, hatte gewonnen. Die Spielenden kamen dabei gut miteinander ins Gespräch, knüpften erste Kontakte und bekamen dabei ganz spielerisch eine Idee, dass sie mit Nachhaltigkeits-Themen bereits in Kontakt sind. Zudem erfuhren sie dabei auch, wo die anderen so stehen.
43 Nachhaltigkeit lernen in Hessen 43 Klaus Adamaschek berichtete, dass er die Studierenden das Kinderbuch Wenn die Welt ein Dorf wäre von David J.Smith (ISBN-10: ) spielen lässt. Durch den Blick über den eigenen Tellerrand wird globales Denken geübt. Mit diesem Gedankenspiel wurde das Bedürfnis nach weltweiter Akzeptanz und Verständnis deutlich. Diskussionen und Auseinandersetzungen wurden angeregt. Er nutzt alle Sinne der Studierenden und lässt singen, hören, betrachten und malen. Sie erkennen verschiedene Lerntypen anhand eines selbst durchgeführten Tests. Auch das Einbeziehen eines Experten zu einer Einheit mit Experimenten zum Thema Wasser, spiegelt ebenfalls die große Methodenvielfalt wieder, die Adamaschek anwendet, um Möglichkeiten zur eigenen Verknüpfung mit BNE zu schaffen. In den letzten beiden Einheiten wurde dann anhand von guten Praxis-Beispielen und Aufzeigen von gelungenen Kooperationen angeschaut, wie die praktische Anknüpfung an das Leben in Kita und Schule gelingen kann. Adamascheks Fazit lautete: Um BNE an Schulen und Kitas zu verstetigen, braucht es immer Menschen, die für das Thema brennen, die sich Mitstreiter suchen, die den Ist-Zustand ermitteln, die sich Ziele stecken. Diese Ziele sollten dann in einem gemeinschaftlichen Beschluss in der Einrichtung für Verbindlichkeit sorgen. Ein nächster Schritt wäre eine Willenserklärung des Kollegiums, dass BNE im Leitbild verankert wird. Eltern, Gemeinde und andere Einrichtungen sollten mit in den Prozess ein-gebunden werden. So wird die Einrichtung im besten Fall im Laufe der Zeit auch zum Vorbild für andere Institutionen in der Region.
44 44 Nachhaltigkeit lernen in Hessen Zusammenfassung und Ausblick Die Tagung Nachhaltigkeit Lernen in Hessen war mit rund 230 Teilnehmer*innen ein großer Erfolg. Schon länger hat BNE in der hessischen Bildungslandschaft einen hohen Stellenwert, der sich nicht zuletzt in der Bildungsinitiative der Landesnachhaltigkeitsstrategie wiederspiegelte. In zahlreichen Projekten und Programmen hat sich in den letzten Jahren eine vielfältige Praxis der BNE an hessischen Schulen und an außerschulischen Lernorten entwickelt. Dieses breite Spektrum wurde im Rahmen der Tagung mit einem Mix aus Impulsreferaten ausgewiesener BNE-Experten verschiedener Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie mit praxisbezogenen Workshops präsentiert. Aus der Perspektive unterschiedlicher thematischer Zugänge zur BNE vom Schwerpunktthema MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) über Umwelt- und Naturerziehung bis hin zum Lernbereich Globale Entwicklung wurden Beispiele und Unterstützungsangebote für die Grundschule, die Sekundarstufen I und II sowie für die Berufliche Bildung vorgestellt und diskutiert. Der Bogen der Tagung wurde dabei gespannt über die globalen Herausforderungen und grundsätzlichen Entwicklungen in den Bildungsbereichen bis hin zur Etablierung einer gemeinsamen Dachmarke Nachhaltigkeit lernen in Hessen. Dieses Schulnetzwerk wurde durch die Nachhaltigkeitsstrategie Hessen und den Runden Tisch Bildung für nachhaltige Entwicklung mit Unterstützung des Hessischen Kultusministeriums ins Leben gerufen. Hierbei sollen zukünftig hessische Schulen mit unterschiedlichen Zugängen zur Bildung für nachhaltige Entwicklung unter einem gemeinsamen Dach zusammengefügt werden. Für die Implementierung der neuen Dachmarke in der hessischen Bildungslandschaft bot die Tagung einen passenden Rahmen und leistete somit eine große Rolle, um Nachhaltigkeit bzw. nachhaltige Entwicklung zukünftig noch stärker in den Schulalltag zu integrieren.
45 Nachhaltigkeit lernen in Hessen 45 Weitere Informationsmöglichkeiten zu den Workshops Verzeichnis der Workshop-Referenten ó Klaus Adamaschek Umweltzentrum Licherode & Berufliche Schulen Bad Hersfeld Lindenstraße Alheim-Licherode Telefon 05664/ Am Obersberg Bad Hersfeld Telefon 06621/ ó Kai Burchart, Werner Böddiger, Armin Frankenfeld Radko-Stöckl-Schule, Melsungen Evesham-Allee Melsungen Telefon 05661/ ó Petra Carbon, C-edu Rotdornweg Rodgau Telefon 0177/ ó Bettina Dören AZN-Naturerlebnishaus Heideberg Erbenhäuser Weg (außenliegend) Kirtorf Telefon 06635/ ó Carina Hesse, 3-up Goldgrubenstrasse Frankfurt am Main Telefon 069/
46 46 Nachhaltigkeit lernen in Hessen ó Lena Heilmann Umweltbildungszentrum Licherode Lindenstraße Alheim-Licherode Telefon 05664/ ó Dr. Martin Jatho AZN Naturerlebnishaus Heideberg Erbenhäuser Weg (außenliegend) Kirtorf Telefon 06635/ ó Jan Kirchhein Naturschutzzentrum Bergstraße An der Erlache Bensheim Telefon 06251/ ó Lydia Koblofsky Weltladen Marburg & Entwicklungspolitisches Netzwerk (EPN) Hessen e.v. Markt Marburg Telefon 06421/ ó Monika Krocke Umweltlernen in Frankfurt e.v. Seehofstraße Frankfurt am Main Telefon 0212/ ó Prof. Dr. Christine Küster Hochschule Fulda Leipziger Str. 123, Fulda Telefon 0661/ ó Ingo Noack Ministerium für Kultur, Jugend und Sport Baden-Württemberg Thouretstraße Stuttgart Telefon 0711/ ó Christian Quanz Eduard-Stieler-Schule, Fulda Brüder-Grimm-Straße Fulda Telefon 0661/ ó Tanja Rühl PlasticsEurope Mainzer Landstraße Frankfurt am Main Telefon 069/ ó Volker Strauch Umweltzentrum Fulda e.v. Johannisstraße Fulda Telefon 0661/ ó Heike Wefing-Lude Wassererlebnishaus Fuldatal Junghecksweg Fuldatal Simmerhausen Telefon 0561/
47 Nachhaltigkeit lernen in Hessen 47 Markt der Möglichkeiten Verzeichnis der Aussteller und Ansprechpartner In der begleitenden Ausstellung präsentierten sich vielfältige Projekte, Organisationen sowie Institutionen. Hier wurden Unterstützungsstrukturen und angebote für hessische Schulen vorgestellt und es bot sich ein Überblick über die in Hessen zu erwerbenden Zertifikate und Auszeichnungen aus dem Bereich der BNE. ó ANU Hessen e.v. Martina Teipel, Gabriele Schaar-von Römer c/o Naturschutzhaus Weilbacher Kiesgruben Frankfurter Str Flörsheim Telefon 06145/ ó Engagement Global ggmbh Sonja Hellig, Kristina Ollesch Tulpenfeld Bonn Telefon 228/ ó Entwicklungspolitisches Netzwerk Hessen Carolin Bernhardt, Andrea Jung Vilbeler Straße 36, Frankfurt am Main Telefon 069/ ó Handwerkskammer Kassel Stefan Schweiker Scheidemannplatz Kassel Telefon 0561/ ó HessenForst Alice Rosenthal, Karl-Heinz Göbel Bertha-von-Suttner-Straße Kassel Telefon 0561/ ó Informationsstelle Bildungsauftrag Nord-Süd Andrea Peters, Zaira Cesian Goebenstraße Wiesbaden Telefon 0611/ ó Landesverband Hessen im Verband der Chemischen Industrie e.v. Heike Blaum Mainzer Landstraße 55, Frankfurt am Main Telefon 069/25560
48 48 Nachhaltigkeit lernen in Hessen ó Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen Kompetenzzentrum HessenRohstoffe (HeRo) Am Sande 20, Witzenhausen Isabelle Herzog, Maja Nägle Telefon 05542/ ó Landesvereinigung für Milch und Milcherzeugnisse Hessen e.v. Tanja Lotz Lochmühlenweg Friedrichsdorf Telefon 06172/ ó MINT-Projekte der Hessenlinie (I am MINT, Die MINT-Stars von Morgen, MINT Girls Camps, MINT.FResH) Matthias Rust, Christoph Klutsch Emil-von-Behring-Straße Frankfurt am Main Telefon 069/ ó MINT Zukunft schaffen e.v. Sylvia Hirt-Einsiedel Spreeufer 5 ó Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Referat I 3 B Silvia Fengler Mainzer Str Wiesbaden Telefon 0611/ ó Schuljahr der Nachhaltigkeit Jennifer Gatzke, Mareike Beiersdorf Kurt-Schumacher Str Frankfurt am Main Telefon 069/ ó TransFair e.v. Doris Buchenau, Theresa Buchenau Remigiusstraße Köln Telefon 0221/ Berlin Telefon ó Umweltschulen Hessen Silke Bell Friedenstraße Wetzlar Telefon 06441/ ó Unesco-Schulen Ulrike Nentwig, Klaus Schilling Le Levandou Str Kronberg ó Verbraucherzentrale Hessen e.v. Cornelia Fröb, Regina Scholz Große Friedberger Str Frankfurt Telefon 069/ ó Regionale BNE-Netzwerke Alexander Sust, Dr.-Ing. Kyoko Sust-Iida Rodgeser Str Fulda Telefon 0661/
49 Nachhaltigkeit lernen in Hessen 49 Impressionen
50 50 Nachhaltigkeit lernen in Hessen
51 Nachhaltigkeit lernen in Hessen 51
Erfahren Sie, wie wir die Zukunft gestalten Der Besucherdienst des BMBF
 Eine Reise in die Welt der Ideen Erfahren Sie, wie wir die Zukunft gestalten Der Besucherdienst des BMBF Was macht eigentlich das Bundesministerium für Bildung und Forschung? Ganz einfach: Wir fördern
Eine Reise in die Welt der Ideen Erfahren Sie, wie wir die Zukunft gestalten Der Besucherdienst des BMBF Was macht eigentlich das Bundesministerium für Bildung und Forschung? Ganz einfach: Wir fördern
Runder Tisch Bildung für nachhaltige Entwicklung
 Runder Tisch Bildung für nachhaltige Entwicklung 4. Sitzung am 21. Juni 2016 Begrüßung Renate Labonté Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Heike Blaum VCI
Runder Tisch Bildung für nachhaltige Entwicklung 4. Sitzung am 21. Juni 2016 Begrüßung Renate Labonté Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Heike Blaum VCI
Grußwort der Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen. Svenja Schulze
 Grußwort der Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen Svenja Schulze zur Auszeichnung des Klimakompetenzzentrums NaturGut Ophoven als Ort des Fortschritts Leverkusen,
Grußwort der Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen Svenja Schulze zur Auszeichnung des Klimakompetenzzentrums NaturGut Ophoven als Ort des Fortschritts Leverkusen,
KiTa.NRW. Willkommen in der Kita! Eine Information für Eltern.
 KiTa.NRW Willkommen in der Kita! Eine Information für Eltern www.kita.nrw.de 2 Willkommen in der Kita Liebe Eltern, wir freuen uns, Sie in Nordrhein-Westfalen willkommen zu heißen. Durch unsere lange Tradition
KiTa.NRW Willkommen in der Kita! Eine Information für Eltern www.kita.nrw.de 2 Willkommen in der Kita Liebe Eltern, wir freuen uns, Sie in Nordrhein-Westfalen willkommen zu heißen. Durch unsere lange Tradition
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)
 Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) Kurzabriss - Begriff Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ein Bildungskonzept, das Kindern und Erwachsenen nachhaltiges Denken und Handeln vermittelt. Denn
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) Kurzabriss - Begriff Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ein Bildungskonzept, das Kindern und Erwachsenen nachhaltiges Denken und Handeln vermittelt. Denn
Die Bildungsinitiative Haus der kleinen Forscher Zahlen und Fakten (Stand: 30. Juni 2017)
 Die Bildungsinitiative Haus der kleinen Forscher Zahlen und Fakten (Stand: 30. Juni 2017) Die gemeinnützige Stiftung Haus der kleinen Forscher engagiert sich für gute frühe Bildung in den Bereichen Mathematik,
Die Bildungsinitiative Haus der kleinen Forscher Zahlen und Fakten (Stand: 30. Juni 2017) Die gemeinnützige Stiftung Haus der kleinen Forscher engagiert sich für gute frühe Bildung in den Bereichen Mathematik,
Die AG Biologische Vielfalt und Unternehmen in der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen
 Die AG Biologische Vielfalt und Unternehmen in der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen 3. Treffen Kontaktnetzwerk Unternehmen Biologische Vielfalt 2020, Frankfurt/Main 8. Dezember 2015 Palmengarten Frankfurt,
Die AG Biologische Vielfalt und Unternehmen in der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen 3. Treffen Kontaktnetzwerk Unternehmen Biologische Vielfalt 2020, Frankfurt/Main 8. Dezember 2015 Palmengarten Frankfurt,
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) Mag.a Samira Bouslama
 Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) Mag.a Samira Bouslama Die Nachhaltigkeitsdimensionen Ökologische Dimension Gesellschaftliche Dimension Schutz von Natur und Umwelt Erhalt der natürlichen Ressourcen
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) Mag.a Samira Bouslama Die Nachhaltigkeitsdimensionen Ökologische Dimension Gesellschaftliche Dimension Schutz von Natur und Umwelt Erhalt der natürlichen Ressourcen
Forum Berufliche Bildung für nachhaltige Entwicklung NRW. LAAW-Projekt Nachhaltigkeit entdecken - Zugänge & Formate entwickeln
 04. November 2014 (Düsseldorf) Forum Berufliche Bildung für nachhaltige Entwicklung NRW Workshop 3 LAAW-Projekt Nachhaltigkeit entdecken - Zugänge & Formate entwickeln 1 Einfach ANDERS? BNE und bildungsferne
04. November 2014 (Düsseldorf) Forum Berufliche Bildung für nachhaltige Entwicklung NRW Workshop 3 LAAW-Projekt Nachhaltigkeit entdecken - Zugänge & Formate entwickeln 1 Einfach ANDERS? BNE und bildungsferne
BILDUNG FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG
 BILDUNG FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG Chancen und Herausforderungen BNE - Chancen und Herausforderungen Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung Historie und Aktuelles Elemente einer Bildung für nachhaltige
BILDUNG FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG Chancen und Herausforderungen BNE - Chancen und Herausforderungen Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung Historie und Aktuelles Elemente einer Bildung für nachhaltige
FRÜHE FÖRDERUNG HOCHBEGABTER KINDER IM ELEMENTAR- UND PRIMARBEREICH
 FRÜHE FÖRDERUNG HOCHBEGABTER KINDER IM ELEMENTAR- UND PRIMARBEREICH Informationen und Anmeldeunterlagen zur Teilnahme am Entdeckertag für Lehrkräfte Der Fragebogen wurde erarbeitet von der Projektgruppe
FRÜHE FÖRDERUNG HOCHBEGABTER KINDER IM ELEMENTAR- UND PRIMARBEREICH Informationen und Anmeldeunterlagen zur Teilnahme am Entdeckertag für Lehrkräfte Der Fragebogen wurde erarbeitet von der Projektgruppe
Es gilt das gesprochene Wort. Sehr geehrter Herr Schürmann, sehr geehrte Frau Schlecht, meine sehr geehrten Damen und Herren,
 Es gilt das gesprochene Wort Rede der Staatsministerin für Arbeit und Soziales, Familie und Integration, Emilia Müller, anlässlich der Auftaktveranstaltung des KITA- Entdecker-Programms 3malE Bildung mit
Es gilt das gesprochene Wort Rede der Staatsministerin für Arbeit und Soziales, Familie und Integration, Emilia Müller, anlässlich der Auftaktveranstaltung des KITA- Entdecker-Programms 3malE Bildung mit
Es gilt das gesprochene Wort.
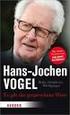 Grußwort der Vizepräsidentin der Kultusministerkonferenz und Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Sylvia Löhrmann Schulnetzwerktreffen MINT400 12. Februar 2015 Es gilt
Grußwort der Vizepräsidentin der Kultusministerkonferenz und Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Sylvia Löhrmann Schulnetzwerktreffen MINT400 12. Februar 2015 Es gilt
BNE - (Tot-)Schlag-Wort für alles und nichts oder zeitgemäßer Prozess?
 Prof. Dr. Heike Molitor FB Landschaftsnutzung und Naturschutz hmolitor@hnee.de BNE - (Tot-)Schlag-Wort für alles und nichts oder zeitgemäßer Prozess? BNE und politische Bildung - wo sind die Verbindungen?
Prof. Dr. Heike Molitor FB Landschaftsnutzung und Naturschutz hmolitor@hnee.de BNE - (Tot-)Schlag-Wort für alles und nichts oder zeitgemäßer Prozess? BNE und politische Bildung - wo sind die Verbindungen?
Das bayerische Schulsystem Viele Wege führen zum Ziel
 Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus Das bayerische Schulsystem Viele Wege führen zum Ziel Das bayerische Schulsystem ist vielfältig und durchlässig. Jedem Kind stehen viele schulische
Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus Das bayerische Schulsystem Viele Wege führen zum Ziel Das bayerische Schulsystem ist vielfältig und durchlässig. Jedem Kind stehen viele schulische
Entwicklung umweltstrategischer Rahmenbedingungen in Hessen
 Entwicklung umweltstrategischer Rahmenbedingungen in Hessen Klaus-Ulrich Battefeld Referat Artenschutz, Naturschutz bei Planungen Dritter, Landschaftsplanung, Naturschutzrecht 6. Oktober 2015 IHK Limburg
Entwicklung umweltstrategischer Rahmenbedingungen in Hessen Klaus-Ulrich Battefeld Referat Artenschutz, Naturschutz bei Planungen Dritter, Landschaftsplanung, Naturschutzrecht 6. Oktober 2015 IHK Limburg
Zukunft mit und in der Gesellschaft gestalten
 1 Zukunft mit und in der Gesellschaft gestalten 2 Forschungszentrum für Umweltpolitik Freie Universität Berlin Institut im Bereich der vergleichenden und internationalen Umweltpolitikforschung und Forschung
1 Zukunft mit und in der Gesellschaft gestalten 2 Forschungszentrum für Umweltpolitik Freie Universität Berlin Institut im Bereich der vergleichenden und internationalen Umweltpolitikforschung und Forschung
Das bayerische Schulsystem Viele Wege führen zum Ziel
 Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus Das bayerische Schulsystem Viele Wege führen zum Ziel Vielfältig und durchlässig Das bayerische Schulsystem ist vielfältig und durchlässig. Jedem
Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus Das bayerische Schulsystem Viele Wege führen zum Ziel Vielfältig und durchlässig Das bayerische Schulsystem ist vielfältig und durchlässig. Jedem
Informations- und. FuE-Förderprogramm. Informations- und
 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie FuE-Förderprogramm Kommunikationstechnik Bayern www.stmwi.bayern.de Kommunikationstechnik INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie FuE-Förderprogramm Kommunikationstechnik Bayern www.stmwi.bayern.de Kommunikationstechnik INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK
Nachhaltigkeitsleitbild der PRIOR1 GmbH. Jemand sollte es tun warum nicht wir!?
 Nachhaltigkeitsleitbild der PRIOR1 GmbH Jemand sollte es tun warum nicht wir!? 2 Unsere Nachhaltigkeitsleitbild Inhaltsverzeichnis 1. Zu diesem Dokument... 3 2. Definition Nachhaltigkeit... 3 3. Unsere
Nachhaltigkeitsleitbild der PRIOR1 GmbH Jemand sollte es tun warum nicht wir!? 2 Unsere Nachhaltigkeitsleitbild Inhaltsverzeichnis 1. Zu diesem Dokument... 3 2. Definition Nachhaltigkeit... 3 3. Unsere
Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung Kompetent für Nachhaltigkeit im Beruf
 Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung Kompetent für Nachhaltigkeit im Beruf Was bedeutet Nachhaltigkeit? Definition der Brundlandt-Kommission der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1987: "Nachhaltige
Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung Kompetent für Nachhaltigkeit im Beruf Was bedeutet Nachhaltigkeit? Definition der Brundlandt-Kommission der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1987: "Nachhaltige
KidStock. Neue Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg
 KidStock Neue Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg NEUE NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE BADEN-WÜRTTEMBERG 1 NEUE NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE BADEN-WÜRTTEMBERG 2 Vorwort Sehr geehrte Damen und Herren, zahlreiche
KidStock Neue Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg NEUE NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE BADEN-WÜRTTEMBERG 1 NEUE NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE BADEN-WÜRTTEMBERG 2 Vorwort Sehr geehrte Damen und Herren, zahlreiche
Naturschutz (-bildung) und Bildung für eine nachhaltige Entwicklung
 Naturschutz (-bildung) und Bildung für eine nachhaltige Entwicklung Hintergrund 1972 Umweltkonferenz Stockholm - dass zu einer dauerhaften Verbesserung der Lebensverhältnisse aller Menschen vor allem die
Naturschutz (-bildung) und Bildung für eine nachhaltige Entwicklung Hintergrund 1972 Umweltkonferenz Stockholm - dass zu einer dauerhaften Verbesserung der Lebensverhältnisse aller Menschen vor allem die
Brandenburg auf dem Weg zu einer Landesstrategie Nachhaltiger Entwicklung
 Brandenburg auf dem Weg zu einer Landesstrategie Nachhaltiger Entwicklung Prof. Dr. Manfred Stock, Vorsitzender des Beirats für Nachhaltige Entwicklung des Landes Brandenburg Berichterstattung des Beirats
Brandenburg auf dem Weg zu einer Landesstrategie Nachhaltiger Entwicklung Prof. Dr. Manfred Stock, Vorsitzender des Beirats für Nachhaltige Entwicklung des Landes Brandenburg Berichterstattung des Beirats
Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Praxis
 Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Praxis Dr. Barbara Dorn Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände Leiterin Abteilung Bildung Berufliche Bildung Anhörung des Parlamentarischen Beirates
Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Praxis Dr. Barbara Dorn Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände Leiterin Abteilung Bildung Berufliche Bildung Anhörung des Parlamentarischen Beirates
Nachhaltigkeit lernen in Hessen
 Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Nachhaltigkeit lernen in Hessen Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) als Antwort auf globale Herausforderungen
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Nachhaltigkeit lernen in Hessen Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) als Antwort auf globale Herausforderungen
Bayerischer Demenzpreis 2016
 Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege Bayerischer Demenzpreis 2016 Ausschreibung Grußwort Sehr geehrte Damen und Herren, in Bayern leben bereits heute etwa 220.000 Menschen mit Demenz.
Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege Bayerischer Demenzpreis 2016 Ausschreibung Grußwort Sehr geehrte Damen und Herren, in Bayern leben bereits heute etwa 220.000 Menschen mit Demenz.
MINISTERIUM FÜR BILDUNG, WISSENSCHAFT, WEITERBILDUNG UND KULTUR. mein portfolio für den Entdeckertag
 MINISTERIUM FÜR BILDUNG, WISSENSCHAFT, WEITERBILDUNG UND KULTUR mein portfolio für den Entdeckertag Foto Name des Kindes: bearbeitet im Schuljahr: von: Entdeckertagsgrundschule: kommentierende Lehrkräfte:
MINISTERIUM FÜR BILDUNG, WISSENSCHAFT, WEITERBILDUNG UND KULTUR mein portfolio für den Entdeckertag Foto Name des Kindes: bearbeitet im Schuljahr: von: Entdeckertagsgrundschule: kommentierende Lehrkräfte:
Lernbereich Globale Entwicklung eine pädagogische Antwort auf globale Entwicklungs- und Zukunftsfragen?!
 Lernbereich Globale Entwicklung eine pädagogische Antwort auf globale Entwicklungs- und Zukunftsfragen?! Übersicht 1)Lernbereich Globale Entwicklung 2)Im thematischen Rahmen: Kooperation SPS -> außerschulischer
Lernbereich Globale Entwicklung eine pädagogische Antwort auf globale Entwicklungs- und Zukunftsfragen?! Übersicht 1)Lernbereich Globale Entwicklung 2)Im thematischen Rahmen: Kooperation SPS -> außerschulischer
Digitalisierte Berufswelt was darf, was soll, was kann die Schule? Prof. Dr. Thomas Merz Prorektor PHTG
 Digitalisierte Berufswelt was darf, was soll, was kann die Schule? Prof. Dr. Thomas Merz Prorektor PHTG Ablauf I. Kontext Herausforderungen der Digitalisierung II. Konsequenzen für die Volksschule III.
Digitalisierte Berufswelt was darf, was soll, was kann die Schule? Prof. Dr. Thomas Merz Prorektor PHTG Ablauf I. Kontext Herausforderungen der Digitalisierung II. Konsequenzen für die Volksschule III.
brennpunkt Bildung Hochwertige Bildung und Lebenslanges Lernen für alle Wunsch und Wirklichkeit
 brennpunkt Bildung Hochwertige Bildung und Lebenslanges Lernen für alle Wunsch und Wirklichkeit Jennifer Gatzke, Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung Hessen e.v., RENN.West in Hessen Eva-Maria
brennpunkt Bildung Hochwertige Bildung und Lebenslanges Lernen für alle Wunsch und Wirklichkeit Jennifer Gatzke, Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung Hessen e.v., RENN.West in Hessen Eva-Maria
Es gilt das gesprochene Wort.
 Grußwort der Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Sylvia Löhrmann Abiturfeier der Abiturientinnen und Abiturienten im Rahmen des Schulversuchs Berufliches Gymnasium für
Grußwort der Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Sylvia Löhrmann Abiturfeier der Abiturientinnen und Abiturienten im Rahmen des Schulversuchs Berufliches Gymnasium für
Empfehlung zur Mobilitäts- und Verkehrserziehung in der Schule. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom i. d. F. vom
 Empfehlung zur Mobilitäts- und Verkehrserziehung in der Schule Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.07.1972 i. d. F. vom 10.05.2012 Vorbemerkung Mobilitäts- und Verkehrserziehung ist eine übergreifende
Empfehlung zur Mobilitäts- und Verkehrserziehung in der Schule Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.07.1972 i. d. F. vom 10.05.2012 Vorbemerkung Mobilitäts- und Verkehrserziehung ist eine übergreifende
Lehramt MINToring : Perspektiven für Studium und Beruf
 Lehramt MINToring : Perspektiven für Studium und Beruf Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik das ist MINT, das macht Schule! Lehramt MINToring ist ein gemeinsames Modellprojekt der Stiftung
Lehramt MINToring : Perspektiven für Studium und Beruf Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik das ist MINT, das macht Schule! Lehramt MINToring ist ein gemeinsames Modellprojekt der Stiftung
Aktions-Plan der Landes-Regierung
 Aktions-Plan der Landes-Regierung Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen Inhalt Inhalt Grußwort 2 Der Aktions-Plan der Landes-Regierung von Rheinland-Pfalz 4 Der UN-Vertrag
Aktions-Plan der Landes-Regierung Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen Inhalt Inhalt Grußwort 2 Der Aktions-Plan der Landes-Regierung von Rheinland-Pfalz 4 Der UN-Vertrag
Wie passt das zusammen? Bildungs- und Lehrpläne der Länder und das Haus der kleinen Forscher. Am Beispiel des Landes Nordrhein-Westfalen
 Wie passt das zusammen? Bildungs- und Lehrpläne der Länder und das Haus der kleinen Forscher Am Beispiel des Landes Nordrhein-Westfalen Worum geht s? Jedes Bundesland hat eigene Bildungs- und Lehrpläne.
Wie passt das zusammen? Bildungs- und Lehrpläne der Länder und das Haus der kleinen Forscher Am Beispiel des Landes Nordrhein-Westfalen Worum geht s? Jedes Bundesland hat eigene Bildungs- und Lehrpläne.
Lernen und Lehren nachhaltig gestalten. Holger Mühlbach, LISA Halle
 Lernen und Lehren nachhaltig gestalten. Holger Mühlbach, LISA Halle war ein Programm der Bund-Länder Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung wurde finanziert vom Bundesministerium für Bildung
Lernen und Lehren nachhaltig gestalten. Holger Mühlbach, LISA Halle war ein Programm der Bund-Länder Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung wurde finanziert vom Bundesministerium für Bildung
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen,
 1 Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, zunächst muss ich den Kolleginnen und Kollegen der FDP ein Lob für Ihren Antrag aussprechen. Die Zielrichtung des Antrages
1 Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, zunächst muss ich den Kolleginnen und Kollegen der FDP ein Lob für Ihren Antrag aussprechen. Die Zielrichtung des Antrages
Grußwort. Svenja Schulze Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen
 Grußwort Svenja Schulze Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen Auftaktveranstaltung Carbon2Chem 27. Juni 2016, Duisburg Es gilt das gesprochene Wort. (Verfügbare
Grußwort Svenja Schulze Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen Auftaktveranstaltung Carbon2Chem 27. Juni 2016, Duisburg Es gilt das gesprochene Wort. (Verfügbare
Raus aus der Schule das Potential außerschulischer Lernorte für den Unterricht
 Raus aus der Schule das Potential außerschulischer Lernorte für den Unterricht Gegründet im Jahr 1669, ist die Universität Innsbruck heute mit mehr als 28.000 Studierenden und über 4.500 Mitarbeitenden
Raus aus der Schule das Potential außerschulischer Lernorte für den Unterricht Gegründet im Jahr 1669, ist die Universität Innsbruck heute mit mehr als 28.000 Studierenden und über 4.500 Mitarbeitenden
Bildung für nachhaltige Entwicklung Erwerb von Gestaltungskompetenz durch Kooperation mit außerschulischen Lernorten
 Workshop Naturschutz und Bildung für nachhaltige Entwicklung Teil 3: Ziele, Strategien und Perspektiven für außerschulische Lernorte, 16. bis18. Juni 2008, Hankensbüttel Dr. Christa Henze, Universität
Workshop Naturschutz und Bildung für nachhaltige Entwicklung Teil 3: Ziele, Strategien und Perspektiven für außerschulische Lernorte, 16. bis18. Juni 2008, Hankensbüttel Dr. Christa Henze, Universität
Pädagogische Plattform SWiSE und MINT
 Dienstag, 19. August 2014, 14.00 bis 14.20 Uhr Pädagogische Plattform SWiSE und MINT Referat von Regierungspräsident Bernhard Pulver, Erziehungsdirektor des Kantons Bern Institut für Weiterbildung (IWB),
Dienstag, 19. August 2014, 14.00 bis 14.20 Uhr Pädagogische Plattform SWiSE und MINT Referat von Regierungspräsident Bernhard Pulver, Erziehungsdirektor des Kantons Bern Institut für Weiterbildung (IWB),
Kompetenzen Workshop Fairer Handel
 Kompetenzen Workshop Fairer Handel Erkennen 1. Informationsbeschaffung und -verarbeitung Informationen zu Fragen der Globalisierung und Entwicklung beschaffen und themenbezogen verarbeiten. Informationen
Kompetenzen Workshop Fairer Handel Erkennen 1. Informationsbeschaffung und -verarbeitung Informationen zu Fragen der Globalisierung und Entwicklung beschaffen und themenbezogen verarbeiten. Informationen
LEHRERIN ODER LEHRER WERDEN
 MINISTERIUM FÜR BILDUNG LEHRERIN ODER LEHRER WERDEN Beruf mit Berufung Herausforderung und Erfüllung zugleich Interessiert? Informieren Sie sich! Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Damen und
MINISTERIUM FÜR BILDUNG LEHRERIN ODER LEHRER WERDEN Beruf mit Berufung Herausforderung und Erfüllung zugleich Interessiert? Informieren Sie sich! Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Damen und
Arbeitszeitgesetz und Tarifverträge. Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz Amt für Arbeitsschutz
 Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz Amt für Arbeitsschutz Wie viel Arbeit darf sein? Arbeitszeitgesetz und Tarifverträge Arbeitszeitgestaltung zum Vorteil für alle
Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz Amt für Arbeitsschutz Wie viel Arbeit darf sein? Arbeitszeitgesetz und Tarifverträge Arbeitszeitgestaltung zum Vorteil für alle
Bildung für nachhaltige Entwicklung im Wald- und Naturkindergarten. Anspruch Wirklichkeit - Möglichkeit
 Bildung für nachhaltige Entwicklung im Wald- und Naturkindergarten Anspruch Wirklichkeit - Möglichkeit Dr. Beate Kohler 16. Fachtagung des Bundesverbandes der Natur- und Waldkindergärten in Deutschland
Bildung für nachhaltige Entwicklung im Wald- und Naturkindergarten Anspruch Wirklichkeit - Möglichkeit Dr. Beate Kohler 16. Fachtagung des Bundesverbandes der Natur- und Waldkindergärten in Deutschland
Grußwort der Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen. Sylvia Löhrmann
 Grußwort der Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen Sylvia Löhrmann Tag der Freien Schulen, zentrale Veranstaltung im Deutschen Theater Berlin 18. September 2015 Sehr geehrte
Grußwort der Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen Sylvia Löhrmann Tag der Freien Schulen, zentrale Veranstaltung im Deutschen Theater Berlin 18. September 2015 Sehr geehrte
Zukunftsprojekt Erde Verantwortung in einer globalen Welt im 21. Jahrhundert
 Zukunftsprojekt Erde Verantwortung in einer globalen Welt im 21. Jahrhundert Rede der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Annette Schavan, MdB, anlässlich der Kick-off Veranstaltung zum
Zukunftsprojekt Erde Verantwortung in einer globalen Welt im 21. Jahrhundert Rede der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Annette Schavan, MdB, anlässlich der Kick-off Veranstaltung zum
Elemente Nachhaltiger Entwicklung
 Bildung für Nachhaltige Entwicklung Der Klimawandel als Impuls für innovativen Unterricht? Franz Rauch Alpen-Adria-Universität Klagenfurt Elemente Nachhaltiger Entwicklung Ökologische Ökonomische Soziale
Bildung für Nachhaltige Entwicklung Der Klimawandel als Impuls für innovativen Unterricht? Franz Rauch Alpen-Adria-Universität Klagenfurt Elemente Nachhaltiger Entwicklung Ökologische Ökonomische Soziale
Weiterentwicklung der HIV/AIDS-Prävention in Nordrhein-Westfalen Schwerpunkt Neuinfektionen minimieren
 Weiterentwicklung der HIV/AIDS-Prävention in Nordrhein-Westfalen Schwerpunkt Neuinfektionen minimieren Überblick www.mgepa.nrw.de Vorwort Aufklärung, Information und Prävention statt Repression ist seit
Weiterentwicklung der HIV/AIDS-Prävention in Nordrhein-Westfalen Schwerpunkt Neuinfektionen minimieren Überblick www.mgepa.nrw.de Vorwort Aufklärung, Information und Prävention statt Repression ist seit
Praxis trifft Theorie Eindrücke von der Tagung und Anknüpfung an Globales Lernen
 Praxis trifft Theorie Eindrücke von der Tagung und Anknüpfung an Globales Lernen Globales Lernen Entwicklungspolitische Bildung Friedenspädagogik Menschenrechtsbildung interkulturelle Pädagogik Ökopädagogik
Praxis trifft Theorie Eindrücke von der Tagung und Anknüpfung an Globales Lernen Globales Lernen Entwicklungspolitische Bildung Friedenspädagogik Menschenrechtsbildung interkulturelle Pädagogik Ökopädagogik
Möglichkeiten der ökonomischen Grundbildung in der Sekundarstufe I Einführung, Kaufen, Online und Finanzen
 Möglichkeiten der ökonomischen Grundbildung in der Sekundarstufe I Einführung, Kaufen, Online und Finanzen Termin: 15.03.2017, 19:00 bis 20:30 Uhr Im Rahmen der esession werden Möglichkeiten präsentiert,
Möglichkeiten der ökonomischen Grundbildung in der Sekundarstufe I Einführung, Kaufen, Online und Finanzen Termin: 15.03.2017, 19:00 bis 20:30 Uhr Im Rahmen der esession werden Möglichkeiten präsentiert,
Bayerische Klima-Allianz
 Bayerische Klima-Allianz Gemeinsame Erklärung der Bayerischen Staatsregierung und des Landesverbandes der Campingwirtschaft in Bayern e.v. (LCB) für eine Zusammenarbeit zum Schutz des Klimas vom 3. August
Bayerische Klima-Allianz Gemeinsame Erklärung der Bayerischen Staatsregierung und des Landesverbandes der Campingwirtschaft in Bayern e.v. (LCB) für eine Zusammenarbeit zum Schutz des Klimas vom 3. August
Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Praxis
 Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Praxis Dr. Isabel Rohner Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände Abteilung Bildung Berufliche Bildung BNE-Agendakongress, 11. Juli 2016 Definition
Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Praxis Dr. Isabel Rohner Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände Abteilung Bildung Berufliche Bildung BNE-Agendakongress, 11. Juli 2016 Definition
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)
 Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) Weltdekade der Vereinten Nationen 2005-2014 Hossam Gamil, Programmleiter für Erneuerbare Energien & Umwelt GERMAN ACADEMY FOR RENEWABLE ENERGY AND ENVIRONMENTAL
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) Weltdekade der Vereinten Nationen 2005-2014 Hossam Gamil, Programmleiter für Erneuerbare Energien & Umwelt GERMAN ACADEMY FOR RENEWABLE ENERGY AND ENVIRONMENTAL
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung Die Welt in der Weiterbildung verankern
 Bildung für eine nachhaltige Entwicklung Die Welt in der Weiterbildung verankern Dr. Christa Henze Universität Duisburg-Essen Quelle: http://www.bmub.bund.de/fileadmin/daten_bmu/bilder_logos/sdgs_logo_de.png
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung Die Welt in der Weiterbildung verankern Dr. Christa Henze Universität Duisburg-Essen Quelle: http://www.bmub.bund.de/fileadmin/daten_bmu/bilder_logos/sdgs_logo_de.png
Kinderuni und Schülerstudium. an der. Technischen Universität Darmstadt
 Hochbegabung und Hochbegabungsförderung im Schulunterricht Walter Diehl Kinderuni und Schülerstudium an der Technischen Universität Darmstadt Chiara Elisa Münz, 5600997, Erziehungswissenschaften Inhalt
Hochbegabung und Hochbegabungsförderung im Schulunterricht Walter Diehl Kinderuni und Schülerstudium an der Technischen Universität Darmstadt Chiara Elisa Münz, 5600997, Erziehungswissenschaften Inhalt
Workshop der LAG 21: Die Global Nachhaltige Stadt
 Workshop der LAG 21: Die Global Nachhaltige Stadt SDG 11 Umsetzung in NRW Stadt Bonn Amt für Internationales und Globale Nachhaltigkeit Verena Schwarte Wie kann SDG 11 durch internationales Engagement
Workshop der LAG 21: Die Global Nachhaltige Stadt SDG 11 Umsetzung in NRW Stadt Bonn Amt für Internationales und Globale Nachhaltigkeit Verena Schwarte Wie kann SDG 11 durch internationales Engagement
Der Länderübergreifende Lehrplan für die Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher in Deutschland. - Entwicklungen und Herausforderungen
 Der Länderübergreifende Lehrplan für die Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher in Deutschland - Entwicklungen und Herausforderungen Beate Schwingenheuer BöfAE 25.11.2013 1 Gliederung Entstehungszusammenhang
Der Länderübergreifende Lehrplan für die Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher in Deutschland - Entwicklungen und Herausforderungen Beate Schwingenheuer BöfAE 25.11.2013 1 Gliederung Entstehungszusammenhang
FÖRDERPREIS VEREIN(T) FÜR GUTE SCHULE Thema: Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) & Kooperationen
 FÖRDERPREIS VEREIN(T) FÜR GUTE SCHULE 2017 Thema: Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) & Kooperationen Was ist der Förderpreis Verein(t) für gute Schule? Schulfördervereine bündeln das zivilgesellschaftliche
FÖRDERPREIS VEREIN(T) FÜR GUTE SCHULE 2017 Thema: Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) & Kooperationen Was ist der Förderpreis Verein(t) für gute Schule? Schulfördervereine bündeln das zivilgesellschaftliche
Frühes Lernen: Kindergarten & Schule kooperieren
 Frühes Lernen: Kindergarten & Schule kooperieren Herford, den 13. März 2012 Gliederung des Vortrags (1) Zur Beeinflussbarkeit institutioneller Differenzen (2) Heterogenität, Inklusion als Herausforderung
Frühes Lernen: Kindergarten & Schule kooperieren Herford, den 13. März 2012 Gliederung des Vortrags (1) Zur Beeinflussbarkeit institutioneller Differenzen (2) Heterogenität, Inklusion als Herausforderung
Kommunalbüro für ärztliche Versorgung
 Kommunalbüro für ärztliche Versorgung Situation Das ambulante ärztliche Versorgungsniveau in Bayern ist hoch. Dies gilt für Städte und ländliche Regionen. Die Gesundheitsversorgung steht jedoch vor großen
Kommunalbüro für ärztliche Versorgung Situation Das ambulante ärztliche Versorgungsniveau in Bayern ist hoch. Dies gilt für Städte und ländliche Regionen. Die Gesundheitsversorgung steht jedoch vor großen
BNE-KOMPETENZEN IN SCHULEN AUFBAUEN. Mehr BNE an Schulen durch kreative und mediale Zugänge
 BNE-KOMPETENZEN IN SCHULEN AUFBAUEN Mehr BNE an Schulen durch kreative und mediale Zugänge AKTUELLE SITUATION Aufbau von BNE-Kompetenzen ein vernachlässigtes Feld an Schulen? Aktuelle Situation an meiner
BNE-KOMPETENZEN IN SCHULEN AUFBAUEN Mehr BNE an Schulen durch kreative und mediale Zugänge AKTUELLE SITUATION Aufbau von BNE-Kompetenzen ein vernachlässigtes Feld an Schulen? Aktuelle Situation an meiner
Rede der Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen. Svenja Schulze
 Rede der Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen Svenja Schulze anlässlich der Veranstaltung "Grand Challenges: Answers from North Rhine-Westphalia" Biotechnology:
Rede der Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen Svenja Schulze anlässlich der Veranstaltung "Grand Challenges: Answers from North Rhine-Westphalia" Biotechnology:
Rede. Klaus Kaiser. Parlamentarischer Staatssekretär für Kultur und Wissenschaft des Landes. Nordrhein-Westfalen. anlässlich der
 Rede Klaus Kaiser Parlamentarischer Staatssekretär für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen anlässlich der 2. Jahrestagung Verbundstudium "Das Verbundstudium vom Projekt zum zukunftsweisenden
Rede Klaus Kaiser Parlamentarischer Staatssekretär für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen anlässlich der 2. Jahrestagung Verbundstudium "Das Verbundstudium vom Projekt zum zukunftsweisenden
Schülerfragebogen zum Thema Globale Entwicklung
 Schülerfragebogen m Thema Globale Entwicklung Hinweise m Ausfüllen des Fragebogens Liebe Schülerin, lieber Schüler, deine Meinung m Projektunterricht im Themenfeld Globale Entwicklung ist gefragt! Die
Schülerfragebogen m Thema Globale Entwicklung Hinweise m Ausfüllen des Fragebogens Liebe Schülerin, lieber Schüler, deine Meinung m Projektunterricht im Themenfeld Globale Entwicklung ist gefragt! Die
Befähigung von Lehrkräften zur Umsetzung einer Beruflichen Bildung für eine nachhaltige Entwicklung(BBnE).
 StR. Sören Schütt-Sayed Befähigung von Lehrkräften zur Umsetzung einer Beruflichen Bildung für eine nachhaltige Entwicklung(BBnE). 23.04.2016 v STR. SÖREN SCHÜTT-SAYED (SOEREN.SCHUETT@UNI-HAMBURG.DE) Überblick
StR. Sören Schütt-Sayed Befähigung von Lehrkräften zur Umsetzung einer Beruflichen Bildung für eine nachhaltige Entwicklung(BBnE). 23.04.2016 v STR. SÖREN SCHÜTT-SAYED (SOEREN.SCHUETT@UNI-HAMBURG.DE) Überblick
TTIP Transatlantische Handelsund Investitionspartnerschaft. Bayerische Staatskanzlei
 TTIP Transatlantische Handelsund Investitionspartnerschaft Bayerische Staatskanzlei TTIP Transatlantische Handelsund Investitionspartnerschaft Informationen der Bayerischen Staatsministerin für Europaangelegenheiten
TTIP Transatlantische Handelsund Investitionspartnerschaft Bayerische Staatskanzlei TTIP Transatlantische Handelsund Investitionspartnerschaft Informationen der Bayerischen Staatsministerin für Europaangelegenheiten
Wie wird Heimat als Natur und Lebensraum heute im Geographieunterricht vermittelt?
 Wie wird Heimat als Natur und Lebensraum heute im Geographieunterricht vermittelt? Zukunftsforum Naturschutz Heimat begreifen Lernen von dem, was uns umgibt Stuttgart, 22. November 2014 Museum am Löwentor
Wie wird Heimat als Natur und Lebensraum heute im Geographieunterricht vermittelt? Zukunftsforum Naturschutz Heimat begreifen Lernen von dem, was uns umgibt Stuttgart, 22. November 2014 Museum am Löwentor
Der Beitrag der Berufsbildungsforschung zur großen Transformation. Prof. Dr. Werner Kuhlmeier
 Der Beitrag der Berufsbildungsforschung zur großen Transformation Prof. Dr. Werner Kuhlmeier Übersicht 1 2 3 Das Ziel: Die große Transformation Berufsbildung für eine nachhaltige Entwicklung Systematik
Der Beitrag der Berufsbildungsforschung zur großen Transformation Prof. Dr. Werner Kuhlmeier Übersicht 1 2 3 Das Ziel: Die große Transformation Berufsbildung für eine nachhaltige Entwicklung Systematik
Information zu den Bewertungskriterien
 Information zu den Bewertungskriterien Ausschreibung 2017/2018 Start der Ausschreibung 15. November 2017 Ende der Einreichfrist 31. Jänner 2018 www.mintschule.at MINT-Gütesiegel Mit dem MINT-Gütesiegel
Information zu den Bewertungskriterien Ausschreibung 2017/2018 Start der Ausschreibung 15. November 2017 Ende der Einreichfrist 31. Jänner 2018 www.mintschule.at MINT-Gütesiegel Mit dem MINT-Gütesiegel
Bessere Bildung trotz Haushaltskonsolidierung Die Chancen des demografischen Wandels nutzen
 Pressekonferenz, 19. August 2010 Bildungsmonitor 2010 Bessere Bildung trotz Haushaltskonsolidierung Die Chancen des demografischen Wandels nutzen Statement Hubertus Pellengahr Geschäftsführer Initiative
Pressekonferenz, 19. August 2010 Bildungsmonitor 2010 Bessere Bildung trotz Haushaltskonsolidierung Die Chancen des demografischen Wandels nutzen Statement Hubertus Pellengahr Geschäftsführer Initiative
Prinzip Nachhaltigkeit PädagogischeÜberlegungen zum professionellen Selbstverständnis von Jugendsozialarbeit an Schulen
 Ev. Hochschule NürnbergN Institut für f r Praxisforschung und Evaluation Prinzip Nachhaltigkeit PädagogischeÜberlegungen zum professionellen Selbstverständnis von Jugendsozialarbeit an Schulen Fachtagung
Ev. Hochschule NürnbergN Institut für f r Praxisforschung und Evaluation Prinzip Nachhaltigkeit PädagogischeÜberlegungen zum professionellen Selbstverständnis von Jugendsozialarbeit an Schulen Fachtagung
Rede der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Annette Schavan, MdB,
 Rede der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Annette Schavan, MdB, anlässlich der Auftaktveranstaltung zum Wissenschaftsjahr 2010 Die Zukunft der Energie am 26. Januar 2010 in Berlin
Rede der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Annette Schavan, MdB, anlässlich der Auftaktveranstaltung zum Wissenschaftsjahr 2010 Die Zukunft der Energie am 26. Januar 2010 in Berlin
I. Das Thema. Besucher-Umfrage zur geplanten Sonderausstellung Anthropozän - Natur und Technik im Menschenzeitalter
 Besucher-Umfrage zur geplanten Sonderausstellung Anthropozän - Natur und Technik im Menschenzeitalter Sehr geehrte Damen und Herren, das Deutsche Museum plant in Kooperation mit dem Rachel Carson Center
Besucher-Umfrage zur geplanten Sonderausstellung Anthropozän - Natur und Technik im Menschenzeitalter Sehr geehrte Damen und Herren, das Deutsche Museum plant in Kooperation mit dem Rachel Carson Center
Theorie und Geschichte der Gestaltung 2.
 Theorie und Geschichte der Gestaltung 2. Von Louisa Wettlaufer Design und Verantwortung Design umgibt uns überall, nie war es mehr im Trend und hatte einen höheren Stellenwert als heute. Verständlich,
Theorie und Geschichte der Gestaltung 2. Von Louisa Wettlaufer Design und Verantwortung Design umgibt uns überall, nie war es mehr im Trend und hatte einen höheren Stellenwert als heute. Verständlich,
10 Leitbilder des Studiums in Gerontologie
 10 Leitbilder des Studiums in Gerontologie des Instituts für Psychogerontologie der Universität Erlangen-Nürnberg F. R. Lang, S. Engel, H.-J. Kaiser, K. Schüssel & R. Rupprecht Präambel In den vergangenen
10 Leitbilder des Studiums in Gerontologie des Instituts für Psychogerontologie der Universität Erlangen-Nürnberg F. R. Lang, S. Engel, H.-J. Kaiser, K. Schüssel & R. Rupprecht Präambel In den vergangenen
Wozu brauchen wir Bildung für nachhaltige Entwicklung? Zielsetzungen und Perspektiven nachhaltiger Bildungslandschaften in Deutschland
 Prof. Dr. Gerhard de Haan Wozu brauchen wir Bildung für nachhaltige Entwicklung? Zielsetzungen und Perspektiven nachhaltiger Bildungslandschaften in Deutschland Neumarkt i. d. OPf. 25. Juni 12010 Wozu
Prof. Dr. Gerhard de Haan Wozu brauchen wir Bildung für nachhaltige Entwicklung? Zielsetzungen und Perspektiven nachhaltiger Bildungslandschaften in Deutschland Neumarkt i. d. OPf. 25. Juni 12010 Wozu
Eröffnung und Grußwort
 Eröffnung und Grußwort Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur Fachkonferenz Sport und Gesundheit bewegen! hier in der Hessischen Landesvertretung in Berlin. Ich begrüße Sie
Eröffnung und Grußwort Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur Fachkonferenz Sport und Gesundheit bewegen! hier in der Hessischen Landesvertretung in Berlin. Ich begrüße Sie
Kommunalbüro für ärztliche Versorgung
 Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit Kommunalbüro für ärztliche Versorgung Situation Das ambulante ärztliche Versorgungsniveau in Bayern ist hoch. Dies gilt für Städte und ländliche
Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit Kommunalbüro für ärztliche Versorgung Situation Das ambulante ärztliche Versorgungsniveau in Bayern ist hoch. Dies gilt für Städte und ländliche
Zukunft gestalten in Demokratien
 Zukunft gestalten in Demokratien Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb DBU-Tagung Umweltbildung, Osnabrück, 19. Januar 2016 Der Mensch als transformative Macht "Die Kapazitäten
Zukunft gestalten in Demokratien Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb DBU-Tagung Umweltbildung, Osnabrück, 19. Januar 2016 Der Mensch als transformative Macht "Die Kapazitäten
Zukunft Lernen NRW Bildung für nachhaltige Entwicklung. in der Elementarbildung in NRW. Dortmund, der
 Zukunft Lernen NRW Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Elementarbildung in NRW Dortmund, der 23.04.2015 Globales Lernen in Kindergärten Rahmenbedingungen und Konzepte Rahmenbedingungen Grundsätze
Zukunft Lernen NRW Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Elementarbildung in NRW Dortmund, der 23.04.2015 Globales Lernen in Kindergärten Rahmenbedingungen und Konzepte Rahmenbedingungen Grundsätze
Wo stehen wir, wohin gehen wir? Herausforderungen für die Waldpädagogik
 Wo stehen wir, wohin gehen wir? Herausforderungen für die Waldpädagogik Impulsvortrag 1. Sächsisches Waldpädagogikforum am 06.11.2015 Berthold Reichle,, Stuttgart Überblick Was ist Waldpädagogik Woher
Wo stehen wir, wohin gehen wir? Herausforderungen für die Waldpädagogik Impulsvortrag 1. Sächsisches Waldpädagogikforum am 06.11.2015 Berthold Reichle,, Stuttgart Überblick Was ist Waldpädagogik Woher
Global oder lokal? Alternativen anpacken! Ulrich Brand
 Global oder lokal? Alternativen anpacken! Ulrich Brand Science Event 2014 Transformation! Energie für den Wandel Umweltbundesamt / Radio ORF 1 27.11.2014 Leitfragen Welche Energie braucht Transformation?
Global oder lokal? Alternativen anpacken! Ulrich Brand Science Event 2014 Transformation! Energie für den Wandel Umweltbundesamt / Radio ORF 1 27.11.2014 Leitfragen Welche Energie braucht Transformation?
Meine Damen und Herren,
 Starke Bibliotheken! Aspekte einer gemeinsamen Bibliotheksstrategie NRW Grußwort von Frau Ministerin Ute Schäfer zur gemeinsamen Bibliothekskonferenz des MFKJKS und des vbnw 15. Januar 2014 Sehr geehrter
Starke Bibliotheken! Aspekte einer gemeinsamen Bibliotheksstrategie NRW Grußwort von Frau Ministerin Ute Schäfer zur gemeinsamen Bibliothekskonferenz des MFKJKS und des vbnw 15. Januar 2014 Sehr geehrter
AUSBILDUNG Sekundarstufe I. Fachwegleitung Natur und Technik
 AUSBILDUNG Sekundarstufe I Fachwegleitung Natur und Technik Inhalt Schulfach/Ausbildungfach 4 Das Schulfach 4 Das Ausbildungsfach 4 Fachwissenschaftliche Ausbildung 5 Fachdidaktische Ausbildung 5 Gliederung
AUSBILDUNG Sekundarstufe I Fachwegleitung Natur und Technik Inhalt Schulfach/Ausbildungfach 4 Das Schulfach 4 Das Ausbildungsfach 4 Fachwissenschaftliche Ausbildung 5 Fachdidaktische Ausbildung 5 Gliederung
Bundesteilhabegesetz. Neue Regeln für Werkstätten für behinderte Menschen. in Leichter Sprache
 Bundesteilhabegesetz Neue Regeln für Werkstätten für behinderte Menschen in Leichter Sprache Dieser Text ist nur in männlicher Sprache geschrieben. Zum Beispiel steht im Text nur das Wort Mit-Arbeiter.
Bundesteilhabegesetz Neue Regeln für Werkstätten für behinderte Menschen in Leichter Sprache Dieser Text ist nur in männlicher Sprache geschrieben. Zum Beispiel steht im Text nur das Wort Mit-Arbeiter.
Die neue Eine-Welt-Strategie des Landes NRW- Ergebnisse und Umsetzungsperspektiven
 Die neue Eine-Welt-Strategie des Landes NRW- Ergebnisse und Umsetzungsperspektiven Workshop der Stiftung Entwicklung und Frieden (SEF) Globale Zusammenhänge vermitteln - eine entwicklungspolitische Kernaufgabe
Die neue Eine-Welt-Strategie des Landes NRW- Ergebnisse und Umsetzungsperspektiven Workshop der Stiftung Entwicklung und Frieden (SEF) Globale Zusammenhänge vermitteln - eine entwicklungspolitische Kernaufgabe
Gegenwart und Zukunft: Integrität und Komplexität der Agenda 2030 und deren Übertragung auf Kommunen
 Gegenwart und Zukunft: Integrität und Komplexität der Agenda 2030 und deren Übertragung auf Kommunen SDG-TAG 2017 - Das Köln, das wir wollen Sebastian Eichhorn Landesarbeitsgemeinschaft Lokale Agenda 21
Gegenwart und Zukunft: Integrität und Komplexität der Agenda 2030 und deren Übertragung auf Kommunen SDG-TAG 2017 - Das Köln, das wir wollen Sebastian Eichhorn Landesarbeitsgemeinschaft Lokale Agenda 21
Eckpunkte einer Bioökonomiestrategie für Nordrhein-Westfalen
 Eckpunkte einer Bioökonomiestrategie für Nordrhein-Westfalen A. Ausgangslage Die Lösung der globalen gesellschaftlichen Herausforderungen wie Klimawandel, Ressourceneffizienz, Biodiversitätsverlust, Gesundheit
Eckpunkte einer Bioökonomiestrategie für Nordrhein-Westfalen A. Ausgangslage Die Lösung der globalen gesellschaftlichen Herausforderungen wie Klimawandel, Ressourceneffizienz, Biodiversitätsverlust, Gesundheit
Bildung für Nachhaltige Entwicklung Herausforderungen erkennen Zukunft gestalten
 Bildung für Nachhaltige Entwicklung Herausforderungen erkennen Zukunft gestalten Startworkshop der PILGRIM-Schulen 04.10.2012 Nachhaltigkeit - Begriffsklärung Carl von Carlowitz (Sylivicultura Oeconomica,
Bildung für Nachhaltige Entwicklung Herausforderungen erkennen Zukunft gestalten Startworkshop der PILGRIM-Schulen 04.10.2012 Nachhaltigkeit - Begriffsklärung Carl von Carlowitz (Sylivicultura Oeconomica,
Die Zukunft beruflichen Lernens in Ausbildung und Hochschule. Berufsbildung aus einem Guss
 Universität Oldenburg - Forum Berufsbildung 2014 Die Zukunft beruflichen Lernens in Ausbildung und Hochschule Für ein gemeinsames Leitbild für die betrieblich duale und die hochschulische Berufsbildung
Universität Oldenburg - Forum Berufsbildung 2014 Die Zukunft beruflichen Lernens in Ausbildung und Hochschule Für ein gemeinsames Leitbild für die betrieblich duale und die hochschulische Berufsbildung
Zwischenergebnisse (detaillierte Darstellung) zur Delphi-Studie
 14. 1. 29 Zwischenergebnisse (detaillierte Darstellung) zur Delphi-Studie Die Delphi-Studie ist ein Projekt von Studierenden der Freien Universität Berlin. Natalia Basova, Stefanie Behrend, Michael Groneberg,
14. 1. 29 Zwischenergebnisse (detaillierte Darstellung) zur Delphi-Studie Die Delphi-Studie ist ein Projekt von Studierenden der Freien Universität Berlin. Natalia Basova, Stefanie Behrend, Michael Groneberg,
Tourismus in der Entwicklungszusammenarbeit
 Tourismus in der Entwicklungszusammenarbeit DIE BEDEUTUNG DES TOURISMUS IN ZAHLEN, DATEN UND FAKTEN Der Tourismussektor ist einer der am schnellsten wachsenden Wirtschaftszweige. Im welt weiten Vergleich
Tourismus in der Entwicklungszusammenarbeit DIE BEDEUTUNG DES TOURISMUS IN ZAHLEN, DATEN UND FAKTEN Der Tourismussektor ist einer der am schnellsten wachsenden Wirtschaftszweige. Im welt weiten Vergleich
Bayerische Klima-Allianz
 Bayerische Klima-Allianz Gemeinsame Erklärung der Bayerischen Staatsregierung und des Verbandes der bayerischen Bezirke zu einer Zusammenarbeit zum Schutz des Klimas vom 13. Februar 2008 2 Bayerische Klima-Allianz
Bayerische Klima-Allianz Gemeinsame Erklärung der Bayerischen Staatsregierung und des Verbandes der bayerischen Bezirke zu einer Zusammenarbeit zum Schutz des Klimas vom 13. Februar 2008 2 Bayerische Klima-Allianz
Natur und Technik. Fachwegleitung. AUSBILDUNG Sekundarstufe I
 AUSBILDUNG Sekundarstufe I Fachwegleitung Integrierter Bachelor-/Master-Studiengang Vollzeit und Teilzeit Konsekutiver Master-Studiengang für Personen mit Fachbachelor Natur und Technik Inhalt Schulfach
AUSBILDUNG Sekundarstufe I Fachwegleitung Integrierter Bachelor-/Master-Studiengang Vollzeit und Teilzeit Konsekutiver Master-Studiengang für Personen mit Fachbachelor Natur und Technik Inhalt Schulfach
Leitbild Kantons schule Rychen berg Winterthur
 Leitbild Kantons schule Rychen berg Winterthur Präambel Die Kantonsschule Rychenberg gibt sich ein Leitbild, das für alle Akteure an unserer Schule verbindlich ist und an dem wir uns auch messen lassen
Leitbild Kantons schule Rychen berg Winterthur Präambel Die Kantonsschule Rychenberg gibt sich ein Leitbild, das für alle Akteure an unserer Schule verbindlich ist und an dem wir uns auch messen lassen
Ingenieurwissenschaften Das traue ich mir zu. Prof. Dr.-Ing. Burghilde Wieneke-Toutaoui
 Ingenieurwissenschaften Das traue ich mir zu Prof. Dr.-Ing. Burghilde Wieneke-Toutaoui Gliederung Ausgangssituation Projekt Zauberhafte Physik Projekt TasteMINT Projekt MINT Role Models UnterstÄtzung zum
Ingenieurwissenschaften Das traue ich mir zu Prof. Dr.-Ing. Burghilde Wieneke-Toutaoui Gliederung Ausgangssituation Projekt Zauberhafte Physik Projekt TasteMINT Projekt MINT Role Models UnterstÄtzung zum
Forum Ökologische Nachhaltigkeit: Qualifizierung und Bildung
 Gleichstellung der Geschlechter, Antidiskriminierung und Ökologische Nachhaltigkeit von der Strategie zur Praxis Forum Ökologische Nachhaltigkeit: Qualifizierung und Bildung Julika Schmitz, Henriette Meseke
Gleichstellung der Geschlechter, Antidiskriminierung und Ökologische Nachhaltigkeit von der Strategie zur Praxis Forum Ökologische Nachhaltigkeit: Qualifizierung und Bildung Julika Schmitz, Henriette Meseke
