Beitrag zur Kenntnis der weidenbewohnenden Venturiaceae
|
|
|
- Kerstin Hofmeister
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Research Collection Doctoral Thesis Beitrag zur Kenntnis der weidenbewohnenden Venturiaceae Author(s): Nüesch, Jakob Publication Date: 1960 Permanent Link: Rights / License: In Copyright - Non-Commercial Use Permitted This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection. or more information please consult the Terms of use. ETH Library
2 Prom. Nr. 3046& Dfss ETH Beitrag zur Kenntnis der weidenbewohnenden Venturiaceae VON DER EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE IN ZÜRICH ZUR ERLANGUNG DER WÜRDE EINES DOKTORS DER TECHNISCHEN WISSENSCHATEN GENEHMIGTE PROMOTIONSARBEIT VORGELEGT VON JAKOB NÜESCH DIPL. ING. AGR. ETH VON BALGACH (ST. GALLEN) Referent: Herr Prof. Dr. E. GXumann Korreferent: Herr Prof. Dr. H. Kern Druck von A. W. Hayn's Erben, Berlin West ETH-Bibliothek llllllllllllll EM
3 Veröffentlidit in»phytopathologisdie Zeitsdirift-<, Bd. 39, Heft 4, Seite Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg
4 D. A. Summary. B. C. Aus dem Institut für spezielle Botanik der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich Direktor: Prof. Dr. E. Gäumann Beitrag zur Kenntnis der weidenbewohnenden Venturiaceae Von J. NÜESCH Mit 12 Abbildungen Inhalt: Einleitung. Allgemeine Betrachtungen. Materialien und Methoden. 1. Nährmedien; 2. Isolation der Pilze; 3. ruchtkörperbildung in den Reinkulturen; 4. Tem peraturversuche; 5. Infektionsversuche; 6. Mikromessungen und statistische Auswertungen. 7. ärbungen für morphologische und zytologische Untersuchungen. Ergebnisse. 1. Morphologische Untersuchungen; 2. Physiologische Untersuchungen; 3. Infektionsversuche. Systematik. 1. Gemeinsame Merkmale der untersuchten Arten; 2. ormenkreis der Venturia chlorospora. 3. ormenkreis der Venturia saliciperda; 4. ormenkreis der Venturia subcutanea; 5. ormenkreis des Epipolaeum longisetosum; Auszuschließende Arten. Zusammenfassung. Literaturverzeichnis. EINLEITUNG Die amilie der Venturiaceae wurde von Müller und von Arx (1950) aufgestellt und ihr einige Gattungen, vorwiegend parasitärer Ascomyceten, mit zweizeiligen, bräunlich, gelblich oder grünlich gefärbten Ascosporen zugeteilt. Über die meisten hier einzuordnenden ormen liegen bisher wenig Untersuchungen vor. Nur die wirtschaftlich wichtigen Schorferreger, Venturia inaequalis (Cooke) Winter, Venturia pirina Aderh. und Venturia cerasi Aderh., sind biologisch näher untersucht, während die übrigen ormen bisher lediglich morphologisch beschrieben wurden. In der vorliegenden Arbeit werden die Pilze aus der Verwandtschaft von Venturia de Not., welche auf -Anen parasitieren, einer systemati schen Untersuchung unterzogen. ür die Unterstützung dieser Arbeit danke ich Herrn Prof. Dr. E. Gäumann, Leiter des Institutes für spezielle Botanik der ETH, und Herrn Dr. Phytopath. Z., Bd. 39, Heft 4 23
5 330 NÜESCH E. Müller, Konservator der Herbarien der ETH, herzlich. Dank der Hilfe von Herrn Dr. H. Hess konnte ich mich in die Weidensystematik einarbei ten und die Wirtspflanzen in den meisten ällen eindeutig bestimmen. Mein Dank gilt auch den übrigen Mitarbeitern des Institutes. A. ALLGEMEINE BETRACHTUNGEN daß die in Auf überwinterten, toten Blättern von Weidenarten findet man regel mäßig Ascomyceten der Gattung Venturia de Not., die meist als Venturia chlorospora (Ces.) Karst, bestimmt wurden. Aderhold (1897) stellte den als usicladium ramulosum Rostr. beschriebenen Konidienpilz als Nebenfruchtform in den Entwicklungskreis dieser Venturia. Es ist auffallend, der olge als usicladium saliciperdum (All. et Tub.) Tub. (v. Tubeuf 1902) und später Pollaccia saliciperda (All. et Tub.) v. Arx (von Arx 1957) be zeichnete Konidienform vor allem Kultur- und Zierweiden befällt (z. B. Schwarz 1922, Pape 1925, Jansen 1927), während die ihr zugeschriebene Hauptfruchtform, Venturia chlorospora, vorwiegend auf einheimischen Wei den gefunden wird. Diese Beobachtung ließ an der Zusammengehörigkeit der Pilze zweifeln. Mehrere unternommene Versuche mit Reinkulturen führten nie eindeutig zur Klärung dieses McCormick 1929, Anonym 1931, von Arx 1957). Problems (Kochmann 1929, Clinton und Neben Venturia chlorospora sind noch weitere weidenbewohnende Venturia-Arten beschrieben worden, so von Volkart (1912) die Venturia longisetosa und von Dearness (1917) die den jedoch nicht näher untersucht. Das Ziel dieser Arbeit ist deshalb: Venturia subcutanea. Diese Pilze wur 1. Die Zusammenhänge zwischen der Pollaccia saliciperda und Venturia chlorospora näher zu untersuchen. 2. Vergleichende morphologische, physiologische und biologische Untersu chungen der Venturia-ormen verschiedener Arten der Gattung L. anzustellen. Es war mein Anliegen, ein möglichst umfassendes Pilzmaterial zu sam meln und die Weidenarten an verschiedenen Standorten während der ganzen Pilzformen wurden mor Vegetationsperiode zu beobachten. Alle gesammelten phologisch untersucht und viele auch isoliert. Die gleichzeitig gesammelten Wirtspflanzenproben dienten der sicheren Bestimmung und der Heranzucht von Versuchspflanzen. B. MATERIALIEN UND METHODEN Die vorliegenden Untersuchungen wurden mit den unten beschriebenen Materialien und Methoden durchgeführt. Abweichungen gelangen jeweils beim entsprechenden Versuch zur Darstellung.
6 50 C warmen Malzagar beimischen. c) Hafermehlagar Beitrag zur Kenntnis der weidenbewohnenden Venturiaceae Nährmedien a) Malzagar 2%> Malzextrakt, 2 /o Agar-Agar, Leitungswasser Autoklaviert bei 120 G, 1 atü, 30 min. t b) Terramycin-Malzagar Malzagar + 0,01 /oo Terramycin in Aceton gelöst, nach dem Autoklavieren dem etwa 20 g Hafermehl, 1 1 Leitungswasser. 20 min kochen, durch Käseleinen filtrieren, iltrat wieder auf 1 1 auffüllen, 18 g Agar-Agar beifügen, autoklavieren. d) Blattextraktagar (Keitt und Langford 1941, Menon 1956) 25 g tote, luftgetrocknete Weidenblätter während 30 min in 0,5 1 Leitungswasser kochen, Absud filtrieren, auf 1 1 auffüllen, 0,5 /o Malzextrakt + 2,5 /o Agar-Agar beifügen, autoklavieren. e) Kalt sterilisierte Weidenblätter (Hansen und Snyder 1947) rische, grüne Weidenblätter in einem Glaszylinder mit 1 Volumen-"/oo Propylenoxyd während 12 Stunden bei 27 C sterilisieren. Anschließend die Blätter im Impfkasten in sterile, 5 ml Aqua dest. enthaltende Reagenzröhrchen bringen. f) Hefeextraktnährlösungen I. 0,5 %> Hefeextrakt, 0,5 /o Malzextrakt, 1 1 Aqua dest. (Schmidt 1936). II. Mineral salzlösungen nach Heller (1954), Makroheller + Mikroheller, 1,5 /o Dextropur, 0,5 Vo Hefe extrakt, mit Leitungswasser auf 1 1 gebracht und autoklaviert. 2. Isolation der Pilze a) Hauptfruchtformen Blattstücke mit reifen ruchtkörpern wurden ungefähr 20 min in Was ser gelegt, hierauf mit Vaseline innen am Wattestopfen steriler, eine Schicht Durch die nach Malzagar enthaltender 100-ml-Erlenmeyerkölbchen befestigt. unten gerichteten ruchtkörpermündungen gelangten die aktiv ausgeschleu derten Ascosporen auf die Nährböden, wo sie keimten und nach 10 bis 14 Tagen makroskopisch als kleine, dunkelgraue Myzelhäufchen sichtbar wurden. Diese Ausgangskulturen und davon übertragene Tochterkolonien dienten als Grundlagen der Kulturversuche (Loeffler 1957). = b) Nebenfruchtformen Mit einer sterilen Nadel wurden unter der Lupe Konidien von den Konidienräschen der erkrankten, grünen Blätter abgestreift und auf einem steri len Objektträger in einem Tropfen destilliertem "Wasser suspendiert. Unter dem Mikroskop wurde eine Stelle mit wenigen, gut ausgereiften Konidien ausgesucht. Diese wurden mit einer zur Kapillare ausgezogenen Pipette an und auf eine etwa 1 mm dicke Malzagarschicht in einer Petrischale gesogen gespritzt. Dieses Vorgehen ermöglichte eine gute Verteilung der Konidien, welche auf dem Malzagar auskeimten und dank der dünnen Nährschicht durch die geschlossene Glasschale unter dem Mikroskop beobachtet werden konnten. Je nach den Bedürfnissen ist es so möglich, einzelne oder mehrere ausgekeimte Konidien auf Malzagarkölbchen zu übertragen. Bakterienkonta minationen ließen sich durch eine Passage über Terramycin-Agar ausscheiden (Scheinpflug 1958). 23*
7 332 NÜESCtt 3. ruchtkörperbildung in den Reinkulturen Aus den in Malzagarkölbchen angezogenen Reinkulturen wurden nach dem Erreichen eines guten Wachstums Myzelwürfel ausgestochen und auf ilterscheiben in eine euchtkammer gebracht. Mit Hilfe eines automatisch regulierten Defensors konnte die notwendig hohe, relative Luftfeuchtigkeit von 80 bis 100 /o gehalten werden. Wesentlich ist ein ständiger Wassernebel in der euchtkammer. Die Temperatur muß dem Wachstumsoptimum der zu untersuchenden Kultur entsprechen. Bei dieser Anordnung lassen sich reife ruchtkörper nach zwei bis vier Wochen erzielen. 4. Temperaturversuche Die Temperaturabhängigkeit des Wachstums der Pilze wurde mittels des Myzeltrockengewichtes bestimmt. Die Anzucht der Kulturen erfolgte in Malzagar-Petrischalen. Von diesen wurden mit Hilfe eines Korkbohrers gleich große Myzelstücke ausgestochen und in loc-ml-erlenmeyerkölbchen mit 30 ml Hefeextraktnährlösung II gebracht. Die zu prüfenden Pilze wurden in je fünf Parallelen den entsprechenden Versuchstemperaturen ausgesetzt. Die Auswertung erfolgte, nachdem sich das Myzel im optimalen Temperatur bereich kräftig entwickelt hatte, nach Stoll (1954). Als Infektionsmaterial 5. Infektionsversuche a) Infektionsmaterial dienten Konidien, Ascosporen sowie Myzel. Die Konidien wurden entweder von deren Trägern auf erkrankten Blättern mit einer Präpariernadel abgestreift und in Wasser suspendiert oder von sporulierenden Reinkulturen direkt in Wasser aufgeschwemmt. ür die Gewinnung der Ascosporen wurden ruchtkörper aus Blättern und Reinkulturen unter der Lupe herauspräpariert, in einem Mörser zerquetscht, in Wasser suspendiert und durch einen Wattefilter von den Substrat- und ruchtkörperresten ge reinigt. Die Sporendichte wurde anschließend unter dem Mikroskop kontrol liert und für dieselbe Versuchsreihe möglichst gleich eingestellt. Das gesamte Sporenmaterial mußte vorerst auf Keimfähigkeit geprüft werden. Das Myzellnfektionsmaterial gelangte in Hefeextraktnährlösung I oder II oder auf Malzagar zur Anzucht. Die Nährlösung gut gewachsener Kulturen wurde dekantiert und das Myzel in Wasser suspendiert. Das Auftragen des Infektionsmaterials auf die Pflanzen erfolgte für Ascosporen und Konidien mit einem mit Gummiballon versehenen Sprüh apparat. Das Myzel dagegen wurde mit einem Pinsel auf die Blätter gestri chen oder Malzagarklötzchen mit der Myzelschicht auf die Blätter gelegt. Myzelinfektionen erfolgten nur in Gewächshauskabinen. b) Gewächshausinfektionen Die eingetopften, Glaskabinen mit regulierbarer Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Auftragen des Infektionsmaterials wurde die Luftfeuchtigkeit aus Stecklingen gezogenen Weiden kamen in schattierte Nach dem während etwa
8 Beitrag zur Kenntnis der weidenbewohnenden Venturiaceae 333 fünf Stunden niedrig gehalten, damit dieses antrocknen konnte (Aderhold 1897, Schmidt 1936, Schweizer 1958 a). Hierauf wurden die Pflanzen wäh rend sieben Tagen in einem ständigen Wassernebel gehalten und anschließend bis zur manifesten Erkrankung in Intervallen von ungefähr acht Stunden mit dem Defensor besprüht. Die Kabinentemperatur suche zwischen 18 und 22 C. c) reilandinfektionen schwankte während der Ver Die in Quadratverbänden von je 10 bis 15 Stecklingen auf 400 cm2 an gezogenen Weiden wurden für die Infektionen durch mit Schattierfarbe be strichene Plastiksäcke abgeschirmt. Um eine hohe Luftfeuchtigkeit zu erzielen, müssen die Säcke gut in der Erde verankert sein. Zur Infektion werden sie oben so geöffnet, daß die Mündung des Sprühapparates die Öffnung aus füllt. So ist es möglich, die Sporensuspension über die Pflanzen zu verteilen und gleichzeitig eine hohe Luftfeuchtigkeit herzustellen, ohne die Nachbarpflanzen zu infizieren. Nach dem Besprühen wurde die Öffnung sofort ge schlossen. Die Pflanzen blieben drei Tage in der Isolierung. Meistens genügte die durch das Besprühen erzielte Luftfeuchtigkeit, um die Blätter dauernd benetzt zu halten. Ergab sich die Notwendigkeit zusätzlicher Befeuchtung, so wurde mit Hilfe eines Zerstäubers von unten her Wasser im Raum verteilt. d) Befallskontrolle Alle infizierten Pflanzen wurden vom 10. Tage nach der Infektion täg lich auf Symptome untersucht. Diese zeigten sich zuerst als punktförmige, chlorotische lecke, welche anschließend verbräunten und nekrotischen Cha rakter annahmen. Sobald diese Symptome bei den reilandinfektionen auf traten, wurden die Weiden über der Erde abgeschnitten und in die eucht kammer gebracht. Diese Maßnahme verhütete Spontaninfektionen. In der euchtkammer blieben die Pflanzen noch während Wochen grün und stan den unter weiterer Beobachtung. Zeigten sich nach einem Monat keine Sym ptome, so wurden die Blätter nach Schweizer (1958 a) in 60 % Äthylalkohol eingelegt. In manchen ällen war es dadurch möglich, Befallsstellen als hellere lecke von der übrigen Blattfläche zu unterscheiden. Das infizierte Wirts material wurde jeweils auch mikroskopisch untersucht. Alle Versuche gelang ten mindestens in fünffacher Wiederholung mit fünf bis zehn Parallelen zur Durchführung. 6. Mikromessungen und statistische Auswertungen Die für Mikromessungen bestimmten Präparate wurden in 100 /oige Milchsäure eingebettet und kurz aufgekocht. Um durch Quellungsvorgänge verursachte Größenunterschiede zu vermeiden, wurden die Messungen erst 24 Stunden nach dem Einbetten vorgenommen. Sie erfolgten unter ölimmersion bei einer Vergrößerung von 6 X 90 mit einem Leitz-Meßokular. Sofern statistische Auswertungen erforderlich waren, wurden sie nach Linder (1953) vorgenommen.
9 . 7. eignete Venturia insbesondere 334 NÜESCH ärbungen für morphologische und zytologische Untersuchungen ür die morphologischen Untersuchungen der Pilze des einbaues der ruchtschicht sich am besten eine ärbung mit Baumwollblau. ' Zytologische Befunde konnten an Hauptfruchtformen aus Reinkulturen gemacht werden. Einzelne ruchtkörper wurden aus Agarblöckchen heraus präpariert, auf einen Objektträger gebracht, mit einem Tropfen arblösung versetzt und mittels eines Deckglases unter gleichmäßigem Druck zerquetscht. Zur ärbung eignete sich am besten die Orceinlösung nach Day et al. (1956) (0,2 g Orcein, 4,6 ml Eisessig, 5,2 ml Aq. dest., 0,2 ml 2,5 % Milchsäure). Diese Methode eignete sich für unsere Zwecke besser als die Orceinfärbung nach Singleton (1953) oder die ärbung mit Karminessigsäure. Ein kurzes Erhitzen der Präparate ergab kontrastreiche Bilder. Ebenso erwies sich ein vorheriges ixieren in Carnoy-Lösung als vorteilhaft. Die Präparate wurden jeweils photographiert oder gezeichnet. C. ERGEBNISSE 1. Morphologische Untersuchungen Die morphologischen Untersuchungen erstreckten sich auf Haupt- und Nebenfruchtformen des gesammelten Materials. Da die Hauptfruchtformen der uns interessierenden Pilze meistens auch deren Uberwinterungsformen sind, müssen sie im rühjahr bis rühsommer, je nach den Standorten der Wirte, gesammelt werden. Die bekannten Nebenfruchtformen dagegen para sitieren auf den lebenden Wirtsblättern und -trieben und kommen je nach Witterung rühjahr vom bis in den Herbst vor. Buser (1940) unterschied für die Schweiz 27 verschiedene Weidenarten, die, mit Ausnahme von zwei äußerst seltenen, alle in die Untersuchungen ein bezogen wurden. erner stand auch Herbarmaterial des Staatsherbariums München und des Herbariums der ETH zur Verfügung. a) Hauptfruchtformen Bei den gesammelten Hauptfruchtformen zeigten sich Unterschiede in den Dimensionen und der Lagerung der ruchtkörper, der Borstenausbildung so wie Größe, orm und Beschaffenheit der Sporen. Es ließen sich so fünf ver schiedene morphologische Arten unterscheiden chlorospora (Ces.) Karst., Venturia helvetica, Venturia microspora, Venturia subcutanea Dearn. und Epipolaeum longisetosum (Volk.) nov. comb. (Syn. Venturia longisetosa Volk.) deren Artwert und verwandtschaftliche, Beziehungen durch Kulturund Infektionsversuche überprüft wurden. b) Nebenfruchtformen Obwohl sich die Sammeltätigkeit über zwei Jahre erstreckte, konnte nur eine, vermutlich zu einer Venturia-Art gehörende Nebenfruchtform, Pollaccia salkiperda, gefunden werden. Ebenso enthielt das Herbarmaterial nur diesen Pilz.
10 Beitrag zur Kenntnis der weidenbewohnenden Venturiaceae 335 c) Myzelmerkmale Das Myzel aller isolierten Pilze ist von dunkelbrauner bis dunkelgrauer arbe. Die Hyphen breiten sich sehr langsam aus und zeigen häufig ein knol liges, seltener ein strahliges Wachstum. Sie sind dickwandig, von chlamydosporenartigen, aufgeblasenen, rundlichen, öltropfen enthaltenden Zellen durchsetzt, welche mit seitlichen Keimschläuchen auskeimen und Seitenäste bilden, die vielfach anastomosieren. ür die systematische Einteilung der Arten sind diese Merkmale nur wenig brauchbar, da sie sehr stark variieren. Das Myzel der Pollaccia saliciperda demjenigen der aus Ascosporen gezogenen men mit Beobachtungen von Dennis (1931) überein. unterscheidet sich nicht wesentlich von 2. Physiologische Untersuchungen a) Temperaturabhängigkeit des Myzelwachstums Reinkulturen. Diese Befunde stim Bei diesen Versuchen interessierte in erster Linie die Temperaturabhän gigkeit der verschiedenen, nach morphologischen Gesichtspunkten eingeteilten Arten, ferner der Vergleich der Myzelzuwachsrate einzelner Reinkulturen bei ihren Temperaturoptima in derselben Nährlösung (Hefeextrakt-Nährlösung II S. 331). Um die Gesamtvariation einer bestimmten Art zu erfassen, wurde immer mit Mehrsporkulturen gearbeitet. Konnten verschiedene Pilze auf der gleichen Wirtspflanze gefunden werden (Sammelwirte, Gäumann 1951), wie im alle von Venturia chlorospora und Pollaccia saliciperda auf elegantissima K. Koch, wurden beide gleichzeitig in die Temperaturversuche ein bezogen. Die Resultate (vgl. ig. 4, 6) zeigen, daß sich sowohl Arten mit ähn lichen Temperaturansprüchen und Myzelzuwachsraten, wie solche mit sehr verschiedenen Reaktionen deutlich abzeichnen. Mit Ausnahme von Venturia subcutanea werden die geprüften Pilze bei 27 C in ihrem Wachstum stark gehemmt und bei 33 C irreversibel geschäddigt, d. h. sie setzen nach Überführung in optimale Temperaturverhältnisse das Wachstum nicht mehr fort. Niedere Temperaturen dagegen beeinträchti gen das Wachstum nur in geringem Maß. b) Bildung von Nebenfruchtformen in Kultur Die Ascosporen wie Konidienreinkulturen bildeten, von einer Ausnahme abgesehen, nur kurze Zeit nach der Isolation Nebenfruchtformen auf Malzagar. Aus diesem Grunde fand Dennis (1931) überhaupt keine Konidien in PoZ/tfcatf-Reinkultureri. Die Konidienbildung steht in engem Zusammenhange mit dem MyzelWachstum: sobald ein verhältnismäßig intensives Wachstum beginnt, setzt die Konidienbildung aus. Hansen (1938) zeigte mit Einspor kulturen mehrerer Arten von ungi imperfecti eine Korrelation zwischen ge ringem bzw. starkem Myzelwachstum und vorhandener bzw. fehlender Konidienproduktion. Er führte diese Erscheinung auf Heterokaryosis polynukle arer Einzelsporen zurück. In den vorliegenden Untersuchungen konnte bei Einsporkulturen keine Trennung in sporulierende und nicht sporulierende Stämme gefunden werden.
11 keine anhält bei 336 NÜESCH Mehrere Arbeiten über Venturia inaequalis (Cke.) Wint. befaßten sich mit der Konidienproduktion in vitro (Rudloff 1935, Schmidt 1936, Keitt und Palmiter 1938, Zobrist und Bohnen 1958). Sie zeigten, daß die Bildung der Konidien auf festen Medien, vor allem auf Malzagar usicladium cerasi (Rabh.) Sacc. und usicladium carpophilum (Thüm.) Oudem. auch auf Hafermehlagar (Schweizer 1958 b) und außerdem die Pathogeni tät der Pilze erhalten bleibt (Keitt und Langford 1941). Alle Versuche zur Erhaltung der Sporenbildung in Kultur schlugen bei den untersuchten Pilzen fehl. Es gelang auch nicht, durch Verpflanzung der Kulturen in für Venturia inaequalis geeignete Medien und entsprechenden Temperaturvariationen die Bildung der Konidien erneut auszulösen. Einzig Pollaccia saliciperda bildete auf Agarklötzchen in der euchtkammer wieder Konidien. Der gleiche Effekt trat auch bei einer Beimpfung kalt sterilisierter Blätter in Reagenzröhren ein (S. 331). Die Pollaccia saliciperda bildet wie in der Natur Konidien und Konidienträger, welche den ormen der Gattung Pollaccia Bald, et Cif. (Hughes 1953) entsprechen. Die einzelnen Träger und Konidien stehen nicht in Stromata zusammen, sondern sind, dem Substrat entsprechend, diffus verteilt. Venturia chlorospora dagegen bildet eine Konidienform, welche in die Gattung usicladium Bon. (Hughes 1953) gestellt werden muß. Die einzel ligen, seltener zweizeiligen, langen, schmalen Konidien entstehen auf Höckern der Trägerzellen. Sie werden in langen, unverzweigten Ketten abgeschnürt und unterscheiden sich somit eindeutig von Pollaccia. Venturia microspora und Venturia helvetica, zwei verwandte Arten der Venturia chlorospora, wie auch Epipolaeum longisetosum und Venturia subcutanea bildeten unter den verschiedenen geprüften Bedingungen auch auf kalt sterilisierten Blättern Nebenfruchtformen. c) Hauptfruchtformen in Reinkulturen Da Pollaccia saliciperda nur mutmaßlich zu Venturia chlorospora gestellt wurde (Aderhold 1897) und der Beweis für die Zusammengehörigkeit nicht erbracht werden konnte (Clinton und McCormick 1929, Anonym und von Arx 1957), war es um so mehr notwendig, Versuche zur Gewinnung von Hauptfruchtformen aus Reinkulturen durchzuführen. erner war es unerläßlich, auch die morphologischen Arten einer Prüfung unter vergleich baren Bedingungen zu unterziehen, um eine Konstanz der morphologischen Merkmale nachzuweisen. Untersuchungen über die ruchtkörperbildung in vitro wurden inner halb der Gattung Venturia vor allem mit dem Erreger des Apfelschorfes durchgeführt. Jones (1914) gelang es erstmals, in vitro reife Ascosporen von Venturia inaequalis zu erhalten (s. auch Keitt und Palmiter 1938). Jones ließ einfach Ascosporen von verschiedenen Herkünften auf den gleichen Malzagarnährböden auskeimen. Damit zeigte er, daß Malzagar nicht nur für die Konidien-, sondern auch für die Ascosporenbildung sehr geeignet ist. rey (1924) erreichte die gleichen Resultate mit Hafermehlagar. Keitt und Paimiter (1938), vor allem aber Keitt und Langford (1941) verbesserten diese Methoden und züchteten den Pilz auf Malzagar mit niedrigem Malzanteil
12 Beitrag zur Kenntnis der weidenbewohnenden Venturiaceae 337 unter Zugabe von wässerigem Blattdekokt. Mit diesen Nährböden erzielten sie, und später auch Menon (1956), bei bestimmten Temperaturvariationen regelmäßig reife Ascosporen kompatibler Herkünfte von Venturia inaequalis. Daß Malzagar auch für weitere Venturia-Arten eine gute Grundlage der gene rativen Vermehrung bildet, läßt sich aus Untersuchungen mit verwandten Pilzen entnehmen. So erhielt Gremmfn (1956) ruchtkörper von Venturia macularis (r.) Müller et v. Arx in einer Malzagar enthaltenden Petrischale bei Temperaturen von 0 bis 5 C. Schweizer (1958 b) gelangte kulturen von Venturia cerasi Aderh. zu denselben Resultaten. Analoge Versuche wurden bei mit Rein den weidenbewohnenden Venturia-Arttn vor allem mit der Pollaccia saliciperda gemacht; sie verliefen jedoch meistens negativ (Clinton und McCormick 1929, Dennis 1931, von Arx 1957). In einem alle führten sie zur Bildung von Initialstadien (Kochmann 1929), und Anonymus (1931) erwähnt reife ruchtkörper aus Reinkulturen. Von Arx (1957) erhielt mit Ascosporen-Reinkulturen einer Venturia chlorospora Isola tion von cordata auf Hafermehlagar bei 24 C ohne Beleuchtung Hauptfruchtformen. Die Versuche von von Arx wurden überprüft und konn ten bestätigt werden. Die Isolationen von Venturia chlorospora, insbesondere von alba und cordata, bildeten auf Hafermehlagar unter gleichen Bedingungen reife Ascosporen. In unseren Versuchen konnte jedoch festge stellt werden, daß bei diffusem Licht und Zimmertemperatur die ruktifikationen rascher einsetzten und häufiger auftraten als bei 24 C ohne Beleuch tung. Gleichartig verhielten sich Venturia subcutanea und die zu Kontroll zwecken einbezogenen Venturia fraxini Aderh. und Venturia ditricha (r.) Karst. Die Perithezienbildung auf Malzagar war dagegen bei all diesen Pil zen spärlicher. Die Pollaccia saliciperda, wie auch Venturia microspora, Ven turia helvetica, Epipolaeum longisetosum bildeten bisher weder reife rucht körper noch Initialstadien. Weitere Versuche stützten sich auf die Erfahrun gen von Keitt und Langford (1941) mit Venturia inaequalis. Entsprechend veränderte Blattdekokt-Nährböden (vgl. S. 331) führten jedoch auch nicht zum Ziele: sie unterdrückten sogar bei den auf Hafermehlagar fruktifizierenden Pilzstämmen die Bildung von Hauptfruchtformen. Wilson (1928) zeigte, daß bei Venturia inaequalis eine hohe euchtig keit nicht nur für die Reifung der Perithezien im rühjahr, sondern auch für die Auslösung der Initialstadien im Herbst notwendig ist. Von Arx (1957) fand auf abgestorbenen Weidenblättern eine orm von Venturia chlorospora mit reifen Ascosporen im Herbst; diese frühzeitige Reifung weist darauf hin, daß bei der ruchtkörperbildung nicht so sehr die winterlichen Kälteperioden als vielmehr die euchtigkeitsbedingungen eine erhebliche Rolle spielen. Diese Beobachtungen gaben dazu Veranlassung, bei weiteren Untersuchun gen die euchtigkeitsverhältnisse besonders zu berücksichtigen. Kalt sterili sierte Weidenblätter in 5 ml Aq. dest. enthaltenden Reagenzröhrchen (vgl. S. 331) wurden mit Myzelstücken der verschiedenen Pilzstämme über der Was seroberfläche beimpft, anschließend bei Zimmertemperatur und im'reilande (April bis Mai) aufbewahrt und täglich geschüttelt, so daß die Blattoberfläche
13 Initialstadien, 338 NÜESCH dauernd benetzt blieb. Als Kontrolle dienten Anordnungen, bei welchen sich die Impfstelle am gleichen Ort oder unter der "Wasseroberfläche befand. In allen ällen entwickelten sich die Pilze gut. Nach drei bis vier Wochen hatten sich in den geschüttelten Röhrchen entweder reife ruchtkörper oder bei Pollaccia saliciperda sowohl bei Zimmertemperatur als auch im reiland, gebildet. Bei den Kontrollreihen dagegen zeigten sich nach meh reren Wochen noch keine Perithezien. Dieser Versuch bewies, daß der euch tigkeit die vermutete Bedeutung zukommt; sie muß sehr hoch sein, kann aber nicht einfach mit submersen Kulturen erreicht werden, wie der entsprechende Kontrollversuch zeigt. Da zur Zeit der Perithezienreife im rühjahr eine starke Taubildung vorherrscht, wurden myzeldurchwachsene Malzagarblöckchen zu dieser Jah reszeit auf ilterpapier unter Glasschalen direkt auf die Grasnarbe unter reilandbedingungen gelegt. Die Bodenfeuchtigkeit war während dieser Zeit so groß, daß die ilterpapiere ständig durchnäßt blieben und die Kulturen nicht austrockneten. Obwohl die Pilze unter nicht sterilen Bedingungen ge halten wurden, zeigten sich erstaunlich wenig Kontaminationen. Innerhalb zwei bis vier Wochen bildeten sämtlich Isolationen, einschließlich Pollaccia saliciperda, reife Ascosporen. Die Belichtungsverhält nisse spielten dabei nur eine unbedeutende Rolle. Mit fortschreitender Jahreszeit gegen Sommer, nimmt die Bodenfeuchtig keit ab, und die Temperaturen im reilande schwanken erheblich. Aber auch die Versuche in Gewächshauskabinen mit einstellbarer Luftfeuchtigkeit und -Temperatur (vgl. S. 332) führten zu brauchbaren Resultaten. Es zeigte sich, daß das Wachstums-Temperaturoptimum mit dem Temperaturoptimum zur Bildung der Hauptfruchtformen zusammenfällt. Diese Tatsache steht im Gegensatz zu verschiedenen analogen Versuchen (Lilly und Barnett 1951). Wie Testversuche mit weiteren Pilzen der Gattung Venturia und ver wandter Gattungen zeigten, scheint bei ihnen die Bildung der Hauptfrucht formen auf ähnlichen physiologischen aktoren zu beruhen, da auch diese Pilze unter gleichen Versuchsbedingungen reife Perithezien bildeten. Diese aus Reinkulturen gewonnenen ruchtkörper unterscheiden sich we der im Aufbau noch in der Größe wesentlich von den in der Natur vor kommenden. Die Sporenformen und Dimensionen blieben gänzlich gleich; in der Natur vorgefundene Unterschiede ließen sich bestätigen. Deshalb bezie hen sich die Messungen im systematischen Teile vor allem auf die unter glei chen Bedingungen erhaltenen Hauptfruchtformen. Dieses Vorgehen erlaubt, substratbedingte Variationen von vornherein auszuscheiden. 3. Infektionsversuche Schon Aderhold (1897) regte an, daß eine eindeutige Artumgrenzung der nahverwandten und morphologisch' wenig differenzierten Arten der Gat tung Venturia durch Infektionsversuche gestützt werden sollte. Gleichzeitig wies er jedoch auf die großen methodischen Schwierigkeiten bei dieser Pilz gruppe hin, die in der Erzielung eindeutiger, positiver Infektionen liegt. ür Venturia inaequalis wurden später Methoden entwickelt, die den natürlichen
14 Beitrag zur Kenntnis der weidenbewohnenden Venturiaceae 339 Infektionsbedingungen weitgehend entsprachen, so daß man ohne größere Schwierigkeiten positive Ergebnisse erzielte (Küthe 1935, Schmidt 1936, Nusbaum und Keitt 1938, Keitt und Langford 1941, Keitt et. al. 1943, Menon 1956). Schweizer (1958 a) führte mit den Erregern des Kirschenund Pfirsichschorfes ebenfalls erfolgreiche Infektionsversuche durch. Im Prin zip verwendeten alle Autoren dieselbe Anordnung. Die Blätter junger Ver suchspflanzen wurden mit einer Sporen-, seltener Myzelsuspension besprüht oder bestrichen und anschließend während zwei bis vier Tagen bei hoher euchtigkeit gehalten. Mit dem Erreger des Weidenschorfes, Pollaccia saliciperda, liegen nur wenige Infektionsversuche vor (Schwarz 1922, Clinton und McCormick 1929, Kochmann 1929, Anonym. 1931, Dennis 1931, Brooks und Walkfr 1935). Viele dieser Versuche führten zu negativen Ergebnissen (Schwarz 1922, Dennis 1931). Kochmann (1929), Brooks und Walker (1935) sowie Clinton und McCormick (1929) konnten auf den in der Natur beobach teten Wirten Infektionen erzielen. Bei diesen Untersuchungen handelte es sich nicht in erster Linie um eine Überprüfung des Wirtsspektrums, sondern vielmehr um ein eststellen des Parasitismus der Pollaccia, welcher von ver schiedenen Autoren angezweifelt wurde (Nattrass 1928, Dennis 1931). Aus ihren Versuchen schlössen sie, daß als primärer Parasit ein Imperfekt, Physalospora Miyabeana ukushi (wahrscheinlich eine Glomerclla cingulata-orm) anzusprechen sei. Tatsächlich verursacht dieser Parasit auf den Weidenblät tern Symptome, die makroskopisch kaum von denjenigen der Pollaccia zu unterscheiden sind (Butler und Jones 1949). Clinton und McCormick (1929), auch Brooks und Walker (1935) zeigten jedoch, daß beide Pilze als primäre Parasiten auftreten können. In den vorliegenden Untersuchungen wurden die Infektionen nach den auf S. 332) beschriebenen Methoden entweder im Gewächshaus oder im rei land durchgeführt. Die reilandinfektionen erwiesen sich günstiger als die unter Gewächshausbedingungen, da die Stecklinge in geschlossenen Räumen stark von der roten Spinne befallen wurden und den kräftigen Wuchs der reilandpflanzen nicht erreichten. Laborversuche mit abgetrennten, grünen Blättern in Petrischalen als euchtkammern (Schweizer 1958 a) erwiesen sich als ungünstig, da die Blätter meist vor dem Haften der Infektionen zu fau len begannen. Als Ausgangsmaterial dienten, sofern möglich, aus der Natur gesammelte Blätter mit reifen Konidien oder Ascosporen, um den natür lichen Verhältnissen möglichst zu entsprechen und um den durch Kultur auf künstlichen Nährböden auftretenden Pathogenitätsverlust zu vermeiden (Siebs 1952). Ausnahmsweise wurden aber Kulturen verwendet, die von Mehrsporisolierungen stammten. Es war nicht die Pathogenität einzelner Linien, sondern der Wirtskreis ganzer Arten zu prüfen. Bei der Befallsbonitierung wurde deshalb in erster Linie das Schadbild in qualitativer Hinsicht berücksichtigt. Die Resultate der Infektionsversuche sind in Tabelle 2 zusammenge stellt. Sie beziehen sich auf Gewächshaus- sowie reilandinfektionen. Das ver wendete Infektionsmaterial wurde jeweils entsprechend gekennzeichnet. Bei
15 340 NÜESCH den Myzelinfektionen bewährten sich Myzelklötzchen besser als Myzelsuspen sionen (vgl. auch Keitt et al. 1943). Im Gegensatz zu den Beobachtungen von Schweizer (1958 a) bei Kirschen- und Pfirsichbäumen waren auch In fektionen mit Myzel erfolgreich. Die Resultate der Infektionsversuche werden bei den einzelnen Arten im speziellen Teile besprochen. D. SYSTEMATIK Auf Grund von morphologischen Studien sowie Kultur- und Infektions versuchen lassen sich die in der vorliegenden Arbeit untersuchten Pilze in mehrere Arten trennen. Diese können ihrerseits in verwandte Gruppen, or menkreise (Gäumann 1951), zusammengefaßt werden, welche vor allem auf Merkmalen wie Lagerung der ruchtkörper im Wirtsgewebe, Borstenausbil dung, orm, arbe und Beschaffenheit der Ascosporen sowie der ausgebilde ten Nebenfruchtformen basieren. Innerhalb der ormenkreise werden die einzelnen Arten nach den Dimensionen ihrer Ascusfrüchte, insbesondere der Sporen, wie auch nach ihrem physiologischen und biologischen Verhalten geordnet. Neben den bereits 1. Gemeinsame Merkmale der untersuchten Arten erwähnten Übereinstimmungen im Myzel verhalten sich die einzelnen ormen auch bezüglich der Entstehung und des Aufbaus der ruchtkörper sehr ähnlich. Entwicklungsgang und Ascogenese verlaufen im wesentlichen wie bei Venturia inaequalis (Kiilian 1917, rey 1924, Wil son 1928, Keitt und Palmiter 1938, Backus und Keitt 1940). Die ver schiedenen Stadien von spiralig eingerollten Hyphen bis zu runden Stromata mit durchbrechenden Trichogynen lassen sich in den Reinkulturen studieren. Das mit Orcein (Day et al. 1956) rotbraun färbbare Ascogonium teilt sich mit fortschreitendem Alter und bildet im Innern des jungen ruchtkörpers basal eine Zellschicht, aus welcher ascogene Hyphen und anschließend Asci entstehen. Die erste Reduktionsteilung findet analog zu Venturia inaequalis erst statt, wenn der Ascus beinahe seine endgültige Größe erreicht hat. Die Chromosomen lassen sich im Pachytän der ersten Reduktionsteilung am besten untersuchen; in den meisten ällen konnten bei Venturia chlorospora n 5 Chromosomen gezählt werden. Sie sind mit Orcein färbbar. Die Orien = tierung der Teilungsspindel, wie auch die Sporenbildung über ein kurzes Ein zellstadium zum endgültigen zweizeiligen, entsprechen den Befunden von Backus und Keitt (1940), die Venturia inaequalis untersuchten. Bei Ven turia chlorospora vollziehen sich dagegen nach der Ascosporenbildung noch weitere mitotische Kernteilungen in beiden Zellen der Sporen. So wenig sich die geschlechtlichen Vorgänge bei den verschiedenen Arten unterscheiden, so einheitlich sind auch die Wände der ruchtkörper. Sie be stehen aus einigen Lagen von mehr oder weniger dunklen, polyedrischen, leicht gestreckten, derbwandigen Zellen. Der Scheitel ist meist papillenförmig, seltener zylinderisch verlängert (von Arx 1957) und zur Zeit der Sporen reife von einem rundlichen Porus durchbohrt. Die Mündungen sind von
16 ' Beitrag zur Kenntnis der weidenbewohnenden Venturiaceae 341 einheitlich dunklen, in orm und Größe jedoch variierenden, an den äußeren Wandzellen herauswachsenden Borsten besetzt. Aus den Wandzellen wachsen, analog den Chlamydosporen keimschlauchähnliche Hyphen. Sind die rucht körper gänzlich ins Substrat eingesenkt, wie es bei Agarkulturen teilweise der all ist, so bilden sich aus diesen gewöhnliche Hyphen. Ragen sie jedoch über die Substratoberfläche, so entstehen die charakteristischen, nie septierten, zugespitzten Borsten. Ihre Bildung erfolgt wahrscheinlich nur unter be stimmten euchtigkeitsbedingungen. Die Borsten können somit als verküm merte Hyphen gedeutet werden. stellen: Die untersuchten Arten lassen sich folgendermaßen schlüsselartig dar 1. ruchtkorper oberflächlich auf lebenden oder überwinterten Blattern, einem oberflächlichen Hyphengefledit aufsitzend, Konidienform fehlend, Asco sporen 11 bis 15 X 4 bis 6 fi Eptpolaeum longisetosum p ruchtkörper dem Blattgewebe mehr oder weniger eingesenkt, meist auf überwinternden Blättern 2 2. Parasitische Konidienform Pollaccia, vor allem auf kultivierten Weiden auf 2 tretend, Hauptfruchtform sehr selten Venturia sahciperda p. 349 Konidienform ustcladium oder unbekannt, Hauptfruchtform häufig, meist auf Weiden naturlicher Bestände 3 3. Ascosporen fein dornig skulptiert, 17 bis 24 X 6,5 bis 9 ft auf alpinen Spa lierweiden Venturia subcutanea p Ascosporen glatt: ormenkreis der Venturia chlorospora 4 4. Ascosporen 10 bis 13 X 3,5 bis 4,5 fi, ruchtkörper 60 bis 80 fi groß auf nigricans Sm. und cinerea L Venturia microspora p :' Ascosporen 12 bis 16,5 X 5,5 bis 6,5 fx, ruchtkörper 80 bis 150 /a. groß, auf sehr vielen Weidenarten Venturia chlorospora p Ascosporen 16 bis 21,5 X 6,5 bis 8 fi, ruchtkörper 80 bis 150 /x groß, auf helvetica Vill Venturia helvettca p. 346 Abb. 1. Ascosporen von a) Venturia chlorospora, b) Venturia microspora, c) Venturia subcutanea, d) Venturia helvettca, e) Venturia sahciperda, f) Epipolaeum longisetosum. Konidien von g) Venturia sahciperda, h) Venturia chlorospora. Vergr. 1000X
17 Myc. Rbh. Hedwigia Ann. Schema Stamm Stamm 342 NÜESCH 2. ormenkreis der Venturia chlorospora Die dunklen, kugeligen, oft etwas zusammengedrückten ruchtkörper sind mehr oder weniger tief in das Blattgewebe eingesenkt und stehen her denweise zusammen oder sind unregelmäßig über die Blätter zerstreut. An den von einem rundlichen Porus durchbrochenen Mündungen der ruchtkör per sitzen bis 120^ lange, dunkelbraune, gekrümmte, zugespitzte Borsten. Die bitunikaten Asci enthalten acht ellipsoidische, seltener oblonge, septierte Sporen von gelbgrüner, graugrüner bis bräunlicher arbe und glatter Sporenoberfläche. Soweit Konidien gebildet werden, gehören sie zur ormgattung usicladium Bon.; sie sind jedoch nur in Reinkulturen festgestellt oder fehlen überhaupt. Auf Grund der verschiedenen Sporengrößen (s. Tab. 1 und Abb. 1), des physiologischen und biologischen Verhaltens lassen sich in diesem ormen kreis drei Arten unterscheiden. Tabelle 1 A s c o s p o r e n m a ß e der Venturiaceae von Weidenarten gewonnen aus Reinkulturen auf Malzagar Pilzart Länge Sporenmaße in fx Längen/ Breiten- Index Breite Streu ungen der Längen Signifikanz der Mittelwerte und Streuungen (bezogen auf Venturia chlorospora) t(p=0,01) n = 100 (P = 0,01) n 100 Venturia chlorospora Venturia hehetica Venturia microspora Venturia saliciperda Venturia subcutanea 12,013,516,5 16,018,021, ,513,0 11,512,514,0 17,521,024,0 5,56,06,5 6,57,08,0 3,54,04,5 4,04,55,0 5,56,59,0 2,1 2,4 2,7 2,9 3,2 ±0,59 ± 1,28 ±0,65 ±0,69 ±3, a) Venturia chlorospora (Ces.) Karst. Myc. fenn. 2: 189 (1873) Synonyme: Sphaeria chlorospora Ces. Herb. myc. 2: 48 (1859). Sphaerella chlorospora (Ces.) Ces. et de Not. di Classif. p. 83 (1863). Sphaerella canescens Karst. enn. 2: 190 (1873). Venturia chlorospora (Ces.) Adern. 36: 82 (1897). Endostigme chlorospora (Ces.) Syd. Mycol. 21: 173 (1923). Konidienform: usicladium Bon. Wirtspflanzen: (des Typus) alba L., (weitere) appendiculata Vill. (selten), caesia Vill., caprea L., cordata Mühl., daphnoides Vill., elaeagnos Scop., elegantissima K. Koch (selten), glabra Scop., hastata L., herbacea L. (selten), Hulteni lod., pentandra L., purpurea L., reticulata L. (sehr selten), triandra L., viminalis L. Reinkulturen: Von alba L.: Stamm ETH Nr. 2821, Schneckeneule, ürstentum Liechtenstein, 13. 5, 1958; Stamm ETH Nr. 2822, 2823 und 2824, Tessinufer zwischen Bellinzona und Giubiasco, Kt. Tessin, ; ETH Nr. 2840, bei Bendern, ürstentum Liechtenstein, ; ETH Nr. 2842, Rheinufer
18 tr O n er B * w Infektion keine -= Blattflecke nur Infektion, gelungene = Konidienproduktion mit Infektion gelungene + Hauptfruchtformbildung mit Infektion gelungene = H Myzel mit Infektionen = M Konidien mit Infektionen = K Ascosporen mit Infektionen ~ A H H ,11 KM H H M A Schleich. foetida von longisetosum Epipolaeum A Sm. nigricans von microspora Venturia A L. purpurea K Vill. daphnoides A Mühl. cordata K A L. alba von chlorospora Venturia M K Mühl. cordata K L. babylonica K Koch elegantissima von saliciperda Venturia L. retusa Vill. daphnoides L. purpurea Scop. elaeagnos L. viminalis Vill. helvetica Vill. appendiculata Willd. Waldsteiniana L. foetida L. repens L. aurita L. cinerea lod. Hulteni L. caprea Vill. caesia Sm. nigricans L. triandra L. pentandra L. alba Mühl. cordata L. babylonica Koch K. elegantissima Wirtsarten Pilzarten Weidenarten von ormen Venturiaverschiedenen 2 Tabelle mit e h c su r e v ns o i t k e f n I
19 Stamm Stamm Stamm Stamm Stamm Stamm 344 NÜESCH bei Buchs, Kt. St. Gallen, ; ETH Nr. 2841, Tessinufer bei Osogna, Kt. Tessin, Von alba ssp. vitellina (L.) Arcang.: Stamm ETH Nr. 2827, Katzensee bei Zürich, Kt. Zürich, Von caesia Vill.: Stamm ETH Nr. M 543, La Punt, Kt. Graubünden, Von cordata Mühl.: Stamm ETH Nr. 2849, Hannoversch-Münden, Deutschland, , leg.. Botin. Von daphnoides Vill.: Stamm ETH Nr. 2828, Aiguilles (Hautes-Alpes), rank reich, ; ; 1959; ETH Nr. 2833, Aiguilles (Hautes-Alpes), rankreich, ETH Nr. 2846, Rheinufer bei Buchs, Kt. St. Gallen, ETH Nr. 2504, La Punt, Kt. Graubünden, Von elaeagnos Scop.: Stamm ETH Nr. 2845, Tessinufer bei Osogna, Kt. Tessin, ; ETH Nr. M 534, Gorge de Verdon, rankreich, Von hastata L.: Stamm ETH Nr. 2569, Val Tuors, Kt. Graubünden, Von purpurea L.: Stamm ETH Nr. 2834, Val Capriasca, Kt. Tessin, ; ETH Nr. 2847, Tessinufer bei Osogna, Kt. Tessin, ; Stamm ETH Nr. 2848, Bese-Ufer bei Digne, rankreich, Von sp.: (Ca^rea-Gruppe), Stamm ETH Nr. 2826, Hautes-Grives s. Vouvry, Kt. Wallis, , leg. R. Corbaz. Die dunklen, kugeligen, oft etwas niedergedrückten, 80 bis 150 n großen ruchtkörper (Abb. 2) der Ascusform reifen im rühjahr auf toten, überwin terten Weidenblättern. Sie stehen häufig herdenweise zusammen und sind dem Blattgewebe, vor allem blattoberseits, meist tief eingesenkt. Die rucht körperwand besteht aus wenigen Lagen von braunwandigen, eckigen, 5 bis 10 j«großen, länglichen Zellen. Die ruchtkörper durchbrechen die Epidermis mit einer papillen- oder schnabelförmigen, von einem rundlichen Porus durch bohrten Mündung. Diese ist mit einigen dunklen, derben, leicht gekrümmten, bis 100 p langen und 5 ß breiten Borsten besetzt. Die bi- parallelstehenden, tunikaten Asci messen 45 bis 70 X 10 bis 15 fi, sie sind gegen die Basis hin sackartig er weitert und sitzen mei stens mit einer kurzen, fußförmigen Verlänge- Abb. 2. Querschnitt durch einen ruchtkörper von rung einer zarten, Venturia Morospora. Vergr. etwa 330X kleinzelligen Basal schicht auf. Sie sind von fädigen Paraphysoiden umgeben. Die gelb- bis graugrün gefärbten, 12 bis 13,5 bis 16,5 X 5,5 bis 6 bis 6,5 fi großen, ellipsoidischen Sporen besitzen ein deutliches, glattes Epispor und sind in bzw. wenig über der Mitte septiert und bei der Querwand leicht eingeschnürt. Die in Kultur entstandene Nebenfruchtform (Abb. 3) konnte in der Na tur nicht beobachtet werden. Auf höckerigen, kurzen ortsätzen der durch
20 Beitrag zur Kenntnis der weidenbewohnenden Vcnturiaceae 345 ihre dunklere arbe sich von den Hyphen abhebenden Trägerzellen entstehen in unverzweigten Ketten längliche, an beiden Enden verjüngte, 20 bis 25 X 5 bis 8,u große, braune, meist einzellige Konidien. Diese Konidienform gehört die Gattung usicladium Bon. (Hughes 1953). Nach Beschreibungen und in Abbildungen von Huchfs (1953) und Schwfizer (1958 b) entspricht sie weitgehend dem usicladium carpophilum (Thüm.) Oudem., bei welchem die Konidien ebenfalls in unverzweigten Ketten auf kurzen ortsätzen der Conidiophoren entstehen. ishlr (1957) fand zu usicladium carpo philum die zugehörige Ascusform, die ebenfalls zu Venturia gehört. Dieser Befund führte zur Einordnung der Nebenfruchtform von Venturia chlorospora in die Gattung usicla dium, welche nun neben den ormen mit einzeln abschnürenden, auch solche mit in Ketten entstehenden Konidien einschließt. Diese gehören Abb. 3. «5/c/ad;Mm-Nebenrruchtform von i t- -ii i ii,- ebenfalls in den Entwicklungsgang VentHria Morospca auf Malzagar. von Venturia-Arren. Vcntuua chlo- Vergr. rospora weist eine große geogra etwa 350X Viele einhei phische Verbreitung und geringe Wirtsspezifität auf (Tab. 2). mische Weidenarten werden von ihr befallen, dagegen erheblich weniger kul tivierte ormen, auf welchen Pollaccia saliciperda parasitiert. So erwähnt Alcock (1924), daß Venturia chlorospora in England noch nicht gefunden wurde. Es gelang auch nicht, die Ascusform auf stark von Pollaccia saliciperda befallenen Weiden in Connecticut (USA) zu beobachten (Anonym. 1931). Deshalb lag die Vermutung nahe, daß es sich bei diesem Pilze um einen wenig spezifischen und ebensowenig pathogenen Organismus handelt. Die Ergebnisse der Infektionsversuche (Tab. 2) zeigen, daß Venturia chlorospora wohl verschiedene Weiden zu befallen vermag, und zwar sowohl von Ascosporen als auch von Konidien ausgehend. Es bildeten sich jedoch nur chlorotische, manchmal auch nekrotische Blattflecke, die sich aber nicht zu sporulierenden Läsionen entwickelten, sondern im Stadium von Subinfektionen verblieben (Gäumann 1951). Deshalb vermutete schon Aderhold (1897), der im rühjahr auf einheimischen Weiden häufig Hauptfruchtformen, jedoch nicht den Konidienpilz fand, daß die Ascosporen die ähigkeit besäßen, auf den Blättern Appressorien zu bilden, so die Vegetationsperiode zu über dauern und erst im Herbst auf den absterbenden Blättern weiterzuwachsen. Die Infektions Er nannte diese Appressorienkeimlinge verankerte Sporen". versuche bestätigen, daß Venturia chlorospora während der Vegetations periode vorwiegend saprophytisch auf den toten Blättern zu leben oder auf lebenden Blättern in orm von Stibinfektionen zu überdauern vermag. Ob Phvtopath Z Bd, 39, Heft 4 24
21 346 NÜESCH sie sich unter günstigen Bedingungen zu einem aggressiven Parasiten mit der usicladienform (Abb. 3) entwickeln kann, konnte nicht festgestellt werden. Venturia chlorospora besitzt ihr Temperaturoptimum, wie Venturia microspora, bei 24 C (Abb. 4). Die Myzelzuwachsrate in Hefeextraktnähr lösung II ist bei allen drei Arten des Venturia c&/oro5/?ora-ormenkreises gleich. Dagegen unterschei det sich Venturia chloro spora physiologisch von den beiden weiteren Arten ihres ormenkreises, Venturia mi crospora und Venturia helvetica, durch ihre ähigkeit, auf Hafermehlagar bei Zim mertemperatur ruchtkörper zu bilden. Innerhalb der wenig spezifischen Art lassen sich Rassen erkennen. So bilden alle cworospora-isolationen von alba von verschie U C 30 Abb. 4. Die Temperaturabhängigkeit des Myzelwachs tums von 1. Venturia saliciperda, 2. Venturia cblorospora denen Standorten schon nach ein bis zwei Wochen auf Hafermehlagar Haupt fruchtformen. Auffallend war ferner, daß alle Isolationen von daphnoides Vill. im Vergleich zu den übrigen Arten über längere Zeit Konidien des usicladium-typus in Kulturen bildeten. Außerdem verhielten sie sich im Infektionsversuch mehr wirtsspezifisch als die anderen ormen (Tab. 2). Konidienform: keine. Wirtspflanzen: helvetica Vill. b) Venturia belvetica nov. spec. Die dunklen, kugeligen, 80 bis 150 /a. großen ruchtkörper reifen im rühsommer auf toten, überwinterten Blättern. Blattoberseits sind sie dem Blattgewebe ziemlich tief eingewachsen und treten in rundlichen Herden auf. Auf der stark verfilzten Blattunterseite wachsen sie häufig ganz oberflächlich oder sind nur mit ihrer Basis in die Epidermis eingesenkt und liegen unregel mäßig zerstreut. Am Scheitel besitzen die ruchtkörper eine papillenförmige, seltener zylindrische, von einem rundlichen Porus durchbohrte Mündung, die von schwarzbraunen, bis 120,«langen, zugespitzten Borsten umgeben ist. Die ruchtkörperwand besteht aus wenigen Lagen von dunklen, derbwandigen, polyedrischen, leicht zusammengedrückten, 5 bis 15 /i großen Zellen. Die bitunikaten, 50 bis 75 X 14 bis 16,a großen, parallelstehenden, gegen die Basis sackartig erweiterten Asci, sitzen mit einer fußförmigen Verlängerung der zarten Basalschicht auf und sind von hyalinen, fädigen Paraphysoiden umgeben. Die 16 bis 18 bis 21,5 X 6,5 bis 7 bis 8 ju großen, ellipsoidischen, dunkel-graugrünen bis braunen Sporen (Abb. 1 und Tab. 1) sind meist in bzw. leicht über der Mitte septiert und bei der Querwand etwas eingeschnürt. Perithecia umbrina, globosa, 80150,«magnitudine principio aestatis ad maturitatem veniunt foliis emortuis per hiemem servatis, utraque parte
22 olivaceae Beitrag zur Kenntnis der weidenbewohnenden Venturiaceae 347 foliarum plus minusve immersa aut superficialia, gregatim aut dispersa. Perithecia apice ostiolo papilliforme, raro cylindraceo. Ostiolum circumdatum setis acutis, aterrimis, 120 fi longitudine. Paries peritheciorum paucis stratis cellularum umbrinarum, polyedricarum, leniter compressarum, 512 ß magnitudine compositus. Asci bitunicati, 5070 X 1416 /i magnitudine paralleli, base prolatione figura sacci et circumdati paraphysoidibus filiformibus, hyalinis. Sporae 1621,5 X 6,58 ß magnitudine, ellipsoideae, cinereo aut brunneae, in media aut supra mediam septatae et leniter constrictae. Hab. in foliis emortuis Salicis helveticae VilL, Albulapaß, Kt. Grau bünden, (= Reinkultur Stamm ETH Nr. 2571). Weitere Kollektionen: Aiguilles (Hautes-Alpes), rankreich, , leg, E. Mülj-er; Val Tuors, Kt. Graubünden, (= Stamm ETH Nr. 2587). Die auf helvetica gefundene orm unterscheidet sich von Venturia chlorospora nicht nur im natürlichen Vorkommen, sondern auch in Rein kultur (Tab. 1 und Abb. 1) eindeutig durch die größeren Sporen von grau grüner bis brauner arbe. Eine konstante Abweichung in der Sporengröße konnte nur bei den Isolationen von helvetica festgestellt werden. Phy siologisch verhält sich dagegen die Art zum Teil wie Venturia chlorospora, wie durch die ähnliche Myzelzuwachsrate in Hefeextraktnährlösung gezeigt werden konnte (Abb. 6). Ihr Temperaturoptimum liegt, der alpinen Her kunft entsprechend, niedriger, bei 18 bis 21 C. Ebenso bildet sie weder Hauptfruchtformen auf Hafermehlagar noch Nebenfruchtformen in allen geprüften Medien. Wahrscheinlich handelt es sich bei dieser Art um einen auf helvetica spezialisierten Pilz. Konidienform: keine. c) Venturia microspora nov. spec. Wirtspflanzen: nigricans Sm., cinerea L. Die dunklen, rundlichen, 60 bis 80 /t großen ruchtkörper reifen im Mai und Juni auf überwinterten Blättern. Sie stehen herdenweise, vorwiegend auf der Blattunterseite zusammen und sitzen basal in der Epidermis. Nährhyphen durchwuchern das Blattgewebe, wachsen aber teilweise auch gänzlich ober flächlich und bilden häufig eine subkutikuläre bis intraepidermale, stromatische Schicht. Die ruchtkörper besitzen eine papillenförmige bis zylindrische Mündung, die von derben, schwarzbraunen, stacheligen Borsten umgeben ist. Die ruchtkörperwand besteht aus einer oder wenigen Schichten von dunklen, 3 bis 5 ^ großen, polyedrischen, leicht gestreckten Zellen. Die bitunikaten, 25 bis 35 X 7 bis 9,u großen, keuligen oder unten sackartig erweiterten Asci stehen parallel zueinander und sind von hyalinen, fädigen Paraphysoiden umgeben. Sie sitzen mit einer fußförmigen Verlängerung einer zarten, klein zelligen Basalschicht auf. Die durchscheinenden, hellgrünen, oblongen oder breit spindelförmigen Sporen sind meist etwas über der Mitte septiert, an der Querwand leicht eingeschnürt und messen 10 bis 11,5 bis 13 X 3,5 bis 4 bis 4,5 p. Perithecia umbrina, globosa, 6080 /n magnitudine, fine veris ad maturitatum veniunt foliis emortuis per hiemem servatis, gregatim et base immersa. 24*
23 Aareaue Moudon, Val 348 Nüesch Hyphae in parenchymo luxuriantur aut superficiales et stromata formantes. Perithecia apice ostiolo papilliforme raro cylindraceo. Ostiolum circumdatum setis acutis, aterrimis. Paries pertheciorum paucis stratis cellularum umbrinarum, polyedricarum, leniter compressarum, 35 pi magnitudine compositus. Asci bitunicati, 2535 X 79 /i magnitudine, paralleli, base prolatione figura sacci et circumdati paraphysoidibus filiformibus, hyalinis. Sporae 1013 X 3,54,5 ß magnitudine, pallide virides, oblongae et plerumque supra mediam constrictae. Hab. in foliis emortuis Salicis nigricantis Sm., Aareaue bei Rubigen, Kt. Bern, (- Stamm ETH Nr. M 523). Weitere Kollektionen: nigricans Sm., Aiguilles (Hautes-Alpes), rankreich, ; Kt. Graubünden, Tuors, cinerea L., de Thümen, Mycotheca universalis (sub. Venturia cblorospora), Sach sen, Deutschland, Mai 1874, leg. G. Winter; Kt. Waadt, , leg. R. Corbaz; bei Rubigen, Kt. Bern, (= Stamm ETH Nr. M 525). Abb. 5. Querschnitt durch einen ruchtkörper von Venturia microspora. Vergr. etwa 500X C 30 Abb. 6. Temperaturabhängigkeit des Myzelwachstums von 1. Venturia helvetica, 2. Venturia microspora,?. Venturia subcutanea, 4. Epipolaeum longisetum Diese sehr kleine orm (Abb. 5) konnte vorwiegend im lachlande auf ni gricans und cinerea gefunden werden. In ihrem Temperaturanspruch und Myzelwachstum verhält sie sich wie Venturia cbloro spora (Abb. 6), unterscheidet sich außer den gesichert kleineren Sporenmaßen (Tab. 1) aber wiederum von ihr durch das ehlen einer Konidienform sowie der
24 All. T. Ann. Arb. Beitrag zur Kenntnis der weidenbewohnenden Venturiaceae 349 Bildung von Hauptfruchtformen auf Hafermehlagar. Infektionsversuche mit Ascosporen aus Reinkulturen auf ihrem Wirte nigricans (Tab. 2) verliefen negativ, obwohl gleichzeitig durchgeführte Kontrollversuche mit Konidien der Pollaccia-orm deutlich hafteten. Diese Kleinart scheint sich deshalb, wie auch Venturia helvetica, vorwiegend saprophytisch zu entwickeln. Innerhalb des ormenkreises der Venturia chlorospora zeigt sich eine deutliche Abnahme der Pathogenität vom fakultativen Parasiten bis zum spezialisierten Saprophyten. 3. ormenkreis der Venturia saliciperda Die im wesentlichen der Venturia chlorospora entsprechenden rucht körper enthalten achtsporige, bitunikate Asci mit hellgelbgrünen, durchschei nenden, kleinen, oblongen Sporen. Diese kommen in der Natur nur selten vor. Die den Weidenschorf verursachenden Konidienformen gehören Gattung Pollaccia Bald, et Cif. Konidienform: Pollaccia Bald, et Cif. Venturia saliciperda nov. spec. in die Bekannt als: Pollaccia saliciperda (All. et Tub.) v. Arx Pl.ziekten 63: 233 (1957). Septogloeum saliciperdum All et Tub. et Schnabl, ungi bavarici" No. 485 (1895). usicladium saliciperdum (All. et Tub.) Tub. Biol. Abt. Land- und orstw. Kaiserl. Gesundheitsamt 2: 568 (1902). usicladium saliciperdum (All. et Tub.) Lind Mycol. 3: 430 (1905). Wirtspflanzen: pentandra L., alba ssp. vitellina (L.) Arcang., babylonica L., cordata Mühl., elegantissima K. Koch. Die braunwandigen, rundlichen bis birnenförmigen, 80 bis 120 fi gro ßen ruchtkörper besitzen an ihrem Scheitel eine meist zylindrische, seltener kegel- oder papillenförmige Mündung, die mit einigen dunklen, derben, leicht gekrümmten Borsten besetzt ist. Die ruchtkörperwand besteht aus einer oder wenigen Schichten von braunen, polyedrischen, 4 bis 7 /t großen Zellen. Die zarten, bitunikaten Asci sind zur Basis hin etwas erweitert und sitzen mit einer fußförmigen Verlängerung einer hyalinen, feinzelligen Basalschicht auf. Sie stehen parallel, sind von fädigen, hyalinen Paraphysoiden umgeben und messen 35 bis 55 X 8 bis 12 ß. Die hellgelbgrünen, durchsichtigen, länglichen Sporen (Längen/Breiten-Index: 2,9; Venturia chlorospora: 2,1) (Abb. 1; Tab. 1) sind ein wenig oberhalb der Mitte septiert und an der Querwand leicht eingeschnürt. Sie messen 11,5 bis 12,5 bis 14 X 3,5 bis 4,5 bis 5 fi. Die olivgrünen Konidienlager bilden sich während der Vegetationspe riode auf grünen Blättern und Jungtrieben aus. Sie durchbrechen rasenartig, hauptsächlich auf den Leitbündeln, die Epidermis und töten das umliegende Gewebe durch Nekrosenbildung ab. Die Konidien entstehen akrogen auf braunen, dickwandigen, zylindrischen oder leicht kegelförmigen Trägerzellen, welche einem zarten, anfänglich subkutikulären, später epidermalen Stroma aufsitzen. Die bräunlich-grünen, länglichen, tonnenförmigen, meistens in der oberen Hälfte einmal, seltener auch zweimal septierten Konidien sind an
25 Kabät Katzensee. 12 Dielsdorf, 350 NUESCH den Querwänden geringfügig eingeschnürt, verjüngen sich zu beiden Enden hin und messen 16 bis 23 X 6 bis 9 ß. Die reifen Konidien werden von den Trägern abgeschnürt und durch neu entstehende verdrängt. Perithecia umbrina, globosa, ß magnitudine, in vitro invenienda solum. Perithecia apice ostiolo papilliforme. Ostiolum circundatum setis acutis, aterrimis. Paries peritheciorum paucis stratis cellularum umbrinarum, polyedricarum, leniter compressarum, 47 ß magnitudine compositus. Asci bitunicati, 35 X 55 X 8 ß magnitudine paralleli, base prola- tione figura sacci et circumdati paraphysoidibus filiformibus, hyalinis. Sporae 11,514 X 3,55 ß magnitudine, pallide virides, oblongae et plerumque supra mediam constrictae. Untersuchte Kollektionen (ausschließlich Konidienform): pentandra L.: Bayern, Tutzing am Starnberger See, Juli 1895, leg. v. Tubeuf (Typus von Septogloeum saliciperdum All. et Tub. ausgegeben in Alleschex et Schnabl: ungi bavarici, Nr. 485). Bastardformen verschiedener -Amn: bei Königstein (Sachsen), Juli 1901, leg. W. Krieger (ausgegeben in Kmeger: ungi saxonici, Nr. 2090); Tranzschei et SeribriaNikow: Mycotheca Rossica, N. 146 (sub. usicladtum saliciperdum [All. et Tub.] Lind), Prov. Charkow, distr. atesch, Rußland, Juni 1909, leg. A. PoTEBnia; et Bubäk, ungi imperfecti exsiccati, Nr. 642 (sub. usicladium saliciperdum [All. et Tub.] Lind), am Isreufer bei Turnau, Böhmen, , leg. J. E. Kabät; Petrak, Mycotheca generalis, Nr. 735 (sub. usicla dtum saliciperdum [All. et Tub.] Lind), Mähren, Sternberg, Juni 1926, leg. J. Piskor. alba ssp. vitellina (L.) Arcang., Rüti, Kt. Zürich, , leg. Wiesmawn; Dielsdorf, Kt. Zürich, , leg. Zobrist; Kt. Zürich, , leg. H. Zogg; bei Zürich, Kt. Zürich, (= Stamm ETH Nr. 2838). babylonica L., Katzensee bei Zürich, Kt. Zürich, cordata Mühl., Katzensee bei Zürich, Kt. Zürich, (= Stamm ETH Nr. 2836) (Typus). elegantissima K. Koch, Ackermannstraße, Zürich, (= Stamm ETH Nr. 2837). Rostrup (1883) stellte den weiden- und pappelbewohnenden Konidienpilz zu usicladium und nannte ihn usicladtum ramulosum (Desm.) Rostr., in der Annahme, daß es sich sowohl bei Pappeln als auch bei Weiden um die gleiche orm handle, welche Desmazieres (1852) als Cladosporium ramulo sum auf Populus alba (leg. Roberge) be schrieb. Aderhold (1897) trennte dann die beiden ormen, nannte die weidenbe wohnende usicla dium ramulosum Rostr., ohne in Be tracht zu ziehen, daß diese Bezeichnung zu- Abb. 7. Querschnitt durch ein Konidienlager von Venturia erst *ur die orm aur saltciperda. Vergr. etwa 500X Pappeln verwendet
26 Beitrag zur Kenntnis der weidenbewohnenden Venturiaceae 351 worden war. Die pappelbewohnende orm beschrieb er als usicladium tremulae Aderhold. Allescher und Schnabl (1895) gaben den Erreger des Weidenschorfes als Septogloeum saliciperdum All. et Tub. heraus. Von Tubeuf (1902) stellte diesen dann zu usicladium unter dem Namen usicla dium saliciperdum (All. et Tub.) Tub. Lind (1905) diskutierte die nomenklatorischen ragen dieses Pilzes, ließ jedoch die Publikation von von Tu beuf (1902) unberücksichtigt und bezeichnet daher die Konidienform des Weidenschorfes fälschlicherweise als usicladium saliciperdum (All. et Tub.) Lind. Von Arx (1957) reihte den Pilz nach Hughes (1953) in die Gattung Pollaccia Bald, et Cif. unter dem Namen Pollaccia saliciperda ein. Kochmann (1929), Clinton und McCormick (1929) und von Arx (1957) konnten aus Reinkulturen von Pollaccia saliciperda keine Haupt fruchtformen erhalten und deshalb die von Aderhold (1897) vermutete Zuge hörigkeit zu Venturia chlorospora nicht beweisen. Nach einer anderen Mittei lung wurden reife Ascusformen in Kultur erhalten, die sich jedoch von Ven turia chlorospora unterschieden (Anonym. 1931). Die Unterschiede in der Merkmalsausprägung, wie die angewandten Methoden zur Gewinnung von Hauptfruchtformen wurden allerdings nicht angegeben. Mit Hilfe der auf S. 332 beschriebenen Methoden gelang es erneut, die Hauptfruchtformen der Pollaccia saliciperda in Kultur zu erhalten. Sie unter scheiden sich sowohl in Sporengröße als auch in arbe und orm von den jenigen der Venturia chlorospora und bilden auch aus Ascosporen in Kultur die Po//dcck-Nebenfruchtform (Abb. 8). Es besteht also kein Zweifel mehr, daß Venturia saliciperda einen von Venturia chlorospora eindeutig zu unter scheidenden Pilz darstellt. Hinsichtlich seiner physiologischen Eigenschaften bestehen ebenfalls Unterschiede. Die in Abbildung 4 gegebenen Resultate der Temperaturversuche beziehen sich auf Mehrspor-Isolationen von Pollaccia saliciperda und Venturia chlorospora der gleichen Wirtspflanze. Die Temperaturoptima liegen deutlich getrennt zwischen 18 und 21 bzw. 24 C. Analog dazu divergieren auch die Myzelzuwachsraten. erner bildet Venturia salici perda auf Hafermehlagar keine Hauptfruchtform. Venturia saliciperda stellt einen primären, sehr aggressiven Parasiten mit einem verhältnismäßig engen Wirtsspektrum dar. Infektionsversuche, die der Klärung des Wirtskreises von Pollaccia saliciperda galten, führten Clinton und McCormick (1929) und Kochmann (1929) durch. Weitere Autoren befaßten sich mit den Befallsbildern der natür lichen Vorkommen, so von Tubeuf (1902), Schwarz (1922), Alcock (1924, 1926), Pape (1925), Brooks und Walker (1935), von Arx (1957). Als Hauptwirte werden von den Autoren kultivierte Weiden genannt, doch stößt man immer wieder auf Angaben, nach denen Pollaccia saliciperda auch auf weiteren Weidenarten festgestellt worden wäre. Eigene Beobachtungen in der Natur sowie Infektionsversuche (Tab. 2) zeigten jedoch, daß nur kultivierte Weiden, wie die Zierformen elegantissima, babylonica, alba ssp. vitellina, Bastarde der Trauerweiden mit alba und anderen Arten und die amerikanische Korbweide cordata befallen werden. Zwei syste matisch entfernte Gruppen, einerseits Arten der Untergattung Amerina Dum.,
27 352 NUESCH die durch geringe Bastardierung mit den übrigen Weiden gekennzeichnet sind, andererseits die amerikanische Weide, cordata, aus der Sektion Hastatae r., der Untergattung Caprisalix Dum. bilden den Wirtskreis. Auf fallend ist, daß die einheimische alba, der Hauptwirt von Venturia chlorospora, weder im reilande noch in den Infektionsversuchen durch Pol laccia saliciperda befallen wurde. In der Literatur wird alba auch als Wirt der Pollaccia saliciperda angeführt. Potebnia (1910) teilte mit, daß alba-besz'dnde in Mittelrußland von dem Pilz stark geschädigt wurden. Entsprechendes Herbarmaterial aus dem Staatsherbarium München konnte untersucht werden. Krankheitsbild und pathogener Organismus entsprachen Pollaccia saliciperda; dagegen war der Wirt keine alba, sondern eine ihrer Bastardformen mit einer anfälligen Weidenart aus derselben systema tischen Untergattung. Analoge eststellungen konnten bei weiterer Exsikkatdurchsicht gemacht werden. Diese Beobachtungen sowie die Infektionsver suche weisen darauf hin, daß die reine Spezies alba von Pol laccia saliciperda kaum befallen wird. Abb 8. /V/acaa-Nebenfruchtfonn Abb. 9. ruchtkörper von Venturia sahaauf Malzagar. Vergr. etwa 350X perda auf Malzagar Vcrgr etwa 250X Der Entwicklungsgang der Venturia saheipetda weicht von demjenigen der Venturia chlorospora ab. Während letztere in der Natur vorwiegend mit Hilfe ihrer Hauptfruchtform überwintert, ist bei Venturia saliciperda das Vorkommen der Hauptfruchtform auf Weiden bisher nicht bekannt (Ciimton und McCormick 1929, Anonym. 1931, von Arx 1957). Kochmann (1929) fand auf Pollaccia-befallenen Weiden ebenfalls Hauptfruchtformen, in Reinkulturen erhielt er aber Konidien, die seiner Beschreibung nach der usicladiumform angehörten, und daher Nebenfruchtformen von Venturia (hlorospora darstellten. Nach unseren Beobachtungen tritt Venturia chloro spora, wenn auch spärlich, auf den Wirten von Venturia saliciperda auf. Analog zu Pollaccia radiosa, der Konidienform von Venturia macularis, über wintert Venturia saliciperda in Myzelform (Gremmen 1956). Die stromatischen Konidienlager auf jungen Zweigen beginnen bei feuchter rühjahrs witterung zu sporulieren und übernehmen die unktion primärer Infektions-
28 Gizzihimmel, Albulapaß, 18. Schänzli, St. Altein, Col Pordoijoch, Report Welschtobel, Beitrag zur Kenntnis der weidenbewohnenden Venturiaceae 353 herde. So scheint im Entwicklungsgang der Venturia saliciperda die genera tive Vermehrung eine nur untergeordnete Rolle zu spielen. 4. ormenkreis der Venturia subcutanea Die schwarzbraunen, kugeligen ruchtkörper sind tief in das Blattgewebe eingelagert. An ihren die Epidermis durchbrechenden Mündungen sitzen schwarzbraune, schlanke, steif aufgerichtete, spitze Borsten. Die septierten Sporen sind langellipsoidisch, gelbbraun gefärbt und die Sporenoberfläche ist skulptiert. Nebenfruchtformen sind nicht bekannt. Venturia subcutanea Dearn. Mycologia 9: 347 (1917) Synonyme: Mycosphaerella minor var. reticulata Dearn. of the Canadian Arctic Expedition 1913 IV: Botany. Parr C: ungi p. 7 (1923). Konidienform: keine. Wirtspflanzen: (des Typus) reticulata L., (weitere) arctica auct., herbacea L., retusa L., serpyllifolia Scop. Die dunklen, kugeligen bis birnenförmigen 100 bis 170 ß großen rucht körper reifen im rühsommer auf überwinterten, toten Blättern. Sie sind dem Blattgewebe meist tief eingelagert und stehen herdenweise zusammen oder sind unregelmäßig über die Blätter zerstreut. An der die Epidermis durchbre chenden papillenförmigen bis zylindrischen Mündung sitzen schwarzbraune, schlanke, steif aufgerichtete bis 200 ju lange und 6 bis 8 /i dicke, spitze Borsten. Die ruchtkörperwand besteht aus einigen Lagen typisch dickwan diger, dunkelbrauner, polyedrischer, 8 bis 15 fi großer Zellen. Die bitunikaten, 50 bis 90 X 14 bis 17 ju großen, parallelstehenden, zur Basis hin ein wenig erweiterten Asci, sitzen mit einer fußförmigen Verlängerung einem zarten Hyphengeflecht auf und sind von hyalinen, fädigen Paraphysoiden umgeben. Die 17 bis 21,5 bis 24 X 5,5 bis 6,5 bis 9 /t großen, in oder meist etwas über der Mitte septierten und bei der Querwand leicht eingeschnürten, länglichellipsoidischen (mittlerer Längen/Breiten-Index: 3,2; Venturia chlorospora: 2,1) gelbbraunen, selten olivbraunen Sporen sind feindornig skulptiert und häufig von einer zarten, unbeständigen Schleimhaut umgeben. Typus: reticulata L., Kongengevik, N.-Alaska, Juni 1914, leg.. Johansen. Untersuchtes Material: Von herbacea L.: Lago bianco, Engadin, Kt. Graubünden, , leg. J. Braun; Kt. Graubünden, , leg. E. Müller; Albulapaß, Kt. Graubünden, (= Stamm ETH Nr. 2829). Von reticulata L.: Kraemerigrat, ürstenalp, Kt. Graubünden, , leg. A. Volkart: ürstenalp, Kt. Graubünden, , leg. A. Volkart; ürstenalp, Kt. Graubünden, , leg. A. Volkart; Bockmattli, Wäggithal, Kt. Schwyz, , leg. A. Volkart; Seiseralpe, Südtirol, , leg. E. Müller; Südtirol, , leg. E. Müller; Moritz, Corviglia, Kt. Graubünden, , leg. L. Weh meyer et E. Müller; dtzoard, Casse desserte, rankreich, , leg. E. Müller; Kt. Graubünden, , leg. E. Müller; Albulapaß, Kt. Graubünden, (= Stamm ETH Nr. M 527); Isla, Arosa, Kt. Graubünden, , leg. E. Müller. Auf retusa L.: Albulapaß, Kt. Graubünden, Auf serpyllifolia Scop.: Albulapaß,
29 354 NUESCH Ventuna subcutanea stellt eine Pilzform der alpinen und nordischen Spalierweiden dar. In den Alpen findet man diese vor allem auf reticulata (Müller 1957) und herbacea, weit seltener auf retma und serpyllifolia. In den nördlichen Gebieten Amerikas kommt sie außer auf reticulata auch auf einer nordischen Spalierweide, nämlich arctica auct. vor (Dearness 1917, 1923, Barr 1959). Da dem Boden anliegende alpine Pflanzen sehr stark der EinStrahlungswärme ausgesetzt sind, müssen auch ihre Parasiten die oft hohen Temperaturen überdauern. So wächst auch Venturia subcutanea als einzige der geprüften Arten noch bei 27 C und wird bei 33 C wohl im Wachstum gehemmt, wächst jedoch ohne Schädigung bei niederen Temperaturen weiter (Abb. 6). Abb 10. Querschnitt durch einen ruchtkorper von Venturia subcutanea Vergr. etwa 250X Das Myzel dieser orm zeigt manchmal helle, knollige, gemmenartige Bildungen und enthält häufig öltropfen. Venturia subcutanea bildet wie Ven turia chlorospora schon auf Malz- und Hafermehlagar, wenn auch spärlich, ruchtkörper. Konidienformen konnten weder in Kultur gewonnen noch in der Natur gefunden werden. Wahrscheinlich lebt sie analog zu Venturia helvetica und Venturia microspora vorwiegend saprophytisch. 5. ormenkreis der Epipolaeum longisetosum Die ruchtkörper sitzen einem auf der Blattoberfläche spinnwebeartig ausgebreiteten Hyphengeflecht auf. Sie tragen lange, stark gekrümmte, dunkle, zugespitzte Borsten. Die glatten, septierten, ellipsoidischen Sporen sind von graugrüner arbe. Nebenfruchtformen sind nicht bekannt.
30 Aiguilles Val Engl. Alp Acta Gen. Aiguilles Heutal, Cavia, zur Oberiberg, Val Straße Beitrag zur Kenntnis der weidenbewohnenden Venturiaceae 355 Synonyme: Epipolaeum longisetosum (Volk.) nov. comb. Venturia longisetosa Volk. bot. Jahrb. 47: 513 (1912). Raciborskiomyces polonicus Siemaszko Soc. Bot. Polon. 2: 270 (1925). Chaetyllis polonicus (Siemaszko) Clem. of ungi. 253 (1931). Konidienform: keine. Wirtspflanzen: appendiculata Vill., caprea L, joetida Schleich., Waldsteiniana Willd. Die kugeligen, manchmal etwas niedergedrückten, 50 bis 90 i* großen ruchtkörper sitzen einem spinnwebeartig über die Blattunterseite verteilten, aus braunen, septierten, verzweigten Hyphen bestehenden Polster auf und bilden mehr oder weniger ausgedehnte, rußige Überzüge auf lebenden und toten Blättern. Die papillenförmigen, von einem rundlichen Porus durch brochenen Mündungen der ruchtkörper sind von dunklen, derben, stark zurückgebogenen, bis 200 ß langen und 4 bis 6 n breiten Borsten besetzt. Die ruchtkörperwand besteht aus 1 bis 3 Lagen von braunen, eckigen, etwas länglichen 4 bis 9 fi großen Zellen. Die achtsporigen, parallelstehenden, bitunikaten, 35 bis 50 X 9 bis 13 jx großen Asci sind an der Basis etwas erweitert und sitzen einer zarten Basalschicht auf. Sie sind von fädigen Reifezeit manchmal fehlenden hyalinen Paraphysoiden umgeben. Die ellipsoidischen. glatten, in oder leicht über der Mitte septierten und bei der Querwand etwas eingeschnürten 11 bis 12,5 bis 15 X 4 bis 5 bis 6 /i großen Sporen sind grau grün gefärbt. Die obere Sporenzelle erwies sich in den meisten ällen als etwas breiter im Vergleich zur unteren. Untersuchtes Material: appendiculata Vill.: Seveler Berg, Kt. St. Gallen, ; Schwyz, ; Tuors, Kt. Graubünden, ; Graubünden, (= Stamm ETH Nr. M 548). Kt. Tuors, Kt. caprea L.: ürstenalp, Kt. Graubünden, , leg. A. Volkart; ober halb Leghetto, Nante, Kt. Tessin, , leg. A. Volkart; nach Nante, Airolo, Kt. Tessin, , leg. A. Volkart; ilisur, Kt. Graubünden, , leg. E.Müller; (Hautes-Alpes), rankreich, , leg. E. Müller (= Stamm ETH Nr. 2835). joetida Schleich.: Piz Alv, Bernina, Engadin, , leg. J. Braun (Typus); (Hautes-Alpes), rankreich, (= Stamm ETH Nr. 2830); Val Tuors, Kt. Graubünden, ; bei Berninahäuser, Engadin, Kt. Graubünden, ; d'il Chant, beim Val Tuors, Kt. Graubünden, Waldsteiniana Willd.: ürstenalp, Kt. Graubünden, , leg. A. Volkart; Hinterruck, Churfirsten, Kt. St. Gallen, , leg. E. Müller; Aiguilles (Hautes-Alpes), rankreich, Die Gattung Epipolaeum wurde von Theissen und Sydow (1918) auf gestellt und von Müller und v. Arx (Manuskript) neu umschrieben. Die von Volkart (1912) als Venturia longisetosa beschriebene Pilzart gehört wegen ihrer gänzlich oberflächlich gebildeten Perithezien in diese Gattung. Auf Grund der zu besprechenden Eigenschaften und Merkmale ist der von Siemaszko (1925) als Raciborskiomyces polonicus bezeichnete Pilz mit Epipo laeum longisetosum identisch.
31 356 Nuesch Epipolaeum longisctosum steht den Venturia-A.rt.en verwandtschaftlich sehr nahe. Der Pilz unterscheidet sich weder im Aufbau noch in der Bildung der Hauptfruchtformen wesentlich von ihnen. Die ruchtkörperbildung in Abb 11 Qvcrschniit durch einen ruchtkorpcr von Epipolaeum longisctosum Vergr. etwa 330X Reinkulturen kann ebenfalls mit den für die Ventnna-Arten geeigneten Me thoden induziert werden. Phvsiologisch verhält sich diese Art insofern ver schieden, als sie ein wesentlich tieferes Temperaturoptimuni von 15 bis 18 C, eine stärkere Empfindlichkeit gegen höhere Temperaturen und ein größeres Myzelwachstum aufweist im Vergleich zu den Venturia-Arten (Abb. 6). Auch biologisch lassen sich einige beachtenswerte Unterschiede erkennen. Epipolaeum longisetosum bildet seine ruchtkörper fast ausschließlich auf der Blattunter seite. Die Perithezien werden aber sowohl auf den toten überwinterten als M1 ^Pl auch auf den lebenden Blät tern gefunden. Vülkar r (1912) beschrieb den Pilz auf abgestorbenen Blättern alpiner Weiden, doch gelang es mit den Infektionsversuchen nachzuweisen, daß er auch während der Vegeta tionsperiode ruchtkörper auf den lebender Blättern zu bilden vermag (Tab. 2). Da mit konnte auch die mor phologisch gleiche, aber auf lebenden Weidenblättern in Polen von Siemaszko (1925) als Rascibor^kiomyces polo- Abb.12. ruchtkorper von Epipolaeum longisctosum "icus bezeichnete orm als auf einem grünen Vergr. Blatt von Waldsteiniana Epipolaeum longisetosum etwa 55X identifiziert weiden.
Studien über die Bestimmung des ätherischen Oeles in Arzneidrogen und Gewürzen
 Research Collection Doctoral Thesis Studien über die Bestimmung des ätherischen Oeles in Arzneidrogen und Gewürzen Author(s): Schenker, Ernst Publication Date: 1933 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-a-000110642
Research Collection Doctoral Thesis Studien über die Bestimmung des ätherischen Oeles in Arzneidrogen und Gewürzen Author(s): Schenker, Ernst Publication Date: 1933 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-a-000110642
Der Versuch im Bild. März 2008
 Der Versuch im Bild März 2008 Zaun aufstellen Ein Zaun stellt sicher, dass keine gentechnisch veränderten Pflanzen von Menschen oder Tieren verschleppt werden. Zudem wird der Versuch, welcher nur von eingewiesenen
Der Versuch im Bild März 2008 Zaun aufstellen Ein Zaun stellt sicher, dass keine gentechnisch veränderten Pflanzen von Menschen oder Tieren verschleppt werden. Zudem wird der Versuch, welcher nur von eingewiesenen
Vortrag Katja Ehlert, JKI-Fachinstitut für Pflanzenschutz in Obst- und Weinbau, Dossenheim
 Vortrag Katja Ehlert, JKI-Fachinstitut für Pflanzenschutz in Obst- und Weinbau, Dossenheim Epidemiologische Untersuchungen zum Apfelschorf (Venturia inaequalis) und die biologische Validierung einer neuen
Vortrag Katja Ehlert, JKI-Fachinstitut für Pflanzenschutz in Obst- und Weinbau, Dossenheim Epidemiologische Untersuchungen zum Apfelschorf (Venturia inaequalis) und die biologische Validierung einer neuen
7 Ergebnisse der Untersuchungen zur Sprungfreudigkeit der Rammler beim Absamen und zu den spermatologischen Parametern
 Ergebnisse 89 7 Ergebnisse der Untersuchungen zur Sprungfreudigkeit der Rammler beim Absamen und zu den spermatologischen Parametern 7.1 Einfluß des Lichtregimes 7.1.1 Verhalten der Rammler beim Absamen
Ergebnisse 89 7 Ergebnisse der Untersuchungen zur Sprungfreudigkeit der Rammler beim Absamen und zu den spermatologischen Parametern 7.1 Einfluß des Lichtregimes 7.1.1 Verhalten der Rammler beim Absamen
Neues Triebsterben an Buxus - nun auch in Mecklenburg-Vorpommern -
 Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Pflanzenschutzdienst Neues Triebsterben an Buxus - nun auch in Mecklenburg-Vorpommern - Erreger/ Historie Symptome Biologie Vorbeugung/
Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Pflanzenschutzdienst Neues Triebsterben an Buxus - nun auch in Mecklenburg-Vorpommern - Erreger/ Historie Symptome Biologie Vorbeugung/
Bei näherer Betrachtung des Diagramms Nr. 3 fällt folgendes auf:
 18 3 Ergebnisse In diesem Kapitel werden nun zunächst die Ergebnisse der Korrelationen dargelegt und anschließend die Bedingungen der Gruppenbildung sowie die Ergebnisse der weiteren Analysen. 3.1 Ergebnisse
18 3 Ergebnisse In diesem Kapitel werden nun zunächst die Ergebnisse der Korrelationen dargelegt und anschließend die Bedingungen der Gruppenbildung sowie die Ergebnisse der weiteren Analysen. 3.1 Ergebnisse
Abb. 2: Mögliches Schülermodell
 Einzeller Ein Unterrichtskonzept von Dirk Krüger und Anke Seegers Jahrgang Klasse 7 / 8 Zeitumfang Unterrichtsreihe Fachinhalt Kompetenzen MK Methoden Materialien 90 Minuten Tiergruppe der Einzeller (Bauplan
Einzeller Ein Unterrichtskonzept von Dirk Krüger und Anke Seegers Jahrgang Klasse 7 / 8 Zeitumfang Unterrichtsreihe Fachinhalt Kompetenzen MK Methoden Materialien 90 Minuten Tiergruppe der Einzeller (Bauplan
Blattflecken im Mais. durch Pilzinfektionen
 Blattflecken im Mais durch Pilzinfektionen Blattflecken im Mais durch Pilzinfektionen Blattflecken im Mais treten in Deutschland selten ertragsmindernd auf. Ein reifendes Blatt kann von vielen Krankheiten
Blattflecken im Mais durch Pilzinfektionen Blattflecken im Mais durch Pilzinfektionen Blattflecken im Mais treten in Deutschland selten ertragsmindernd auf. Ein reifendes Blatt kann von vielen Krankheiten
DIAGNOSTIK UND MONITORING VON SCHADERREGERN UND ERKRANKUNGEN AN HEIDELBEERE DI BARBARA FRIEDRICH, HBLA UND BA KLOSTERNEUBURG
 DIAGNOSTIK UND MONITORING VON SCHADERREGERN UND ERKRANKUNGEN AN HEIDELBEERE DI BARBARA FRIEDRICH, HBLA UND BA KLOSTERNEUBURG --- 1 --- DIAGNOSTIK Die gezielte Abfolge verschiedener Untersuchungen mit dem
DIAGNOSTIK UND MONITORING VON SCHADERREGERN UND ERKRANKUNGEN AN HEIDELBEERE DI BARBARA FRIEDRICH, HBLA UND BA KLOSTERNEUBURG --- 1 --- DIAGNOSTIK Die gezielte Abfolge verschiedener Untersuchungen mit dem
1 Einleitung... 1. 2 Material und Methoden... 11. Inhaltsverzeichnis. 1.1 Venturia inaequalis... 3. 1.1.1 Die Biologie des Erregers...
 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 1 1.1 Venturia inaequalis... 3 1.1.1 Die Biologie des Erregers... 3 1.1.2 Symptome... 4 1.1.3 In vitro-testsysteme für das Pathosystem Malus/V. inaequalis... 6 1.2 Die
Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung... 1 1.1 Venturia inaequalis... 3 1.1.1 Die Biologie des Erregers... 3 1.1.2 Symptome... 4 1.1.3 In vitro-testsysteme für das Pathosystem Malus/V. inaequalis... 6 1.2 Die
ANGEBRANNTES HOLZ Statt der Verwendung eines Trennmittels wird die Holzoberfläche angebrannt.
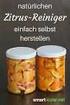 ANGEBRANNTES HOLZ Statt der Verwendung eines Trennmittels wird die Holzoberfläche angebrannt. Das Holz wird mit Bunsenbrenner leicht angebrannt. Nur mit minimaler verbrannter Schicht auf der Oberfläche.
ANGEBRANNTES HOLZ Statt der Verwendung eines Trennmittels wird die Holzoberfläche angebrannt. Das Holz wird mit Bunsenbrenner leicht angebrannt. Nur mit minimaler verbrannter Schicht auf der Oberfläche.
Erkältung im Anmarsch?
 Erkältung im Anmarsch? Jetzt müssen Sie nicht mehr tatenlos zusehen! Kriegt die Erkältung bevor Du sie kriegst. Basierend auf pflanzlichen Inhaltsstoffen Erkältung immer zum falschen Zeitpunkt Erkältungen
Erkältung im Anmarsch? Jetzt müssen Sie nicht mehr tatenlos zusehen! Kriegt die Erkältung bevor Du sie kriegst. Basierend auf pflanzlichen Inhaltsstoffen Erkältung immer zum falschen Zeitpunkt Erkältungen
D-(+)-Biotin (Vitamin H)
 D-(+)-Biotin (Vitamin H) Benedikt Jacobi 28. Januar 2005 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 1.1 Aufgabenstellung: Prüfung der Stabilität von Biotin (Vitamin H) unter alltäglichen Bedingungen (Kochen,
D-(+)-Biotin (Vitamin H) Benedikt Jacobi 28. Januar 2005 1 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 1.1 Aufgabenstellung: Prüfung der Stabilität von Biotin (Vitamin H) unter alltäglichen Bedingungen (Kochen,
Mykologische Bemerkungen
 1 Mykologische Bemerkungen Von F. Petrak (Wien) 131. C e nang ium as t e r in o sp o r um E. et E. in Bull. Torr. Bot. Club X. p. 76 (1883). Diesen Pilz hat Saccardo in Syll. Pung. VIII. p. 766 (1889)
1 Mykologische Bemerkungen Von F. Petrak (Wien) 131. C e nang ium as t e r in o sp o r um E. et E. in Bull. Torr. Bot. Club X. p. 76 (1883). Diesen Pilz hat Saccardo in Syll. Pung. VIII. p. 766 (1889)
Eine Sandwüste malen. Arbeitsschritte
 Dies ist eine Anleitung der Künstlerin und Autorin Efyriel von Tierstein (kurz: EvT) Die Anleitung ist nur für den privaten Gebrauch gedacht und EvT übernimmt keine Garantien dafür, dass eine Arbeit nach
Dies ist eine Anleitung der Künstlerin und Autorin Efyriel von Tierstein (kurz: EvT) Die Anleitung ist nur für den privaten Gebrauch gedacht und EvT übernimmt keine Garantien dafür, dass eine Arbeit nach
Bildtafeln zur Bestimmung von Weidenarten
 Bildtafeln zur Bestimmung von Weidenarten zusammengestellt von Dr. Karl Gebhardt, Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, Abt. Waldgenressourcen, Hann. Münden Bildnachweis: Bilder aus Kurt Stüber's
Bildtafeln zur Bestimmung von Weidenarten zusammengestellt von Dr. Karl Gebhardt, Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, Abt. Waldgenressourcen, Hann. Münden Bildnachweis: Bilder aus Kurt Stüber's
VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS PCT
 VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS PCT INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT (Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT) Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts Anmelder
VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS PCT INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT (Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT) Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts Anmelder
Praktikum Physik. Protokoll zum Versuch: Oberflächenspannung. Durchgeführt am Gruppe X
 Praktikum Physik Protokoll zum Versuch: Oberflächenspannung Durchgeführt am 02.02.2012 Gruppe X Name 1 und Name 2 (abc.xyz@uni-ulm.de) (abc.xyz@uni-ulm.de) Betreuer: Wir bestätigen hiermit, dass wir das
Praktikum Physik Protokoll zum Versuch: Oberflächenspannung Durchgeführt am 02.02.2012 Gruppe X Name 1 und Name 2 (abc.xyz@uni-ulm.de) (abc.xyz@uni-ulm.de) Betreuer: Wir bestätigen hiermit, dass wir das
Die Wirkung der Verteidigungsmechanismen von Daphnia atkinsoni gegenüber Triops cancriformis
 Die Wirkung der Verteidigungsmechanismen von Daphnia atkinsoni gegenüber Triops cancriformis Einleitung Bericht zum Praktikum Räuber-Beute-Interaktionen an der Ludwig-Maximilians-Universität München SS
Die Wirkung der Verteidigungsmechanismen von Daphnia atkinsoni gegenüber Triops cancriformis Einleitung Bericht zum Praktikum Räuber-Beute-Interaktionen an der Ludwig-Maximilians-Universität München SS
Saugschuppen. Station: Saugschuppen mikroskopieren. Klassenstufe: 8. Klasse (Sek I) Benötigte Zeit: 30 Minuten
 Station: Saugschuppen mikroskopieren Klassenstufe: 8. Klasse (Sek I) Benötigte Zeit: 30 Minuten Überblick: Die Schüler/innen sollen Abdrücke von den Blattoberflächen nehmen und durch das Mikroskopieren
Station: Saugschuppen mikroskopieren Klassenstufe: 8. Klasse (Sek I) Benötigte Zeit: 30 Minuten Überblick: Die Schüler/innen sollen Abdrücke von den Blattoberflächen nehmen und durch das Mikroskopieren
Zoologische Staatssammlung München;download: http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at SPIXIANA
 SPIXIANA Abb. 1: Strombus k. kleckhamae Cernohorsky, 1971, dorsal und ventral 320 Abb. 2: Strombus k. boholensis n. subsp., Typus, dorsal und ventral Gehäusefärbung: Die ersten 3-^ "Windungen sind bräunlich
SPIXIANA Abb. 1: Strombus k. kleckhamae Cernohorsky, 1971, dorsal und ventral 320 Abb. 2: Strombus k. boholensis n. subsp., Typus, dorsal und ventral Gehäusefärbung: Die ersten 3-^ "Windungen sind bräunlich
3.Ergebnisse Ausschluß des Einflusses der Therapiedauer auf die Messergebnisse
 3.Ergebnisse 3.1. Ausschluß des Einflusses der Therapiedauer auf die Messergebnisse Die Einteilung der Patienten erfolgte in verschiedene Gruppen wie bereits beschrieben. Der Vergleich des Herzfrequenzverhaltens
3.Ergebnisse 3.1. Ausschluß des Einflusses der Therapiedauer auf die Messergebnisse Die Einteilung der Patienten erfolgte in verschiedene Gruppen wie bereits beschrieben. Der Vergleich des Herzfrequenzverhaltens
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt: Sonnenblume - Fächerübergreifend einsetzbar!
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Sonnenblume - Fächerübergreifend einsetzbar! Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Lernwerkstatt
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Lernwerkstatt: Sonnenblume - Fächerübergreifend einsetzbar! Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de Titel: Lernwerkstatt
Gruppenstruktur und Gruppenbild
 Prom. Nr. 2155 Gruppenstruktur und Gruppenbild VON DER EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE IN ZÜRICH ZUR ERLANGUNG DER WÜRDE EINES DOKTORS DER MATHEMATIK GENEHMIGTE PROMOTIONSARBEIT VORGELEGT VON Hans
Prom. Nr. 2155 Gruppenstruktur und Gruppenbild VON DER EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE IN ZÜRICH ZUR ERLANGUNG DER WÜRDE EINES DOKTORS DER MATHEMATIK GENEHMIGTE PROMOTIONSARBEIT VORGELEGT VON Hans
Research Collection. Backward stochastic differential equations with super-quadratic growth. Doctoral Thesis. ETH Library. Author(s): Bao, Xiaobo
 Research Collection Doctoral Thesis Backward stochastic differential equations with super-quadratic growth Author(s): Bao, Xiaobo Publication Date: 2009 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-a-005955736
Research Collection Doctoral Thesis Backward stochastic differential equations with super-quadratic growth Author(s): Bao, Xiaobo Publication Date: 2009 Permanent Link: https://doi.org/10.3929/ethz-a-005955736
Schleswig-Holstein 2008 Leistungskurs Biologie Thema: Entwicklung und Veränderung lebender Systeme. Zur Evolution einer giftigen Form des Weißklees
 Schleswig-Holstein 008 Zur Evolution einer giftigen Form des Weißklees ) Definieren Sie die Begriffe Art, Rasse und Population und diskutieren Sie, inwieweit es sich bei dem ungiftigen und dem Blausäure
Schleswig-Holstein 008 Zur Evolution einer giftigen Form des Weißklees ) Definieren Sie die Begriffe Art, Rasse und Population und diskutieren Sie, inwieweit es sich bei dem ungiftigen und dem Blausäure
Technischer Milchsäurebakterien -Test 2012
 Technischer Milchsäurebakterien -Test 2012 Der vorliegende Test beinhaltet die technische Prüfung von Milchsäurebakterien-Starterkulturen für den biologischen Säureabbau. Dabei soll nicht das beste Präparat
Technischer Milchsäurebakterien -Test 2012 Der vorliegende Test beinhaltet die technische Prüfung von Milchsäurebakterien-Starterkulturen für den biologischen Säureabbau. Dabei soll nicht das beste Präparat
Physikalisches Grundpraktikum Technische Universität Chemnitz
 Physikalisches Grundpraktikum Technische Universität Chemnitz Protokoll «A10 - AVOGADRO-Konstante» Martin Wolf Betreuer: Herr Decker Mitarbeiter: Martin Helfrich Datum:
Physikalisches Grundpraktikum Technische Universität Chemnitz Protokoll «A10 - AVOGADRO-Konstante» Martin Wolf Betreuer: Herr Decker Mitarbeiter: Martin Helfrich Datum:
Laubbäume
 Laubbäume http://www.faz-mattenhof.de/ausbildung/ueberbetriebliche-ausbildung/unterlagen Stand: 06-11-12 Knospen gelbgrün, kreuzgegenständig Seitenknospen abstehend glatte Rinde Knospen klein, spitz, graubraun
Laubbäume http://www.faz-mattenhof.de/ausbildung/ueberbetriebliche-ausbildung/unterlagen Stand: 06-11-12 Knospen gelbgrün, kreuzgegenständig Seitenknospen abstehend glatte Rinde Knospen klein, spitz, graubraun
Gibt es in Deutschland nur noch zu warme Monate?
 Gibt es in Deutschland nur noch zu warme Monate? Rolf Ullrich 1), Jörg Rapp 2) und Tobias Fuchs 1) 1) Deutscher Wetterdienst, Abteilung Klima und Umwelt, D-63004 Offenbach am Main 2) J.W.Goethe-Universität,
Gibt es in Deutschland nur noch zu warme Monate? Rolf Ullrich 1), Jörg Rapp 2) und Tobias Fuchs 1) 1) Deutscher Wetterdienst, Abteilung Klima und Umwelt, D-63004 Offenbach am Main 2) J.W.Goethe-Universität,
Tab. 4.1: Altersverteilung der Gesamtstichprobe BASG SASG BAS SAS UDS SCH AVP Mittelwert Median Standardabweichung 44,36 43,00 11,84
 Im weiteren wird gemäß den allgemeinen statistischen Regeln zufolge bei Vorliegen von p=,5 und
Im weiteren wird gemäß den allgemeinen statistischen Regeln zufolge bei Vorliegen von p=,5 und
Protokoll. Das Geheimnis der grünen Blätter
 Aufgabenstellung: Zeige den Unterschied Gärung-Atmung o Erlenmeyer-Kolben o Feuchte Papierschnitzel o Erbsen o Hefesuspension o Pfropfen mit verschließbaren gebogenen Glasröhrchen o Wasser Durchführung:
Aufgabenstellung: Zeige den Unterschied Gärung-Atmung o Erlenmeyer-Kolben o Feuchte Papierschnitzel o Erbsen o Hefesuspension o Pfropfen mit verschließbaren gebogenen Glasröhrchen o Wasser Durchführung:
2 Die Niederschlagsverteilung für Deutschland im Jahr 2004 - Überblick
 2 Die Niederschlagsverteilung für Deutschland im Jahr 2004 - Überblick Das Hauptziel dieser Arbeit ist einen hochaufgelösten Niederschlagsdatensatz für Deutschland, getrennt nach konvektivem und stratiformem
2 Die Niederschlagsverteilung für Deutschland im Jahr 2004 - Überblick Das Hauptziel dieser Arbeit ist einen hochaufgelösten Niederschlagsdatensatz für Deutschland, getrennt nach konvektivem und stratiformem
Wie vermehren sich Pilze?
 Wie vermehren sich Pilze? 31. Woche Pilze sind geheimnisvoll. Manche schaffen es, über Nacht zu wachsen Sie vermehren sich durch Sporen. Sporen sieht man nur ganz selten, aber du kannst sie sichtbar machen.
Wie vermehren sich Pilze? 31. Woche Pilze sind geheimnisvoll. Manche schaffen es, über Nacht zu wachsen Sie vermehren sich durch Sporen. Sporen sieht man nur ganz selten, aber du kannst sie sichtbar machen.
Die Alpakaherde vom Zoo Zürich
 Die Alpakaherde vom Zoo Zürich Schweizer Jugend forscht - Verhaltensbiologie Projekt im Zoo Zürich 10. - 15. November 2013, Zürich Verfasser: Lisa Maahsen, Kantonsschule Wil Marlene Schmid, Kantonsschule
Die Alpakaherde vom Zoo Zürich Schweizer Jugend forscht - Verhaltensbiologie Projekt im Zoo Zürich 10. - 15. November 2013, Zürich Verfasser: Lisa Maahsen, Kantonsschule Wil Marlene Schmid, Kantonsschule
Versuch: In der Natur verschwindet nichts - Lösen und Auskristallisieren von Salz
 Name: Datum: Versuch: In der Natur verschwindet nichts - Lösen und Auskristallisieren von Salz Material: Kochsalz (NaCl), Leitungswasser, Mineralwasser, Becherglas, Spatel, destilliertes Wasser, Alu-Teelichtschalen,
Name: Datum: Versuch: In der Natur verschwindet nichts - Lösen und Auskristallisieren von Salz Material: Kochsalz (NaCl), Leitungswasser, Mineralwasser, Becherglas, Spatel, destilliertes Wasser, Alu-Teelichtschalen,
Das Foucaultsche Pendel
 Das Foucaultsche Pendel Inhaltsverzeichnis 1. Vorwort 2. Einleitung 3. Material und Methoden 4. Resultate 5. Diskussion 6. Schlusswort 7. Literaturliste Vorwort Wir beschäftigen uns mit dem Foucaultschen
Das Foucaultsche Pendel Inhaltsverzeichnis 1. Vorwort 2. Einleitung 3. Material und Methoden 4. Resultate 5. Diskussion 6. Schlusswort 7. Literaturliste Vorwort Wir beschäftigen uns mit dem Foucaultschen
MORPHOLOGISCHE VARIATIONEN DER WAAGRECHTEN WAND DES LÄNGSPARENCHYMS IM HOLZ VON TAXODIUM ASCENDENS BRONGN M. KEDVES
 161 MORPHOLOGISCHE VARIATIONEN DER WAAGRECHTEN WAND DES LÄNGSPARENCHYMS IM HOLZ VON TAXODIUM ASCENDENS BRONGN M. KEDVES Botanisches Institut der Universität, Szeged (Eingegangen: 15. April, 1959).. Einleitung
161 MORPHOLOGISCHE VARIATIONEN DER WAAGRECHTEN WAND DES LÄNGSPARENCHYMS IM HOLZ VON TAXODIUM ASCENDENS BRONGN M. KEDVES Botanisches Institut der Universität, Szeged (Eingegangen: 15. April, 1959).. Einleitung
Die Haut: Bau, Bedeutung und Funktion der Haut. Die Haut Haut und Strahlung, Hautkrebs (Lernzirkel : Teil 2) Haut
 Versuchsanleitung Die Haut: Bau, Bedeutung und Funktion der Haut Die Haut Haut und Strahlung, Hautkrebs (Lernzirkel : Teil 2) Klassenstufe Oberthemen Unterthemen Anforderungsniveau Durchführungsniveau
Versuchsanleitung Die Haut: Bau, Bedeutung und Funktion der Haut Die Haut Haut und Strahlung, Hautkrebs (Lernzirkel : Teil 2) Klassenstufe Oberthemen Unterthemen Anforderungsniveau Durchführungsniveau
Statistische Randnotizen
 Landkreis /Weser Februar 08 Stabsstelle Regionalentwicklung Az.: 12.01.20 Statistische Randnotizen Geburtenziffern im Landkreis /Weser und den anderen Kreisen im Bezirk Hannover Einleitung Kenntnis über
Landkreis /Weser Februar 08 Stabsstelle Regionalentwicklung Az.: 12.01.20 Statistische Randnotizen Geburtenziffern im Landkreis /Weser und den anderen Kreisen im Bezirk Hannover Einleitung Kenntnis über
Elastizität und Torsion
 INSTITUT FÜR ANGEWANDTE PHYSIK Physikalisches Praktikum für Studierende der Ingenieurswissenschaften Universität Hamburg, Jungiusstraße 11 Elastizität und Torsion 1 Einleitung Ein Flachstab, der an den
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE PHYSIK Physikalisches Praktikum für Studierende der Ingenieurswissenschaften Universität Hamburg, Jungiusstraße 11 Elastizität und Torsion 1 Einleitung Ein Flachstab, der an den
Der Januar-Effekt in der Schweiz
 Der Januar-Effekt in der Schweiz Bachelorarbeit in Banking & Finance Universität Zürich Institut für Banking & Finance Prof. Dr. Alexander F. Wagner vorgelegt von: Daniel Brändli Ort, Abgabedatum: Zürich,
Der Januar-Effekt in der Schweiz Bachelorarbeit in Banking & Finance Universität Zürich Institut für Banking & Finance Prof. Dr. Alexander F. Wagner vorgelegt von: Daniel Brändli Ort, Abgabedatum: Zürich,
Der Regenwurm. Der Gärtner liebt den Regenwurm, denn überall wo dieser wohnt, wachsen Blumen, Sträucher und Bäume wunderbar.
 Der Gärtner liebt den Regenwurm, denn überall wo dieser wohnt, wachsen Blumen, Sträucher und Bäume wunderbar. - Auf der gesamten Welt gibt es ca. 320 verschiedene Regenwurmarten. 39 Arten leben in Europa.
Der Gärtner liebt den Regenwurm, denn überall wo dieser wohnt, wachsen Blumen, Sträucher und Bäume wunderbar. - Auf der gesamten Welt gibt es ca. 320 verschiedene Regenwurmarten. 39 Arten leben in Europa.
Standardisierte Vorgehensweisen und Regeln zur Gewährleistung von: Eindeutigkeit Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden sind nur dann zwingend
 Standardisierte Vorgehensweisen und Regeln zur Gewährleistung von: Eindeutigkeit Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden sind nur dann zwingend oder eindeutig, wenn keine alternativen Interpretationsmöglichkeiten
Standardisierte Vorgehensweisen und Regeln zur Gewährleistung von: Eindeutigkeit Schlussfolgerungen aus empirischen Befunden sind nur dann zwingend oder eindeutig, wenn keine alternativen Interpretationsmöglichkeiten
Versuch 6.14 ph-abhängigkeit eines Indikators am Beispiel Thymolblau
 Versuch 6.14 ph-abhängigkeit eines Indikators am Beispiel Thymolblau Einleitung Lösungen mit verschiedenen ph-werten von stark sauer bis stark basisch werden mit gleich viel Thymolblau-Lösung versetzt.
Versuch 6.14 ph-abhängigkeit eines Indikators am Beispiel Thymolblau Einleitung Lösungen mit verschiedenen ph-werten von stark sauer bis stark basisch werden mit gleich viel Thymolblau-Lösung versetzt.
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Unsere Jahreszeiten: Die Natur im Jahreskreis
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Unsere Jahreszeiten: Die Natur im Jahreskreis Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 1. Auflage 2002 Alle Rechte
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Unsere Jahreszeiten: Die Natur im Jahreskreis Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de 1. Auflage 2002 Alle Rechte
Exkursion zur Uni-Graz
 Exkursion zur Uni-Graz der 5.B. Klasse 2012/13 Erstellt von Manuel Ruiß, Raphael Kropf und Sarah Wachtler. Protokolle Experiment: Was Rote Rüben zum Bluten bringt? Material: Rote Rübe, Reagenzgläser, Messer,
Exkursion zur Uni-Graz der 5.B. Klasse 2012/13 Erstellt von Manuel Ruiß, Raphael Kropf und Sarah Wachtler. Protokolle Experiment: Was Rote Rüben zum Bluten bringt? Material: Rote Rübe, Reagenzgläser, Messer,
Prüfbericht BM OglOT mm2 x 2 mm
 INSTITUT FÜR LUFTHYGIENE Luft und Wasser: Planung, Analysen, Sanierungskonzepte ILH BERLIN ILH Berlin Kurfürstenstraße 130785 Berlin Telefon: ++49(0)30 2639999-0 Telefax ++49(0)30 2639999-99 Prüfbericht
INSTITUT FÜR LUFTHYGIENE Luft und Wasser: Planung, Analysen, Sanierungskonzepte ILH BERLIN ILH Berlin Kurfürstenstraße 130785 Berlin Telefon: ++49(0)30 2639999-0 Telefax ++49(0)30 2639999-99 Prüfbericht
Reduktion von Bauschäden durch den Einsatz von hochdiffusionsoffenen Unterspannbahnen
 Reduktion von Bauschäden durch den Einsatz von hochdiffusionsoffenen Unterspannbahnen Prof. Dr.-Ing. Hans-Peter Leimer 1 Einleitung In letzter Zeit werden infolge eines fortschreitenden Bauablaufes unter
Reduktion von Bauschäden durch den Einsatz von hochdiffusionsoffenen Unterspannbahnen Prof. Dr.-Ing. Hans-Peter Leimer 1 Einleitung In letzter Zeit werden infolge eines fortschreitenden Bauablaufes unter
Schulversuchspraktikum. Constanze Koch. Sommersemester Klassenstufen 5 & 6. Wasser als Lösungsmittel. Kurzprotokoll
 Schulversuchspraktikum Constanze Koch Sommersemester 2015 Klassenstufen 5 & 6 Wasser als Lösungsmittel Kurzprotokoll Auf einen Blick: In diesem Protokoll werden ein Lehrerversuch und vier Schülerversuche
Schulversuchspraktikum Constanze Koch Sommersemester 2015 Klassenstufen 5 & 6 Wasser als Lösungsmittel Kurzprotokoll Auf einen Blick: In diesem Protokoll werden ein Lehrerversuch und vier Schülerversuche
Testleiterbefragung. Einleitung. Fragestellung. Methode. Wie viele Schüler/innen zeigten das folgende Verhalten?
 Testleiterbefragung Einleitung "Ruhe bitte!" Vom Pausenhof schallt Geschrei in die Klasse, in der hinteren Reihe tauschen sich mehrere Schülerinnen und Schüler über die Lösung der letzten Frage aus, ein
Testleiterbefragung Einleitung "Ruhe bitte!" Vom Pausenhof schallt Geschrei in die Klasse, in der hinteren Reihe tauschen sich mehrere Schülerinnen und Schüler über die Lösung der letzten Frage aus, ein
KULTIVIERUNG VON MIKROORGANISMEN
 KULTIVIERUNG VON MIKROORGANISMEN KULTIVIERUNG VON MIKROORGANISMEN Verfahren, das Bakterien außerhalb des natürlichen Standortes zur Vermehrung bringt (unbelebte Substrate oder Zellkulturen) 1 Voraussetzungen
KULTIVIERUNG VON MIKROORGANISMEN KULTIVIERUNG VON MIKROORGANISMEN Verfahren, das Bakterien außerhalb des natürlichen Standortes zur Vermehrung bringt (unbelebte Substrate oder Zellkulturen) 1 Voraussetzungen
8 Stevia qualitativ aus der Pflanze extrahieren
 8 Stevia qualitativ aus der Pflanze extrahieren 8.1 Vorwort Stevia ist der mit Abstand am teuersten Zuckerersatzstoff den wir untersucht haben, deshalb beschäftigte uns die Frage, wie der hohe Preis zu
8 Stevia qualitativ aus der Pflanze extrahieren 8.1 Vorwort Stevia ist der mit Abstand am teuersten Zuckerersatzstoff den wir untersucht haben, deshalb beschäftigte uns die Frage, wie der hohe Preis zu
Versuch C: Auflösungsvermögen Einleitung
 Versuch C: svermögen Einleitung Das AV wird üblicherweise in Linienpaaren pro mm (Lp/mm) angegeben und ist diejenige Anzahl von Linienpaaren, bei der ein normalsichtiges Auge keinen Kontrastunterschied
Versuch C: svermögen Einleitung Das AV wird üblicherweise in Linienpaaren pro mm (Lp/mm) angegeben und ist diejenige Anzahl von Linienpaaren, bei der ein normalsichtiges Auge keinen Kontrastunterschied
Wachstum und Zerfall / Exponentialfunktionen. a x = e (lna) x = e k x
 Wachstum und Zerfall / Exponentialfunktionen Mit Exponentialfunktionen können alle Wachstums- und Zerfalls- oder Abnahmeprozesse beschrieben werden. Im Allgemeinen geht es dabei um die Exponentialfunktionen
Wachstum und Zerfall / Exponentialfunktionen Mit Exponentialfunktionen können alle Wachstums- und Zerfalls- oder Abnahmeprozesse beschrieben werden. Im Allgemeinen geht es dabei um die Exponentialfunktionen
ONYCHOMYKOSE Nagelpilz
 Nagelpilz Messe Salzburg 2011 Vortragende Karin Holiczky Was ist ONYCHOMYKOSE? Eine Pilzerkrankung des Nagels. Nagelpilz (Onychomykose) ist eine Infektion des Nagels (Fuß- und Fingernägel) der in der Regel
Nagelpilz Messe Salzburg 2011 Vortragende Karin Holiczky Was ist ONYCHOMYKOSE? Eine Pilzerkrankung des Nagels. Nagelpilz (Onychomykose) ist eine Infektion des Nagels (Fuß- und Fingernägel) der in der Regel
Das Lennox-Gastaut-Syndrom
 Das Lennox-Gastaut-Syndrom Diagnose, Behandlung und Unterstützung im Alltag von Ulrich Stephani 1. Auflage Das Lennox-Gastaut-Syndrom Stephani schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG
Das Lennox-Gastaut-Syndrom Diagnose, Behandlung und Unterstützung im Alltag von Ulrich Stephani 1. Auflage Das Lennox-Gastaut-Syndrom Stephani schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG
Tab. 12: HGA-positive Seren (IFT) in verschiedenen Patientengruppen. Kontrollseren insgesamt
 MATERIAL UND METHODEN 3. Ergebnisse 3.1. IFT - Ergebnisse 3.1.1. Gesamtanzahl der HGA-positiven Seren im IFT Um zu prüfen, ob in den Seren der Borreliose-positiven Patienten, die nachweislich einen Zeckenstich
MATERIAL UND METHODEN 3. Ergebnisse 3.1. IFT - Ergebnisse 3.1.1. Gesamtanzahl der HGA-positiven Seren im IFT Um zu prüfen, ob in den Seren der Borreliose-positiven Patienten, die nachweislich einen Zeckenstich
Standardabweichung und Variationskoeffizient. Themen. Prinzip. Material TEAS Qualitätskontrolle, Standardabweichung, Variationskoeffizient.
 Standardabweichung und TEAS Themen Qualitätskontrolle, Standardabweichung,. Prinzip Die Standardabweichung gibt an, wie hoch die Streuung der Messwerte um den eigenen Mittelwert ist. Sie ist eine statistische
Standardabweichung und TEAS Themen Qualitätskontrolle, Standardabweichung,. Prinzip Die Standardabweichung gibt an, wie hoch die Streuung der Messwerte um den eigenen Mittelwert ist. Sie ist eine statistische
Die Masse der Milchstraße [28. März] Die Milchstraße [1] besteht ganz grob aus drei Bereichen (Abb. 1):
![Die Masse der Milchstraße [28. März] Die Milchstraße [1] besteht ganz grob aus drei Bereichen (Abb. 1): Die Masse der Milchstraße [28. März] Die Milchstraße [1] besteht ganz grob aus drei Bereichen (Abb. 1):](/thumbs/55/37824085.jpg) Die Masse der Milchstraße [28. März] Die Milchstraße [1] besteht ganz grob aus drei Bereichen (Abb. 1): (a) dem Halo [1], der die Galaxis [1] wie eine Hülle umgibt; er besteht vorwiegend aus alten Sternen,
Die Masse der Milchstraße [28. März] Die Milchstraße [1] besteht ganz grob aus drei Bereichen (Abb. 1): (a) dem Halo [1], der die Galaxis [1] wie eine Hülle umgibt; er besteht vorwiegend aus alten Sternen,
Können Haare schimmeln?
 Können Haare schimmeln? Vorangehende Gedanken, These: Ob Haare, respektive Dreadlocks, schimmeln können, ist ungeklärt. Die bisherigen Beobachtungen sprechen dagegen; Schimmelbefall bei sauberen Dreads
Können Haare schimmeln? Vorangehende Gedanken, These: Ob Haare, respektive Dreadlocks, schimmeln können, ist ungeklärt. Die bisherigen Beobachtungen sprechen dagegen; Schimmelbefall bei sauberen Dreads
Schwärmen und Gleiten bei Mikroorganismen
 Schwärmen und Gleiten bei Mikroorganismen VerfasserInnen: Betreuerinnen: Bettina Schulthess, s0171291@access.unizh.ch Nadja Weisshaupt, s0170097@access.unizh.ch Alfred Mody Ayieye, s9873317@access.unizh.ch
Schwärmen und Gleiten bei Mikroorganismen VerfasserInnen: Betreuerinnen: Bettina Schulthess, s0171291@access.unizh.ch Nadja Weisshaupt, s0170097@access.unizh.ch Alfred Mody Ayieye, s9873317@access.unizh.ch
Natur und Technik. Lernstandserhebung zu den Schwerpunkten Biologie, Naturwissenschaftliches Arbeiten, Informatik. Datum:
 Name: Natur und Technik Lernstandserhebung zu den Schwerpunkten Biologie, Naturwissenschaftliches Arbeiten, Informatik Datum: Klasse: 1 In einem Becherglas befindet sich flüssiges Wasser. Dies lässt sich
Name: Natur und Technik Lernstandserhebung zu den Schwerpunkten Biologie, Naturwissenschaftliches Arbeiten, Informatik Datum: Klasse: 1 In einem Becherglas befindet sich flüssiges Wasser. Dies lässt sich
Kapitel 10. Stichproben
 Kapitel 10 n In der deskriptiven Statistik werden die Charakteristika eines Datensatzes durch Grafiken verdeutlicht und durch Maßzahlen zusammengefasst. In der Regel ist man aber nicht nur an der Verteilung
Kapitel 10 n In der deskriptiven Statistik werden die Charakteristika eines Datensatzes durch Grafiken verdeutlicht und durch Maßzahlen zusammengefasst. In der Regel ist man aber nicht nur an der Verteilung
2. Beschrifte das Bild des Mikroskops. 3. Lies den Text noch einmal. Welche Fehler hat Julian gemacht? Antworte schriftlich in ganzen Sätzen.
 Das neue Mikroskop Julian hat Geburtstag. Begeistert sitzt er vor seinem neuen Mikroskop. Das hatte er sich schon lange gewünscht! Er will nämlich Naturforscher werden. Das Mikroskop hat eine Lampe. Julian
Das neue Mikroskop Julian hat Geburtstag. Begeistert sitzt er vor seinem neuen Mikroskop. Das hatte er sich schon lange gewünscht! Er will nämlich Naturforscher werden. Das Mikroskop hat eine Lampe. Julian
Bestimmungsschlüssel für einheimische Holzarten. Die Bestimmung des Holzen kann vorgenommen werden nach
 Bestimmungsschlüssel für einheimische Holzarten Die Bestimmung des Holzen kann vorgenommen werden nach Nr 1: Farbe (bei Kernholzbäumen ist die Kernholzfarbe maßgebend) a) weißlich b) gelblich c) grünlich
Bestimmungsschlüssel für einheimische Holzarten Die Bestimmung des Holzen kann vorgenommen werden nach Nr 1: Farbe (bei Kernholzbäumen ist die Kernholzfarbe maßgebend) a) weißlich b) gelblich c) grünlich
0 3 0 4 J 0 3 0 4 J 0 3 0 4 0 4. 0 4 J. j 0 4. 0 7. 0 3 j 0 4 0 4. 0 4. 0 4 0 3 J 0 3 J
 1 318 Architektur in deutschland Text und MuSIK: Bodo WARtke rechtwinklig resolut (q = ca 136 ) /B b /A m/a b 7 12 8 К 1 7 1 7 1 7 12 8 12 8 К b B b 2 B n 5 1 7 0 7 Ich find a, К К Deutsch - land ent-wi-ckelt
1 318 Architektur in deutschland Text und MuSIK: Bodo WARtke rechtwinklig resolut (q = ca 136 ) /B b /A m/a b 7 12 8 К 1 7 1 7 1 7 12 8 12 8 К b B b 2 B n 5 1 7 0 7 Ich find a, К К Deutsch - land ent-wi-ckelt
3.2.1 Neurogeneserate der magnetfeldbehandelten Tiere aus restriktiver Haltung
 Eigene Untersuchungen 25 3.2 Ergebnisse 3.2.1 Neurogeneserate der magnetfeldbehandelten Tiere aus restriktiver Haltung Untersucht wurde, ob die Magnetfeldbehandlung mit 1, 8, 12, 29 und 5 Hz einen Einfluss
Eigene Untersuchungen 25 3.2 Ergebnisse 3.2.1 Neurogeneserate der magnetfeldbehandelten Tiere aus restriktiver Haltung Untersucht wurde, ob die Magnetfeldbehandlung mit 1, 8, 12, 29 und 5 Hz einen Einfluss
Aus der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie der Medizinischen Fakultät der Charité Universitätsmedizin Berlin DISSERTATION
 Aus der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie der Medizinischen Fakultät der Charité Universitätsmedizin Berlin DISSERTATION Evaluation der Laser-Scan-Mikroskopie, der Laser-Doppler- Blutflussmessung
Aus der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie der Medizinischen Fakultät der Charité Universitätsmedizin Berlin DISSERTATION Evaluation der Laser-Scan-Mikroskopie, der Laser-Doppler- Blutflussmessung
Kurzbericht über die im Rahmen der Infektionskrankheiten-Surveillance nach IfSG in Hamburg registrierten Krankheiten
 Infektionsepidemiologisches Landeszentrum INFEKT - INFO Ausgabe 2 / 204, 24. Januar 204 Kurzbericht über die im Rahmen der Infektionskrankheiten-Surveillance nach IfSG in Hamburg registrierten Krankheiten
Infektionsepidemiologisches Landeszentrum INFEKT - INFO Ausgabe 2 / 204, 24. Januar 204 Kurzbericht über die im Rahmen der Infektionskrankheiten-Surveillance nach IfSG in Hamburg registrierten Krankheiten
Stärkeaufbau. Viktor Bindewald Inhaltsverzeichnis. Versuchsprotokoll
 Stärkeaufbau Versuchsprotokoll Viktor Bindewald 1.12.2005 Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen 2 1.1 Jod-Stärkenachweis.............................. 2 1.2 Energetische Kopplung............................
Stärkeaufbau Versuchsprotokoll Viktor Bindewald 1.12.2005 Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen 2 1.1 Jod-Stärkenachweis.............................. 2 1.2 Energetische Kopplung............................
Wirksamkeit von Grander-Wasser
 Wirksamkeit von Grander-Wasser Beitrag zum Wettbewerb Schüler experimentieren 2007 von Sebastian Prüfling aus Beutelsbach Gymnasium Vilshofen 1 Inhaltsverzeichnis Seite 2: Seite 3: Seite 6: Inhaltsverzeichnis,
Wirksamkeit von Grander-Wasser Beitrag zum Wettbewerb Schüler experimentieren 2007 von Sebastian Prüfling aus Beutelsbach Gymnasium Vilshofen 1 Inhaltsverzeichnis Seite 2: Seite 3: Seite 6: Inhaltsverzeichnis,
AUGENHORNHAUTSPENDE UND -TRANSPLANTATION
 AUGENHORNHAUTSPENDE UND -TRANSPLANTATION Information DIE AUGENHORNHAUT Die durchsichtige, leicht gewölbte Augenhornhaut oder Cornea ist gleichsam das Fenster des Auges. Hitze, ätzende Flüssigkeiten, Fremdkörper
AUGENHORNHAUTSPENDE UND -TRANSPLANTATION Information DIE AUGENHORNHAUT Die durchsichtige, leicht gewölbte Augenhornhaut oder Cornea ist gleichsam das Fenster des Auges. Hitze, ätzende Flüssigkeiten, Fremdkörper
Baumtagebuch Japanische Zierkirsche
 Baumtagebuch Japanische Zierkirsche Klasse 9d Juni 2016 Die Japanische Zierkirsche habe ich mir für das Baumtagebuch ausgesucht. Ich habe mich für diesen Baum entschieden, weil er in meiner Straße sehr
Baumtagebuch Japanische Zierkirsche Klasse 9d Juni 2016 Die Japanische Zierkirsche habe ich mir für das Baumtagebuch ausgesucht. Ich habe mich für diesen Baum entschieden, weil er in meiner Straße sehr
MERKBLÄTTER DER FORSTLICHEN VERSUCHS- UND FORSCHUNGSANSTALT BADEN-WÜRTTEMBERG 1981 Nr.2. Douglasienschütte. Bearbeitet B.R.STEPHAN, Großhansdorf«
 MERKBLÄTTER DER FORSTLICHEN VERSUCHS- UND FORSCHUNGSANSTALT BADEN-WÜRTTEMBERG 1981 Nr.2 Douglasienschütte Bearbeitet B.R.STEPHAN, Großhansdorf« Douglasienschütte Von B. R. Stephan, Großhansdorf 1 Allgemeines
MERKBLÄTTER DER FORSTLICHEN VERSUCHS- UND FORSCHUNGSANSTALT BADEN-WÜRTTEMBERG 1981 Nr.2 Douglasienschütte Bearbeitet B.R.STEPHAN, Großhansdorf« Douglasienschütte Von B. R. Stephan, Großhansdorf 1 Allgemeines
Übungen mit dem Applet Vergleich von zwei Mittelwerten
 Vergleich von zwei Mittelwerten 1 Übungen mit dem Applet Vergleich von zwei Mittelwerten 1 Statistischer Hintergrund... 2 1.1 Typische Fragestellungen...2 1.2 Fehler 1. und 2. Art...2 1.3 Kurzbeschreibung
Vergleich von zwei Mittelwerten 1 Übungen mit dem Applet Vergleich von zwei Mittelwerten 1 Statistischer Hintergrund... 2 1.1 Typische Fragestellungen...2 1.2 Fehler 1. und 2. Art...2 1.3 Kurzbeschreibung
Vertikutieren richtig gemacht
 Vertikutieren richtig gemacht Hat sich über den Winter Moos und Rasenfilz im Garten breit gemacht? Wenn ja, sollte beides unbedingt entfernt werden, um den Rasen im Frühling wieder ordentlich zum Wachsen
Vertikutieren richtig gemacht Hat sich über den Winter Moos und Rasenfilz im Garten breit gemacht? Wenn ja, sollte beides unbedingt entfernt werden, um den Rasen im Frühling wieder ordentlich zum Wachsen
Wie hängen beim Kreis Durchmesser und Umfang zusammen?
 Euro-Münzen und die Kreiszahl Ulla Schmidt, Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Lünen Steckbrief der Aufgabe Sekundarstufe I (Kreisberechnungen) Dauer: 2 Unterrichtsstunden Notwendige Voraussetzungen: Schülerinnen
Euro-Münzen und die Kreiszahl Ulla Schmidt, Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Lünen Steckbrief der Aufgabe Sekundarstufe I (Kreisberechnungen) Dauer: 2 Unterrichtsstunden Notwendige Voraussetzungen: Schülerinnen
Pflanzen. 1.)Unterschied: Monokotyle und Dikotyle
 Pflanzen 1.)Unterschied: Monokotyle und Dikotyle Monokotyle: heißen auch noch Einkeimblättrige. Bei diesen Pflanzen sind die Leitbündel zerstreut angeordnet, das nennt man Anaktostelen. Die Blüte hat die
Pflanzen 1.)Unterschied: Monokotyle und Dikotyle Monokotyle: heißen auch noch Einkeimblättrige. Bei diesen Pflanzen sind die Leitbündel zerstreut angeordnet, das nennt man Anaktostelen. Die Blüte hat die
Harnstoffspaltung durch Urease
 Martin Raiber Chemie Protokoll Nr.5 Harnstoffspaltung durch Urease Versuch 1: Materialien: Reagenzglasgestell, Reagenzgläser, Saugpipetten, 100 ml-becherglas mit Eiswasser, 100 ml-becherglas mit Wasser
Martin Raiber Chemie Protokoll Nr.5 Harnstoffspaltung durch Urease Versuch 1: Materialien: Reagenzglasgestell, Reagenzgläser, Saugpipetten, 100 ml-becherglas mit Eiswasser, 100 ml-becherglas mit Wasser
Labor für Technische Akustik
 Labor für Technische Akustik Kraus Abbildung 1: Experimenteller Aufbau zur optischen Ermittlung der Schallgeschwindigkeit. 1. Versuchsziel In einer mit einer Flüssigkeit gefüllten Küvette ist eine stehende
Labor für Technische Akustik Kraus Abbildung 1: Experimenteller Aufbau zur optischen Ermittlung der Schallgeschwindigkeit. 1. Versuchsziel In einer mit einer Flüssigkeit gefüllten Küvette ist eine stehende
Monate Präop Tabelle 20: Verteilung der NYHA-Klassen in Gruppe 1 (alle Patienten)
 Parameter zur Beschreibung der Leistungsfähigkeit Klassifikation der New-York-Heart-Association (NYHA) Gruppe 1 (alle Patienten): Die Eingruppierung der Patienten in NYHA-Klassen als Abbild der Schwere
Parameter zur Beschreibung der Leistungsfähigkeit Klassifikation der New-York-Heart-Association (NYHA) Gruppe 1 (alle Patienten): Die Eingruppierung der Patienten in NYHA-Klassen als Abbild der Schwere
Ein- und Zweistichprobentests
 (c) Projekt Neue Statistik 2003 - Lernmodul: Ein- Zweistichprobentests Ein- Zweistichprobentests Worum geht es in diesem Modul? Wiederholung: allgemeines Ablaufschema eines Tests Allgemeine Voraussetzungen
(c) Projekt Neue Statistik 2003 - Lernmodul: Ein- Zweistichprobentests Ein- Zweistichprobentests Worum geht es in diesem Modul? Wiederholung: allgemeines Ablaufschema eines Tests Allgemeine Voraussetzungen
Kalkausscheidungen bei Flachdächern
 Kalkausscheidungen bei Flachdächern Autor(en): Trüb, U. Objekttyp: Article Zeitschrift: Cementbulletin Band (Jahr): 34-35 (1966-1967) Heft 15 PDF erstellt am: 31.01.2017 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-153465
Kalkausscheidungen bei Flachdächern Autor(en): Trüb, U. Objekttyp: Article Zeitschrift: Cementbulletin Band (Jahr): 34-35 (1966-1967) Heft 15 PDF erstellt am: 31.01.2017 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-153465
Written by André Annen. Feuer-Experiment
 Feuer-Experiment 1 Vorbereitung In diesem Experiment geht es darum auf zwei verschiedenen Flächen, einer mit Vieh behandelten Fläche A und einer unbehandelten Fläche B, Unterschiede in Bezug auf die Reaktion
Feuer-Experiment 1 Vorbereitung In diesem Experiment geht es darum auf zwei verschiedenen Flächen, einer mit Vieh behandelten Fläche A und einer unbehandelten Fläche B, Unterschiede in Bezug auf die Reaktion
Ihr seid das Salz der Erde
 Ihr seid das Salz der Erde Eingangslied aus der gleichnamigen Messe im ospelton opyright horarrangement 2013 by M &, Saarbrücken Abdruck erolgt mit relicher enehmigung von Hubert Janssen Melodie Text:
Ihr seid das Salz der Erde Eingangslied aus der gleichnamigen Messe im ospelton opyright horarrangement 2013 by M &, Saarbrücken Abdruck erolgt mit relicher enehmigung von Hubert Janssen Melodie Text:
Seite 2. Allgemeine Informationzu Basilikum. Kontakt. Vorwort. ingana Shop
 2., verb. Auflage Allgemeine Informationzu Basilikum Basilikum gehärt mit zu den beliebtesten Kräutern in der Küche, auf dem Balkon und im Garten. Es gibt eine Reihe von Sorten, die ganz nach Geschmack
2., verb. Auflage Allgemeine Informationzu Basilikum Basilikum gehärt mit zu den beliebtesten Kräutern in der Küche, auf dem Balkon und im Garten. Es gibt eine Reihe von Sorten, die ganz nach Geschmack
Beeinflussung des Pflanzenwachstums durch verschieden farbiges Licht
 Beeinflussung des Pflanzenwachstums durch verschieden farbiges Licht Diese Arbeit wurde angefertigt von: Sonia Olaechea Sofia Zaballa Alba Calabozo Betreuung: Axel Stöcker 2 Inhalt 1. Kurzfassung der Arbeit...4
Beeinflussung des Pflanzenwachstums durch verschieden farbiges Licht Diese Arbeit wurde angefertigt von: Sonia Olaechea Sofia Zaballa Alba Calabozo Betreuung: Axel Stöcker 2 Inhalt 1. Kurzfassung der Arbeit...4
Schulversuchspraktikum. Johanna Osterloh. Sommersemester Klassenstufen 9 & 10. Stoffkreisläufe. Kurzprotokoll
 Schulversuchspraktikum Johanna Osterloh Sommersemester 2015 Klassenstufen 9 & 10 Stoffkreisläufe Kurzprotokoll Auf einen Blick: Dieses Protokoll enthält vier Schülerversuche, die zum Thema Kohlenstoffdioxidkreislauf
Schulversuchspraktikum Johanna Osterloh Sommersemester 2015 Klassenstufen 9 & 10 Stoffkreisläufe Kurzprotokoll Auf einen Blick: Dieses Protokoll enthält vier Schülerversuche, die zum Thema Kohlenstoffdioxidkreislauf
Das Lennox- Gastaut-Syndrom
 Prof. Dr. med. Ulrich Stephani Das Lennox- Gastaut-Syndrom Diagnose, Behandlung und Unterstützung im Alltag Inhalt Vorwort 5 Was ist das Lennox-Gastaut-Syndrom? 6 Was ist Epilepsie? 6 Was ist ein Epilepsiesyndrom?
Prof. Dr. med. Ulrich Stephani Das Lennox- Gastaut-Syndrom Diagnose, Behandlung und Unterstützung im Alltag Inhalt Vorwort 5 Was ist das Lennox-Gastaut-Syndrom? 6 Was ist Epilepsie? 6 Was ist ein Epilepsiesyndrom?
Lasse Pflanzen in mineraldüngerhaltigem Wasser und in Trinkwasser wachsen.
 Naturwissenschaften - Chemie - Anorganische Chemie - 5 Düngemittel (P75600) 5.2 Mineralstoffaufnahme der Pflanzen Experiment von: Seb Gedruckt: 24.03.204 :54:0 intertess (Version 3.2 B24, Export 2000)
Naturwissenschaften - Chemie - Anorganische Chemie - 5 Düngemittel (P75600) 5.2 Mineralstoffaufnahme der Pflanzen Experiment von: Seb Gedruckt: 24.03.204 :54:0 intertess (Version 3.2 B24, Export 2000)
Geschmackstests zeigten deutliche Sortenunterschiede bei Öko-Kartoffeln (A. Peine; Dr. E. Leisen, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen)
 Geschmackstests zeigten deutliche Sortenunterschiede bei Öko-Kartoffeln (A. Peine; Dr. E. Leisen, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen) In den letzten 4 Jahren wurden in Westfalen-Lippe Testessen
Geschmackstests zeigten deutliche Sortenunterschiede bei Öko-Kartoffeln (A. Peine; Dr. E. Leisen, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen) In den letzten 4 Jahren wurden in Westfalen-Lippe Testessen
Statistik Testverfahren. Heinz Holling Günther Gediga. Bachelorstudium Psychologie. hogrefe.de
 rbu leh ch s plu psych Heinz Holling Günther Gediga hogrefe.de Bachelorstudium Psychologie Statistik Testverfahren 18 Kapitel 2 i.i.d.-annahme dem unabhängig. Es gilt also die i.i.d.-annahme (i.i.d = independent
rbu leh ch s plu psych Heinz Holling Günther Gediga hogrefe.de Bachelorstudium Psychologie Statistik Testverfahren 18 Kapitel 2 i.i.d.-annahme dem unabhängig. Es gilt also die i.i.d.-annahme (i.i.d = independent
EnzymeLab.
 Das Enzyme Lab ist ein virtuelles Labor in dem enzymatische Reaktionen getestet werden können. Dem Benutzer sollen hier in einfacher Form Prinzipien der Enzymkinetik und die experimentelle Laborarbeit
Das Enzyme Lab ist ein virtuelles Labor in dem enzymatische Reaktionen getestet werden können. Dem Benutzer sollen hier in einfacher Form Prinzipien der Enzymkinetik und die experimentelle Laborarbeit
Gutachten. Labor Analysen. Berichte. ärztliche Bestätigungen
 Gutachten Labor Analysen Berichte ärztliche Bestätigungen Institut für Med. Mikrobiologie, Immunologie und Krankenhaushygiene mit Blutdepot Chefarzt: Prof. Dr. P. Emmerling Akademisches
Gutachten Labor Analysen Berichte ärztliche Bestätigungen Institut für Med. Mikrobiologie, Immunologie und Krankenhaushygiene mit Blutdepot Chefarzt: Prof. Dr. P. Emmerling Akademisches
Mikroskopische Wasseruntersuchungen - Berthold Heusel M.A. - Wasserstudio Bodensee
 Mikroskopische Wasseruntersuchungen - Berthold Heusel M.A. - Wasserstudio Bodensee Untersuchung des Wasseraktivators Max Gross Überlingen, 28.3.2013 Untersucht wurde ein Wasseraktivator der Fa. Max Gross
Mikroskopische Wasseruntersuchungen - Berthold Heusel M.A. - Wasserstudio Bodensee Untersuchung des Wasseraktivators Max Gross Überlingen, 28.3.2013 Untersucht wurde ein Wasseraktivator der Fa. Max Gross
Wachstumsverhalten von Kresse
 Wachstumsverhalten von Kresse unter verschiedenen Lichtbedingungen Wettbewerb "Jugend Forscht" 2005 Julian Kohrs (16 Jahre) Arbeitsgemeinschaft "Jugend Forscht" des Christian-Gymnasiums Hermannsburg Leitung:
Wachstumsverhalten von Kresse unter verschiedenen Lichtbedingungen Wettbewerb "Jugend Forscht" 2005 Julian Kohrs (16 Jahre) Arbeitsgemeinschaft "Jugend Forscht" des Christian-Gymnasiums Hermannsburg Leitung:
ALVA. Gute Herstellungspraxis für pflanzliche Produkte
 ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR LEBENSMITTEL- VETERINÄR- UND AGRARWESEN ISSN 1606-612X ALVA Gute Herstellungspraxis für pflanzliche Produkte Tagungsbericht 2007 BERICHT ALVA Jahrestagung 2007 Gute Herstellungspraxis
ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR LEBENSMITTEL- VETERINÄR- UND AGRARWESEN ISSN 1606-612X ALVA Gute Herstellungspraxis für pflanzliche Produkte Tagungsbericht 2007 BERICHT ALVA Jahrestagung 2007 Gute Herstellungspraxis
Auswertung P2-10 Auflösungsvermögen
 Auswertung P2-10 Auflösungsvermögen Michael Prim & Tobias Volkenandt 22 Mai 2006 Aufgabe 11 Bestimmung des Auflösungsvermögens des Auges In diesem Versuch sollten wir experimentell das Auflösungsvermögen
Auswertung P2-10 Auflösungsvermögen Michael Prim & Tobias Volkenandt 22 Mai 2006 Aufgabe 11 Bestimmung des Auflösungsvermögens des Auges In diesem Versuch sollten wir experimentell das Auflösungsvermögen
Weinbergschnecke. Outdoor-Schneckenbestimmungsbüchlein. Zusammengestellt von Angelika Benninger, 2015
 0 cm Wer schneckt denn da? 1 cm Outdoor-Schneckenbestimmungsbüchlein 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm Zusammengestellt von Angelika Benninger, 2015 Schrift: Andika Leseschrift by zaubereinmaleins.de Fotos: siehe
0 cm Wer schneckt denn da? 1 cm Outdoor-Schneckenbestimmungsbüchlein 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm Zusammengestellt von Angelika Benninger, 2015 Schrift: Andika Leseschrift by zaubereinmaleins.de Fotos: siehe
