Waldorfschule gesellschaftliche Avantgarde? Zeichen der Zeit. Neue Art der Zusammenarbeit
|
|
|
- Leopold Artur Friedrich
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Zeichen der Zeit Waldorfschule gesellschaftliche Avantgarde? Bei der Konferenz der Bundes-Geschäftsführer der deutschen Waldorfschulen am 7. Mai 2007 in Gera mit dem Gesamtthema»Unternehmerisches Handeln in der Selbstverwaltung oder Verrechtlichung des Geisteslebens?«wurden die nachfolgenden Überlegungen als Schlusswort formuliert und zum Abdruck um einige Literaturhinweise ergänzt. Die Gründung der ersten Waldorfschule stand in einem gesamtgesellschaftlichen Bezug (»Dreigliederung des sozialen Organismus«) und war Folge einer Bemühung um die Veränderung des öffentlichen Schulwesens. Emil Molt hat zuerst versucht, eine Reform des Schulwesens in Baden-Württemberg zu veranlassen. Erst als das nicht gelang, hat er sich entschlossen, wenigstens eine Schule für die Kinder seiner Arbeiter zu begründen. 1 Auch Rudolf Steiner war es ein großes Anliegen, die Waldorfschule als Avantgarde der Gesamtgesellschaft zu verstehen. Es ging ihm darum, das gesamte geistige Leben und darin besonders das Bildungswesen auf eine neue Basis zu stellen. Als es in den nächsten Jahren noch einige andere Schulgründungsinitiativen in Deutschland gab, warnte Rudolf Steiner davor, eine an sich wünschenswerte Ausdehnung der Schulbewegung durch»winkelschulen«zu konterkarieren. Er ging vielmehr davon aus, dass man an der einen, in Stuttgart bestehenden Schule das pädagogische Prinzip erkennen könne und dass dadurch weltweit ein gesellschaftlicher Sog zur Verwirklichung dieser Pädagogik entstünde. Dann könnten an den verschiedensten Orten und in den verschiedensten Situationen jeweils Schulen ganz verschiedener Ausprägung (und wohl auch verschiedener Trägerschaft) entstehen. Das Gemeinsame wäre»nur«ihr Ursprung aus dem pädagogischen Impuls. So steht von Anfang an jede einzelne Waldorfschule in einem gesamtgesellschaftlichen Rahmen. Man kann diesen Ursprung aus dem Bewusstsein verlieren, er ist aber trotzdem da. Neue Art der Zusammenarbeit Mit der Gründung der ersten Waldorfschule in Stuttgart 1919 ist die Aufgabe verbunden, in eine neue Art von Zusammenarbeit einzutreten. Die beiden großen Möglichkeiten, die aus der Geschichte bekannt sind, sind inzwischen erschöpft: Es geht weder hierarchisch weiter, noch basisdemokratisch. Es muss eine neue Art der bewussten Zusammenarbeit gefunden werden. Beim Geistesleben geht es im Kern darum: Wie kommen die Kräfte der Individualität des Menschen in der Gemeinschaft zum Tragen? Und wie kommen diese tragenden Kräfte der Individualitäten zu einer Zusammenarbeit? Das ist heute, seit gut 20 Jahren, eine zentrale Frage in der gesamten Arbeitswelt geworden. Dort wird immer deutlicher, dass die alte Form, die Hierarchie, für die Zukunft nicht ausreicht. Auch wenn kaum ein Unternehmen die Hierarchie formal abschafft, so geht es doch in fortschrittlichen Unternehmen darum, aus den individuellen Kräften aller Beteiligten zu dem zu kommen, was man gestalten will. Wir haben diese Bemühung in der Wirtschaftswelt als»dialogische Führung«beschrieben 2 als eine Bemühung, die Kräfte des Individuellen zu wecken und zusammenzuführen. Die (teilweise schmerzlichen) Erfahrungen, die man in Waldorfschulen in der letzten Zeit gemacht hat, können daher vor dem Hintergrund eines gesamtgesellschaftlichen Umbruchs gesehen werden. Dieser basiert auf der Einsicht, dass es bei der Zusammenarbeit nicht auf Regelungen (Prinzipien, Normen, Satzungen, Strukturen) ankommt, sondern auf geistige Produktivität und freie Empfänglichkeit der Beteiligten ein von Rudolf Steiner Erziehungskunst 7/
2 beschriebenes, aber bis heute meist übersehenes Prinzip der Zusammenarbeit im Geistesleben. 3 Ich führe das alles hier an, um zu zeigen, dass der Ansatz Rudolf Steiners zu einer neuen Art der Zusammenarbeit heute, 80 bis 90 Jahre später, allmählich ein allgemeines Bedürfnis beschreibt. Hier sind die Waldorfschulen Vorreiter einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, in der wir mitten darin stehen. Neues Verständnis von Individualität Ein zweiter Gesichtspunkt hängt mit dem zuerst genannten in gewisser Weise zusammen. Wenn die Kräfte der Individualität aufgerufen und eingesetzt werden sollen, dann setzt das voraus, dass Individualität nichts Banales ist, sich nicht auf Selbstgefühl o.ä. beschränkt. Wenn wir nach den verbreiteten Menschenbildern in den letzten 100 Jahren fragen, dann finden wir vor allem zwei: Das eine kann man zusammenfassen mit der Bezeichnung»der determinierte Mensch«. Der Mensch ist ein Wesen, das von vorneherein festgelegt ist. Dabei gibt es mehrere Arten von Festlegung. Erstens die genetische Festlegung. Ihr wird in dem Wirtschaftsleben eine immer noch zunehmende Aufmerksamkeit gewidmet, mit praktischen Konsequenzen. Warum gehen Frauen so gerne auf Einkaufsbummel? Warum sieht das Einkaufsverhalten bei Männern ganz anders aus? Weil die Frauen ihre genetische Herkunft von den»sammlern«haben und die Männer von den»jägern«. Frauen muss man Wühltische bieten, wo sie finden, was sie nicht gesucht haben. Das ist wie früher, da gingen sie mit dem Körbchen in den Wald und konnten auch nicht so genau wissen, welche Beeren oder Pilze sie finden würden. Und sie gingen schon damals gerne in Gruppen. In einer amerikanischen Haushaltswarenkette blieben Frauen in Begleitung anderer Frauen durchschnittlich ca. 8 Minuten im Laden; Frauen in Begleitung von Männern nur halb so lang. Da die Verweildauer sich wie kein anderer Faktor auf die Größe eines Einkaufs auswirkt, vernichten die Männer durch ihre bloße Anwesenheit wertvollen Umsatz. Man muss also dafür sorgen, dass sie zwar als»brieftaschenträger«in der Nähe bleiben, sich aber nicht selbst am Einkauf beteiligen. Deshalb wird in immer mehr Läden eine Brems- oder Dekompressionszone gleich hinter dem Eingang eingerichtet, wo Männer zwischengelagert werden können. Es handelt sich meist um eine Sitzgruppe mit Zeitschriften u.ä. Der genetisch determinierte Mensch ist eine feste Grundannahme in der Geschäftswelt geworden, die es z.b. ermöglicht, das»konsumentenverhalten«zu manipulieren. Es gibt aber auch eine seelische Determination, z.b. durch die frühkindliche Prägung. Wie meine Bezugsperson, in der Regel die Mutter, mich in den ersten drei Lebensjahren behandelt hat, davon hängt es ab, ob ich später intelligent, sozialverträglich und erfolgreich werde. Schwerverbrecher, die vor Gericht kommen, Mörder, Kinderschänder usw., erhalten heute Strafnachlass, wenn sie eine in dieser Hinsicht schwere Kindheit hatten. Denn man geht seit einigen Jahrzehnten (noch nicht länger!) in der Gerichtspraxis davon aus, dass seelische Verwahrlosung in der Kindheit dazu führt, dass die Menschen später so werden müssen. Man spricht drittens von geistiger oder sozialer Determination. Daher sollen die Menschen möglichst früh bestimmte gesellschaftliche Wertvorstellungen aufnehmen. Das ist das eine große Menschenbild des 20. Jahrhunderts: Der vorgeprägte Mensch. Der Mensch ist und bleibt, was er geworden ist; da kommt er nicht heraus. Der ganze Mensch Leib, Seele und Geist ist an seine Vergangenheit gefesselt. Das andere große Menschenbild des 20. Jahrhunderts ist der»neue Mensch«. Dessen Zukunft wird manipuliert. Ich kann aus Ihnen einen»anderen«machen, wenn ich die 850 Erziehungskunst 7/8 2007
3 richtigen Maßnahmen ergreife. Das haben die beiden großen Diktaturen des 20. Jahrhunderts im Einzelnen vorgeführt. Was man in unserer westlichen Welt heute»personalentwicklung«nennt, beruht im Grunde auf demselben Prinzip. 4 Wenn diese Menschenbilder gelten, das eine oder das andere, dann ist Waldorfpädagogik gegenstandslos. In deren Mittelpunkt stehen»erweckende Erziehung«und»Selbsterziehung«. 5 Diese setzen Freiheit voraus und fördern sie. Freiheit ist dabei kein absoluter Anspruch (man ist entweder frei oder unfrei), sondern Wesen und zugleich Entwicklungsziel jedes Menschen. 6 Erziehung ist ein zentrales Moment dieser Bemühung um Entwicklung zur Freiheit. Dass die Ansicht vom determinierten Menschen und die Ansicht vom neuen Menschen Realitäten beschreiben, steht wohl außer Frage. Die Frage ist allerdings, wie weit diese Einflüsse, denen jeder Mensch unterliegt, endgültig prägen und Freiheit ausschließen. Das ist eine bedeutende Frage, der sich natürlich diejenigen nicht zu widmen brauchen, die von vorne herein von der Festlegung des Menschen in der einen oder anderen Richtung ausgehen. Denn dann gibt es keine Freiheit. Wer Waldorfpädagogik vertritt, müsste sich jedoch diese Frage stellen. Und zwar nicht nur zur»verteidigung«der eigenen Ansichten, sondern weil die Sehnsucht nach dem»freien Menschen«in unserer Gesamtgesellschaft seit Jahren im Wachsen begriffen ist. Sehnsucht nach dem freien Menschen Je mehr die genannten Menschenbilder unsere Zivilisation bestimmen (z.b. in Marketing, Personalentwicklung usw.), um so mehr beginnt man sie zu durchschauen und um so häufiger taucht bei immer mehr Menschen die Frage auf: Finde ich mich eigentlich in diesem Selbstverständnis wieder? Es setzt sich zunehmend, oft gefühlsmäßig, ein Bedürfnis durch: sich so zu verstehen, wie der Mensch in der Waldorfpädagogik verstanden wird. Das ist nicht der determinierte und nicht der manipulierbare Mensch, sondern das ist, man könnte sagen, der werdende Mensch, der entwicklungsfähige Mensch, der seine Entwicklung selbst in die Hand nehmen kann und auch selbst in die Hand nehmen muss, wenn er seelisch älter werden will als 20 Jahre. 7 Noch ist es nicht so, dass man in der öffentlichen Meinung dieses gefühlte Selbstverständnis ich bin entwicklungsfähig mit dem Menschenverständnis der Waldorfpädagogik identifiziert. Noch gelingt es den Vertretern der Waldorfpädagogik nicht, ihr Menschenverständnis so darzustellen, dass dessen allgemeine und aktuelle Brisanz allen deutlich würde. Noch leben ein Bedürfnis und eine Erfahrungswelt fast unverbunden nebeneinander. Die einen haben das Bedürfnis und die andern gehen schon lange mit seiner Erfüllung um. Sind wir darauf gefasst, dass man eines Tages die Koinzidenz sehen könnte? Dass man also plausible Antworten auf die Fragen, die schon heute immer mehr Menschen in sich tragen, gerade von uns erwarten wird? Sind wir darauf vorbereitet? Wir mussten es beispielsweise beim ökologischen Landbau erleben: Erst bleibt er lange in seiner»nische«und leidet unter Absatzschwierigkeiten, dann, ganz plötzlich, werden die Verbraucher wach und der Landbau kann die an ihn gerichteten Erwartungen bei weitem nicht erfüllen! Die Klärung von Menschenbild- Fragen ist jedenfalls seit einigen Jahrzehnten kein theoretisches Thema mehr. Sie wird immer mehr zur Grundlage von Lebenspraxis. 8 Das sind also zwei große gesamtgesellschaftliche Fragen, zu denen man Beiträge von der Rudolf-Steiner-Pädagogik erwarten darf. Es gibt für die nächste Zukunft wohl nur zwei Möglichkeiten: Entweder die Koinzidenz des Bedürfnisses mit der Erfahrung wird bemerkt dann werden wir auskunftspflichtig. Dann müssen wir eine Sprache finden, die die Menschen verstehen. Da können wir nicht einfach so von Ätherleib und Astralleib reden. Die Erziehungskunst 7/
4 andere Möglichkeit ist, dass die Menschen mit ihrem Bedürfnis nach Freiheit dessen Befriedigung woanders suchen, wie sich das vielfach bereits abzeichnet. Aus dieser Einsicht entstehen Aufgaben für uns in der Waldorfpädagogik. Neues Verständnis kindlicher Entwicklung Mit den hier beschriebenen Aufgaben sind die pädagogischen Themen im engeren Sinne noch gar nicht berührt. Der»PISA-Schock«vor einigen Jahren war die Fanfare für einen großen allgemeinen Aufbruch im Hinblick auf Kindererziehung. Von ganz grundlegenden Fragen sind die Zeitungen fast täglich voll. Wo hätte es einen solchen Aufbruch in den letzten Jahrzehnten schon einmal gegeben? Hier besteht die Chance, dass etwas in Gang kommen kann, das über die Schulpädagogik als solche weit hinausgeht. Die Zeit scheint reif für ein neues Verständnis kindlicher Entwicklung. Die Reaktion der Kultusministerien und ihrer Gegenspieler erscheint dem gegenüber eher hilflos. Da nun einmal unverhofft eine Gelegenheit öffentlicher Aufmerksamkeit gekommen ist, versucht jeder, seine alten Bäche auf die Mühlen einer Bildungsreform zu leiten. Vieles von dem, was hier neu ins öffentliche Bewusstsein kommt, geht andererseits in die Richtung, in der sich Waldorfpädagogik seit Jahrzehnten bewegt. An manchen Stellen hat man den Eindruck, wir müssten uns langsam anstrengen, um nicht überholt zu werden. Da fällt einem die alte Geschichte aus der DDR ein: Die Führung gab die Parole aus, man wolle die andere Seite (Westdeutschland)»überholen«. Als sich der (wirtschaftliche) Abstand aber jahrelang nicht verringerte, versuchte man es mit einer neuen Formel: Man wollte Westdeutschland überholen, ohne es einzuholen. Darüber lachte damals die ganze Welt (außer denen, die nicht lachen durften). Vielleicht muss dieses Bild im Hinblick auf die gegenwärtige pädagogische Situation einmal wiederbelebt werden? Was wird von Seiten der Waldorfpädagogik zu dieser öffentlichen Debatte, deren Gelegenheit bald wieder schwinden könnte, eigentlich beigetragen? Auf das pädagogische Problemfeld im engeren Sinne kann in diesem Zusammenhang nicht weiter eingegangen werden. Es sei jedoch verwiesen auf eine kleine Schrift von Bruno Sandkühler, die vor drei Jahren zu dieser Fragestellung verfasst wurde. 9 Darin finden sich besonnene Gesichtspunkte, offene Worte und vor allem Richtungen, in die die Bemühungen von Waldorf-Seite gehen könnten. Sie bietet hervorragende Orientierung für den ganzen Problemkomplex. Jugendimpulse Zuletzt noch ein anderes Problemfeld, das die Pädagogik im engeren Sinne übersteigt. Eine der größten Nöte in unserer Zeit ist die Not der Jugendlichen. Was bringen die Jugendlichen für vorgeburtliche Impulse mit, die sie dann hier manchmal nicht so richtig ausleben können? Können wir diese Impulse, die sie mitbringen, verstehen? Und können wir sie aufgreifen? Können wir die»günstigste Umgebung«10 für diese Impulse abgeben? Dazu gibt es bei denen, die sich mit der anthroposophischen Pädagogik beschäftigen, gute Voraussetzungen. Ich verweise nur auf drei Ansätze aus jüngster Zeit aus der Feder von Mona Doosry, Urs Dietler und Heinz Zimmermann. 11 Wenn wir diese Aufgabe nicht ergreifen: wer ergreift sie dann? Ich ende mit einer Ermahnung von George Bernard Shaw:»Man gibt immer den Verhältnissen die Schuld für das, was man ist. Ich glaube nicht an die Verhältnisse. Diejenigen, die in der Welt vorankommen, gehen hin und suchen sich die Verhältnisse, die sie wollen, und wenn sie sie nicht finden können, schaffen sie sie selbst.«in dieser Lage finden wir uns heute. Wir sind nicht angetreten, um unsere internen Probleme zu lösen, sondern um Avantgarde ei- 852 Erziehungskunst 7/8 2007
5 ner gesamtgesellschaftlichen Entwicklung zu werden. Das ist der Waldorfschule seit ihren ersten Tagen ausdrücklich aufgegeben. Die Aufgabe besteht unabhängig davon, wie weit sie ergriffen oder gar gelöst werden kann. Im vorigen Jahr haben sich einige verantwortlich Tätige an Waldorfschulen zu einer Pädagogischen Akademie zusammengefunden, um an Fragen dieser Art zusammenzuarbeiten. Sie freuen sich über alle, die sich an diesen Bemühungen beteiligen wollen. 12 Karl-Martin Dietz Anmerkungen: 1 Albert Schmelzer: Die Dreigliederungsbewegung 1919, Stuttgart 1991, S. 117, 125, 138; ferner Dietrich Esterl: Die erste Waldorfschule, Stuttgart 2006, S K.-M. Dietz / T. Kracht: Dialogische Führung, Frankfurt/New York Karl-Martin Dietz: Dialogische Schulführung an Waldorfschulen, Heidelberg 2006, S. 55 ff. Genaueres dazu demnächst in: Karl-Martin Dietz: Produktivität und Empfänglichkeit das Arbeitsprinzip des Geisteslebens (Arbeitstitel), Heidelberg Oswald Neuberger: Personalentwicklung, Stuttgart Näheres zu»erweckender Erziehung«,»Selbsterziehung«,»prophetischer Erziehung«und»Willenserziehung«: s. Karl-Martin Dietz: Erziehung in Freiheit. Rudolf Steiner über Selbständigkeit im Jugendalter, Heidelberg Rudolf Steiner: Die Philosophie der Freiheit (1894), GA 4 (1978), Kapitel IX 7 Näheres siehe Karl-Martin Dietz: Individualität im Zeitenschicksal, Stuttgart Siehe auch Karl-Martin Dietz: Die Wette um den Menschen, Heidelberg 2000, S Siehe dazu auch: Bruno Sandkühler: Aufgaben der Waldorfpädagogik nach PISA, Heidelberg Siehe Anm. 5, ebd., S Mona Doosry: Zwischen Pubertät und Mündigkeit, Heidelberg 2003; Urs Dietler: Jugend im Wandel Pädagogik im Umbruch, Heidelberg 2003; Heinz Zimmermann: Was kann die Pädagogik des Jugendalters zur Willenserziehung beitragen, Heidelberg Pädagogische Akademie am Hardenberg Institut, Hauptstraße 59, Heidelberg, Tel , Fax: , info@ paedagogische-akademie.de; Die FAZ und die Waldorfschulen Im Juni 2002 berichtete die FAZ, ihrer Redakteurin für evangelische Kirche, Schul- und Hochschulpolitik sei von der Evangelisch- Theologischen Fakultät der Universität Tübingen der Ehrendoktor der Theologie verliehen worden. Nun hat Heike Schmoll, die bisher zur Waldorfpädagogik schwieg, obwohl sich eine Vielzahl von Gelegenheiten geboten hätte, im Rahmen der PISA-Diskussion auch diese zu würdigen, einen Artikel mit dem Titel»Auf Rudolf Steiners Spuren«veröffentlicht. Ihre kleine Arbeit zeugt von dem Geist, dem sie ihre Ehrendoktorwürde verdankt, dem Geist des»selbstbewussten Protestantismus«. Heike Schmoll hat sich durch ihre Wortmeldung den ideologischen Gegnern der Waldorfschulen angeschlossen und manchen Kollegen von der theologischen Fakultät Schützenhilfe geleistet mit der Realität hat ihr Räsonnement über die Waldorfschulen jedoch wenig bis gar nichts zu tun. Das fängt schon damit an, dass sie von einer lauter werdenden öffentlichen Kritik an Waldorfschulen spricht, weil die ARD eine Sendung ausgestrahlt hat oder weil drei ehemalige Seminaristen ihre Unzufriedenheit mit einem Waldorflehrerseminar zum Ausdruck gebracht haben. Diese angebliche öffentliche Kritik richtet sich, wie Schmoll behauptet, vor allem gegen die Lehrerausbildung. Dass sie die»öffentliche Kritik«erst dadurch ins Leben ruft, dass sie ihren Artikel schreibt, muss nicht eigens hervorgehoben werden. Das gilt auch für den ebenfalls der evangelischen Kirche nahestehenden Rainer Fromm, der im Jahr 2006 eine Instantreportage für»frontal21«drehte. Und es gilt für Dietrich Krauss, den Autor der Sendung»Wie gut sind Waldorfschulen?«, der als sein Hobby den»klassenkampf«bezeichnet. Erziehungskunst 7/
6 Nehmen wir das Hauptproblem gleich vorweg: jene Autoren, die den Waldorfschulen vorwerfen, sie seien Weltanschauungsschulen und würden dies»verheimlichen«, tun dies, weil sie selbst bestimmten Weltanschauungen anhängen, die sie die anthroposophischen Grundlagen der Waldorfpädagogik ablehnen lassen. Nun ist nicht zu bezweifeln, dass jede Form von Unterricht auf Weltanschauung fußt, auch der Unterricht an staatlichen Regelschulen. Man muss sich nur einmal die Lehrpläne ansehen. Es gibt keinen weltanschaulich»neutralen«unterricht. Naturwissenschaftliche Fächer, Geschichte, Literatur fußen immer auf bestimmten Weltinterpretationen, die den Schülern implizit oder sogar explizit vermittelt werden. Der weltanschaulich neutrale Unterricht ist eine reine Fiktion. Zwar soll der Staat sich»weltanschaulich neutral«verhalten, indem er keine bestimmte Weltanschauung präferiert, aber dadurch setzt er gerade die Pluralität der individuellen Weltanschauungen frei, die auf diesem Weg ein Heimatrecht in den von ihm betriebenen Schulen erhalten. Die»weltanschauliche Neutralität«enthält im Grundsatz keine Vorentscheidung für oder gegen eine bestimmte Weltanschauung. Insofern geht der Vorwurf, die Waldorfschulen seien heimliche Weltanschauungsschulen schon aus prinzipiellen Gründen ins Leere. Schließlich ist die Forderung nach»weltanschaulicher Neutralität«auch nur als formales Prinzip durchführbar, aber nicht lebbar. Sie ist eine Leerform, die eine Parteinahme zugunsten bestimmter Weltanschauungen ausschließt, mehr nicht. Als Leitlinie staatlichen Handelns ist sie eine negative Maxime. Natürlich liegen darin einige Paradoxa, z.b., wie es sich mit der weltanschaulichen Neutralität des Staates vereinbaren lässt, dass er inhaltlich festgelegte Lehrpläne vorschreibt, von denen manche Inhalte eingeschlossen, andere aber ausgeschlossen werden. Dasselbe gilt für die Normen, von deren Erfüllung Zugangsberechtigungen zu Bildungswegen abhängig gemacht werden. Insoweit diese inhaltlich ausgefüllt sind, werden bestimmte Weltanschauungsinhalte normativ festgelegt, deren erfolgreiche Reproduktion den Zugang zu Bildungseinrichtungen ermöglicht. Von dieser Seite her unterläuft also der Staat mit seiner Bildungsverwaltung wiederum die auf der anderen Seite von ihm selbst geforderte weltanschauliche Neutralität. Zum Berufsethos der Waldorflehrer gehört, die anthroposophische Grundlage der Pädagogik (Menschenbild, Entwicklungspsychologie usw.) als methodisch-didaktisches Werkzeug zu handhaben, sie aber nicht zum Inhalt des Unterrichts zu machen. Entscheidend für die pädagogische Wirksamkeit und die Erfüllung der Bildungsaufgabe ist, wie unterrichtet wird, sekundär ist, was unterrichtet wird. Steiner forderte, die Schulen dürften nicht zur Anthroposophie erziehen. Dass dies in der Regel gelingt, hat erst jüngst eine empirische Untersuchung gezeigt, auf die weiter unten hingewiesen wird. Nicht abzustreiten ist, dass Waldorfschulen durch ihre anthroposophische Grundlage der Spiritualität gegenüber offen sind. Indem sie diese Offenheit gegenüber dem Transzendenten in ihre Curricula eingeschrieben haben, können sie eine Entwicklung der Schüler zu einer integralen Weltauffassung, die das bloße Diesseits transzendiert, nicht systematisch verhindern. Das macht diese Schulform gerade für Kulturen attraktiv, die noch in spirituellen Traditionen verwurzelt sind, wie in Asien oder auch in Afrika. Nur jemand, der in Offenheit für die Transzendenz generell etwas Verwerfliches sieht, z.b. Opium für das Volk, kann diese Grundhaltung kritisieren. Aber menschliche Existenz ohne Bezug zum Transzendenten dürfte auch für Heike Schmoll nicht wünschenswert sein. Schmoll zweifelt die Gleichwertigkeit der Ausbildung an Waldorflehrerseminaren an, weil diese im Gegensatz zu staatlichen Hochschulen»eher Erziehungskünstler«als»Wissensvermittler«heranziehen. Nun, was heißt gleichwertig? Wer urteilt über den gleichen 854 Erziehungskunst 7/8 2007
7 Wert? Schmoll scheint zu meinen, wenn etwas nicht gleichartig ist, dann kann es auch nicht gleichwertig sein, also auf ein anderes Gebiet übertragen: weil Schwarze und Weiße nicht gleichartig sind, können sie auch nicht gleichwertig sein. Wir Europäer haben uns mühsam zur Einsicht durchgerungen, dass etwas trotz seiner Ungleichartigkeit gleichwertig sein kann. Im Grunde ist die Unterstellung, der Erziehungskünstler sei dem Wissensvermittler nicht gleichwertig, eine Art von verkapptem Rassismus. Heike Schmoll beruft sich auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster vom 20. März 1993 zum Lehrerseminar Witten aber dieses Urteil ist längst veraltet. Das Bundesverwaltungsgericht hat am 23. Juni 1993 zugunsten der Gleichwertigkeit entschieden. Sie beruft sich auf Berliner Seminaristen, die von einer Steiner-Heiligenverehrung gesprochen haben. Na und? An jedem Universitätsinstitut gibt es die Verehrung der Autoritäten, das weiß jeder Absolvent, nicht nur einer theologischen Fakultät. So sehr und so gerne sich Schmoll einerseits auf den Staat, also auf die Obrigkeit beruft, wenn sie diese für ihre Argumentation benutzen kann, dass die Berliner Schulaufsicht die Kritik der Seminaristen»abgetan«hat, kommt ihr gar nicht zupass. Offenbar scheint die Berliner Schulaufsicht, die den Schulen ja näher steht als Heike Schmoll oder die Studienabbrecher, auf die sie sich beruft, doch den Eindruck zu haben, dass die Lehrkräfte an den Berliner Waldorfschulen als Erziehungskünstler ganz gut im Alltag der Schulen bestehen. Man muss allerdings auch daran erinnern, dass es nach dem Grundgesetz und gängiger Rechtsauffassung nicht die Aufgabe der staatlichen Schulverwaltung ist, fachliche Aufsicht über freie Schulen zu führen. Die von Steiner entwickelte anthroposophische Weltanschauung liegt dem Unterricht an Waldorfschulen zugrunde, behauptet Schmoll. Will sie damit suggerieren, dass sie diese Weltanschauung den Schülern vermitteln? Später greift sie dieses Motiv noch einmal auf, wenn sie behauptet, die Waldorfschulen seien nach Artikel 7 des Grundgesetzes»Weltanschauungsschulen«und dürften deshalb nach der anthroposophischen Lehre Rudolf Steiners unterrichten. Will sie behaupten, die Schulen unterrichteten die Lehre Steiners an die Schüler? Die neueste empirische Untersuchung zu diesem Thema jedenfalls,»absolventen von Waldorfschulen«, die von Heiner Barz und Dirk Randoll 2007 herausgegeben wurde, zieht das Fazit:»Der immer neu erhobene Vorwurf, Waldorfschule erziehe zur Anthroposophie, wird durch die Daten eindrücklich widerlegt.«stattdessen bescheinigen die Absolventen der Schule»eine hohe religiöse und weltanschauliche Offenheit.«Immerhin erwähnt Schmoll, dass die Waldorfschulen bestreiten, Weltanschauungsschulen zu sein. In der Tat werden in Deutschland Waldorfschulen aufgrund von Artikel 7 (5) GG nicht als»weltanschauungsschulen«genehmigt, sondern stets auf Grund des»besonderen pädagogischen Interesses«. Dieser Bestimmung, die sich auf Volksschulen bezieht, ist jedoch Absatz 4 vorgelagert, der die Errichtungsgarantie für freie Schulen enthält. Die Besonderheit der Waldorfschulen ist, dass sie eine besondere pädagogische Methodik praktizieren, die von der üblichen abweicht. Diese Methodik fußt allerdings auf Weltanschauung, und es ist deswegen nicht verwunderlich, dass Waldorflehrer mit dieser Art die Welt anzuschauen, vertraut gemacht werden, sonst könnten sie ja das Spezifische der Methodik überhaupt nicht praktizieren. Auch die Klassenlehrer, die als vorbildhafte Autoritäten den Heranwachsenden moralische Orientierung vermitteln, sind ein Bestandteil dieser Methodik. In der Tat versteht sich ein Klassenlehrer in der Unter- und Mittelstufe nicht in erster Linie als Wissensvermittler, sondern als Erziehungskünstler, der die ihm anvertrauten Kinder möglichst umfassend in die Welt, in der sie leben, einführt, so wie sie sich in seiner Persönlichkeit spiegelt. Im übrigen stehen den Klassenlehrern eine ganze Erziehungskunst 7/
8 Reihe von so genannten Fachlehrern zur Seite, die in denselben Klassen unterrichten. Dass Schmoll über Diplomarbeiten von Lehrern herzieht und diese in aller Öffentlichkeit lächerlich macht, grenzt schon ans Skandalöse. Wie kommt sie eigentlich an diese persönlichen Arbeiten von Seminaristen? Aber hat sie denn die Voraussetzungen, das Spezifische an diesen Arbeiten zu beurteilen? Dass über Goethes Urpflanze»spekuliert«wird: ist das anrüchig? Ist die Urpflanze selbst anrüchig oder Goethe? An wie vielen philosophischen oder germanistischen Seminaren werden gleichartige Themen behandelt, oder sogar als Gegenstände von Magisterarbeiten und Dissertationen herangezogen? Man sehe sich daraufhin nur einmal die Abschlussarbeiten von theologischen Fakultäten an! Nun aber: die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften»beschäftigt sich mit dem Unterricht an Waldorfschulen«? Seit wann ist denn die Bundesprüfstelle für die Aufsicht über den Unterricht an Schulen zuständig? Eine ziemlich abwegige Formulierung für das, was die Bundesprüfstelle tatsächlich tut. Sie hat nämlich ein Buch von Ernst Uehli für eine Begutachtung in Betracht gezogen, das mit vielen anderen auf einer Literaturliste stand, die Waldorflehrern von der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen zur Verfügung gestellt wurde. Ernst Uehli gehörte zu den ersten Waldorflehrern an der Stuttgarter Schule seit 1919 und schrieb auch Bücher, unter anderem das inkriminierte Buch über das»rätsel der Eiszeitkunst«, das 1935 erstmals erschien. Damals schrieb und redete man in einem ganz anderen Stil über so genannte Rassenfragen, nicht nur im Kontext der NS-Rassenauffassungen, sondern überall auf der Welt in den biologischen und vielen anderen Fakultäten. Nun wurde das Buch nicht einmal für den Geschichtsunterricht empfohlen, sondern lediglich als mögliche Literatur angeführt, allerdings nicht wegen des Rassenthemas, sondern wegen der sonstigen darin enthaltenen geschichtlichen Darstellungen (insbesondere die der Eiszeitkunst). Jene ideologischen Kritiker der Waldorfschulen, die mit immensem Eifer versuchen, sie in ein Zwielicht zu rücken, haben diese Literaturlisten ausgegraben und mittels der Technik der Denunziation den Antrag auf Überprüfung bei der Bundesprüfstelle veranlasst. Wie dem auch sei: Es trifft weder zu, dass der Bund der Freien Waldorfschulen das Buch nach heftiger öffentlicher Kritik aus dem Verkehr gezogen hätte, noch dass die Bundesprüfstelle weiterhin vorhat, das Buch»abzusetzen«, was immer das auch sein mag. Die»heftige Kritik«ist eine Erfindung Schmolls. Der Bund der Freien Waldorfschulen konnte das Buch gar nicht zurückziehen, weil er ja auch nicht der Herausgeber oder Verleger war. Der Verleger, der mit den Waldorfschulen nichts zu tun hat, hat vielmehr das Buch vom Markt genommen. Danach hat sich auch die Begutachtung durch die Bundesprüfstelle erübrigt. Die Waldorfschulen arbeiten schon seit über 80 Jahren in Deutschland, in vielen anderen europäischen Ländern und in der übrigen Welt. Die Anzahl der Schulen hat sich seither kontinuierlich vergrößert. Eine ganze Reihe dieser Schulen in verschiedenen europäischen Ländern sind wegen ihres vorbildlichen Einsatzes für internationale Verständigung, Nachhaltigkeit und interkulturelles Lernen, für Themen wie Menschenrechte, Umweltschutz und Toleranz als UNESCO-Projekt-Schulen anerkannt. Jeder vernünftige Mensch muss sich doch fragen, wie diese Erfolgsgeschichte möglich ist, wenn sich die Waldorfpädagogik nicht in der Praxis bewähren würde. An all diesen Schulen arbeiten Lehrer, die gleichwertige, nicht gleichartige Ausbildungsgänge durchlaufen haben und ihre Schüler zu Abitursnoten führen, von denen die staatlichen nur träumen können. Es scheint, dass die Erziehungskünstler wohl auch im Stande gewesen sein müssen, ihren Schülern Wissen zu vermitteln. Lorenzo Ravagli 856 Erziehungskunst 7/8 2007
9 Nah-Todes- Erfahrungen Interview mit Iris Paxino-Gresser Erlebnisse an der Todesschwelle sind Grenzerfahrungen, die seit Jahrtausenden die Menschheitsgeschichte begleiten. Seit dem 20. Jahrhundert häufen sich weltweit die Berichte über die individuelle Begegnung des Menschen mit dem Tod. Wissenschaft und Forschung beginnen, dieses Phänomen eingehend zu untersuchen, geben ihm einen Namen (Nah-Todes-Erfahrungen) und stellen es in den Mittelpunkt zahlreicher Studien. Dr. Iris Paxino-Gresser (1970) studierte Psychologie, Pädagogik und Literaturwissenschaft in Stuttgart und Tübingen und promvierte zum Thema Nah-Todes-Erfahrungen, unterrichtete als Waldorflehrerin, war als psychologische Beraterin im Paracelsus Krankenhaus Unterlengenhardt tätig und arbeitet zur Zeit in der Geschäftsleitung der Haußerstiftung und in ihrer eigenen psychologischen Praxis in Stuttgart. Frau Gresser, Sie sind Psychologin. Was hat Sie dazu gebracht, sich mit dem speziellen Thema der Nah-Todes-Erfahrungen (NTE) zu befassen? In der persönlichen Begegnung und in der therapeutischen Arbeit mit Menschen erlebt man auf vielfältige und intensive Weise, dass jede Biografie durch die unterschiedlichsten Wandlungs- und Veränderungsprozesse hindurchgeht. Hierin stellen Schwellensituationen Entwicklungsschritte, ja sogar -sprünge der eigenen Selbstwerdung dar. Krisensituationen, Krankheitsprozesse und Grenzerleb- nisse vollziehen sich stets in der Verflechtung von Werden und Vergehen, von Sterben und Neugeburt. Die konkrete Grenze zwischen Leben und Tod ist eine der markantesten und entscheidendsten Schwellen, nicht nur vom physiologischen, sondern auch vom entwicklungspsychologischen Standpunkt her. Auch hier befindet sich die betroffene Person in einem individuell bedeutenden Werdeprozess; es ist eine unmittelbare Selbstbegegnung, die einerseits einen bewussten Rückblick auf den bereits gestalteten Lebenslauf als auch einen vorbereitenden Blick auf den Schwellenübergang ermöglicht. Was ist eine NTE und wie wird sie von den Betroffenen erlebt? Allgemein werden Nah-Todes-Erfahrungen als Grenzerlebnisse von Menschen geschildert, die klinisch tot oder dem Tod sehr nahe waren, sich nach eigenen Aussagen außerkörperlich wahrgenommen und durch ein körperfreies Bewusstsein eine andere Realität erlebt haben. Zu dieser anderen Realität können Begegnungen mit verstorbenen Angehörigen oder mit unterschiedlichen Lichtgestalten gehören. Häufig wird auch von einem Lebensrückblick berichtet, in dem der Erlebende in panoramaartiger Weise sein Leben überschaut. Diese Erfahrungen scheinen bezüglich ihres Aufbaus und ihrer Erlebniskomponenten einem gemeinsamen Muster zu folgen, obwohl Essenz und Inhalt von individueller Qualität ist. Die Menschen, die davon berichten, beschreiben, dass sie sich außerhalb ihres Körpers wahrnehmen, obwohl ihr physischer Körper bewusstlos ist, beziehungsweise in zahlreichen Fällen vom medizinischen Personal als klinisch tot deklariert wird. Sie sprechen weiter von Einblicken in eine friedvolle Welt, die von wundersamen Farben und Klängen geprägt ist, die von einer überwältigenden Liebe und einem tiefen Verständnis erfüllt ist. Verstorbene Verwandte empfangen ge- Erziehungskunst 7/
10 meinsam mit anderen Lichtgestalten den»neuankömmling«. In einzelnen Fällen wird auch ein zutiefst beeindruckendes, lichtvolles Geistwesen beschrieben, das den Sterbenden in Licht und Liebe einhüllt und das ihm in einer Rückschau sein gesamtes bisheriges Leben zeigt. Das Leben nach der unerwarteten und meist unerwünschten Rückkehr ist ein im Empfinden, Denken und Handeln verändertes. Die meisten NTE-Betroffenen, mit denen ich bisher gesprochen habe, beschreiben dieses Erlebnis als die bewegendste und erhöhendste Erfahrung ihres Lebens. Gibt es typische Kennzeichen? Ja, typische Merkmale von NTE sind das Verlassen des physischen Leibes und konkrete Wahrnehmungen des Geschehens um den eigenen leblosen Körper (so genannte Außerleiblichkeitserfahrungen), dann der Durchgang durch einen Tunnel, der Eintritt in eine Welt, in der die bereits erwähnte Begegnung mit unterschiedlichsten geistigen Gestalten stattfinden kann, sowie die relativ häufig auftretende Lebensrückschau. Charakteristisch für Erlebnisse an der Todesschwelle sind eine veränderte Zeitwahrnehmung und ein intaktes Ich-Bewusstsein, das zu Selbstreflexion und zu einer selektiven Wahrnehmung fähig ist. Erstaunlich ist auch, dass die Erinnerung an dieses Erlebnis nicht verblasst, der innere Eindruck bleibt auch über Jahrzehnte hinweg in einer Klarheit erhalten, die ansonsten auch bei besonderen Träumen oder bei anderen geistigen Erlebnissen nicht in dieser Weise bleibt. Tritt die Nahtodeserfahrung vor allem bei besonderen Menschen auf? Die Ergebnisse aller bisherigen Studien weisen darauf hin, dass es keinen Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Nah-Todes-Erfahrungen und kulturellen Einflüssen bzw. Persönlichkeitsvariablen gibt. Das bedeutet, dass Religionszugehörigkeit, Weltanschauung, soziale Schicht, regionale Herkunft, Erziehung, Temperament, Charaktereigenschaften, Familienstand, Beruf, Vorwissen über NTE usw. keine Rolle beim Auftreten solcher Erlebnisse spielen. Ebenfalls wurde bereits in den 1980er Jahren festgestellt, dass Menschen mit Erlebnissen an der Todesschwelle hinsichtlich der psychischen Gesundheit ganz dem Bevölkerungsdurchschnitt entsprechen und diesbezüglich keinerlei Auffälligkeiten aufweisen. Es kann also kein»typus«ausgemacht werden, der für das Auftreten solcher Erlebnisse prädestiniert ist. Im Übrigen, es herrscht noch heute die Vorstellung, dass es sich um Ausnahme-Erfahrungen handelt. Doch groß angelegte Untersuchungen in den USA, in Deutschland und Holland ergeben, dass ca. 4% bis 5% der gesamten Bevölkerung solche Erlebnisse hat! Hat die Nahtodeserfahrung Auswirkungen auf das weitere Leben der Betroffenen? Ja, in der Tat prägen solche Erlebnisse entscheidend das weitere Leben der Betroffenen. Ausnahmslos alle Menschen mit NTE berichten, dass sie die Angst vor dem Tod verloren haben. Weiter findet ein Wertewandel statt, der ihnen ermöglicht, das Leben in all seinen Facetten zu schätzen und besser anzunehmen. Sie entwickeln mehr Verständnis, Mitgefühl und Empathie für ihre Mitmenschen, ihr Interesse für geistig-spirituelle Fragen steigt, die Gewissheit um die Existenz einer den Menschen immer umgebenden geistigen Wirklichkeit verleiht ihrem Lebensverständnis einen erweiterten Sinn. Die Bedeutung der Liebe, der Selbstverantwortung in jeder Handlung und Begegnung sowie die Verbundenheit von Mensch und Welt werden in den Gesprächen mit diesen Menschen stets stark hervorgehoben. Haben solche subjektiven Erlebnisse einen allgemeinen Aussagewert? 858 Erziehungskunst 7/8 2007
11 Ja, einen entscheidenden sogar. Es geht hier nicht um theoretische Erkenntnisse, sondern um wahrhaftige Erlebnisse, um innere Lebenswirklichkeiten. Trotz oder gerade wegen des tief individuellen Charakters solcher Erfahrungen haben diese eine Aussagekraft bezüglich des allgemeinen Mensch-Seins. In einer Zeit, in der Hypothesenbildungen weitgehend die Vorstellungen, den Glauben, das Denken, Fühlen und Handeln unserer Gesellschaft prägen, ist es von großer Bedeutung, dass tief menschlich Erlebtes die eigenen inneren Wirklichkeiten wieder aufdeckt und zu Bewusstsein führt. Welche Bedeutung haben diese Erlebnisse für sich selbst? Persönlich habe ich die langjährige Auseinandersetzung mit dieser Thematik als eine entscheidende Bereicherung und Erweiterung meines eigenen Lebens und Wesens erlebt. Jede Begegnung mit NTE-Betroffenen ist mir als besonderes und einzigartiges Geschenk geblieben. Das innere Licht, das von jeder dieser Erfahrungen ausgeht, lässt einen die unmittelbare Gegenwart einer höheren Wahrheit erspüren. Wie geht die Wissenschaft mit diesen Schilderungen um? Die naturwissenschaftlich ausgerichteten Disziplinen ringen noch um eine Deutung dieses Phänomens. Das Bewusstseinskonzept der klassischen Neurologie basiert auf der Annahme, dass das Bewusstsein eine biochemisch-neurologische Funktion des Gehirns darstellt. Von dieser Grundlage ausgehend, werfen solche Erlebnisse für die Medizin und für weite Bereiche der Psychologie ungelöste Fragen auf. Die in diesen Wissenschaftsbereichen entstehenden Hypothesenbildungen tendieren zu einer Psychopathologisierung des Phänomens. Sie sind jedoch nicht in der Lage, umfassende Erklärungsmuster für diese Erlebnisse zu liefern, auch können sie nicht die überwiegend positiven und persönlichkeitskonsolidierenden Auswirkungen von Erlebnissen an der Todesschwelle erklären. Bemerkenswert ist jedoch, dass gerade diejenigen Forscher, die unmittelbar vom NTE- Erlebnis ausgehen und ohne bestimmte Theorien vertreten zu wollen das Phänomen als solches darstellen und untersuchen, auf die zwingende Notwendigkeit einer Überprüfung bestehender Bewusstseinshypothesen aufmerksam machen. Auch wenn diese Forscher bisher noch eine Minderheit darstellen, werden tendenziell die Stimmen deutlicher, die das Dogma einer materialistischen Wissenschaft in Frage stellen. Ich gehe davon aus, dass in den kommenden Jahrzehnten dramatische Veränderungen diesbezüglich stattfinden werden. Müssten Konsequenzen aus diesen Berichten gezogen werden und wenn, dann welche und wo? Wenn man mit Menschen spricht, die Erlebnisse an der Todesschwelle gehabt haben, ist es erschütternd zu erfahren, wie vielen Vorurteilen, Fehleinschätzungen und auch Diskriminierungen sie ausgesetzt wurden. Der Großteil der Studien überprüft erst die»psychische Gesundheit«der Betroffenen, d.h. in erster Linie wird untersucht, ob diese Menschen neurotisch oder psychotisch sind, ob es hier um Halluzinationen, Wunschvorstellungen oder Einbildungen geht, ob sie sich wichtig machen wollen usw. Obwohl eine dreißigjährige, weltweite Forschung belegt, dass das Persönlichkeitsprofil von NTE-Erlebenden ein absolut normales ist, begegnet man diesen Menschen sowohl in der Wissenschaft als auch in der Gesellschaft noch immer mit Misstrauen. Die meisten NTE-Erlebenden fühlen sich tief davon betroffen und verschweigen verständlicherweise lieber ihr Erlebnis. Ich denke, dass es diesbezüglich an der Zeit ist, in einer anderen Weise mit diesen Berichten und Erziehungskunst 7/
12 vor allem mit diesen Menschen umzugehen. Für die wissenschaftliche Forschung bleibt weiterhin die Aufgabe, das Verhältnis von Gehirn und Bewusstsein zu untersuchen. Genau hier muss die weitere Forschung ansetzen und den Mut haben, Erklärungstheorien zu entwickeln, die dem tatsächlichen Phänomen entsprechen. Die Mentalität,»dass nicht sein kann, was nicht sein darf«, ist mehr als antiquiert. Also finden Sie Veranstaltungen sinnvoll, wie den im September in Berlin stattfindenden Kongress zum Thema»Nah-Tod- Erlebnisse«? Bild: Ninetta Sombart NAH-TOD-ERLEBNISSE Blick in eine andere Wirklichkeit? Kongress in Berlin 14. September 2007 Urania, Humboldtsaal bis Uhr Mit Wissenschaftlern, Betroffenen und Ärzten im Gespräch Vorträge, Podium, Plenumsgespräche Dr. med. Matthias Girke, Dr. med. Michaela Glöckler Dr. Iris Paxino-Gresser, Dr. med. Pim van Lommel Moderation: Annette Bopp Information und Anmeldung: gesundheit aktiv. anthroposophische heilkunst e.v. Tel.: Fax: Ethik des Sterbens Würde des Lebens Es ist von Bedeutung, dass Kongresse und Veranstaltungen einen Rahmen bieten, in dem sich zeitgenössische Natur- und Geisteswissenschaft, Betroffene und Interessierte in einer offenen und fördernden Weise begegnen können. Der gegenseitige Austausch ermöglicht Wahrnehmung, Gespräch, das Stellen von Fragen, das Annehmen anderer Perspektiven, die Erweiterung der eigenen Sichtweise. Es geht nicht lediglich um Informationsaustausch, sondern auch um ein menschliches Sich-gegenseitig-Erleben. Selbst aus der NTE-Forschung kommend begrüße ich z.b. sehr, dass ein Wissenschaftler wie Dr. Pim van Lommel, den Kongress als Referent mitgestaltet. Er hat in den letzten Jahren im europäischen Raum mit die fundiertesten Studien durchgeführt, darüber hinaus ist er ein kritischer Fragender bezüglich bestehender Bewusstseinstheorien. Gleichzeitig wird sowohl ein fruchtbarer Austausch mit Vertretern der anthroposophischen Medizin und Geisteswissenschaft als auch mit Menschen, die aus eigenem Erleben über Erfahrungen an der Grenze des Todes berichten, ermöglicht. Solche Veranstaltungen entsprechen der zeitgenössischen Sehnsucht nach zwischenmenschlicher Begegnung, sie sind sowohl was die Thematik angeht, als auch was die Gestaltung betrifft im wahrsten Sinne des Wortes»am Puls der Zeit«. 860 Erziehungskunst 7/8 2007
Inhalt. I. Waldorfschulen im Kontext ihrer Zeit. Vorwort 11
 Inhalt Vorwort 11 I. Waldorfschulen im Kontext ihrer Zeit Waldorfschulen aktuelle Fragen, neue Herausforderungen 17 Wer seinen Namen tanzen kann 17 Themen der aktuellen Bildungsdiskussion der Beitrag der
Inhalt Vorwort 11 I. Waldorfschulen im Kontext ihrer Zeit Waldorfschulen aktuelle Fragen, neue Herausforderungen 17 Wer seinen Namen tanzen kann 17 Themen der aktuellen Bildungsdiskussion der Beitrag der
darstellen und alternativ weiterführen. Für diejenigen, die sich nicht mit einer oberflächlichen Rede von der quantenphysikalisch erweiterten
 darstellen und alternativ weiterführen. Für diejenigen, die sich nicht mit einer oberflächlichen Rede von der quantenphysikalisch erweiterten Wirklichkeit zufriedengeben möchten, bohren wir mit anschaulichen
darstellen und alternativ weiterführen. Für diejenigen, die sich nicht mit einer oberflächlichen Rede von der quantenphysikalisch erweiterten Wirklichkeit zufriedengeben möchten, bohren wir mit anschaulichen
Klemens Schaupp. Ein spiritueller Übungsweg. echter
 Klemens Schaupp Ein spiritueller Übungsweg echter Inhalt 1. Einleitung................................. 7 2. Grundbedürfnisse und menschliche Entwicklung.............................. 13 3. Der Übungsweg...........................
Klemens Schaupp Ein spiritueller Übungsweg echter Inhalt 1. Einleitung................................. 7 2. Grundbedürfnisse und menschliche Entwicklung.............................. 13 3. Der Übungsweg...........................
Herzlich willkommen zum Vortrag von. Prof. Dr. Friedrich Schweitzer Universität Tübingen
 Herzlich willkommen zum Vortrag von Prof. Dr. Friedrich Schweitzer Universität Tübingen Verfassungsauftrag christliche Gemeinschaftsschule Oder: Von der alten zur neuen Gemeinschaftsschule LV Baden-Württemberg
Herzlich willkommen zum Vortrag von Prof. Dr. Friedrich Schweitzer Universität Tübingen Verfassungsauftrag christliche Gemeinschaftsschule Oder: Von der alten zur neuen Gemeinschaftsschule LV Baden-Württemberg
Das Fach Praktische Philosophie wird im Umfang von zwei Unterrichtsstunden in der 8./9. Klasse unterrichtet. 1
 Werrestraße 10 32049 Herford Tel.: 05221-1893690 Fax: 05221-1893694 Schulinternes Curriculum für das Fach Praktische Philosophie in der Sekundarstufe I (G8) (in Anlehnung an den Kernlehrplan Praktische
Werrestraße 10 32049 Herford Tel.: 05221-1893690 Fax: 05221-1893694 Schulinternes Curriculum für das Fach Praktische Philosophie in der Sekundarstufe I (G8) (in Anlehnung an den Kernlehrplan Praktische
Religionsunterricht wozu?
 Religionsunterricht wozu? Mensch Fragen Leben Gott Beziehungen Gestalten Arbeit Glaube Zukunft Moral Werte Sinn Kirche Ziele Dialog Erfolg Geld Wissen Hoffnung Kritik??? Kompetenz Liebe Verantwortung Wirtschaft
Religionsunterricht wozu? Mensch Fragen Leben Gott Beziehungen Gestalten Arbeit Glaube Zukunft Moral Werte Sinn Kirche Ziele Dialog Erfolg Geld Wissen Hoffnung Kritik??? Kompetenz Liebe Verantwortung Wirtschaft
Wie man ein besserer Mensch ist
 1 Gemeinsam kreativ werden Zusammenarbeit an Waldorfschulen durch den Logos Ein Beitrag der Pädagogischen Akademie am Hardenberg Institut zum Kongress 2012 über Selbstverwaltung in Flensburg Zahlreiche
1 Gemeinsam kreativ werden Zusammenarbeit an Waldorfschulen durch den Logos Ein Beitrag der Pädagogischen Akademie am Hardenberg Institut zum Kongress 2012 über Selbstverwaltung in Flensburg Zahlreiche
Auf dem Weg vom Bewusstsein zum Geist (Nachwort von Pietro Archiati)
 Auf dem Weg vom Bewusstsein zum Geist (Nachwort von Pietro Archiati) Man kann aus verschiedenen Gründen von einer Sonderstellung der Anthroposophie in der modernen Menschheit sprechen. Sie baut auf der
Auf dem Weg vom Bewusstsein zum Geist (Nachwort von Pietro Archiati) Man kann aus verschiedenen Gründen von einer Sonderstellung der Anthroposophie in der modernen Menschheit sprechen. Sie baut auf der
Leitbild der Kita St. Elisabeth
 Leitbild der Kita St. Elisabeth Unser Christliches Menschenbild Die Grundlage unseres christlichen Glaubens ist die biblische Offenbarung und die Überlieferung durch die Kirche. Wir Menschen sind Geschöpfe
Leitbild der Kita St. Elisabeth Unser Christliches Menschenbild Die Grundlage unseres christlichen Glaubens ist die biblische Offenbarung und die Überlieferung durch die Kirche. Wir Menschen sind Geschöpfe
Nahtoderfahrungen. Dr.med. Walter Meili. Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie Basel
 Nahtoderfahrungen Dr.med. Walter Meili Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie Basel Was ist eine Nahtoderfahrung Nahtoderfahrungen sind tief greifende psychische Erfahrungen mit transzendenten und
Nahtoderfahrungen Dr.med. Walter Meili Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie Basel Was ist eine Nahtoderfahrung Nahtoderfahrungen sind tief greifende psychische Erfahrungen mit transzendenten und
Das anthroposophische Menschenbild Rudolf Steiners als Grundlage der Waldorfpädagogik
 Pädagogik Daniela Hammerschmidt Das anthroposophische Menschenbild Rudolf Steiners als Grundlage der Waldorfpädagogik Studienarbeit Johannes Gutenberg Universität MainzSommersemester 2006 Pädagogisches
Pädagogik Daniela Hammerschmidt Das anthroposophische Menschenbild Rudolf Steiners als Grundlage der Waldorfpädagogik Studienarbeit Johannes Gutenberg Universität MainzSommersemester 2006 Pädagogisches
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Das Gewissen. Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Das Gewissen Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de RAAbits Hauptschule 7 9 Religion/Ethik 48 Das Gewissen 1 von
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Das Gewissen Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de RAAbits Hauptschule 7 9 Religion/Ethik 48 Das Gewissen 1 von
Ansprache zum 25. Geburtstag der Freien Waldorfschule am Bodensee in Überlingen-Rengoldshausen Seite 1
 Seite 1 Sehr geehrte Gäste, liebe Freunde unserer Schule, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich heiße Sie im Namen unserer Schulgemeinschaft herzlich willkommen
Seite 1 Sehr geehrte Gäste, liebe Freunde unserer Schule, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich heiße Sie im Namen unserer Schulgemeinschaft herzlich willkommen
Meine lieben Freunde! Es ist mir eine große Befriedigung,
 Zur Einführung Rudolf Steiner über seine öffentlichen Vorträge Dornach, 11. Februar 1922 Meine lieben Freunde! Es ist mir eine große Befriedigung, Sie nach längerer Zeit wieder hier begrüßen zu können,
Zur Einführung Rudolf Steiner über seine öffentlichen Vorträge Dornach, 11. Februar 1922 Meine lieben Freunde! Es ist mir eine große Befriedigung, Sie nach längerer Zeit wieder hier begrüßen zu können,
Der metaethische Relativismus
 Geisteswissenschaft Julia Pech Der metaethische Relativismus Was spricht für/gegen eine relativistische Position in der Moral? Essay Julia Pech 8.5.2011 Universität Stuttgart Proseminar: Einführung in
Geisteswissenschaft Julia Pech Der metaethische Relativismus Was spricht für/gegen eine relativistische Position in der Moral? Essay Julia Pech 8.5.2011 Universität Stuttgart Proseminar: Einführung in
LEITARTIKEL: Geistiges Heilen - Selbstbefreiung und Selbstheilung ein Interview
 LEITARTIKEL: Geistiges Heilen - Selbstbefreiung und Selbstheilung ein Interview mit: Angela Broda Angela Broda Dipl.-Betriebswirtin (DH) Systemische Beraterin Karriereberaterin und Coach Wölflinstr. 20,
LEITARTIKEL: Geistiges Heilen - Selbstbefreiung und Selbstheilung ein Interview mit: Angela Broda Angela Broda Dipl.-Betriebswirtin (DH) Systemische Beraterin Karriereberaterin und Coach Wölflinstr. 20,
Leitlinien für eine professionelle anthroposophische Pflegepraxis
 Leitlinien für eine professionelle anthroposophische Pflegepraxis Einleitung Das Internationale Forum für Anthroposophische Pflege, das nationale anthroposophische Pflegeorganisationen in aller Welt vertritt,
Leitlinien für eine professionelle anthroposophische Pflegepraxis Einleitung Das Internationale Forum für Anthroposophische Pflege, das nationale anthroposophische Pflegeorganisationen in aller Welt vertritt,
Pestalozzi-Gymnasium Unna im Januar Schulinternes Curriculum Praktische Philosophie für die Jahrgangsstufen 9 und 10 bzw.
 Pestalozzi-Gymnasium Unna im Januar 2010 Schulinternes Curriculum Praktische Philosophie für die Jahrgangsstufen 9 und 10 bzw. 8 und 9: Fragenkreis 1. Die dem Selbst Körper Leib Seele Freiheit ( obligatorisch)
Pestalozzi-Gymnasium Unna im Januar 2010 Schulinternes Curriculum Praktische Philosophie für die Jahrgangsstufen 9 und 10 bzw. 8 und 9: Fragenkreis 1. Die dem Selbst Körper Leib Seele Freiheit ( obligatorisch)
Das erste Mal Erkenntnistheorie
 Das erste Mal... Das erste Mal...... Erkenntnistheorie Systemische Therapie hat nicht nur theoretische Grundlagen, sie hat sich in der letzten Dekade auch in verschiedene Richtungen und Ansätze aufgesplittert
Das erste Mal... Das erste Mal...... Erkenntnistheorie Systemische Therapie hat nicht nur theoretische Grundlagen, sie hat sich in der letzten Dekade auch in verschiedene Richtungen und Ansätze aufgesplittert
Inhalt. Existenzphilosophie und Pädagogik. Versuch über unstetige Formen der Erziehung. Einleitung. II. Die Erweckung
 Inhalt Vorwort der Herausgeber zur Studienausgabe Zur Einführung in Band 8 Existenzphilosophie und Pädagogik. Versuch über unstetige Formen der Erziehung Einleitung 1. Die pädagogische Situation der Gegenwart
Inhalt Vorwort der Herausgeber zur Studienausgabe Zur Einführung in Band 8 Existenzphilosophie und Pädagogik. Versuch über unstetige Formen der Erziehung Einleitung 1. Die pädagogische Situation der Gegenwart
KATHOLISCHE KINDERTAGESSTÄTTE ST. ALBERT LONDONER RING LUDWIGSHAFEN
 KATHOLISCHE KINDERTAGESSTÄTTE ST. ALBERT LONDONER RING 52 67069 LUDWIGSHAFEN 1. ALLGEMEINER TEIL DER KINDERTAGESSTÄTTEN ST. ALBERT, MARIA KÖNIGIN, ST. MARTIN 1 & ST. MARTIN 2 SEITE 2 TRÄGERSCHAFT DIE TRÄGERSCHAFT
KATHOLISCHE KINDERTAGESSTÄTTE ST. ALBERT LONDONER RING 52 67069 LUDWIGSHAFEN 1. ALLGEMEINER TEIL DER KINDERTAGESSTÄTTEN ST. ALBERT, MARIA KÖNIGIN, ST. MARTIN 1 & ST. MARTIN 2 SEITE 2 TRÄGERSCHAFT DIE TRÄGERSCHAFT
ALLGEMEINE ZIELE / LEITIDEEN THEMENSCHWERPUNKTE / ZIELE UND INHALTE 2. ARBEITS- UND DENKWEISE AUSBILDEN 3. HALTUNGEN ENTWICKELN
 I N H A L T ALLGEMEINE ZIELE / LEITIDEEN 1. ZUSA M M ENHÄ N GE ERKEN NEN - > 2. ARBEITS - U N D DENKW EISE AUSBILDEN - > 3. HALTU N GEN ENTWICKELN - > THEMENSCHWERPUNKTE / ZIELE UND INHALTE 1. 2. 3. 4.
I N H A L T ALLGEMEINE ZIELE / LEITIDEEN 1. ZUSA M M ENHÄ N GE ERKEN NEN - > 2. ARBEITS - U N D DENKW EISE AUSBILDEN - > 3. HALTU N GEN ENTWICKELN - > THEMENSCHWERPUNKTE / ZIELE UND INHALTE 1. 2. 3. 4.
Leitbild des Max Mannheimer Studienzentrums
 Leitbild des Max Mannheimer Studienzentrums 1. Einleitung 2. Zielgruppen unserer Bildungsangebote 3. Inhalte und Ziele unserer Arbeit 4. Grundsätze für das Lernen 1 1. Einleitung Das Max Mannheimer Studienzentrum
Leitbild des Max Mannheimer Studienzentrums 1. Einleitung 2. Zielgruppen unserer Bildungsangebote 3. Inhalte und Ziele unserer Arbeit 4. Grundsätze für das Lernen 1 1. Einleitung Das Max Mannheimer Studienzentrum
Inhalt. I. Historischer Rückblick Die deutsche Pädagogik im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts
 Inhalt Vorwort der Herausgeber zur Studienausgabe Zur Einführung in Band 7 Anthropologische Pädagogik Vorwort I. Historischer Rückblick Die deutsche Pädagogik im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts 1.
Inhalt Vorwort der Herausgeber zur Studienausgabe Zur Einführung in Band 7 Anthropologische Pädagogik Vorwort I. Historischer Rückblick Die deutsche Pädagogik im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts 1.
Eine Waldorfschule für das Mühlenbecker Land. Die Elterninitiative Schulfreude e.v. stellt sich vor.
 Eine Waldorfschule für das Mühlenbecker Land Die Elterninitiative Schulfreude e.v. stellt sich vor. Das sind wir Über 35 Eltern mit insgesamt 60 Kindern Viele beigeisterte Menschen, die uns zusätzlich
Eine Waldorfschule für das Mühlenbecker Land Die Elterninitiative Schulfreude e.v. stellt sich vor. Das sind wir Über 35 Eltern mit insgesamt 60 Kindern Viele beigeisterte Menschen, die uns zusätzlich
Rezension zum Aufsatz von Wolfgang Klafki: "Studien zur Bildungstheorie und Didaktik"
 Pädagogik Simone Strasser Rezension zum Aufsatz von Wolfgang Klafki: "Studien zur Bildungstheorie und Didaktik" Rezension / Literaturbericht Rezension zum Aufsatz von Wolfang Klafki: Studien zur Bildungstheorie
Pädagogik Simone Strasser Rezension zum Aufsatz von Wolfgang Klafki: "Studien zur Bildungstheorie und Didaktik" Rezension / Literaturbericht Rezension zum Aufsatz von Wolfang Klafki: Studien zur Bildungstheorie
1. Grundlagen der Ethik 1.1 Wesen, Gegenstand und Ziel der Ethik Ethik und Moral
 1. Grundlagen der Ethik 1.1 Wesen, Gegenstand und Ziel der Ethik 1.1.1 Ethik und Moral Ethik Moral Wissenschaft, die sich mit Moral beschäftigt beschreibt und bestimmt die sittlichen Werte und Normen für
1. Grundlagen der Ethik 1.1 Wesen, Gegenstand und Ziel der Ethik 1.1.1 Ethik und Moral Ethik Moral Wissenschaft, die sich mit Moral beschäftigt beschreibt und bestimmt die sittlichen Werte und Normen für
Hanspeter Diboky DELTA PÄDAGOGIK DER MENSCH AUS GEIST, SEELE UND LEIB EINE ZUSAMMENFASSUNG UND ENTSPRECHENDE ERLEBNISSE
 Hanspeter Diboky DELTA PÄDAGOGIK DER MENSCH AUS GEIST, SEELE UND LEIB EINE ZUSAMMENFASSUNG UND ENTSPRECHENDE ERLEBNISSE Hanspeter Diboky DELTA PÄDAGOGIK DER MENSCH AUS GEIST, SEELE UND LEIB EINE ZUSAMMENFASSUNG
Hanspeter Diboky DELTA PÄDAGOGIK DER MENSCH AUS GEIST, SEELE UND LEIB EINE ZUSAMMENFASSUNG UND ENTSPRECHENDE ERLEBNISSE Hanspeter Diboky DELTA PÄDAGOGIK DER MENSCH AUS GEIST, SEELE UND LEIB EINE ZUSAMMENFASSUNG
Evangelische Religionspädagogik, Religion
 Lehrplaninhalt Vorbemerkung Die religionspädagogische Ausbildung in der FS Sozialpädagogik ermöglicht es den Studierenden, ihren Glauben zu reflektieren. Sie werden befähigt, an der religiösen Erziehung
Lehrplaninhalt Vorbemerkung Die religionspädagogische Ausbildung in der FS Sozialpädagogik ermöglicht es den Studierenden, ihren Glauben zu reflektieren. Sie werden befähigt, an der religiösen Erziehung
Qualifikationsphase (Q1) Auf der Suche nach Orientierung im Glauben und im Zweifel
 Unterrichtsvorhaben 1 Thema: Woran kann ich glauben? Christliche Antworten auf die Gottesfrage als Angebote Inhaltsfelder: IF 2: Christliche Antworten auf die Gottesfrage IF 1: Der Mensch in christlicher
Unterrichtsvorhaben 1 Thema: Woran kann ich glauben? Christliche Antworten auf die Gottesfrage als Angebote Inhaltsfelder: IF 2: Christliche Antworten auf die Gottesfrage IF 1: Der Mensch in christlicher
Wie kommen wir von den Kompetenzerwartungen und Inhaltsfeldern des KLP zu Unterrichtsvorhaben?
 Wie kommen wir von den Kompetenzerwartungen und Inhaltsfeldern des KLP zu Unterrichtsvorhaben? 1. Entwickeln Sie ausgehend von a. den übergeordneten und konkretisierten Kompetenzerwartungen b. den inhaltlichen
Wie kommen wir von den Kompetenzerwartungen und Inhaltsfeldern des KLP zu Unterrichtsvorhaben? 1. Entwickeln Sie ausgehend von a. den übergeordneten und konkretisierten Kompetenzerwartungen b. den inhaltlichen
Lassen sich Lebensqualität und Behinderung überhaupt miteinander vereinbaren?
 Lassen sich Lebensqualität und Behinderung überhaupt miteinander vereinbaren? SZH-Kongress Pierre Margot-Cattin Seite 1 SZH 1 2013 - P. Margot-Cattin Lebensqualität Gutes Leben? Wohlbefinden? Lebensqualität:
Lassen sich Lebensqualität und Behinderung überhaupt miteinander vereinbaren? SZH-Kongress Pierre Margot-Cattin Seite 1 SZH 1 2013 - P. Margot-Cattin Lebensqualität Gutes Leben? Wohlbefinden? Lebensqualität:
KMK. Rheinland-Pfalz EPA EPA. Bildungsstandards +Beispielaufgaben. Bildungsstandards +Beispielaufgaben. Lehrpläne. Erwartungshorizont Klasse
 KMK Rheinland-Pfalz EPA 13 EPA 12 11 Bildungsstandards +Beispielaufgaben 10 9 8 7 Bildungsstandards +Beispielaufgaben Erwartungshorizont Klasse 8 Lehrpläne 5-10 6 Erwartungshorizont Klasse 6 5 Allgemeine
KMK Rheinland-Pfalz EPA 13 EPA 12 11 Bildungsstandards +Beispielaufgaben 10 9 8 7 Bildungsstandards +Beispielaufgaben Erwartungshorizont Klasse 8 Lehrpläne 5-10 6 Erwartungshorizont Klasse 6 5 Allgemeine
Iris Gresser. Psychologische Auswirkungen von Nah-Todes-Erfahrungen. Wachstumsmotivationsbedürfnisse als Schritte der Selbstverwirklichung
 Iris Gresser Psychologische Auswirkungen von Nah-Todes-Erfahrungen Wachstumsmotivationsbedürfnisse als Schritte der Selbstverwirklichung Logos Verlag Berlin 2004 Inhaltsverzeichnis Tabellenverzeichnis
Iris Gresser Psychologische Auswirkungen von Nah-Todes-Erfahrungen Wachstumsmotivationsbedürfnisse als Schritte der Selbstverwirklichung Logos Verlag Berlin 2004 Inhaltsverzeichnis Tabellenverzeichnis
Rudolf Steiner GEISTESPFLEGE UND WIRTSCHAFTSLEBEN
 Rudolf Steiner GEISTESPFLEGE UND WIRTSCHAFTSLEBEN Erstveröffentlichung in: Die Dreigliederung des sozialen Organismus, I. Jg. 1919/20, Heft 13, Oktober 1919 (GA 24, S. 70-74) Von «Sozialisierung» reden
Rudolf Steiner GEISTESPFLEGE UND WIRTSCHAFTSLEBEN Erstveröffentlichung in: Die Dreigliederung des sozialen Organismus, I. Jg. 1919/20, Heft 13, Oktober 1919 (GA 24, S. 70-74) Von «Sozialisierung» reden
So entstand 2007 meine Idee für HERZWERK. Nach zwei Jahren der intensiven Vorbereitung konnten wir im Oktober 2009 unsere Auftaktveranstaltung
 HERZWERK Meine Idee In Würde Altern, der ewige Appell. Um diesem Ansinnen Gehör zu verleihen, habe ich 2009 gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz Düsseldorf das Projekt HERZWERK Aktiv gegen Armut im
HERZWERK Meine Idee In Würde Altern, der ewige Appell. Um diesem Ansinnen Gehör zu verleihen, habe ich 2009 gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz Düsseldorf das Projekt HERZWERK Aktiv gegen Armut im
Allgemeinbildung und Persönlichkeitsentwicklung
 Hans-Joachim Hausten Allgemeinbildung und Persönlichkeitsentwicklung Ein Beitrag zur Aufarbeitung der DDR-Pädagogik PETER LANG Frankfurt am Main Berlin Bern Bruxelles New York Oxford Wien Inhaltsverzeichnis
Hans-Joachim Hausten Allgemeinbildung und Persönlichkeitsentwicklung Ein Beitrag zur Aufarbeitung der DDR-Pädagogik PETER LANG Frankfurt am Main Berlin Bern Bruxelles New York Oxford Wien Inhaltsverzeichnis
Was ist Waldorfpädagogik
 Was ist Waldorfpädagogik Die erste Waldorfschule Die erste Waldorfschule 1919 in Stuttgart Sie wurde 1919 von Rudolf Steiner (1861-1925) zusammen mit Emil Molt, Besitzer der damaligen Waldorf Astoria Zigarettenfabrik,
Was ist Waldorfpädagogik Die erste Waldorfschule Die erste Waldorfschule 1919 in Stuttgart Sie wurde 1919 von Rudolf Steiner (1861-1925) zusammen mit Emil Molt, Besitzer der damaligen Waldorf Astoria Zigarettenfabrik,
Jesus erzählt vom Reich Gottes die Evangelien als frohe Botschaft
 Unterrichtsvorhaben A: Jesus erzählt vom Reich Gottes die Evangelien als frohe Botschaft Bibel als Ur-kunde des Glaubens an Gott (IF 3), Jesus der Christus (IF 4) deuten biblisches Sprechen von Gott als
Unterrichtsvorhaben A: Jesus erzählt vom Reich Gottes die Evangelien als frohe Botschaft Bibel als Ur-kunde des Glaubens an Gott (IF 3), Jesus der Christus (IF 4) deuten biblisches Sprechen von Gott als
Unser Wesen ist immer in und bei uns und gibt uns Orientierung im Leben. Es ist der Schlüssel zu Energie, Erfolg und Glück.
 Artikel in der PSI-Info (Basler PSI-Verein) Ausgabe Dez 2014, Akademie für Wesenspsychologie: Unser Wesen ein Geschenk unserer Seele Unser Wesen ist immer in und bei uns und gibt uns Orientierung im Leben.
Artikel in der PSI-Info (Basler PSI-Verein) Ausgabe Dez 2014, Akademie für Wesenspsychologie: Unser Wesen ein Geschenk unserer Seele Unser Wesen ist immer in und bei uns und gibt uns Orientierung im Leben.
Die enneagrammatische Homöopathie! Dr. h.c. Detlef Rathmer
 Enneagramm & Homöopathie Die enneagrammatische Homöopathie! Dr. h.c. Detlef Rathmer Die enneagrammatische Homöopathie Dr. h.c. Detlef Rathmer Copyright by Detlef Rathmer Molkereiweg 9 D - 48727 Billerbeck
Enneagramm & Homöopathie Die enneagrammatische Homöopathie! Dr. h.c. Detlef Rathmer Die enneagrammatische Homöopathie Dr. h.c. Detlef Rathmer Copyright by Detlef Rathmer Molkereiweg 9 D - 48727 Billerbeck
Standards Thema Jesus Christus Inhalte Kompetenzen. Zeit und Umwelt Jesu, Leiden u. Sterben (Mk 14;15)
 Standards Thema Jesus Christus Inhalte Kompetenzen -können Grundzüge der Botschaft Jesu in ihrem historischen und systematischen Zusammenhang erläutern -kennen ausgewählte Texte der Botschaft Jesu vom
Standards Thema Jesus Christus Inhalte Kompetenzen -können Grundzüge der Botschaft Jesu in ihrem historischen und systematischen Zusammenhang erläutern -kennen ausgewählte Texte der Botschaft Jesu vom
Palliative Betreuung am Lebensende
 Palliative Betreuung am Lebensende Informationen für Angehörige Liebe Angehörige Die Zeit des Sterbens einer nahestehenden Person ist für viele Angehörige und Freunde eine Zeit der Krise, der Angst und
Palliative Betreuung am Lebensende Informationen für Angehörige Liebe Angehörige Die Zeit des Sterbens einer nahestehenden Person ist für viele Angehörige und Freunde eine Zeit der Krise, der Angst und
Maria, die Mutter von Jesus wenn ich diesen
 Maria auf der Spur Maria, die Mutter von Jesus wenn ich diesen Namen höre, dann gehen mir die unterschiedlichsten Vorstellungen durch den Kopf. Mein Bild von ihr setzt sich zusammen aus dem, was ich in
Maria auf der Spur Maria, die Mutter von Jesus wenn ich diesen Namen höre, dann gehen mir die unterschiedlichsten Vorstellungen durch den Kopf. Mein Bild von ihr setzt sich zusammen aus dem, was ich in
Grußwort. der Ministerin für Schule und Weiterbildung. des Landes Nordrhein-Westfalen, Sylvia Löhrmann
 Grußwort der Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Sylvia Löhrmann Grußwort Namensgebungsfeier der Städtischen Gesamtschule in Alexander- Coppel-Gesamtschule in Solingen
Grußwort der Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Sylvia Löhrmann Grußwort Namensgebungsfeier der Städtischen Gesamtschule in Alexander- Coppel-Gesamtschule in Solingen
Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Jahrgangsstufe EF
 Unterrichtsvorhaben A: Woran glaubst du? religiöse Orientierung in unserer pluralen Gesellschaft Inhaltsfeld 1: Der Mensch in christlicher Perspektive Inhaltliche Schwerpunkte: Religiosität in der pluralen
Unterrichtsvorhaben A: Woran glaubst du? religiöse Orientierung in unserer pluralen Gesellschaft Inhaltsfeld 1: Der Mensch in christlicher Perspektive Inhaltliche Schwerpunkte: Religiosität in der pluralen
Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre am Städtischen Gymnasium Gütersloh
 Unterrichtsvorhaben 1 : Thema: Was ist Religion? Inhaltsfelder: IF 1: Der Mensch in christlicher Perspektive Übergeordnete Kompetenzerwartungen: Konkretisierte Kompetenzerwartungen: Inhaltliche Schwerpunkte:
Unterrichtsvorhaben 1 : Thema: Was ist Religion? Inhaltsfelder: IF 1: Der Mensch in christlicher Perspektive Übergeordnete Kompetenzerwartungen: Konkretisierte Kompetenzerwartungen: Inhaltliche Schwerpunkte:
ab abend Abend aber Aber acht AG Aktien alle Alle allein allen aller allerdings Allerdings alles als Als also alt alte alten am Am amerikanische
 ab abend Abend aber Aber acht AG Aktien alle Alle allein allen aller allerdings Allerdings alles als Als also alt alte alten am Am amerikanische amerikanischen Amt an An andere anderen anderer anderes
ab abend Abend aber Aber acht AG Aktien alle Alle allein allen aller allerdings Allerdings alles als Als also alt alte alten am Am amerikanische amerikanischen Amt an An andere anderen anderer anderes
Leit-Bild der Werkstätten Gottes-Segen
 Leit-Bild der Werkstätten Gottes-Segen An diesem Leit-Bild haben viele Menschen mitgearbeitet: Die Mitarbeiter Die Beschäftigten Und die Angehörigen von den Beschäftigten 1 Das erfahren Sie im Leit-Bild
Leit-Bild der Werkstätten Gottes-Segen An diesem Leit-Bild haben viele Menschen mitgearbeitet: Die Mitarbeiter Die Beschäftigten Und die Angehörigen von den Beschäftigten 1 Das erfahren Sie im Leit-Bild
1. Johannes 4, 16b-21
 Predigt zu 1. Johannes 4, 16b-21 Liebe Gemeinde, je länger ich Christ bin, desto relevanter erscheint mir der Gedanke, dass Gott Liebe ist! Ich möchte euch den Predigttext aus dem 1. Johannesbrief vorlesen,
Predigt zu 1. Johannes 4, 16b-21 Liebe Gemeinde, je länger ich Christ bin, desto relevanter erscheint mir der Gedanke, dass Gott Liebe ist! Ich möchte euch den Predigttext aus dem 1. Johannesbrief vorlesen,
Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule
 Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule Kompetenzbereiche: Sach-, Methoden-, Urteils-, Handlungskompetenz Synopse aller Kompetenzerwartungen Sachkompetenz
Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule Kompetenzbereiche: Sach-, Methoden-, Urteils-, Handlungskompetenz Synopse aller Kompetenzerwartungen Sachkompetenz
Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung über Theologische Fragen an die Hirnforschung. Erste Lieferung
 Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung über Theologische Fragen an die Hirnforschung Erste Lieferung Zum Thema: Einführung: Verbreitete Ansichten, die für die Theologie relevant
Orientierungsfragen und -aufgaben für die Klausur zur Vorlesung über Theologische Fragen an die Hirnforschung Erste Lieferung Zum Thema: Einführung: Verbreitete Ansichten, die für die Theologie relevant
( Picasso ) LuPe Lebenskunst
 ( Picasso ) LuPe Lebenskunst Nutzt die Schule nur 10% der Hirnen der Schüler? Paolo Freire Körper Wissen Körper Inspiration Intuition Imagination Improvisation Impulse Assoziieren Automatische Aktionen
( Picasso ) LuPe Lebenskunst Nutzt die Schule nur 10% der Hirnen der Schüler? Paolo Freire Körper Wissen Körper Inspiration Intuition Imagination Improvisation Impulse Assoziieren Automatische Aktionen
Es gilt das gesprochene Wort!
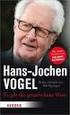 Es gilt das gesprochene Wort! 40-jähriges Bestehen der Freien Waldorfschule Würzburg am 30. Januar 2016, um 16.00 Uhr in Würzburg Grußwort von Barbara Stamm, MdL Präsidentin des Bayerischen Landtags Sehr
Es gilt das gesprochene Wort! 40-jähriges Bestehen der Freien Waldorfschule Würzburg am 30. Januar 2016, um 16.00 Uhr in Würzburg Grußwort von Barbara Stamm, MdL Präsidentin des Bayerischen Landtags Sehr
Die Beziehung von Entwicklung und Kultur
 I Die Beziehung von Entwicklung und Kultur Kapitel Einführung: die Wissenschaft vom Alltagsleben 3 Kapitel 2 Kultur und Kontext eine untrennbare Allianz 7 Kapitel 3 Kultur definiert die menschliche Natur
I Die Beziehung von Entwicklung und Kultur Kapitel Einführung: die Wissenschaft vom Alltagsleben 3 Kapitel 2 Kultur und Kontext eine untrennbare Allianz 7 Kapitel 3 Kultur definiert die menschliche Natur
EMOTIONALITAT, LERNEN UND VERHALTEN. Ein heilpadagogisches Lehrbuch
 EMOTIONALITAT, LERNEN UND VERHALTEN Ein heilpadagogisches Lehrbuch von Konrad Bundschuh 2003 VERLAG JULIUS KLINKHARDT BAD HEILBRUNN / OBB. Inhalt Vorwort 9 Einleitung 13 1. Die Bedeutung der Emotionalitat
EMOTIONALITAT, LERNEN UND VERHALTEN Ein heilpadagogisches Lehrbuch von Konrad Bundschuh 2003 VERLAG JULIUS KLINKHARDT BAD HEILBRUNN / OBB. Inhalt Vorwort 9 Einleitung 13 1. Die Bedeutung der Emotionalitat
I. Begrüßung: Kontext der Initiative Anrede
 1 - Es gilt das gesprochene Wort! - - Sperrfrist: 21.11.2011, 10:00 Uhr - Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Veranstaltung zur Initiative
1 - Es gilt das gesprochene Wort! - - Sperrfrist: 21.11.2011, 10:00 Uhr - Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich der Veranstaltung zur Initiative
Praktische Philosophie
 Praktische Philosophie Praktische Philosophie ist am PKG verbindliches Unterrichtsfach für alle SchülerInnen der Jahrgangsstufen 6 bis 9, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen (sei es weil sie einer
Praktische Philosophie Praktische Philosophie ist am PKG verbindliches Unterrichtsfach für alle SchülerInnen der Jahrgangsstufen 6 bis 9, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen (sei es weil sie einer
11. Verfassung des Landes Baden-Württemberg (Auszug)
 Verfassung Baden-Württemberg 11 11. Verfassung des Landes Baden-Württemberg (Auszug) Vom 11. November 1953 (GBl. S. 173) geänd. durch Gesetz vom 7. Dezember 1959 (GBl. S. 171), vom 8. Februar 1967 (GBl.
Verfassung Baden-Württemberg 11 11. Verfassung des Landes Baden-Württemberg (Auszug) Vom 11. November 1953 (GBl. S. 173) geänd. durch Gesetz vom 7. Dezember 1959 (GBl. S. 171), vom 8. Februar 1967 (GBl.
Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie in der Einführungsphase der Gesamtschule Aachen-Brand
 Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie in der Einführungsphase der Gesamtschule Aachen-Brand Stand: August 2014 Unterrichtsvorhaben I Eigenart philosophischen Fragens und Denkens - Was heißt es
Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie in der Einführungsphase der Gesamtschule Aachen-Brand Stand: August 2014 Unterrichtsvorhaben I Eigenart philosophischen Fragens und Denkens - Was heißt es
Schulinternes Curriculum Evangelische Religionslehre
 Schulinternes Curriculum Evangelische Religionslehre Jahrgang 7.2 1. Unterrichtsvorhaben Inhaltsfeld 1: Inhaltlicher Schwerpunkt 2: Entwicklung einer eigenen religiösen Identität Reformatorische Grundeinsichten
Schulinternes Curriculum Evangelische Religionslehre Jahrgang 7.2 1. Unterrichtsvorhaben Inhaltsfeld 1: Inhaltlicher Schwerpunkt 2: Entwicklung einer eigenen religiösen Identität Reformatorische Grundeinsichten
CAS Philosophie für Fachleute aus Medizin und Psychotherapie. «Der Philosoph behandelt eine Frage; wie eine Krankheit.» Ludwig Wittgenstein
 CAS Philosophie für Fachleute aus Medizin und Psychotherapie. «Der Philosoph behandelt eine Frage; wie eine Krankheit.» Ludwig Wittgenstein Neuer Kursbeginn: Herbstsemester 2017 / 2018 Anmeldung bis 11.10.2017
CAS Philosophie für Fachleute aus Medizin und Psychotherapie. «Der Philosoph behandelt eine Frage; wie eine Krankheit.» Ludwig Wittgenstein Neuer Kursbeginn: Herbstsemester 2017 / 2018 Anmeldung bis 11.10.2017
Wortformen des Deutschen nach fallender Häufigkeit:
 der die und in den 5 von zu das mit sich 10 des auf für ist im 15 dem nicht ein Die eine 20 als auch es an werden 25 aus er hat daß sie 30 nach wird bei einer Der 35 um am sind noch wie 40 einem über einen
der die und in den 5 von zu das mit sich 10 des auf für ist im 15 dem nicht ein Die eine 20 als auch es an werden 25 aus er hat daß sie 30 nach wird bei einer Der 35 um am sind noch wie 40 einem über einen
DER INDIVIDUELLE MYTHOS DES NEUROTIKERS
 DER INDIVIDUELLE MYTHOS DES NEUROTIKERS LACANS PARADOXA Was Sie eine Analyse lehrt, ist auf keinem anderen Weg zu erwerben, weder durch Unterricht noch durch irgendeine andere geistige Übung. Wenn nicht,
DER INDIVIDUELLE MYTHOS DES NEUROTIKERS LACANS PARADOXA Was Sie eine Analyse lehrt, ist auf keinem anderen Weg zu erwerben, weder durch Unterricht noch durch irgendeine andere geistige Übung. Wenn nicht,
Freundschaft am Arbeitsplatz - Spezifika einer persönlichen Beziehung im beruflichen Umfeld
 Geisteswissenschaft Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz - Spezifika einer persönlichen Beziehung im beruflichen Umfeld Bachelorarbeit Bakkalaureatsarbeit Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz
Geisteswissenschaft Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz - Spezifika einer persönlichen Beziehung im beruflichen Umfeld Bachelorarbeit Bakkalaureatsarbeit Daniel Rössler Freundschaft am Arbeitsplatz
Unterstützung von Angehörigen von Menschen mit Behinderungen
 Unterstützung von Angehörigen von Menschen mit Behinderungen Zusammenfassung In der UNO-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen geht es um die Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen.
Unterstützung von Angehörigen von Menschen mit Behinderungen Zusammenfassung In der UNO-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen geht es um die Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen.
Katholische Religionslehre Q2
 Unterrichtsvorhaben V : Thema: Die (christliche) Herausforderung sinnvoll zu leben und ethisch zu handeln Inhaltsfelder: IF 1: Der Mensch in christlicher Perspektive IF 5: Verantwortliches Handeln aus
Unterrichtsvorhaben V : Thema: Die (christliche) Herausforderung sinnvoll zu leben und ethisch zu handeln Inhaltsfelder: IF 1: Der Mensch in christlicher Perspektive IF 5: Verantwortliches Handeln aus
Schulinterner Lehrplan für das Fach Ethik, Klasse 1-4
 Schulinterner Lehrplan für das Fach Ethik, Klasse 1-4 Lernziele/Inhalte Klasse 1 und 2 Hinweise Soziale Beziehungen Freundschaft - was gehört dazu und worauf kommt es an? o Formen von Freundschaft o Merkmale
Schulinterner Lehrplan für das Fach Ethik, Klasse 1-4 Lernziele/Inhalte Klasse 1 und 2 Hinweise Soziale Beziehungen Freundschaft - was gehört dazu und worauf kommt es an? o Formen von Freundschaft o Merkmale
Teil B Maria Montessoris pädagogisches und religionspädagogisches
 Teil A Hinführung 1 EINLEITENDES UND ZIELE DER ARBEIT... 17 2 THEORETISCHE FRAGEN UND METHODISCHE ÜBERLEGUNGEN... 21 2.1 Schlaglichter zur Hermeneutik... 21 2.2 Prinzipielle Probleme der Interpretation
Teil A Hinführung 1 EINLEITENDES UND ZIELE DER ARBEIT... 17 2 THEORETISCHE FRAGEN UND METHODISCHE ÜBERLEGUNGEN... 21 2.1 Schlaglichter zur Hermeneutik... 21 2.2 Prinzipielle Probleme der Interpretation
Die geisteswissenschaftliche Pädagogik
 TU Chemnitz Philosophische Fakultät Pädagogik und Philosophie Allgemeine Erziehungswissenschaft Die geisteswissenschaftliche Pädagogik Beantwortung der Fragestellungen zum Seinar Konzepte der Erziehungswissenschaft
TU Chemnitz Philosophische Fakultät Pädagogik und Philosophie Allgemeine Erziehungswissenschaft Die geisteswissenschaftliche Pädagogik Beantwortung der Fragestellungen zum Seinar Konzepte der Erziehungswissenschaft
Verfassung des Landes Baden-Württemberg Auszug
 Landesverfassung BaWü LV BW 700.200 Verfassung des Landes Baden-Württemberg Auszug Vom 11. November 1953 (GBl. S. 173), zuletzt geändert am 7. Februar 2011 (GBl. S. 46) I. Mensch und Staat Artikel 3 (1)
Landesverfassung BaWü LV BW 700.200 Verfassung des Landes Baden-Württemberg Auszug Vom 11. November 1953 (GBl. S. 173), zuletzt geändert am 7. Februar 2011 (GBl. S. 46) I. Mensch und Staat Artikel 3 (1)
(Elbkinder-)Kitas eine neue Heimat für Flüchtlingskinder
 (Elbkinder-)Kitas eine neue Heimat für Flüchtlingskinder Wertegrundlagen der Elbkinder Vision und Leitbild Wir bereiten den Weg in eine ideenreiche und solidarische Gesellschaft von morgen. Wertegrundlagen
(Elbkinder-)Kitas eine neue Heimat für Flüchtlingskinder Wertegrundlagen der Elbkinder Vision und Leitbild Wir bereiten den Weg in eine ideenreiche und solidarische Gesellschaft von morgen. Wertegrundlagen
2 THEORETISCHE FRAGEN UND METHODISCHE ÜBERLEGUNGEN 21
 Teil A Hinführung 1 EINLEITENDES UND ZIELE DER ARBEIT 17 2 THEORETISCHE FRAGEN UND METHODISCHE ÜBERLEGUNGEN 21 2.1 Schlaglichter zur Hermeneutik 21 2.2 Prinzipielle Probleme der Interpretation von Montessori-Texten
Teil A Hinführung 1 EINLEITENDES UND ZIELE DER ARBEIT 17 2 THEORETISCHE FRAGEN UND METHODISCHE ÜBERLEGUNGEN 21 2.1 Schlaglichter zur Hermeneutik 21 2.2 Prinzipielle Probleme der Interpretation von Montessori-Texten
Was ist denn bloß. mit der Ernte los???
 Predigt Was ist denn bloß mit der Ernte los??? Die Ernte ist ein Begriff dafür, daß Menschen positiv auf das Evangelium reagieren. Jesu Aussagen: Schaut euch doch um! Überall reifen die Felder heran und
Predigt Was ist denn bloß mit der Ernte los??? Die Ernte ist ein Begriff dafür, daß Menschen positiv auf das Evangelium reagieren. Jesu Aussagen: Schaut euch doch um! Überall reifen die Felder heran und
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus:
 Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Ich muss wissen, was ich machen will... - Ethik lernen und lehren in der Schule Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form Auszug aus: Ich muss wissen, was ich machen will... - Ethik lernen und lehren in der Schule Das komplette Material finden Sie hier: School-Scout.de
Über den Zusammenhang von Gehirn, Gesellschaft und Geschlecht
 Geisteswissenschaft Anonym Über den Zusammenhang von Gehirn, Gesellschaft und Geschlecht Studienarbeit Humboldt Universität - Berlin Kulturwissenschaftliches Seminar Hauptseminar: Das Unbewusste Sommersemester
Geisteswissenschaft Anonym Über den Zusammenhang von Gehirn, Gesellschaft und Geschlecht Studienarbeit Humboldt Universität - Berlin Kulturwissenschaftliches Seminar Hauptseminar: Das Unbewusste Sommersemester
Ästhetik ist die Theorie der ästhetischen Erfahrung, der ästhetischen Gegenstände und der ästhetischen Eigenschaften.
 16 I. Was ist philosophische Ästhetik? instrumente. Die Erkenntnis ästhetischer Qualitäten ist nur eine unter vielen möglichen Anwendungen dieses Instruments. In diesem Sinn ist die Charakterisierung von
16 I. Was ist philosophische Ästhetik? instrumente. Die Erkenntnis ästhetischer Qualitäten ist nur eine unter vielen möglichen Anwendungen dieses Instruments. In diesem Sinn ist die Charakterisierung von
Einführung in die Erziehungs- und Bildungswissenschaft
 Cathleen Grunert Einführung in die Erziehungs- und Bildungswissenschaft Vorwort zum Modul Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten
Cathleen Grunert Einführung in die Erziehungs- und Bildungswissenschaft Vorwort zum Modul Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten
Das Menschenbild im Koran
 Geisteswissenschaft Nelli Chrispens Das Menschenbild im Koran Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung...2 2. Der Mensch als Geschöpf Gottes...3 3. Stellung des Menschen im Islam...4 3.1 Der Mensch
Geisteswissenschaft Nelli Chrispens Das Menschenbild im Koran Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung...2 2. Der Mensch als Geschöpf Gottes...3 3. Stellung des Menschen im Islam...4 3.1 Der Mensch
schließt. Aus vielen Nahtoderfahrungen wissen wir heute jedoch, dass das Leben mehr ist als unser kurzer Aufenthalt hier auf Erden.
 Inhalt Einleitung 7 Der Verlust eines geliebten Menschen 12 Vom Umgang mit Sterbenden 18 Meditation: Einstimmung in die Sterbebegleitung 25 Der innere Sterbeprozess 29 Der Augenblick des Todes 38 Abschied
Inhalt Einleitung 7 Der Verlust eines geliebten Menschen 12 Vom Umgang mit Sterbenden 18 Meditation: Einstimmung in die Sterbebegleitung 25 Der innere Sterbeprozess 29 Der Augenblick des Todes 38 Abschied
Predigt zu Johannes 14, 12-31
 Predigt zu Johannes 14, 12-31 Liebe Gemeinde, das Motto der heute beginnenden Allianzgebetswoche lautet Zeugen sein! Weltweit kommen Christen zusammen, um zu beten und um damit ja auch zu bezeugen, dass
Predigt zu Johannes 14, 12-31 Liebe Gemeinde, das Motto der heute beginnenden Allianzgebetswoche lautet Zeugen sein! Weltweit kommen Christen zusammen, um zu beten und um damit ja auch zu bezeugen, dass
Klausurrelevante Zusammenfassung WS Kurs Teil 2 Modul 1A B A 1 von
 Klausurrelevante Zusammenfassung WS 2010 2011 Kurs 33042 Teil 2 Modul 1A B A 1 von 12-21.02.11 Lernzusammenfassung Dilthey und der hermeneutische Zirkel - 33042 - T2...3 Lebensphilosophie Dilthey - (3)...3
Klausurrelevante Zusammenfassung WS 2010 2011 Kurs 33042 Teil 2 Modul 1A B A 1 von 12-21.02.11 Lernzusammenfassung Dilthey und der hermeneutische Zirkel - 33042 - T2...3 Lebensphilosophie Dilthey - (3)...3
Welcher Platz gebührt der Geschichte der Mathematik in einer Enzyklopädie der mathematischen Wissenschaften?
 Welcher Platz gebührt der Geschichte der Mathematik in einer Enzyklopädie der mathematischen Wissenschaften? Von G. ENESTRöM aus Stockholm. Die Beantwortung der Frage, die ich heute zu behandeln beabsichtige,
Welcher Platz gebührt der Geschichte der Mathematik in einer Enzyklopädie der mathematischen Wissenschaften? Von G. ENESTRöM aus Stockholm. Die Beantwortung der Frage, die ich heute zu behandeln beabsichtige,
EF- GK 11 PSYCHOLOGIE EINFÜHRUNG IN DIE PSYCHOLOGIE SCE/ PASC. Paradigmen (Schulen / Hauptströmungen) der Psychologie (Hobmair, 2013, S. 35 ff.
 Paradigmen (Schulen / Hauptströmungen) der Psychologie (Hobmair, 2013, S. 35 ff.) Die Psychologie stellt sich nicht als eine einheitliche Wissenschaft dar, sie umfasst mehrere, zum Teil gegensätzliche
Paradigmen (Schulen / Hauptströmungen) der Psychologie (Hobmair, 2013, S. 35 ff.) Die Psychologie stellt sich nicht als eine einheitliche Wissenschaft dar, sie umfasst mehrere, zum Teil gegensätzliche
Eltern wollen immer das Beste für ihr Kind. Fachpersonen wollen immer das Beste für ihre SchülerInnen.
 Zusammenarbeit mit Eltern im Kontext einer Institution 6. Heilpädagogik-Kongress in Bern am 1. September 2009 Netzwerk web Aufbau Drei Postulate Die Sicht der Eltern die Sicht der Fachleute Der Prozess
Zusammenarbeit mit Eltern im Kontext einer Institution 6. Heilpädagogik-Kongress in Bern am 1. September 2009 Netzwerk web Aufbau Drei Postulate Die Sicht der Eltern die Sicht der Fachleute Der Prozess
in der Anregungen für die Vorbereitung und Gespräche vor Ort
 KIRCHENENTWICKLUNG in der VISITATION Anregungen für die Vorbereitung und Gespräche vor Ort VISITATION ALS CHANCE, GEMEINSAM MEHR ZU SEHEN Die Visitation im Bistum Limburg zielt darauf ab, dem Bischof bzw.
KIRCHENENTWICKLUNG in der VISITATION Anregungen für die Vorbereitung und Gespräche vor Ort VISITATION ALS CHANCE, GEMEINSAM MEHR ZU SEHEN Die Visitation im Bistum Limburg zielt darauf ab, dem Bischof bzw.
Russische Philosophen in Berlin
 Russische Philosophen in Berlin Julia Sestakova > Vortrag > Bilder 435 Julia Sestakova Warum wählten russische Philosophen vorzugsweise Berlin als Ziel ihres erzwungenen Exils? Was hatte ihnen das Land
Russische Philosophen in Berlin Julia Sestakova > Vortrag > Bilder 435 Julia Sestakova Warum wählten russische Philosophen vorzugsweise Berlin als Ziel ihres erzwungenen Exils? Was hatte ihnen das Land
Werkstatt Anthroposophie
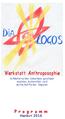 Werkstatt Anthroposophie Schöpferisches Umsetzen geistiger sozialer, kultureller u n d wirtschaftlicher Impulse P r o g r a m m Herbst 2016 DIA-LOGOS steht für:... einen Ort schaffen, wo Menschen einander
Werkstatt Anthroposophie Schöpferisches Umsetzen geistiger sozialer, kultureller u n d wirtschaftlicher Impulse P r o g r a m m Herbst 2016 DIA-LOGOS steht für:... einen Ort schaffen, wo Menschen einander
Fünf öffentliche Vorträge, gehalten in Köln, Bern und München vom 23. Januar bis 18. Mai 1922
 InhaltsverzeIchnIs Fünf öffentliche Vorträge, gehalten in Köln, Bern und München vom 23. Januar bis 18. Mai 1922 Zur Einführung: Rudolf Steiner über seine öffentlichen Vorträge (Dornach, 11.2.1922) S.
InhaltsverzeIchnIs Fünf öffentliche Vorträge, gehalten in Köln, Bern und München vom 23. Januar bis 18. Mai 1922 Zur Einführung: Rudolf Steiner über seine öffentlichen Vorträge (Dornach, 11.2.1922) S.
PÄDAGOGISCHES LANDESINSTITUT BERUFSEINSTIEG. Persönlichkeit und Präsenz
 PÄDAGOGISCHES LANDESINSTITUT BERUFSEINSTIEG Persönlichkeit und Präsenz PERSÖNLICHKEIT Die Persönlichkeit von Lehrerinnen und Lehrern wird für Schülerinnen und Schüler und für Kolleginnen und Kollegen erfahrbar,
PÄDAGOGISCHES LANDESINSTITUT BERUFSEINSTIEG Persönlichkeit und Präsenz PERSÖNLICHKEIT Die Persönlichkeit von Lehrerinnen und Lehrern wird für Schülerinnen und Schüler und für Kolleginnen und Kollegen erfahrbar,
Analytische Charaktertheorie
 Erich Fromm Analytische Charaktertheorie BAND II Deutsche Verlags- Anstalt INHALT Psychoanalyse und Ethik. Bausteine zu einer humanistischen Charakterologie (1947a).... 1 Vorwort... 1 Die Fragestellung...
Erich Fromm Analytische Charaktertheorie BAND II Deutsche Verlags- Anstalt INHALT Psychoanalyse und Ethik. Bausteine zu einer humanistischen Charakterologie (1947a).... 1 Vorwort... 1 Die Fragestellung...
Predigt über Römer 14,7-9 am in Oggenhausen und Nattheim (2 Taufen)
 Das Copyright für diese Predigt liegt beim Verfasser Bernhard Philipp, Alleestraße 40, 89564 Nattheim Predigt über Römer 14,7-9 am 07.11.2010 in Oggenhausen und Nattheim (2 Taufen) Die Gnade unseres Herrn
Das Copyright für diese Predigt liegt beim Verfasser Bernhard Philipp, Alleestraße 40, 89564 Nattheim Predigt über Römer 14,7-9 am 07.11.2010 in Oggenhausen und Nattheim (2 Taufen) Die Gnade unseres Herrn
Wie können wir entscheiden ob eine Person oder ein Wesen einen Geist hat?
 Einleitung Dr. M. Vogel Vorlesung Grundprobleme der Philosophie des Geistes Wie können wir entscheiden ob eine Person oder ein Wesen einen Geist hat? Malvin Gattinger Vor einem Antwortversuch will ich
Einleitung Dr. M. Vogel Vorlesung Grundprobleme der Philosophie des Geistes Wie können wir entscheiden ob eine Person oder ein Wesen einen Geist hat? Malvin Gattinger Vor einem Antwortversuch will ich
Seele und Emotion bei Descartes und Aristoteles
 Geisteswissenschaft Anne-Kathrin Mische Seele und Emotion bei Descartes und Aristoteles Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 2 2. Das Leib-Seele-Verhältnis bei Descartes und Aristoteles...
Geisteswissenschaft Anne-Kathrin Mische Seele und Emotion bei Descartes und Aristoteles Studienarbeit Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung... 2 2. Das Leib-Seele-Verhältnis bei Descartes und Aristoteles...
DIE FILES DÜRFEN NUR FÜR DEN EIGENEN GEBRAUCH BENUTZT WERDEN. DAS COPYRIGHT LIEGT BEIM JEWEILIGEN AUTOR.
 Weitere Files findest du auf www.semestra.ch/files DIE FILES DÜRFEN NUR FÜR DEN EIGENEN GEBRAUCH BENUTZT WERDEN. DAS COPYRIGHT LIEGT BEIM JEWEILIGEN AUTOR. Meyer, J. W. und R. L. Jepperson 2005. Die "Akteure"
Weitere Files findest du auf www.semestra.ch/files DIE FILES DÜRFEN NUR FÜR DEN EIGENEN GEBRAUCH BENUTZT WERDEN. DAS COPYRIGHT LIEGT BEIM JEWEILIGEN AUTOR. Meyer, J. W. und R. L. Jepperson 2005. Die "Akteure"
Wie entscheidest du dich, der Welt in diesem Augenblick zu begegnen?
 zu lernen; um an den unerlässlichen Erfahrungen zu wachsen, die wir durch die Begegnung mit anderen Seelen hier auf der Erde gewinnen. Begegnen wir ihnen ausgehend von der Liebeskraft in uns, erkennen
zu lernen; um an den unerlässlichen Erfahrungen zu wachsen, die wir durch die Begegnung mit anderen Seelen hier auf der Erde gewinnen. Begegnen wir ihnen ausgehend von der Liebeskraft in uns, erkennen
ARD-Themenwoche Leben mit dem Tod (4)
 Südwestrundfunk Impuls Aufnahme: 15.11.2012 Sendung: 22.11.2012 Dauer: 05 31 Autor: Mirko Smiljanic Redaktion: Rainer Hannes ARD-Themenwoche Leben mit dem Tod (4) Wie möchten wir sterben? 2 Wie möchten
Südwestrundfunk Impuls Aufnahme: 15.11.2012 Sendung: 22.11.2012 Dauer: 05 31 Autor: Mirko Smiljanic Redaktion: Rainer Hannes ARD-Themenwoche Leben mit dem Tod (4) Wie möchten wir sterben? 2 Wie möchten
Grundlagen der Sportpädagogik (WS 2004/05) Dietrich Kurz Universität Bielefeld Abteilung Sportwissenschaft
 Grundlagen der Sportpädagogik (WS 2004/05) Grundlagen der Sportpädagogik (WS 2004/05) Lektion 12: Sport pädagogisch vermitteln Lektion 12: Sport pädagogisch vermitteln 1. Sport vermitteln nicht nur eine
Grundlagen der Sportpädagogik (WS 2004/05) Grundlagen der Sportpädagogik (WS 2004/05) Lektion 12: Sport pädagogisch vermitteln Lektion 12: Sport pädagogisch vermitteln 1. Sport vermitteln nicht nur eine
