Aaron Löwenbein, Frank Sauerland, Siegfried Uhl (Hrsg.) Berufsorientierung in der Krise?
|
|
|
- Willi Schwarz
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Aaron Löwenbein, Frank Sauerland, Siegfried Uhl (Hrsg.) Berufsorientierung in der Krise? Der Übergang von der Schule in den Beruf
2
3 Aaron Löwenbein, Frank Sauerland und Siegfried Uhl (Hrsg.) Berufsorientierung in der Krise? Der Übergang von der Schule in den Beruf Waxmann 2017 Münster New York
4 Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über abrufbar. Print-ISBN E-Book-ISBN Waxmann Verlag GmbH, Münster 2017 Steinfurter Straße 555, Münster info@waxmann.com Umschlaggestaltung: Inna Ponomareva, Jena Titelbild: patpitchaya fotolia.de Satz: Sven Solterbeck, Münster Druck: Hubert & Co., Göttingen Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier, säurefrei gemäß ISO 9706 Printed in Germany Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Kein Teil dieses Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
5 Inhalt Aaron Löwenbein, Frank Sauerland und Siegfried Uhl Einführung Herausforderungen bei der Berufswahl und der Berufsorientierung Manfred Eckert Der Übergang von der Schule in die Berufsausbildung aus berufspädagogischer Sicht Günter Ratschinski Das Berufswahlverhalten von Ausbildungsaspiranten und Ergebnisse institutioneller Unterstützung Jörg-Peter Pahl und Michael Tärre Transition Zum lernorganisatorischen Problemzusammenhang des Übergangs von einer Ausbildungs- und Arbeitsstätte zur nächsten Jörg-Peter Pahl und Michael Tärre Zusatzausbildung Lernorganisatorische Konzepte zur Erleichterung des Übergangs von der Berufsausbildung in die Arbeitswelt Klaus Jenewein Berufsbildung, demografischer Wandel und zunehmende Heterogenität Eine Analyse der Entwicklungen in den neuen Bundesländern Christian Staden Berufswahlpass Online Die Weiterentwicklung des Berufswahlpasses zu einem E-Portfolio-Konzept für die Berufsorientierung Aaron Löwenbein Innovative Ansätze in der vorberuflichen und beruflichen Bildung und ihre Verwirklichung in nationalen und übernationalen Förderprogrammen Dan Löwenbein Projekte und Programme zur Bereicherung und Unterstützung schulischer Angebote zur Förderung politischer Handlungsfähigkeit und Motivation von Schülerinnen und Schülern
6 Ingrid Tiefenbach Was die Studienseminare für Grund-, Haupt-, Real- und Förderschulen zur Berufsorientierung von Schülerinnen und Schülern beitragen können Am Beispiel des Studienseminars für Grund-, Haupt-, Real- und Förderschulen in Frankfurt Hannelore Faulstich-Wieland Geschlechtersensible Berufsorientierung weitgehend Fehlanzeige Axel Plünnecke Das Verhältnis beruflicher und akademischer Bildung in Deutschland aus Sicht der Wirtschaft Elke Hannack Weniger ist mehr DGB-Vorschläge für einen besseren Übergang von der Schule in die Ausbildung Charlotte Venema Berufsbildung und die Entwicklung der Industriegesellschaft Berufliche Bildung nimmt Industrie 4.0 vorweg Michael Heister Ausblick: Digitalisierung und Zuzug von Geflüchteten Zwei Herausforderungen für die vorberufliche und die berufliche Bildung Personenregister Sachregister Autorinnen und Autoren
7 Aaron Löwenbein, Frank Sauerland und Siegfried Uhl Einführung Herausforderungen bei der Berufswahl und der Berufsorientierung Jede Gruppe ist für ihr Fortbestehen auf Nachwuchs angewiesen. Das gilt für soziale Gebilde aller Art: für Kleinbetriebe und Großunternehmen, für die staatliche Verwaltung, für Parteien und Gewerkschaften, für die großen nationalen und übernationalen Verbände und genauso für die kleinen Vereine in der Nachbarschaft. In der ständischen Gesellschaft lagen die Dinge einfach. Der Lebensweg war für die allermeisten Menschen vorherbestimmt. Sie wurden in ihren Stand hineingeboren und traten in festgesetztem Alter in die Sozialgebilde ein, denen schon ihre Eltern und Voreltern angehört haben. Es ist eines der Kernmerkmale der Moderne, dass die enge Verbindung von Herkunft und Lebensweg schwächer geworden und in manchen Bereichen ganz weggefallen ist. Vom Grundsatz her kann heute jeder bei genügender Anstrengung in Schule und Ausbildung neue Wege beschreiten und beruflich wie von der gesamten Weltauffassung her die in seiner Familie üblichen Pfade hinter sich lassen. Die gestiegene Freiheit des einzelnen ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere die Schattenseite ist die Verschärfung des Allokationsproblems. So wird in der Soziologie die Erscheinung bezeichnet, dass bei freier Wahl für manche sozialen Gruppen (einschließlich der Berufsgruppen) zu viel Nachwuchs zur Verfügung steht und für manche anderen Gruppen zu wenig. Bei einigen Berufen gibt es sogar eine ziemlich regelmäßige Abfolge von Überangebot und Unterversorgung. Das ist beispielsweise im Lehrerberuf der Fall, wo sich seit der Entstehung der staatlichen Lehrerausbildung im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert Zeiten der Lehrerschwemme und des Lehrermangels abwechseln. Die Allokations-, die Zuordnungs- und Platzierungsschwierigkeiten sind in der offenen Gesellschaft bis zu einem gewissen Grad unvermeidlich. Wo es keine ständische und nur wenig staatliche Steuerung gibt, entscheiden die Menschen selbst. Es gehört zum Preis der Freiheit, dass sie neben vielen richtigen manchmal auch falsche Entscheidungen treffen und damit sich und anderen Nachteile einhandeln. Bedenklich wird die Lage dann, wenn sich die Fehlentscheidungen häufen: Sie können für den einzelnen wie gesamtgesellschaftlich hohe Kosten verursachen und ganze Wirtschaftszweige beeinträchtigen. Mehrere Studien deuten darauf hin, dass die Allokationsschwierigkeiten in puncto Ausbildung, Beruf und Arbeitsplatz in den nächsten Jahren in Deutschland eher zu- als abnehmen werden. Für diese Annahme werden die folgenden Überlegungen angeführt: 1. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die im allgemeinbildenden oder im beruflichen Schulwesen die Berechtigung zum Studium an einer Hochschule erwerben, ist über die letzten Jahrzehnte auf mehr als 50 % des Altersjahrgangs
8 8 Aaron Löwenbein, Frank Sauerland und Siegfried Uhl gestiegen. Gleichzeitig sind die Noten besser geworden. Die Studierneigung ist groß: Die meisten, die dazu berechtigt sind, nehmen auf kurz oder lang auch tatsächlich ein Studium auf. 2. Bei einer ganzen Reihe von Berufen wird sich Deutschland nicht dem Beispiel anderer Staaten verschließen können und die Ausbildung früher oder später akademisieren, d. h. aus dem beruflichen Schulwesen in die Hochschulen verlagern. Das ist bei den Gesundheits-, Pflege- und Erziehungsberufen teilweise bereits geschehen; wahrscheinlich werden weitere folgen. 3. Dem Aufschwung der Hochschulausbildung stehen angesichts des demographischen Wandels und der jahrzehntelang rückläufigen Geburtenrate notwendigerweise Einbußen bei der dualen und der vollzeitschulischen Berufsausbildung gegenüber. Schon 2013 gab es mehr Studienanfänger als Schulabgänger, die eine Berufsausbildung außerhalb der Hochschulen begannen. Daran wird sich so die Voraussagen in den nächsten zwanzig Jahren nichts ändern. Die Zahl der Studierenden wird gleichbleiben oder sogar noch steigen, die Zahl der Auszubildenden im außerakademischen Bereich weiter sinken. 4. Der Siegeszug der akademischen Ausbildung kommt nicht von ungefähr. Er ist in Deutschland wie in vielen anderen Staaten aus wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Erwägungen erwünscht gewesen und seit den sechziger Jahren von den Regierungen unterstützt worden. Die Ausweitung des Hochschulstudiums galt als Königsweg des sozialen Aufstiegs und gleichzeitig als wirtschaftlich unumgänglich. Der gewaltige Bedarf an Ingenieuren, Lehrern und anderen akademisch ausgebildeten Fachkräften war nur über die Ausschöpfung der Begabungsreserve zu decken. Heute mehren sich die Anzeichen, dass die annähernde Verzehnfachung der Studienanfängerquote ein Pyrrhussieg gewesen ist und der Akademisierungswahn (Julian Nida-Rümelin) die außerakademische Berufsausbildung hat ausbluten lassen: rein zahlenmäßig, aber auch hinsichtlich ihres Ansehens in der Öffentlichkeit. 5. Bei vielen Ausbildungsangeboten sowohl innerhalb als auch außerhalb der Hochschulen ist ein Auseinandertreten von Bedarf und Nachfrage festzustellen. In den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen fehlt es an Studierenden; die geistes- und sozialwissenschaftlichen Studiengänge sind überfüllt. Ein ähnliches Bild bei der dualen und vollzeitschulischen Berufsausbildung: Die Schulabgänger drängen in einige wenige Ausbildungsberufe in der Industrie, im Einzelhandel, im Dienstleistungsbereich und im Erziehungs-, Sozial- und Gesundheitswesen. Die Handwerksberufe zumal die körperlich anstrengenden, die wenig angesehenen und die Berufe mit ungewöhnlichen Arbeitszeiten werden gemieden. Ein Teil der Ausbildungsplätze bleibt unbesetzt. Manche Betriebe haben sich ganz aus der Ausbildung zurückgezogen, weil sich bei ihnen keine geeigneten Bewerberinnen und Bewerber einfinden. Bei der Beschreibung der Allokationsschwierigkeiten stehen häufig die abträglichen Folgen für das Erwerbsleben und die Leistungsfähigkeit der Unternehmen im Vor-
9 Einführung 9 dergrund. Das ist verständlich, trifft aber nicht die ganze Wahrheit. Neben den wirtschaftlichen Verlusten haben Fehlentscheidungen bei der Berufswahl nicht selten auch einen hohen Preis für die persönlich Betroffenen. Wenn unpassende Ausbildungswege eingeschlagen werden, wird die Ausbildung im Betrieb, in der beruflichen Schule oder an der Hochschule schnell zur Enttäuschung. Viele betrachten sie als notwendiges Übel, das man mit zusammengebissenen Zähnen und mit möglichst geringem Aufwand hinter sich bringt. Je nach Bereich zwischen 20 und 40 % brechen die Ausbildung ab. In der Ratgeberliteratur und in der Presse kann man mitunter lesen, dass die hohe Abbrecherquote nicht unbedingt ein Grund zur Besorgnis sei. Manche Menschen gewönnen erst aus dem Scheitern die Kraft, ernsthaft über ihre berufliche Zukunft nachzudenken. Sie kämen dann im zweiten Anlauf und in einem anderen Ausbildungsgang zum Ziel. Häufig wird auch auf die vielen Berühmtheiten hingewiesen, die die Schule, die Ausbildung oder das Studium abgebrochen hätten und trotzdem in Staat, Politik, Wirtschaft, Kunst und Medien in Spitzenränge aufgestiegen seien. Ein Teil der Zuversicht ist sicher angebracht, auch wenn es nicht jeder Schul- und Ausbildungsabbrecher bis zum Außenminister bringt. Eines muss man aber im Auge behalten: Empirisch ist wenig darüber bekannt, was aus der großen Mehrheit der Abbrecher wird und wie viele später doch noch mit Erfolg ein Studium oder sonst eine Berufsausbildung abschließen. Sicher ist, dass die Umwege Zeit und Geld kosten und für den einzelnen wie für die Menschen in seiner Umgebung mit erheblichen seelischen Belastungen verbunden sind. Man kann es drehen und wenden, wie man will: Abbrechen heißt immer auch versagen, und das geht an kaum jemand spurlos vorüber. Aber auch ohne jeden Bezug auf die individuellen psychischen Kosten kann man aus rein volkswirtschaftlicher Sicht die Frage stellen, ob sich unsere Gesellschaft das Phänomen der Abbrüche weiter leisten soll oder kann, nicht zuletzt wegen der oft beträchtlichen Mehrkosten für eine Mehrfachausbildung, die ganz oder zum großen Teil vom Steuerzahler zu tragen sind. Von der Grundbeschaffenheit her sind die Schwierigkeiten bei der Suche nach der richtigen Schul-, Ausbildungs- und Berufslaufbahn keine neue Erscheinung. Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, zwischen den Wünschen und Erwartungen der Bewerber und den Anforderungen in den Ausbildungseinrichtungen und Betrieben hat auch in der Vergangenheit immer wieder Anlass zu Besorgnis gegeben. Als Gegenmaßnahme ist beispielsweise für bestimmte Mangelberufe geworben und von überlaufenen Ausbildungs- und Studiengängen abgeraten worden. Man hat ein anderes Beispiel die Eingangsvoraussetzungen je nach Bedarf strenger gemacht oder abgesenkt. Auch die nordrhein-westfälische Kollegschule der siebziger bis neunziger Jahre, an der die Schülerinnen und Schüler eine Berufsausbildung durchlaufen und zugleich die allgemeine Hochschulzugangsberechtigung erwerben konnten, war nicht zuletzt als Hilfe bei der Wahl der Berufslaufbahn gedacht. Ihre Abgänger hatten mit einiger Wahrscheinlichkeit sowohl eine Vorstellung von den akademischen als auch von den außerakademischen Tätigkeitsfeldern erworben. Sie müssten so die Erwartung wegen ihrer größeren Sachkenntnis besser begründete
10 10 Aaron Löwenbein, Frank Sauerland und Siegfried Uhl und weniger änderungsanfällige Entscheidungen treffen als andere Schülerinnen und Schüler, die weniger Einblick und Vergleichsmöglichkeiten hätten. Aus heutiger Sicht ist schwer zu beurteilen, ob und wie viel diese und ähnliche Maßnahmen genützt haben. Aber ganz gleich, ob sie sich bewährt haben oder nicht: Sie reichen anscheinend nicht aus. Nach wie vor sind viele junge Menschen unsicher über den richtigen Ausbildungs- und Berufsweg, sie entscheiden sich auf unzureichender Wissensgrundlage und immer noch unzuträglich viele brechen die Ausbildung oder das Studium ab. Die Kernfrage ist die gleiche wie früher: Was kann man dagegen unternehmen? Die Lösung liegt auf der Hand wenigstens bei allgemeiner Betrachtung vom sicheren Schreibtisch aus und lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Man sollte alles daransetzen, dass sich die jungen Menschen rechtzeitig Gedanken über ihre berufliche Zukunft machen und sich für einen Ausbildungsweg entscheiden, der zu ihren Fähigkeiten und Neigungen ebenso passt wie zum voraussichtlichen Bedarf. Damit sie das können, muss ihnen die ältere Generation zu den erforderlichen Entscheidungsgrundlagen verhelfen. Für die Entscheidung wird zunächst einmal Wissen gebraucht, und zwar über die für die Ausbildung erforderlichen Voraussetzungen und über die Anforderungen bei der Ausübung der einzelnen Berufe. Dazu gehören geistige und körperliche Qualitäten beispielsweise bestimmte mathematische, naturwissenschaftliche oder kaufmännische Kenntnisse, die Beherrschung der Mutter- und vielleicht auch von Fremdsprachen in Wort und Schrift, technisches Vorstellungsvermögen, Denk- und Problemlösefähigkeit, außerdem je nach Beruf Kraft, Gewandtheit und Belastungsfähigkeit. Nicht weniger wichtig sind die außerintellektuellen Persönlichkeitsmerkmale: die sozialen und moralischen Kompetenzen, das Berufsethos und die Arbeitstugenden, Einfühlungsvermögen und Geschick im Umgang mit Menschen, ästhetisches Verständnis und gute Umgangsformen. Als zweites sollte man bei der Berufswahl über sich selbst Bescheid wissen. Verfügt man über die intellektuellen und charakterlichen Voraussetzungen und die Motivation, um sich um einen Ausbildungsplatz in seinem Wunschberuf bewerben und die Ausbildung dann auch mit Erfolg abschließen zu können? Und falls es daran hapert: Besteht bei nüchterner Betrachtung Aussicht, dass man sich aufraffen und das Versäumte in vertretbarer Zeit aufholen kann? Solche Fragen lassen sich nur dann ehrlich und ohne Selbsttäuschung beantworten, wenn man die eigenen Stärken und Schwächen einzuschätzen vermag und sein Leistungs- und Durchhaltevermögen richtig beurteilen kann. Gerade im Jugendalter ist das nicht immer der Fall. Bisweilen werden die eigenen Fähigkeiten unter- oder überschätzt Stichwort juveniler Größenwahn. Hier sind Beratung und Unterstützung bei der Selbsterkenntnis von Nutzen und eigene Erfahrungen. Damit sind wir bei Punkt drei angelangt. Als Entscheidungshilfe haben eigene Erfahrungen besonderes Gewicht. Deswegen werden schon während des Besuchs der allgemeinbildenden Schule berufspraktische Tage, Kurzpraktika, Schnupperlehren, Girls und Boys Days, Betriebspraktika, Schülerinformationstage an den Hoch-
11 Einführung 11 schulen und dergleichen mehr angeboten. Sie sollen den Schülerinnen und Schülern dabei helfen, einen ersten Eindruck von den Anforderungen im Beruf zu gewinnen und sich über ihre Berufswünsche klarzuwerden im Idealfall unter realistischer Einschätzung der eigenen Möglichkeiten. Viertens ist eine Vorstellung davon zweckmäßig, wie es um Angebot und Nachfrage bestellt ist. Wie sind die Aussichten, später in dem gelernten oder studierten Fach tätig sein zu können? Fehlt der Nachwuchs oder ist der Beruf überlaufen? Wird er auch künftig gebraucht oder fällt er dem technischen Fortschritt zum Opfer? Wie sind die Verdienst-, Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten? Solche Fragen sind schwer zu beantworten, vor allem wenn man dafür weit in die Zukunft blicken muss. Trotzdem können die Arbeitsmarktfachleute aufgrund früherer Erfahrungen für viele Berufe mit einiger Sicherheit voraussagen, wie sich der Bedarf in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gestalten wird. Solche Vorhersagen sind ungeachtet ihrer unvermeidlichen Unzulänglichkeiten als Entscheidungsgrundlage zuverlässiger als wohlmeinende, aber manchmal wenig durchdachte Ratschläge aus dem Bekanntenkreis, oberflächliche Eindrücke aus dem Fernsehen, schieres Wunschdenken oder was bei der Lebensplanung sonst noch hereinspielt. Fünftens: Wenn man als junger Mensch die Sache ernst nimmt und die Entscheidung über seinen Ausbildungsweg nicht einfach aus dem Bauch heraus treffen möchte, dann muss man dabei viele verschiedene Umstände berücksichtigen und mit ihrem Für und Wider gegeneinander abwägen. Weil kaum jemand gleichzeitig alles Wichtige im Auge behalten kann, bieten sich schriftliche Hilfen für das Sammeln, Ordnen und Gewichten der einzelnen Gesichtspunkte an. Solche Hilfen gibt es auf Papier und in elektronischer Form. Einige kann man auf eigene Faust durcharbeiten, andere sind in erster Linie für den Einsatz im Schulunterricht gedacht. Die Maßnahmen, mit denen die Berufswahl der Jugendlichen unterstützt und Fehlentscheidungen verringert werden sollen, werden unter dem Namen Berufsorientierung zusammengefasst. Die Spannbreite ist beträchtlich. Sie reicht von den ersten Grundschul- oder sogar Kindergartenausflügen zu Betrieben und öffentlichen Einrichtungen bis zu den Informationstagen für Abiturienten und Hochschulabsolventen. Der Schwerpunkt liegt am Ende der Sekundarstufe I, wo üblicherweise in allen Schulformen die Betriebserkundungen und -praktika stattfinden. Die Hauptlast tragen die Schulen und die dort tätigen Lehrkräfte. Sie haben, wie es zum Beispiel im hessischen Erlass zur Ausgestaltung der Berufs- und Studienorientierung in Schulen vom 8. Juni 2015 heißt, die Aufgabe, ihre Schülerinnen und Schüler fächerübergreifend auf [die] Berufswahl und Berufsausübung vorzubereiten. Zu diesem Zweck sollen die Schulen neutrale und umfassende Beratungen über Qualifikationsmöglichkeiten (gewährleisten). Am Ende ihrer schulischen Laufbahn sollen die Schülerinnen und Schüler in der Lage sein, eine ihren Kompetenzen entsprechende fundierte Berufs- oder Studienwahlentscheidung zu treffen und die dann an sie gestellten Anforderungen zu bewältigen ( 1). Viele allgemeinbildende und berufliche Schulen fühlen sich mit der großen Aufgabe der beruflichen Vorbereitung alleingelassen. Nicht ganz ohne Grund: Um der
12 12 Aaron Löwenbein, Frank Sauerland und Siegfried Uhl Vielfalt der Problemstellungen und Erziehungsaufgaben gerecht werden zu können, sind Zusatzmittel nötig, die der Dienstherr allein nicht in vollem Umfang aufzubringen vermag. Eine große Unterstützung sind daher neben den Stiftungen die einschlägigen Landes- und Bundesprogramme, die in aller Regel mit den entsprechenden Förderprogrammen der Europäischen Union korrespondieren. Viele davon haben ausdrücklich die berufliche Orientierung im Fokus. Neben Sachausgaben werden auch Personalkosten übernommen. Für die Akquirierung der Fördermittel sind die Einbindung des schulischen Fördervereins und die Zusammenarbeit mit dem Schulträger und den Sozialpartnern von Vorteil. Viele weitere öffentliche und private Einrichtungen sind ebenfalls in der Berufsorientierung tätig. Sie treten im Regelfall nicht als Konkurrenten der Schulen auf, sondern versuchen mit ihren Angeboten die schulische Berufsorientierung zu unterstützen, zu ergänzen und über den Abschluss der allgemeinbildenden Schule hinaus fortzuführen. Die außerschulischen Anbieter einer der bedeutendsten ist die Agentur für Arbeit arbeiten auch untereinander zusammen. Ein Beispiel dafür ist die Initiative Bildungsketten, die auf Anregung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, des Bundesministerium für Arbeit und Soziales und der Bundesagentur für Arbeit entstanden ist und der Abstimmung der verschiedenen Einzelmaßnahmen und ihrer Träger dienen soll. Nach der Breite und Vielfalt des Angebots zu urteilen, ist für die Berufsorientierung gut gesorgt. Wenigstens auf dem Papier. Die Grundschwierigkeiten sind allerdings noch die gleichen wie in den sechziger und siebziger Jahren. Teilweise haben sie wie das Allokationsproblem zugenommen. Der technische Fortschritt und die Digitalisierung beschleunigen den Wandel der beruflichen Anforderungen, und entsprechend schwierig sind Voraussagen über den künftigen Bedarf an akademisch und außerakademisch ausgebildeten Fachkräften. Weil immer noch viele junge Menschen mit falschen Erwartungen und ohne die nötigen Voraussetzungen eine Ausbildung beginnen, ist und bleibt die Berufsorientierung eine der wichtigsten erzieherischen Aufgaben. Das Angebot an Informationsunterlagen, Unterrichtsmaterialien, Beratungsmöglichkeiten und Entscheidungshilfen ist riesig und das Wissen immer noch gering, welche Maßnahmen im Verhältnis zum Aufwand am meisten Nutzen versprechen und welche weniger gut abschneiden. Es könnte sogar Fälle geben, wo die Anstrengungen ohne Wirkung verpuffen oder die unerwünschten Nebenwirkungen die Vorteile überwiegen. Die Beiträge in diesem Band sollen dabei helfen, sich auf dem unübersichtlichen Feld der Berufsorientierung zurechtzufinden, und einen Einblick in die verwickelten Zusammenhänge geben. Die Herausgeber haben sich um ein breites Spektrum von Themen bemüht und darauf geachtet, dass neben der immer ein wenig grauen Theorie auch die Ergebnisse der erfahrungswissenschaftlichen Forschung vorgestellt werden. Nur so kann man abschätzen, auf welchen Gebieten man schon gut Bescheid weiß und wo noch weiterer Forschungsbedarf besteht. Damit verknüpfen wir auch ein praktisches Anliegen. Denn nur wer die Stärken und Schwächen der vorhandenen Maßnahmen zur Berufsorientierung kennt, kann sie verbessern und effektiver machen.
13 Manfred Eckert Der Übergang von der Schule in die Berufsausbildung aus berufspädagogischer Sicht 1. Ein kurzer Überblick vorweg: Grundzüge der Berufswahl und der Berufswahlunterstützung Berufswahlvorbereitung in der Schule ist ein breites Thema: Unbestritten ist ihre Notwendigkeit, sichtbar ihr Erfolg, widersprüchlich die Erfahrungen der Lehrkräfte bei der Organisation. So wird zum Beispiel eine Betriebserkundung mit viel Aufwand organisiert. Der Ausbilder vor Ort müht sich redlich ab, um die interessanten Aspekte zu zeigen und für die Ausbildung zu werben. Manche Schülerinnen und Schüler sind sehr interessiert, andere völlig gelangweilt, was sie beschämend für die Lehrkraft durchaus auch sichtbar werden lassen können. Wir als Erwachsene würden aus Höflichkeit Interesse zeigen, auch wenn wir eine Sache langweilig fänden. Viel wirksamer ist es, wenn ein Betrieb sich entscheidet, die Schülerinnen und Schüler nicht durch seriöse Ausbilder, sondern durch engagierte Auszubildende herumführen zu lassen. Sie können aus der Jugendlichen-Perspektive beschreiben, warum sie in diesem Ausbildungsberuf und in diesem Betrieb gern ihre Ausbildung machen. Das sind spannende Fragen: Warum hat sich dieser fast gleichaltrige Mensch so entschieden? Was hat er zu berichten? Welche Erfahrungen hat er gemacht? Was gefällt ihm gut, was ist ein bisschen schwierig, wohin kann der berufliche Weg führen? Pädagogisch formuliert: Auszubildende reden nicht über Technologien, Ökonomien, Arbeitsorganisation, auch nicht über hohe Anforderungen, die den Zugang verbauen, sondern wie sie sie bewältigt haben. Aus ihrer konkreten Erfahrung können sie einen erfolgreichen Übergang darstellen der doch gerade jetzt den Schülerinnen und Schülern der Klasse 9 oder 10 mit allen seinen Unsicherheiten bevorsteht. Schon die reine Neugier macht die Sache lebendig, positive Erfahrungsberichte stimmen optimistisch. Berufswahl und Berufsausbildung haben mit persönlichem Interesse zu tun sie verlangen individuelle Orientierungen und Entscheidungen. Orientierungen erfordern Vor-Stellungen, schon um Richtungen abzustecken, in die der (Selbst-)Erkundungsweg gehen soll. Und hier wird das Spektrum breit: Es gibt Schülerinnen und Schüler, die wissen genau, wohin ihre berufliche Reise gehen soll, es gibt andere, die nicht die geringste Ahnung davon haben. Und es gibt ein Mittelfeld, auf dem diejenigen aufgestellt sind, die mehr oder weniger klare Wünsche und Vorstellungen haben. Gerade die Ahnungslosen hätten Unterstützung am nötigsten. Schwierige soziale Herkunftsmilieus, keine Vorbilder als Orientierungspunkte, geringe elterliche Unterstützung und damit verbundene Benachteiligungserfahrungen könnten zu den Ursachen gehören (Brändle & Grundmann, 2013). Die Lage zeigt ein Dilemma:
14 14 Manfred Eckert Berufswahl und Berufswahlreife sind ein Prozess. Er erfordert wenigstens eine vage Orientierung am Anfang, und er endet mit (vorläufiger) Klarheit. Das Modell eines hermeneutischen Prozesses zeichnet sich im Hintergrund ab: Je nach individuellem Stand der Vororientierungen muss unterschiedlich gestartet werden, und das ist für Schule immer eine sehr große, manchmal kaum bewältigbare Herausforderung. Insgesamt zeigen sich hier extrem hoch individualisierte Prozesse. Gute elterliche und familiale Unterstützung kann sich in manchen Fällen darauf einstellen, aber keineswegs immer. Wo der stützende Elterneinfluss fehlt, ist die Schule mit dieser schwierigen Aufgabe besonders gefordert. So sind es gerade die gering orientierten Jugendlichen, die eine besondere Hilfe nötig brauchen, obwohl es manchmal vorkommt, dass gerade diese Jugendlichen sie schlecht annehmen können, was die Sache schwierig macht. Hinzu kommen objektive hinderliche Faktoren. Da ist zu allererst die Lage auf dem Ausbildungsstellenmarkt anzusprechen. Wenn für eine große Zahl jugendlicher Ausbildungsplatzsuchender keine Ausbildungsstellen zur Verfügung stehen, sieht die Lage völlig anders aus, als wenn ein Überhang an unbesetzten Ausbildungsstellen besteht, wie das derzeit der Fall ist. Freilich sollte auch hier nicht verkannt werden, dass die Berufsentscheidung in ein Zwischenfeld fallen kann, zwischen einem idealen Wunschberuf auf der einen und den gegebenen realen Möglichkeiten auf der anderen Seite. Hier müssen oft Kompromisse gefunden werden, und wo diese nicht gelingen, droht ein Fehlstart ins Berufsleben, der mit Ausbildungslosigkeit oder mit Ausbildungsabbrüchen enden kann (Beinke, 2011; Bohlinger, 2003). Ob Ausbildung gelingt, ist nicht zuletzt aber auch eine Frage dessen, was man heute Ausbildungsqualität nennt. Werden in einem Ausbildungsbetrieb gute Sozial-, Lern- und Arbeitserfahrungen ermöglicht, ist das sicher förderlicher, als wenn das veraltete Modell Lehrjahre sind keine Herrenjahre realisiert wird. Frustrationserfahrungen zur Stärkung des individuellen Durchhaltevermögens sind heute weder zeitgemäß noch funktional. Zu dem gesamten Komplex der Berufsorientierung und Berufswahl gibt es viele theoretische Zugänge, und gerade in den letzten Jahren ist hier intensiv gearbeitet worden (Beinke, 2012; Berufsbildung, H. 160/2016; Brüggemann & Rahn, 2013; Driesel-Lange, 2011; Neuenschwander, Geber, Frank & Rottermann, 2012; Schlemmer & Gerstberger 2008; Ziegler 2016). Auch die älteren Berufswahltheorien sind hier zu erwähnen, sie haben durchaus Einleuchtendes anzusprechen (Driesel-Lange, 2011; Hirschi, 2013; Neuenschwander et al., 2012; Ratschinski, 2009; Ziegler, 2016). Aber sie führen immer eine besondere Betrachtungsperspektive mit sich, und es ist unzulässig, diesen Sachverhalt außer Acht zu lassen und Aussagen zu verabsolutieren. Theorien des Berufs, der Berufswahl, der ökologischen Übergänge, der gelingenden beruflichen Sozialisation zeigen wichtige und bedenkenswerte Aspekte, sie bieten wichtige Reflexionshorizonte, aber nur in Grenzen Handlungsanleitungen für Pädagogen und Lehrkräfte. Hier sind vielmehr die seit ca. zehn Jahren entwickelten Programme des Bundes und der Länder anzusprechen, in denen ein stufenweise aufgebautes Konzept zur Realisierung einer guten schulischen Berufsorientierung
15 Der Übergang von der Schule in die Berufsausbildung aus berufspädagogischer Sicht 15 entwickelt worden ist, das darzustellen und kritisch zu würdigen ist. Ein Blick auf die professionellen Anforderungen und Leistungen der Lehrkräfte soll den Beitrag abschließen. 2. Berufs- und berufsbildungstheoretische Vorüberlegungen: Beruf, Berufswahl, Beruf/Sozialisation/Biographie Der Begriff des Berufs stand lange im Mittelpunkt der Berufspädagogik. Dabei ist er sehr kontrovers diskutiert worden: Einerseits als das fast geheiligte Zentrum der Berufsbildungstheorie verehrt und idealisiert, andererseits als leere Begriffshülse deklariert, als antiquiert und in den Inhalten überholt, weil der moderne Arbeitsmarkt solche festen Schablonen der Qualifikation ohnehin nicht brauche und der Berufswechsel längst zum Alltag geworden sei. Kompetenzorientierung ist das aktuelle Schlagwort. Zu Recht ist kritisiert worden, dass der Berufs- und Berufsbildungsidealismus an den empirischen Realitäten vorbeigehen kann und damit zu einer Ideologie werden muss, die die Wirklichkeit verschleiert und pädagogisches Handeln fahrlässig an unzeitgemäßen Maßstäben orientiert. Davor sollte sich das berufspädagogische Handeln hüten. Wenn hier trotzdem einleitend auf diesen Berufsbildungsidealismus eingegangen wird, dann sollen damit Grundlinien skizziert werden, über die nachzudenken sich unverändert lohnt. Schon ein schneller Blick zeigt, dass unter dem Begriff Beruf sehr bedeutungsvolle Sachverhalte verhandelt worden sind (Ziegler, 2015). Da ist zunächst die soziale Bedeutung des Berufs. Beruf enthält soziale Statuszuweisungen, Teilhabe- und Entfaltungschancen, er verbindet soziale und personale Systeme. Er hat auch eine arbeitsmarktbezogene Bedeutung, denn Berufe sind geordnete und strukturierte Qualifikationsbündel, die in beruflichen Ausbildungsgängen systematisch angeeignet werden. Zugleich sind auch die Arbeitsteilung und die Arbeitsorganisation analog zur Differenzierung des Berufssystems aufgebaut. Auf dem Arbeitsmarkt wird Arbeitskraft in der Form des Qualifikationsbündels Beruf angeboten, und es wird Arbeitskraft in Form von Berufen nachgefragt. Auch wenn die Anforderungen an konkreten, oftmals auch spezialisierten Arbeitsplätzen selten identisch sind mit den komplexen Qualifikationsbündeln, die in einer Berufsausbildung vermittelt werden, bestehen doch häufig deutliche Parallelen. Zwar gibt es hinsichtlich der Passung von individuellem Arbeitsvermögen und Arbeitsplatzanforderungen Flexibilitäts-, Substitutions- und Gestaltungsspielräume, aber an der Grundform der Beruflichkeit der Arbeit ändert das wenig. Genau daraus resultiert auch die individualbiographische Bedeutung des Berufs. Selbst große berufsbiographische Umsteuerungsprozesse (Berufswechsel) haben ihre eigene Logik, und sie gehen von einer Station (häufig von der Berufsausbildung und den beruflichen Arbeitserfahrungen) zu einer anderen, so wie eben jede Reise nur von einem (konkreten) Ort zu einem anderen erfolgen kann.
16 16 Manfred Eckert Genauer betrachtet geht es hier um das Verhältnis von individuellem Arbeitsvermögen und konkreten Arbeitsanforderungen. Auch der Berufswahlprozess geht häufig von solchen Passungsvorstellungen aus, die ja auf den ersten Blick auch sehr einleuchtend sind. In dem historischen Prozess, in dem die Berufseinmündung nicht mehr durch Stand und Status definiert, sondern aufgrund einer Wahlentscheidung festgelegt werden kann (Heisler, 2016), treten Fragen von Eignung und Neigung in den Vordergrund. Hier setzt insbesondere die Berufswahlforschung an. Aus psychologischer, soziologischer und pädagogischer Sicht wird der Frage nachgegangen, wie persönliche (Kompetenz-)Entwicklungsprozesse und Kompetenzanforderungen beruflicher Ausbildungsgänge zueinander passen und wie sich individuelle Motivations- und berufliche Handlungsstrukturen aufeinander beziehen lassen. So sind Kompetenzfeststellungsverfahren oder Potentialanalysen heute ein fester Baustein in der Berufsorientierung. Die Vorstellung, dass durch ein solches Verfahren gleichsam über den Kopf des jungen Menschen hinweg geklärt werden könne, welcher Beruf für sie oder ihn besonders gut geeignet und empfehlenswert sei, wird heute nicht mehr vertreten. Sie käme einer wohlmeinenden Entmündigung gleich. Trotzdem zeigt sich, dass junge Menschen durchaus an solchen Testverfahren interessiert sind, weil hier nicht wie allzu oft in der Schule nur die Leistungsdefizite, sondern auch die Potentiale sichtbar gemacht werden. Genauer zu erfahren, was ich gut kann, ist immer interessant und informativ und sicher ein wichtiger, motivationsfördernder Baustein innerhalb der Berufsorientierung. Dabei spielt es weniger eine Rolle, welches psychologische Konzept hinter solchen Verfahren steht ob es um eine Passung von Persönlichkeitsprofilen und berufsfeldtypischen Dispositionen (Holland, 1997; ähnlich Spranger, 1930) oder um persönliche Entwicklungsprozesse im Sinne einer Berufswahlreife geht. Wichtig ist, dass junge Menschen angeregt werden, sich mit der Frage ihrer eigenen Berufswahl gründlich auseinanderzusetzen und ein fundiertes berufliches Selbstkonzept zu entwickeln. Das ist eine Entwicklungsfigur, die bereits Spranger (1924) sehr klar angesprochen hat. Berufsbildungstheoretisch betrachtet liegt hinter diesen Überlegungen etwas sehr Grundlegendes. Nicht nur die im Hintergrund erkennbare Figur der persönlichen Selbstverwirklichung, wie sie im deutschen Idealismus häufig angesprochen worden ist, sondern auch ein lern- und entwicklungstheoretisches Konzept. Diesen idealisierenden Grundgedanken hat Kerschensteiner (1999), der Altmeister der Berufsbildungstheorie, beispielhaft in seinem Grundaxiom des Bildungsprozesses für alle Lernprozesse generell entwickelt: Aus seiner Sicht muss der Bildungsprozess genau mit jenen Kulturgütern (zu denen auch der Beruf gehören kann) anfangen, die dem individuellen Seelenrelief des jungen Menschen entsprechen. Die im spezifischen Kulturgut aufgespeicherte Energie muss im Lernprozess durch handelndes Aneignen, durch Nach-Denken und Nachkonstruieren beim Jugendlichen wieder freigesetzt und durch handelndes Lernen und lernendes Handeln angeeignet werden. Empirische Bildungsforschung kann sich auf einen solchen begrifflich offenen Ansatz ( Seelenrelief ) kaum einlassen. Aber der Grundgedanke enthält pädagogische
17 Der Übergang von der Schule in die Berufsausbildung aus berufspädagogischer Sicht 17 Plausibilität: Lernprozesse werden erheblich erleichtert, wenn der junge Mensch ein Interesse an den Lerninhalten entwickeln kann. Schulpädagogisch oder psychologisch gesehen ist das die Aufgabe der Motivationsphase des Unterrichts. Aber selbst die geschickteste Motivationstechnik stößt auf Grenzen, wenn sich kein Interesse wecken lässt. Richtig bedeutungsvoll wird dieser Ansatz bei der Berufswahl. Sie sollte immer eine individuelle Entscheidung sein, sollte auf fundierten Berufswünschen aufbauen und persönliche Entfaltungswünsche, Handlungs- und Entwicklungspotentiale aufnehmen, subjektive berufliche Perspektiven klären und weiterentwickeln. Plakativ formuliert: Der Beruf muss dem Seelenrelief entsprechen, oder anders formuliert: Er muss Chancen zur Selbstverwirklichung bieten. Das könnte als Unsinn abgetan werden, weil daraus keinerlei vernünftige Operationalisierung folgen kann. Richtig ist aber, dass vieles von dieser Grundidee in die Berufsorientierung Eingang gefunden hat. Die Frage Was willst Du werden? ist der erste Schritt der Selbstexploration, die häufig darauf folgende Potentialanalyse zeigt mehr oder weniger gut ausgebaute Kenntnisse und Fähigkeiten. Die anschließenden Erfahrungen in Ausbildungswerkstätten und in Praktika zeigen Anforderungen und Chancen betrieblichen Handelns (wenn das Praktikum gut läuft). Hier müssen viele Sachverhalte gut zusammenkommen, damit dem jungen Menschen die Einmündung in seinen Beruf und in den konkreten Ausbildungsbetrieb gelingt. Nötig sind entsprechende individuelle Erfahrungs- und Erprobungsprozesse, damit begründete Entscheidungen getroffen werden können. Die unverändert hohe Abbrecherquote der Berufsausbildung von ca. 25 % zeigt, dass hier in zu vielen Fällen mit großem Aufwand und hohen Kosten und großen Enttäuschungen auf allen Seiten nachjustiert werden muss. Abbrüche sind in vielen Fällen Neuorientierungen: Es werden eine andere Berufsausbildung und ein anderer Betrieb gesucht. Aber die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe wird dabei sicher nicht gefördert. 3. Übergänge, Statuspassagen, Biographie und Entwicklung. Die Ökologie der (gelingenden) Übergänge Übergänge sind Bestandteil jeder Biographie, der Wechsel von der Schule in die Berufsausbildung ist einer davon (Schröer, Stauber, Walther, Böhnisch & Lenz, 2013). Sie lassen sich als Statuspassagen beschreiben, und gelingende Übergänge können wichtige Bausteine einer guten Entwicklung sein. Das Modell einer ökologischen Sozialisationsforschung (Bronfenbrenner, 1981) hat auf diese Überlegungen erheblichen Einfluss gehabt. Es kontrastiert zwei Interpretationslinien, die bis heute aktuell sind. Auf der einen Seite steht das Modell, das eher einem schulpädagogischen Denken entspricht: Ein Übergang wird erfolgreich bewältigt, wenn die Anforderungen, die das abgebende System stellt hier: die allgemeinbildende Schule, gut erfüllt worden sind. Gute Leistungen in den wichtigen Schulfächern stehen aus dieser Sicht im Mittelpunkt, wenn der Einstieg gut gelingen soll. Die Diskussion
18 18 Manfred Eckert um die Ausbildungsreife und den Kriterienkatalog des Nationalen Pakts für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs (2006) bringt genau dieses Denken zum Ausdruck. Sicher richtig ist, dass gute Leistungen in den einschlägigen und für den gewählten Beruf bedeutsamen Schulfächern für eine Berufsausbildung förderlich, ja manchmal fast unabdingbar sind. (Beispielhaft mit Kerscheinsteiner gesprochen: Wenn im Seelenrelief so gar keine Disposition für Mathematik und Naturwissenschaften auffindbar ist, dann könnte auch der Weg in eine technische Berufsausbildung wenig erfolgversprechend sein.) Allerdings ist schon aus berufspsychologischer Sicht der Begriff der Ausbildungsreife relativiert worden. Da es niemals um Berufsausbildung schlechthin, sondern immer um eine konkrete Ausbildung in einem gewählten Beruf geht, kommt es mehr auf eine konkrete, auf den einzelnen Beruf bezogene Berufs(ausbildungs) reife als auf eine abstrakte Ausbildungsreife an (Dobischat, Kühnlein & Schurgatz, 2012; Hielke, 2008). Berufsbildungstheoretisch betrachtet sind es nicht die Inhalte einer Berufsausbildung, die an sich von Bedeutung sind. Verschiedene Berufe haben sehr verschiedene Inhalte. Auch die damit verbundenen Karrierechancen werden hier kaum zum Thema. Wichtig werden diese Inhalte allein in Bezug auf das lernende Subjekt und auf dessen Interesse, sich genau diese Inhalte und die damit verbundenen Fähigkeiten und Fertigkeiten anzueignen und sie in der Berufspraxis einsetzen zu können. Aus dieser Perspektive wird deutlich, warum eine gelingende Berufswahl aus berufsbildungstheoretischer Sicht so eminent bedeutungsvoll ist. Ein schulpädagogisch akzentuierter Allgemeinbildungsanspruch setzt andere Akzente: Hier sind es die einzelnen Schulfächer, denen ein Bildungswert zugeschrieben wird. Guten Leistungen in möglichst allen diesen Fächern wird hier ein besonderer Wert und den erfolgreichen Absolventen eine besondere Reife zur Bewältigung der folgenden Bildungsanforderungen zugemessen. Aus berufspädagogischer Sicht stellt sich das anders dar. Hier geht es um Lerninhalte, die ihren Sinn und ihre Bedeutung in der Beruflichkeit des Handelns in der Ausbildung und der Arbeitswelt finden (so zum Beispiel sind die Inhalte des beruflichen Fachrechnens andere als die der Mathematik in der Schule wobei die formale Struktur der Mathematik keine andere ist). Spezifische berufliche Lerninhalte können neue Interessenlagen ansprechen, denn berufliches Wissen ist eher auch ein verwertbares Wissen. Das alles ist freilich nur erfolgversprechend, wenn wie bereits angesprochen die Berufswahl gut gelungen ist. Damit tritt die Frage in den Mittelpunkt, wie der Übergang von der Schule in die Berufswelt erfolgreich sein kann. Die ökologische Sozialisationsforschung hat darauf eine interessante Antwort gegeben. Gute Übergänge erfordern nicht abgegrenzte Bildungsanstalten, die als soziale Systeme nacheinander durchlaufen werden, sondern Vernetzungen zwischen diesen Systemen. Schon im System der Schule sollten erste Erfahrungsbrücken in die Arbeitswelt, in zukünftige Ausbildungsbetriebe und -berufe gebaut werden, und es sollte gezeigt und geübt werden, wie die Übergänge bewältigt werden können. Der Umgang mit der Berufsberatung und dem Berufsinformationszentrum gehört ebenso dazu wie erste Erfahrungen in betrieblichen Interaktions- und Arbeitszusammen-
19 Der Übergang von der Schule in die Berufsausbildung aus berufspädagogischer Sicht 19 hängen. Solche Erkundungen und Praktika gehören heute zum Standardprogramm guter Schulen. Lange Zeit wenig berücksichtigt, aber heute zunehmend mehr erforscht ist der Elterneinfluss das Mikrosystem Familie bei der Berufswahl (Mayhack, 2011; Ziegler, 2016). Auf den ersten Blick geht es dabei um elterliche Beratungs- und Betreuungskompetenzen, die sicher von großer Bedeutung sind. Die ökologische Sozialisationsforschung hat aber gezeigt, dass entwicklungsförderliche Übergänge auch dann eintreten, wenn junge Menschen an sozialen Systemen teilhaben können, an denen sie nicht unmittelbar aktiv beteiligt sind, deren Auswirkungen sie aber sehr berühren können. Von besonderer Bedeutung ist hier die Arbeitswelt der Eltern und anderer naher Bezugspersonen. Selbstverständlich nehmen Kinder an dieser Welt nicht unmittelbar teil, aber sie erleben die Art und Weise, wie im Familiensystem damit umgegangen wird, wie Eltern Anforderungen annehmen und gestalten oder auch, dass Arbeit nur als Mühsal und Entfremdung erlebt wird oder wie ein Leben ganz ohne Arbeit in Arbeitslosigkeit aussieht und wie dabei die Bedeutung von Arbeit aus dem Blick geraten kann. Diese unterschiedlichen Sozialisationsmilieus haben starken Einfluss auf die Art, wie sich Übergangsprobleme aus subjektiver Sicht darstellen (Brändle & Grundmann, 2013). Bieten sie erste Einblicke und erste konkrete Vorstellungen von der Berufs- und Arbeitswelt, zeigen sie die Bewältigbarkeit des Ausbildungs- und Berufseinstieges oder ist gerade das Gegenteil der Fall? Letzteres könnte zu großen Unsicherheiten bis hin zu schwierigen Verweigerungshaltungen führen. Wie bereits angesprochen, ist hier die Schule besonders gefragt, und gerade dort, wo die Ausgangsbedingungen besonders prekär sind, ist der größte Einsatz gefordert. Aus dieser Sicht betrachtet sind es die unterschiedlichen sozialen Milieus und ihre Nähe oder Ferne zur Arbeitswelt, die berufliche Einmündungen fördern oder behindern können. Dass es darüber hinaus auch sehr spezifische elterliche/ familiale Erwartungsfiguren gibt, die sich stark normierend und sehr restriktiv auf Berufsentscheidungen auswirken können, sei hier nur am Rande angemerkt. Die Qualität der Berufsausbildung und des Ausbildungsbetriebes Auf den ersten Blick scheint die gelingende Einmündung in Ausbildung und Beruf eine Frage der Qualität der Berufsvorbereitung des einzelnen Jugendlichen zu sein. Die oft gestellten Fragen nach Potentialen, Kompetenzen, passgenauer Einmündung, Lern- und Leistungsbereitschaft etc. stellen immer wieder den Jugendlichen in den Mittelpunkt. Die Unterstellung, dass hier der entscheidende Bedingungsfaktor liegt, greift jedoch zu kurz. Es sind die Betriebe, in denen sich die Realität der Ausbildung vollzieht, und hier gibt es deutliche Unterschiede. Sie betreffen auch die verschiedenen Berufe, die Branchen und schließlich auch die Ausbildungsqualität der einzelnen Betriebe selbst. Ob eine Ausbildungseinmündung erfolgreich verläuft, hängt auch von der Organisation der Ausbildung und der Kompetenz des ausbildenden Personals ab. Das sind einerseits die hauptamtlichen Ausbilder, andererseits aber auch die
20 20 Manfred Eckert vielen Fachkräfte, die an der Ausbildung mitwirken, wenn sie Auszubildende anleiten (Brater, 2011). Ein Indikator für die Gestaltungskompetenzen der Ausbildenden könnte die Ausbildungszufriedenheit der Auszubildenden sein, die in vielen Studien immer wieder untersucht worden ist. Werden die Ergebnisse als Durchschnittswerte dargestellt, schneidet die Duale Ausbildung relativ gut ab. Die Zufriedenheit der Auszubildenden ist hinreichend gegeben. Etwas anders stellt sich die Lage dar, wenn die Berufsbildungsreporte der Gewerkschaften herangezogen werden. Nach ausbildungsfremden Tätigkeiten, Systematik der Ausbildung im Betrieb, Betreuung durch Ausbildende, angemessener Entlohnung, Überstunden und besonderen Belastungen befragt, zeigen sich ganz andere Profile. Die Ausbildungszufriedenheit variiert stark nach Ausbildungsberufen und Branchen, und die Abbrecherquoten sind unterschiedlich hoch (DGB, 2016). Hier entsteht unter der Hand eine neue, auch für die Berufswahl bedeutungsvolle Problematik: In manchen Berufen, zum Beispiel die im einfachen Dienstleistungsgewerbe wie in der Gastronomie und im Nahrungsmittelgewerbe, sind die Belastungen (Arbeitszeit, Monotonie etc.) relativ groß, und zugleich sind Auszubildende schlecht zu finden. Gerade hier wird deswegen sehr geworben, auch und gerade bei jenen Jugendlichen, die bis zum Schluss der regulären Bewerbungsfrist keine Stelle gefunden haben. Aber genau die Besetzung dieser Ausbildungsstellen erfordert eine sehr fundierte und überlegte Entscheidung, um die entsprechenden Belastungen auszuhalten. Als Notlösung sind solche Arten der Einmündung gar nicht geeignet, obwohl sie oft so propagiert werden. Darin liegt eine Problematik, auf die der aktuelle Berufsbildungsbericht (BMBF, 2016a, S. 48) in Bezug auf junge Migrantinnen und Migranten ausdrücklich hinweist. Das Problem ist aber keineswegs auf diese Zielgruppe begrenzt, wie der Ausbildungsreport der Gewerkschaften (DGB, 2016) zeigt. Zwar spricht diese jährlich erstellte Studie auch von einer hohen Ausbildungszufriedenheit insgesamt, aber sie zeigt deutlich die extremen Unterschiede zwischen einzelnen Ausbildungsberufen. Auch die individuellen Belastungen variieren stark und dürfen nicht unterschätzt werden. Hier können sich viele, auch individuelle oder betriebsbezogene Faktoren auswirken, die Ausbildungsabbrüche nach sich ziehen, wie die Abbrecherstudien zeigen. Insofern sind die Programme zur Verbesserung der Ausbildungsqualität (Ebbinghaus, 2009; Ebbinghaus, Tschöpe & Velten, 2011; Fischer, 2014) ein sehr richtiger Ansatz. Das alles ändert nichts daran, dass Berufseinmündung, Ausbildungszufriedenheit und Ausbildungserfolg auch durch sehr individuelle, vielleicht sogar existenzielle Prozesse und Ereigniskonfigurationen bedingt sind. Pädagogisch schauen wir immer zuerst auf das Subjekt, auf seine Potentiale, Kompetenzen, Wünsche und Neigungen. Sie sollen mit dem gewählten Beruf möglichst weitgehend übereinstimmen. Mit dem Eintritt in einen Ausbildungsbetrieb war traditionell besonders in der industriellen Berufsausbildung jedoch der weitere Prozess der beruflich-betrieblichen Sozialisation weitgehend depersonalisiert. Industrielle Betriebe arbeiteten nach einer Rationalität, in der die meisten persönlichen Besonderheiten explizit ausgeblendet wurden, sie sollten im industriellen Produktionsprozess und in der Arbeitsorganisation keine
21 Der Übergang von der Schule in die Berufsausbildung aus berufspädagogischer Sicht 21 Rolle spielen. Traditionell war auch die betriebliche Berufsausbildung dementsprechend organisiert. Das hat sich geändert. Nicht zuletzt der Einfluss der Sozialpädagogisch orientierten Berufsausbildung im Rahmen der Benachteiligtenförderung, aber auch die Diskussionen zur Humanisierung der Arbeitswelt in den 1980er und 1990er Jahren haben dieses funktionalistische Menschenbild revidiert. Sehr viel stärker ist auch bei den betrieblichen Ausbildern ins Bewusstsein getreten, dass junge Menschen, die in den betrieblichen Arbeitsprozess als Auszubildende eintreten, ihre eigenen Problemlagen mitbringen. Sie sind in biographische Entwicklungsprozesse des Erwachsenwerdens eingebunden, und sie haben vielfältige Betreuungs- und Unterstützungsbedarfe. Ausbildungsbegleitende Hilfen und sozialpädagogische Betreuungsangebote sind hier ebenso erforderlich wie neue pädagogische Kompetenzen auf Seiten der Ausbildenden. Dazu gibt es durchaus interessante Ansätze (Schemme, 2014). Zu bedenken ist auch, dass junge Auszubildende immer in einen konkreten Betrieb eintreten und dort auf ebenso konkrete ausbildende Personen treffen. Sie finden betriebsbezogene Arbeitsaufgaben und Interaktionsprozesse vor, in denen sie ihre eigene Rolle finden müssen, die nicht zuletzt auch von persönlicher Anerkennung und kleinen Erfolgen, aber auch von der erfolgreichen Bewältigung von Belastungen abhängig ist. Gerade weil die Arbeit der Auszubildenden im Betrieb nicht in einem pädagogisch geplanten Schonraum stattfindet, sind die Ausbilderinnen und Ausbilder hier besonders gefordert. Sie gestalten die Lern- und Arbeitssituationen in der betrieblichen Ausbildung. Damit sind sie ein entscheidender Erfolgsfaktor für eine gute Ausbildungs-, Berufs- und Betriebseinmündung (Eckert, 2014). Werden diese Problemhorizonte konsequent eröffnet, dann bekommt die Vorstellung von Passgenauigkeit der Berufswahl und der Betriebseinmündung eine ganz andere Dimension. Es geht weniger um die Abstimmung von Kompetenzen und Anforderungen, sondern um Selbstreflexion und Selbstexploration und Gestaltung des eigenen beruflichen Entwicklungsweges. Dazu gehören angeleitete und begleitete Erfahrungsprozesse von beruflicher Arbeit und konkreten betrieblichen Interaktionszusammenhängen. Allein eine sachlich-fachliche Aufklärung über Arbeitswelt schlechthin, wie man das in den Entwürfen zur Arbeitslehre finden konnte, ist dazu keineswegs ausreichend. Genau an dieser Problematik setzen die Programme der letzten zehn Jahre zur Berufsorientierung an, wie sie auf Bundesebene vom BMBF und auf der Ebene der Länder von entsprechenden Landeseinrichtungen entwickelt worden sind. Die Berufsorientierungsprogramme Im Jahr 2008 hat das BMBF mit dem Programm zur Förderung der Berufsorientierung in überbetrieblichen und vergleichbaren Berufsbildungsstätten (Berufsorientierungsprogramm) eine bundesweite Initiative gestartet, die in den Klassen 7 und 8 eine Potentialanalyse und erste berufliche Arbeitserfahrungen durch Werkstatttage in überbetrieblichen Ausbildungswerkstätten ermöglicht. Dabei soll Schülerinnen
Berufsvorbereitung in der Schule zwischen Institutionalisierung und Individualisierung. Manfred Eckert Universität Erfurt
 Berufsvorbereitung in der Schule zwischen Institutionalisierung und Individualisierung Manfred Eckert Universität Erfurt Das Übergangssystem Eine Notlösung? Eine Warteschleife? Ein Indikator für den Verfall
Berufsvorbereitung in der Schule zwischen Institutionalisierung und Individualisierung Manfred Eckert Universität Erfurt Das Übergangssystem Eine Notlösung? Eine Warteschleife? Ein Indikator für den Verfall
Studienportfolio für das Betriebspraktikum
 Studienportfolio für das Betriebspraktikum Name:... Matrikelnummer:.. Betrieb(e):.... Zeitraum: Ein Betriebspraktikum als Bestandteil des Lehramtsstudiums? Welche Zielsetzungen stehen dahinter? Was kann
Studienportfolio für das Betriebspraktikum Name:... Matrikelnummer:.. Betrieb(e):.... Zeitraum: Ein Betriebspraktikum als Bestandteil des Lehramtsstudiums? Welche Zielsetzungen stehen dahinter? Was kann
Unternehmensbefragung
 Seite 1 von 10 Unternehmensbefragung Diese Umfrage enthält 26 Fragen. Allgemeine Angaben 1 1. Wie viele Beschäftigte hat Ihr Unternehmen? * Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein: (Anzahl der Mitarbeiter/innen)
Seite 1 von 10 Unternehmensbefragung Diese Umfrage enthält 26 Fragen. Allgemeine Angaben 1 1. Wie viele Beschäftigte hat Ihr Unternehmen? * Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein: (Anzahl der Mitarbeiter/innen)
Das Berufsorientierungsprogramm Zwischenbilanz einer Erfolgsstory Dr. Ulrike Geiger, BMBF. ZWH-Bildungskonferenz 2011 Berlin, 16./17.
 Das Berufsorientierungsprogramm Zwischenbilanz einer Erfolgsstory Dr. Ulrike Geiger, BMBF Warum Berufsorientierung? Ungenügende Vorbereitung der Jugendlichen auf das Berufsleben durch die Schule (Erwartungen,
Das Berufsorientierungsprogramm Zwischenbilanz einer Erfolgsstory Dr. Ulrike Geiger, BMBF Warum Berufsorientierung? Ungenügende Vorbereitung der Jugendlichen auf das Berufsleben durch die Schule (Erwartungen,
Online Nachwuchs finden was tun Betriebe?
 Online Nachwuchs finden was tun Betriebe? Angelika Puhlmann Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) Bildungskonferenz 2013 Bildung: Darf s ein bisschen mehr sein? 14./15.Oktober 2013, Estrel Hotel Berlin
Online Nachwuchs finden was tun Betriebe? Angelika Puhlmann Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) Bildungskonferenz 2013 Bildung: Darf s ein bisschen mehr sein? 14./15.Oktober 2013, Estrel Hotel Berlin
Herausforderungen an die berufliche Bildung und an deren Bildungspersonal. Manfred Eckert
 Herausforderungen an die berufliche Bildung und an deren Bildungspersonal Manfred Eckert Die Megatrends am Ausbildungsstellenmarkt Demografischer Rückgang der Bewerbendenzahlen Intensive Strategien zur
Herausforderungen an die berufliche Bildung und an deren Bildungspersonal Manfred Eckert Die Megatrends am Ausbildungsstellenmarkt Demografischer Rückgang der Bewerbendenzahlen Intensive Strategien zur
Berufs- und Studienorientierung im Freien Gymnasium Borsdorf schon für 10-Jährige. Erfahrung und Neugier zusammenbringen - Für Gute Bildung
 Der Förderverein des Freien Gymnasiums Borsdorf informiert: Berufs- und Studienorientierung im Freien Gymnasium Borsdorf schon für 10-Jährige Erfahrung und Neugier zusammenbringen - Für Gute Bildung Jugendliche
Der Förderverein des Freien Gymnasiums Borsdorf informiert: Berufs- und Studienorientierung im Freien Gymnasium Borsdorf schon für 10-Jährige Erfahrung und Neugier zusammenbringen - Für Gute Bildung Jugendliche
Initiative für Ausbildungsstellen und Fachkräftenachwuchs im Kreis Warendorf
 LERNPARTNERSCHAFTEN: Betriebe und Schulen als Partner Zahlen & Fakten: nur 26% der Hauptschüler gelingt der direkte Einstieg in eine betriebliche Ausbildung (lt. DJI - Deutsches Jugendinstitut) Durch Warteschleifen
LERNPARTNERSCHAFTEN: Betriebe und Schulen als Partner Zahlen & Fakten: nur 26% der Hauptschüler gelingt der direkte Einstieg in eine betriebliche Ausbildung (lt. DJI - Deutsches Jugendinstitut) Durch Warteschleifen
Berufsorientierung in der Schule
 Berufsorientierung in der Schule - Inzwischen stehen über 350 Ausbildungsberufe zur Verfügung. Ca. 60% der neuen Ausbildungsverträge verteilen sich auf ca. 25 Berufe. Somit verteilen sich die restlichen
Berufsorientierung in der Schule - Inzwischen stehen über 350 Ausbildungsberufe zur Verfügung. Ca. 60% der neuen Ausbildungsverträge verteilen sich auf ca. 25 Berufe. Somit verteilen sich die restlichen
Die Kunst des Fragens 4. Auflage
 POCKET POWER Die Kunst des Fragens 4. Auflage Pocket Power Anne Brunner Die Kunst des Fragens Die Autorin Anne Brunner hat eine Professur für Schlüssel kom pe tenzen an der Hochschule München. Sie vermittelt
POCKET POWER Die Kunst des Fragens 4. Auflage Pocket Power Anne Brunner Die Kunst des Fragens Die Autorin Anne Brunner hat eine Professur für Schlüssel kom pe tenzen an der Hochschule München. Sie vermittelt
Rede der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Annette Schavan, MdB, anlässlich der Eröffnung der Berufsbildungskonferenz
 Rede der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Annette Schavan, MdB, anlässlich der Eröffnung der Berufsbildungskonferenz am 12. Juni 2009 in Shenyang Es gilt das gesprochene Wort! 1 I.
Rede der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Annette Schavan, MdB, anlässlich der Eröffnung der Berufsbildungskonferenz am 12. Juni 2009 in Shenyang Es gilt das gesprochene Wort! 1 I.
Mehrsprachige Lehramtsstudierende schreiben
 Dagmar Knorr, Ursula Neumann (Hrsg.) Mehrsprachige Lehramtsstudierende schreiben Schreibwerkstätten an deutschen Hochschulen Waxmann 2014 Münster New York Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Dagmar Knorr, Ursula Neumann (Hrsg.) Mehrsprachige Lehramtsstudierende schreiben Schreibwerkstätten an deutschen Hochschulen Waxmann 2014 Münster New York Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Modelle zur Durchführung des Praxistages für Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf Stefan Voigtländer und Dirk Sponholz PZ
 Modelle zur Durchführung des Praxistages für Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf Stefan Voigtländer und Dirk Sponholz PZ Rheinland-Pfalz Praxistage für Schüler/innen mit sonderpädagogischem
Modelle zur Durchführung des Praxistages für Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf Stefan Voigtländer und Dirk Sponholz PZ Rheinland-Pfalz Praxistage für Schüler/innen mit sonderpädagogischem
TranzparenzKompetenzKooperation am Übergang Schule-Beruf. 21. Februar 2013 IHK-Akademie München
 TranzparenzKompetenzKooperation am Übergang Schule-Beruf 21. Februar 2013 IHK-Akademie München In Deutschland gibt es rund 350 Ausbildungsberufe und mit ihnen eine breite Variation von Inhalten und Anforderungen.
TranzparenzKompetenzKooperation am Übergang Schule-Beruf 21. Februar 2013 IHK-Akademie München In Deutschland gibt es rund 350 Ausbildungsberufe und mit ihnen eine breite Variation von Inhalten und Anforderungen.
Grußwort. Dieter M. Putz Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern. anlässlich
 Grußwort Dieter M. Putz Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern anlässlich der Expertentagung Hauptschule am 22.11.2004, 10,00 Uhr IHK-Akademie Westerham - 2 - Sehr geehrte
Grußwort Dieter M. Putz Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern anlässlich der Expertentagung Hauptschule am 22.11.2004, 10,00 Uhr IHK-Akademie Westerham - 2 - Sehr geehrte
Beratungs- und Hilfezentrum
 Seit 2004 ist das pro aktiv center (PACE) des Landkreises eine Beratungsstelle für junge Menschen im Alter von 14 bis unter 27 Jahren mit Wohnsitz im Landkreis Peine. Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist
Seit 2004 ist das pro aktiv center (PACE) des Landkreises eine Beratungsstelle für junge Menschen im Alter von 14 bis unter 27 Jahren mit Wohnsitz im Landkreis Peine. Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist
Konzept zur Studien- und Berufswahl des Gymnasiums Otterndorf
 Schulträger Gymnasium Otterndorf, Schulstraße 2, 21762 Otterndorf Konzept zur Studien- und Berufswahl des Gymnasiums Otterndorf (Stand: August 2013) I. Begründung und Zielsetzung des Konzeptes: Im Rahmen
Schulträger Gymnasium Otterndorf, Schulstraße 2, 21762 Otterndorf Konzept zur Studien- und Berufswahl des Gymnasiums Otterndorf (Stand: August 2013) I. Begründung und Zielsetzung des Konzeptes: Im Rahmen
Empfehlung zur Beruflichen Orientierung an Schulen. (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom )
 Empfehlung zur Beruflichen Orientierung an Schulen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.12.2017) Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland
Empfehlung zur Beruflichen Orientierung an Schulen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.12.2017) Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland
Berufswahl im Überblick
 Berufswahl im Überblick 1. Beratungsangebote 1 2. Angebote zur Berufsorientierung 6 Seite 1 Beratung Persönliche Berufsberatung bei der Agentur für Arbeit - Beratung bei der Berufswahl sowie zu Bildungswegen
Berufswahl im Überblick 1. Beratungsangebote 1 2. Angebote zur Berufsorientierung 6 Seite 1 Beratung Persönliche Berufsberatung bei der Agentur für Arbeit - Beratung bei der Berufswahl sowie zu Bildungswegen
Rede der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Johanna Wanka,
 Rede der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Johanna Wanka, anlässlich der Beratung und Unterrichtung durch die Bundesregierung Berufsbildungsbericht 2014 am 22. Mai 2014 im Deutschen
Rede der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Johanna Wanka, anlässlich der Beratung und Unterrichtung durch die Bundesregierung Berufsbildungsbericht 2014 am 22. Mai 2014 im Deutschen
Band II Heinz-Hermann Krüger Einführung in Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft
 Einführungskurs Erziehungswissenschaft Herausgegeben von Heinz-Hermann Krüger Band II Heinz-Hermann Krüger Einführung in Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft Die weiteren Bände Band I Heinz-Hermann
Einführungskurs Erziehungswissenschaft Herausgegeben von Heinz-Hermann Krüger Band II Heinz-Hermann Krüger Einführung in Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft Die weiteren Bände Band I Heinz-Hermann
Gewinnen Sie Ihre Fachkräfte von morgen
 Berufsfelderkundung Informationen für Arbeitgeber Gewinnen Sie Ihre Fachkräfte von morgen Berufsfelderkundung in der Landesinitiative KEIN ABSCHLUSS OHNE ANSCHLUSS Informationen für Arbeitgeber www.berufsfelderkundung-koeln.de
Berufsfelderkundung Informationen für Arbeitgeber Gewinnen Sie Ihre Fachkräfte von morgen Berufsfelderkundung in der Landesinitiative KEIN ABSCHLUSS OHNE ANSCHLUSS Informationen für Arbeitgeber www.berufsfelderkundung-koeln.de
Soziologie für die Soziale Arbeit
 Studienkurs Soziale Arbeit Klaus Bendel Soziologie für die Soziale Arbeit Nomos Studienkurs Soziale Arbeit Lehrbuchreihe für Studierende der Sozialen Arbeit an Universitäten und Fachhochschulen. Praxisnah
Studienkurs Soziale Arbeit Klaus Bendel Soziologie für die Soziale Arbeit Nomos Studienkurs Soziale Arbeit Lehrbuchreihe für Studierende der Sozialen Arbeit an Universitäten und Fachhochschulen. Praxisnah
Forschung und Entwicklung in der Erziehungswissenschaft. Herausgegeben von R. Treptow, Tübingen, Deutschland
 Forschung und Entwicklung in der Erziehungswissenschaft Herausgegeben von R. Treptow, Tübingen, Deutschland Herausgegeben von Prof. Dr. Rainer Treptow Tübingen, Deutschland Rainer Treptow Facetten des
Forschung und Entwicklung in der Erziehungswissenschaft Herausgegeben von R. Treptow, Tübingen, Deutschland Herausgegeben von Prof. Dr. Rainer Treptow Tübingen, Deutschland Rainer Treptow Facetten des
Leitperspektive Berufliche Orientierung. Berufs- und Studienorientierung im Bildungsplan 2016
 Leitperspektive Berufliche Orientierung Berufs- und Studienorientierung im Bildungsplan 2016 Thomas Schenk Arbeitskreis SCHULEWIRTSCHAFT Freudenstadt 5. November 2014 Leitperspektiven Allgemeine Leitperspektiven
Leitperspektive Berufliche Orientierung Berufs- und Studienorientierung im Bildungsplan 2016 Thomas Schenk Arbeitskreis SCHULEWIRTSCHAFT Freudenstadt 5. November 2014 Leitperspektiven Allgemeine Leitperspektiven
Empfehlungen zur Verbesserung der Ausbildungsmöglichkeiten lernbeeinträchtigter Jugendlicher
 Nr: 53 Erlassdatum: 6. Dezember 1979 Fundstelle: DGB Berufliche Bildung - Arbeitshilfen zur Berufsbildung 2 /1986 Beschließender Ausschuss: Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) Empfehlungen
Nr: 53 Erlassdatum: 6. Dezember 1979 Fundstelle: DGB Berufliche Bildung - Arbeitshilfen zur Berufsbildung 2 /1986 Beschließender Ausschuss: Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) Empfehlungen
AUSBILDUNGS- UND BERUFSSTARTPROBLEME VON JUGENDLI- CHEN UNTER DEN BEDINGUNGEN VERSCHÄRFTER SITUATIONEN AUF DEM ARBEITS- UND AUSBILDUNGSSTELLENMARKT
 SOZIOLOGISCHES FORSCHUNGSINSTITUT GOTTINGEN SOFI AUSBILDUNGS- UND BERUFSSTARTPROBLEME VON JUGENDLI- CHEN UNTER DEN BEDINGUNGEN VERSCHÄRFTER SITUATIONEN AUF DEM ARBEITS- UND AUSBILDUNGSSTELLENMARKT Abschlußbericht
SOZIOLOGISCHES FORSCHUNGSINSTITUT GOTTINGEN SOFI AUSBILDUNGS- UND BERUFSSTARTPROBLEME VON JUGENDLI- CHEN UNTER DEN BEDINGUNGEN VERSCHÄRFTER SITUATIONEN AUF DEM ARBEITS- UND AUSBILDUNGSSTELLENMARKT Abschlußbericht
Modul 1: Einführung in die Bildungswissenschaft Praxis. Umfang 6 LP. Modulnummer Workload 180 h. Turnus WS und SS
 Modul 1: Einführung in die Bildungswissenschaft Praxis Modulnummer 801 103 100 180 h Umfang 6 LP Dauer Modul 1 Semester Modulbeauftragter Dozent/Dozentin der Vorlesung im jeweiligen Semester Anbietende
Modul 1: Einführung in die Bildungswissenschaft Praxis Modulnummer 801 103 100 180 h Umfang 6 LP Dauer Modul 1 Semester Modulbeauftragter Dozent/Dozentin der Vorlesung im jeweiligen Semester Anbietende
Aus dem Mismatch ein Match machen! Chancen und Grenzen des Ausbildungsmarkts
 71. Dortmunder Dialog Aus dem Mismatch ein Match machen! Chancen und Grenzen des Ausbildungsmarkts Prof. Dr. Friedrich Hubert Esser Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung Dortmund, 14. Februar
71. Dortmunder Dialog Aus dem Mismatch ein Match machen! Chancen und Grenzen des Ausbildungsmarkts Prof. Dr. Friedrich Hubert Esser Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung Dortmund, 14. Februar
Es gilt das gesprochene Wort.
 Grußwort der Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Sylvia Löhrmann Abiturfeier der Abiturientinnen und Abiturienten im Rahmen des Schulversuchs Berufliches Gymnasium für
Grußwort der Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Sylvia Löhrmann Abiturfeier der Abiturientinnen und Abiturienten im Rahmen des Schulversuchs Berufliches Gymnasium für
der Oberschule Uplengen
 Berufsorientierungskonzept der Oberschule Uplengen Stand: Überarbeitet 31.03.14 1 1. Grundsätzliches Die Berufs- und Arbeitswelt ist heute einem stetigen schnellen Wandel unterworfen. Dieses hat Auswirkungen
Berufsorientierungskonzept der Oberschule Uplengen Stand: Überarbeitet 31.03.14 1 1. Grundsätzliches Die Berufs- und Arbeitswelt ist heute einem stetigen schnellen Wandel unterworfen. Dieses hat Auswirkungen
Schulversuch Berufsorientierungsklassen Kooperationsmodelle von Mittel- und Berufsschulen in Bayern
 Schulversuch Berufsorientierungsklassen Kooperationsmodelle von Mittel- und Berufsschulen in Bayern Barbara Klöver, Thomas Hochleitner STAATSINSTITUT FÜR SCHULQUALITÄT UND BILDUNGSFORSCHUNG MÜNCHEN Thematische
Schulversuch Berufsorientierungsklassen Kooperationsmodelle von Mittel- und Berufsschulen in Bayern Barbara Klöver, Thomas Hochleitner STAATSINSTITUT FÜR SCHULQUALITÄT UND BILDUNGSFORSCHUNG MÜNCHEN Thematische
Änderungsanträge der Jusos Hamburg zu Antrag BA 1 Landesvorstand Durchlässigkeit und Weiterqualifizierung
 Änderungsanträge der Hamburg zu Antrag BA 1 Landesvorstand Durchlässigkeit und Weiterqualifizierung 3 42 Füge an: Ein Austausch mit den Landesstellen ist dabei sicherzustellen. 3 55 Füge an: Dieses Leistungspunktesystem
Änderungsanträge der Hamburg zu Antrag BA 1 Landesvorstand Durchlässigkeit und Weiterqualifizierung 3 42 Füge an: Ein Austausch mit den Landesstellen ist dabei sicherzustellen. 3 55 Füge an: Dieses Leistungspunktesystem
Ausbildungsumfrage Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim
 Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim Herausgeber Industrie- und Handelskammer Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim Neuer Graben 38 49074 Osnabrück Internet: www.osnabrueck.ihk24.de Ihr Ansprechpartner
Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim Herausgeber Industrie- und Handelskammer Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim Neuer Graben 38 49074 Osnabrück Internet: www.osnabrueck.ihk24.de Ihr Ansprechpartner
Berufswahl in der Region
 Berufswahl in der Region Wo fallen Wunsch und Wirklichkeit auseinander? Perspektiven von Auszubildenden und Unternehmen Dipl. Soz.arb./Soz.päd. Swantje Penke Wissenschaftliche Mitarbeiterin, HAWK 26. August
Berufswahl in der Region Wo fallen Wunsch und Wirklichkeit auseinander? Perspektiven von Auszubildenden und Unternehmen Dipl. Soz.arb./Soz.päd. Swantje Penke Wissenschaftliche Mitarbeiterin, HAWK 26. August
Es gilt das gesprochene Wort.
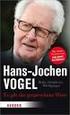 Grußwort der Vizepräsidentin der Kultusministerkonferenz und Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Sylvia Löhrmann Schulnetzwerktreffen MINT400 12. Februar 2015 Es gilt
Grußwort der Vizepräsidentin der Kultusministerkonferenz und Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Sylvia Löhrmann Schulnetzwerktreffen MINT400 12. Februar 2015 Es gilt
Studienabbrecher: Vom Hörsaal in die Ausbildung
 Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Studium 04.08.2017 Lesezeit 4 Min. Studienabbrecher: Vom Hörsaal in die Ausbildung Derzeit bricht fast ein Drittel aller Bachelorstudenten in
Informationen aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Studium 04.08.2017 Lesezeit 4 Min. Studienabbrecher: Vom Hörsaal in die Ausbildung Derzeit bricht fast ein Drittel aller Bachelorstudenten in
Jugendarbeitslosigkeit
 dbb jugend Bund) Tel: 030. 40 81 57 57 Fax: 030. 40 81 57 99 E-Mail: info_dbbj@dbb.de Internet: www.dbbj.de www.facebook.com/dbbjugend Jugendarbeitslosigkeit Im Jahr 2014 waren in Deutschland 330.000 Jugendliche
dbb jugend Bund) Tel: 030. 40 81 57 57 Fax: 030. 40 81 57 99 E-Mail: info_dbbj@dbb.de Internet: www.dbbj.de www.facebook.com/dbbjugend Jugendarbeitslosigkeit Im Jahr 2014 waren in Deutschland 330.000 Jugendliche
Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen
 Grußwort von Ministerialdirigent Burkard Rappl Tagung Leben pur München, den 9. März 2012 Für die Einladung zur Tagung hier im Holiday Inn in München danke ich sehr. Herzliche Grüße darf ich von Frau Staatsministerin
Grußwort von Ministerialdirigent Burkard Rappl Tagung Leben pur München, den 9. März 2012 Für die Einladung zur Tagung hier im Holiday Inn in München danke ich sehr. Herzliche Grüße darf ich von Frau Staatsministerin
Soziologie für die Soziale Arbeit
 Studienkurs Soziale Arbeit 1 Soziologie für die Soziale Arbeit Bearbeitet von Prof. Dr. Klaus Bendel 1. Auflage 2015. Buch. 249 S. Kartoniert ISBN 978 3 8487 0964 9 Weitere Fachgebiete > Ethnologie, Volkskunde,
Studienkurs Soziale Arbeit 1 Soziologie für die Soziale Arbeit Bearbeitet von Prof. Dr. Klaus Bendel 1. Auflage 2015. Buch. 249 S. Kartoniert ISBN 978 3 8487 0964 9 Weitere Fachgebiete > Ethnologie, Volkskunde,
Berufsausbildung in Deutschland
 1. Berufsausbildung in Deutschland 1.1 Das Bildungssystem 1.2 Rechtliche Grundlagen 1.3 Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) 1.1 Das Bildungssystem Grafik: Bildung in Deutschland 1.1 Das Bildungssystem
1. Berufsausbildung in Deutschland 1.1 Das Bildungssystem 1.2 Rechtliche Grundlagen 1.3 Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) 1.1 Das Bildungssystem Grafik: Bildung in Deutschland 1.1 Das Bildungssystem
Berufliche Bildung im Wandel der Zeit zwischen Demografie und Akademisierung 4. Bilanzbuchhalter- und Controllertag 6. Juni 2017 IHK Saarland
 Berufliche Bildung im Wandel der Zeit zwischen Demografie und Akademisierung 4. Bilanzbuchhalter- und Controllertag 6. Juni 2017 IHK Saarland Peter Nagel, Geschäftsführer Aus- und Weiterbildung 8100
Berufliche Bildung im Wandel der Zeit zwischen Demografie und Akademisierung 4. Bilanzbuchhalter- und Controllertag 6. Juni 2017 IHK Saarland Peter Nagel, Geschäftsführer Aus- und Weiterbildung 8100
Beschreibung des Angebotes
 Soziologie (Bachelor of Arts) in Dresden Angebot-Nr. 00072379 Angebot-Nr. 00072379 Bereich Termin Studienangebot Hochschule Permanentes Angebot Regelstudienzeit: 6 Semester Anbieter Tageszeit Ganztags
Soziologie (Bachelor of Arts) in Dresden Angebot-Nr. 00072379 Angebot-Nr. 00072379 Bereich Termin Studienangebot Hochschule Permanentes Angebot Regelstudienzeit: 6 Semester Anbieter Tageszeit Ganztags
Bewerbungsgespräch-Training für Schüler und Schülerinnen
 Bewerbungsgespräch-Training für Schüler und Schülerinnen Anmeldung für das Bewerbungsgespräch-Training - Im Vorfeld der Messe: Download des Anmeldeformulars unter http://www.steu-dat.de oder http://www.abizukunft.de/standorte/osnabrueck.
Bewerbungsgespräch-Training für Schüler und Schülerinnen Anmeldung für das Bewerbungsgespräch-Training - Im Vorfeld der Messe: Download des Anmeldeformulars unter http://www.steu-dat.de oder http://www.abizukunft.de/standorte/osnabrueck.
Matthias Brungs, Vanessa Kolb Zeitarbeit als Chance für arbeitslose Menschen?
 Matthias Brungs, Vanessa Kolb Zeitarbeit als Chance für arbeitslose Menschen? Perspektiven Sozialer Arbeit in Theorie und Praxis Herausgegeben von Prof. Dr. Süleyman Gögercin und Prof. Karin E. Sauer,
Matthias Brungs, Vanessa Kolb Zeitarbeit als Chance für arbeitslose Menschen? Perspektiven Sozialer Arbeit in Theorie und Praxis Herausgegeben von Prof. Dr. Süleyman Gögercin und Prof. Karin E. Sauer,
Arbeitswelt in der Schule
 Anwendervortrag Der Stellenwert Profiling von Arbeitswelt in der Schule Ergebnisse Interpretationen - Utopien Agenda Schule- Arbeitswelt Übergang vs. Übergabe Permanet- vs. Best Practice Schule braucht
Anwendervortrag Der Stellenwert Profiling von Arbeitswelt in der Schule Ergebnisse Interpretationen - Utopien Agenda Schule- Arbeitswelt Übergang vs. Übergabe Permanet- vs. Best Practice Schule braucht
AUSBILDEN. In die Zukunft investieren
 AUSBILDEN In die Zukunft investieren www.kausa-essen.de IMPRESSUM Gestaltung & Idee: Cem Şentürk - Illustrationen: Matthias Enter - Fotolia AUSBILDEN - In die Zukunft investieren Wer ausbildet, investiert
AUSBILDEN In die Zukunft investieren www.kausa-essen.de IMPRESSUM Gestaltung & Idee: Cem Şentürk - Illustrationen: Matthias Enter - Fotolia AUSBILDEN - In die Zukunft investieren Wer ausbildet, investiert
Förderung für Ihre zukünftigen Fachkräfte INFORMATIONEN FÜR ARBEITGEBER. Berufsberatung. Qualifizierten Nachwuchs sichern. Logo
 Berufsberatung Förderung für Ihre zukünftigen Fachkräfte INFORMATIONEN FÜR ARBEITGEBER Qualifizierten Nachwuchs sichern Logo Qualifizierten Nachwuchs sichern Qualifizierte Fachkräfte sichern Ihre Zukunft.
Berufsberatung Förderung für Ihre zukünftigen Fachkräfte INFORMATIONEN FÜR ARBEITGEBER Qualifizierten Nachwuchs sichern Logo Qualifizierten Nachwuchs sichern Qualifizierte Fachkräfte sichern Ihre Zukunft.
Heiner Hermes. Referat Berufliche Bildung und Weiterbildung GEW Niedersachsen
 Heiner Hermes Referat Berufliche Bildung und Weiterbildung GEW Niedersachsen 20.03.2014 Bildungskonferenz Braunschweig 1 Gliederung 1. Ausgangssituation 2. Gemeinsames Positionspapier der Wirtschafts-und
Heiner Hermes Referat Berufliche Bildung und Weiterbildung GEW Niedersachsen 20.03.2014 Bildungskonferenz Braunschweig 1 Gliederung 1. Ausgangssituation 2. Gemeinsames Positionspapier der Wirtschafts-und
Günter Ratschinski Ariane Steuber (Hrsg.) Ausbildungsreife. Kontroversen, Alternativen und Förderansätze
 Ausbildungsreife Günter Ratschinski Ariane Steuber (Hrsg.) Ausbildungsreife Kontroversen, Alternativen und Förderansätze Herausgeber Günter Ratschinski, Ariane Steuber, Leibniz Universität Hannover, Deutschland
Ausbildungsreife Günter Ratschinski Ariane Steuber (Hrsg.) Ausbildungsreife Kontroversen, Alternativen und Förderansätze Herausgeber Günter Ratschinski, Ariane Steuber, Leibniz Universität Hannover, Deutschland
Neue Wege in die duale Ausbildung Heterogenität als Chance für die Fachkräftesicherung
 Neue Wege in die duale Ausbildung Heterogenität als Chance für die Fachkräftesicherung Prof. Dr. Klaus Jenewein Berufs und Betriebspädagogik Modellversuchsveranstaltung Altenburg 28.05.2013 Die Bundesregierung
Neue Wege in die duale Ausbildung Heterogenität als Chance für die Fachkräftesicherung Prof. Dr. Klaus Jenewein Berufs und Betriebspädagogik Modellversuchsveranstaltung Altenburg 28.05.2013 Die Bundesregierung
Auswahl der Bewerber. Eine Auswahl im beiderseitigen Interesse. Eignung und Anforderung sollen sich entsprechen. Persönliches Eignungsprofil
 Auswahl der Bewerber Mit der Bewerberauswahl wollen Sie die Richtige oder den Richtigen für Ihr Ausbildungsangebot herausfinden. Das geschieht in gegenseitigem Interesse, denn eine falsche Berufswahl ist
Auswahl der Bewerber Mit der Bewerberauswahl wollen Sie die Richtige oder den Richtigen für Ihr Ausbildungsangebot herausfinden. Das geschieht in gegenseitigem Interesse, denn eine falsche Berufswahl ist
Armin Klein (Hrsg.) Gesucht: Kulturmanager
 Armin Klein (Hrsg.) Gesucht: Kulturmanager Armin Klein (Hrsg.) Gesucht: Kulturmanager Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
Armin Klein (Hrsg.) Gesucht: Kulturmanager Armin Klein (Hrsg.) Gesucht: Kulturmanager Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
Ready-Steady-Go! Ein biographisches Planspiel zur Berufserkundung und Lebensplanung. Ready, Steady, Go!; DGB-Jugend Baden-Württemberg 1
 Ready-Steady-Go! Ein biographisches Planspiel zur Berufserkundung und Lebensplanung Ready, Steady, Go!; DGB-Jugend Baden-Württemberg 1 Was ist ein Planspiel und ein biografischer Ansatz? Planspiel: Modell
Ready-Steady-Go! Ein biographisches Planspiel zur Berufserkundung und Lebensplanung Ready, Steady, Go!; DGB-Jugend Baden-Württemberg 1 Was ist ein Planspiel und ein biografischer Ansatz? Planspiel: Modell
Fachoberschule für Sozial- und Gesundheitswesen
 Praktikumsmappe für das Schuljahr 2017 /18 Das Praktikum in der FOS 11 dient der Ergänzung des Unterrichts. Es hat die Aufgabe, auf das Berufsleben vorzubereiten und eine Orientierung für einen Beruf oder
Praktikumsmappe für das Schuljahr 2017 /18 Das Praktikum in der FOS 11 dient der Ergänzung des Unterrichts. Es hat die Aufgabe, auf das Berufsleben vorzubereiten und eine Orientierung für einen Beruf oder
Die Ausbildungsplatzsituation
 Die Ausbildungsplatzsituation Analyse der Zahlen der BA im September 2011 DGB-Bezirk Niedersachsen Bremen Sachsen-Anhalt Abteilung Jugend Abteilung Arbeitsmarktpolitik Bundesweit fehlen 70.000 Ausbildungsplätze
Die Ausbildungsplatzsituation Analyse der Zahlen der BA im September 2011 DGB-Bezirk Niedersachsen Bremen Sachsen-Anhalt Abteilung Jugend Abteilung Arbeitsmarktpolitik Bundesweit fehlen 70.000 Ausbildungsplätze
Ergebnisse der Unternehmensumfrage zur Berufsausbildung 2011
 Ergebnisse der Unternehmensumfrage zur Berufsausbildung 2011 Herausforderungen - Trends Konzepte, Berufsbildung / Ausbildungsbegleitung, Verband der Wirtschaft Thüringens e.v., Erfurt 1 Unternehmensumfrage
Ergebnisse der Unternehmensumfrage zur Berufsausbildung 2011 Herausforderungen - Trends Konzepte, Berufsbildung / Ausbildungsbegleitung, Verband der Wirtschaft Thüringens e.v., Erfurt 1 Unternehmensumfrage
Konzept zur Schullaufbahnberatung, Berufswahlvorbereitung und Studienorientierung
 Konzept zur Schullaufbahnberatung, Berufswahlvorbereitung und Studienorientierung der BBS III Mainz Vorbemerkung Information, Beratung, Unterstützung und Hilfe in allen für die Schullaufbahnentscheidung,
Konzept zur Schullaufbahnberatung, Berufswahlvorbereitung und Studienorientierung der BBS III Mainz Vorbemerkung Information, Beratung, Unterstützung und Hilfe in allen für die Schullaufbahnentscheidung,
LERN, WAS DU WILLST. Berufliche Bildung in der. stiftung st. franziskus heiligenbronn
 LERN, WAS DU WILLST Berufliche Bildung in der stiftung st. franziskus heiligenbronn Zentrum für Ausbildung und Qualifikation Berufswahl und Berufsausbildung sind wichtige Lebensentscheidungen Berufswahl
LERN, WAS DU WILLST Berufliche Bildung in der stiftung st. franziskus heiligenbronn Zentrum für Ausbildung und Qualifikation Berufswahl und Berufsausbildung sind wichtige Lebensentscheidungen Berufswahl
Die Arbeit in Mutter-Kind-Einrichtungen: Eine fachliche und persönliche Herausforderung
 Die Arbeit in Mutter-Kind-Einrichtungen: Eine fachliche und persönliche Herausforderung In Mutter-Kind-Einrichtungen leben heute Frauen, die vielfach belastet sind. Es gibt keinen typischen Personenkreis,
Die Arbeit in Mutter-Kind-Einrichtungen: Eine fachliche und persönliche Herausforderung In Mutter-Kind-Einrichtungen leben heute Frauen, die vielfach belastet sind. Es gibt keinen typischen Personenkreis,
HHG Helmholtz-Gymnasium Schule der Stadt Bonn
 HHG Helmholtz-Gymnasium Konzept einer Studien- und Berufsorientierung am Helmholtz-Gymnasium Die Entscheidung für einen bestimmten Beruf oder für ein bestimmtes Studium ist ein wichtiger Prozess, der von
HHG Helmholtz-Gymnasium Konzept einer Studien- und Berufsorientierung am Helmholtz-Gymnasium Die Entscheidung für einen bestimmten Beruf oder für ein bestimmtes Studium ist ein wichtiger Prozess, der von
Berufsorientierung. STAR Schule trifft Arbeitswelt
 STAR Schule trifft Arbeitswelt Ziel ist der erfolgreiche Übergang von der Schule in eine Ausbildung oder in Arbeit Es werden im Rahmen der Berufsorientierung z. B. Potenzialanalysen, Berufsfelderkundungen
STAR Schule trifft Arbeitswelt Ziel ist der erfolgreiche Übergang von der Schule in eine Ausbildung oder in Arbeit Es werden im Rahmen der Berufsorientierung z. B. Potenzialanalysen, Berufsfelderkundungen
Sondervereinbarung zwischen dem BMBF und dem Land NRW zur
 Sondervereinbarung zwischen dem BMBF und dem Land NRW zur Berufs- und Studienorientierung an allgemein bildenden Schulen im neuen Übergangssystem Schule Beruf 1 Berufsorientierungsprogramm des BMBF Leitgedanken
Sondervereinbarung zwischen dem BMBF und dem Land NRW zur Berufs- und Studienorientierung an allgemein bildenden Schulen im neuen Übergangssystem Schule Beruf 1 Berufsorientierungsprogramm des BMBF Leitgedanken
Berufsorientierung: Was? Wo? Wie? Warum? - Berufswahl - Studienwahl - Ausbildungsberufe - Zusatzqualifikationen - Duale Studiengänge - Infoquellen
 Berufsorientierung: Was? Wo? Wie? Warum? - Berufswahl - Studienwahl - Ausbildungsberufe - Zusatzqualifikationen - Duale Studiengänge - Infoquellen Nach der Schule Die Entscheidung, ob Studium oder Ausbildung,
Berufsorientierung: Was? Wo? Wie? Warum? - Berufswahl - Studienwahl - Ausbildungsberufe - Zusatzqualifikationen - Duale Studiengänge - Infoquellen Nach der Schule Die Entscheidung, ob Studium oder Ausbildung,
Unternehmensbefragung Duale Berufsausbildung im Landkreis Northeim
 Unternehmensbefragung Duale Berufsausbildung im Landkreis Northeim 1. Zu welcher Branche gehört Ihr Unternehmen? Industrie Handwerk Handel / Banken Dienstleistungen Sonstige 2. Wo befindet sich Ihr Unternehmensstandort?
Unternehmensbefragung Duale Berufsausbildung im Landkreis Northeim 1. Zu welcher Branche gehört Ihr Unternehmen? Industrie Handwerk Handel / Banken Dienstleistungen Sonstige 2. Wo befindet sich Ihr Unternehmensstandort?
Leitbild trifft auf Praxis Bochum, 04. / 05. November. Studium als wissenschaftliche Berufsausbildung
 Leitbild trifft auf Praxis Bochum, 04. / 05. November Studium als wissenschaftliche Berufsausbildung Gliederung Die Formulierungen des Leitbildes die Qualifikationsziele des Akkreditierungsrates das Konzept
Leitbild trifft auf Praxis Bochum, 04. / 05. November Studium als wissenschaftliche Berufsausbildung Gliederung Die Formulierungen des Leitbildes die Qualifikationsziele des Akkreditierungsrates das Konzept
Der Beruf. sich in die Zusammenarbeit im Pflegeteam und zwischen den Berufsgruppen im Gesundheitswesen konstruktiv einzubringen;
 Der Beruf Die Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege an unserer Berufsfachschule soll Ihnen Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln, die Sie dazu befähigen, Menschen kompetent zu pflegen und zu
Der Beruf Die Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege an unserer Berufsfachschule soll Ihnen Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln, die Sie dazu befähigen, Menschen kompetent zu pflegen und zu
Anhang A. Fragebogen Berufswahlkompetenz. Friedrich-Schiller-Universität Jena
 Anhang A Fragebogen Berufswahlkompetenz 0 Name: Klasse: Datum: Fragebogen Berufswahlkompetenz Liebe Schülerin, lieber Schüler, dieser Fragebogen wurde entwickelt, um die Berufsorientierungsangebote deiner
Anhang A Fragebogen Berufswahlkompetenz 0 Name: Klasse: Datum: Fragebogen Berufswahlkompetenz Liebe Schülerin, lieber Schüler, dieser Fragebogen wurde entwickelt, um die Berufsorientierungsangebote deiner
Inhalt. Einführung: Intelligenztests und IQ 5. Das System von Intelligenztests erkennen 19. Typische Bestandteile von Intelligenztests 27
 2 Inhalt Einführung: Intelligenztests und IQ 5 Wo überall Intelligenztests eingesetzt werden 6 Intelligenz und was dazugehört 9 Das System von Intelligenztests erkennen 19 Wie ein Intelligenztest entsteht
2 Inhalt Einführung: Intelligenztests und IQ 5 Wo überall Intelligenztests eingesetzt werden 6 Intelligenz und was dazugehört 9 Das System von Intelligenztests erkennen 19 Wie ein Intelligenztest entsteht
Erwartungen der Wirtschaft an Hochschulabsolventen DIHK Unternehmensbefragung 2011
 Erwartungen der Wirtschaft an Hochschulabsolventen DIHK Unternehmensbefragung 2011 Der Fachkräftemangel ist eine der größten Herausforderungen in den kommenden Jahren und entscheidend für die Innovationsfähigkeit
Erwartungen der Wirtschaft an Hochschulabsolventen DIHK Unternehmensbefragung 2011 Der Fachkräftemangel ist eine der größten Herausforderungen in den kommenden Jahren und entscheidend für die Innovationsfähigkeit
Geschichte, Geografie, Politische Bildung
 AUSBILDUNG Sekundarstufe I Fachwegleitung Bachelor-/Master-Studiengang Quereinstieg Konsekutiver Master-Studiengang für Primarlehrpersonen Facherweiterungsstudium Geschichte, Geografie, Politische Bildung
AUSBILDUNG Sekundarstufe I Fachwegleitung Bachelor-/Master-Studiengang Quereinstieg Konsekutiver Master-Studiengang für Primarlehrpersonen Facherweiterungsstudium Geschichte, Geografie, Politische Bildung
Vorstellung des neuen Förderkonzeptes
 Amt für Lehrerbildung gefördert durch den Europäischen Sozialfonds Vorstellung des neuen Förderkonzeptes Wesentliche Elemente des SchuB-Förderkonzeptes/ der Praxisklassen an Förderschulen Unterricht Stundentafel
Amt für Lehrerbildung gefördert durch den Europäischen Sozialfonds Vorstellung des neuen Förderkonzeptes Wesentliche Elemente des SchuB-Förderkonzeptes/ der Praxisklassen an Förderschulen Unterricht Stundentafel
Informationen für Lehrkräfte
 Informationen für Lehrkräfte Warum Berufsorientierung? Rund 60.000 junge Menschen verlassen jedes Jahr ohne Abschluss die Schule. Eine weitere wachsende Zahl von jungen Menschen gilt als nicht ausbildungsreif
Informationen für Lehrkräfte Warum Berufsorientierung? Rund 60.000 junge Menschen verlassen jedes Jahr ohne Abschluss die Schule. Eine weitere wachsende Zahl von jungen Menschen gilt als nicht ausbildungsreif
Berufsorientierungs- und Übergangsprozesse Jugendlicher im regionalen Kontext
 Berufsorientierungs- und Übergangsprozesse Jugendlicher im regionalen Kontext Impulsreferat im Rahmen der Bildungskonferenz Berufsorientierung im Wandel am 22.11.2013 in Bottrop Berufsorientierung und
Berufsorientierungs- und Übergangsprozesse Jugendlicher im regionalen Kontext Impulsreferat im Rahmen der Bildungskonferenz Berufsorientierung im Wandel am 22.11.2013 in Bottrop Berufsorientierung und
Leitbild. des Deutschen Kinderschutzbundes
 Leitbild des Deutschen Kinderschutzbundes Wichtig für Sie, wichtig für uns! Unser Leitbild ist die verbindliche Grundlage für die tägliche Kinderschutzarbeit. Es formuliert, wofür der Deutsche Kinderschutzbund
Leitbild des Deutschen Kinderschutzbundes Wichtig für Sie, wichtig für uns! Unser Leitbild ist die verbindliche Grundlage für die tägliche Kinderschutzarbeit. Es formuliert, wofür der Deutsche Kinderschutzbund
Kompetenzfeststellung. Informationen. Praxis. Beratung. Förderung. Bewerbung / Vermittlung. Zukunftsperspektive. passgenaue Berufe und Ausbildungen
 Curriculum für eine fächerübergreifende Berufsorientierung für den Hauptschulbereich Zielsetzung der Berufsorientierung an der Anton-Calaminus-Schule ist es, jeden Schüler und jede Schülerin in die Lage
Curriculum für eine fächerübergreifende Berufsorientierung für den Hauptschulbereich Zielsetzung der Berufsorientierung an der Anton-Calaminus-Schule ist es, jeden Schüler und jede Schülerin in die Lage
Übersicht über die deutsche Berufsbildung. Priv. Doz. Dr. phil. Stefan Wolf Fachgebiet Schul- und Berufspädagogik im IfE
 Übersicht über die deutsche Berufsbildung Priv. Doz. Dr. phil. Stefan Wolf Fachgebiet Schul- und Berufspädagogik im IfE s.wolf@tu-berlin.de Tertiäre Bildung: Universitäten und Fachhochschulen Diese holzschnittartige
Übersicht über die deutsche Berufsbildung Priv. Doz. Dr. phil. Stefan Wolf Fachgebiet Schul- und Berufspädagogik im IfE s.wolf@tu-berlin.de Tertiäre Bildung: Universitäten und Fachhochschulen Diese holzschnittartige
Beschreibung des Angebotes
 Studiengang Höheres Lehramt berufsbildende Schulen (Master of Education) - Sozialpädagogik in Angebot-Nr. 00634890 Angebot-Nr. 00634890 Bereich Termin Studienangebot Hochschule Permanentes Angebot Regelstudienzeit:
Studiengang Höheres Lehramt berufsbildende Schulen (Master of Education) - Sozialpädagogik in Angebot-Nr. 00634890 Angebot-Nr. 00634890 Bereich Termin Studienangebot Hochschule Permanentes Angebot Regelstudienzeit:
BFO BO. Berufsfrühorientierung und Berufsorientierung. Konzept der Regionalen Schule Sanitz
 BFO BO Berufsfrühorientierung und Berufsorientierung Konzept der Regionalen Schule Sanitz 2 Berufsfrühorientierung von Kindern und Jugendlichen Konzept der Regionalen Schule Sanitz Vorwort Berufsfrühorientierung
BFO BO Berufsfrühorientierung und Berufsorientierung Konzept der Regionalen Schule Sanitz 2 Berufsfrühorientierung von Kindern und Jugendlichen Konzept der Regionalen Schule Sanitz Vorwort Berufsfrühorientierung
Zeitmanagement in der beruflichen Bildung
 Zeitmanagement in der beruflichen Bildung Stefan Dornbach Zeitmanagement in der beruflichen Bildung Jugendliche im Umgang mit zeitlichen Anforderungen der modernen Arbeitswelt Stefan Dornbach Berlin, Deutschland
Zeitmanagement in der beruflichen Bildung Stefan Dornbach Zeitmanagement in der beruflichen Bildung Jugendliche im Umgang mit zeitlichen Anforderungen der modernen Arbeitswelt Stefan Dornbach Berlin, Deutschland
Karl-Heinz Paqué. Wachs tum! Wachstum! downloaded from by on March 1, 2017
 Karl-Heinz Paqué Wachs tum! Die Zukunft des globalen Kapitalismus Karl-Heinz Paqué Wachstum! Karl-Heinz Paqué Wachstum! Die Zukunft des globalen Kapitalismus Das für dieses Buch verwendete FSC-zertifizierte
Karl-Heinz Paqué Wachs tum! Die Zukunft des globalen Kapitalismus Karl-Heinz Paqué Wachstum! Karl-Heinz Paqué Wachstum! Die Zukunft des globalen Kapitalismus Das für dieses Buch verwendete FSC-zertifizierte
Die Ausbildungsplatzsituation
 Die Ausbildungsplatzsituation Analyse der Zahlen der BA für 2014 DGB-Bezirk Niedersachsen Bremen Sachsen-Anhalt Ausbildungsjahr 2014 in der BA-Statistik Am 30.10. veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit
Die Ausbildungsplatzsituation Analyse der Zahlen der BA für 2014 DGB-Bezirk Niedersachsen Bremen Sachsen-Anhalt Ausbildungsjahr 2014 in der BA-Statistik Am 30.10. veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit
Anhang I Praktikumstagebuch ThüBOM
 0 Anhang I Praktikumstagebuch ThüBOM 1 Startnummer Liebe Schülerin, lieber Schüler, Du hast Dir sicher schon einmal Gedanken gemacht, welche beruflichen Tätigkeiten Du interessant findest. Das vor Dir
0 Anhang I Praktikumstagebuch ThüBOM 1 Startnummer Liebe Schülerin, lieber Schüler, Du hast Dir sicher schon einmal Gedanken gemacht, welche beruflichen Tätigkeiten Du interessant findest. Das vor Dir
Auftaktveranstaltung Schulversuch Talente finden und fördern an der Mittelschule (TAFF)
 Auftaktveranstaltung Schulversuch Talente finden und fördern an der Mittelschule (TAFF) Donnerstag, 23.04.2015 um 10:25 Uhr Schloss Fürstenried Forst-Kasten-Allee 103, 81475 München Grußwort Bertram Brossardt
Auftaktveranstaltung Schulversuch Talente finden und fördern an der Mittelschule (TAFF) Donnerstag, 23.04.2015 um 10:25 Uhr Schloss Fürstenried Forst-Kasten-Allee 103, 81475 München Grußwort Bertram Brossardt
Berufsbildung in sechs Schritten
 4 Berufsbildung in sechs Schritten Berufsbildung in sechs Schritten 5 Kontakt obvita Berufliche Integration berufsbildung@obvita.ch Tel. 071 246 61 91 obvita Berufliche Integration Bruggwaldstrasse 53
4 Berufsbildung in sechs Schritten Berufsbildung in sechs Schritten 5 Kontakt obvita Berufliche Integration berufsbildung@obvita.ch Tel. 071 246 61 91 obvita Berufliche Integration Bruggwaldstrasse 53
Wie kommt es zu sozialer Exklusion im Wohlfahrtsstaat und was kann der Staat dagegen tun?
 Geisteswissenschaft Tanja Lorenz Wie kommt es zu sozialer Exklusion im Wohlfahrtsstaat und was kann der Staat dagegen tun? Studienarbeit Fachbereich 12: Sozialwissenschaften Institut für Soziologie -
Geisteswissenschaft Tanja Lorenz Wie kommt es zu sozialer Exklusion im Wohlfahrtsstaat und was kann der Staat dagegen tun? Studienarbeit Fachbereich 12: Sozialwissenschaften Institut für Soziologie -
Mit Aus- und Weiterbildung gegen den Fachkräftemangel
 Mit Aus- und Weiterbildung gegen den Fachkräftemangel Auswertung der Sonderfragen der IHK-Konjunkturumfrage für das 3. Quartal 2014 Die Auswertung Mit Aus- und Weiterbildung gegen den Fachkräftemangel
Mit Aus- und Weiterbildung gegen den Fachkräftemangel Auswertung der Sonderfragen der IHK-Konjunkturumfrage für das 3. Quartal 2014 Die Auswertung Mit Aus- und Weiterbildung gegen den Fachkräftemangel
Pläne und Wege Jugendlicher am Übergang zwischen Schule und Arbeitswelt Potentiale für Unternehmen und Konsequenzen für Berufsorientierung
 Pläne und Wege Jugendlicher am Übergang zwischen Schule und Arbeitswelt Potentiale für Unternehmen und Konsequenzen für Berufsorientierung Jana Voigt, Leiterin Koordinierungsstelle Regionales Übergangsmanagement
Pläne und Wege Jugendlicher am Übergang zwischen Schule und Arbeitswelt Potentiale für Unternehmen und Konsequenzen für Berufsorientierung Jana Voigt, Leiterin Koordinierungsstelle Regionales Übergangsmanagement
Nr. 67. MINT und das Geschäftsmodell Deutschland. Christina Anger / Oliver Koppel / Axel Plünnecke
 Beiträge zur Ordnungspolitik aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Nr. 67 Christina Anger / Oliver Koppel / Axel Plünnecke MINT und das Geschäftsmodell Deutschland Beiträge zur Ordnungspolitik
Beiträge zur Ordnungspolitik aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln Nr. 67 Christina Anger / Oliver Koppel / Axel Plünnecke MINT und das Geschäftsmodell Deutschland Beiträge zur Ordnungspolitik
Am haben der Kultusminister und der Vorsitzende der Geschäftsführung der
 Vereinbarung über die Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung zwischen dem Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt und der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit
Vereinbarung über die Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung zwischen dem Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt und der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit
Fragebogen für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I / II
 Fragebogen für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I / II Wie sehr stimmst du den folgenden Aussagen über deine Schule zu? 1 Ich fühle mich in unserer Schule wohl. 2 An unserer Schule gibt es klare
Fragebogen für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I / II Wie sehr stimmst du den folgenden Aussagen über deine Schule zu? 1 Ich fühle mich in unserer Schule wohl. 2 An unserer Schule gibt es klare
Rede. Hubert Schöffmann Bildungskoordinator des Bayerischen Industrie- und Handelskammertages. anlässlich
 Rede Hubert Schöffmann Bildungskoordinator des Bayerischen Industrie- und Handelskammertages anlässlich der Pressekonferenz zur Bilanz des Ausbildungsstellenmarktes 2010 am Mittwoch, 27. Oktober 2010,
Rede Hubert Schöffmann Bildungskoordinator des Bayerischen Industrie- und Handelskammertages anlässlich der Pressekonferenz zur Bilanz des Ausbildungsstellenmarktes 2010 am Mittwoch, 27. Oktober 2010,
Zwischenergebnisse Zweiter Teil. Wege der Stellenfindung Angaben in Prozent
 Zwischenergebnisse Zweiter Teil Die erste Erhebung, die sich in zwei Teilbefragungen gliederte, ist nun abgeschlossen und 2200 Personen haben daran teilgenommen. Ziel dieser Befragung war es, die aktuelle
Zwischenergebnisse Zweiter Teil Die erste Erhebung, die sich in zwei Teilbefragungen gliederte, ist nun abgeschlossen und 2200 Personen haben daran teilgenommen. Ziel dieser Befragung war es, die aktuelle
Berufsbildung 2012 Nürnberg Baustein Jahrgangsstufe 8
 Lehrerinfo Lehrerinfo Lehrerinfo Lehrerinfo Lehrerinfo Lehrerinfo Berufsbildung 2012 Nürnberg Baustein Jahrgangsstufe 8 Voraussetzungen und Vorbereitungsmaßnahmen für die Jahrgangsstufen 8 Die Schülerinnen
Lehrerinfo Lehrerinfo Lehrerinfo Lehrerinfo Lehrerinfo Lehrerinfo Berufsbildung 2012 Nürnberg Baustein Jahrgangsstufe 8 Voraussetzungen und Vorbereitungsmaßnahmen für die Jahrgangsstufen 8 Die Schülerinnen
Ein gemeinsames Projekt der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften und der Volkshochschule Wolfsburg
 Ein gemeinsames Projekt der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften und der Volkshochschule Wolfsburg Iris Bothe, Dezernentin für die Bereiche Jugend, Bildung und Integration Vorwort Wolfsburg
Ein gemeinsames Projekt der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften und der Volkshochschule Wolfsburg Iris Bothe, Dezernentin für die Bereiche Jugend, Bildung und Integration Vorwort Wolfsburg
Bildungspolitische Herausforderungen beim Übergang von der Schule in die Ausbildung
 Prof. Dr. Eckart Severing Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) BIBB-Berufsbildungskongress 2011 Forum 4.2: Übergangsmanagement Wege von der Schule in Ausbildung und Beruf gestalten Bildungspolitische
Prof. Dr. Eckart Severing Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) BIBB-Berufsbildungskongress 2011 Forum 4.2: Übergangsmanagement Wege von der Schule in Ausbildung und Beruf gestalten Bildungspolitische
BiEv 1/07. Bildungsplanung und Evaluation. Lehrvertragsauflösung: direkter Wechsel und vorläufiger Ausstieg. Ergebnisse aus dem Projekt LEVA
 Bildungsplanung und Evaluation BiEv 1/07 Lehrvertragsauflösung: direkter Wechsel und vorläufiger Ausstieg Ergebnisse aus dem Projekt LEVA Evi Schmid Barbara E. Stalder Februar 2007 Bildungsplanung und
Bildungsplanung und Evaluation BiEv 1/07 Lehrvertragsauflösung: direkter Wechsel und vorläufiger Ausstieg Ergebnisse aus dem Projekt LEVA Evi Schmid Barbara E. Stalder Februar 2007 Bildungsplanung und
Grundkurs Philosophie / Metaphysik und Naturphilosophie (Reclams Universal-Bibliothek) Click here if your download doesn"t start automatically
 Grundkurs Philosophie / Metaphysik und Naturphilosophie (Reclams Universal-Bibliothek) Click here if your download doesn"t start automatically Grundkurs Philosophie / Metaphysik und Naturphilosophie (Reclams
Grundkurs Philosophie / Metaphysik und Naturphilosophie (Reclams Universal-Bibliothek) Click here if your download doesn"t start automatically Grundkurs Philosophie / Metaphysik und Naturphilosophie (Reclams
