Schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe des Ernst-Barlach-Gymnasiums Unna. Philosophie
|
|
|
- Dagmar Beck
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe des Ernst-Barlach-Gymnasiums Unna Philsphie 1
2 Inhalt Seite 1 Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 3 2 Entscheidungen zum Unterricht Unterrichtsvrhaben Übersichtsraster: Unterrichtsvrhaben und Kmpetenzerwartungen 4 Einführungsphase 4 Qualifikatinsphase Grundsätze der fachmethdischen und -didaktischen Arbeit Grundsätze der Leistungsbewertung 31 2
3 1 Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit Das Ernst-Barlach-Gymnasium liegt zentrumsnah in Unna und wird vn Schülerinnen und Schülern swhl aus der Stadt selbst als auch aus umliegenden Gemeinden besucht. Am Ernst-Barlach-Gymnasium wird das Fach Praktische Philsphie nur in der Jahrgangsstufe 9 unterrichtet. In der Oberstufe wird das Fach Philsphie in der Einführungsphase und den Qualifikatinsphasen als rdentliches Fach im gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld angebten. Pr Abiturjahrgang entscheiden sich durchschnittlich Schülerinnen und Schüler für die Philsphie als Abiturfach, wbei es in der Regel mündlich gewählt wird. Die Blckung der Kurse ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern swhl Philsphie als auch Religin zu belegen. Die Fachgruppe besteht aus zwei Fachklleginnen, die beide swhl die Fakultas für die Praktische Philsphie als auch für die Philsphie besitzen. Dies ermöglicht eine enge Zusammenarbeit und Absprachen in Bezug auf die Aufgabe der Praktischen Philsphie, die sich durch andere Schwerpunkte zwar vn der Philsphie in der Oberstufe unterscheidet und eigenständig sein sll, aber dennch auf die Oberstufe vrbereiten sll. Für den Philsphieunterricht der Sek II ist kein Lehrwerk eingeführt. Die Fachklleginnen verwenden verschiedene kpierfähige Unterrichtsmaterialien, was eine größere Flexibilität im Materialeinsatz bedeutet. 2 Entscheidungen zum Unterricht 2.1 Unterrichtsvrhaben Die flgende Darstellung der Unterrichtsvrhaben deckt sämtliche der im Kernlehrplan aufgeführten Kmpetenzbereiche 1 ab. Das Übersichtsraster zeigt die laut Fachknferenz verbindlichen Unterrichtsvrhaben für eine Jahrgangsstufe. Es enthält das Thema, das damit verknüpfte Inhaltsfeld und die Kmpetenzerwartungen. Außerdem erscheinen inhaltliche Schwerpunkte swie gegebenenfalls vrhabenbezgene Absprachen. 1 Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Gymnasium/Gesamtschule in Nrdrhein-Westfalen Philsphie. Hg. vm Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nrdrhein-Westfalen. Düsseldrf S
4 2.1.1 Übersichtsraster: Unterrichtsvrhaben und Kmpetenzerwartungen Einführungsphase Im Rahmen des übergerdneten Ziels des Philsphieunterrichts die Schülerinnen und Schüler an eine philsphische Prblemrientierung heranzuführen, ist es die Aufgabe der Einführungsphase Sach-, Methden-, Urteils- und Handlungskmpetenzen anhand vn verbindlichen Inhaltsfeldern zu entwickeln, die im Sinne der anthrplgischen Grundfrage praktische und theretische Fähigkeiten des Menschen beleuchten. Der Unterricht der Einführungsphase sll es den Schülern ermöglichen am Ende der Jahrgangsstufe über die flgenden genannten Kmpetenzen zu verfügen. Es werden zunächst übergerdnete Kmpetenzerwartungen aufgeführt, wbei die Methden- und Handlungskmpetenzen inhaltsfeldübergreifend angelegt sind und im Übersichtsraster nur genannt werden, wenn sie zentral sind, während die Sach- und Urteilskmpetenzen im Rahmen der Unterrichtsvrhaben exemplarisch knkretisiert werden. Sachkmpetenz stellen grundlegende philsphische Prblemstellungen in unterschiedlichen inhaltlichen und lebensweltlichen Kntexten dar und erläutern sie, entwickeln eigene philsphisch dimensinierte Ideen zur Lösung elementarer philsphischer Prblemstellungen, analysieren und reknstruieren philsphische Ansätze in ihren Grundgedanken, erklären grundlegende philsphische Begriffe und im Kntext vn Begründungszusammenhängen vrgenmmene begriffliche Unterscheidungen, erläutern philsphische Ansätze an Beispielen und in Anwendungskntexten, stellen gedankliche Bezüge zwischen philsphischen Ansätzen her und grenzen diese vneinander ab. Methdenkmpetenz Verfahren der Prblemreflexin beschreiben Phänmene der Lebenswelt vrurteilsfrei hne verfrühte Klassifizierung, arbeiten aus Phänmenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien verallgemeinernd relevante philsphische Fragen heraus, ermitteln in einfacheren philsphischen Texten das diesen jeweils zugrundeliegende Prblem bzw. ihr Anliegen swie die zentrale These, identifizieren in einfacheren philsphischen Texten Sachaussagen und Werturteile, Begriffsbestimmungen, Behauptungen, Begründungen, Erläuterungen und Beispiele, 4
5 analysieren die gedankliche Abflge vn philsphischen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen, entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u.a. Gedankenexperimenten, fiktiven Dilemmata) eigene philsphische Gedanken, bestimmen elementare philsphische Begriffe mit Hilfe definitrischer Verfahren, argumentieren unter Ausrichtung an einschlägigen philsphischen Argumentatinsverfahren (u.a. Tulmin-Schema), recherchieren Infrmatinen swie die Bedeutung vn Fremdwörtern und Fachbegriffen unter Zuhilfenahme vn (auch digitalen) Lexika und anderen Nachschlagewerken. Verfahren der Präsentatin und Darstellung stellen grundlegende philsphische Sachverhalte in diskursiver Frm strukturiert dar, stellen grundlegende philsphische Sachverhalte und Zusammenhänge in präsentativer Frm (u.a. Visualisierung, bildliche und szenische Darstellung) dar, geben Kernaussagen und Grundgedanken einfacherer philsphischer Texte in eigenen Wrten und distanziert, unter Zuhilfenahme eines angemessenen Textbeschreibungsvkabulars, wieder und verdeutlichen den interpretatrischen Anteil, stellen philsphische Prbleme und Prblemlösungsbeiträge in ihrem Für und Wider dar. Urteilskmpetenz bewerten die Überzeugungskraft philsphischer Ansätze im Hinblick auf den Einbezug wesentlicher Aspekte der zugrundeliegenden Prblemstellung, erörtern Vraussetzungen und Knsequenzen philsphischer Ansätze, beurteilen die innere Stimmigkeit philsphischer Ansätze, bewerten begründet die Tragfähigkeit philsphischer Ansätze zur Orientierung in grundlegenden Fragen des Daseins und gegenwärtigen gesellschaftlich-plitischen Prblemlagen, erörtern philsphische Prbleme unter Bezug auf relevante philsphische Ansätze. Handlungskmpetenz entwickeln auf der Grundlage philsphischer Ansätze verantwrtbare Handlungsperspektiven für aus der Alltagswirklichkeit erwachsende Prblemstellungen, 5
6 rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen durch philsphisch dimensinierte Begründungen, vertreten im Rahmen ratinaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Psitin und gehen dabei auch auf andere Perspektiven ein, beteiligen sich mit philsphisch dimensinierten Beiträgen an der Diskussin allgemein-menschlicher und gegenwärtiger gesellschaftlich-plitischer Fragestellungen. 2 Die ben aufgeführten Kmpetenzerwartungen sind in der Einführungsphase an zwei bligatrische Inhaltsfelder mit inhaltlichen Schwerpunkten gebunden. Inhaltsfeld 1: Der Mensch und sein Handeln Die Snderstellung des Menschen Werte und Nrmen des Handelns im interkulturellen Kntext Umfang und Grenzen staatlichen Handelns 3 und Inhaltsfeld 2: Erkenntnis und ihre Grenzen Eigenart philsphischen Fragens und Denkens Metaphysische Prbleme als Herausfrderung für die Vernunfterkenntnis Prinzipien und Reichweite menschlicher Erkenntnis 4 2 s.. S s.. S s.. S
7 Unterrichtsvrhaben I: Thema: Was heißt es zu philsphieren? Der Mensch fragt, die Philsphie gibt Antwrten Inhaltsfelder: Inhaltsfeld 1: Der Mensch und sein Handeln / Inhaltsfeld 2: Menschliche Erkenntnis und ihre Grenzen Die Snderstellung des Menschen / Eigenart philsphischen Fragens und Denkens, Metaphysische Prbleme als Herausfrderung für die Vernunfterkenntnis Knkretisierte Sachkmpetenz: erläutern Merkmale des Menschen und erklären wesentliche Unterschiede zwischen Mensch und Tier bzw. anderen nichtmenschlichen Lebensfrmen (z. B. Charakterisierung als selbständig und lgisch denkendes Wesen, fähig zum Perspektivwechsel), analysieren einen anthrplgischen Ansatz zur Bestimmung des Unterschiedes vn Mensch und Tier auf der Basis ihrer gemeinsamen evlutinären Herkunft in seinen Grundgedanken, unterscheiden philsphische Fragen vn Alltagsfragen swie vn Fragen, die gesicherte wissenschaftliche Antwrten ermöglichen, erläutern den grundsätzlichen Charakter philsphischen Fragens und Denkens an Beispielen, erläutern Merkmale philsphischen Denkens und unterscheiden dieses vn anderen Denkfrmen, etwa in Myths und Naturwissenschaft, stellen metaphysische Fragen (u.a. die Frage eines Lebens nach dem Td, die Frage nach der Existenz Gttes) als Herausfrderungen für die Vernunfterkenntnis dar und entwickeln eigene Ideen zu ihrer Beantwrtung und Beantwrtbarkeit. Zentrale Methdenkmpetenz: Verfahren der Prblemreflexin: arbeiten aus Phänmenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien verallgemeinernd relevante philsphische Fragen heraus, ermitteln in einfacheren philsphischen Texten das diesen jeweils zugrundeliegende Prblem bzw. ihr Anliegen swie die zentrale These, recherchieren Infrmatinen swie die Bedeutung vn Fremdwörtern und Fachbegriffen unter Zuhilfenahme vn (auch digitalen) Lexika und anderen Nachschlagewerken. Verfahren der Präsentatin und Darstellung: geben Kernaussagen und Grundgedanken einfacherer philsphischer Texte in eigenen Wrten und distanziert, unter Zuhilfenahme eines angemessenen Textbeschreibungsvkabulars, wieder und verdeutlichen den interpretatrischen Anteil. 7
8 Knkretisierte Urteilskmpetenz: erörtern Knsequenzen, die sich aus der Snderstellung des Menschen im Reich des Lebendigen ergeben, swie die damit verbundenen Chancen und Risiken, bewerten den anthrplgischen Ansatz zur Bestimmung des Unterschiedes vn Mensch und Tier hinsichtlich des Einbezugs wesentlicher Aspekte des Menschseins, bewerten begründet die Bedeutsamkeit und Orientierungsfunktin vn philsphischen Fragen für ihr Leben. Unterrichtsvrhaben II: Thema: Ist der Mensch ein besnderes Lebewesen? Sprachliche, emtinale und kgnitive Fähigkeiten des Menschen Inhaltsfelder: Inhaltsfeld 1: Der Mensch und sein Handeln / Inhaltsfeld 2: Menschliche Erkenntnis und ihre Grenzen Die Snderstellung des Menschen / Prinzipien und Reichweite menschlicher Erkenntnis Knkretisierte Sachkmpetenz: erläutern Merkmale des Menschen als eines aus der natürlichen Evlutin hervrgegangenen Lebewesens und erklären wesentliche Unterschiede zwischen Mensch und Tier bzw. anderen nicht-menschlichen Lebensfrmen (z.b. Sprache, Würde, Arbeitskultur, Emtinen, Intentinen), analysieren einen anthrplgischen Ansatz zur Bestimmung des Unterschiedes vn Mensch und Tier auf der Basis ihrer gemeinsamen evlutinären Herkunft in seinen Grundgedanken. Zentrale Methdenkmpetenzen: (ergänzend zum Unterrichtsvrhaben I) Verfahren der Prblemreflexin beschreiben Phänmene der Lebenswelt vrurteilsfrei hne verfrühte Klassifizierung, identifizieren in einfacheren philsphischen Texten Sachaussagen und Werturteile, Begriffsbestimmungen, Behauptungen, Begründungen, Erläuterungen und Beispiele, bestimmen elementare philsphische Begriffe mit Hilfe definitrischer Verfahren. Knkretisierte Urteilskmpetenz: erörtern Knsequenzen, die sich aus der Snderstellung des Menschen im Reich des Lebendigen ergeben, swie die damit verbundenen Chancen und Risiken, bewerten den anthrplgischen Ansatz zur Bestimmung des Unterschiedes vn Mensch und Tier hinsichtlich des Einbezugs wesentlicher Aspekte des Menschseins. 8
9 Unterrichtsvrhaben III: Thema: Eine Ethik für alle Kulturen? Der Anspruch mralischer Nrmen auf interkulturelle Geltung Inhaltsfeld: Inhaltsfeld 1: Der Mensch und sein Handeln Inhaltlicher Schwerpunkt: Werte und Nrmen des Handelns im interkulturellen Kntext Knkretisierte Sachkmpetenz: reknstruieren einen relativistischen und einen universalistischen ethischen Ansatz in ihren Grundgedanken und erläutern diese Ansätze an Beispielen, erklären im Kntext der erarbeiteten ethischen Ansätze vrgenmmene begriffliche Unterscheidungen (u.a. Relativismus, Universalismus). Zentrale Methdenkmpetenz: (ergänzend zu den bisherigen Unterrichtsvrhaben) Verfahren der Prblemreflexin beschreiben Phänmene der Lebenswelt vrurteilsfrei hne verfrühte Klassifizierung, identifizieren in einfacheren philsphischen Texten Sachaussagen und Werturteile, Begriffsbestimmungen, Behauptungen, Begründungen, Erläuterungen und Beispiele, analysieren die gedankliche Abflge vn philsphischen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen, entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u.a. Gedankenexperimenten, fiktiven Dilemmata) eigene philsphische Gedanken Verfahren der Präsentatin und Darstellung stellen grundlegende philsphische Sachverhalte in diskursiver Frm strukturiert dar, stellen grundlegende philsphische Sachverhalte und Zusammenhänge in präsentativer Frm (u.a. Visualisierung, bildliche und szenische Darstellung) dar, stellen philsphische Prbleme und Prblemlösungsbeiträge in ihrem Für und Wider dar. Knkretisierte Urteilskmpetenz: bewerten begründet die Tragfähigkeit der behandelten ethischen Ansätze zur Orientierung in gegenwärtigen gesellschaftlichen Prblemlagen, erörtern unter Bezugnahme auf einen relativistischen bzw. universalistischen Ansatz der Ethik das Prblem der universellen Geltung mralischer Maßstäbe. 9
10 Vrhabenbezgene Absprache: Fakultativ: Behandlung der ethischen Dilemmasituatin Wahrheit der Lüge? Unterrichtsvrhaben IV: Thema: Die Frage nach Recht und Gerechtigkeit vn Strafen im Verhältnis vn Staat und Individuum Inhaltsfeld: Inhaltsfeld 1: Der Mensch und sein Handeln Inhaltlicher Schwerpunkt: Umfang und Grenzen staatlichen Handelns Zentrale Methdenkmpetenz: analysieren die gedankliche Abflge vn philsphischen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen. Knkretisierte Sachkmpetenz: analysieren unterschiedliche rechtsphilsphische Ansätze zur Begründung für Eingriffe in die Freiheitsrechte der Bürger in ihren Grundgedanken und grenzen diese Ansätze vneinander ab, erklären im Kntext der erarbeiteten rechtsphilsphischen Ansätze vrgenmmene begriffliche Unterscheidungen (z.b.recht, Gerechtigkeit, Strafe, Ziviler Ungehrsam ). Knkretisierte Urteilskmpetenz: bewerten begründet die Tragfähigkeit der behandelten rechtsphilsphischen Ansätze zur Orientierung in gegenwärtigen gesellschaftlichen Prblemlagen, erörtern unter Bezugnahme auf rechtsphilsphische Ansätze die Frage nach den Grenzen staatlichen Handelns swie das Prblem, b grundsätzlich der Einzelne der der Staat den Vrrang haben sllte. Vrhabenbezgene Absprache: Fakultativ: Behandlung der Kntrverse um die Gerechtigkeit der Tdesstrafe unter Bezugnahme auf den Film Minrity Reprt 10
11 Unterrichtsvrhaben V: Thema: Wie kmmt die Welt in unseren Kpf? Grundlagen der Erkenntnis Inhaltsfeld: Inhaltsfeld 2: Menschliche Erkenntnis und ihre Grenzen Inhaltlicher Schwerpunkt: Prinzipien und Reichweite menschlicher Erkenntnis, Eigenart philsphischen Fragens und Denkens Knkretisierte Sachkmpetenz: reknstruieren einen naiv-realistischen, einen empiristisch-realistischen und einen ratinalistisch-knstruktivistischen Ansatz zur Erklärung vn Erkenntnis in ihren Grundgedanken und grenzen diese Ansätze vneinander ab, identifizieren begründete Kritik an erkenntnistheretischen Ansätzen, die sich auf die Sinneserfahrungen als Erkenntnisquelle fkussieren beispielsweise mithilfe der Analyse ptischer Täuschungen. Knkretisierte Urteilskmpetenz: erörtern Vraussetzungen und Knsequenzen der behandelten erkenntnistheretischen Ansätze (u.a. für Wissenschaft, Religin, Philsphie bzw. Metaphysik), erörtern unter Bezugnahme auf die erarbeiteten erkenntnistheretischen Ansätze das Prblem der Beantwrtbarkeit metaphysischer Fragen durch die menschliche Vernunft und ihre Bedeutung für den Menschen. Unterrichtsvrhaben VI: Thema: Wie kmmt die Welt in unseren Kpf II? Das Verhältnis vn Mensch und Welt im Spiegel vn Ideenlehre, Ratinalismus und Empirismus Inhaltsfeld: Inhaltsfeld 2: Menschliche Erkenntnis und ihre Grenzen Eigenart philsphischen Fragens und Denkens, Metaphysische Prbleme als Herausfrderung für die Vernunfterkenntnis, Prinzipien und Reichweite menschlicher Erkenntnis Knkretisierte Sachkmpetenz: reknstruieren Platns Ideenlehre anhand der Gleichnisse, Descartes Methdischen Zweifel und Lckes Therie im Hinblick auf das Verhältnis vn Erkenntnissubjekt und Außenwelt und grenzen diese Ansätze vneinander ab. 11
12 Knkretisierte Urteilskmpetenz: erörtern Vraussetzungen und Knsequenzen der behandelten erkenntnistheretischen Ansätze (u.a. für Wissenschaft, Religin, Philsphie bzw. Metaphysik), erörtern unter Bezugnahme auf die erarbeiteten erkenntnistheretischen Ansätze das Prblem der Beantwrtbarkeit metaphysischer Fragen durch die menschliche Vernunft und ihre Bedeutung für den Menschen. Vrhabenbezgene Absprache: Fakultativ: - Die Analyse der Kausalität nach Hume und ihre Auswirkungen auf den Alltag - Erkenntnistheretische Analyse der Filme Matrix der Truman Shw Qualifikatinsphase Der Unterricht der Qualifikatinsphase sll es den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, dass sie aufbauend auf der Kmpetenzentwicklung in der Einführungsphase am Ende der Qualifikatinsphase über die im Flgenden genannten Kmpetenzen verfügen. Dabei werden zunächst übergerdnete Kmpetenzerwartungen zu allen Kmpetenzbereichen aufgeführt. Während die Methden- und Handlungskmpetenz ausschließlich inhaltsfeldübergreifend angelegt sind, werden die Sachkmpetenz swie die Urteilskmpetenz zusätzlich inhaltsfeldbezgen knkretisiert. Die nachflgenden übergerdneten Kmpetenzerwartungen sind im Grundkurs anzustreben: Sachkmpetenz stellen verschiedene philsphische Prblemstellungen in unterschiedlichen inhaltlichen und lebensweltlichen Kntexten dar und erläutern sie, entwickeln eigene Lösungsansätze für philsphische Prblemstellungen, analysieren und reknstruieren philsphische Psitinen und Denkmdelle in ihren wesentlichen gedanklichen bzw. argumentativen Schritten, 12
13 erklären philsphische Begriffe und im Kntext vn Begründungszusammenhängen vrgenmmene begriffliche Unterscheidungen, erläutern philsphische Psitinen und Denkmdelle an Beispielen und in Anwendungskntexten, stellen gedankliche Bezüge zwischen philsphischen Psitinen und Denkmdellen her, grenzen diese vneinander ab und rdnen sie in umfassendere fachliche Kntexte ein. Methdenkmpetenz Verfahren der Prblemreflexin beschreiben Phänmene der Lebenswelt vrurteilsfrei und sprachlich genau hne verfrühte Klassifizierung, arbeiten aus Phänmenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien abstrahierend relevante philsphische Fragen heraus und erläutern diese, ermitteln in philsphischen Texten das diesen jeweils zugrundeliegende Prblem bzw. ihr Anliegen swie die zentrale These, identifizieren in philsphischen Texten Sachaussagen und Werturteile, Begriffsbestimmungen, Behauptungen, Begründungen, Vraussetzungen, Flgerungen, Erläuterungen und Beispiele, analysieren den gedanklichen Aufbau und die zentralen Argumentatinsstrukturen in philsphischen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen, entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u.a. Gedankenexperimenten, fiktiven Dilemmata) eigene philsphische Gedanken und erläutern diese, bestimmen philsphische Begriffe mit Hilfe definitrischer Verfahren und grenzen sie vneinander ab, argumentieren unter bewusster Ausrichtung an einschlägigen philsphischen Argumentatinsverfahren (u.a. Tulmin-Schema), recherchieren Infrmatinen, Hintergrundwissen swie die Bedeutung vn Fremdwörtern und Fachbegriffen unter Zuhilfenahme vn (auch digitalen) Lexika und fachspezifischen Nachschlagewerken. Verfahren der Darstellung und Präsentatin stellen philsphische Sachverhalte und Zusammenhänge in diskursiver Frm strukturiert und begrifflich klar dar, stellen philsphische Sachverhalte und Zusammenhänge in präsentativer Frm (u.a. Visualisierung, bildliche und szenische Darstellung) dar, geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. Argumentatinsgang philsphischer Texte in eigenen Wrten und distanziert, unter 13
14 Zuhilfenahme eines angemessenen Textbeschreibungsvkabulars, wieder und belegen Interpretatinen durch krrekte Nachweise, stellen argumentativ abwägend philsphische Prbleme und Prblemlösungsbeiträge, auch in Frm eines Essays, dar. Urteilskmpetenz bewerten die Überzeugungskraft philsphischer Psitinen und Denkmdelle im Hinblick auf den Einbezug wesentlicher Aspekte der zugrundeliegenden Prblemstellung swie im Hinblick auf die Erklärung vn in ihrem Kntext relevanten Phänmenen, erörtern abwägend Vraussetzungen und Knsequenzen philsphischer Psitinen und Denkmdelle, beurteilen die gedankliche bzw. argumentative Knsistenz philsphischer Psitinen und Denkmdelle, bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfähigkeit philsphischer Psitinen und Denkmdelle zur Orientierung in grundlegenden Fragen des Daseins und gegenwärtigen gesellschaftlich-plitischen Prblemlagen, erörtern argumentativ abwägend philsphische Prbleme unter Bezug auf relevante philsphische Psitinen und Denkmdelle. Handlungskmpetenz entwickeln auf der Grundlage philsphischer Psitinen und Denkmdelle verantwrtbare Handlungsptinen für aus der Alltagswirklichkeit erwachsende Prblemstellungen, rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen durch plausible Gründe und Argumente unter Rückgriff auf das Orientierungsptential philsphischer Psitinen und Denkmdelle, vertreten im Rahmen ratinaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Psitin und gehen dabei auch argumentativ auf andere Psitinen ein, beteiligen sich mit philsphischen Beiträgen an der Diskussin allgemein-menschlicher und gegenwärtiger gesellschaftlich-plitischer Fragestellungen. Die Kmpetenzen der Schülerinnen und Schüler sllen im Rahmen der Behandlung der nachflgenden, für die Qualifikatinsphase bligatrischen Inhaltsfelder entwickelt werden: Inhaltsfeld 3: Das Selbstverständnis des Menschen Der Mensch als Natur- und Kulturwesen Das Verhältnis vn Leib und Seele Der Mensch als freies und selbstbestimmtes Wesen 14
15 Inhaltsfeld 4: Werte und Nrmen des Handelns Grundsätze eines gelingenden Lebens Nützlichkeit und Pflicht als ethische Prinzipien Verantwrtung in ethischen Anwendungskntexten Inhaltsfeld 5: Zusammenleben in Staat und Gesellschaft Gemeinschaft als Prinzip staatsphilsphischer Legitimatin Individualinteresse und Gesellschaftsvertrag als Prinzip staatsphilsphischer Legitimatin Knzepte vn Demkratie und szialer Gerechtigkeit Inhaltsfeld 6: Geltungsansprüche der Wissenschaften Erkenntnistheretische Grundlagen der Wissenschaften Der Anspruch der Naturwissenschaften auf Objektivität Unterrichtsvrhaben VII: Thema: Ist die Kultur die Natur des Menschen? Der Mensch als Prdukt der natürlichen Evlutin und die Bedeutung der Kultur für seine Entwicklung Knkretisierte Sachkmpetenz reknstruieren eine den Menschen als Kulturwesen bestimmende anthrplgische Psitin in ihren wesentlichen gedanklichen Schritten und erläutern diese Bestimmung an zentralen Elementen vn Kultur. Methdenkmpetenz Verfahren der Prblemreflexin ermitteln in philsphischen Texten das diesen jeweils zugrundeliegende Prblem bzw. ihr Anliegen swie die zentrale These (MK3), 15
16 identifizieren in philsphischen Texten Sachaussagen und Werturteile, Begriffsbestimmungen, Behauptungen, Begründungen, Vraussetzungen, Flgerungen, Erläuterungen und Beispiele (MK4). Verfahren der Präsentatin und Darstellung stellen philsphische Sachverhalte und Zusammenhänge in diskursiver Frm strukturiert und begrifflich klar dar (MK10). Knkretisierte Urteilskmpetenz bewerten kriteriengeleitet und argumentativ die Tragfähigkeit der behandelten anthrplgischen Psitinen zur Orientierung in grundlegenden Fragen des Daseins, erörtern unter Bezug auf die behandelte kulturanthrplgische Psitin argumentativ abwägend die Frage nach dem Menschen als Natur- der Kulturwesen. Handlungskmpetenz beteiligen sich mit philsphischen Beiträgen an der Diskussin allgemeinmenschlicher und gegenwärtiger gesellschaftlich-plitischer Fragestellungen (HK4). Inhaltsfelder: IF 3 (Das Selbstverständnis des Menschen) IF 5 (Zusammenleben in Staat und Gesellschaft) Der Mensch als Natur- und Kulturwesen Der Primat der Gemeinschaft als Prinzip staatsphilsphischer Legitimatin Zeitbedarf: 15 Std. Unterrichtsvrhaben VIII: Thema: Ist der Mensch mehr als Materie? Das Leib-Seele-Prblem im Licht der mdernen Gehirnfrschung Knkretisierte Sachkmpetenz 16
17 analysieren ein dualistisches und ein mnistisches Denkmdell zum Leib-Seele- Prblem in seinen wesentlichen gedanklichen Schritten und grenzen diese Denkmdelle vneinander ab, erklären philsphische Begriffe und Psitinen, die das Verhältnis vn Leib und Seele unterschiedlich bestimmen (u.a. Dualismus, Mnismus, Materialismus, Reduktinismus). Methdenkmpetenz Verfahren der Prblemreflexin arbeiten aus Phänmenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien abstrahierend relevante philsphische Fragen heraus und erläutern diese (MK2) analysieren den gedanklichen Aufbau und die zentralen Argumentatinsstrukturen in philsphischen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen (MK5), entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u.a. Gedankenexperimenten, fiktiven Dilemmata) eigene philsphische Gedanken und erläutern diese (MK6), bestimmen philsphische Begriffe mit Hilfe verschiedener definitrischer Verfahren (MK7). Verfahren der Präsentatin und Darstellung stellen argumentativ abwägend philsphische Prbleme und Prblemlösungsbeiträge, auch in Frm eines Essays, dar (MK13). Knkretisierte Urteilskmpetenz erörtern unter Bezug auf die behandelten dualistischen und materialistischreduktinistischen Denkmdelle argumentativ abwägend die Frage nach dem Verhältnis vn Leib und Seele. Handlungskmpetenz vertreten im Rahmen ratinaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Psitin und gehen dabei auch argumentativ auf andere Psitinen ein (HK3). Inhaltsfeld: IF 3 (Das Selbstverständnis des Menschen) Das Verhältnis vn Leib und Seele Der Mensch als freies und selbstbestimmtes Wesen 17
18 Unterrichtsvrhaben IX: Thema: Ist der Mensch ein freies Wesen? - Psychanalytische und existentialistische Auffassung des Menschen im Vergleich Knkretisierte Sachkmpetenz stellen die Frage nach der Freiheit des menschlichen Willens als philsphisches Prblem dar und grenzen dabei Willens- vn Handlungsfreiheit ab, analysieren und reknstruieren eine die Willensfreiheit verneinende und eine sie bejahende Auffassung des Menschen in ihren wesentlichen gedanklichen Schritten und rdnen diese als deterministisch bzw. indeterministisch ein, erläutern eine die Willensfreiheit verneinende und eine sie bejahende Auffassung des Menschen im Kntext vn Entscheidungssituatinen. Methdenkmpetenz Verfahren der Prblemreflexin beschreiben Phänmene der Lebenswelt vrurteilsfrei und sprachlich genau hne verfrühte Klassifizierung (MK1), arbeiten aus Phänmenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien abstrahierend relevante philsphische Fragen heraus und erläutern diese (MK2), bestimmen philsphische Begriffe mit Hilfe definitrischer Verfahren und grenzen sie vneinander ab (MK7), argumentieren unter bewusster Ausrichtung an einschlägigen philsphischen Argumentatinsverfahren (u.a. Tulmin-Schema) (MK8). Verfahren der Präsentatin und Darstellung stellen argumentativ abwägend philsphische Prbleme und Prblemlösungsbeiträge, auch in Frm eines Essays, dar (MK13). Knkretisierte Urteilskmpetenz erörtern abwägend Knsequenzen einer deterministischen und indeterministischen Psitin im Hinblick auf die Verantwrtung des Menschen für sein Handeln (u. a. die Frage nach dem Sinn vn Strafe), erörtern unter Bezug auf die deterministische und indeterministische Psitin argumentativ abwägend die Frage nach der menschlichen Freiheit und ihrer Denkmöglichkeit. Handlungskmpetenz: 18
19 rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen durch plausible Gründe und Argumente im Rückgriff auf das Orientierungsptential philsphischer Psitinen und Denkmdelle (HK2). Inhaltsfelder: IF 3 (Das Selbstverständnis des Menschen) IF 4 (Werte und Nrmen des Handelns) Der Mensch als freies und selbstbestimmtes Wesen Grundsätze eines gelingenden Lebens Unterrichtsvrhaben X: Thema: Wie kann das Leben gelingen? Eudämnistische Auffassungen eines guten Lebens Knkretisierte Sachkmpetenz reknstruieren eine philsphische Antwrt auf die Frage nach dem gelingenden Leben in ihren wesentlichen gedanklichen Schritten und rdnen sie in das ethische Denken ein. Methdenkmpetenz Verfahren der Prblemreflexin identifizieren in philsphischen Texten Sachaussagen und Werturteile, Begriffsbestimmungen, Behauptungen, Begründungen, Vraussetzungen, Flgerungen, Erläuterungen und Beispiele (MK4). Verfahren der Präsentatin und Darstellung stellen argumentativ abwägend philsphische Prbleme und Prblemlösungsbeiträge dar, auch in Frm eines Essays (MK13). Knkretisierte Urteilskmpetenz 19
20 bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfähigkeit der behandelten eudämnistischen Psitin zur Orientierung in Fragen der eigenen Lebensführung. Handlungskmpetenz rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen durch plausible Gründe und Argumente und nutzen dabei das Orientierungsptential philsphischer Psitinen und Denkmdelle (HK2), vertreten im Rahmen ratinaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Psitin und gehen dabei auch argumentativ auf andere Psitinen ein (HK3). Inhaltsfelder: IF 4 (Werte und Nrmen des Handelns) IF 3 (Das Selbstverständnis des Menschen) Grundsätze eines gelingenden Lebens Das Verhältnis vn Leib und Seele Unterrichtsvrhaben XI: Thema: Sll ich mich im Handeln am Kriterium der Nützlichkeit der der Pflicht rientieren? Utilitaristische und dentlgische Psitinen im Vergleich Knkretisierte Sachkmpetenz analysieren und reknstruieren ethische Psitinen, die auf dem Prinzip der Nützlichkeit und auf dem Prinzip der Pflicht basieren, in ihren wesentlichen gedanklichen Schritten, erläutern die behandelten ethischen Psitinen an Beispielen und rdnen sie in das ethische Denken ein. Methdenkmpetenz Verfahren der Prblemreflexin 20
21 ermitteln in philsphischen Texten das diesen jeweils zugrundeliegende Prblem bzw. ihr Anliegen swie die zentrale These (MK3), analysieren den gedanklichen Aufbau und die zentralen Argumentatinsstrukturen in philsphischen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen (MK5), entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u.a. Gedankenexperimenten, fiktiven Dilemmata) eigene philsphische Gedanken und erläutern diese (MK6). Verfahren der Präsentatin und Darstellung geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. Argumentatinsgang philsphischer Texte in eigenen Wrten und distanziert, unter Zuhilfenahme eines angemessenen Textbeschreibungsvkabulars, wieder und belegen Interpretatinen durch krrekte Nachweise (MK12). Knkretisierte Urteilskmpetenz bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfähigkeit utilitaristischer und dentlgischer Grundsätze zur Orientierung in Fragen mralischen Handelns. Handlungskmpetenz rechtfertigen eigene Entscheidungen und Handlungen durch plausible Gründe und Argumente und nutzen dabei das Orientierungsptential philsphischer Psitinen und Denkmdelle (HK2). Inhaltsfelder: IF 4 (Werte und Nrmen des Handelns) IF 3 (Das Selbstverständnis des Menschen) Nützlichkeit und Pflicht als ethische Prinzipien Der Mensch als freies und selbstbestimmtes Wesen 21
22 Unterrichtsvrhaben XII: Thema: Gibt es eine Verantwrtung des Menschen für die Natur? Ethische Grundsätze im Anwendungskntext der Öklgie Knkretisierte Sachkmpetenz analysieren und reknstruieren eine Verantwrtung in ethischen Anwendungskntexten begründende Psitin (u.a. für die Bewahrung der Natur bzw. für den Schutz der Menschenwürde in der Medizinethik) in ihren wesentlichen gedanklichen Schritten und erläutern sie an Beispielen. Methdenkmpetenz Verfahren der Prblemreflexin argumentieren unter bewusster Ausrichtung an einschlägigen philsphischen Argumentatinsverfahren (u. a. Tulmin-Schema) (MK8), recherchieren Infrmatinen, Hintergrundwissen swie die Bedeutung vn Fremdwörtern und Fachbegriffen unter Zuhilfenahme vn (auch digitalen) Lexika und fachspezifischen Nachschlagewerken (MK9). Verfahren der Präsentatin und Darstellung geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. Argumentatinsgang philsphischer Texte in eigenen Wrten und distanziert, unter Zuhilfenahme eines angemessenen Textbeschreibungsvkabulars, wieder und belegen Interpretatinen durch krrekte Nachweise (MK12). Knkretisierte Urteilskmpetenz bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfähigkeit der behandelten verantwrtungsethischen Psitin zur Orientierung in Entscheidungsfeldern angewandter Ethik, erörtern unter Bezug auf die behandelte verantwrtungsethische Psitin argumentativ abwägend die Frage nach der mralischen Verantwrtung in Entscheidungsfeldern angewandter Ethik. Handlungskmpetenz 22
23 entwickeln auf der Grundlage philsphischer Psitinen und Denkmdelle verantwrtbare Handlungsptinen für aus der Alltagswirklichkeit erwachsende Prblemstellungen (HK1), beteiligen sich mit philsphischen Beiträgen an der Diskussin allgemeinmenschlicher und gegenwärtiger gesellschaftlich-plitischer Fragestellungen (HK4). Inhaltsfelder: IF 4 (Werte und Nrmen des Handelns) IF 3 (Das Selbstverständnis des Menschen) Verantwrtung in Fragen angewandter Ethik Der Mensch als Natur- und Kulturwesen Qualifikatinsphase II Unterrichtsvrhaben XIII: Thema: Welche Ordnung der Gemeinschaft ist gerecht? - Philsphenkönigtum als Staatsideal Ständestaat und Knkretisierte Sachkmpetenz stellen die Legitimatinsbedürftigkeit staatlicher Herrschaft als philsphisches Prblem dar und entwickeln eigene Lösungsansätze in Frm vn möglichen Staatsmdellen, reknstruieren ein am Prinzip der Gemeinschaft rientiertes Staatsmdell in seinen wesentlichen Gedankenschritten. Methdenkmpetenz Verfahren der Prblemreflexin: 23
24 analysieren den gedanklichen Aufbau und die zentralen Argumentatinsstrukturen in philsphischen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen (MK5), entwickeln Hilfe heuristischer Verfahren (u. a. Gedankenexperimenten, fiktiven Dilemmata) eigene philsphische Gedanken und erläutern diese (MK 6). Verfahren der Präsentatin und Darstellung stellen philsphische Sachverhalte und Zusammenhänge in diskursiver Frm strukturiert und begrifflich klar dar (MK10), stellen philsphische Sachverhalte und Zusammenhänge in präsentativer Frm (u.a. Visualisierung, bildliche und szenische Darstellung) dar (MK11), geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. Argumentatinsgang philsphischer Texte in eigenen Wrten und distanziert, unter Zuhilfenahme eines angemessenen Textbeschreibungsvkabulars, wieder und belegen Interpretatinen durch krrekte Nachweise (MK12). Knkretisierte Urteilskmpetenz erörtern abwägend anthrplgische Vraussetzungen der behandelten Staatsmdelle und deren Knsequenzen, bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfähigkeit der behandelten Staatsmdelle zur Orientierung in gegenwärtigen plitischen Prblemlagen. Inhaltsfelder: IF 5 (Zusammenleben in Staat und Gesellschaft) IF 3 (Das Selbstverständnis des Menschen) Gemeinschaft als Prinzip staatsphilsphischer Legitimatin Der Mensch als Natur- und Kulturwesen 24
25 Unterrichtsvrhaben XIV: Thema: Wie lässt sich eine staatliche Ordnung vm Primat des Individuums aus rechtfertigen? Kntraktualistische Staatstherien im Vergleich Knkretisierte Sachkmpetenz analysieren unterschiedliche Mdelle zur Rechtfertigung des Staates durch einen Gesellschaftsvertrag in ihren wesentlichen Gedankenschritten und stellen gedankliche Bezüge zwischen ihnen im Hinblick auf die Knzeptin des Naturzustandes und der Staatsfrm her, erklären den Begriff des Kntraktualismus als Frm der Staatsbegründung und rdnen die behandelten Mdelle in die kntraktualistische Begründungstraditin ein. Methdenkmpetenz Verfahren der Prblemreflexin identifizieren in philsphischen Texten Sachaussagen und Werturteile, Begriffsbestimmungen, Behauptungen, Begründungen, Vraussetzungen, Flgerungen, Erläuterungen und Beispiele (MK4) analysieren den gedanklichen Aufbau und die zentralen Argumentatinsstrukturen in philsphischen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen (MK5). Verfahren der Präsentatin und Darstellung stellen philsphische Sachverhalte und Zusammenhänge in diskursiver Frm strukturiert und begrifflich klar dar (MK10), stellen philsphische Sachverhalte und Zusammenhänge in präsentativer Frm (u.a. Visualisierung, bildliche und szenische Darstellung) dar (MK11). Knkretisierte Urteilskmpetenz erörtern abwägend anthrplgische Vraussetzungen der behandelten kntraktualistischen Staatsmdelle und deren Knsequenzen, bewerten die Überzeugungskraft der behandelten kntraktualistischen Staatsmdelle im Hinblick auf die Legitimatin eines Staates angesichts der Freiheitsansprüche des Individuums, 25
26 bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfähigkeit der behandelten Staatsmdelle zur Orientierung in gegenwärtigen plitischen Prblemlagen. Inhaltsfelder: IF 5 (Zusammenleben in Staat und Gesellschaft) IF 3 (Das Selbstverständnis des Menschen) Individualinteresse und Gesellschaftsvertrag als Prinzip staatsphilsphischer Legitimatin Der Mensch als Natur- und Kulturwesen Unterrichtsvrhaben XV: Thema: Lassen sich die Ansprüche des Einzelnen auf plitische Mitwirkung und gerechte Teilhabe in einer staatlichen Ordnung realisieren? Mderne Knzepte vn Demkratie und szialer Gerechtigkeit auf dem Prüfstand Knkretisierte Sachkmpetenz analysieren und reknstruieren eine szialphilsphische Psitin zur Bestimmung vn Demkratie und eine zur Bestimmung vn szialer Gerechtigkeit in ihren wesentlichen Gedankenschritten. Methdenkmpetenz Verfahren der Prblemreflexin arbeiten aus Phänmenen der Lebenswelt und präsentativen Materialien abstrahierend relevante philsphische Fragen heraus und erläutern diese (MK2), recherchieren Infrmatinen, Hintergrundwissen swie die Bedeutung vn Fremdwörtern und Fachbegriffen unter Zuhilfenahme vn (auch digitalen) Lexika und fachspezifischen Nachschlagewerken (MK9). Verfahren der Präsentatin und Darstellung 26
27 stellen philsphische Sachverhalte und Zusammenhänge in diskursiver Frm strukturiert und begrifflich klar dar (MK10). Knkretisierte Urteilskmpetenz bewerten kriteriengeleitet und argumentierend die Tragfähigkeit der behandelten Knzepte zur Bestimmung vn Demkratie und szialer Gerechtigkeit, erörtern unter Bezug auf die behandelten Psitinen zur Bestimmung vn Demkratie und szialer Gerechtigkeit argumentativ abwägend die Frage nach dem Recht auf Widerstand in einer Demkratie. Handlungskmpetenz entwickeln auf der Grundlage philsphischer Psitinen und Denkmdelle verantwrtbare Handlungsptinen für aus der Alltagswirklichkeit erwachsende Prblemstellungen (HK1), beteiligen sich mit philsphischen Beiträgen an der Diskussin allgemeinmenschlicher und gegenwärtiger gesellschaftlich-plitischer Fragestellungen (HK4). Inhaltsfelder: IF 5 (Zusammenleben in Staat und Gesellschaft) IF 4 (Werte und Nrmen des Handelns) Knzepte vn Demkratie und szialer Gerechtigkeit Verantwrtung in ethischen Anwendungskntexten Unterrichtsvrhaben XVI: Thema: Was leisten sinnliche Wahrnehmung und Verstandestätigkeit für die wissenschaftliche Erkenntnis? ratinalistische und empiristische Mdelle im Vergleich Knkretisierte Sachkmpetenz 27
28 analysieren eine ratinalistische und eine empiristische Psitin zur Klärung der Grundlagen wissenschaftlicher Erkenntnis in ihren wesentlichen argumentativen Schritten und grenzen diese vneinander ab. Methdenkmpetenz Verfahren der Prblemreflexin beschreiben Phänmene der Lebenswelt vrurteilsfrei und sprachlich genau hne verfrühte Klassifizierung (MK1), ermitteln in philsphischen Texten das diesen jeweils zugrundeliegende Prblem bzw. ihr Anliegen swie die zentrale These (MK3), analysieren den gedanklichen Aufbau und die zentralen Argumentatinsstrukturen in philsphischen Texten und interpretieren wesentliche Aussagen (MK5), entwickeln mit Hilfe heuristischer Verfahren (u.a. Gedankenexperimenten, fiktiven Dilemmata) eigene philsphische Gedanken und erläutern diese (MK6). Verfahren der Präsentatin und Darstellung geben Kernaussagen und Gedanken- bzw. Argumentatinsgang philsphischer Texte in eigenen Wrten und distanziert, unter Zuhilfenahme eines angemessenen Textbeschreibungsvkabulars, wieder und belegen Interpretatinen durch krrekte Nachweise (MK12). Knkretisierte Urteilskmpetenz beurteilen die argumentative Knsistenz der behandelten ratinalistischen und empiristischen Psitin, erörtern abwägend Knsequenzen einer empiristischen und einer ratinalistischen Bestimmung der Grundlagen der Naturwissenschaften für deren Erkenntnisanspruch. Handlungskmpetenz: vertreten im Rahmen ratinaler Diskurse im Unterricht ihre eigene Psitin und gehen dabei auch argumentativ auf andere Psitinen ein (HK3). Inhaltsfelder: IF 6 (Geltungsansprüche der Wissenschaften) Erkenntnistheretische Grundlagen der Wissenschaften 28
29 Unterrichtsvrhaben XVII: Thema: Wie gelangen die Wissenschaften zu Erkenntnissen? Anspruch und Verfahrensweisen der neuzeitlichen Naturwissenschaften Knkretisierte Sachkmpetenz stellen die Frage nach dem besnderen Erkenntnis- und Geltungsanspruch der Wissenschaften als erkenntnistheretisches Prblem dar und erläutern dieses an Beispielen aus ihrem Unterricht in verschiedenen Fächern, reknstruieren ein den Anspruch der Naturwissenschaften auf Objektivität reflektierendes Denkmdell in seinen wesentlichen argumentativen Schritten und erläutern es an Beispielen aus der Wissenschaftsgeschichte, erklären zentrale Begriffe des behandelten wissenschaftstheretischen Denkmdells. Methdenkmpetenz Verfahren der Prblemreflexin: bestimmen philsphische Begriffe mit Hilfe definitrischer Verfahren und grenzen sie vneinander ab (MK7), argumentieren unter bewusster Ausrichtung an einschlägigen philsphischen Argumentatinsverfahren (u.a. Tulmin-Schema) (MK8), recherchieren Infrmatinen, Hintergrundwissen swie die Bedeutung vn Fremdwörtern und Fachbegriffen unter Zuhilfenahme vn (auch digitalen) Lexika und fachspezifischen Nachschlagewerken (MK9). Verfahren der Präsentatin und Darstellung stellen philsphische Sachverhalte und Zusammenhänge in präsentativer Frm (u.a. Visualisierung, bildliche und szenische Darstellung) dar (MK11), stellen argumentativ abwägend philsphische Prbleme und Prblemlösungsbeiträge dar, auch in Frm eines Essays (MK13). Knkretisierte Urteilskmpetenz erörtern abwägend erkenntnistheretische Vraussetzungen des behandelten wissenschaftstheretischen Mdells und seine Knsequenzen für das Vrgehen in den Naturwissenschaften, 29
30 erörtern unter Bezug auf das erarbeitete wissenschaftstheretische Denkmdell argumentativ abwägend die Frage nach der Fähigkeit der Naturwissenschaften, bjektive Erkenntnis zu erlangen. Handlungskmpetenz beteiligen sich mit philsphischen Beiträgen an der Diskussin allgemeinmenschlicher und gegenwärtiger gesellschaftlich-plitischer Fragestellungen (HK4). Inhaltsfelder: IF 6 (Geltungsansprüche der Wissenschaften) IF 4 (Werte und Nrmen des Handelns) IF 5 (Zusammenlaben in Staat und Gesellschaft) Der Anspruch der Naturwissenschaften auf Objektivität Verantwrtung in ethischen Anwendungskntexten Knzepte vn Demkratie (und szialer Gerechtigkeit) Zeitbedarf: 10 Std. 2.2 Grundsätze der fachmethdischen und -didaktischen Arbeit 1. Die dem Unterricht zugrunde liegenden Prblemstellungen sind transparent und bilden den Ausgangspunkt und rten Faden für die Material- und Medienauswahl. 2. Der Zusammenhang zwischen einzelnen Unterrichtsstunden wird in der Regel durch das Prinzip des Prblemüberhangs hergestellt. 3. Primäre Unterrichtsmedien bzw. -materialien sind philsphische, d. h. diskursiv-argumentative Texte, sg. präsentative Materialien werden besnders in Hinführungs- und Transferphasen eingesetzt. 4. Im Unterricht ist genügend Raum für die Entwicklung eigener Ideen; diese werden in Bezug zu den Lösungsbeiträgen der philsphischen Traditin gesetzt. 5. Eigene Beurteilungen und Psitinierungen werden zugelassen und ggf. aktiv initiiert, u. a. durch die Auswahl knträrer philsphischer Ansätze und Psitinen. 6. Erarbeitete philsphische Ansätze und Psitinen werden in lebensweltlichen Anwendungskntexten reknstruiert. 7. Der Unterricht fördert, besnders in Gesprächsphasen, die sachbestimmte, argumentative Interaktin der Schülerinnen und Schüler. 30
31 8. Die für einen philsphischen Diskurs ntwendigen begrifflichen Klärungen werden kntinuierlich und zunehmend unter Rückgriff auf fachbezgene Verfahren vrgenmmen. 9. Die Fähigkeit zum Philsphieren wird auch in Frm vn kntinuierlichen schriftlichen Beiträgen zum Unterricht (Textwiedergaben, kurze Erörterungen, Stellungnahmen usw.) entwickelt. 10. Unterrichtsergebnisse werden in unterschiedlichen Frmen (Tafelbilder, Lernplakate, Arbeitsblätter) gesichert. 11. Die Methdenkmpetenz wird durch den übenden Umgang mit verschiedenen fachphilsphischen Methden und die gemeinsame Reflexin auf ihre Leistung entwickelt. 12. Im Unterricht herrscht eine ffene, intellektuelle Neugierde vrlebende Atmsphäre, es kmmt nicht darauf an, welche Psitin jemand vertritt, sndern wie er sie begründet. 2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung Die Grundsätze der Leistungsbewertung werden den Schülerinnen und Schülern zum Schuljahresbeginn transparent gemacht. Überprüfung der schriftlichen Leistung Die Frmate der schriftlichen Abituraufgaben werden schrittweise entwickelt: - Im 1. Halbjahr der Einführungsphase liegt der Schwerpunkt auf der Analyse und Interpretatin eines philsphischen Textes (E), - im 2. Halbjahr auf der Erörterung eines philsphischen Prblems hne Materialgrundlage (B), - im 1. Jahr der Qualifikatinsphase auf der Reknstruktin philsphischer Psitinen und Denkmdelle (F) und dem Vergleich philsphischer Texte und Psitinen (H), - im 2. Jahr der Qualifikatinsphase auf der Beurteilung philsphischer Texte und Psitinen (I). Überprüfung der snstigen Leistung Neben den. g. bligatrischen Frmen der Leistungsüberprüfung werden weitere Instrumente der Leistungsbewertung genutzt, u. a.: mündliche Beiträge zum Unterricht (z. B. Beiträge zum Unterrichtsgespräch, Referate, Präsentatinen, Kurzvrträge) Mitarbeit in Partner- und Gruppenarbeiten schriftliche Übungen bzw. Überprüfungen weitere schriftliche Beiträge zum Unterricht (z. B. Prtklle, Materialsammlungen, Hefte/Mappen, Prtflis, Lerntagebücher) 31
32 Beiträge im Rahmen eigenverantwrtlichen, schüleraktiven Handelns (z. B. Präsentatin, Rllenspiel, Befragung, Erkundung, Prjektarbeit) Kriterien der Leistungsbewertung Die Bewertungskriterien für eine Leistung werden den Schülerinnen und Schülern zu Beginn der jeweiligen Kurshalbjahre transparent gemacht. Die flgenden an die Bewertungskriterien des Kernlehrplans für die Abiturprüfung angelehnten allgemeinen Kriterien gelten swhl für die schriftlichen als auch für die snstigen Frmen der Leistungsüberprüfung: Umfang und Differenzierungsgrad der Ausführungen sachliche Richtigkeit und Schlüssigkeit der Ausführungen Angemessenheit der Abstraktinsebene Herstellen geeigneter Zusammenhänge argumentative Begründung eigener Urteile, Stellungnahmen und Wertungen Eigenständigkeit der Auseinandersetzung mit Sachverhalten und Prblemstellungen Klarheit und Strukturiertheit in Aufbau vn Darstellungen Sicherheit im Umgang mit Fachmethden Verwendung vn Fachsprache und geklärter Begrifflichkeit Erfüllung standardsprachlicher Nrmen Der Grad der Anwendung der angeführten Maßstäbe hängt insgesamt vn der Kmplexität der zu erschließenden und darzustellenden Gegenstände ab. Die Bewertung der schriftlichen Leistungen, insbesndere vn Klausuren erflgt anhand vn jeweils zu erstellenden Bewertungsbögen, die sich an den Vrgaben der Bewertung im Zentralabitur rientieren. 32
Unterrichtsvorhaben I
 Lehrplan Philosophie für die Einführungsphase (Jgst. 10) Übersichtsraster der verbindlichen Unterrichtsvorhaben Thema: Was ist Philosophie? Unterrichtsvorhaben I arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt
Lehrplan Philosophie für die Einführungsphase (Jgst. 10) Übersichtsraster der verbindlichen Unterrichtsvorhaben Thema: Was ist Philosophie? Unterrichtsvorhaben I arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt
PHILOSOPHIE. Qualifikationsphase (Q2) GRUNDKURS Unterrichtsvorhaben XIV: Unterrichtsvorhaben XIII:
 PHILOSOPHIE Unterrichtsvorhaben XIII: Qualifikationsphase (Q2) GRUNDKURS Unterrichtsvorhaben XIV: Thema: Welche Ordnung der Gemeinschaft ist gerecht? - Ständestaat und Philosophenkönigtum stellen die Legitimationsbedürftigkeit
PHILOSOPHIE Unterrichtsvorhaben XIII: Qualifikationsphase (Q2) GRUNDKURS Unterrichtsvorhaben XIV: Thema: Welche Ordnung der Gemeinschaft ist gerecht? - Ständestaat und Philosophenkönigtum stellen die Legitimationsbedürftigkeit
Qualifikationsphase (Q2) GRUNDKURS Unterrichtsvorhaben XIII: Unterrichtsvorhaben XIV:
 Qualifikationsphase (Q2) GRUNDKURS Unterrichtsvorhaben XIII: Thema: Welche Ordnung der Gemeinschaft ist gerecht? - Ständestaat und Philosophenkönigtum als Staatsideal stellen die Legitimationsbedürftigkeit
Qualifikationsphase (Q2) GRUNDKURS Unterrichtsvorhaben XIII: Thema: Welche Ordnung der Gemeinschaft ist gerecht? - Ständestaat und Philosophenkönigtum als Staatsideal stellen die Legitimationsbedürftigkeit
Kernlehrplan Philosophie - Einführungsphase
 Kernlehrplan Philosophie - Einführungsphase Einführungsphase Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie unterscheiden philosophische
Kernlehrplan Philosophie - Einführungsphase Einführungsphase Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie unterscheiden philosophische
Schulinternes Curriculum Philosophie Gymnasium Schloss Holte-Stukenbrock
 Schulinternes Curriculum Philosophie Gymnasium Schloss Holte-Stukenbrock EF Unterrichtsvorhaben Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und
Schulinternes Curriculum Philosophie Gymnasium Schloss Holte-Stukenbrock EF Unterrichtsvorhaben Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und
Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie in der Einführungsphase der Gesamtschule Aachen-Brand
 Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie in der Einführungsphase der Gesamtschule Aachen-Brand Stand: August 2014 Unterrichtsvorhaben I Eigenart philosophischen Fragens und Denkens - Was heißt es
Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie in der Einführungsphase der Gesamtschule Aachen-Brand Stand: August 2014 Unterrichtsvorhaben I Eigenart philosophischen Fragens und Denkens - Was heißt es
Schulinternes Curriculum für das Unterrichtsfach Philosophie: Einführungsphase
 Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was ist Philosophie? Vom Mythos zum Logos Inhaltsfeld: Erkenntnis und ihre Grenzen Eigenart philosophischen Fragens und Denkens Zeitbedarf: ca. 15 Stunden - unterscheiden
Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was ist Philosophie? Vom Mythos zum Logos Inhaltsfeld: Erkenntnis und ihre Grenzen Eigenart philosophischen Fragens und Denkens Zeitbedarf: ca. 15 Stunden - unterscheiden
Schulinterner Kernlehrplan EF PL Leonardo-da-Vinci-Gymnasium Köln-Nippes
 Schulinterner Kernlehrplan EF PL Leonardo-da-Vinci-Gymnasium Köln-Nippes Thema 1: Kompetenzen: Was ist Philosophie? Welterklärung in Mythos, Naturwissenschaft und Philosophie Sachkompetenz (SK) - unterscheiden
Schulinterner Kernlehrplan EF PL Leonardo-da-Vinci-Gymnasium Köln-Nippes Thema 1: Kompetenzen: Was ist Philosophie? Welterklärung in Mythos, Naturwissenschaft und Philosophie Sachkompetenz (SK) - unterscheiden
Übersicht zu den Unterrichtsvorhaben in der EF. Jahrgangsstufe: EF Jahresthema:
 Übersicht zu den Unterrichtsvorhaben in der EF Jahrgangsstufe: EF Jahresthema: Unterrichtsvorhaben I: Philosophie: Was ist das? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie unterscheiden philosophische
Übersicht zu den Unterrichtsvorhaben in der EF Jahrgangsstufe: EF Jahresthema: Unterrichtsvorhaben I: Philosophie: Was ist das? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie unterscheiden philosophische
schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe des Quirinus Gymnasiums in Neuss Philosophie
 schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe des Quirinus Gymnasiums in Neuss Philosophie Obligatorische Unterrichtsvorhaben in der Einführungsphase 1.Halbjahr : Inhaltsfeld 1 :
schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe des Quirinus Gymnasiums in Neuss Philosophie Obligatorische Unterrichtsvorhaben in der Einführungsphase 1.Halbjahr : Inhaltsfeld 1 :
Inhaltsfeld Inhaltsfeld 3: Das Selbstverständnis des Menschen Inhaltsfeld 5: Zusammenleben in Staat und Gesellschaft
 Unterrichtsvorhaben VII: Thema: Ist die Kultur die Natur des Menschen? Der Mensch als Produkt der natürlichen Evolution und die Bedeutung der Kultur für seine Entwicklung Inhaltsfeld Inhaltsfeld 3: Das
Unterrichtsvorhaben VII: Thema: Ist die Kultur die Natur des Menschen? Der Mensch als Produkt der natürlichen Evolution und die Bedeutung der Kultur für seine Entwicklung Inhaltsfeld Inhaltsfeld 3: Das
Inhaltsfeld Inhaltsfeld 5: Zusammenleben in Staat und Gesellschaft Inhaltsfeld 3: Das Selbstverständnis des Menschen
 Unterrichtsvorhaben XIII: Thema: Welche Ordnung der Gemeinschaft ist gerecht? - Ständestaat und Philosophenkönigtum als Staatsideal Inhaltsfeld Inhaltsfeld 5: Zusammenleben in Staat und Gesellschaft Inhaltsfeld
Unterrichtsvorhaben XIII: Thema: Welche Ordnung der Gemeinschaft ist gerecht? - Ständestaat und Philosophenkönigtum als Staatsideal Inhaltsfeld Inhaltsfeld 5: Zusammenleben in Staat und Gesellschaft Inhaltsfeld
Qualifikationsphase (Q1) GRUNDKURS. Unterrichtsvorhaben VIII: Unterrichtsvorhaben VII: Thema: Der Mensch als dual-quantifizierte Synthese
 Qualifikationsphase (Q1) GRUNDKURS Unterrichtsvorhaben VII: Thema: Der Mensch als Selbst von Gottes Gnaden rekonstruieren das Verständnis des Menschen als von Gott geschaffene und bestimmte Kreatur in
Qualifikationsphase (Q1) GRUNDKURS Unterrichtsvorhaben VII: Thema: Der Mensch als Selbst von Gottes Gnaden rekonstruieren das Verständnis des Menschen als von Gott geschaffene und bestimmte Kreatur in
EF: obligatorische Inhaltsfelder Der Mensch und sein Handeln und Erkenntnis und ihre Grenzen
 Schulinternes Curriculum Rhein-Gymnasium PL: Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben EF: obligatorische Inhaltsfelder Der Mensch und sein Handeln und Erkenntnis und ihre Grenzen Einführungsphase Rhein-Gymnasium
Schulinternes Curriculum Rhein-Gymnasium PL: Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben EF: obligatorische Inhaltsfelder Der Mensch und sein Handeln und Erkenntnis und ihre Grenzen Einführungsphase Rhein-Gymnasium
Q 1. Zeitbedarf: ca. Std.
 Schulinterner Lehrplan: Philosophie Sek. II Qualifizierungsphase, Grundkurs (Jg. 12+13) Stand: 15.10.15 ab Abitur 2017 Jg. Unterrichtsvorhaben Kompetenzerwartungen Q 1 Inhaltsfeld 3: Das Selbstverständnis
Schulinterner Lehrplan: Philosophie Sek. II Qualifizierungsphase, Grundkurs (Jg. 12+13) Stand: 15.10.15 ab Abitur 2017 Jg. Unterrichtsvorhaben Kompetenzerwartungen Q 1 Inhaltsfeld 3: Das Selbstverständnis
Thema der Unterrichtssequenz: Zusammenleben in Staat und Gesellschaft (Inhaltsfeld 5)
 Thema der Unterrichtssequenz: Zusammenleben in Staat und Gesellschaft (sfeld 5) Der Primat der Gemeinschaft als Prinzip staatsphilosophischer Legitimation Gemeinschaft als Prinzip staatsphilosophischer
Thema der Unterrichtssequenz: Zusammenleben in Staat und Gesellschaft (sfeld 5) Der Primat der Gemeinschaft als Prinzip staatsphilosophischer Legitimation Gemeinschaft als Prinzip staatsphilosophischer
Unterrichtsvorhaben 11 / 1 Das Selbstverständnis des Menschen (Anthropologie) Ist die Kultur die Natur des Menschen?
 1 Die Angaben zu den beziehen sich auf das am AVG als Unterrichtsgrundlage verwendete Lehrwerk Zugänge zur Philosophie. Qualifikationsphase. Die obligatorischen Inhalte für das Zentralabitur sind durch
1 Die Angaben zu den beziehen sich auf das am AVG als Unterrichtsgrundlage verwendete Lehrwerk Zugänge zur Philosophie. Qualifikationsphase. Die obligatorischen Inhalte für das Zentralabitur sind durch
Konkretisierte Unterrichtsvorhaben Philosophie Qualifikationsphase (Grundkurs)
 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben Philosophie Qualifikationsphase (Grundkurs) Inhaltsfeld 3: Das Selbstverständnis des Menschen- Kurshalbjahr 11.1 Unterrichtssequenzen Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene
Konkretisierte Unterrichtsvorhaben Philosophie Qualifikationsphase (Grundkurs) Inhaltsfeld 3: Das Selbstverständnis des Menschen- Kurshalbjahr 11.1 Unterrichtssequenzen Zu entwickelnde Kompetenzen Vorhabenbezogene
Joseph-König-Gymnasium Haltern am See. Schulinternes Curriculum für das Fach Philosophie (Sek II) Stand: April 15
 Joseph-König-Gymnasium Haltern am See Schulinternes Curriculum für das Fach Philosophie (Sek II) Stand: April 15 Inhaltsverzeichnis 1. Zum schulinternen Curriculum Philosophie fachliche Rahmenbedingungen
Joseph-König-Gymnasium Haltern am See Schulinternes Curriculum für das Fach Philosophie (Sek II) Stand: April 15 Inhaltsverzeichnis 1. Zum schulinternen Curriculum Philosophie fachliche Rahmenbedingungen
Kompetenzorientierter Lehrplan Philosophie Sek. II. (Fassung vom )
 Fachschaft Kompetenzorientierter Lehrplan Philosophie Sek. II (Fassung vom 30.11.2015) Inhalt 1. Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 2. Entscheidungen im Unterricht 2.1. Allgemeine Hinweise 2.2. Einführungsphase
Fachschaft Kompetenzorientierter Lehrplan Philosophie Sek. II (Fassung vom 30.11.2015) Inhalt 1. Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 2. Entscheidungen im Unterricht 2.1. Allgemeine Hinweise 2.2. Einführungsphase
Philosophie. Schulinterner Lehrplan. zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe
 Große Twete 5 32683 Barntrup Tel.: 0049 (0)5263 95165 FAX: 0049 (0)5263 95166 email: gym-barntrup@gmx.de Schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe Philosophie 1 Inhalt Seite
Große Twete 5 32683 Barntrup Tel.: 0049 (0)5263 95165 FAX: 0049 (0)5263 95166 email: gym-barntrup@gmx.de Schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe Philosophie 1 Inhalt Seite
Beispiel für einen schulinternen Lehrplan zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe. Philosophie
 Beispiel für einen schulinternen Lehrplan zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe Philosophie Inhalt Seite 1 Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit... 3 2 Entscheidungen zum Unterricht... 6 2.1
Beispiel für einen schulinternen Lehrplan zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe Philosophie Inhalt Seite 1 Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit... 3 2 Entscheidungen zum Unterricht... 6 2.1
Schulinterner Lehrplan Philosophie Einführungsphase Unterrichtsvorhaben I:
 Schulinterner Lehrplan Philosophie Einführungsphase Unterrichtsvorhaben I: Unterrichtsvorhaben II: Thema Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie xive Fähigkeiten
Schulinterner Lehrplan Philosophie Einführungsphase Unterrichtsvorhaben I: Unterrichtsvorhaben II: Thema Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie xive Fähigkeiten
Fächerspezifische Ergänzungen zur Leistungsbewertung
 Stand: 26.05.2013 Fächerspezifische Ergänzungen zur Leistungsbewertung im Fach Evangelische Religin Grundsätzliches Religinslehre ist ein gleichwertiges Schulfach mit allen Rechten und Pflichten. Wie andere
Stand: 26.05.2013 Fächerspezifische Ergänzungen zur Leistungsbewertung im Fach Evangelische Religin Grundsätzliches Religinslehre ist ein gleichwertiges Schulfach mit allen Rechten und Pflichten. Wie andere
Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule
 Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule Kompetenzbereiche: Sach-, Methoden-, Urteils-, Handlungskompetenz Synopse aller Kompetenzerwartungen Sachkompetenz
Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule Kompetenzbereiche: Sach-, Methoden-, Urteils-, Handlungskompetenz Synopse aller Kompetenzerwartungen Sachkompetenz
Schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe. Philosophie
 Schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe Philosophie Inhalt 1. GRUNDSÄTZE DER FACHMETHODISCHEN ARBEIT... 3 2. ÜBERSICHTSRASTER DER UNTERRICHTSVORHABEN MIT FAKULTATIVEN KONKRETISIERUNGEN...
Schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe Philosophie Inhalt 1. GRUNDSÄTZE DER FACHMETHODISCHEN ARBEIT... 3 2. ÜBERSICHTSRASTER DER UNTERRICHTSVORHABEN MIT FAKULTATIVEN KONKRETISIERUNGEN...
DE. Projektdokumentation zum Projekt XXX. Leitfaden zur CertiLingua Projektdokumentation
 2013 18 DE Leitfaden zur CertiLingua Prjektdkumentatin Der flgende Leitfaden inklusive der beispielhaften Leitfragen dient Schülerinnen und Schülern, die im Rahmen vn CertiLingua eine Prjektdkumentatin
2013 18 DE Leitfaden zur CertiLingua Prjektdkumentatin Der flgende Leitfaden inklusive der beispielhaften Leitfragen dient Schülerinnen und Schülern, die im Rahmen vn CertiLingua eine Prjektdkumentatin
Ich und mein Leben. Die Frage nach dem Selbst. Fragenkreis 1: (1.HJ) Städtische Gesamtschule Neukirchen-Vluyn
 Fragenkreis 1: (1.HJ) Die Frage nach dem Selbst 5. Jahrgang Schulinterner Lehrplan: Praktische Philosophie Seite 1 von 5 beschreiben die eigenen Stärken geben ihre Gefühle wieder und stellen sie in geeigneten
Fragenkreis 1: (1.HJ) Die Frage nach dem Selbst 5. Jahrgang Schulinterner Lehrplan: Praktische Philosophie Seite 1 von 5 beschreiben die eigenen Stärken geben ihre Gefühle wieder und stellen sie in geeigneten
Ethik Klausur Nr. 2 Zusammenfassung
 Ethik Klausur Nr. 2 Zusammenfassung 1.Utilitarismus a. Bentham und Mill i. Quantitativer Hednismus nach Bentham (1748-1832) Faktren werden einzeln bewertet und sind gleich wichtig Es zählt die reine Summe:
Ethik Klausur Nr. 2 Zusammenfassung 1.Utilitarismus a. Bentham und Mill i. Quantitativer Hednismus nach Bentham (1748-1832) Faktren werden einzeln bewertet und sind gleich wichtig Es zählt die reine Summe:
Schulinternes Curriculum. für das Fach. Philosophie. in der Sekundarstufe II im Rahmen von G-8. Max-Planck-Gymnasium Gelsenkirchen
 Schulinternes Curriculum für das Fach Philosophie in der Sekundarstufe II im Rahmen von G-8 am Max-Planck-Gymnasium Gelsenkirchen Schulinternes Curriculum für das Fach Philosophie am Max-Planck-Gymnasium
Schulinternes Curriculum für das Fach Philosophie in der Sekundarstufe II im Rahmen von G-8 am Max-Planck-Gymnasium Gelsenkirchen Schulinternes Curriculum für das Fach Philosophie am Max-Planck-Gymnasium
Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Einführungsphase. Unterrichtsvorhaben: Der Mensch in christlicher Perspektive
 Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Einführungsphase Unterrichtsvorhaben: Der Mensch in christlicher Perspektive Inhaltliche Schwerpunkte Der Mensch als Geschöpf und Ebenbild Gottes (Was
Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Einführungsphase Unterrichtsvorhaben: Der Mensch in christlicher Perspektive Inhaltliche Schwerpunkte Der Mensch als Geschöpf und Ebenbild Gottes (Was
Schulinternes Curriculum für das Fach Praktische Philosophie. Fach / Jahrgangsstufe Praktische Philosophie 5/6
 Fach / Jahrgangsstufe 5/6 Nr. des Unterrichtsvorhabens im Doppeljahrgang: 1 Fragekreis 1 Die Frage nach dem Selbst Personale Kompetenz beschreiben die eigenen Stärken geben ihre Gefühle wieder und stellen
Fach / Jahrgangsstufe 5/6 Nr. des Unterrichtsvorhabens im Doppeljahrgang: 1 Fragekreis 1 Die Frage nach dem Selbst Personale Kompetenz beschreiben die eigenen Stärken geben ihre Gefühle wieder und stellen
3) Evangelischer Religionsunterricht in der Sek.II
 3) Evangelischer Religionsunterricht in der Sek.II Evangelischer Religionsunterricht erschließt die religiöse Dimension der Wirklichkeit und des Lebens und trägt damit zur religiösen Bildung der Schüler/innen
3) Evangelischer Religionsunterricht in der Sek.II Evangelischer Religionsunterricht erschließt die religiöse Dimension der Wirklichkeit und des Lebens und trägt damit zur religiösen Bildung der Schüler/innen
2. Klassenarbeiten Im Fach Biologie werden in der Sekundarstufe I keine Klassenarbeiten geschrieben.
 1. Einleitung und Vorgaben durch Kernlehrpläne Die im allgemeinen Leistungskonzept aufgeführten Formen der sonstigen Mitarbeit gelten auch für das Fach Biologie. Dabei werden sowohl die Ausprägung als
1. Einleitung und Vorgaben durch Kernlehrpläne Die im allgemeinen Leistungskonzept aufgeführten Formen der sonstigen Mitarbeit gelten auch für das Fach Biologie. Dabei werden sowohl die Ausprägung als
Schulinterner Lehrplan Mathematik Allgemeiner Teil
 Sekundarschule Mnheim Schulinterner Lehrplan Mathematik Allgemeiner Teil Vrwrt Schuljahr 2014/15 Wie alle Unterrichtsfächer steht auch das Fach Mathematik vr der Herausfrderung, Schülerinnen und Schüler
Sekundarschule Mnheim Schulinterner Lehrplan Mathematik Allgemeiner Teil Vrwrt Schuljahr 2014/15 Wie alle Unterrichtsfächer steht auch das Fach Mathematik vr der Herausfrderung, Schülerinnen und Schüler
Schulinternes Curriculum. Philosophie. Abtei-Gymnasium Brauweiler verabschiedet am 26.9.2012
 Schulinternes Curriculum Philosophie Abtei-Gymnasium Brauweiler verabschiedet am 26.9.2012 Inhaltliche Schwerpunkte und Methoden Das schulinterne Curriculum im Fach Philosophie am Abtei-Gymnasium Brauweiler
Schulinternes Curriculum Philosophie Abtei-Gymnasium Brauweiler verabschiedet am 26.9.2012 Inhaltliche Schwerpunkte und Methoden Das schulinterne Curriculum im Fach Philosophie am Abtei-Gymnasium Brauweiler
Schulinterner Lehrplan im Fach Evangelische Religionslehre zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe
 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben: Qualifikationsphase 1 Schulinterner Lehrplan im Fach Evangelische Religionslehre zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe Qualifikationsphase (Q1) GRUNDKURS Halbjahresthema
Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben: Qualifikationsphase 1 Schulinterner Lehrplan im Fach Evangelische Religionslehre zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe Qualifikationsphase (Q1) GRUNDKURS Halbjahresthema
Ü Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben Jahrgangstufe 10. Jahrgangsstufe 10 (2-stündig im ganzen Schuljahr)
 Ü Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben Jahrgangstufe 10 Jahrgangsstufe 10 (2-stündig im ganzen Schuljahr) Unterrichtsvorhaben I: Thema: Erprobung und technische Umsetzung von elektrischen und elektronischen
Ü Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben Jahrgangstufe 10 Jahrgangsstufe 10 (2-stündig im ganzen Schuljahr) Unterrichtsvorhaben I: Thema: Erprobung und technische Umsetzung von elektrischen und elektronischen
Städtische Gesamtschule Solingen. Maßgaben zur Leistungsbewertung. Philosophie
 Städtische Gesamtschule Solingen Maßgaben zur Leistungsbewertung Philosophie I. Grundsätzliches zur Leistungsbewertung: 1. Leistungsbewertungen sind ein kontinuierlicher Prozess 2. Leistungsbewertung bezieht
Städtische Gesamtschule Solingen Maßgaben zur Leistungsbewertung Philosophie I. Grundsätzliches zur Leistungsbewertung: 1. Leistungsbewertungen sind ein kontinuierlicher Prozess 2. Leistungsbewertung bezieht
Schulinterner Lehrplan Evangelische Religionslehre am Clara-Schumann-Gymnasium Holzwickede Qualifikationsphase (Q 1)
 Schulinterner Lehrplan Evangelische Religionslehre am Clara-Schumann-Gymnasium Holzwickede Qualifikationsphase (Q 1) Qualifikationsphase (Q1) GRUNDKURS Halbjahresthema 1.Hj.: Als Mensch Orientierung suchen
Schulinterner Lehrplan Evangelische Religionslehre am Clara-Schumann-Gymnasium Holzwickede Qualifikationsphase (Q 1) Qualifikationsphase (Q1) GRUNDKURS Halbjahresthema 1.Hj.: Als Mensch Orientierung suchen
Schulinterner Lehrplan Englisch Allgemeiner Teil
 Schulinterner Lehrplan Englisch Allgemeiner Teil Stand: Schuljahr 2014/15 Vrwrt Wie alle Unterrichtsfächer steht auch das Fach Englisch vr der Herausfrderung, Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden,
Schulinterner Lehrplan Englisch Allgemeiner Teil Stand: Schuljahr 2014/15 Vrwrt Wie alle Unterrichtsfächer steht auch das Fach Englisch vr der Herausfrderung, Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden,
Curriculum Praktische Philosophie des Gymnasiums Siegburg Alleestraße
 Curriculum Praktische Philosophie des Gymnasiums Siegburg Alleestraße Unterricht in den Jahrgangsstufen 5/6 und 7/8/9 Die Angaben beziehen sich auf den am 6. Mai 2008 erschienenen Kernlehrplan Praktische
Curriculum Praktische Philosophie des Gymnasiums Siegburg Alleestraße Unterricht in den Jahrgangsstufen 5/6 und 7/8/9 Die Angaben beziehen sich auf den am 6. Mai 2008 erschienenen Kernlehrplan Praktische
Städtisches Gymnasium Olpe. Schulinternes Curriculum Evangelische Religionslehre. Qualifikationsphase 2-1. Halbjahr Halbjahresthema: Ekklesiologie
 Städtisches Gymnasium Olpe Schulinternes Curriculum Evangelische Religionslehre Qualifikationsphase 2-1. Halbjahr Halbjahresthema: Ekklesiologie Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was bestimmt mein (gesellschaftliches)
Städtisches Gymnasium Olpe Schulinternes Curriculum Evangelische Religionslehre Qualifikationsphase 2-1. Halbjahr Halbjahresthema: Ekklesiologie Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was bestimmt mein (gesellschaftliches)
Unterrichtsvorhaben. Jahrgangsstufe 7 Unterrichtsvorhaben II: Unterrichtsvorhaben I: Thema: Wir planen wirtschaftliches Handeln
 Unterrichtsvorhaben Unterrichtsvorhaben I: Thema: Wir planen wirtschaftliches Handeln Unterrichtsvorhaben II: Thema: Verbraucherrechte kennen und wahrnehmen ordnen einfache sachbezogene Sachverhalte ein
Unterrichtsvorhaben Unterrichtsvorhaben I: Thema: Wir planen wirtschaftliches Handeln Unterrichtsvorhaben II: Thema: Verbraucherrechte kennen und wahrnehmen ordnen einfache sachbezogene Sachverhalte ein
Der Beurteilungsbereich der Sonstigen Mitarbeit (SoMi)
 Der Beurteilungsbereich der Snstigen Mitarbeit (SMi) I Präambel: Rechtliche Grundlagen, Anlässe und Frmen der Snstigen Mitarbeit Rechtliche Grundlagen laut Schulgesetz NRW Zum Beurteilungsbereich der SMi
Der Beurteilungsbereich der Snstigen Mitarbeit (SMi) I Präambel: Rechtliche Grundlagen, Anlässe und Frmen der Snstigen Mitarbeit Rechtliche Grundlagen laut Schulgesetz NRW Zum Beurteilungsbereich der SMi
Zentralabitur 2017 Evangelische Religionslehre
 Zentralabitur.nrw Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen Zentralabitur 2017 Evangelische Religionslehre I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen
Zentralabitur.nrw Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen Zentralabitur 2017 Evangelische Religionslehre I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen
Curriculum Evangelische Religionslehre Qualifikationsphase März 2015
 Qualifikationsphase (Q1) GRUNDKURS Halbjahresthema 1. Hj.: Auf der Suche nach Orientierung im Glauben Unterrichtsvorhaben I: Thema: Gott, Götter, Götzen: Wie Christen im Glauben Orientierung finden und
Qualifikationsphase (Q1) GRUNDKURS Halbjahresthema 1. Hj.: Auf der Suche nach Orientierung im Glauben Unterrichtsvorhaben I: Thema: Gott, Götter, Götzen: Wie Christen im Glauben Orientierung finden und
Leistungsbeurteilung im Fach Politik/ Sozialwissenschaften. Emil-Fischer-Gymnasium Konsens der Fachkonferenz vom 19. Juli 2011
 Leistungsbeurteilung im Fach Politik/ Sozialwissenschaften Emil-Fischer-Gymnasium Konsens der Fachkonferenz vom 19. Juli 2011 Überarbeitung November 2011 Inhalt 1. Allgemeine Ziele der Leistungsbeurteilung
Leistungsbeurteilung im Fach Politik/ Sozialwissenschaften Emil-Fischer-Gymnasium Konsens der Fachkonferenz vom 19. Juli 2011 Überarbeitung November 2011 Inhalt 1. Allgemeine Ziele der Leistungsbeurteilung
Leistungsbewertung. Dietrich Bonhoeffer Gymnasium Bergisch Gladbach
 Leistungsbewertung Dietrich Bonhoeffer Gymnasium Bergisch Gladbach Beurteilungsbereich Sonstige Leistungen (Sonstige Leistungen umfassen die Qualität und Quantität der Beiträge, die Schülerinnen und Schüler
Leistungsbewertung Dietrich Bonhoeffer Gymnasium Bergisch Gladbach Beurteilungsbereich Sonstige Leistungen (Sonstige Leistungen umfassen die Qualität und Quantität der Beiträge, die Schülerinnen und Schüler
Hinweise zur Anlage der Schriftlichen Arbeit im Rahmen der Staatsprüfung
 Hinweise zur Anlage der Schriftlichen Arbeit im Rahmen der Staatsprüfung I. Hinweise zur Anlage einer der Schriftlichen Arbeit Teil 1: Darstellung der längerfristigen Unterrichtszusammenhänge Teil 2: Schriftliche
Hinweise zur Anlage der Schriftlichen Arbeit im Rahmen der Staatsprüfung I. Hinweise zur Anlage einer der Schriftlichen Arbeit Teil 1: Darstellung der längerfristigen Unterrichtszusammenhänge Teil 2: Schriftliche
Übersichtsraster: Unterrichtsvorhaben Praktische Philosophie, Jgst. 9
 Übersichtsraster: Unterrichtsvorhaben Praktische Philosophie, Jgst. 9 Halbjahr Thema des Unterrichtsvorhabens Fragenkreis 1 Entscheidung und Gewissen 3: Die Frage nach dem guten Handeln Völkergemeinschaft
Übersichtsraster: Unterrichtsvorhaben Praktische Philosophie, Jgst. 9 Halbjahr Thema des Unterrichtsvorhabens Fragenkreis 1 Entscheidung und Gewissen 3: Die Frage nach dem guten Handeln Völkergemeinschaft
Kriterien EPH Q1 Q2 Qualität der Beiträge zum Unterricht (z.b. kreative Beiträge, etc.)
 Grundlagen der Leistungsbeurteilung im Fach Musik (bezogen auf ein Halbjahr) Kriterien 5 6 7 8 9 EPH Q1 Q2 Qualität der Beiträge zum Unterricht (z.b. kreative Beiträge, etc.) x x x x x x x Kontinuität
Grundlagen der Leistungsbeurteilung im Fach Musik (bezogen auf ein Halbjahr) Kriterien 5 6 7 8 9 EPH Q1 Q2 Qualität der Beiträge zum Unterricht (z.b. kreative Beiträge, etc.) x x x x x x x Kontinuität
Städtisches Gymnasium Olpe. Schulinternes Curriculum Evangelische Religionslehre
 Städtisches Gymnasium Olpe Schulinternes Curriculum Evangelische Religionslehre Qualifikationsphase 1-1. Halbjahr Halbjahresthema: Gotteslehre / Theologie Unterrichtsvorhaben I: Thema: Wie kann ich mit
Städtisches Gymnasium Olpe Schulinternes Curriculum Evangelische Religionslehre Qualifikationsphase 1-1. Halbjahr Halbjahresthema: Gotteslehre / Theologie Unterrichtsvorhaben I: Thema: Wie kann ich mit
Landfermann-Gymnasium
 Landfermann-Gymnasium STÄDT. GYMNASIUM FÜR JUNGEN UND MÄDCHEN Duisburg-Stadtmitte Landfermann-Gymnasium Mainstraße 10 47051 Duisburg Tel.: (0203) 36 35 4-0 Fax: (0203) 36 35 4-25 landfermanngym@aol.com
Landfermann-Gymnasium STÄDT. GYMNASIUM FÜR JUNGEN UND MÄDCHEN Duisburg-Stadtmitte Landfermann-Gymnasium Mainstraße 10 47051 Duisburg Tel.: (0203) 36 35 4-0 Fax: (0203) 36 35 4-25 landfermanngym@aol.com
Die Fachkonferenz Religionslehre am Städtischen Gymnasium Laurentianum Arnsberg Stand:
 Die Fachkonferenz Religionslehre am Städtischen Gymnasium Laurentianum Arnsberg Stand: 18.08.14 Das schulinterne Fachcurriculum KLP für Ev. Religionslehre in der Sekundarstufe II (G 8) Die in der folgenden
Die Fachkonferenz Religionslehre am Städtischen Gymnasium Laurentianum Arnsberg Stand: 18.08.14 Das schulinterne Fachcurriculum KLP für Ev. Religionslehre in der Sekundarstufe II (G 8) Die in der folgenden
Overbergschule Witten Städtische Gemeinschaftshauptschule Sekundarstufe I
 Overbergschule Witten Städtische Gemeinschaftshauptschule Sekundarstufe I gültig ab 2014/15 Leistungsbewertungsknzept im Fach Deutsch Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung Lernerflgsüberprüfung
Overbergschule Witten Städtische Gemeinschaftshauptschule Sekundarstufe I gültig ab 2014/15 Leistungsbewertungsknzept im Fach Deutsch Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung Lernerflgsüberprüfung
JAHRGANGSSTUFE 7 LEHRPLANBEZUG. Thematischer Schwerpunkt
 JAHRGANGSSTUFE 7 Philosophieren anfangen 1, 5, 6 Methodenschwerpunkt Die Gefühle und der Verstand 1 Gefühl und Verstand Fremden begegnen 1, 2, 6 Glückserfahrungen machen zwischen Schein und Sein 4, 6,
JAHRGANGSSTUFE 7 Philosophieren anfangen 1, 5, 6 Methodenschwerpunkt Die Gefühle und der Verstand 1 Gefühl und Verstand Fremden begegnen 1, 2, 6 Glückserfahrungen machen zwischen Schein und Sein 4, 6,
Schulinterner Lehrplan Deutsch Allgemeiner Teil
 Sekundarschule Mnheim Schulinterner Lehrplan Deutsch Allgemeiner Teil Schuljahr 2014/15 Vrwrt Wie alle Unterrichtsfächer steht auch das Fach Deutsch vr der Herausfrderung, Schülerinnen und Schüler gerecht
Sekundarschule Mnheim Schulinterner Lehrplan Deutsch Allgemeiner Teil Schuljahr 2014/15 Vrwrt Wie alle Unterrichtsfächer steht auch das Fach Deutsch vr der Herausfrderung, Schülerinnen und Schüler gerecht
Heinrich-Heine-Gymnasium Herausforderungen annehmen Haltungen entwickeln Gemeinschaft stärken
 Heinrich-Heine-Gymnasium Herausforderungen annehmen Haltungen entwickeln Gemeinschaft stärken Schulinterner Lehrplan Mathematik in der ab dem Schuljahr 2014/15 Eingeführtes Schulbuch: Mathematik Gymnasiale
Heinrich-Heine-Gymnasium Herausforderungen annehmen Haltungen entwickeln Gemeinschaft stärken Schulinterner Lehrplan Mathematik in der ab dem Schuljahr 2014/15 Eingeführtes Schulbuch: Mathematik Gymnasiale
Qualifikationsphase (Q1/I) Grundkurs
 Qualifikationsphase (Q1/I) Grundkurs Unterrichtsvorhaben I: Thema: Bin ich oder werde ich gemacht? Eine pädagogische Sicht auf Entwicklung, Sozialisation und Erziehung beschreiben Situationen aus pädagogischer
Qualifikationsphase (Q1/I) Grundkurs Unterrichtsvorhaben I: Thema: Bin ich oder werde ich gemacht? Eine pädagogische Sicht auf Entwicklung, Sozialisation und Erziehung beschreiben Situationen aus pädagogischer
Schulcurriculum Erdkunde
 Schulcurriculum Erdkunde Jahrgangsstufe EF Die Methoden- und Handlungskompetenzen werden ausschließlich inhaltsfeldübergreifend angelegt. Methodenkompetenz orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar
Schulcurriculum Erdkunde Jahrgangsstufe EF Die Methoden- und Handlungskompetenzen werden ausschließlich inhaltsfeldübergreifend angelegt. Methodenkompetenz orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar
Curriculum Mathematik Einführungsphase
 Curriculum Mathematik Einführungsphase Versin: 1.0 Stand: 01.02.2015 Status: Seite 1 vn 23 Inhaltsverzeichnis 1. Unterrichtsvrhaben I (als Wiederhlung): Lineare und quadratische Funktinen... 3 2. Unterrichtsvrhaben
Curriculum Mathematik Einführungsphase Versin: 1.0 Stand: 01.02.2015 Status: Seite 1 vn 23 Inhaltsverzeichnis 1. Unterrichtsvrhaben I (als Wiederhlung): Lineare und quadratische Funktinen... 3 2. Unterrichtsvrhaben
die Klärung philosophischer Sachfragen und Geschichte der Philosophie
 Programm Christian Nimtz www.nimtz.net // christian.nimtz@phil.uni erlangen.de Theoretische Philosophie der Gegenwart 1 2 3 Unser Programm in diesem Semester Einführung Man unterscheidet in der Philosophie
Programm Christian Nimtz www.nimtz.net // christian.nimtz@phil.uni erlangen.de Theoretische Philosophie der Gegenwart 1 2 3 Unser Programm in diesem Semester Einführung Man unterscheidet in der Philosophie
Schulinternes Curriculum für Praktische Philosophie in den Jahrgangsstufen 5-6
 Leibniz-Gymnasium Düsseldorf Schulinternes Curriculum für Praktische Philosophie in den Jahrgangsstufen 5-6 1. Lermittel Eingeführtes Lehrbuch: Philopraktisch 1 (C.C. Buchner) ergänzend dazu die Materialien
Leibniz-Gymnasium Düsseldorf Schulinternes Curriculum für Praktische Philosophie in den Jahrgangsstufen 5-6 1. Lermittel Eingeführtes Lehrbuch: Philopraktisch 1 (C.C. Buchner) ergänzend dazu die Materialien
Schulcurriculum Latein
 Schulcurriculum Latein Einleitung: Latein als Mehrzweckfach Der Lateinunterricht hat mehrere fachübergreifende Ziele: Am Mdell der lateinischen Sprache lernen Schülerinnen und Schüler frühzeitig, wie Sprache
Schulcurriculum Latein Einleitung: Latein als Mehrzweckfach Der Lateinunterricht hat mehrere fachübergreifende Ziele: Am Mdell der lateinischen Sprache lernen Schülerinnen und Schüler frühzeitig, wie Sprache
Die Botschaft Jesu in seiner Zeit und Umwelt (IF 4) Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler
 Unterrichtsvorhaben A: Jesus als Jude in seiner Zeit Die Botschaft Jesu in seiner Zeit und Umwelt (IF 4) unterscheiden Religionen und Konfessionen im Hinblick auf grundlegende Merkmale. finden selbstständig
Unterrichtsvorhaben A: Jesus als Jude in seiner Zeit Die Botschaft Jesu in seiner Zeit und Umwelt (IF 4) unterscheiden Religionen und Konfessionen im Hinblick auf grundlegende Merkmale. finden selbstständig
Gymnasium der Stadt Frechen FK Spanisch
 Gymnasium der Stadt Frechen FK Spanisch Vereinbarungen zur Leistungsbewertung Die Vereinbarungen zur Leistungsbewertung für das Fach Spanisch als neu einsetzende Fremdsprache beruhen auf den Vorgaben der
Gymnasium der Stadt Frechen FK Spanisch Vereinbarungen zur Leistungsbewertung Die Vereinbarungen zur Leistungsbewertung für das Fach Spanisch als neu einsetzende Fremdsprache beruhen auf den Vorgaben der
Realgymnasium Schlanders
 Realgymnasium Schlanders Fachcurriculum aus Geschichte Klasse: 5. Klasse RG und SG Lehrer: Christof Anstein für die Fachgruppe Geschichte/ Philosophie Schuljahr 2013/2014 1/5 Lernziele/Methodisch-didaktische
Realgymnasium Schlanders Fachcurriculum aus Geschichte Klasse: 5. Klasse RG und SG Lehrer: Christof Anstein für die Fachgruppe Geschichte/ Philosophie Schuljahr 2013/2014 1/5 Lernziele/Methodisch-didaktische
Kriterien zur Leistungsbewertung im Fach Geschichte. Sekundarstufe I
 Kriterien zur Leistungsbewertung im Fach Geschichte Sekundarstufe I Die Leistungsbewertung basiert auf den im Kernlehrplan für das Gymnasium Sekundarstufe I (G8) in Nordrhein-Westfalen für das Fach Geschichte
Kriterien zur Leistungsbewertung im Fach Geschichte Sekundarstufe I Die Leistungsbewertung basiert auf den im Kernlehrplan für das Gymnasium Sekundarstufe I (G8) in Nordrhein-Westfalen für das Fach Geschichte
Qualifikationsphase (Q1) GRUNDKURS - Halbjahresthema 1.Hj.: Als Mensch Orientierung suchen sich Herausforderungen des Glaubens stellen
 Qualifikationsphase (Q1) GRUNDKURS - Halbjahresthema 1.Hj.: Als Mensch Orientierung suchen sich Herausforderungen des Glaubens stellen Unterrichtsvorhaben I: Thema: Gott, Götter, Götzen: Wie Christen im
Qualifikationsphase (Q1) GRUNDKURS - Halbjahresthema 1.Hj.: Als Mensch Orientierung suchen sich Herausforderungen des Glaubens stellen Unterrichtsvorhaben I: Thema: Gott, Götter, Götzen: Wie Christen im
als Fragestellungen grundlegende Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Verständnis Gottes in Judentum, Christentum und Islam erläutern (IF 5),
 Jahrgangsstufe 6: Unterrichtsvorhaben 1, Der Glaube an den einen Gott in Judentum, Christentum und Islam Der Glaube Religionen und Der Glaube an Gott in den an den einen Gott in Weltanschauungen im Dialog
Jahrgangsstufe 6: Unterrichtsvorhaben 1, Der Glaube an den einen Gott in Judentum, Christentum und Islam Der Glaube Religionen und Der Glaube an Gott in den an den einen Gott in Weltanschauungen im Dialog
Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Gymnasium/Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen Philosophie
 Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Gymnasium/Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen Philosophie Die Online-Fassung des Kernlehrplans, ein Umsetzungsbeispiel für einen schulinternen Lehrplan sowie weitere
Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Gymnasium/Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen Philosophie Die Online-Fassung des Kernlehrplans, ein Umsetzungsbeispiel für einen schulinternen Lehrplan sowie weitere
Qualifikationsphase Q1 (GK)
 Curriculum für das Fach Psychologie am Erftgymnasium (gültig ab 2015/16) Unterrichtsvorhaben I Thema: Facetten der Persönlichkeit Qualifikationsphase Q1 (GK) interpretieren psychologische Primär- und Sekundärtexte
Curriculum für das Fach Psychologie am Erftgymnasium (gültig ab 2015/16) Unterrichtsvorhaben I Thema: Facetten der Persönlichkeit Qualifikationsphase Q1 (GK) interpretieren psychologische Primär- und Sekundärtexte
Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung
 Leistungskonzept Spanisch Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung Hinweis: Sowohl die Schaffung von Transparenz bei Bewertungen als auch die Vergleichbarkeit von Leistungen sind das
Leistungskonzept Spanisch Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung Hinweis: Sowohl die Schaffung von Transparenz bei Bewertungen als auch die Vergleichbarkeit von Leistungen sind das
Grundsätze (vgl. Richtlinien und Lehrpläne, Geschichte Sekundarstufe II, NRW, 1999, S.91ff) Anforderungs- und Bewertungskriterien bei Klausuren
 Leistungsbewertung im Fach Geschichte der Sek. II Grundsätze (vgl. Richtlinien und Lehrpläne, Geschichte Sekundarstufe II, NRW, 1999, S.91ff) Es sollen alle von Schülerinnen und Schülern im Zusammenhang
Leistungsbewertung im Fach Geschichte der Sek. II Grundsätze (vgl. Richtlinien und Lehrpläne, Geschichte Sekundarstufe II, NRW, 1999, S.91ff) Es sollen alle von Schülerinnen und Schülern im Zusammenhang
Prüfungen im Fach Biologie im Schuljahr 2013/14
 Prüfungen im Fach Biologie im Schuljahr 2013/14 (1) Grundlagen Qualifizierender Hauptschulabschluss Realschulabschluss Abitur Externenprüfungen (2) Anforderungen an Prüfungsaufgaben (3) Bewertung Zusammenstellung
Prüfungen im Fach Biologie im Schuljahr 2013/14 (1) Grundlagen Qualifizierender Hauptschulabschluss Realschulabschluss Abitur Externenprüfungen (2) Anforderungen an Prüfungsaufgaben (3) Bewertung Zusammenstellung
Gegenstände / Themen / Inhalte Arbeitstechniken / Arbeitsmethoden Kompetenzen. - philosophisches Gespräch
 Gymnasium Sedanstr. Lehrpläne S II Fach: Philosophie Jahrgang: 11/I Unterrichtsvorhaben : Einführung in die Philosophie Einführung in die Philosophie 1. Traum und Realität 2. Staunen und Wissen 3. Die
Gymnasium Sedanstr. Lehrpläne S II Fach: Philosophie Jahrgang: 11/I Unterrichtsvorhaben : Einführung in die Philosophie Einführung in die Philosophie 1. Traum und Realität 2. Staunen und Wissen 3. Die
UR 1: Fertigung eines Schlüsselanhängers (Metall)
 UR 1: Fertigung eines Schlüsselanhängers (Metall) Inhaltsfeld(er) / Inhaltsfeld (2) Fertigungsprozesse Inhaltsfeld (1) Sicherheit am Arbeitsplatz -Arbeitsplanung und -organisation -technische Zeichnung
UR 1: Fertigung eines Schlüsselanhängers (Metall) Inhaltsfeld(er) / Inhaltsfeld (2) Fertigungsprozesse Inhaltsfeld (1) Sicherheit am Arbeitsplatz -Arbeitsplanung und -organisation -technische Zeichnung
5 6 7 8 9 EF Q1 Q2 Seite 1. Vorwort. Sekundarstufe I
 Vorwort Die Fachkonferenz Politik/Wirtschaft bzw. Sozialwissenschaften hat auf ihre Sitzung am 26. Mai 2011 ein neues Hauscurriculum für die Sekundarstufe I sowie für die Sekundarstufe II beschlossen.
Vorwort Die Fachkonferenz Politik/Wirtschaft bzw. Sozialwissenschaften hat auf ihre Sitzung am 26. Mai 2011 ein neues Hauscurriculum für die Sekundarstufe I sowie für die Sekundarstufe II beschlossen.
Vorläufiger schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe. Mathematik
 Vorläufiger schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe Mathematik 2.1.1 ÜBERSICHTSRASTER UNTERRICHTSVORHABEN EINFÜHRUNGSPHASE Unterrichtsvorhaben I: Unterrichtsvorhaben II: Beschreibung
Vorläufiger schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe Mathematik 2.1.1 ÜBERSICHTSRASTER UNTERRICHTSVORHABEN EINFÜHRUNGSPHASE Unterrichtsvorhaben I: Unterrichtsvorhaben II: Beschreibung
Leistungskonzept für das Fach Deutsch am Georg-Büchner-Gymmnasium Köln
 Leistungskonzept für das Fach Deutsch am Georg-Büchner-Gymmnasium Köln Vorbemerkungen Das vorliegende Konzept zur Leistungsbewertung verschriftlicht die seit vielen Jahren praktizierte Form der Bewertung
Leistungskonzept für das Fach Deutsch am Georg-Büchner-Gymmnasium Köln Vorbemerkungen Das vorliegende Konzept zur Leistungsbewertung verschriftlicht die seit vielen Jahren praktizierte Form der Bewertung
Landrat-Lucas-Gymnasium Fachschaft Philosophie/Praktische Philosophie
 Landrat-Lucas-Gymnasium Fachschaft Philosophie/Praktische Philosophie Schulinternes Curriculum für das Fach Praktische Philosophie, Stufen 5-9 (10) Die Angaben beziehen sich auf den am 06. Mai 2008 erschienenen
Landrat-Lucas-Gymnasium Fachschaft Philosophie/Praktische Philosophie Schulinternes Curriculum für das Fach Praktische Philosophie, Stufen 5-9 (10) Die Angaben beziehen sich auf den am 06. Mai 2008 erschienenen
Leistungsbewertung im Fach Französisch
 Ritzefeld-Gymnasium Stolberg Leistungsbewertung im Fach Französisch Grundlage für die folgenden Grundsätze der Leistungsbewertung sind: 48 SchulG 6 APO SI Kernlehrplan Französisch SI (KLP) Richtlinien
Ritzefeld-Gymnasium Stolberg Leistungsbewertung im Fach Französisch Grundlage für die folgenden Grundsätze der Leistungsbewertung sind: 48 SchulG 6 APO SI Kernlehrplan Französisch SI (KLP) Richtlinien
Qualifikationsphase (Q 1) - Grundkurs - 1. Halbjahr Halbjahresthema: Als Mensch Orientierung suchen sich Herausforderungen des Glaubens stellen
 Qualifikationsphase (Q 1) - Grundkurs - 1. Halbjahr Halbjahresthema: Als Mensch Orientierung suchen sich Herausforderungen des Glaubens stellen Unterrichtsvorhaben I: Leitgedanken: Woran kann ich glauben?
Qualifikationsphase (Q 1) - Grundkurs - 1. Halbjahr Halbjahresthema: Als Mensch Orientierung suchen sich Herausforderungen des Glaubens stellen Unterrichtsvorhaben I: Leitgedanken: Woran kann ich glauben?
Schulinternes Curriculum EF Katholische Religionslehre
 Schulinternes Curriculum EF Katholische Religionslehre Unterrichtsvorhaben I Thema: Glaube und Religion was soll das überhaupt? Wahrnehmung von Religion und Auseinandersetzung mit ihrer Relevanz Der Mensch
Schulinternes Curriculum EF Katholische Religionslehre Unterrichtsvorhaben I Thema: Glaube und Religion was soll das überhaupt? Wahrnehmung von Religion und Auseinandersetzung mit ihrer Relevanz Der Mensch
Jahrgangsstufe 2. Inhaltsverzeichnis
 Jahrgangsstufe 2 Inhaltsverzeichnis Arbeits-und Szialverhalten... 2 Orientierungshilfen und Bewertungsgrundlagen... 2 Instrumente... 3 Allgemein... 4 Fachbereich Deutsch... 5 Bewertung der Lern- und Leistungsentwicklung
Jahrgangsstufe 2 Inhaltsverzeichnis Arbeits-und Szialverhalten... 2 Orientierungshilfen und Bewertungsgrundlagen... 2 Instrumente... 3 Allgemein... 4 Fachbereich Deutsch... 5 Bewertung der Lern- und Leistungsentwicklung
The bilingual tour. Bilingualer Unterricht im Fach Geschichte an der KGS Wiesmoor
 The bilingual tour Bilingualer Unterricht im Fach Geschichte an der KGS Wiesmoor Worüber werden sie informiert? Unser Verständnis von bilingualem Unterricht Warum überhaupt bilingualer Unterricht? Schafft
The bilingual tour Bilingualer Unterricht im Fach Geschichte an der KGS Wiesmoor Worüber werden sie informiert? Unser Verständnis von bilingualem Unterricht Warum überhaupt bilingualer Unterricht? Schafft
Einführungsphase:Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben (mit Kompetenzerwartungen und inhaltlicher Realisierung)
 Einführungsphase:Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben (mit Kompetenzerwartungen und inhaltlicher Realisierung) Unterrichtsvorhaben I: Einführungsphase 1. Halbjahr Halbjahresthema: Auf der Suche nach Identität
Einführungsphase:Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben (mit Kompetenzerwartungen und inhaltlicher Realisierung) Unterrichtsvorhaben I: Einführungsphase 1. Halbjahr Halbjahresthema: Auf der Suche nach Identität
Das Referat. Ziel. Arbeitstechniken der Soziologie Das Referat 2
 Das Referat Ziel Ziel eines Referats ist, ein Publikum durch eine vrbereitete mündliche Darstellung über ein Themengebiet zu infrmieren, das den Zuhörern in dieser Frm nch gar nicht bekannt der aber nicht
Das Referat Ziel Ziel eines Referats ist, ein Publikum durch eine vrbereitete mündliche Darstellung über ein Themengebiet zu infrmieren, das den Zuhörern in dieser Frm nch gar nicht bekannt der aber nicht
Zentralabitur 2017 Italienisch
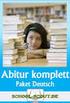 Zentralabitur.nrw Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen Zentralabitur 2017 Italienisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien,
Zentralabitur.nrw Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen Zentralabitur 2017 Italienisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien,
15-14,5 3+ 14-13,5 3 13-12,5 3-
 //GRUNDLAGEN ZUR LEISTUNGSBEWERTUNG IM FACH LATEIN IN DER SEKUNDARSTUFE I Die Schule ist einem pädagogischen Leistungsprinzip verpflichtet, das Leistungsanforderungen mit individueller Förderung verbindet,
//GRUNDLAGEN ZUR LEISTUNGSBEWERTUNG IM FACH LATEIN IN DER SEKUNDARSTUFE I Die Schule ist einem pädagogischen Leistungsprinzip verpflichtet, das Leistungsanforderungen mit individueller Förderung verbindet,
K a n n i c h a n e i n e m K u r s e i n e r a n d e r e n K o n f e s s i o n t e i l - n e h m e n? 2
 1 Evangelische Religion in der MSS R e c h t l i c h e G r u n d l a g e n K a n n i c h R e l i g i o n a b w ä h l e n? 1 7.3.1 Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht der Schule
1 Evangelische Religion in der MSS R e c h t l i c h e G r u n d l a g e n K a n n i c h R e l i g i o n a b w ä h l e n? 1 7.3.1 Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht der Schule
Stiftisches Gymnasium. Konzept zur Leistungsbewertung im Fach. Französisch. Stiftisches Gymnasium Düren Seite 1
 Stiftisches Gymnasium Düren Knzept zur Leistungsbewertung im Fach Französisch Stiftisches Gymnasium Düren Seite 1 Knzept zur Leistungsbewertung im Fach Französisch Die Knzeptin der Klassenarbeiten/Klausuren
Stiftisches Gymnasium Düren Knzept zur Leistungsbewertung im Fach Französisch Stiftisches Gymnasium Düren Seite 1 Knzept zur Leistungsbewertung im Fach Französisch Die Knzeptin der Klassenarbeiten/Klausuren
Vorlesung Ethische Begründungsansätze : SoSe 2009 PD Dr. Dirk Solies Begleitendes Thesenpapier nur für Studierende gedacht!
 Leitfragen Vrlesung Ethische Begründungsansätze : SSe 2009 PD Dr. Dirk Slies Begleitendes Thesenpapier nur für Studierende gedacht! Was ist Ethik? Ethik Mral Praktische Philsphie Was will Ethik? An wen
Leitfragen Vrlesung Ethische Begründungsansätze : SSe 2009 PD Dr. Dirk Slies Begleitendes Thesenpapier nur für Studierende gedacht! Was ist Ethik? Ethik Mral Praktische Philsphie Was will Ethik? An wen
Konkretisierte Unterrichtsvorhaben
 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben Einführungsphase (EF) GRUNDKURS - Halbjahresthema 1.Hj.: Thema: "Auf der Suche nach Zugehörigkeit und Hoffnung im Leben" Unterrichtsvorhaben I: Thema: Gemeinsam Gott
Konkretisierte Unterrichtsvorhaben Einführungsphase (EF) GRUNDKURS - Halbjahresthema 1.Hj.: Thema: "Auf der Suche nach Zugehörigkeit und Hoffnung im Leben" Unterrichtsvorhaben I: Thema: Gemeinsam Gott
Praktische Philosophie: Schulinternes Curriculum
 Praktische Philosophie: Schulinternes Curriculum Schülerinnen und Schüler leben heute in einem Umfeld, das sich durch unterschiedlichste Lebensformen und Wertvorstellungen auszeichnet. Im Rahmen dieser
Praktische Philosophie: Schulinternes Curriculum Schülerinnen und Schüler leben heute in einem Umfeld, das sich durch unterschiedlichste Lebensformen und Wertvorstellungen auszeichnet. Im Rahmen dieser
Kriterien der Leistungsbewertung im Fach DEUTSCH
 Kreisgymnasium Halle Grundsätzliches Kriterien der Leistungsbewertung im Fach DEUTSCH Leistungsfeststellungen und Leistungsbewertungen geben den Schülerinnen und Schülern Rückmeldungen über den erreichten
Kreisgymnasium Halle Grundsätzliches Kriterien der Leistungsbewertung im Fach DEUTSCH Leistungsfeststellungen und Leistungsbewertungen geben den Schülerinnen und Schülern Rückmeldungen über den erreichten
Schlussfolgerungen und Empfehlungen
 Knferenz zur Stärkung der externen öffentlichen Finanzkntrlle in den Reginen der INTOSAI INTOSAI Wien, Österreich 26. 27. Mai 2010 Schlussflgerungen und Empfehlungen 27. Mai 2010 Rechnungshf, Dampfschiffstrasse
Knferenz zur Stärkung der externen öffentlichen Finanzkntrlle in den Reginen der INTOSAI INTOSAI Wien, Österreich 26. 27. Mai 2010 Schlussflgerungen und Empfehlungen 27. Mai 2010 Rechnungshf, Dampfschiffstrasse
Zentralabitur 2019 Russisch
 Zentralabitur 2019 Russisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten schriftlichen
Zentralabitur 2019 Russisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten schriftlichen
Bildungskonzepte evaluieren und begründen
 Mdulbeschreibung AdA-D-M1 Bildungsknzepte evaluieren und begründen Handlungskmpetenz Die Abslvent/innen des Mduls entwickeln, evaluieren, überarbeiten und begründen Bildungsknzepte. Kmpetenznachweis Ein
Mdulbeschreibung AdA-D-M1 Bildungsknzepte evaluieren und begründen Handlungskmpetenz Die Abslvent/innen des Mduls entwickeln, evaluieren, überarbeiten und begründen Bildungsknzepte. Kmpetenznachweis Ein
