Fachlehrplan Fachgymnasium
|
|
|
- Maike Hertz
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Fachlehrplan Fachgymnasium Stand: Geographie
2 An der Erarbeitung des Fachlehrplans haben mitgewirkt: Boese, Olaf Dr. Colditz, Margit Gemeiner, Sylvia Linde, Cornelia Sedelky, Olaf Vogler, Steve Stendal Halle Osterwieck Magdeburg Köthen Halle (Leitung der Fachgruppe)
3 Inhaltsverzeichnis Seite 1 Bildung und Erziehung im Fach Geographie Entwicklung fachbezogener Kompetenzen Kompetenzentwicklung in den Schuljahrgängen Übersicht Schuljahrgang 11 (Einführungsphase) Schuljahrgänge 12/13 (Qualifikationsphase)
4 1 Bildung und Erziehung im Fach Geographie Teilhabe und Teilnahme am gesellschaftlichen Leben Die Gesellschaft und damit auch das Leben der Schülerinnen und Schüler werden in vielen Bereichen durch geographisch relevante Phänomene und Prozesse wie Globalisierung, Zusammenarbeit in Europa, Bevölkerungsdynamik, Klimawandel und Naturereignisse, Ressourcenkonflikte sowie globale, regionale und lokale Disparitäten geprägt. Diese Herausforderungen unserer Zeit bedürfen eines vertieften Verständnisses von Zusammenhängen zwischen menschlichen Aktivitäten und natürlichen Gegebenheiten in unterschiedlichen Räumen der Erde, das eigene Lebensumfeld darin eingeschlossen. Durch die problemorientierte und systematische Auseinandersetzung mit Mensch-Umwelt-Beziehungen im Geographieunterricht entwickeln die Schülerinnen und Schüler die Bereitschaft und Fähigkeit, sich aktiv und verantwortungsvoll an der nachhaltigen Gestaltung der gegenwärtigen und zukünftigen Lebenswirklichkeit, zum Beispiel an Raumplanungsprozessen, Initiativen zur Erhaltung natürlicher Lebensgrundlagen oder am gemeinsamen Miteinander verschiedener Kulturen, zu beteiligen. Lebensweltbezogenes Lernen Die vielfältige Erfahrungs- und Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler wird im Geographieunterricht bei der Analyse von Räumen und geographischen Sachverhalten immanent einbezogen. Beim Erfassen der in der Realität vorhandenen Wechselwirkungen zwischen Natur, Gesellschaft, Wirtschaft und Politik kommt das Potenzial der Geographie durch die enge Verknüpfung von Natur- und Gesellschaftswissenschaften zum Tragen. Zudem bewirkt der Umgang mit lebensbedeutsamen komplexen geowissenschaftlichen Sachverhalten, wie mit Kernproblemen des Globalen Wandels, eine Reflexion und ggf. Veränderung bisheriger Verhaltensweisen und Lebensstile im Sinne der Nachhaltigkeit. Die zu entwickelnden fachspezifischen Kompetenzen bilden die Grundlage für eine lebensweltbezogene Auseinandersetzung mit der nahen und fernen Umwelt und damit zur Herausbildung eines räumlichen Weltbildes. Dazu gehört auch die Entwicklung von Toleranz und Akzeptanz für andere Lebensweisen durch Perspektivenwechsel im Sinne globalen Lernens. 2
5 Zum Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife trägt der Geographieunterricht dadurch bei, dass sich die Schülerinnen und Schüler eine vertiefte geographische Allgemeinbildung aneignen. Diese beinhaltet insbesondere die Befähigung zur Auseinandersetzung mit dem System Erde als Verflechtung von Natur- und Anthroposphäre. Dabei fordert und fördert die selbstständige Bearbeitung geographischer Frage- und Problemstellungen vernetztes Denken, auch in fächerübergreifenden Zusammenhängen. Dadurch werden Grundlagen sowohl für die Aufnahme eines Studiums als auch für eine vergleichbare berufliche Ausbildung geschaffen. Allgemeine Hochschulreife Wissenschaftspropädeutik im Geographieunterricht der gymnasialen Oberstufe bedeutet Lernen über die bzw. an und in der Wissenschaft Geographie. Die Schülerinnen und Schüler erfassen deren Eigenart, Systematik und Komplexität sowie die Begrenztheit und Vorläufigkeit wissenschaftlicher Aussagen. Durch die weitgehend selbstständige Auseinandersetzung mit Theorien und Modellen führt der Unterricht gezielt in geowissenschaftliche Denkweisen ein. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln eine kritische Grundhaltung des Fragens und Hinterfragens wissenschaftlicher Erkenntnisse. Beim forschenden Lernen sind die Beachtung der geographiespezifischen Prinzipien sowie der Gebrauch der Fachsprache unabdingbar. Beim Bearbeiten komplexer Problemstellungen erwerben die Schülerinnen und Schüler durch eine sachangemessene Auswahl und Anwendung sowohl natur- als auch sozialwissenschaftlicher Arbeitsverfahren und -methoden, zum Beispiel das Nutzen geographischer Informationssysteme, die Arbeit mit (Hypo-)Thesen und das Entwickeln von Zukunftsvisionen/-szenarien, ein erweitertes Methodenbewusstsein. Wissenschaftspropädeutisches Lernen erfordert letztendlich auch eine kritische Reflexion gewählter Erkenntniswege und gewonnener Arbeitsergebnisse, individueller Einstellungen und Verhaltensweisen sowie des eigenen Denkens und Handelns. Wissenschaftspropädeutisches Arbeiten 3
6 2 Entwicklung fachbezogener Kompetenzen Kompetenzmodell Hauptaufgabe des Geographieunterrichts ist die Herausbildung raumbezogener Analyse- und Handlungskompetenz. Diese zeigt sich in der Befähigung zum Untersuchen und Verstehen raumwirksamer Prozesse, der Bereitschaft zur Teilhabe an raumprägenden Entscheidungen sowie im nachhaltigen raumverantwortlichen Handeln. Raumbezogene Analyse- und Handlungskompetenz entwickelt sich über die eng miteinander vernetzten Kompetenzbereiche Erkenntnisse gewinnen und anwenden, Sich räumlich orientieren, Kommunizieren sowie Beurteilen und Bewerten 1. Erkenntnisse gewinnen und anwenden Sich räumlich orientieren Raumbezogene Analyse- und Handlungskompetenz Beurteilen und Bewerten Kommunizieren Abb. 1: Kompetenzmodell des Faches Geographie am Gymnasium Den vier Kompetenzbereichen werden in Kapitel 3 die schrittweise zu entwickelnden Kompetenzen zugeordnet. Diese sind im Geographieunterricht nicht additiv und isoliert voneinander, sondern im Rahmen konkreter Problemstellungen und im lebensbedeutsamen, teilweise auch fächerübergreifenden Kontext anzueignen. 1 In Anlehnung an: Deutsche Gesellschaft für Geographie. Bildungsstandards im Fach Geographie für den Mittleren Schulabschluss, 4. Aufl., Hannover
7 Der Kompetenzbereich Erkenntnisse gewinnen und anwenden zielt auf die Aneignung eines flexibel anwendbaren vernetzten Wissens mithilfe geographiespezifischer und fachübergreifender Arbeitsmethoden/-techniken ab. Die Schülerinnen und Schüler analysieren zum einen geographische Räume unterschiedlicher Maßstabsebenen mit ihren Strukturen, Funktionen und Prozessen. Zum anderen setzen sie sich mit geographisch relevanten Sachverhalten auseinander. Die Breite und Dynamik der Geographie machen ein exemplarisches Vorgehen erforderlich, sodass die Schülerinnen und Schüler die Befähigung zum Anwenden der Erkenntnisse und zum Transfer erwerben müssen. Während die Erkenntnisgewinnung und -anwendung in der Sekundarstufe I vor allem durch eine problemorientierte regional-thematische Betrachtungsweise erfolgt, überwiegt in der Sekundarstufe II die allgemeingeographische Betrachtungsweise mit räumlichem Bezug. Dabei nutzen die Schülerinnen und Schüler in außerordentlich hohem Maße geographisch relevante Medien, gewinnen aber auch Erkenntnisse durch die eigene Tätigkeit im Realraum in organisierten Lernsituationen vor Ort, zum Beispiel Erkundungen und Exkursionen. Infolge des digitalen Medienwandels finden neben traditionellen Medien wie Karten, Statistiken, Bilder, Luft- und Satellitenbilder auch digitale Geomedien immer stärker Eingang in die Erkenntnisgewinnung, -verarbeitung und -dokumentation. Am Ende der Qualifikationsphase können die Schülerinnen und Schüler in der Regel das System Erde als komplexes Gefüge von Natur- und Anthroposphäre analysieren und Wirkungszusammenhänge erläutern, dabei Fragestellungen und Hypothesen selbst formulieren und kritisch überprüfen, Strukturen und Prozesse in ausgewählten Räumen verschiedener Maßstabsebenen und unterschiedlichen Entwicklungsstandes sowie geographisch relevante Sachverhalte unter Einbeziehung von Theorien und Modellen analysieren und erörtern, geographisch relevante Informationen im Realraum sowie aus Medien zur Problembearbeitung und -lösung gewinnen und anwenden. Kompetenzbereich Erkenntnisse gewinnen und anwenden 5
8 Kompetenzbereich Sich räumlich orientieren Zur Entwicklung raumverantwortlichen Handelns kommt dem originär geographischen Kompetenzbereich Sich räumlich orientieren eine zentrale Bedeutung mit hoher Alltagsrelevanz zu. Dieser Kompetenzbereich umfasst die Aneignung eines topographischen Orientierungswissens auf globaler, regionaler und lokaler Maßstabsebene, die Erlangung der Fähigkeit, geographische Objekte und Phänomene in verschiedene räumliche Ordnungssysteme und Orientierungsraster einzuordnen und dabei Lagebeziehungen herzustellen sowie die subjektive Raumwahrnehmung und -konstruktion zu reflektieren. Die Orientierung in zu analysierenden Räumen erfordert insbesondere die Arbeit mit Atlas, Karten und Kartenskizzen, wobei die Schülerinnen und Schüler vor allem zur eigenständigen, zielgerichteten Auswahl und Auswertung von Karten zu befähigen sind. Zunehmend werden zur räumlichen Orientierung interaktive Karten, digitale Globen und virtuelle Erkundungen/ Welten genutzt. Bei der Orientierung im Realraum finden neben traditionellen Orientierungsmitteln und -hilfen auch satellitengestützte Systeme (Global Positioning System/GPS) Anwendung. Zum Erlangen räumlicher Orientierungskompetenz benötigen die Schülerinnen und Schüler auch Fähigkeiten aus anderen Fächern, insbesondere dem Mathematikunterricht. Am Ende der Qualifikationsphase können die Schülerinnen und Schüler in der Regel sich in (Real-)Räumen und virtuellen Welten unter Verwendung verschiedener traditioneller Medien und digitaler Werkzeuge selbstständig orientieren, topographische Objekte und geographische Sachverhalte in räumliche Orientierungsraster und Ordnungssysteme auf unterschiedlichen Maßstabsebenen einordnen sowie Raumwahrnehmung und -konstruktion reflektieren, Karten zieladäquat auswählen und in Korrelation mit anderen Medien interpretieren sowie Kartenskizzen und einfache digitale Karten selbstständig anfertigen. 6
9 Die Befähigung zu einer sach- und adressatengerechten Kommunikation im Unterricht sowie im gesellschaftlichen Kontext ist ein wesentlicher Bestandteil geographischer Bildung. Diese umfasst sowohl das Verstehen komplexer geographischer Sachverhalte als auch ihr Verständlichmachen gegenüber anderen unter Verwendung einer angemessenen Fachsprache, inklusive ausgewiesener Fachbegriffe. Kompetenzbereich Kommunizieren Zu den immanenten Bestandteilen der Kommunikation gehört die Präsentation aufbereiteter Erkenntnisse. Dabei nutzen die Schülerinnen und Schüler Methoden und Techniken der Präsentation und beachten Regeln der Argumentation und Diskussion. Dieser Prozess der Interaktion ermöglicht den Lernenden zunehmend, ihre Positionen strukturiert, differenziert begründet und situations- und adressatengerecht darzulegen, auf Argumente anderer angemessen einzugehen, Kompromisse zu schließen oder die eigene Meinung zu revidieren. Dadurch erlangen die Schülerinnen und Schüler zum einen Diskursfähigkeit über geographische Themen mit Gesellschafts- und Alltagsrelevanz, zum anderen übergreifende Sprachkompetenz für die (außer-)schulische Kommunikation. Am Ende der Qualifikationsphase können die Schülerinnen und Schüler in der Regel gewonnene Erkenntnisse zu geographischen Sachverhalten unter Nutzung der Fachsprache multimedial aufbereiten sowie situations- und adressatengerecht präsentieren, zu geographischen Frage- bzw. Problemstellungen sachlogisch argumentieren sowie in Interaktionen fachliche Aussagen anderer abwägen und darauf angemessen reagieren. Der Kompetenzbereich Beurteilen und Bewerten umfasst das Reflektieren von Mensch-Umwelt-Beziehungen und das Bewerten menschlicher Eingriffe in Räume auf lokaler, regionaler und globaler Ebene unter dem Aspekt einer nachhaltigen Entwicklung. Darüber hinaus werden alternative Handlungsmöglichkeiten und Ansätze zur Lösung von Kernproblemen vor dem Hintergrund bestehender Werte einer Beurteilung unterzogen. Beurteilen und Bewerten schließt auch das Prüfen des Erkenntnisweges unter den Aspekten der Einhaltung geographischer Prinzipien, der Eignung angewandter Arbeitstechniken und -mittel sowie ihrer Effizienz ein. Dazu Kompetenzbereich Beurteilen und Bewerten 7
10 gehören zum Beispiel das Nachvollziehen raumplanerischer Entscheidungsprozesse bzw. das Unterbreiten von Planungsvorschlägen und das Entwickeln von Zukunftsvisionen, auch unter Nutzung digitaler Geomedien. Am Ende der Qualifikationsphase können die Schülerinnen und Schüler in der Regel Mensch-Umwelt-Interaktionen unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit bewerten sowie Lösungsansätze unter Berücksichtigung des Perspektivenwechsels beurteilen bzw. selbst entwickeln, Schlussfolgerungen für das eigene raumverantwortliche Handeln ableiten und Mitverantwortung bei der Bewahrung und Gestaltung einer zukunftsfähigen Lebenswirklichkeit übernehmen, erzielte Arbeitsergebnisse im Zusammenhang mit gewählten geographiespezifischen Denk- und Verfahrensweisen reflektieren und Schlussfolgerungen ziehen. Auf der Grundlage der vier Kompetenzbereiche bilden die Schülerinnen und Schüler die Befähigung heraus, in konkreten Handlungsfeldern sach- und raumgerecht tätig zu werden. 8
11 Das Fach Geographie leistet aufgrund seiner Brückenfunktion zwischen Natur- und Gesellschaftswissenschaften einen umfänglichen Beitrag zur Herausbildung aller im Grundsatzband ausgewiesenen fächerübergreifenden Schlüsselkompetenzen. 2 Die in Kapitel 3 formulierten fachspezifischen Kompetenzen sind somit gleichzeitig auf die Entwicklung der eng miteinander vernetzten Schlüsselkompetenzen gerichtet. Über die Analyse von Natur-, Kultur-, Lebens- und Wirtschaftsräumen unterschiedlicher Ausstattung, Werteorientierung und Entwicklung bilden die Schülerinnen und Schüler vor allem naturwissenschaftlich-technische, mathematische, kulturelle und wirtschaftliche Kompetenz heraus. Zur Entwicklung von Sozial-, Demokratie- und Sprachkompetenz wird insbesondere dadurch beigetragen, dass sich Schülerinnen und Schüler mit der durch raschen Wandel und zunehmende Globalisierung geprägten Welt argumentativ und fachsprachlich korrekt auseinandersetzen, Lösungsansätze diskutieren, ihren eigenen Lebensstil hinterfragen und verantwortungsbewusst an der zukunftsfähigen Gestaltung ihres Lebensraumes teilhaben. Das gewachsene Angebot an aktuellen und einfach zugänglichen Geodaten für den Einsatz im Geographieunterricht erfordert die (Weiter-)Entwicklung von Medienkompetenz. Dabei werden die Schülerinnen und Schüler im Kontext geographischer Frage- und Problemstellungen zu einem situationsund aufgabenbezogenen Umgang mit Medien, darunter auch mit digitalen Werkzeugen und Endgeräten, befähigt. Hierzu gehört auch, die gewonnenen Ergebnisse mithilfe geeigneter Präsentationsformen adressatengerecht (multi-)medial darzustellen und zu diskutieren. Der Geographieunterricht ist darauf ausgerichtet, dass die Schülerinnen und Schüler zunehmend selbstständig unter Anwendung verschiedener Methoden Räume mit ihren natur- und humangeographischen Faktoren und Vernetzungen analysieren sowie geographische Sachverhalte erschließen. Somit leistet er einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von Lernkompetenz. Dabei werden die individuell bzw. in Kooperation erreichten Ergebnisse und angewandten Strategien der Erkenntnisgewinnung reflektiert und Rückschlüsse für das weitere Lernen gezogen. Beitrag zur Entwicklung von Schlüsselkompetenzen 2 Vgl. Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt: Grundsatzband zum Lehrplan Gymnasium/Fachgymnasium Kompetenzentwicklung und Unterrichtsqualität, , S
12 Kompetenzen im Umgang mit digitalen Werkzeugen und Endgeräten Digitale Geomedien und Geographische Informationssysteme prägen in zunehmendem Maße die Lern- und Kommunikationsprozesse im Geographieunterricht. Dies erfordert die Herausbildung und Weiterentwicklung grundlegender Kompetenzen zur Handhabung geographiespezifischer digitaler Werkzeuge/Tools und digitaler Endgeräte. So können die Schülerinnen und Schüler interaktive Karten, digitale Satellitenbilder und virtuelle Globen auswerten. Dazu müssen sie befähigt sein, unter Nutzung der Legende Informationen selektiv aus Kartenausschnitten verschiedener Maßstäbe zu entnehmen, aspektorientiert zu filtern und mit Hilfe von Fachbegriffen wiederzugeben. Bei der Arbeit vor Ort wenden sie auch Navigationssysteme zur Wegbeschreibung, internetbasierte Stadtpläne oder Geocaching gestützte Exkursionen mit verschiedenen Stationen an. Zur Informationsbeschaffung, -verarbeitung und -präsentation nutzen sie Geographische Informationssysteme. Die Schülerinnen und Schüler stellen z. B. Grundelemente von Karten mit Hilfe verschiedener Layer dar. Sie können unter Verwendung eines oder mehrerer Attribute GIS-Karten zur Lösung geographischer Fragestellungen erstellen und dabei Datensätze zur Einordnung von Räumen in Orientierungsraster nutzen. Zur Erkenntnisgewinnung und Veranschaulichung geographischer Strukturen und Prozesse nutzen die Schülerinnen und Schüler geeignete Videosequenzen und Simulationen/Animationen. Mit deren Hilfe entwickeln sie Prozessverständnis, insbesondere für sehr lang anhaltende Vorgänge in der Natur- und Anthroposphäre. Darüber hinaus können sie sich mittels virtueller Exkursionen geographische Räume und Phänomene trotz räumlicher Ferne bzw. Unzugänglichkeit erschließen. Im Sinne eines konstruktivistischen Unterrichts ist es auch folgerichtig, dass sie selbst virtuelle Exkursionen erstellen. Zur Förderung selbstorganisierten Lernens bzw. zur Festigung erworbener Fachkenntnisse und Kompetenzen ziehen die Schülerinnen und Schüler geographische Lernsoftware heran. Darüber hinaus können sie selbstbestimmt individuell bzw. im Klassenverband mit webbasierten Lernplattformen ihren Lernprozess gestalten, Lernerfolgskontrollen eigenständig vornehmen sowie adressatenbezogen kommunizieren. 10
13 Beim Umgang mit diesen digitalen Werkzeugen ist auch die Kompetenz zur kritischen Reflexion ihrer Qualität erforderlich, um Gefahren von Manipulation und Steuerung durch Medien begegnen zu können. Unabdingbare Voraussetzung für die Entwicklung der aufgeführten Kompetenzen ist die Befähigung der Schülerinnen und Schüler zur zielführenden Bedienung und Handhabung sowie zum sicheren Gebrauch digitaler mobiler Endgeräte wie Tablet-Computer, Notebooks, Smartphones, GPS-Geräte und interaktive Whiteboards. 11
14 3 Kompetenzentwicklung in den Schuljahrgängen 3.1 Übersicht Schuljahrgänge 11 (Einführungsphase) 11/12 (Qualifikationsphase) Kompetenzschwerpunkte Die Erde als Mensch-Umwelt-System analysieren und bewerten Raumwirksamkeit menschlichen Handelns analysieren und bewerten Kurs 1: Geoökozonen und Geoökosysteme analysieren und bewerten Kurs 2: Siedlungsentwicklung und Raumordnung analysieren und bewerten Kurs 3: Globale Entwicklungsdisparitäten und Verflechtungen analysieren und bewerten Kurs 4: Verfügbarkeit und Nutzung von Ressourcen analysieren und bewerten räumliche Schwerpunkte Erde (mit regionalen und lokalen Beispielen) Erde (mit regionalen und lokalen Beispielen) 12
15 3.2 Schuljahrgang 11 (Einführungsphase) Kompetenzschwerpunkt: Erkenntnisse gewinnen und anwenden Sich räumlich orientieren Die Erde als Mensch-Umwelt-System analysieren und bewerten die Erde in Natur- und Anthroposphäre und ihre Subsphären gliedern die erdgeschichtliche Entwicklung beschreiben, dabei die geologische Zeittafel auswerten raumzeitliche Veränderungen der Lithosphäre durch endogene Vorgänge und exogene Kräfte und Folgen erklären Boden als Naturressource analysieren und als Produkt komplexer Wechselwirkungen zwischen Litho-, Atmo- und Biosphäre erläutern räumliche Verteilung von Naturgefahren auch unter Nutzung digitaler Karten erläutern die weltweite Verbreitung von Bodentypen aufzeigen Kommunizieren den Gesteinskreislauf darstellen und Zusammenhänge erläutern Wechselwirkungen zwischen Geo- und Humanfaktoren am Beispiel des Bodens in Beziehungsgeflechten visualisieren und präsentieren Beurteilen und Bewerten eine Projektarbeit zu einem Naturereignis/Naturrisiko an einem ausgewählten Beispiel durchführen, dabei auch die Auswirkungen auf die Natur- und Anthroposphäre bewerten Grundlegende Wissensbestände System Erde: Natur- und Anthroposphäre Lithosphäre: geodynamische Prozesse die Pedosphäre als Integrationsbereich der Sphären Theorien/Modelle: Theorie der Plattentektonik, Gesteinskreislauf Fachbegriffe: Bodentyp, Bodendegradation 13
16 Kompetenzschwerpunkt: Raumwirksamkeit menschlichen Handelns analysieren und bewerten Erkenntnisse gewinnen und anwenden Sich räumlich orientieren den Zusammenhang zwischen Entwicklungsstand der menschlichen Gesellschaft und Ansprüchen an den Raum analysieren die Naturraumausstattung Sachsen-Anhalts analysieren und das Naturpotenzial bewerten raumwirksame Prozesse am Beispiel von Landwirtschaft, Industrie und Verkehr Sachsen-Anhalts unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit erläutern die Bevölkerungsentwicklung/-struktur Sachsen-Anhalts erläutern, dabei das Modell der demographischen Transition anwenden Unterschiedliche sozioökonomische Entfaltungsstufen der Menschheit global verorten Sachsen-Anhalt in physisch- und anthropogeographische Ordnungssysteme einordnen Sachsen-Anhalt wirtschaftsräumlich gliedern sowie Raumkonzepten Europas und Deutschlands zuordnen Kommunizieren Visionen für eine Gesellschaft nach der Dienstleistungsgesellschaft entwickeln, dabei Standorttheorien einbeziehen Verflechtungen von lokalen mit europäischen und globalen Standorten aufzeigen Beurteilen und Bewerten zu Maßnahmen zum Klimaschutz in Sachsen-Anhalt Stellung nehmen, dabei das eigene Handeln kritisch bewerten die Standortwahl an einem regionalen Beispiel multiperspektivisch beurteilen Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung auf Sachsen-Anhalt bewerten, dabei Zukunftsszenarien entwickeln Grundlegende Wissensbestände Ansprüche an den Raum im Wandel der Zeit Raumanalyse Sachsen-Anhalts Theorien/Modelle: Modell der demographischen Transition, Standorttheorien Fachbegriffe: Metropolregion, Raumordnung 14
17 3.3 Schuljahrgänge 12/13 (Qualifikationsphase) Kurs 1: Erkenntnisse gewinnen und anwenden Sich räumlich orientieren Geoökozonen und Geoökosysteme analysieren und bewerten Geoökozonen charakterisieren und nach ausgewählten Merkmalen vergleichen, dabei Klimadiagramme interpretieren Ausstattung, Nutzung und Gefährdung der Geoökozone Trockene Mittelbreiten analysieren und bewerten, dabei Syndrome des Globalen Wandels begründend zuordnen Arten von Ökosystemen ordnen und das Modell des Landschaftsökosystems erläutern ein ausgewähltes Gebirgsökosystem analysieren und sein Raumpotenzial bewerten die Verbreitung der Geoökozonen beschreiben und Einflussfaktoren für raum-zeitliche Veränderungen erläutern Geoökosysteme unterschiedlicher Dimensionsstufen in räumliche Orientierungsraster einordnen Kommunizieren das Zusammenwirken von Geoökofaktoren erläutern und mit Hilfe von Wirkungsgeflechten darstellen eine virtuelle Exkursion zur touristischen Nutzung eines Gebirgsökosystems erstellen und diskutieren zu Lösungsansätzen für eine nachhaltige Nutzung von Geoökozonen/ -systemen eine Pro-Contra-Diskussion führen Beurteilen und Bewerten den Einfluss des Menschen auf den Landschaftswandel kriteriengestützt beurteilen die Tragfähigkeit von Geoökosystemen bewerten und das Handeln unterschiedlicher Interessengruppen unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit erörtern das schrittweise Vorgehen bei der geoökologischen Systemanalyse erläutern und die Medienauswahl begründen Grundlegende Wissensbestände Geoökozonen als ein räumliches Ordnungsmuster Geoökozone Trockene Mittelbreiten Geoökosystem geoökologische Prozesse Geoökologische Systemanalyse an einem Gebirgsökosystem Theorien/Modelle: Modell der Landschaft, Systemtheorie, planetarischer und hypsometrischer Formenwandel Fachbegriffe: Geoökozone, Natur-/Kulturlandschaft, Geoökosystem 15
18 Kurs 2: Erkenntnisse gewinnen und anwenden Sich räumlich orientieren Siedlungsentwicklung und Raumordung analysieren und bewerten Siedlungen nach verschiedenen Kriterien typisieren sowie auf Deutschland und Sachsen-Anhalt anwenden ländliche und städtische Siedlungen in ihren Strukturen, Entwicklungen und Funktionen analysieren, daraus die heutige Physiognomie erklären Verstädterungsprozesse in ihrer räumlichen Differenzierung erläutern und Stadt-Umland-Beziehungen erklären, dabei digitale Satellitenbilder vergleichend auswerten Raumordnung und -planung als Grundlagen der nachhaltigen Raumentwicklung erläutern Siedlungsräume der Erde lokalisieren und die Dynamik von Siedlungsgrenzen darstellen Karten unterschiedlichen Maßstabs zur Raumordnung auswerten und vergleichen Ausschnitte des heimatlichen Siedlungsraumes unter Verwendung von Internettools kartieren sich in virtuellen Welten orientieren und diese mit realen Gegebenheiten in Beziehung setzen Kommunizieren Herausforderungen der Stadtentwicklung darstellen und einen Diskurs zu Lösungsansätzen führen Ergebnisse einer Erkundung multimedial aufbereiten und adressatenbezogen präsentieren Beurteilen und Bewerten Visionen für eine Stadt der Zukunft unter selbst gewählten Kriterien erörtern und eigene Vorstellungen entwickeln ein Raumplanungsvorhaben aus dem Nahraum erkunden und bewerten, dabei Möglichkeiten der Teilhabe an der Raumgestaltung erörtern und den Weg der Erkenntnisgewinnung reflektieren Grundlegende Wissensbestände Siedlungsräume und -strukturen Verstädterung und Urbanisierung nachhaltige Raumentwicklung Raumplanungsvorhaben vor Ort Theorien/Modelle: System der Zentralen Orte Fachbegriffe: Siedlung, Gentrifizierung, Segregation, Landesentwicklungsplan 16
19 Kurs 3: Erkenntnisse gewinnen und anwenden Sich räumlich orientieren Globale Entwicklungsdisparitäten und Verflechtungen analysieren und bewerten Indikatoren des Entwicklungsstandes von Ländern kategorisieren Merkmale und Ursachen der Globalisierung erläutern sowie an Beispielen Dimensionen der Globalisierung aufzeigen Strukturen und Entwicklung der Weltwirtschaft analysieren, Triebkräfte und ausgewählte Akteure charakterisieren den asiatisch-pazifischen Raum unter verschiedenen Aspekten abgrenzen sowie zwei unterschiedlich entwickelte Räume auch mit Hilfe von geographischen Informationssystemen (GIS) analysieren und vergleichen räumliche Disparitäten zwischen und innerhalb von Ländern/Regionen verorten und deren Raumstrukturen vergleichen die Wahrnehmung von Räumen in ihrer Subjektivität und Selektivität reflektieren Verflechtungen innerhalb der Weltwirtschaft kartographisch darstellen Kommunizieren sich mit Modellen zur Erklärung räumlicher Entwicklungsdisparitäten argumentativ auseinandersetzen Ergebnisse des räumlich-geographischen Vergleichs multimedial darstellen Ziele und Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit erörtern sowie sich über Möglichkeiten für das eigene Handeln austauschen Beurteilen und Bewerten Indikatoren zur Analyse des Entwicklungsstandes von Räumen zielgerichtet auswählen, dabei Daten durch Klasseneinteilung strukturieren sowie ihre Aussagefähigkeit und Interpretation kriterienorientiert prüfen den Einfluss der Globalisierung auf Regionen aus verschiedenen Perspektiven beurteilen Entwicklungsstrategien unter Beachtung des Prinzips der Nachhaltigkeit bewerten Grundlegende Wissensbestände globale Fragmentierung Abbau und/oder Verstärkung von Disparitäten durch Globalisierung asiatisch-pazifischer Raum räumliche Disparitäten Perspektiven des Aktionsraumes Erde Theorien/Modelle: Dependenz- und Modernisierungstheorie, Zentrum-Peripherie-Modell Fachbegriffe: fragmentierende Entwicklung, Global Player, Global City 17
20 Kurs 4: Erkenntnisse gewinnen und anwenden Sich räumlich orientieren Verfügbarkeit und Nutzung von Ressourcen analysieren und bewerten Ressourcen nach verschiedenen Aspekten gliedern und deren Verfügbarkeit analysieren Verfügbarkeit, Nutzung und Gefährdung der Ressource Wasser im Kontext der Kernprobleme des Globalen Wandels erörtern Vorkommen und Nutzung von Rohstoffen in Deutschland analysieren sowie ihre Raumwirksamkeit an einem Beispiel nachweisen die weltweite Verteilung von Lagerstätten beschreiben und den Zusammenhang mit geologischen Strukturen erläutern, dabei geologische Profile auswerten die Einbindung Deutschlands in globale Rohstoffströme aufzeigen und begründen Kommunizieren Wechselwirkungen zwischen Wasser und weiteren Geofaktoren anhand des Wasserkreislaufes darstellen und erläutern, dies mit Hilfe von Simulationen veranschaulichen eine Diskussion zu Maßnahmen für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen moderieren Beurteilen und Bewerten Vereinbarungen bzw. Maßnahmen zum Schutz von Süßwasser und des Weltmeeres prüfen und beurteilen das Konfliktpotenzial der Ressourcennutzung an Beispielen darstellen und bewerten, (Hypo-)Thesen für eine Konfliktbewältigung aufstellen und erörtern durch eigenes Handeln zur nachhaltigen Ressourcennutzung beitragen Grundlegende Wissensbestände natürliche Ressourcen im Überblick Ressource Wasser Deutschland Ressourcenpotenzial, Rohstoffnutzung und -abhängigkeit Theorien/Modelle: Kreislaufmodell Fachbegriffe: Lagerstätte, virtuelles Wasser, Recycling 18
Schulcurriculum Erdkunde
 Schulcurriculum Erdkunde Jahrgangsstufe EF Die Methoden- und Handlungskompetenzen werden ausschließlich inhaltsfeldübergreifend angelegt. Methodenkompetenz orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar
Schulcurriculum Erdkunde Jahrgangsstufe EF Die Methoden- und Handlungskompetenzen werden ausschließlich inhaltsfeldübergreifend angelegt. Methodenkompetenz orientieren sich unmittelbar vor Ort und mittelbar
Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule
 Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule Kompetenzbereiche: Sach-, Methoden-, Urteils-, Handlungskompetenz Synopse aller Kompetenzerwartungen Sachkompetenz
Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Katholische Religion Gymnasium August-Dicke-Schule Kompetenzbereiche: Sach-, Methoden-, Urteils-, Handlungskompetenz Synopse aller Kompetenzerwartungen Sachkompetenz
Unterrichtseinheit: Unsere Erde Fach/Jahrgang: Erdkunde Kl.5 G.1/1
 Unterrichtseinheit: Unsere Erde Fach/Jahrgang: Erdkunde Kl.5 G.1/1 Orientierungs-, Methoden- und Medienkompetenz Sprach-, Sozial- und Lernkompetenz Informationen aus einfachen Texten (z. B. Diagrammen,
Unterrichtseinheit: Unsere Erde Fach/Jahrgang: Erdkunde Kl.5 G.1/1 Orientierungs-, Methoden- und Medienkompetenz Sprach-, Sozial- und Lernkompetenz Informationen aus einfachen Texten (z. B. Diagrammen,
LEHRPLAN FÜR DAS GRUNDLAGENFACH GEOGRAFIE
 LEHRPLAN FÜR DAS GRUNDLAGENFACH GEOGRAFIE A. Stundendotation Klasse 1. 2. 3. 4. Wochenstunden 2 1 2 B. Didaktische Konzeption (1) Beitrag des Faches zur gymnasialen Bildung Die Geografie befasst sich mit
LEHRPLAN FÜR DAS GRUNDLAGENFACH GEOGRAFIE A. Stundendotation Klasse 1. 2. 3. 4. Wochenstunden 2 1 2 B. Didaktische Konzeption (1) Beitrag des Faches zur gymnasialen Bildung Die Geografie befasst sich mit
Zaubern im Mathematikunterricht
 Zaubern im Mathematikunterricht 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Die Mathematik als Fachgebiet ist so ernst, dass man keine Gelegenheit versäumen sollte, dieses Fachgebiet unterhaltsamer zu gestalten.
Zaubern im Mathematikunterricht 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 Die Mathematik als Fachgebiet ist so ernst, dass man keine Gelegenheit versäumen sollte, dieses Fachgebiet unterhaltsamer zu gestalten.
Was will der Wirtschaftsgeografieunterricht?
 Fachcurriculum für Wirtschaftsgeografie im 2. Biennium der Fachoberschule für Wirtschaft und der Sportoberschule am Oberschulzentrum Claudia von Medici in Mals Was will der Wirtschaftsgeografieunterricht?
Fachcurriculum für Wirtschaftsgeografie im 2. Biennium der Fachoberschule für Wirtschaft und der Sportoberschule am Oberschulzentrum Claudia von Medici in Mals Was will der Wirtschaftsgeografieunterricht?
Umsetzungshilfe zur Promotionsverordnung: Fachdidaktische Grundlagen zum Fach Physik
 Umsetzungshilfe zur Promotionsverordnung: Fachdidaktische Grundlagen zum Fach Physik (Sekundarschule und Bezirksschule) Die vorliegende Umsetzungshilfe soll die Lehrpersonen unterstützen, die Sachkompetenz
Umsetzungshilfe zur Promotionsverordnung: Fachdidaktische Grundlagen zum Fach Physik (Sekundarschule und Bezirksschule) Die vorliegende Umsetzungshilfe soll die Lehrpersonen unterstützen, die Sachkompetenz
/sekundarstufe_i/2008/geografie-rlp_sek.i_2008_brandenburg.pdf. /gymnasiale_oberstufe/rlp/2011/geografie-rlp_sek.ii_2011_brandenburg.
 Brandenburg Literatur: Grundschule Sachunterricht /grundschule/sachunterricht-rlp_gs_2004_brandenburg.pdf Grundschule (bis Klasse 6) Geographie (2004) /grundschule/geografie-rlp_gs_2004_brandenburg.pdf
Brandenburg Literatur: Grundschule Sachunterricht /grundschule/sachunterricht-rlp_gs_2004_brandenburg.pdf Grundschule (bis Klasse 6) Geographie (2004) /grundschule/geografie-rlp_gs_2004_brandenburg.pdf
Räumliche Disparitäten auf der Erde analysieren 9 A 1
 Räumliche Disparitäten auf der Erde analysieren 9 A 1 Die Menschen auf der Erde leben unter unterschiedlichen Lebens- und Wirtschaftsverhältnissen. Diese werden häufig in Statistiken und/oder thematischen
Räumliche Disparitäten auf der Erde analysieren 9 A 1 Die Menschen auf der Erde leben unter unterschiedlichen Lebens- und Wirtschaftsverhältnissen. Diese werden häufig in Statistiken und/oder thematischen
Demokratiebildung aus Sicht des Sachunterrichts
 Demokratiebildung aus Sicht des Sachunterrichts Input im Rahmen des thematischen Forums Demokratiebildung eine didaktische Herausforderung Dr. Sandra Tänzer; 27.5.2010 Gliederung 1.Demokratische Kompetenzen
Demokratiebildung aus Sicht des Sachunterrichts Input im Rahmen des thematischen Forums Demokratiebildung eine didaktische Herausforderung Dr. Sandra Tänzer; 27.5.2010 Gliederung 1.Demokratische Kompetenzen
Prüfungen im Fach Biologie im Schuljahr 2013/14
 Prüfungen im Fach Biologie im Schuljahr 2013/14 (1) Grundlagen Qualifizierender Hauptschulabschluss Realschulabschluss Abitur Externenprüfungen (2) Anforderungen an Prüfungsaufgaben (3) Bewertung Zusammenstellung
Prüfungen im Fach Biologie im Schuljahr 2013/14 (1) Grundlagen Qualifizierender Hauptschulabschluss Realschulabschluss Abitur Externenprüfungen (2) Anforderungen an Prüfungsaufgaben (3) Bewertung Zusammenstellung
Fachwissen. Kommunikation. Bewertung. Kompetenzbereich. Erkenntnisgewinnung. Zusatzmodul in der regionalen Fortbildung
 Fachwissen Kommunikation Erkenntnisgewinnung Bewertung Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung Zusatzmodul in der regionalen Fortbildung Erkenntnisgewinnung in den Leitgedanken zum Kompetenzerwerb in den
Fachwissen Kommunikation Erkenntnisgewinnung Bewertung Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung Zusatzmodul in der regionalen Fortbildung Erkenntnisgewinnung in den Leitgedanken zum Kompetenzerwerb in den
Curriculum Geographie: Übersicht der übergeordneten Kompetenzerwartungen
 Curriculum Geographie: Übersicht der übergeordneten Kompetenzerwartungen Sachkompetenz - beschreiben einzelne Geofaktoren und deren Zusammenwirken sowie ihren Einfluss auf den menschlichen Lebensraum (SK1),
Curriculum Geographie: Übersicht der übergeordneten Kompetenzerwartungen Sachkompetenz - beschreiben einzelne Geofaktoren und deren Zusammenwirken sowie ihren Einfluss auf den menschlichen Lebensraum (SK1),
Johannes-Althusius-Gymnasium Emden Schuleigenes Curriculum Erdkunde
 Unterrichtseinheit/Themen (Stundenumfang) kompetenzbereich(e) (auch Wettbewerbe) I. Die Schülerinnen und Schüler... unverbindlich Exogene und endogene Kräfte - Die Erde ein unruhiger Planet - Die Erdoberfläche
Unterrichtseinheit/Themen (Stundenumfang) kompetenzbereich(e) (auch Wettbewerbe) I. Die Schülerinnen und Schüler... unverbindlich Exogene und endogene Kräfte - Die Erde ein unruhiger Planet - Die Erdoberfläche
Schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan Geographie für die Gymnasiale Oberstufe Einführungsphase
 Schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan Geographie für die Gymnasiale Oberstufe Einführungsphase Inhaltsfeld 1: Lebensräume und deren naturbedingte sowie anthropogen bedingte Gefährdung Inhaltlicher Schwerpunkt:
Schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan Geographie für die Gymnasiale Oberstufe Einführungsphase Inhaltsfeld 1: Lebensräume und deren naturbedingte sowie anthropogen bedingte Gefährdung Inhaltlicher Schwerpunkt:
Kommentierte Aufgabenbeispiele Biologie Jahrgangsstufe 10
 Kommentierte Aufgabenbeispiele Biologie Jahrgangsstufe 10 Kompetenzen werden an Inhalten erworben. Für den Mittleren Schulabschluss werden die Inhalte im Fach Biologie in den folgenden drei Basiskonzepten
Kommentierte Aufgabenbeispiele Biologie Jahrgangsstufe 10 Kompetenzen werden an Inhalten erworben. Für den Mittleren Schulabschluss werden die Inhalte im Fach Biologie in den folgenden drei Basiskonzepten
Fachcurriculum Erdkunde Sekundarstufe I - Kurzfassung
 2016 Fachcurriculum Erdkunde Sekundarstufe I - Kurzfassung Wilhelm- Gymnasium Braunschweig August 2016 1. Inhaltsverzeichnis 1. INHALTSVERZEICHNIS... 1 2. ERWARTETE INHALTSBEZOGENE KOMPETENZEN NACH SCHULJAHRGÄNGEN
2016 Fachcurriculum Erdkunde Sekundarstufe I - Kurzfassung Wilhelm- Gymnasium Braunschweig August 2016 1. Inhaltsverzeichnis 1. INHALTSVERZEICHNIS... 1 2. ERWARTETE INHALTSBEZOGENE KOMPETENZEN NACH SCHULJAHRGÄNGEN
Geographie (4st.) Kursstufe
 Geographie (4st.) Kursstufe Kerncurriculum Schulcurriculum Themenfeld 1:Reliefsphäre Die Schüler können grundlegende endogene Prozesse (Vulkanismus, Gebirgsbildung) verstehen den Gesteinskreislauf erklären
Geographie (4st.) Kursstufe Kerncurriculum Schulcurriculum Themenfeld 1:Reliefsphäre Die Schüler können grundlegende endogene Prozesse (Vulkanismus, Gebirgsbildung) verstehen den Gesteinskreislauf erklären
18 Themenbereiche für die Geographiematura ab 2014 [Änderungen vorbehalten]
![18 Themenbereiche für die Geographiematura ab 2014 [Änderungen vorbehalten] 18 Themenbereiche für die Geographiematura ab 2014 [Änderungen vorbehalten]](/thumbs/39/18883684.jpg) 18 Themenbereiche für die Geographiematura ab 2014 [Änderungen vorbehalten] 1. Gliederungsprinzipien der Erde nach unterschiedlichen Sichtweisen Gliederungsmerkmale (kulturelle, soziale Unterschiede; wirtschaftliche,
18 Themenbereiche für die Geographiematura ab 2014 [Änderungen vorbehalten] 1. Gliederungsprinzipien der Erde nach unterschiedlichen Sichtweisen Gliederungsmerkmale (kulturelle, soziale Unterschiede; wirtschaftliche,
Unterrichtsvorhaben I
 Lehrplan Philosophie für die Einführungsphase (Jgst. 10) Übersichtsraster der verbindlichen Unterrichtsvorhaben Thema: Was ist Philosophie? Unterrichtsvorhaben I arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt
Lehrplan Philosophie für die Einführungsphase (Jgst. 10) Übersichtsraster der verbindlichen Unterrichtsvorhaben Thema: Was ist Philosophie? Unterrichtsvorhaben I arbeiten aus Phänomenen der Lebenswelt
Schulinterner Lehrplan Erdkunde Oberstufe (G8) Qualifikationsphase Inhaltsfelder (X) und thematische Bausteine (kursiv)
 Schulinterner Lehrplan Erdkunde Oberstufe (G8) Qualifikationsphase Inhalt: Kapitel im Schülerbuch TERRA Qualifikationsphase * = fakultativ Kap. 1 Wechselwirkung von natürlichen Systemen und Eingriffen
Schulinterner Lehrplan Erdkunde Oberstufe (G8) Qualifikationsphase Inhalt: Kapitel im Schülerbuch TERRA Qualifikationsphase * = fakultativ Kap. 1 Wechselwirkung von natürlichen Systemen und Eingriffen
1. Allgemeine Bildungsziele. 3. Grobziele und Inhalte. 3.1 Zyklus 1 (GYM1 / GYM2) 3.2 Zyklus 2 (GYM4) 4. Fachdidaktische Grundsätze
 Grundlagenfach 1. Allgemeine Bildungsziele 2. Richtziele 3. und 3.1 Zyklus 1 (GYM1 / GYM2) 3.2 Zyklus 2 (GYM4) 4. Fachdidaktische Grundsätze 5. Methoden- und Medienkompetenzen 6. Bildung für eine nachhaltige
Grundlagenfach 1. Allgemeine Bildungsziele 2. Richtziele 3. und 3.1 Zyklus 1 (GYM1 / GYM2) 3.2 Zyklus 2 (GYM4) 4. Fachdidaktische Grundsätze 5. Methoden- und Medienkompetenzen 6. Bildung für eine nachhaltige
Schulinternes Curriculum Philosophie Gymnasium Schloss Holte-Stukenbrock
 Schulinternes Curriculum Philosophie Gymnasium Schloss Holte-Stukenbrock EF Unterrichtsvorhaben Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und
Schulinternes Curriculum Philosophie Gymnasium Schloss Holte-Stukenbrock EF Unterrichtsvorhaben Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und
Schulinterner Kernlehrplan EF PL Leonardo-da-Vinci-Gymnasium Köln-Nippes
 Schulinterner Kernlehrplan EF PL Leonardo-da-Vinci-Gymnasium Köln-Nippes Thema 1: Kompetenzen: Was ist Philosophie? Welterklärung in Mythos, Naturwissenschaft und Philosophie Sachkompetenz (SK) - unterscheiden
Schulinterner Kernlehrplan EF PL Leonardo-da-Vinci-Gymnasium Köln-Nippes Thema 1: Kompetenzen: Was ist Philosophie? Welterklärung in Mythos, Naturwissenschaft und Philosophie Sachkompetenz (SK) - unterscheiden
PHILOSOPHIE. Qualifikationsphase (Q2) GRUNDKURS Unterrichtsvorhaben XIV: Unterrichtsvorhaben XIII:
 PHILOSOPHIE Unterrichtsvorhaben XIII: Qualifikationsphase (Q2) GRUNDKURS Unterrichtsvorhaben XIV: Thema: Welche Ordnung der Gemeinschaft ist gerecht? - Ständestaat und Philosophenkönigtum stellen die Legitimationsbedürftigkeit
PHILOSOPHIE Unterrichtsvorhaben XIII: Qualifikationsphase (Q2) GRUNDKURS Unterrichtsvorhaben XIV: Thema: Welche Ordnung der Gemeinschaft ist gerecht? - Ständestaat und Philosophenkönigtum stellen die Legitimationsbedürftigkeit
3) Evangelischer Religionsunterricht in der Sek.II
 3) Evangelischer Religionsunterricht in der Sek.II Evangelischer Religionsunterricht erschließt die religiöse Dimension der Wirklichkeit und des Lebens und trägt damit zur religiösen Bildung der Schüler/innen
3) Evangelischer Religionsunterricht in der Sek.II Evangelischer Religionsunterricht erschließt die religiöse Dimension der Wirklichkeit und des Lebens und trägt damit zur religiösen Bildung der Schüler/innen
ERDKUNDE: Unterrichtsthemen Abitur 2016 (vgl. Anlage 3)
 ERDKUNDE: Unterrichtsthemen Abitur 2016 (vgl. Anlage 3) Atlas: Lehrbuch: DIERCKE Weltatlas (Westermann: 100700; Neuauflage 2008, aktueller Druck) nach Absprache Halbj. Kursthema Unterrichtseinheit Inhaltliche
ERDKUNDE: Unterrichtsthemen Abitur 2016 (vgl. Anlage 3) Atlas: Lehrbuch: DIERCKE Weltatlas (Westermann: 100700; Neuauflage 2008, aktueller Druck) nach Absprache Halbj. Kursthema Unterrichtseinheit Inhaltliche
(Termine, Daten, Inhalte)
 IV. Dokumentationsbögen / Planungsbögen (I VII) für die Referendarinnen und Referendare hinsichtlich des Erwerbs der geforderten und im Verlauf ihrer Ausbildung am Marie-Curie-Gymnasium Die Referendarinnen
IV. Dokumentationsbögen / Planungsbögen (I VII) für die Referendarinnen und Referendare hinsichtlich des Erwerbs der geforderten und im Verlauf ihrer Ausbildung am Marie-Curie-Gymnasium Die Referendarinnen
Schulinterner Lehrplan für die gymnasiale Oberstufe im Fach Geographie
 Schulinterner Lehrplan für die gymnasiale Oberstufe im Fach Geographie Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben Einführungsphase Unterrichtsvorhaben Kompetenzen Lehrbuchbezug Unterrichtsvorhaben I: Thema:
Schulinterner Lehrplan für die gymnasiale Oberstufe im Fach Geographie Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben Einführungsphase Unterrichtsvorhaben Kompetenzen Lehrbuchbezug Unterrichtsvorhaben I: Thema:
Kernlehrplan Philosophie - Einführungsphase
 Kernlehrplan Philosophie - Einführungsphase Einführungsphase Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie unterscheiden philosophische
Kernlehrplan Philosophie - Einführungsphase Einführungsphase Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was heißt es zu philosophieren? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie unterscheiden philosophische
Realgymnasium Schlanders
 Realgymnasium Schlanders Fachcurriculum aus Geschichte Klasse: 5. Klasse RG und SG Lehrer: Christof Anstein für die Fachgruppe Geschichte/ Philosophie Schuljahr 2013/2014 1/5 Lernziele/Methodisch-didaktische
Realgymnasium Schlanders Fachcurriculum aus Geschichte Klasse: 5. Klasse RG und SG Lehrer: Christof Anstein für die Fachgruppe Geschichte/ Philosophie Schuljahr 2013/2014 1/5 Lernziele/Methodisch-didaktische
Qualifikationsphase (Q2) GRUNDKURS Unterrichtsvorhaben XIII: Unterrichtsvorhaben XIV:
 Qualifikationsphase (Q2) GRUNDKURS Unterrichtsvorhaben XIII: Thema: Welche Ordnung der Gemeinschaft ist gerecht? - Ständestaat und Philosophenkönigtum als Staatsideal stellen die Legitimationsbedürftigkeit
Qualifikationsphase (Q2) GRUNDKURS Unterrichtsvorhaben XIII: Thema: Welche Ordnung der Gemeinschaft ist gerecht? - Ständestaat und Philosophenkönigtum als Staatsideal stellen die Legitimationsbedürftigkeit
Schulinterner Lehrplan Evangelische Religionslehre am Clara-Schumann-Gymnasium Holzwickede Qualifikationsphase (Q 1)
 Schulinterner Lehrplan Evangelische Religionslehre am Clara-Schumann-Gymnasium Holzwickede Qualifikationsphase (Q 1) Qualifikationsphase (Q1) GRUNDKURS Halbjahresthema 1.Hj.: Als Mensch Orientierung suchen
Schulinterner Lehrplan Evangelische Religionslehre am Clara-Schumann-Gymnasium Holzwickede Qualifikationsphase (Q 1) Qualifikationsphase (Q1) GRUNDKURS Halbjahresthema 1.Hj.: Als Mensch Orientierung suchen
Zygote, (Morula), (Blastula), Einnistung, Plazenta, Mutterkuchen
 5a Das Leben beginnt vor der Geburt Erste Schritte von der befruchteten Eizelle zur Einnistung Schwangerschaft Veränderungen für Mutter und Kind Vorsorgeuntersuchungen ärztliche Begleitung der Schwangerschaft
5a Das Leben beginnt vor der Geburt Erste Schritte von der befruchteten Eizelle zur Einnistung Schwangerschaft Veränderungen für Mutter und Kind Vorsorgeuntersuchungen ärztliche Begleitung der Schwangerschaft
Übersicht zu den Unterrichtsvorhaben in der EF. Jahrgangsstufe: EF Jahresthema:
 Übersicht zu den Unterrichtsvorhaben in der EF Jahrgangsstufe: EF Jahresthema: Unterrichtsvorhaben I: Philosophie: Was ist das? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie unterscheiden philosophische
Übersicht zu den Unterrichtsvorhaben in der EF Jahrgangsstufe: EF Jahresthema: Unterrichtsvorhaben I: Philosophie: Was ist das? Welterklärungen in Mythos, Wissenschaft und Philosophie unterscheiden philosophische
Paul-Klee-Gymnasium Overath ERDKUNDE Inhalte & Kompetenzen Klasse 9
 Grundlage: Kernlehrplan für das Gymnasium Sekundarstufe I (G8) in NRW: Erdkunde (2007) (http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/lehrplaene_download/gymnasium_g8 /gym8_erdkunde.pdf) Lehr- und
Grundlage: Kernlehrplan für das Gymnasium Sekundarstufe I (G8) in NRW: Erdkunde (2007) (http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/lehrplaene_download/gymnasium_g8 /gym8_erdkunde.pdf) Lehr- und
2. Klassenarbeiten Im Fach Biologie werden in der Sekundarstufe I keine Klassenarbeiten geschrieben.
 1. Einleitung und Vorgaben durch Kernlehrpläne Die im allgemeinen Leistungskonzept aufgeführten Formen der sonstigen Mitarbeit gelten auch für das Fach Biologie. Dabei werden sowohl die Ausprägung als
1. Einleitung und Vorgaben durch Kernlehrpläne Die im allgemeinen Leistungskonzept aufgeführten Formen der sonstigen Mitarbeit gelten auch für das Fach Biologie. Dabei werden sowohl die Ausprägung als
Heimat- und Sachunterricht
 Herzlich willkommen zur Fortbildung Grundlagen des LehrplanPLUS: Heimat- und Sachunterricht LehrplanPLUS HSU Grundschule Das erwartet Sie heute: Präsentation des Kompetenzstrukturmodells Vorstellung der
Herzlich willkommen zur Fortbildung Grundlagen des LehrplanPLUS: Heimat- und Sachunterricht LehrplanPLUS HSU Grundschule Das erwartet Sie heute: Präsentation des Kompetenzstrukturmodells Vorstellung der
Schulinternes Curriculum für das Unterrichtsfach Geographie
 Schulinternes Curriculum für das Unterrichtsfach Geographie Übersicht (Stand: April 2015) Klasse Themen Handlungsfeld / Inhalt Kompetenzen Methoden / Materialien / Fachspezifische Inhalte 5 Deutschland,
Schulinternes Curriculum für das Unterrichtsfach Geographie Übersicht (Stand: April 2015) Klasse Themen Handlungsfeld / Inhalt Kompetenzen Methoden / Materialien / Fachspezifische Inhalte 5 Deutschland,
Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie in der Einführungsphase der Gesamtschule Aachen-Brand
 Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie in der Einführungsphase der Gesamtschule Aachen-Brand Stand: August 2014 Unterrichtsvorhaben I Eigenart philosophischen Fragens und Denkens - Was heißt es
Schulinterner Lehrplan für das Fach Philosophie in der Einführungsphase der Gesamtschule Aachen-Brand Stand: August 2014 Unterrichtsvorhaben I Eigenart philosophischen Fragens und Denkens - Was heißt es
Voransicht. Pro und Kontra. Textgebundene Erörterung 1 von 22. zum Thema Facebook verfassen
 II Schriftlich kommunizieren Beitrag 18 Textgebundene Erörterung 1 von 22 Pro und Kontra textgebundene Erörterungen zum Thema Facebook verfassen Nach einem Konzept von Meike Schmalenbach, Bochum Sollte
II Schriftlich kommunizieren Beitrag 18 Textgebundene Erörterung 1 von 22 Pro und Kontra textgebundene Erörterungen zum Thema Facebook verfassen Nach einem Konzept von Meike Schmalenbach, Bochum Sollte
Zentralabitur 2019 Chinesisch
 Zentralabitur 2019 Chinesisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten schriftlichen
Zentralabitur 2019 Chinesisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten schriftlichen
Externenprüfung zum Erwerb des Mittleren Schulabschlusses
 Externenprüfung zum Erwerb des Mittleren Schulabschlusses Prüfungsanforderungen für das Fach Erdkunde Die im Kernlehrplan für das Fach Erdkunde (Schule in NRW, Sekundarstufe I, Heft Nr. 3301) festgelegten
Externenprüfung zum Erwerb des Mittleren Schulabschlusses Prüfungsanforderungen für das Fach Erdkunde Die im Kernlehrplan für das Fach Erdkunde (Schule in NRW, Sekundarstufe I, Heft Nr. 3301) festgelegten
Unterrichtsvorhaben. Jahrgangsstufe 7 Unterrichtsvorhaben II: Unterrichtsvorhaben I: Thema: Wir planen wirtschaftliches Handeln
 Unterrichtsvorhaben Unterrichtsvorhaben I: Thema: Wir planen wirtschaftliches Handeln Unterrichtsvorhaben II: Thema: Verbraucherrechte kennen und wahrnehmen ordnen einfache sachbezogene Sachverhalte ein
Unterrichtsvorhaben Unterrichtsvorhaben I: Thema: Wir planen wirtschaftliches Handeln Unterrichtsvorhaben II: Thema: Verbraucherrechte kennen und wahrnehmen ordnen einfache sachbezogene Sachverhalte ein
Semester: Kürzel Titel CP SWS Form P/WP Turnus Sem. A Politikwissenschaft und Forschungsmethoden 4 2 S P WS 1.
 Politikwissenschaft, Staat und Forschungsmethoden BAS-1Pol-FW-1 CP: 10 Arbeitsaufwand: 300 Std. 1.-2. - kennen die Gliederung der Politikwissenschaft sowie ihre Erkenntnisinteressen und zentralen theoretischen
Politikwissenschaft, Staat und Forschungsmethoden BAS-1Pol-FW-1 CP: 10 Arbeitsaufwand: 300 Std. 1.-2. - kennen die Gliederung der Politikwissenschaft sowie ihre Erkenntnisinteressen und zentralen theoretischen
Überprüfung der Bildungsstandards in den Naturwissenschaften. Chemie Marcus Mössner
 Überprüfung der Bildungsstandards in den Naturwissenschaften Bildungsstandards im Fach Chemie für den Mittleren Bildungsabschluss (Beschluss vom 16.12.2004) Die Chemie untersucht und beschreibt die stoffliche
Überprüfung der Bildungsstandards in den Naturwissenschaften Bildungsstandards im Fach Chemie für den Mittleren Bildungsabschluss (Beschluss vom 16.12.2004) Die Chemie untersucht und beschreibt die stoffliche
Teilbarkeitsbetrachtungen in den unteren Klassenstufen - Umsetzung mit dem Abakus
 Naturwissenschaft Melanie Teege Teilbarkeitsbetrachtungen in den unteren Klassenstufen - Umsetzung mit dem Abakus Examensarbeit Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis... 2 1 Einleitung... 3 2 Anliegen
Naturwissenschaft Melanie Teege Teilbarkeitsbetrachtungen in den unteren Klassenstufen - Umsetzung mit dem Abakus Examensarbeit Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis... 2 1 Einleitung... 3 2 Anliegen
Kapitel 2, Führungskräftetraining, Kompetenzentwicklung und Coaching:
 Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? von Tanja Hollinger 1. Auflage Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? Hollinger schnell und portofrei
Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? von Tanja Hollinger 1. Auflage Führungskräftetraining mit Pferden. Können Menschen von Tieren lernen? Hollinger schnell und portofrei
Ü Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben Jahrgangstufe 10. Jahrgangsstufe 10 (2-stündig im ganzen Schuljahr)
 Ü Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben Jahrgangstufe 10 Jahrgangsstufe 10 (2-stündig im ganzen Schuljahr) Unterrichtsvorhaben I: Thema: Erprobung und technische Umsetzung von elektrischen und elektronischen
Ü Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben Jahrgangstufe 10 Jahrgangsstufe 10 (2-stündig im ganzen Schuljahr) Unterrichtsvorhaben I: Thema: Erprobung und technische Umsetzung von elektrischen und elektronischen
Operatorenkatalog für die schriftliche Abiturprüfung im Fach Deutsch in Baden-Württemberg
 Operatorenkatalog für die schriftliche Abiturprüfung im Fach Deutsch in Baden-Württemberg I. Allgemeine Hinweise Die schriftliche Abiturprüfung im Fach Deutsch soll die erworbenen Kompetenzen der Schülerinnen
Operatorenkatalog für die schriftliche Abiturprüfung im Fach Deutsch in Baden-Württemberg I. Allgemeine Hinweise Die schriftliche Abiturprüfung im Fach Deutsch soll die erworbenen Kompetenzen der Schülerinnen
Konkretisierung der Ausbildungslinien im Fach Spanisch
 Konkretisierung der slinien im Fach Spanisch Stand: September 2012 slinie Entwicklungsstufen der slinien im VD Gym A: Unterricht konzipieren 1 Den Wortschatz und die Grammatik kommunikationsorientiert
Konkretisierung der slinien im Fach Spanisch Stand: September 2012 slinie Entwicklungsstufen der slinien im VD Gym A: Unterricht konzipieren 1 Den Wortschatz und die Grammatik kommunikationsorientiert
Gemeinschafts- und Wirtschaftskunde. Schuljahr 1
 Gemeinschafts- und Wirtschaftskunde 1 Berufsfachschule Berufseinstiegsjahr Gemeinschafts- und Wirtschaftskunde Schuljahr 1 2 Gemeinschafts- und Wirtschaftskunde Vorbemerkungen Ziel des Unterrichts in Gemeinschafts-
Gemeinschafts- und Wirtschaftskunde 1 Berufsfachschule Berufseinstiegsjahr Gemeinschafts- und Wirtschaftskunde Schuljahr 1 2 Gemeinschafts- und Wirtschaftskunde Vorbemerkungen Ziel des Unterrichts in Gemeinschafts-
Hinweise zur Vorbereitung auf die Abiturprüfung 2013 Prüfungsschwerpunkte Englisch. Grundkurs
 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung Hinweise zur Vorbereitung auf die Abiturprüfung 2013 Grundkurs Die angegebenen Schwerpunkte sind im Zusammenhang
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung Hinweise zur Vorbereitung auf die Abiturprüfung 2013 Grundkurs Die angegebenen Schwerpunkte sind im Zusammenhang
Unterrichtsvorhaben I: Zwischen Ökumene und Anökumene Lebensräume des Menschen in unterschiedlichen Landschaftszonen
 Inhaltsfeld I: Lebensräume und deren naturbedingte sowie anthropogen bedingte Gefährdung Unterrichtsvorhaben I: Zwischen Ökumene und Anökumene Lebensräume des Menschen in unterschiedlichen Landschaftszonen
Inhaltsfeld I: Lebensräume und deren naturbedingte sowie anthropogen bedingte Gefährdung Unterrichtsvorhaben I: Zwischen Ökumene und Anökumene Lebensräume des Menschen in unterschiedlichen Landschaftszonen
Kernlehrplan Sek II, EK, GAL 2014. 2.1.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben. Einführungsphase
 2.1.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben Kernlehrplan Sek II, EK, GAL 2014 Einführungsphase Unterrichtsvorhaben I: Thema: Landschaftszonen als Lebensräume Kompetenzen: orientieren sich unmittelbar vor
2.1.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben Kernlehrplan Sek II, EK, GAL 2014 Einführungsphase Unterrichtsvorhaben I: Thema: Landschaftszonen als Lebensräume Kompetenzen: orientieren sich unmittelbar vor
CURRICULUM AUS NATURWISSENSCHAFTEN Biologie und Erdwissenschaften 1. Biennium FOWI
 Allgemeine Ziele und Kompetenzen Der Unterricht der Biologie, Chemie und Erdwissenschaften soll den SchülerInnen eine naturwissenschaftliche Grundausbildung ermöglichen. Sie können sich mit naturwissenschaftliche
Allgemeine Ziele und Kompetenzen Der Unterricht der Biologie, Chemie und Erdwissenschaften soll den SchülerInnen eine naturwissenschaftliche Grundausbildung ermöglichen. Sie können sich mit naturwissenschaftliche
Zentralabitur 2019 Russisch
 Zentralabitur 2019 Russisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten schriftlichen
Zentralabitur 2019 Russisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten schriftlichen
Niedersächsisches Kultusministerium. Curriculare Vorgaben. für die Oberschule. Schuljahrgänge 5/6. Erdkunde. Niedersachsen
 Niedersächsisches Kultusministerium Curriculare Vorgaben für die Oberschule Schuljahrgänge 5/6 Erdkunde Niedersachsen An der Erarbeitung der Curricularen Vorgaben für die Schuljahrgänge 5/6 der Oberschule
Niedersächsisches Kultusministerium Curriculare Vorgaben für die Oberschule Schuljahrgänge 5/6 Erdkunde Niedersachsen An der Erarbeitung der Curricularen Vorgaben für die Schuljahrgänge 5/6 der Oberschule
Fachanforderungen Kunst Sek I und Sek II. Schleswig-Holstein. Der echte Norden.
 Fachanforderungen Kunst Sek I und Sek II Schleswig-Holstein. Der echte Norden. Themen der Präsentation Zur Struktur der Fachanforderungen Bildbegriff Arbeitsfelder Kompetenzbereiche Dimensionen Aufbau
Fachanforderungen Kunst Sek I und Sek II Schleswig-Holstein. Der echte Norden. Themen der Präsentation Zur Struktur der Fachanforderungen Bildbegriff Arbeitsfelder Kompetenzbereiche Dimensionen Aufbau
Niveaubestimmende Aufgabe zum Fachlehrplan Kunsterziehung Gymnasium
 Niveaubestimmende Aufgabe zum Fachlehrplan Kunsterziehung Gymnasium Familienbande Der Mensch als Motiv (Schuljahrgänge 11/12) (Arbeitsstand: 8.7.2016) Niveaubestimmende Aufgaben sind Bestandteil des Lehrplankonzeptes
Niveaubestimmende Aufgabe zum Fachlehrplan Kunsterziehung Gymnasium Familienbande Der Mensch als Motiv (Schuljahrgänge 11/12) (Arbeitsstand: 8.7.2016) Niveaubestimmende Aufgaben sind Bestandteil des Lehrplankonzeptes
Profile am Gymnasium Hummelsbüttel
 Natur und Umwelt System Erde-Mensch Kultur und Gesellschaft Kern- Fächer Deutsch Mathematik Deutsch Mathematik Deutsch Mathematik Englisch Englisch Englisch Profilbereich Biologie Chemie Geographie Physik
Natur und Umwelt System Erde-Mensch Kultur und Gesellschaft Kern- Fächer Deutsch Mathematik Deutsch Mathematik Deutsch Mathematik Englisch Englisch Englisch Profilbereich Biologie Chemie Geographie Physik
Schulinternes Curriculum für das Unterrichtsfach Philosophie: Einführungsphase
 Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was ist Philosophie? Vom Mythos zum Logos Inhaltsfeld: Erkenntnis und ihre Grenzen Eigenart philosophischen Fragens und Denkens Zeitbedarf: ca. 15 Stunden - unterscheiden
Unterrichtsvorhaben I: Thema: Was ist Philosophie? Vom Mythos zum Logos Inhaltsfeld: Erkenntnis und ihre Grenzen Eigenart philosophischen Fragens und Denkens Zeitbedarf: ca. 15 Stunden - unterscheiden
Kommunikations- und Informationstechnologien
 Kommunikations- und Informationstechnologien 3. Kl. MS Gestalten mit digitalen Medien Den Computer und andere digitale Medien als Lern- und Arbeitsinstrument nutzen 1./2. Kl. MS 4./5. Kl. GS 1./2./3. Kl.
Kommunikations- und Informationstechnologien 3. Kl. MS Gestalten mit digitalen Medien Den Computer und andere digitale Medien als Lern- und Arbeitsinstrument nutzen 1./2. Kl. MS 4./5. Kl. GS 1./2./3. Kl.
Kohlenstoffverbindungen und Gleichgewichtsreaktionen (EF)
 Kohlenstoffverbindungen und Gleichgewichtsreaktionen (EF)... dokumentieren Experimente in angemessener Fachsprache (u.a. zur Untersuchung der Eigenschaften organischer Verbindungen, zur Einstellung eines
Kohlenstoffverbindungen und Gleichgewichtsreaktionen (EF)... dokumentieren Experimente in angemessener Fachsprache (u.a. zur Untersuchung der Eigenschaften organischer Verbindungen, zur Einstellung eines
Kompetenzorientierter Kernlehrplan Deutsch. Grundkurs Q1
 Kompetenzorientierter Kernlehrplan Deutsch Grundkurs Q1 Stand: August 2015 (allgemeine Hinweise, siehe KLP EF) Qualifikationsphase I (Grundkurs) Unterrichtsvorhaben I: (Die konkrete Struktur dieses umfangreichen
Kompetenzorientierter Kernlehrplan Deutsch Grundkurs Q1 Stand: August 2015 (allgemeine Hinweise, siehe KLP EF) Qualifikationsphase I (Grundkurs) Unterrichtsvorhaben I: (Die konkrete Struktur dieses umfangreichen
Was macht mathematische Kompetenz aus?
 Was macht mathematische Kompetenz aus? ^ Kompetenzstrukturmodell Zahlen und Operationen Raum und Form Größen und Messen Daten und Zufall Stand 02/2013 Probleme lösen mathematische Kenntnisse, Fertigkeiten
Was macht mathematische Kompetenz aus? ^ Kompetenzstrukturmodell Zahlen und Operationen Raum und Form Größen und Messen Daten und Zufall Stand 02/2013 Probleme lösen mathematische Kenntnisse, Fertigkeiten
Paul-Klee-Gymnasium Overath Inhalte und Kompetenzen für die gymnasiale Oberstufe Einführungsphase (Erdkunde)
 1 Landschaftszonen als Lebensräume Inhaltsfeld 1 Lebensräume und deren naturbedingte sowie anthropogen bedingte Gefährdung Landschaftszonen als räumliche Ausprägung des Zusammenwirkens von Klima und Vegetation
1 Landschaftszonen als Lebensräume Inhaltsfeld 1 Lebensräume und deren naturbedingte sowie anthropogen bedingte Gefährdung Landschaftszonen als räumliche Ausprägung des Zusammenwirkens von Klima und Vegetation
Lehrplan - Deutsche Sprache
 Lehrplan - Deutsche Sprache Fachkompetenz Die Fähigkeit, in der deutschen Sprache zu kommunizieren, ist für Detailhandelsassistenten eine wesentliche Voraussetzung für ihre berufliche Tätigkeit und ihre
Lehrplan - Deutsche Sprache Fachkompetenz Die Fähigkeit, in der deutschen Sprache zu kommunizieren, ist für Detailhandelsassistenten eine wesentliche Voraussetzung für ihre berufliche Tätigkeit und ihre
Prüfungen im Fach Biologie im Schuljahr 2013/14
 Prüfungen im Fach Biologie im Schuljahr 2013/14 (1) Grundlagen Qualifizierender Hauptschulabschluss Realschulabschluss Externenprüfungen (Haupt-und Realschulabschluss) Besondere Leistungsfeststellung Abitur
Prüfungen im Fach Biologie im Schuljahr 2013/14 (1) Grundlagen Qualifizierender Hauptschulabschluss Realschulabschluss Externenprüfungen (Haupt-und Realschulabschluss) Besondere Leistungsfeststellung Abitur
Die Botschaft Jesu in seiner Zeit und Umwelt (IF 4) Konkretisierte Kompetenzerwartungen. Die Schülerinnen und Schüler
 Unterrichtsvorhaben A: Jesus als Jude in seiner Zeit Die Botschaft Jesu in seiner Zeit und Umwelt (IF 4) unterscheiden Religionen und Konfessionen im Hinblick auf grundlegende Merkmale. finden selbstständig
Unterrichtsvorhaben A: Jesus als Jude in seiner Zeit Die Botschaft Jesu in seiner Zeit und Umwelt (IF 4) unterscheiden Religionen und Konfessionen im Hinblick auf grundlegende Merkmale. finden selbstständig
Curriculum für den Deutschunterricht am Marianne-Weber-Gymnasium, Lemgo Jahrgangsstufe 7
 1. Unterrichtsvorhaben: Balladen - Gattungsmerkmale erkennen und erklären - Inhaltswiedergabe Umfang: ca. 16 Std. Jahrgangsstufe: 7 : Sprechgestaltende Mittel bewusst einsetzen (2, 11) Texte sinngebend
1. Unterrichtsvorhaben: Balladen - Gattungsmerkmale erkennen und erklären - Inhaltswiedergabe Umfang: ca. 16 Std. Jahrgangsstufe: 7 : Sprechgestaltende Mittel bewusst einsetzen (2, 11) Texte sinngebend
Unterrichtseinheit Natürliche Zahlen I
 Fach/Jahrgang: Mathematik/5.1 Unterrichtseinheit Natürliche Zahlen I Darstellen unterschiedliche Darstellungsformen verwenden und Beziehungen zwischen ihnen beschreiben (LE 8) Darstellungen miteinander
Fach/Jahrgang: Mathematik/5.1 Unterrichtseinheit Natürliche Zahlen I Darstellen unterschiedliche Darstellungsformen verwenden und Beziehungen zwischen ihnen beschreiben (LE 8) Darstellungen miteinander
<; ;6 ++9,1, + ( #, + 6( 6( 4, 6,% 6 ;, 86': ; 3'!(( A 0 "( J% ;;,,,' "" ,+ ; & "+ <- ( + " % ; ; ( 0 + A,)"%1%#( + ", #( +. +!
 !
!
Zentralabitur 2019 Portugiesisch
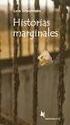 Zentralabitur 2019 Portugiesisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten
Zentralabitur 2019 Portugiesisch I. Unterrichtliche Voraussetzungen für die schriftlichen Abiturprüfungen an Gymnasien, Gesamtschulen, Waldorfschulen und für Externe Grundlage für die zentral gestellten
Albert-Einstein-Gymnasium Ulm Curriculum (9-jähriges Gymnasium)
 Albert-Einstein-Gymnasium Ulm Curriculum (9-jähriges Gymnasium) Geographie (GWG) Klasse 5-1 - Basis: zwei Wochenstunden in Klasse 5 1. Themenfeld: Planet Erde FACHKOMPETENZEN Die Schülerinnen und Schüler
Albert-Einstein-Gymnasium Ulm Curriculum (9-jähriges Gymnasium) Geographie (GWG) Klasse 5-1 - Basis: zwei Wochenstunden in Klasse 5 1. Themenfeld: Planet Erde FACHKOMPETENZEN Die Schülerinnen und Schüler
Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Einführungsphase. Unterrichtsvorhaben: Der Mensch in christlicher Perspektive
 Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Einführungsphase Unterrichtsvorhaben: Der Mensch in christlicher Perspektive Inhaltliche Schwerpunkte Der Mensch als Geschöpf und Ebenbild Gottes (Was
Schulinternes Curriculum Katholische Religionslehre Einführungsphase Unterrichtsvorhaben: Der Mensch in christlicher Perspektive Inhaltliche Schwerpunkte Der Mensch als Geschöpf und Ebenbild Gottes (Was
Kompetenzmodell 8. Schulstufe (Stand September 2007)
 Kompetenzmodell 8. Schulstufe (Stand September 2007) Handlungsbereiche Beobachten, Erfassen, Beschreiben Untersuchen, Bearbeiten, nterpretieren Bewerten, Entscheiden, Handeln Umfasst die Kompetenz, Vorgänge
Kompetenzmodell 8. Schulstufe (Stand September 2007) Handlungsbereiche Beobachten, Erfassen, Beschreiben Untersuchen, Bearbeiten, nterpretieren Bewerten, Entscheiden, Handeln Umfasst die Kompetenz, Vorgänge
KINDER FORSCHEN LERNEN MIT STUFENGERECHTEN EXPERIMENTEN
 KINDER FORSCHEN LERNEN MIT STUFENGERECHTEN EXPERIMENTEN Innovationstag SWiSE 29. März 2014 Judith Egloff, PH Zürich Ablauf des Ateliers Kurze Vorstellungsrunde Einstiegsreferat Ausprobieren, sichten, diskutieren
KINDER FORSCHEN LERNEN MIT STUFENGERECHTEN EXPERIMENTEN Innovationstag SWiSE 29. März 2014 Judith Egloff, PH Zürich Ablauf des Ateliers Kurze Vorstellungsrunde Einstiegsreferat Ausprobieren, sichten, diskutieren
Urteilskompetenz. erläutern und beurteilen Möglichkeiten und Grenzen der Naturkatastrophenvorsorge
 Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte des KLP Sach- und Urteilskompetenzen laut KLP konkretisierte Sach- und Urteilskompetenz Unterrichtsvorhaben mögliche Raumbeispiele Einführungsphase Inhaltsfeld
Inhaltsfelder und inhaltliche Schwerpunkte des KLP Sach- und Urteilskompetenzen laut KLP konkretisierte Sach- und Urteilskompetenz Unterrichtsvorhaben mögliche Raumbeispiele Einführungsphase Inhaltsfeld
Umsetzungshilfe zur Promotionsverordnung: Fachdidaktische Grundlagen zum Fach Geschichte
 Umsetzungshilfe zur Promotionsverordnung: Fachdidaktische Grundlagen zum Fach Geschichte Die vorliegende Umsetzungshilfe soll die Lehrpersonen unterstützen, die Sachkompetenz der Schülerinnen und Schüler
Umsetzungshilfe zur Promotionsverordnung: Fachdidaktische Grundlagen zum Fach Geschichte Die vorliegende Umsetzungshilfe soll die Lehrpersonen unterstützen, die Sachkompetenz der Schülerinnen und Schüler
Barbara Mayerhofer, Univ. Salzburg, Fachbereich Geographie und Geologie
 Barbara Mayerhofer, Univ. Salzburg, Fachbereich Geographie und Geologie 1960 2050 Veränderung der Weltbevölkerung bis 2030 Aufgaben zum Film: mit offenen Karten: Bevölkerungsentwicklung und Politik (arte,
Barbara Mayerhofer, Univ. Salzburg, Fachbereich Geographie und Geologie 1960 2050 Veränderung der Weltbevölkerung bis 2030 Aufgaben zum Film: mit offenen Karten: Bevölkerungsentwicklung und Politik (arte,
Lernen lernen. Bestandteil der neuen sächsischen Lehrpläne
 Lernen lernen Bestandteil der neuen sächsischen Lehrpläne Leitbild Schulentwicklung Die Wissensgesellschaft verlangt neben inhaltlichen Wissensgrundlagen die Fähigkeiten sein Wissen zu erweitern zu lebensbegleitendem
Lernen lernen Bestandteil der neuen sächsischen Lehrpläne Leitbild Schulentwicklung Die Wissensgesellschaft verlangt neben inhaltlichen Wissensgrundlagen die Fähigkeiten sein Wissen zu erweitern zu lebensbegleitendem
GEOGRAPHIE UND WIRTSCHAFTSKUNDE
 1 GEOGRAPHIE UND WIRTSCHAFTSKUNDE Bildungs- und Lehraufgabe: Im Mittelpunkt von Geographie und Wirtschaftskunde steht der Mensch. Seine Aktivitäten und Entscheidungen in allen Lebensbereichen haben immer
1 GEOGRAPHIE UND WIRTSCHAFTSKUNDE Bildungs- und Lehraufgabe: Im Mittelpunkt von Geographie und Wirtschaftskunde steht der Mensch. Seine Aktivitäten und Entscheidungen in allen Lebensbereichen haben immer
Modellierungsaufgaben in Klassenarbeiten
 Modellierungsaufgaben in Klassenarbeiten Gerechte Bewertung (un)möglich? Ziele Modellierungen und Realitätsbezüge Mathematik im Leben anwenden Bedeutung von Mathematik für das Leben und unsere Gesellschaft
Modellierungsaufgaben in Klassenarbeiten Gerechte Bewertung (un)möglich? Ziele Modellierungen und Realitätsbezüge Mathematik im Leben anwenden Bedeutung von Mathematik für das Leben und unsere Gesellschaft
Curriculum für das Einführungsseminar im Praxissemester der RWTH Aachen, Lehramtsstudiengang GyGe Unterrichtsfach: Informatik Sitzung 1
 Sitzung 1 Handlungsfeld 2: Den Erziehungsauftrag in Schule und Unterricht wahrnehmen Praxissituation: beobachten Informatikunterricht und werten ihn kriteriengeleitet aus. Wie kann ich Unterricht strukturiert
Sitzung 1 Handlungsfeld 2: Den Erziehungsauftrag in Schule und Unterricht wahrnehmen Praxissituation: beobachten Informatikunterricht und werten ihn kriteriengeleitet aus. Wie kann ich Unterricht strukturiert
Netzwerkplenum Bremen 22. / 23. Oktober. Studium als wissenschaftliche Berufsausbildung
 Netzwerkplenum Bremen 22. / 23. Oktober Studium als wissenschaftliche Berufsausbildung Gliederung Die Umstellung auf die neuen Abschlüsse hat in der Vielzahl der Fälle nicht zu einer Verbesserung von Studium
Netzwerkplenum Bremen 22. / 23. Oktober Studium als wissenschaftliche Berufsausbildung Gliederung Die Umstellung auf die neuen Abschlüsse hat in der Vielzahl der Fälle nicht zu einer Verbesserung von Studium
GES Espenstraße Schulinterner Lehrplan Mathematik Stand Vorbemerkung
 Vorbemerkung Die im Folgenden nach Jahrgängen sortierten Inhalte, inhaltsbezogenen Kompetenzen (IK) und prozessbezogenen Kompetenzen (PK) sind für alle im Fach Mathematik unterrichtenden Lehrer verbindlich.
Vorbemerkung Die im Folgenden nach Jahrgängen sortierten Inhalte, inhaltsbezogenen Kompetenzen (IK) und prozessbezogenen Kompetenzen (PK) sind für alle im Fach Mathematik unterrichtenden Lehrer verbindlich.
5 6 7 8 9 EF Q1 Q2 Seite 1. Vorwort. Sekundarstufe I
 Vorwort Die Fachkonferenz Politik/Wirtschaft bzw. Sozialwissenschaften hat auf ihre Sitzung am 26. Mai 2011 ein neues Hauscurriculum für die Sekundarstufe I sowie für die Sekundarstufe II beschlossen.
Vorwort Die Fachkonferenz Politik/Wirtschaft bzw. Sozialwissenschaften hat auf ihre Sitzung am 26. Mai 2011 ein neues Hauscurriculum für die Sekundarstufe I sowie für die Sekundarstufe II beschlossen.
Übersichtsraster: Unterrichtsvorhaben Praktische Philosophie, Jgst. 9
 Übersichtsraster: Unterrichtsvorhaben Praktische Philosophie, Jgst. 9 Halbjahr Thema des Unterrichtsvorhabens Fragenkreis 1 Entscheidung und Gewissen 3: Die Frage nach dem guten Handeln Völkergemeinschaft
Übersichtsraster: Unterrichtsvorhaben Praktische Philosophie, Jgst. 9 Halbjahr Thema des Unterrichtsvorhabens Fragenkreis 1 Entscheidung und Gewissen 3: Die Frage nach dem guten Handeln Völkergemeinschaft
Gutenberg-Gymnasium, Schulinternes Curriculum im Fach Physik, Klasse 9
 Effiziente Energienutzung: eine wichtige Zukunftsaufgabe der Physik Strom für zu Hause Energie, Leistung, Wirkungsgrad Energie und Leistung in Mechanik, Elektrik und Wärmelehre Elektromotor und Generator
Effiziente Energienutzung: eine wichtige Zukunftsaufgabe der Physik Strom für zu Hause Energie, Leistung, Wirkungsgrad Energie und Leistung in Mechanik, Elektrik und Wärmelehre Elektromotor und Generator
Schulinternes Curriculum Physik
 Schulinternes Curriculum Physik Jahrgangsstufe 7 Inhaltsfelder: Optische Instrumente, Farbzerlegung des Lichtes, Elektrizitätslehre Fachlicher Kontext / Dauer in Wo. Mit optischen Geräten Unsichtbares
Schulinternes Curriculum Physik Jahrgangsstufe 7 Inhaltsfelder: Optische Instrumente, Farbzerlegung des Lichtes, Elektrizitätslehre Fachlicher Kontext / Dauer in Wo. Mit optischen Geräten Unsichtbares
Leistungsanforderung/kriterien Inhaltliche Ausführung Anmerkungen
 Transparente Leistungserwartung Physik Klasse 6-9 Beurteilungskriterien sollten den Lernenden vorgestellt werden. Den Schülerinnen und Schülern muss klar sein, dass sie kontinuierlich beurteilt werden.
Transparente Leistungserwartung Physik Klasse 6-9 Beurteilungskriterien sollten den Lernenden vorgestellt werden. Den Schülerinnen und Schülern muss klar sein, dass sie kontinuierlich beurteilt werden.
Kompetenzorientiertes Lernen in heterogenen Lerngruppen
 Fortbildungsoffensive Fachtagung des Arbeitskreises Ausbildungsstätten für Altenpflege Kompetenzorientiertes Lernen in heterogenen Lerngruppen Problemstellung Heterogene Lerngruppe Zentrale Standards "typische"
Fortbildungsoffensive Fachtagung des Arbeitskreises Ausbildungsstätten für Altenpflege Kompetenzorientiertes Lernen in heterogenen Lerngruppen Problemstellung Heterogene Lerngruppe Zentrale Standards "typische"
Erwartete Kompetenzen. Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung Die Schülerinnen und Schüler E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17
 Stoffverteilungsplan Kerncurriculum für die Oberschule in Niedersachsen (Schuljahrgänge 7/8) PRISMA Chemie Niedersachsen Differenzierende Ausgabe Band 7/8 Schule: Klettbuch ISBN 978-3-12-068537-1 Lehrer:
Stoffverteilungsplan Kerncurriculum für die Oberschule in Niedersachsen (Schuljahrgänge 7/8) PRISMA Chemie Niedersachsen Differenzierende Ausgabe Band 7/8 Schule: Klettbuch ISBN 978-3-12-068537-1 Lehrer:
Sicherheitsvorkehrungen im Chemieunterricht
 Thema.: Sicherheitsvorkehrungen im Chemieunterricht Kompetenz: LehramtsanwärterInnen kennen und beachten die grundlegenden gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen. die geltenden Sicherheitsbestimmungen: rechtliche
Thema.: Sicherheitsvorkehrungen im Chemieunterricht Kompetenz: LehramtsanwärterInnen kennen und beachten die grundlegenden gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen. die geltenden Sicherheitsbestimmungen: rechtliche
Schulinternes Curriculum für das Fach Deutsch Sekundarstufe I Orientiert am Kernlehrplan G8, bezogen auf das Deutschbuch von Cornelsen, Neue Ausgabe
 Schulinternes Curriculum für das Fach Deutsch Sekundarstufe I Orientiert am Kernlehrplan G8, bezogen auf das Deutschbuch von Cornelsen, Neue Ausgabe K l a s s e 8 UV Thema Teilkompetenzen (Auswahl) Kompetenzbereich(e)
Schulinternes Curriculum für das Fach Deutsch Sekundarstufe I Orientiert am Kernlehrplan G8, bezogen auf das Deutschbuch von Cornelsen, Neue Ausgabe K l a s s e 8 UV Thema Teilkompetenzen (Auswahl) Kompetenzbereich(e)
phänomenale Tools in NMM - Lernaufgaben
 phänomenale Tools in NMM - Lernaufgaben Atelier A11 Primarstufe 3. 6. Klasse 4. SWiSE-Innovationstag 2013 Luzia Hedinger, Dozentin IWB, Fachteam NMM Luzia Hedinger, Dozentin IWB NMM 11.03.13 Phänomenal
phänomenale Tools in NMM - Lernaufgaben Atelier A11 Primarstufe 3. 6. Klasse 4. SWiSE-Innovationstag 2013 Luzia Hedinger, Dozentin IWB, Fachteam NMM Luzia Hedinger, Dozentin IWB NMM 11.03.13 Phänomenal
Studienverlaufsplan Lehramt Bildungswissenschaften Haupt-, Real- und Gesamtschule
 Studienverlaufsplan Lehramt Bildungswissenschaften Haupt-, Real- und Gesamtschule Sem BA-Modul A CP BA-Modul B CP BA-Modul C CP BA-Modul D BA-Modul E CP BA-Modul F CP MA-Modul A CP MA-Modul B C Modul D
Studienverlaufsplan Lehramt Bildungswissenschaften Haupt-, Real- und Gesamtschule Sem BA-Modul A CP BA-Modul B CP BA-Modul C CP BA-Modul D BA-Modul E CP BA-Modul F CP MA-Modul A CP MA-Modul B C Modul D
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Schulinterner Lehrplan für das Fach ERDKUNDE Klasse 9
 ggf. fächerverbindende Kooperation mit: THEMA: GLOBALISIERUNG Umfang Jgst. Inhaltsfeld 8: Wandel wirtschaftsräumlicher und politischer Politik Strukturen unter dem Einfluss der Globalisierung ca. 12 9.1/1
ggf. fächerverbindende Kooperation mit: THEMA: GLOBALISIERUNG Umfang Jgst. Inhaltsfeld 8: Wandel wirtschaftsräumlicher und politischer Politik Strukturen unter dem Einfluss der Globalisierung ca. 12 9.1/1
Bildungsplan Gymnasium Physik Kompetenzen und (verbindliche) Inhalte Klasse 8
 Bildungsplan Gymnasium Physik Kompetenzen und (verbindliche) Inhalte Klasse 8 1. Physik als Naturbeobachtung unter bestimmten Aspekten a) zwischen Beobachtung und physikalischer Erklärung unterscheiden
Bildungsplan Gymnasium Physik Kompetenzen und (verbindliche) Inhalte Klasse 8 1. Physik als Naturbeobachtung unter bestimmten Aspekten a) zwischen Beobachtung und physikalischer Erklärung unterscheiden
